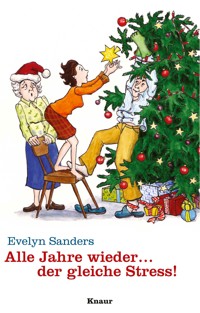6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Eigentlich wollt' ich Blumen kaufen" ist der erste Geschichtenband der Bestsellerautorin Evelyn Sanders und diente schon vielen Lesern als »Einstiegsdroge« für ihre turbulenten Romane. Da geht es um Urlaubspannen und Äpfelklau beim Nachbarn, um Benni, den Lehrerschreck, und die Kunst des Haarefärbens, vor allem aber immer wieder ums Schenken - zu Weihnachten, zum Geburtstag und überhaupt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 199
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Evelyn Sanders
Eigentlich wollt’ ich Blumen kaufen
Geschichten
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Alles fing ganz harmlos an, mit einer kleinen Elefantenfigur aus Thailand, die Frau Dagelow, die Nachbarin der Sanders-Familie, geschenkt bekommt. Doch dann macht das Gerücht die Runde, sie sammle Elefanten – und schon bald verdrängen Elefantenfiguren das Foto ihres Ehemanns, Gott hab ihn selig, vom Eckregal, greifen auf das Gästezimmer über, erobern Flur und WC …
In dieser und vielen weiteren Geschichten rund ums Schenken und Beschenkt-werden, spielt Evelyn Sanders, die Meisterin der Alltagskomik, ihr ganzes Können aus. Witzig und turbulent nimmt sie den Wahnsinn des täglichen Lebens mit Genuss aufs Korn!
Inhaltsübersicht
Die feine Küche
Schönheitskonkurrenz
»… fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!«
Woran müssen wir denn heute wieder denken?
Elefantenhochzeit
Der Butter
»Eigentlich wollt’ ich Blumen kaufen!«
Das Barometer des Kolumbus
Der Mann im Rollstuhl
Das Köfferchen
Henri fliegt nach Ibiza
»Es is aba gaanz wichtig!«
Zurück zur Natur
Die schwarze Flasche
1. Akt
2. Akt
3. Akt
4. Akt
Klassentreffen
Alle Jahre wieder …
»Du machst das schon!«
Die feine Küche
Gibt’s hier irgendwo eine Zitruspresse?«
Seit mindestens fünf Minuten trabte ich durch diese Lehrküche, hatte bereits sämtliche Schubladen durchstöbert und machte mich nun an die Unterschränke. »Muss ich jetzt tatsächlich fünf Zitronen mit der Hand auspressen?«
»Vorhin habe ich eine gesehen«, sagte Irmchen, die große Schlanke mit dem ironischen Blick, »aber ich weiß nicht mehr, wo!«
Das half mir nun auch nicht weiter. Als ich mich gerade entschlossen hatte, nun doch auf Handbetrieb umzusteigen, drückte mir jemand das Gesuchte in die Hand. Es bestand aus Pressglas und hatte seine beste Zeit zweifellos schon hinter sich.
Überhaupt schien das ganze Interieur dieser Küche im dritten Stock eines Hauses irgendwo in der Heidelberger Innenstadt aus mehreren Epochen zusammengestückelt, wobei das Mobiliar noch das Modernste war und wohl aus den frühen Siebzigern des vorigen Jahrhunderts stammte. Die Elektroherde waren auch nicht jünger, eher im Gegenteil, und was ich mir so an ›Handwerkszeug‹ zusammengesucht hatte, konnte teilweise schon als antik bezeichnet werden. Jetzt wunderte ich mich auch nicht mehr, dass Stefanie vor unserer Abfahrt eine ihrer eisernen Bratpfannen eingepackt und zwei unterschiedlich große Messer mitgenommen hatte. »Die sind wenigstens scharf!«
Weshalb ich mich für diesen Kochabend angemeldet hatte, ist mir immer noch rätselhaft, es muss wohl an Stefanies blumigen Schilderungen gelegen haben.
»Man kann ja nie genug lernen, und Spaß macht’s auch«, hatte sie schließlich in den Telefonhörer gekichert, »komm doch am Mittwoch mal mit! Da wird’s bestimmt interessant, das Motto lautet nämlich Huhn mal anders.«
»Wie anders? Etwa mit Federn?«
»Woher soll ich das wissen? Geflügel hatten wir noch nicht!«
Also hatte ich mein Übernachtungsköfferchen gepackt und war zu meiner Tochter gefahren, um nun in dieser Lehrküche zu stehen und den Worten des Meisters zu lauschen, der in einem Nobelhotel zweiter Küchenchef war und uns zehn Frauen heute Abend an seinem kulinarischen Wissen teilhaben ließ. Er hieß Marcel, Ende zwanzig, gut aussehend und erstaunlicherweise schlank. Seine Schülerinnen waren es auch, jedenfalls die jüngeren; die anderen befanden sich eher so im Zwischenbereich mit Tendenz nach oben, sowohl altersmäßig als auch vom Gewicht her. Und sie hießen nicht Cordy, Tina, Annette oder Ecki, sondern Marianne, Irmchen, Edelgard und Waltraud. Die ersten vier kannte ich schon lange, die anderen waren mir unbekannt. Ich musste aber ganz schnell lernen, dass man sich bei solchen Veranstaltungen duzt, weil das bequemer ist. Übrigens war Irmchen auch zum ersten Mal dabei und kämpfte mit den gleichen Schwierigkeiten.
Nachdem der finanzielle Teil dieses Abends abgehakt war – Honorar für Marcel und Eigenanteil für die Zutaten –, sollten wir drei Gruppen bilden, denn jede würde etwas anderes kochen müssen. Stefanie, Cordy (eigentlich heißt sie Cordula), Tina und ich entschieden uns für Hähnchen im Salzmantel mit karamellisiertem Fenchel und Pfannenrisotto. Das klang so schön nach gehobener Küche, obwohl ich gar kein Risotto mag. Ecki ging lieber zur Maispoularde mit hausgemachten Nudeln, sie hasste Fenchel, weil sie als Kind immer so viel Fencheltee trinken musste, und die dritte Gruppe würde Stubenküken mit Safrankartoffeln zubereiten, ein Gericht, das Cordy von vornherein abgelehnt hatte. »Ich schmeiße doch keine Babys in den Kochtopf!«
Nun standen wir für das Salzmantelhuhn Zuständigen etwas hilflos in unserem Kochviereck, bestehend aus Herd, drei Arbeitsplatten und Spülbecken, und begannen mit den Vorbereitungen. Cordy zupfte Thymianblätter von den Stengeln – und es waren sehr viele trockene Blättchen von sehr vielen trockenen Stengeln –, Steffi schälte Knoblauchzehen, Tina heulte in die Zwiebeln, und ich sollte Zitronen auspressen, schälen und die Schale in ganz kleine Stückchen schneiden. Als der Saft von den ersten zwei Früchten auf meine Schuhe tropfte, fiel mir endlich auf, dass die Zitruspresse keinen Boden mehr hatte. Natürlich hätte ich das gleich sehen müssen, aber zu Hause habe ich für derartige Tätigkeiten ein Gerät mit Stecker dran …
Die Schale von einer bereits ausgepressten Zitrone zu entfernen ist sehr mühsam, besonders dann, wenn man ein Messer hat, das mindestens fünf Jahre alt und offenbar noch nie geschärft worden ist. Jetzt wusste ich wenigstens, weshalb Stefanie ihr eigenes Messer dabeihatte. Ich wollte es mir leihen, aber sie zerhackte immer noch Knoblauchzehen. Und danach hatte Cordy schon Bedarf angemeldet, weil der Thymian ebenfalls zerkleinert werden musste. Na gut, dann würde ich mich eben weiterhin mit diesem stumpfen Ding behelfen müssen. (Wann genau ich mir die beiden Fingernägel abgesäbelt habe, ließ sich später nicht mehr feststellen, sie sind wohl irgendwie zwischen den Zitronenschalenschnipseln verlorengegangen.)
Marcel schritt kontrollierend von Tisch zu Tisch, legte mit Hand an oder erteilte fachmännischen Rat, doch bevor er die rohen Poularden auseinandernahm, rief er uns zusammen. Ein paar kräftige Schnitte, zwei Drehungen mit der Hand … und schon lag das Vieh komplett tranchiert vor ihm.
»Das würde ich niemals so hinkriegen!«, murmelte ich leise, aber er hatte es trotzdem gehört. »Am besten ist es, wenn Sie sich das Huhn gleich vom Metzger zerteilen lassen, man braucht ja doch ziemlich viel Übung dazu.«
Ich nickte und stellte mir gleichzeitig das Gesicht unseres Metzgers vor, wenn ich ihn bitten würde, ein Huhn zu sezieren! Der ist doch auf Schweine und Rinder trainiert, und die haben keine Flügel, dafür immer vier Beine!
Momentan war das jedoch alles nebensächlich, denn unser Salzmantelhuhn sollten wir gar nicht zerschnippeln, es musste im Gegenteil ganz bleiben und voll gestopft werden mit jenem Brei, an dessen Zutaten wir uns immer noch abarbeiteten …
Bekanntlich steht einem gewerblichen Koch eine bestimmte Menge Flüssigkeit pro Tag zu, denn kochen macht durstig, und ganz besonders dann, wenn man acht Stunden oder länger vor dem Herd steht. Ob dieser Flüssigkeitsbedarf auch heute noch mit einer genau festgelegten Menge Bier gedeckt werden darf, weiß ich nicht, immerhin stammt diese Behauptung von Sohn Sascha und liegt auch schon ein paar Jahrzehnte zurück. Jedenfalls hatte Marcel auch unseren zu erwartenden Durst berücksichtigt und entsprechend vorgesorgt. Allerdings gab es kein Bier, sondern durchaus trinkbaren Weißwein, dessen Ankauf insofern zwingend gewesen war, als in unseren Fenchelsud laut Rezept ein »ordentlicher Schuss Wein« gehörte. Die Maispoularde brauchte auch welchen. Dass von der dritten Flasche aber gerade mal noch ein paar Esslöffel voll übrig geblieben waren, hat später lediglich unseren Maître de cuisine verstört.
Dafür wurde die Stimmung etwas gelockerter. Irmchen, mit den Stubenküken befasst, hatte sie nunmehr als Teigklöpse in den Ofen geschoben und ein bisschen Erholung verdient, während Ecki und Annette Kartoffeln schälten, der Länge nach teilten und dann versuchten, sie zur Form eines kleinen Ruderkahns zurechtzuschnitzen. Man nennt das tournieren, aber bei Alfred Biolek sieht das Ergebnis bestimmt ganz anders aus.
»Haben Sie schon mal … äh, also, hast du schon mal Fenchel gekocht?«, wollte ich von Irmchen wissen, in der ich eine gewiefte Köchin vermutete.
»Wieso gekocht?«, kam es etwas irritiert zurück. »Den brüht man doch bloß auf! Für Kleinkinder. Ich habe immer fertige Teebeutel benutzt.«
Na bravo! »Du stehst wohl nicht allzu oft in der Küche, oder irre ich mich da?«
»Du irrst dich nicht! Ich bin Geschäftsfrau mit einem Zehnstundentag und habe den Küchentrakt vollständig meinem Mann überlassen. Der ist Rentner, relativ lernfähig und hat Zeit.«
»Und weshalb stellst du dich trotzdem hierher?«
Sie lächelte verschmitzt. »Aus taktischen Gründen! Mein Sohn präsentiert uns am übernächsten Wochenende seine neue und endgültig letzte Freundin, also quasi meine potenzielle Schwiegertochter, die offenbar noch weniger Lust zum Kochen hat als ich. Nun soll ich aber so tun, als sei ich eine begnadete Köchin, und muss in Gegenwart von Audrey etwas ganz Tolles auf den Tisch zaubern. Ich glaube, die Küken kriege ich jetzt einigermaßen hin, und wenn die tournierten Kartoffeln wie Kaminholz aussehen, dann kann ich immer noch hoffen, das Mädchen kennt die Originalversion gar nicht. Hinterher gibt’s Crème brûlée, das Zeug kann man in der ›Metro‹ fertig kaufen und muss es bloß noch aufkochen und kalt stellen, aber es macht viel her!«
Nur mühsam konnte ich mir das Lachen verbeißen. »Aus welchem Teil der Welt kommt denn deine zukünftige Schwiegertochter?«
»Aus Kingston.«
»Wie – aus Jamaika??«
»Nee, aus England. Irgendwo im Nordosten.« Irmchen seufzte. »Ich weiß gar nicht, weshalb ich mir so viel Mühe mache, die Engländer können doch sowieso nicht kochen. Sind Sie … du schon mal auf der Insel gewesen?«
Sofort dachte ich an Saschas erste Frau, an die englische Hochzeit, an den denkwürdigen Sunday-Lunch und nickte. »Du hast recht, Kochen ist wirklich nicht ihre Stärke.« Dann fiel mir noch etwas ein. »Was wirst du denn am zweiten Tag servieren?«
»Da gehen wir essen!«
Ich wollte gerade bei den Damen mit der Maispoularde ein bisschen kiebitzen, als ich gerufen wurde. »Willst du nicht endlich an deinen Arbeitsplatz zurückkehren?«, forderte Steffi mich auf. »Du verpasst sonst den Höhepunkt!«
Was um alles in der Welt sollte das wohl sein? Den Kräuterbrei ins Huhn stopfen?
Ich hatte im Laufe der Jahrzehnte nun wirklich genug Weihnachtsgänse gefüllt, und einmal sogar einen Truthahn, aber da Marcel gerade von neun neugierigen Frauen umringt wurde, musste es sich bei dem, was er zu demonstrieren gedachte, um etwas Bedeutsames handeln. – Na klar, der Salzmantel! Für irgendwas mussten die drei Kilo Steinsalz ja Verwendung finden.
»Den Hohlraum so gut wie möglich ausstopfen, damit kein Salz eindringen kann«, wies Marcel an, und Christina stopfte. Mit ›Hohlraum‹ war das Innere unseres schon etwas malträtiert aussehenden Huhns gemeint, doch auf äußere Schönheit kam es nicht an, das Tier sollte ja noch eingepackt werden.
Drei Kilo grobes Steinsalz, vermischt mit Eiern, Zitronensaft, Fenchelsamen, Pfeffer und Wasser ergibt eine Pampe, die der Farbe und Konsistenz nach durchaus als Mörtel für Natursteinmauern dienen könnte. Damit wurde das Vieh nun rundherum dick beschmiert, kriegte ein Alufolienmäntelchen darüber und verschwand für die nächsten anderthalb Stunden im Backofen. Auch der war bereits reif für das Museum vaterländischer Altertümer, musste jedoch nach Cordys Meinung jünger sein als der Topf, den sie zum Abkochen der beiden Fenchelknollen in einem der Schränke ausgegraben hatte: Innen ehemals weiß, außen hellblau, schien er fast identisch mit jenem Geschenk, das ich vor ewigen Zeiten meiner Großmutter unter den Weihnachtsbaum gelegt hatte; seinerzeit war ich noch Taschengeldempfängerin gewesen und meistens knapp bei Kasse.
Die Zubereitung von Risotto dürfte allgemein bekannt sein, man braucht Reis dazu, einen Kochtopf, Flüssigkeit und einen Kochlöffel mit langem Stiel, weil man permanent rühren und immer wieder nachgießen muss, sonst brennt das Zeug an. Diese verantwortungsvolle Tätigkeit wurde mir übertragen. Und weil jetzt in allen drei Backöfen das jeweilige Geflügel vor sich hin bräunte, wurden die nicht mehr mit subalternen Arbeiten beschäftigten Köchinnen zur Abteilung ›Maispoularde‹ befohlen, um bei der Nudelproduktion zu helfen. Die im Rezept empfohlene handbetriebene Nudelmaschine war leider nicht vorhanden, und mangels entsprechender Lineale, Reißschienen und ähnlicher Hilfsgeräte fühlte sich auch niemand befähigt, mit einer Art Brotmesser lange, gerade Streifen zu schneiden. Also wurde der Teig zu Rollen gedreht und dann in dünne Scheiben geschnitten, die dann einzeln wieder zu Bandnudeln entrollt werden sollten. Das klappte aber nicht, weil der Teig zu feucht war und sich erst gar nicht abrollen ließ; deshalb wurden die Scheibchen schließlich platt gedrückt und kamen als »Goldtaler« ins Kochwasser. Dass sie später eine gewisse Ähnlichkeit mit bleichsüchtigen Weihnachtsplätzchen hatten, hat wohl lediglich Marcels ästhetisches Empfinden gestört; meins jedoch nicht, denn geschmeckt haben sie großartig.
Doch bis es so weit war, kamen erst einmal die Spülbecken zum Einsatz. Zwar gab es eine Maschine, mit Sicherheit das jüngste Möbel in der Küche, dennoch aber schon etwas betagt, weshalb man es nicht überfordern durfte. Jedenfalls bildeten sich in den einzelnen Arbeitsbereichen schnell die traditionellen Paarungen – eine spült, die andere trocknet ab, wobei Letzteres nicht so richtig klappte. Zwar gab es Geschirrtücher, aber das waren überwiegend solche, die man zu Hause noch mal zum Über-die-Schuhe-Wienern genommen hätte oder wenn der Sattel vom Fahrrad nass geregnet ist, und danach fliegt der Lappen endgültig in die Mülltonne.
Bei uns teilten sich Tina und Cordy den Spüldienst, Stefanie karamellisierte die Fenchelstreifen in der mitgebrachten Pfanne, und ich rührte Risotto, der langsam zu einer Art Kleister mutierte, aber das muss so sein. Deshalb weiß ich ja auch, warum ich keinen mag!
Im Nebenraum bestückte Edelgard die Tafel, an der wir nachher das verspeisen sollten, was wir zweieinhalb Stunden lang zusammengebrutzelt hatten.
Auf dem Tisch standen oder lagen später jeweils ein Teller, ein Wasserglas sowie Messer und Gabel. In der Mitte eine aufgerissene Packung Papierservietten von doppelter Skatkartengröße und ein paar Tupperwaredosen, deren Zweck ich erst später erfahren würde.
Noch mal ein paar hektische Minuten in der Küche – wie kriegt man ohne Hammer möglichst elegant die verdammte Salzkruste von dem Huhn herunter? Wie dekoriert man auf dem Risotto die karamellisierten Fenchelteile, ohne dass sie auseinanderfallen?? Und wie fischt man ohne Schaumkelle diese niedlichen Nudelplätzchen aus dem Wasser??? –, dann endlich Einmarsch der – nein, nicht der Gladiatoren, obwohl wir uns alle so fühlten, sondern der stolzen Köchinnen. Jede trug das vor sich her, womit sie sich am längsten beschäftigt hatte, und das hätten bei mir eigentlich die Zitronen sein müssen, aber das Risotto mit dem Fenchel obendrauf war sowieso viel dekorativer.
Wir nahmen Platz, Marcel blieb stehen, äußerte sich lobend über unsere Mitarbeit und behauptete tatsächlich, mit uns würde er sehr gerne noch weitere Gourmetkurse abhalten. In drei Wochen sei der nächste, und zwar mit Reh und Hirsch. »Und nun wünsche ich uns allen einen guten Appetit!«
Die Tupperdosen gehörten Waltraud und Edelgard, beide weit jenseits normaler Konfektionsgrößen und offensichtlich bemüht, daran auch nichts zu ändern. In die eine Dose kam nämlich eine ordentliche Portion Maispoularde (Originalton Edelgard: »Die haben wir ja auch gekocht!« – Ergänzung Waltraud: »Und bezahlt!«), die zweite Box wurde mit Nudeltalern gefüllt und durch ein bisschen Grünzeug ergänzt, und in die dritte und größte kamen gut bemessene Kostproben von den anderen Gerichten. Erst dann füllten sich die beiden ungeniert ihre Teller. Begründung für die Vorratshaltung: »Wir wollen das daheim nachkochen, da müssen wir doch vergleichen können, ob alles so schmeckt, wie es soll.«
Niemand antwortete, aber ich wäre gern eine Zeit lang Gedankenleserin gewesen!
Nun habe ich wirklich keine Ahnung, wie eine Maispoularde in Weißwein oder Stubenküken mit Safran-Kartoffeln schmecken müssen, doch das, was wir an jenem Abend gekocht und anschließend gegessen haben, kann eigentlich nicht noch besser munden. Darum bin ich mir auch sicher, dass ich niemals dieses Huhn im Salzmantel nachkochen werde, und zwar nicht, weil es zu viel Arbeit macht, sondern weil aus dem Huhn garantiert Frikassee werden würde, sobald ich diese Salzkruste versuchen würde zu entfernen. Und überhaupt ist so ein frisches Backhendl vom Wagen auch nicht zu verachten!
Schönheitskonkurrenz
Das Telefon bimmelt! Wie so häufig im unpassendsten Augenblick, wenn unten im Keller der Wäschetrockner tutet, weil er fertig ist und abgeschaltet werden möchte, und gleichzeitig der Postbote unter Missachtung des im Vorgarten stehenden Briefkastens Richtung Haustür einschwenkt, schon durchs Fenster signalisierend, dass er mich zu sprechen wünscht. Wahrscheinlich braucht er eine Unterschrift, dazu muss ich aber saubere Hände haben, und die habe ich momentan nicht. Ich schäle nämlich Kartoffeln. Es sind welche direkt vom Feld mit viel Erde dran – ökologische Erde natürlich. Unsere Bauern müssen wir unterstützen, das verstehe ich ja, aber muss ich deshalb gleich ihr Land kaufen?
Das Wasser kommt viel zu heiß aus dem Hahn, ein Handtuch ist auch nicht greifbar, notfalls tun’s die Topflappen, ist ja nicht das erste Mal, jetzt aber ganz schnell die Tür öffnen und dann zum Telefon, weil meine Stimme bereits per Konserve mitteilt, dass ich nicht zu Hause bin. Stefanie, die Anruferin, schreit jedoch schon dazwischen, ich soll jetzt endlich rangehen, und dann will der Briefträger gar keine Unterschrift, sondern nur was für meine Nachbarin abgeben. Die ist nämlich nicht da, und der große Umschlag passt nicht durch den Briefschlitz.
Das alles hat kaum drei Minuten gedauert, doch die haben mich wirklich in Trab gehalten! Der Trockner tutet immer noch wie ein Nebelhorn, das nervt allmählich, und während ich mit dem Hörer in der Hand eine Treppe tiefer steige, will meine Tochter von mir wissen, weshalb ich nicht gleich ans Telefon gegangen bin. »Du hast in jedem Stockwerk eins, reichen die immer noch nicht?«
Das ist natürlich eine rein rhetorische Frage, denn sie kommt sofort zum eigentlichen Grund ihres Anrufs: »Gehst du am Sonntag mit zur Schönheitskonkurrenz? Hannes weigert sich, und allein mag ich nicht.«
»Wo willst du hin? Zu so einer Nabelschau? Weshalb denn bloß? Meinst du wirklich, du hast Chancen?«
»Seh ich vielleicht aus wie ein Pudel?«, kommt es glucksend durch den Hörer. »Das ist eine Art Casting für Hunde! Ich will mit Charly da hin, einfach mal abchecken, wie seine Chancen stehen.«
»Das Kerlchen ist doch erst ein paar Monate alt!«
»Na und? Er soll sich schließlich sein Futter später mal selber verdienen!«
Hier dürfte wohl eine Erklärung fällig sein: Nach dem tief betrauerten Ableben von Rauhhaardackel Mäx hatten Stefanie und Hannes beschlossen, nie wieder einen Hund anzuschaffen; man würde sich ja auch keinen neuen Opa zulegen, wenn der eigene verstorben sei.
Nach ein paar Wochen hieß es schon: »Später vielleicht mal, aber auf keinen Fall mehr einen Dackel! Wir würden ihn doch nur ständig mit Mäx vergleichen!«
Also kam vorübergehend Timo ins Haus, weil dessen Besitzer eine neue Freundin hatte, die gegen Hundehaare allergisch war. Timo entstammte dem gehobeneren Straßenadel, war ziemlich groß und ziemlich laut, doch bevor er endgültig die Herrschaft über Küche und Couch ergreifen konnte, holte ihn der eigentliche Besitzer zurück mit dem Bemerken, ein Hund würde weder rauchen noch singen und sei deshalb ein wesentlich angenehmerer Hausgenosse als nikotinabhängige, unmusikalische Weiber, die nicht mal kochen können.
Nachdem die letzten Hundehaare beseitigt, Fressnapf und Hartgummiball weggeräumt waren und die Zeitung wieder auf dem Tisch lag statt als Konfetti unten drunter, erschien es Timos Pflegeeltern wohl doch zu ruhig im Haus, denn wenige Tage später rief mich Steffi ganz aufgeregt an: »Wie gefällt dir der Name Charly?«
»Für wen? Für ein Kind? Bist du etwa schwanger?«
»Quatsch! Für einen West-Highland-Terrier!«
»Ist das nicht ein Hund? So eine Art Wischmop ohne Stiel?«
»Du kennst bestimmt das kleine weiße Wollknäuel aus der Hundefutterwerbung.«
»Und das heißt Charly?«
»Neeeiiin!!! Was ist denn los mit dir? Sonst bist du nie so begriffsstutzig! Wir haben einen Westi gekauft!«
Natürlich handelte es sich nicht um einen gewöhnlichen Hund, sondern um ein Rassetier von edlem Geblüt. Charly kann nämlich einen ellenlangen, hochadeligen Stammbaum nachweisen mit einer echt schottischen, noch in den Highlands lebenden Großmutter (aber schottisch bellen hat er trotzdem nicht gelernt). Dafür verfügt er über eine angeborene Arroganz: Ein paar Wochen später schon wurde er aus der Welpenschule rausgeschmissen, weil er angeblich zu dominant sei. Der Tierarzt hingegen freut sich immer, wenn Charly zum Impfen kommt, weil er weder neurotisch ist noch verfettet und schon gar nicht degeneriert. »Ein idealer Zuchtrüde.«
»Der ist doch kaum aus den Windeln raus!«, hatte Steffi protestiert. »Im übertragenen Sinn natürlich, stubenrein ist er schon lange.«
Davon gehe er aus, hatte der Herr Doktor erwidert, aber ein anerkannter Zuchtrüde habe außer seiner Herkunft auch gewisse Kriterien zu erfüllen, und das wiederum müsse von Fachleuten durch entsprechenden Eintrag in den Papieren bestätigt werden.
»Und wo findet man diese Fachleute?«, hatte Steffi gefragt.
»Zum Beispiel auf einer Rassehundeschau!«
Nun ist alles klar. »Natürlich komme ich mit«, sichere ich meiner Tochter zu, »so was lasse ich mir doch nicht entgehen! Braucht man Ohrenstöpsel, oder dürfen die Viecher dort gar nicht bellen?«
»Woher soll ich das denn wissen? Jedenfalls musst du am Sonntag spätestens um zehn Uhr hier sein. Um elf geht der Rummel los, und ich habe im Moment noch nicht die geringste Ahnung, wo diese Neckartalhalle überhaupt ist.«
Nie hätte ich geglaubt, dass Hunde in so vielen unterschiedlichen Tonlagen bellen können! Das reicht vom tiefsten Bass (Neufundländer) bis zum schrillen Diskant (Pekinese), und diese Spielzeugwauwaus, die von ihren Frauchen meist in gepolsterten Handtaschen transportiert werden, hören sich immer an, als seien sie hochgradig erkältet. Jedes Mal, wenn mich solch ein Staubwedel ankläfft, habe ich das Bedürfnis, ihm ein Hustenbonbon in die Schnauze zu schieben, damit endlich Ruhe ist. Und ich begegne den Staubwedeln relativ oft, denn in unserer Nachbarschaft wohnen gleich zwei. Im selben Haus. Deshalb benutzt Frauchen auch eine größere Tasche als normalerweise üblich.
Ich habe keine Ahnung, was sich sonst noch alles in diesem Gebäude abspielt, wahrscheinlich Tanzturniere, Tischtennismeisterschaften, Briefmarkenauktionen und die Weihnachtsfeier von der BASF – jedenfalls ist die Halle ziemlich groß und für alle Eventualitäten gerüstet. Präzise ausgedrückt: Es gibt eine Restauration, und es gibt genügend Tische und Stühle. Neu und vermutlich nur für den heutigen Tag installiert: ein leicht erhöhter Schiedsrichtertisch, dahinter vier würdig aussehende Herren, einer mit Brille, jeder mit einem Sortiment Stiften und diversen Papieren vor sich. Stempel sind auch aufgereiht, für jeden der vier Herren erreichbar.
Vor dem Tisch und in gebührendem Abstand voneinander erstrecken sich zwei mit rotweißem Trassierband abgegrenzte Vierecke, die mich sofort an umzäunte Tatorte aus Fernsehkrimis erinnern, wo die Kommissare ihren ersten Blick auf die Leiche zu werfen pflegen: »…und seht zu, dass ihr den zweiten Schuh findet!«
Charly scheint dieser ganze Auftrieb nicht so ganz geheuer. Er bleibt erst einmal am Eingang stehen, betrachtet das Getümmel und schaut Steffi fragend an, als wolle er sagen: Muss ich da wirklich rein? Und wenn ja, warum??? Kurzerhand nimmt sie ihn auf den Arm und wendet sich an einen jener Herren mit Armbinde, die aus mir nicht verständlichen Gründen mit Besen und Schaufel bewaffnet durch die Halle patrouillieren.
»Such schon mal einen Tisch für uns, ich muss uns erst anmelden!«, ruft sie mir zu und begibt sich zu den Ring-, pardon! zu den Schiedsrichtern. Dort wird Charly von vier Augenpaaren gemustert, ob er denn überhaupt einer intensiveren Begutachtung würdig sei – offenbar ist er es, weil nun die Präliminarien beginnen: ein flüchtiger Blick in den Stammbaum, ein etwas intensiverer in Charlys Impfpass, und auch der scheint in Ordnung zu sein, weil man nunmehr zum vermutlich zweitwichtigsten Punkt der Tagesordnung übergeht: »Ich kriege denn mal siebzehn Euro und zwanzig Cent.«
»Wofür?«, will Stefanie wissen.
»Als Mitgliedsbeitrag für den Hundesportverein. Hätten Sie’s vielleicht passend?«
Hat sie nicht, nur einen Zwanzig-Euro-Schein, der Herr hat aber auch kein Wechselgeld, nimmt jedoch dankend den Restbetrag zum Wohle des Vereins an. Hund und Frauchen sind zunächst einmal entlassen. Erstaunlich übrigens, dass die Begleitpersonen der versammelten Vierbeiner überwiegend weiblich sind; Männer zeigen sich allenfalls neben Schäferhunden und Größerem.
Die Halle füllt sich, die verfügbaren Tische ebenfalls. Wir müssen den unseren mit einer schwarzen Pudeldame teilen sowie einer Portion Pommes frites, an der sich abwechselnd Hund und Besitzerin delektieren. »Es ist nämlich ihr Lieblingsessen«, erläutert Frauchen. Na dann …
»Muss man hier eigentlich etwas essen?«, überlegt Steffi mit neidischem Blick zum Nebentisch, auf dem ein Chow-Chow lediglich mit Kamm und Bürste bearbeitet wird, während gegenüber ein sehr großer und dicht behaarter Hund noch schnell die Krallen poliert bekommt.
»Essen müssen Sie nichts, aber wenigstens etwas trinken«, klärt uns Frau Pudel auf und entnimmt ihrer Bereitschaftstasche einen batteriebetriebenen Föhn. »Jetzt werden wir Pearly noch ein bisschen hübsch machen!«
»Wie heißt Ihr Hund?« Vermutlich habe ich mich verhört.