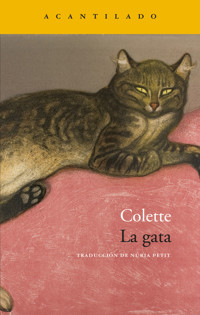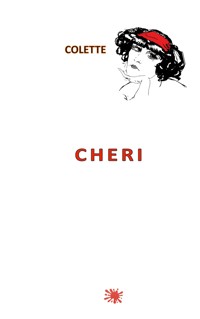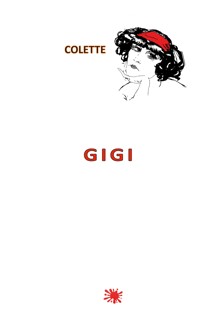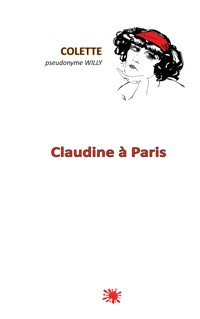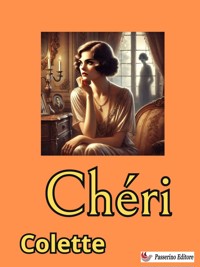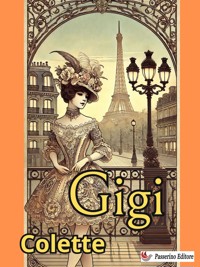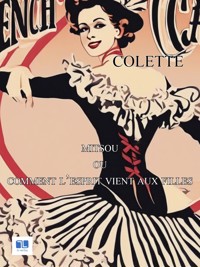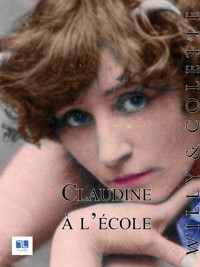9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Colette war 76 Jahre alt, weltberühmte Autorin der «Claudine»-Romane und Präsidentin der Académie Goncourt, als sie liegend im blauen Schein ihrer geliebten Lampe ein letztes Buch schrieb: «Le Fanal bleu». «Kannst du nicht einmal ein Buch schreiben, das nicht von Liebe handelt?» hatte Henri de Jouvenel, ihr zweiter Ehemann, sie einst vorwurfsvoll gefragt. Noch ihr letztes Buch – ohne fortlaufende Erzählung, aus kostbaren Episoden, zärtlichen Schilderungen ihrer Besucher, der sie umgebenden Dinge bestehend – ist ein Buch über die Liebe, die Liebe zum Detail. Wie mit dem Vergrößerungsglas, das in den späten Jahren stets neben ihr lag, betrachtet die Colette auf diesen Seiten eine kleine Welt, in der die große sich abbildet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Colette
Blaue Flamme
Aus dem Französischen von Uli Aumüller
Ihr Verlagsname
Mit einem Nachwort von Angela Praesent
Über dieses Buch
Colette war 76 Jahre alt, weltberühmte Autorin der «Claudine»-Romane und Präsidentin der Académie Goncourt, als sie liegend im blauen Schein ihrer geliebten Lampe ein letztes Buch schrieb: «Le Fanal bleu».
Über Colette
Sidonie-Gabrielle Colette, 1873 in Saint-Sauveur-en-Puisaye (Burgund) geboren und 1954 in Paris gestorben, war eine französische Schriftstellerin, Varietékünstlerin und Journalistin.
Inhaltsübersicht
Daß unsere kostbaren Sinne mit zunehmendem Alter abstumpfen, darf uns nicht über Gebühr erschrecken. Ich schreibe «uns», doch gilt diese Ermahnung mir selbst. Vor allem möchte ich, daß der neue, allmählich erreichte Zustand mich auf keinen Fall über seine wahre Natur hinwegtäuscht. Er trägt einen Namen, er macht mich wachsam, unsicher und befähigt mich zu neuen Anpassungen. Ich freue mich nicht gerade darüber, aber mir bleibt keine andere Wahl.
Wenn ich mich von meiner Lektüre oder dem bläulichen Papier, auf dem ich schreibe, dem herrlichen Spielplatz zuwandte, dessen Anblick mir vergönnt ist, habe ich wiederholt gedacht: «Die Kinder im Park lärmen dieses Jahr weniger»; kurz darauf beschuldigte ich die Türklingel, das Telefon und alle Orchesterklänge des Radios, mehr und mehr zu verstummen. Für die Porzellanlampe wiederum - ich meine nicht das Tag und Nacht brennende blaue «Leuchtfeuer» - nein, die hübsche, mit Sträußen und Ornamenten bemalte Lampe - für sie hatte ich nur ein ungerechtes Brummeln übrig: «Was hat die denn nur gegessen, daß sie so schwer ist?» Oh, man macht immer wieder neue Entdeckungen! Man muß nur abwarten, damit alles sich klärt. Statt Inseln anzulaufen, treibe ich also dieser Weite entgegen, wo nur noch das einsame Geräusch des Herzens hingelangt, das dem der Brandung gleicht. Aber beruhigen wir uns: nichts stirbt ab, ich bin es, die sich entfernt. Die Weite, aber nicht die Wüste. Zu entdecken, daß es keine Wüste gibt: das ist genug, um Herr zu werden über das, was mich bedroht.
Vier Jahre sind vergangen, seit ich ‹L'étoile Vesper› veröffentlicht habe. Es waren kurze Jahre, wie Jahre es eben sind, die immer gleiche Vormittage haben und Abende wie verschlossene Gefäße, mit einem kleinen, unvorhergesehenen Mittelpunkt gleich einem Kern. Ich hatte ‹L'étoile Vesper› in aller Aufrichtigkeit mein letztes Buch genannt. Ich habe jedoch gemerkt, daß Aufhören ebenso schwierig ist wie Weitermachen. Unter meinem blauen Fanal sitzend, wird die Kette, an der ich liege, immer kürzer, mein körperlicher Schmerz dagegen immer beständiger. Aber wie viele Möglichkeiten, mich fortzubewegen, sind mir - vom Gehen abgesehen - doch noch verblieben! 1946 war ich in Uriage, 1947 in Genf und im Beaujolais, 1948 in der Provence - obwohl es mir verboten war. Von einem Auto oder einem Rollstuhl aus zählte ich voller Stolz die wiedergesehenen Landschaften, Ströme und Gestade: «Immerhin, dies kann ich alles noch besichtigen!» Besichtigen? Das sagt man so oder empfindet es zumindest so. Durch ihre ständig zugezogenen Vorhänge hindurch hat Anna de Noailles in der Hinfälligkeit ihrer letzten Lebensjahre mehr Städte, Meere und Berge gesehen als ich.
Eigentlich sollte dieses Buch ein Tagebuch werden. Aber ich bin unfähig, ein richtiges Tagebuch zu führen, nämlich Perle um Perle, Tag um Tag eine dieser Ketten aufzureihen, denen allein schon die Genauigkeit des Schriftstellers, die Betrachtungen, die er über sich und seine Zeit anstellt, einen Wert, das Farbenspiel eines Juwels geben. Es liegt mir nicht, auszuwählen, das Herausragende zu notieren, das Ungewöhnliche festzuhalten, das Banale auszusondern, denn meistens ist es ja das Gewöhnliche, das mich reizt und anregt. Hatte ich mir doch vorgenommen, nach ‹L'étoile Vesper› nichts mehr zu schreiben, und jetzt bin ich dabei, zweihundert Seiten zu füllen, und es sind weder Memoiren, noch ist es ein Tagebuch. Mein Leser möge sich damit abfinden: mein Leuchtfeuer, meine Tag und Nacht brennende Lampe, blau zwischen roten Vorhängen, dicht an das Fenster gedrückt wie einer der Schmetterlinge, die dort im Sommer morgens einschlafen - mein blaues Fanal beleuchtet keine Ereignisse, über deren Größe man staunen könnte.
Es ist zwanzig Jahre oder noch länger her, daß die Prinzessin Edmond de Polignac, die Freundin der Musik und der Musiker, mit einem Blick und einem Wort den vierbeinigen Pult-Tisch verurteilte, der mich von Paris nach Saint-Tropez und zurück begleitete, der in den Herbergen an meinem Bett haltmachte. Ich hing an diesem Möbelstück, das Luc-Albert Moreau, der Maler, Graveur und Oberbastler für mich improvisiert hatte, damit ich an ihm schreiben konnte, ohne mit herunterhängenden Füßen sitzen zu müssen, eine Haltung, die für mein Wohlbefinden und meine Arbeit schon immer schädlich war.
«Ich habe ein kleines englisches Möbelstück», sagte die Prinzessin de Polignac, «das, vergrößert, hervorragend für Sie geeignet wäre.»
Sie irrte sich nicht. Seitdem es verstärkt, befestigt und erhöht wurde und dabei seinen anmutigen englischen Stil des 19. Jahrhunderts weitgehend eingebüßt hat, steht es quer über meiner Bettcouch und dient tatsächlich meiner Erholung und meinem Beruf. In seine solide Mahagoniplatte ist ein verstellbares Pult eingelassen, auf dem Telefon, Obst, Kofferradio und die dicken Bildbände ruhen, die ich mir zur Entspannung von meiner eigenen Schreibarbeit anschaue. Der Aufbau gleitet bequem vom Kopfende bis zu meinen Füßen. Obenauf lege ich einige gute und angenehme Helfer zurecht, darunter das Allzweckmesser mit seinem Skorpiongriff, das Bündel Stifte und Nippsachen ohne bestimmten Nutzen.
Um mich herum herrscht große Unordnung an Blättern und Papieren, doch ist es nur der trügerische Anschein von Unordnung, die mal von gekochten Maronen, mal von einem angebissenen Apfel verstärkt wird. Und seit einem Monat liegt hier auch noch eine - womöglich exotische - Ähre, deren Kapseln feine silberne Samen umschließen und explosionsartig ausstoßen, an denen Fasern hängen, leichter noch als die einer Distel. Diese Quasten befreien sich eine nach der anderen, geraten in die erwärmte Luft unter der Zimmerdecke, schweben dort lange hin und her, fliegen wieder herab, und wenn der Luftsog des Kaminfeuers eine erhascht, schickt sie sich in den Raub, schwingt sich entschlossen in den Kamin und läßt sich willig verzehren. Den Namen der Pflanze kenne ich nicht, die so ihre fliegenden Seelen ausstreut, aber sie braucht sich nicht auszuweisen, um in meinem Museum, dem Museum einer Unwissenden, ihren Platz zu finden.
Wo sind jene geblieben, denen ich für sie selbst und für mich ein langes Leben wünschte? Wäre ich je auf den Gedanken gekommen, daß Marguerite Moreno mich verlassen würde? Bei ihr waren die Ermüdungserscheinungen gelinde; sie lachte geringschätzig, wenn ich die Untätigkeit und den Halbschlaf der Mittagsruhe pries. Aber Marguerite zieht sich eine Erkältung zu und stirbt acht Tage darauf. Und Luc-Albert Moreau trifft einen Freund, ruft fröhlich: «Ah, mein Freund, ich freue mich, dich zu sehen!» und stirbt auf der Stelle an Herzversagen. Und vor ihnen Léon-Paul Fargue. Kurz vor dem Sterben murmelte er in das Blau seiner Bettücher, die er hatte färben lassen: «Viel zu blau … unmöglich …» Und andere, die ich nicht alle nennen oder gar aufzählen kann. Insgeheim nehme ich ihnen ihr Ende übel, ich schelte sie unvorsichtig und fahrlässig. Mich so plötzlich zu verlassen, mir das anzutun! Daher habe ich ihren Anblick, wie sie zur letzten, endgültigen Ruhe aufgebahrt daliegen, aus meiner Vorstellung und meiner Erinnerung verbannt. Fargue soll plötzlich selbst eine Statue geworden sein? Das will ich nicht. Der Fargue meiner Erinnerung trägt noch seine staubigen Wanderschuhe, er redet, er krault den schwarzen Kopf des Katers, er telefoniert mit mir, er läuft von Lipp nach Ménilmontant, er hadert mit der allzu blauen Dünung seines Lagers. Und Marguerite Morenos goldbeschuhte Füße sollen bewegungslos sein? O nein! In meiner Erinnerung bleiben sie lässig, beweglich, verletzbar und nimmermüde …
Meine jüngeren Freunde, die noch höchst lebendig sind, betrachten mich manchmal mit strengem Blick; sie sind auf der Hut. Sie ziehen mir den Schal enger um die Schultern: «Spüren Sie den Luftzug nicht?» - Nein, ich spüre den Luftzug nicht, ‹den› Luftzug, den ihr meint, spüre ich nicht. So weit gehen meine Gedanken nicht, daß ich ihn spürte. Ich habe so viele Gelegenheiten, mich von dem abzuwenden, was ihr verschämt «schlechte Luft» nennt. Vor allem habe ich den Schmerz, diesen immer wieder jungen, aktiven Schmerz, der mir Erstaunen, Wut und Trotz einflößt, der meinen Lebensrhythmus bestimmt; der Schmerz, auf dessen Aufhören ich hoffe, der aber nicht auf das Lebensende hinweist. Glücklicherweise habe ich den Schmerz. Oh, ich gebe zu, daß ich die Kranke hervorkehre und mit ihm kokettiere, wenn ich das Adverb «glücklicherweise» gebrauche. Sehr wenige Kranke behalten ihr ursprüngliches Wesen, aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, als leitete ich aus meinem Gebrechen einen verwerflichen Stolz, das Recht auf Rücksichtnahme oder einen Minderwertigkeitskomplex ab, der der Ursprung für Verbitterung ist. Ich spreche nicht von denen, die Schmerzen simulieren, sie sind überhaupt nicht interessant und stellen außerdem eine verschwindende Minderheit dar. Ich spiele nicht auf eine bestimmte Kategorie Leidender an, denen es gar nicht so unangenehm ist, auf frischer Tat beim Leiden überrascht oder angetroffen zu werden. Mein Bruder, der Arzt, urteilte die Lustgefühle dieser Menschen in wenigen Worten ab: «Das ist eine Art Ekstase», sagte er. «Das ist so, wie wenn man sich mit einem Streichholz im Ohr bohrt. Das ist ein bißchen obszön.»
Ein großer Politiker, der hinkte, hat mir einmal ein Geständnis gemacht, das ich nicht abwegig fand, obwohl ich zu jener Zeit noch erfreulich gesund war. Dieser Politiker liebte es, mich auf das Niveau verallgemeinernder Gedanken zu heben, er versuchte es zumindest. Ich bemühte mich auch, ihm zu folgen, aber nicht lange. Ich glaube, er hätte mich in vielen Dingen mittelmäßig gefunden, wenn er nicht eines meiner Bücher, nämlich ‹Tagesanbruch› so sehr geliebt hätte. Er hatte den Wunsch, mein Leben mit irgendeiner großen Idee zu bereichern (ich sagte: beschränken), die mir gewissermaßen als Religion, als Quelle der Würde (!!), als Inspiration dienen sollte. Aus Bosheit und zur Vergeltung fragte ich ihn eines Tages, ob er sich eine Existenz vorstellen könnte, die von einem einzigen Gedanken verwüstet würde. Seine Antwort erstaunte mich:
«Sehr wohl», erwiderte er ohne Zögern, «denn ich habe mein ganzes Leben lang, Tag für Tag und fast zu jeder Stunde daran gedacht, daß ich hinke.»
Vor seinem frühen Tod ertrug er mit großer Tapferkeit Unfälle und Operationen. Er hinterließ uns ein bedeutendes literarisches Werk, das ausschließlich - wie sein Leben - der Politik gewidmet war - ausschließlich, von einer ziemlich langen Novelle abgesehen, einer Art Meisterwerk, einer einzigen Novelle, deren Held ein Krüppel ist.
Ich habe also, zum Glück, den Schmerz, den ich mit der Lust am Wetten hinnehme, der superweiblichen Lust am Wetten, oder am Spiel, wenn Sie das vorziehen. Als die «Letzte Katze» im Sterben lag, gab sie mit einer Bewegung ihrer Pfote, mit einem Lächeln ihres Gesichts zu verstehen, daß ein über den Boden schleifender Faden sie immer noch zum Spielen anregte, das Denken und die Phantasie einer Katze immer noch beschäftigte. Mir wird man es an Fadenenden nicht fehlen lassen.
Ich komme aus Genf zurück, das bei verhaltener Lautstärke emsig lebt. Zunächst fand ich wenig Ähnlichkeit zwischen der absonderlichen Lebensweise einer Kranken, die sich mitten in einer fremden Stadt einer Behandlung unterzieht, und meinem sonstigen Leben, das seit so langer Zeit und mit so viel gutem Willen einer Krankheit angepaßt ist, an ihre Freuden und ihre Leiden, an eine geliebte Stadt, in der ich den Schmerz fast nicht nötig hatte, um mich wie ein Einsiedler in mutwilliger Einsamkeit oder launiger Geselligkeit einzurichten.
Von meiner Zelle im Hotel aus war von der Hauptstadt der Schweiz nichts zu spüren und nichts zu hören. Ihr heutiges Pflaster ist allerdings auch glatt und wird von lautlosen Autos befahren. Morgens sammelt ein Schubkarren in der kleinen Grünanlage Blätter und Ästchen auf. Und Papier? Nein, in Genf liegt kein Papier auf der Erde! Der kleine Schubkarren rollt auf zwei dicken, luftgefüllten Gummischlangen. Von meinem Fenster aus, das an der Biegung eines Seeuferweges liegt, sehe ich nur Autos, die schimmern wie nagelneue Klaviere.
Die ersten Wochen einer langen Kur bringen gleichermaßen Momente der Beruhigung wie der Verschlimmerung meines Zustands, wenn ich die Niedergeschlagenheit als Beruhigung bewerte. Dazu genügt es, daß ich mich an die kurzen, dreißig Jahre zurückliegenden Aufenthalte in einer Genfer Familienpension erinnere, in der Theater- und Music-hall-Künstler mit ebenso bescheidenen pekuniären Mitteln wie ich den Mittagstisch heimsuchten. Meine Taschen füllten sich mit wohlgemeinten Zigaretten (ich rauche nicht), mit kleinen Armbanduhren aus dunklem Stahl und aus Nickel, die pro Stück gut und gerne zehn Franken kosteten, und das zu einer Zeit, als der Schweizer Franken den gleichen Wert hatte wie der französische.
Als ich 1946 nach Genf zurückkehrte, wartete ich darauf, während der April sich zögernd einstellte, daß ein Teil meiner Kräfte zurückkäme oder vielmehr mein Optimismus - was dasselbe ist -, wenn nicht sogar darauf, daß der Schmerz ein Ende nehmen und eine vorwiegend körperlich bedingte Bangigkeit aufhören möge, sich der Wahrnehmung der Stadt und ihrer Bevölkerung zu widersetzen. War ich wirklich so beeinträchtigt, daß der Berg aus hartem Silber jenseits des Genfer Sees mir anfangs nur wie ein Abklatsch der Ansichtskarten vorkam? Anscheinend ja, denn den riesigen Wasserstrahl, der steil aus dem See schießt und sich ständig in ihn zurückschwingt, betrachtete ich nur wie ein majestätisches Spielzeug, eine Ähre, eine in den Wind gestreute, dem Wind trotzende Saat. Anscheinend ja, denn anfangs konnte keine Rede davon sein, den Zustand der Abhängigkeit und Erniedrigung im Verhältnis zu dem Therapeuten, der den Kampf mit meiner Krankheit aufgenommen hatte, zu überwinden.
Zunächst einmal lernte ich das Verhalten eines Patienten in ärztlicher Behandlung, das meine Arzt-Freunde mir nicht beigebracht hatten. Ich lernte Pünktlichkeit und gewöhnte mich an den geregelten Tagesablauf. Zu einer bestimmten Stunde trat ein mächtiger, wohlgesonnener, aber unerbittlicher Fremder bei mir ein. Das war die Stunde, in der ich ihn fürchtete und ihn gleichwohl herbeisehnte, diesen einen Mann, den neuen Mann. Zum Glück war diese Stunde von fieberhafter Putzsucht ausgefüllt, verlangte nach der rosa Garnitur, nach dem mit frischer Schleife gebundenen Nachthemd und dem schnell aufgebügelten Morgenmantel. Der Augenblick, der dem Eintreten eines so mächtigen Mannes vorausgeht, ist aufregender als dessen Quälereien mit Spritzen, Massagen, Stromstößen, die durch seine leibhaftige Anwesenheit erträglicher werden. Nach dem unwillkürlichen Aufschrei oder dem Zähneknirschen gestattete ich mir ein Lachen, das anständiger ist als Schluchzen, gab ich einen herzhaften Fluch, einen derben Scherz von mir, die der Arzt mir verzieh. Dann kam ich für einen Augenblick in den Genuß einer überaus angenehmen, herzlichen Unterhaltung, die mich erleichterte und von mir selbst erlöste, und dann hieß es: «… lieber Doktor, bis morgen.»
Mein Genf von einst mußte ich wohl ganz vergessen haben, denn bei den ersten Ausflügen im Wagen, bei Einbruch der Aprilnacht, wunderte ich mich so sehr darüber, daß dieser Strom von Fußgängern, Fahrrädern, lautlosen amerikanischen Autos, dieses Gedränge ohne Getöse, diese Betriebsamkeit ohne Zusammenstöße, dieses geordnete Hasten Genf sein sollten. Am meinsten staunte ich nach meinen sechs Jahren in der Abgeschiedenheit des verdunkelten Paris - im blauen Licht des Kellers, im Schwarz des Krieges, im Rot der Kerzenstümpfe - über die Festbeleuchtung. Eine verschwenderische Flut von rosa Licht verwandelte die überquellenden und wohlgeordneten Schaukästen der Läden für Lebensmittel, Spitzenwaren, Schuhe und Parfums in schwirrende Aquarien. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus. Was! Schokolade zum Greifen nahe, und der Kuchen in den Konditoreien, die man plündern kann und doch nicht erschöpft! Milch, reine, hochgeschätzte MILCH in Reichweite meiner Hand, meines entwöhnten Mundes. Milch, in Paris nach den Vorschriften der «Fünf» tröpfchenweise und bläulich schimmernd zugeteilt, wird hier an jeder Haustür verkauft. Ein jeder, ich eingeschlossen, kann sich hier in ein Gartenlokal oder in eine Eisdiele setzen, eine, zwei, drei Tassen Milch verlangen und sie auch bekommen. Jedem steht es frei, sie aus einem roten Becher mit weißen Tupfen zu trinken oder aus einem blauen, so blau wie die Immergrün-Blüte. Oder aus einem Plastikbecher, der so weiß ist wie sie selbst, in dem man sie nicht sieht, aber schmeckt. Steht es mir frei, sie in meinem Hotelzimmer zu jeder beliebigen Zeit zu bestellen, entweder eiskalt und geschmacklos oder lauwarm, an das samtige Euter erinnernd, mit Kaffee gefärbt, variiert, schaumig geschlagen, heiß mit Vanille, Zucker und Rum? Ich werde mich lange nicht daran satt sehen können, wie die Milch in einer blankpolierten Kanne, von Kinderhänden getragen, die Stadt durchläuft, zu beobachten, wie sie mir bei meinen Ausflügen auf Rädern in regelmäßigen Abständen begegnet: schutzlos und vertrauensvoll vor dem halbgeöffneten Törchen der Chalets stehend, an einem niedrigen Ast zwischen grünen Kirschen hängend, mutterseelenallein auf der kleinen Gartenmauer abgestellt und von der Katze bewacht!
Wer nicht den Bürgersteig entlangschlendern und sich den Zufällen und Launen eines Fußgängers überlassen kann, für den bleibt nur der oberflächliche Anblick von flüchtigen Städten, von Gebäuden mit verführerischen optischen Täuschungen. Schon jetzt bin ich nicht nur entschlossen, mich mit diesen oder jenen zu begnügen, sondern ich ermutige mich sogar dazu. Was habe ich zu verlieren? Nichts mehr. Im Gegenteil. Die Trugbilder drängen sich auf. Aber nein, dies ist keine Heckenschere, dies ist das neue Gerät, das ganz von selbst Kaffee kocht. Und jener hübsche, sanft geschwungene Gegenstand ist keineswegs das ideale Klettergerüst für Schlingknöterich, sondern eine Hosenbügelmaschine. Die praktische Erfindungskunst bringt hier nämlich wahre Wunder zustande. Wie lange noch werden bestimmte Geschäfte, die sich bescheiden «Eisenwarenhandlung» nennen, unerreichbar für mich sein? Ich wünschte, ich könnte wenigstens meine Nase gegen ihre Schaufenster drücken und mich an dem gefirnißten Holz, dem rosigen Buchenholz, dem emaillierten Eisen und dem Aluminium berauschen, so sehr erweckt die Schweizer Findigkeit bei ihrem Anblick den Gedanken an Kunst und Harmonie. Wenn ich dagegen an die Läden mit Kunstgegenständen und Kunstgewerbe denke …
Aber niemand hat mich aufgefordert, Kunstkritik zu üben, Aussagen über Landschaftsgemälde, rosige Akte oder Stilleben abzugeben, und was sollte ich wohl mit einer Schreibunterlage aus punziertem Leder oder einem kristallenen Ziergefäß anfangen? Lassen wir die Kunst in Ruhe; es wird mir reichlich vergolten, wenn ich mit verlangsamter Geschwindigkeit ganz dicht an den Läden vorbeifahre, deren ausgestellte Eßwaren alle wie frischgelegt aussehen. Kunst bedeutet hier den Zustand der Reinheit, bedeutet die peinliche Sorgfalt, die gewissenhafte Verkäuferin. Die Kunst, der Luxus, das ist das Papier: gemustertes Papier, gezacktes, gefaltetes, vergoldetes, verschwenderisches Papier, weiß wie Schnee, blau wie der Gletscher. Verglichen mit dessen hygienischer Hülle und Fülle, wird uns das in winzigen Stücken genutzte Leinen unseres zur Knauserigkeit gezwungenen Frankreichs etwas dürftig vorkommen.
Bananen, noch saftige Spätäpfel, frühe Erdbeeren, Apfelsinen, Eier, geschlagene oder ungeschlagene Sahne. Im Gegensatz dazu: kein Käse, höchstens grammweise, kein Reis, keine Butter, außer mit Hilfe von Tricks und Beziehungen. Ungläubig rufen wir aus: «Kein Schweizer Käse in der Schweiz? Das ist wohl ein Witz!» Wir halten das für einen scherzhaften Streich, bis uns das ernsthafte Wesen der Einheimischen wieder ernst werden läßt. «Nein, momentan gibt es keinen», sagt die charmante junge Genferin. Sie trägt maßgeschneiderte Kleider und Juwelen. Aber sie hat keinen Schweizer Käse, keine Butter. Sie hat Respekt vor der Rationierung und mogelt nicht. Vielleicht haben sie in der Schweiz keinen Teufel …
Und, auf andere Weise gesättigt, trösten wir uns, indem wir das Brot ohne Belag essen, das Kuchen-Brot, das Rosinen-Brot, das Brot für Leckermäuler. Es schmeckt so gut, daß wir vor lauter Schüchternheit unser Verlangen nicht stillen können und bei Tisch nicht wagen, es mehr als zweimal nachzubestellen.
In der Erkundung der Genfer Annehmlichkeiten bin ich nur in kleinen Sprüngen vorangekommen, wenn ich so sagen darf. Der Frühling verzögert sich, und von einem Krankenlager aus nimmt man vom Leben der Gesunden nur einen knappen Ausschnitt wahr. Um acht Uhr abends war ich am Ende meiner Kräfte. Ein Tablett wurde gebracht, beladen mit Rohkost, gegrilltem Fleisch, rohem Gemüse, Obst - wer kennt die sogenannte Krankenkost nicht auswendig? Danach kam meine leuchtende Ruhezeit. Durch das offene Fenster, das ein nach und nach nächtlicher werdendes Blau umrahmt, sehe ich einen Zipfel des Sees, der eine Brücke und Kais widerspiegelt. Bis spät nach Mitternacht umgrenzen bunte Leuchtschriften, Scheinwerfer und die Perlen der elektrischen Beleuchtung den See. Morgen wird der Frühnebel mir die in allen Regenbogenfarben schillernde, wie belebt sich über die Dächer schwingende Kathedrale wiederbringen und die seltsamen Glaskuppeln, die sich über den Innenhöfen wölben. Morgen früh werde ich die friedliche, dunstige Morgenröte haben und das Kreisen der Schwalben. Abends habe ich die bunten Lichtgirlanden, deren Spiegelung im Wasser badet und sich ausdehnt. Ein bestimmtes Reklame-Blau preist die nationale Uhrenfabrikation, leuchtet im Kontrast zu einem Absinth-Grün noch stärker auf, während ein Scharlachrot sich bis zu den nachenförmigen Leibern dreier Schwäne fortpflanzt, die sich auf ihrem eigenen Spiegelbild wiegen.
Es ist zweifellos ein Vergnügen, ein solches Schauspiel aus Lichtern und Schatten unmittelbar vor Augen zu haben, ohne sich aufzustützen, ohne den Kopf zu drehen, ohne sich im Bett aufzurichten, und es erst aus den Augen zu verlieren, wenn uns die Lider zufallen. Was uns leichtfällt, ist ein Vergnügen, selbst wenn ein bitterer Tropfen sich hineinmischt: wenn ich nicht - da und da, und auch noch da - diesen … nun ja, diesen Schmerz hätte, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, mein Bett in einem genauestens berechneten Winkel aufstellen zu lassen, so daß ich im Liegen drei Horizonte erforschen kann, ohne mich zu rühren. Wer beweglich und in guter Verfassung ist, hat so viel Bequemlichkeit nicht nötig.
«Ich werde selbst gehen», sagt eine Freundin, die ein paar Tage in Genf verbringt, «und das, was Sie hier verlocken könnte, in den Geschäften besorgen. Geben Sie mir eine Liste.» Ich hatte schon lange Lust auf eine gut gearbeitete Pfeffermühle, eine Mühle, die «mahlt», wie man in meinem Pariser Viertel sagt, und nicht eines jener schlechten, kleinen, schnell stumpf werdenden Räderwerke, die auf unseren Märkten verbreitet sind. Ich wollte einen geflochtenen Strang Nähgarn und einen Strang Nähseide, auf die altmodische Art aus gleich dicken, mehrfarbigen Fäden geflochten und an beiden Enden wie eine Wurst verknotet. Ich habe sie bekommen. Ein bißchen dünn zwar, aber ein hübscher, handgearbeiteter Zopf, ein echtes Stück Posamenterie. Ich wollte Wäscheknöpfe mit vier Löchern aus Perlmutt. Aus Perlmutt, davon lasse ich mich nicht abbringen. Jawohl, aus Perlmutt, so närrisch und verschwenderisch es klingen mag. Und Nadeln, das heißt «englische» Nadeln (schon als ich klein war, war ihr glänzender Umschlag deutsch beschriftet!), Nadeln, die wir, wir Spezialistinnen für Handarbeit, «Nadeln mit schmalem Öhr» nennen. Und Stopfwolle, auf Karten. Und Gummiband, das man in den Bund der Wollschlüpfer einziehen kann. Und Rollen mit Garn der alten Art, «verpichtes» Garn, zum Nähen von Leder. Habe ich Leder genäht, nähe ich, werde ich Leder nähen? Darum geht es hier nicht. Und seidenes Besatzband aus echter Seide, um die ausgeleierten Knopflöcher an Männerjacketts zu erneuern. Erzeugt denn der Anblick, das Anfassen bestimmter «Bedarfsartikel», die nie Veränderungen nach dem Diktat der Ästhetik oder der Mode unterworfen waren, ein merkwürdiges Wohlgefühl? Ganz bestimmt. Doch weil ich noch reich bin, benutze ich die Dinge auch nicht in der üblichen Weise. In einer Art magischer Versunkenheit und Erinnerung schmücke ich mich mit Kurzwaren. Das können Sie sich wohl nicht vorstellen, daß meine vom vielen Schreiben etwas knotige rechte Hand einmal ein solches Meisterwerk an Exaktheit, an Gediegenheit hervorbringen konnte, wie den zart-wulstigen Saum eines Knopflochs an einem Männerjackett? Selbstverständlich meine ich das im Schlaufenstich umsäumte Knopfloch. Das andere, das sogenannte gepaspelte Knopfloch, entbehrt jeder Poesie.