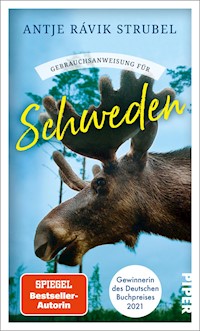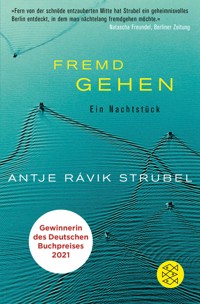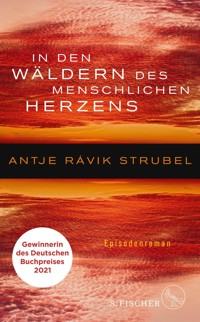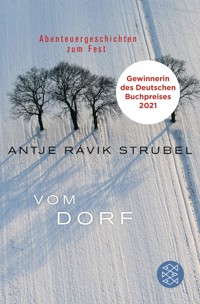10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Adina wuchs als letzter Teenager ihres Dorfs im tschechischen Riesengebirge auf. Bei einem Sprachkurs in Berlin lernt sie die Fotografin Rickie kennen, die ihr ein Praktikum in einem neu entstehenden Kulturhaus in der Uckermark vermittelt. Nach einem sexuellen Übergriff durch einen westdeutschen Kulturpolitiker strandet Adina nach einer Irrfahrt durch halb Europa in Helsinki. Dort wird Leonides, ein estnischer Politikwissenschaftler und Abgeordneter der EU, zunächst zu ihrem Halt. Während er sich für die Menschenrechte stark macht, sucht Adina einen Ausweg aus dem inneren Exil. »Blaue Frau« erzählt aufwühlend vom Ringen um persönliche Integrität einer jungen Frau, unterwegs zwischen Tschechien und Finnland, Estland und Deutschland. In ihren Erfahrungen spiegeln sich auch die jüngsten Machtverhältnisse zwischen Ost- und Westeuropa.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2021
Sammlungen
Ähnliche
Antje Rávik Strubel
Blaue Frau
Roman
Über dieses Buch
Adina wuchs als letzter Teenager ihres Dorfs im tschechischen Riesengebirge auf und sehnte sich schon als Kind in der Ferne. Bei einem Sprachkurs in Berlin lernt sie die Fotografin Rickie kennen, die ihr ein Praktikum in einem neu entstehenden Kulturhaus in der Uckermark vermittelt. Von einem sexuellen Übergriff, den keiner ernst nimmt, unsichtbar gemacht, strandet Adina nach einer Irrfahrt in Helsinki. Im Hotel, in dem sie schwarzarbeitet, begegnet sie dem estnischen Professor Leonides, Abgeordneter der EU, der sich in sie verliebt. Während er sich für die Menschenrechte stark macht, sucht Adina einen Ausweg aus dem inneren Exil. »Blaue Frau« erzählt aufwühlend von den ungleichen Voraussetzungen der Liebe, den Abgründen Europas und davon, wie wir das Ungeheuerliche zur Normalität machen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Antje Rávik Strubel veröffentlichte zahlreiche Romane. »Kältere Schichten der Luft« (2007) war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert, »Sturz der Tage in die Nacht« (2011) stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Antje Rávik Strubel wurde als erste Writer in Residence an das Helsinki Collegium for Advanced Studies eingeladen, sie erhielt 2019 den Preis der Literaturhäuser. Zuletzt erschien 2016 der Episodenroman »In den Wäldern des menschlichen Herzens«. Sie lebt in Potsdam.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: Büro KLASS, Hamburg
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-491448-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
TEIL 1 (Helsinki)
Jede Nacht sind die [...]
Auf den Felsen am [...]
Im Bad läuft das [...]
Die blaue Frau ist [...]
Die Linden vor dem [...]
Der Kaffee in der [...]
Die blaue Frau ist [...]
Zu ihrer ersten Verabredung [...]
Die blaue Frau sitzt [...]
Sie speichert den Brief [...]
Manchmal bleibe ich allein. [...]
Sie hat es zurück [...]
Die blaue Frau wartet [...]
Die Wärme vom Schnaps [...]
Wenn die blaue Frau [...]
Die Schnapsflasche ist zu [...]
Wenn die blaue Frau [...]
In der Wohnung fehlt [...]
Die blaue Frau ist [...]
Der Küchenboden ist kalt. [...]
Als die blaue Frau [...]
Sie schläft. Nur einmal [...]
Ob die blaue Frau [...]
Wir brauchen eine Ausweitung [...]
Die blaue Frau bleibt, [...]
Durch das Fenster sind [...]
Die blaue Frau erscheint [...]
Der ausgefahrene Sandweg vor [...]
Die blaue Frau redet [...]
Draußen fiel Schnee.
Die blaue Frau wartet [...]
Die Wohnung ist still. [...]
Wann die blaue Frau [...]
Sie wickelt sich aus [...]
Die blaue Frau schweigt, [...]
Ich heiße Adina Schejbal. [...]
Abendsonne hat die Bootsschuppen, [...]
Teil 2 (Rickies Laden)
Am Morgen, auf den [...]
Nach Sonnenuntergang wird es [...]
Es war ein Montag, [...]
Die blaue Frau ist [...]
Teil 3 (Haus an der Oder)
Das Gutshaus stand allein [...]
Teil 4 (Eine Straße unterqueren)
Sie ging nach Norden. [...]
Ich gehe jeden Tag [...]
Der Waldboden wurde zum [...]
Regen hat die Unterführung [...]
In der Sonne, die [...]
Die blaue Frau ist [...]
Sie geht auf den [...]
Solange ich warte, muss [...]
In den Schränken in [...]
Wenn ich aufwache, weil [...]
Kristina heißen viele. Popsängerinnen, [...]
Leonides Siilmann hat mich [...]
Sie liest die Verse [...]
Die blaue Frau steht [...]
Schwarz ist der Schatten [...]
Die blaue Frau nimmt [...]
Es war ein Mittwoch, [...]
Ich solle sie mir [...]
»Es gibt kein Zurück«, [...]
Ob die blaue Frau [...]
»Mir ist da jemand [...]
Die blaue Frau will [...]
Kristiina war nicht genug [...]
Die blaue Frau hängt [...]
Auf der Wanduhr ist [...]
Die blaue Frau hat [...]
Als Kristiina im letzten [...]
Ich solle mich wappnen, [...]
Hoch oben ragen Regenrinnen [...]
Die blaue Frau tritt [...]
Vor einer Weile war [...]
DANKSAGUNG
Meiner Freundin und Mentorin
Silvia Bovenschen gewidmet
TEIL 1 (Helsinki)
Ich habe gehört, daß ich die Frau bin, der er schon auf Seite sechzehn begegnet.
Inger Christensen
Jede Nacht sind die Autos zu hören. Das Rauschen der Autos auf den dreispurigen Straßen und das Rascheln der Blätter am Vogelbeerbaum.
Das sind die Geräusche.
Sie dringen durch das Fenster herein, das einen Spaltbreit geöffnet ist. Das Meer hört man nicht. Die Ostsee, die im Süden liegt, jenseits der Plattenbauten, in einer Bucht mit verschilften Ufern, die im Winter schnell zufrieren wird.
Peitschenlampen säumen die Wege. Nachts fällt ihr bleiches Licht auf den Bordstein und auf den Balkon der kleinen Wohnung, der zur Straße zeigt. Die metallenen Lampenschirme schwanken im Wind. Das Schlafzimmer zeigt zum Hof, wo es einen Spielplatz gibt, einen Verschlag für die Fahrräder und den Vogelbeerbaum.
Die Wände der Wohnung sind weiß und leer bis auf den Spiegel im Flur. In der Küche hängen zwei Postkarten über der Spüle. Auf der einen Karte fahren gelbe Taxis durch eine Straßenschlucht in New York. Auf der anderen, einer Schwarzweißaufnahme, sitzen zwei Frauen in einem Pariser Straßencafé. Sie tragen Glockenhüte aus den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts und elegante Röcke.
Das sind die Bilder.
Die Blumentöpfe im Metallregal auf dem Balkon sind unbenutzt. Spinnweben haben sich dort verbreitet. Die Spinnen leben noch. Es ist September.
Am Horizont, wo Lagerhallen und ein riesiger Sendemast die Reihen der Plattenbauten begrenzen, türmen sich Wolkenberge auf. Der Sendemast ist der einzige Orientierungspunkt in den identischen Straßen.
Niemand weiß, wo sie ist.
Die Wanduhr zeigt halb drei. Das silberne Zifferblatt stellt den Weltatlas dar. Einen Sekundenzeiger gibt es nicht, nur ein kleines rotes Flugzeug, das die silberne Welt umrundet. Jede Weltumrundung dauert bloß eine Minute, und doch sieht es langsam, fast gemächlich aus. Ein Schatten fliegt unter dem Flugzeug mit und ist ihm manchmal ein kleines Stück voraus, je nachdem, wie der Lichteinfall ihn auf die glänzende Erde wirft.
Sie könnte überall sein.
Nina. Sala. Adina.
In der Küche gibt es ein paar Töpfe, einen Wasserkocher und eine fleckige Espressokanne. Die Kanne fiept, wenn unter Druck Wasserdampf aus dem Ventil am Kessel tritt. Auf den Tassen im Schrank steht in Großbuchstaben IKEA. Die Wohnung sieht nach einer echten Wohnung aus, nach einem Menschen. Ein paar Bücher sind da, Kerzenständer, Hochglanzmagazine übers Kochen und Reisen. Im Flur liegt ein abgewetzter Läufer. Walkingstöcke stehen an der Garderobe.
Das sind die Gegenstände.
Sie stellt die Walkingstöcke in den Schrank im Flur. Aus dem Bad ist einlaufendes Wasser zu hören. Aus dem Treppenhaus dringt kein Geräusch. Die Wohnungstür ist abgeschlossen. Die Griffe an den Fenstern sind fest verschraubt. Nur ein schmales Winterfenster lässt sich einen Spalt weit öffnen. Der Spalt ist nicht groß genug, um den Kopf hinauszustrecken. Das ist ihr recht, obwohl im Moment die Sonne scheint und die Wohnung sich aufheizt.
In der Küche steht die angebrochene Plastikflasche. Sie misst einen Deckel voll Flüssigkeit ab und gießt den Schwapp in den Kaffee.
»Nur ein Schluck«, sagt sie, als wäre da jemand.
Die Wanduhr schlägt mit dem Klang einer leisen Kirchenglocke.
»Salut, Sala! Auf dich.« Mit erhobener Tasse nickt sie den schmutzigen Scheiben der Balkonverglasung zu. »Auf dich und alles Gute!«
Wind zieht durch den Fensterspalt. Auf der Wanduhr ist es kurz vor drei. Die silbernen Umrisse der Kontinente zeigen keine Städte, keine Straßen, keine Gebirgsfalten und keinen Fluss. Sie stellt den Schnaps in den Kühlschrank. Eine Flasche braucht ihren Platz, wenn sie selbst schon fremd und die Wohnung nicht ihre ist. Sie ist in einem Land, das sie nicht kennt, in einem Land im Norden, wo die Bäume andere sind und die Menschen eine andere Sprache sprechen, wo das Wasser anders schmeckt und der Horizont keine Farbe hat.
Ihr Herz setzt einen schnellen Schlag, wo er nicht hingehört. Sie lenkt sich ab. Sie denkt an Buchen und Kastanien, an Linden und Kiefern, an den Geruch nach Holz und Erde und daran, wie ruhig und scheinbar zeitlos das Leben eines Baumes verläuft, wie das des Vogelbeerbaums vor dem Schlafzimmerfenster. Sie denkt daran, wie mickrig ihr Herzrasen wird vor der gleichgültigen Pracht dieser Bäume und ihrem Ewigkeitsversprechen, ewig jedenfalls, solange sie nicht in Rodungsgebieten stehen. Aber die Bäume, die sie im Kopf hat, wachsen unversehrt vor einem Doppelhaus. Niemand wird sie fällen, weil sie aufpasst.
Aufgepasst hat.
Das ist die Vergangenheit.
In ihrer Vorstellung hat sie das Recht, in der Vergangenheit zu sein. Es fällt Schnee dort. Es ist Winter und sie noch ein Kind. In kristallklaren Nächten scheint der Mond fahl auf die Wege und beleuchtet die Tannen und Fichten und die Masten der Skilifte, die an den gerodeten und von Pistenraupen gewalzten, schneebedeckten Hängen stehen. Das Doppelhaus befindet sich in einem sanften Tal vor einem hohen Horizont. Es ist weit weg von hier. Es ist 1500 Kilometer, eine Stunde Zeitverschiebung und zwanzig Autostunden von Helsinki entfernt, in einem Gebirge an der tschechisch-polnischen Grenze. Sie liegt im Kinderzimmer unter dem Dach. Ihr Bett hat sie mit einer Lichterkette dekoriert. Wenn sie sich aufrichtet, kann sie vom Fenster aus den Čertova hora sehen. Nur der Gipfel des Berges zeichnet sich vor dem Nachthimmel ab, seine schneebeflogenen schroffen Felsen.
Wenn ihre Mutter zum Gutenachtsagen ins Dachzimmer kommt, lässt sie die Jalousie herunter und schaltet die Lichterkette aus. Sobald sie gegangen ist, macht Adina die Jalousie wieder auf. Sie will sehen, wie das Mondlicht auf ihre Haut fällt und sie verwandelt. Sie zieht das Nachthemd hoch bis zum Bauch. Die Beine sehen im bleichen Licht dünn aus, verletzlicher als am Tag. Sie legt eine Hand auf ihren Oberschenkel, sie kann den Oberschenkel zur Hälfte umfassen. Sie winkelt das Bein an, ein schimmerndes Ding, das Knie nur ein Knochen. Sie stellt sich einen Jungen vor, einen Jungen, der noch kein Gesicht hat, noch nicht einmal einen Körper, er hat nur diese Hand, die ihre ist und sich deshalb gut anfühlt, als sie mit den Fingerspitzen über ihren Oberschenkel streift.
Im Dorf gibt es keine Jungen. Es gibt nur die Barkeeper in der Cocktailbar des Viersternehotels, die den Touristen in der Saison Cubra Libre und Old Fashioned mixen und ihr manchmal einen Orangensaft auf Kosten des Hauses spendieren. Es gibt die Kinder der Touristen, die den ganzen Tag mit Snowboards auf der Piste sind und ihre Plastikanzüge auch zum Abendessen nicht ausziehen. Sie streifen nur die Ärmel ab, und die Oberteile bleiben auf der Hüfte hängen.
»Du musst morgen früh raus«, sagt ihre Mutter, wenn sie die Lichterkette ausmacht und die künstlichen Blüten mit einem Nachglühen verlöschen. »Dein Brot liegt in der Brotbüchse im Kühlschrank. Und dass du mir die Äpfel isst!«
Adina sieht das Mondlicht auf ihrem Bettzeug und auf ihren Anziehsachen, die über der Stuhllehne hängen. Sie sucht die Kleidung für den nächsten Morgen immer schon am Abend vorher heraus, gefütterte Hosen und einen grünen Wollpullover, der ihr zu groß ist. Die Ärmel schlackern über die Handgelenke. Wenn sie ihn trägt, kommt sie sich vor wie ein Naturforscher auf Expedition.
Auch die Schultasche ist fertig gepackt. Morgens ist dafür keine Zeit. Außerdem ist es dunkel, denn sie macht das Licht nicht an. Sie hat sich alles so ausgedacht, dass sie es mit Zähneputzen rechtzeitig zum Bus schafft. Der Bus wartet nicht, obwohl sie in den ersten fünfzehn Minuten die einzige Mitfahrerin ist. Abends, wenn es auf der schmalen, kurvigen Straße, die sich vom Tal ins Dorf hinaufwindet, Glätte gibt, muss sie die letzten Kilometer nach Hause laufen, weil der Busfahrer nicht extra wegen ihr Schneeketten montiert.
Das Dorf klemmt zwischen Bergmassiven. Die Gebirgszüge des Krkonoše bilden seine natürliche Grenze. Hinter dem Dorf steht der Wald an steilen Hängen. Auf den letzten Kilometern des Nachhausewegs hält Adina sich dicht an den Schneewällen am Straßenrand. Die Straße ist unbeleuchtet. Aber der Schnee schimmert. Und die Autos, die aus dem Tal hinauf nach Harrachov fahren, bestrahlen mit ihren Scheinwerfern die Wipfel der Fichten.
Sie drückt ihr Knie auf die Matratze zurück und betrachtet die Beine. Zwei Leberflecken. Eine Narbe am rechten Knie, der Rest ist glatt weiß.
Das ist der Blick.
Der Blick kommt aus der Gegenwart. Die weiße Glätte der Beine wäre ihr als Kind nicht aufgefallen. Das hätte sie nicht gekümmert. In ihrem Bett am Čertova hora gab es solche Blicke nicht. Ihre Mutter machte die Lichterkette aus, und Adina schlief ein. So ist es glaubwürdig. Alles andere ist hinzugefügt.
»Theater«, sagt sie laut und nimmt den letzten Schluck aus der Tasse.
Wind zieht durch den Fensterspalt. Aus dem Bad ist das Einlaufen des Wassers zu hören.
Theater kann sie sich nicht leisten. Wer eine Aussage macht, muss präzise sein.
Sie weiß nicht, wie man eine Aussage macht. Sie wird vor ein Gericht müssen. In Helsinki gibt es ein Gericht. Es befindet sich in der Nähe des Doms, der wie ein weißer Felsen aus der Brandung der Stadt aufragt. Aber sie kann nicht einfach zum Gerichtsgebäude gehen und anklopfen. Sie ist in einem Land, dessen Sprache sie nicht spricht. Sie weiß nicht, an wen man sich wendet, nur, dass sie einen Anwalt braucht, und Anwälte kosten Geld. Sie weiß aber, dass sie die Aussage machen muss, in einem holzgetäfelten Saal und vor Geschworenen, wie sie es im Film gesehen hat, in den amerikanischen Serien der Barkeeper. Die Richterin wird eine schwarze Robe tragen. Und die Angeklagten kommen in Handschellen herein, und werden herangezoomt von Kameras, die alles filmen, die jede Einzelheit festhalten. Jede Pore, jede Schuppe, jedes Flackern der Augen wird von nun an wiedererkennbar sein.
Und wenn die Verteidiger sagen, Einspruch Euer Ehren, weil ihre Aussage ungeheuerlich ist, wird die Richterin den Kopf heben. Sie wird sich Zeit nehmen, jeden Verteidiger zu mustern, und das wird lange dauern, weil für Männer wie diese ein einziger Verteidiger nicht reicht.
Einspruch abgelehnt, wird die Richterin sagen. Bitte, Adina Schejbal, sprechen Sie weiter.
Und die Männer werden ahnen, wen sie vor sich haben. Ihre Hände in den Handschellen werden anfangen zu zittern. Und die Geschworenen erheben sich. Der Saal wird verstummen, wenn die Geschworenen rufen: Welchen sollen wir töten? Es wird still werden vor Gericht, wenn man fragt, wer wohl sterben muss. Und sie wird sagen: alle.
Es wird sich anfühlen wie das nasse Glitzern der Birkenblätter im Morgenlicht. Ein Flirren, ein Sprühen, als hätten die Birken ihre Blätter soeben ins Meer getaucht.
»Sala?«
Das Meer. Das jenseits der Plattenbauten beginnt, und das sie von hier aus nicht sehen kann.
»Sala!«
Das ist Leonides.
»Träumst du wieder, Sala?«
Leonides mit seinem weichen Kinn. Mit seinen braunen Cordjacketts und den glänzenden Krawatten. Mit seinem Tick, drei Äpfel am Tag zu essen, niemals nackt zu schlafen und Natur nur auf Gemälden zu mögen, vor allem auf den Gemälden niederländischer Maler.
Sie wird nie wieder hören, wie Leonides diesen Namen sagt. Sala.
Auf den Felsen am Ufer, jenseits der Birken, am Ende der Bucht erscheint die blaue Frau. Sie ist so deutlich, dass ihre Gestalt alles überstrahlt.
Das Licht fällt scharf auf die Felsen.
Hinter den Felsen liegt Schotter, der zu schwarzen Wegen aufgeschüttet wurde, um das Wasser zurückzuhalten. Dort, wo kein Schotter liegt, ist der Untergrund weich und schlammig, durchwebt vom Wasser, das mit den Flussläufen aus den höhergelegenen Sümpfen und Moorwiesen des Umlands in die Stadt hineinströmt, in unzähligen Rinnsalen hin zum Meer.
Das Wasser schwemmt die Moose auf, nährt Blaubeeren, Sumpfporst und Farne, versickert im Uferschlamm, dringt durch die Risse im Stein und steht knapp unterhalb des Asphalts der Straßen. Der Regen bringt es mit. Und das Meer, das gegen die Hafenbefestigung rollt, treibt es zurück an Land. Windböen tragen das Wasser heran. Sie peitschen, vom Schärengarten kaum abgeschwächt, über die Schnellstraßen, die den Hafen begrenzen, und in die Gebäude jenseits der Schnellstraßen, die noch im Rohbau stehen.
Die blaue Frau kommt langsam näher.
Sie betritt die Einfriedung des kleinen Seglerhafens. Sie steigt über die rostigen Schienen, auf denen die Boote zum Einwintern hochgezogen werden. Sie geht an den Booten vorbei. Ihr Tuch wird vom Wind aufgeweht, und sie nimmt es ab.
Sie bleibt stehen und ordnet ihr Haar, und das Tuch in ihrer Hand flattert.
Wenn die blaue Frau auftaucht, muss die Erzählung innehalten.
Im Bad läuft das Wasser ein. Es ist ein fensterloses Bad mit einer Wanne auf Füßen. Kalk hat sich ins Linoleum gebrannt. Die Heizrohre an der Wand feuern, und ihr wird heiß, obwohl sie nackt dasteht.
Sie taucht einen Fuß in die Wanne. Beim Nachholen des anderen Beines mischt sie kaltes Wasser dazu. Langsam geht sie in die Knie. Das Wasser steigt an den Oberschenkeln hoch, die Brüste tauchen ein. Dann rutscht ihr Po an der glatten Emaillewand ab, und sie schlittert der Länge nach in die randvolle Wanne. Ihr Kopf taucht beinahe unter.
Schaum bedeckt sie wie schwereloses Gebirge, Blasen platzen am Kinn. Unter Wasser greift sie nach ihrem Bein. Sie umfasst den Oberschenkel und zieht das Bein an, ihr Knie ein Gipfel inmitten von Flocken.
Das ist der Körper.
Das Wasser glüht auf der Haut, die sich rötet. Die Poren öffnen sich, und die Hülle wird weich, beschützt und umfangen vom Schaum. Sie tastet vorsichtig die Ränder ihres Körpers ab. Sie macht es so, wie Leonides sie berühren würde, obwohl er nicht da ist, und in ihrer Vorstellung ist es nicht mehr seine Hand. Aber das ist in diesem Moment nicht wichtig. Wichtig ist, dass es sich gut anfühlt.
Nur das Herz schnellt in den Hals, wo es flattert. Sie atmet langsam, bis es herunterfährt, und denkt an die Kühle seines Apartments, an die hohen Decken, das nüchterne Mobiliar. Tisch und Stühle sind aus Holz, aus hellem Holz, das einmal gewachsen ist, das ein gemaserter Stamm war, eine Birke, Außenseiterin unter den Bäumen mit einer Biegsamkeit, um die sie nicht zu beneiden ist. Ihr weicher Stamm hat sich einmal zurück zur Erde biegen lassen und wird nun eingerahmt von Glas und Chrom und Geschirr von iittala, das Leonides auf die grüne Marmorplatte in der Küche stellt. Die Einrichtung muss den verschiedensten Geschmäckern entsprechen, hat er gesagt, weil das Apartment der Universität gehört.
Ein paar ihrer Sachen sind noch dort. Die Mütze, ein Nachthemd, das blaue Button-down-Hemd und eine Jeans hat sie in Leonides’ begehbarem Kleiderschrank zurückgelassen. Das Nachthemd ist ein Geschenk von ihm. Vielleicht hebt er es auf. Vielleicht legt er es neben seine Seidenpyjamas, solange er dieses Apartment noch benutzt.
»Geh zum Arzt«, hatte Leonides gesagt, wenn das Flattern im Hals wiederkam, das sie glauben lässt, sie ersticke.
»Das hatte ich schon als Kind.«
»Du warst ein nervöses Kind.«
»Nein.« Sie seift sich ein, schöpft Wasser unter die Achseln, zwischen die Beine und schrubbt die weiche Haut mit dem Waschlappen sauber. Vorsichtig hebt sie sich aus der Wanne. »Nicht, dass ich wüsste. Ich war nicht nervös.«
Schaum ist auf den Boden geschwappt. Sie wischt die Lauge mit Klopapier auf und wirft den Matsch ins Klo. Ins Handtuch gewickelt, betritt sie den Flur. Nasse Fußabdrücke bleiben auf dem Linoleum zurück, als sie das Wohnzimmer durchquert, um auf den Balkon zu gehen, der ringsum mit Glasfenstern verschlossen ist. Von ihrem Körperdampf beschlagen die Scheiben. Die Ostsee ist von hier aus nicht zu sehen. Der dritte Stock ist zu niedrig, um über die Dächer der Plattenbauten und die Schnellstraßen hinweg das Meer sehen zu können. Nur die Anliegerstraße vor dem Häuserblock zeichnet sich im Dunst auf den Scheiben ab und das Flachdach des Gebäudes gegenüber. Dort sind die Mülltonnen des Wohnblocks untergebracht. Drei Bäume stehen davor, zwei Linden, die noch Früchte tragen, und ein Ahorn mit rotem Laub. Auf dem Thermometer sind es zehn Grad. Die Spinnen in den Blumentöpfen bewegen sich wie im Schlaf.
Das ist der Abschied.
Sie muss kühl sein, wenn sie eine Aussage macht. Sie muss sich herunterfahren wie ein Tier im Winterschlaf. Die Kälte muss sie bis auf die Knochen erfassen. Sie muss langsamer werden, bis alles vereist, jedes Zögern, jede Schwäche, die Schuldgefühle, die Scham und alle Bedenken, bis sie ganz still ist und nur noch eines zählt: dass die Angeklagten die Höchststrafe erhalten.
»Du Meisterin im Abschiednehmen!«
»Ich?«
»Ja.«
Sie kann sich so viel Zeit mit dem Abschied lassen wie die Bäume, die sich dem Jahr entziehen, jeder mit seiner eigenen Geschwindigkeit. Den Ahorn hat die Kälte schon erfasst, während in den Linden noch der Sommer steckt.
»Oder ist noch jemand hier?«
Linden gibt es auch in Harrachov, im Schatten des Čertova hora. Eine alte Linde steht vor der Glasbläserei, und neben dem Potraviny wurden in den neunziger Jahren junge Linden gepflanzt. Eine Lärche wirft ihren Schatten auf die Treppe vor dem Doppelhaus. Am Saum der steilen Waldwege wachsen Fichten, und Tannen umkränzen den Schanzentisch der großen Sprungschanze. Im Winter liegen Äste auf den verschneiten Straßen und auf der Zufahrt zur Benzinpumpe, an der es nur zwei Tanksäulen gibt. Die Schneelast bricht regelmäßig Äste von den Bäumen.
Wenn ihre Mutter morgens von der Schicht kommt, nimmt sie, ehe sie sich schlafen legt, den Schneeschieber, um den Gehweg vorm Haus vom Schnee zu befreien. Ihre Mutter hat Angst, dass jemand ausrutschen könnte. Jeden Tag gehen Urlauber mit Skiern auf den Schultern am Haus vorbei, meistens Deutsche. In Deutschland, hat ihre Mutter gehört, wird man verklagt, wenn sich jemand vor dem Haus etwas bricht. Seitdem schippt sie im ersten Morgengrauen Schnee. Sie kann es sich nicht leisten, verklagt zu werden, weil sie keine deutsche Rechtsschutzversicherung hat. Sie hat überhaupt keine Rechtsschutzversicherung. Manchmal ist sie morgens zu müde. Dann schiebt Adina den Schnee vor der Treppe weg. Sie schwitzt, weshalb sie später in der Schule frieren wird. Aber sie hat keine Zeit, sich umzuziehen. Der Bus wartet nicht, bis der einzige Fahrgast seinen Pullover gewechselt hat.
Das Doppelhaus steht am Rand von Harrachov, am unteren Ortseingang. Es steht schon lange. Als mährische Bergleute es bauten, die in den Stollen nach Erz schürften, gab es die Sprungschanze und die Skilifte noch nicht. Später wohnten dort Deutsche. Die Deutschen zogen aus, als sie den Krieg verloren hatten, und die Sowjets zogen ein. Die Rote Armee machte ein Lazarett aus dem Haus, ehe nach dem Krieg eine Gipswand und eine zweite Haustür eingebaut wurden. Die Wand trennt die eine Hälfte des Hauses von der anderen ab, damit zwei Familien darin Platz haben. Aber nur eine Familie zog ein. In die andere Hälfte zog ihre Großmutter, Tochter eines Partisans. Der Partisan war im Krieg geblieben und wurde zum Helden des Antifaschismus. Als Tochter eines Helden musste ihre Großmutter nicht zur Untermiete wohnen wie jede andere ledige, junge Frau, sondern bekam als Anerkennung ein halbes Haus. Die Klärgrube am Schuppen gab es damals schon und den großen, mit Obstbäumen bestandenen Garten auch.
Die Deutschen kamen wieder. Jeden Winter kommen sie zum Skifahren nach Harrachov. In der Nähe des Hauses gibt es einen Übungshang. Es gibt einen Babylift, einen Zauberteppich und einen aufblasbaren Rübezahl, der an Seilen im Wind mit den Gliedmaßen wackelt.
»Daran habe ich lange nicht gedacht.«
»Woran?«
»Wie das war, als ich klein war.«
»Aber jetzt denkst du daran?«
»Ja.«
»Und wie war das?«
»Ich glaube, ich war nicht nervös. Ich war kein nervöses Kind.«
Vor dem Dachfenster in Harrachov leuchtet der Čertova hora. Wenn der Wind ungünstig steht, trägt er das Rattern der Sessel am Skilift zu ihr ins Zimmer herein. Auch bei geschlossenem Fenster ist das Rattern zu hören. Sobald ein Sessel über die Rollen an den Masten gleitet, rattern die eisernen Halterungen. Kraft ist Masse mal Geschwindigkeit. Das trägt Adina in die dünnen Hausaufgabenhefte ein. Sie hat ein kariertes Heft für Mathe und Physik und ein liniertes für Tschechisch, Geschichte und Deutsch. In Deutsch gibt es drei Möglichkeiten der Verneinung. Nein. Kein. Und nicht. Das Rattern des Sessellifts dringt zu ihr herein, auch wenn sie das nicht möchte.
Manchmal rattern die Sessel noch im Schlaf über ihre Schädeldecke. Jungs in klobigen Skischuhen bringen sie zum Schaukeln. Sie beachten die Verbotsschilder an den Liftmasten nicht. Die Piktogramme, auf denen schaukelnde Liftsessel durchgestrichen sind, haben für sie keine Gültigkeit.
Der kleine Tisch, an dem Adina ihre Hausaufgaben macht, wackelt. Sie hat ihn in jede Ecke des Zimmers geschoben. Aber das Wackeln kommt nicht von den schiefen Holzdielen. Eines der Tischbeine ist zu kurz. Früher waren die Beine am unteren Ende mit Tierköpfen verziert, mit geschnitzten Löwen, die ihre Mäuler aufrissen, als wollten sie dem Tisch die Füße abbeißen. Der Partisan sägte die Löwen ab. Bevor er in den Krieg zog, sägte er die Tischbeine oberhalb der Löwenköpfe durch. Er war überzeugt vom Sieg der Sowjetunion. Diesen Sieg zu erleben, damit rechnete er nicht. Sollte er sein Leben im Kampf verlieren, durften die Genossen keine bourgeoisen Möbel in der Wohnung finden, keinen feudalistischen Tisch. Verzierungen und Dekoration waren ein Überbleibsel des Feudalismus, und der Feudalismus gehörte ausgemerzt, besonders Löwenköpfe. Sie symbolisierten die herrschende Klasse, Fürsten und Könige. Das wusste der Partisan. Er rottete die Löwen mit Stumpf und Stiel aus, damit seine Tochter nicht als Klassenfeind in ein Umerziehungslager kam. Beim letzten Bein vertat er sich. Er setzte die Säge einige Millimeter zu weit oben an. Niemand wusste, warum, nicht einmal ihre Großmutter, die auf dem Tisch Pflaumen und Kirschen einweckte, Apfelkuchen machte und Holundersaft. Ihr diente der Tisch als Küchenbank. Als das Herz ihrer Großmutter versagte und die alten Möbel auf den Sperrmüll sollten, hat Adina die Küchenbank gerettet. Sie hat sie aus dem Möbelhaufen vor dem Haus wieder herausgeholt und in ihr Dachzimmer geschleppt, über jede der zehn Stufen.
Ihr Computer steht inmitten roter verwitterter Flecken. Unter das kurze Bein hat sie ein Stück Pappe geklemmt, so, wie ihre Großmutter das gehandhabt hat. Der Tisch wackelt trotzdem.
Zur Piste geht Adina nicht. Sie geht auch nicht zum Übungshang oder zum Auslauf des Funparks, wo sich die Snowboarder treffen. Sie ist eine gute Skifahrerin. Sie hat mit drei Jahren Ski fahren gelernt. Aber sie läuft lieber querfeldein den Berg hinauf, durch ungespurtes, unwegsames Gelände, um abseits der Pisten abzufahren, im steilen Tiefschnee zwischen den Fichten. Ihre Mutter hat ihr eine Stirnlampe geschenkt, ein Licht an einem Gummiband, das man auf Blinken einstellen kann. Von ihrer Stirn zucken geisterhafte Blitze durch den Wald. Düster leuchten die verschneiten Baumstämme vor ihr auf und gleiten zurück ins Dunkel. Adina stellt sich vor, der erste Mensch zu sein, der je hier gegangen ist. Oder nicht einmal ein Mensch, denkt sie, ein Wesen, dessen Stirn eine geheimnisvolle Leuchtkraft hat.
Wenn sie mit den Hausaufgaben fertig ist, geht sie zur Glühweinbude beim Sessellift. Sie macht das viermal in der Woche. Sie löst die Frau ab, die dort seit dem Mittag hinter dem Tresen steht. Die Frau hat früher in einer Textilfabrik des Krkonoše gearbeitet. Die Textilfabrik hat dicht gemacht, und jetzt verdient sie sich zu ihrer kleinen Rente etwas dazu. Auch Adina verdient sich etwas dazu. Sie reißt einen neuen Zettel vom Kassenblock. Für jeden verkauften Glühwein macht sie mit Kugelschreiber einen Strich. Es gibt auch Becherovka und Slibowicz, für die macht sie einen Stern. Abends herrscht viel Betrieb vor der Bude, Skifahrer mit roten Irokesenkämmen und Hasenohren auf den Helmen, Spaziergänger und Snowboarder. Die Snowboarder tragen auch Helme, aber ohne Schmuck. Ihre Helme sind schwarz oder glänzen metallisch über Gesichtern, die weich und mehlig sind wie der viele Schnee. Die Snowboarder sind älter als Adina. Das bedeutet nicht, dass sie alt genug für Glühwein sind. Adina müsste sie nach ihrem Alter fragen. Aber sie weiß, wie die Snowboarder dann gucken. Sie gucken, als gäbe es in der Bude etwas zu sehen, etwas, das einer Untersuchung unterzogen werden muss wie der Frosch, dem die Jungs in ihrer Klasse die Beine ausgerissen haben, um herauszufinden, was er ohne Beine macht.
Nur einmal hat sie einen Snowboarder gefragt, ob er schon achtzehn ist, an einem ihrer ersten Tage am Glühweinstand. Der Snowboarder hatte einen schwarzen Military-Anzug an, Pusteln auf den Wangen und einen dünnen Oberlippenbart. Seine Kumpel sagten Ronny zu ihm. Zu ihr sagte Ronny nichts. Er grinste, als sie ihm Kinderpunsch gab, und kippte den Punsch in den Schnee. Dann sagte er etwas, das Adina nicht verstand. Seine Kumpel johlten. Sie klopften mit ihren Fausthandschuhen auf seinen Helm und drängelten sich neben ihn an die Theke. Er beugte sich vor und streckte ihr langsam seine Zunge entgegen. Er ließ sie auf- und abflappen wie einen gefangenen Schmetterling, mit derselben Geschwindigkeit, nur viel nasser. Am nächsten Tag kam er wieder. Er baute sich vor ihr auf, pflanzte seine Arme auf die Theke, verlangte Glühwein und flappte mit seiner Zunge herum. Schließlich packte er ihren Arm. Die Borsten auf seiner Oberlippe glitzerten im Budenlicht, als ihr Kopf gegen seinen Helm stieß. Ein feuchter Schlag traf ihre Lippen, und der Becher fiel um. Glühwein spritzte auf Ronnys teuren Skianzug. »Blöde Fotze!«
Das hat Adina verstanden. So viel Deutsch kann sie schon. Sie weiß, dass das Wort hässlich ist, obwohl ein Körperteil, das noch niemand gesehen hat, weder schön noch hässlich sein kann.
Aber vielleicht geht es um etwas anderes. Dass jemand wie Ronny ihr einfach seine Zunge in den Mund stecken kann, hängt vielleicht mit dem zusammen, was die Barkeeper meinen, wenn sie über deutsche Frauen reden. Sie reden oft über deutsche Frauen, manchmal sogar, wenn welche in der Bar sitzen und Cuba Libre durch die Strohhalme ziehen. Die Barkeeper sprechen kein Deutsch. Und die Frauen mit den Strohhalmen wissen nicht, was es bedeutet, wenn die Barkeeper beim Servieren des Cubra Libre grinsend fragen, ob sie glauben, Tschechen seien ein bisschen dumm im Kopf. Gut genug zum Liftsitze unter den Arsch klemmen, zum Dreck wegmachen oder als Sexspielzeug, billig wie die Hörnchen im Potraviny.
Vielleicht hat Ronny gedacht, sie sei ein bisschen dumm im Kopf. Ihre Mutter kann sie nicht fragen. Ihre Mutter will nicht, dass sie Alkohol verkauft. Wer zu jung ist, welchen zu trinken, sollte auch keinen verkaufen, lautet ihre Devise. »Warum triffst du dich nicht mal mit einer Freundin«, sagt sie, wenn sie abends ins Zimmer kommt, um die Jalousie herunterzulassen. »Lad jemanden ein. In deiner Klasse gibt’s doch bestimmt nette Mitschüler.« In der Schule sitzt Adina in der hintersten Reihe. Sie hat keine Banknachbarin. Sie meldet sich selten im Unterricht. Sie findet es albern, auf Fragen zu reagieren, deren Antworten die Lehrerin kennt. Sie ist ein bisschen arrogant. Jedenfalls glaubt Adina, die anderen denken das von ihr, weil sie in den Pausen nie mit ihnen raucht. Sie macht nicht beim Jungsgucken mit und lästert nicht über die Mitschülerin, die noch keinen Busen hat. Sie gehört zu keiner Clique und ist nie für oder gegen jemanden. Sie hat einfach nicht so viel Interesse an den Schülern aus der Stadt.
Touristenkinder kriegt sie leicht herum. Adina kennt die heimlichen Pfade, die Schleichwege am Fluss und den kürzesten Weg durch den Fichtenwald zum Kamm. Sie weiß, wie man mit den Barkeepern umgehen muss, um mittags in der Bar kostenlos Orangensaft zu trinken. Touristenkinder sind für jede Abwechslung dankbar. Adina hat schon so viele kennengelernt, dass sie sie nicht mehr auseinanderhalten kann. Nur manchmal erkennt sie jemanden im nächsten Jahr wieder. Dann führt sie ihn stolz den Barkeepern vor, die eine Runde spendieren zur Feier des Tages. Aber Touristenkinder bleiben nur eine Woche. Eine Woche ist zu kurz, um Freunde zu machen.
Adinas Freunde sind aus Rio. Wenn es vor ihrem Dachfenster dunkel wird und die Umrisse des Čertova hora leuchten vom Schnee, wird es bei ihren Freunden Morgen oder Nachmittag, oder es ist tief in der Nacht. In Rio ist das nicht wichtig. In Rio ist immer jemand, sobald sie den Computer anmacht.
Ihre Mutter lässt die Jalousie herunter, gibt ihr einen Gute-Nacht-Kuss und macht sich auf den Weg ins Zlatá Vyhlídka. Dann ist niemand mehr im Haus. Adina kann ungestört mit ihren Freunden chatten. Sie zieht den Computer auf den Schoß, gibt den Link ein und wartet auf das Schnarren, das sie nach Rio bringt.
Manchmal ist die Verbindung schlecht. Nebel oder Sturm stören das Netz. Sie sitzt im Schneidersitz auf dem Bett, und bis sich der Torbogen nach Rio öffnet, schabt sie mit einem Obstmesser den Lack von den Nägeln. Sie hat den Nagellack heimlich ausprobiert. Aber mit lackierten Nägeln kann sie nicht nach Rio. Dort nennen sie sich Galadriel, ZP oder Darth Vader. Sie ist der letzte Mohikaner, und zum letzten Mohikaner passt kein Nagellack.
Mit ZP unterhält sie sich darüber, ob ein letzter Mohikaner den Stamm überhaupt retten kann. ZP schlägt vor, Kinder zu kriegen, aber sie will keine Kinder. Darth Vader findet, sie sollte alle Feinde ausrotten. Ihr Stamm würde die anderen überleben, und das wäre auch eine Rettung. Aber sie hat keine Feinde. Eine Woche ist zu kurz, um Feinde zu machen.
Außer Ronny.
Auch am vierten Tag kreuzte er vor der Glühweinbude auf. Sie hätte sich gern unsichtbar gemacht. Sie wollte sich ducken, als sie ihn kommen sah. In seinem Military-Look trat er aus dem Schatten der Fichten. Aber wer Striche auf einer Liste macht für jedes verkaufte Getränk, kann sich nicht ducken. An diesem Tag hat sie ihm heimlich Schuss in den Glühwein getan; jede Menge Slibowicz. Für ihn ging die Skisaison vorzeitig zu Ende. Er hätte nicht weiterfahren dürfen. Trotz beleuchteter Piste war er gegen einen Liftmast geknallt.
Den Freunden in Rio kann sie das erzählen. In Rio lassen sich Dinge sagen, die man sonst nicht aussprechen darf. Sie konnte nicht wissen, dass Ronny an einen Liftmast knallt. Aber wenn sie es gewusst hätte, schreibt sie an ihre Freunde, dann hätte sie das mit dem Slibowicz trotzdem getan. Aus Rio kommt ein kleines Teufelsgesicht zurück. »Bleib tapfer, kleiner Mohikaner!«
Darauf ist Adina stolz. In Rio wissen sie, was ihr Name bedeutet. In Rio ist es etwas Besonderes, der letzte Teenager von Harrachov zu sein.
Die blaue Frau ist bei den Bootsschuppen angelangt. In den Schuppen lagern Spanten und Bohlen und Werkzeug zum Reparieren der Boote. Schlösser hängen an den verwitterten Türen, die abgeschlossen sind.
Sie geht mir entgegen. Sie lächelt mich an, ihr Gesicht ist ein einziges Strahlen.
Sie kommt mir bekannt vor.
Das kann nur ein Irrtum sein.
Die Linden vor dem Balkon tragen Früchte, obwohl der Ahorn schon herbstlich bunte Blätter hat. Das ist ein Irrtum der Pflanzen, ein Orientierungsverlust, ausgelöst durch das flache nördliche Licht.
»Komm rein, Sala!«
Eine Regenfront schiebt sich vor die Spitze des Sendemasts. Der Dunst hat das Blinken der roten Warnleuchte geschluckt. An den Plattenbauten sehen die Balkone zum Verwechseln ähnlich aus. Nur die Himmelsrichtung unterscheidet sie. Aber die Wolkenfront löscht auch diesen Unterschied jetzt aus.
»Du erkältest dich!«
Das ist Leonides.
»Sala?«
Leonides mit seiner ruhigen Stimme. Mit seiner Gelassenheit. Der findet, dass Adina ein schöner Name ist. Aber Sala gefällt ihm besser. Sala klingt in seinen Ohren streng und klar, ein Kosename, der gut zu ihr passt, und so, wie er ihn ausspricht, mit stimmlosem S und der Betonung auf dem ersten A, findet sie das auch. Leonides. Der darauf dringt, dass ein Mensch sich vor Kälte schützt. Der darauf gedrungen hätte mit seiner Zimperlichkeit und seiner Fürsorge. »Du wirst noch krank von deinen Abhärtungsmethoden!« Eine Fürsorge, die schwer auszuhalten ist, jetzt, wo sie sich anschmiegen möchte wie an einer wärmenden Wand und er nicht da ist.
Die Bastmatte unter den Füßen ist eisig.
Sie geht zurück ins Warme. Sie macht die Balkontür hinter sich zu, und auf dem Weg ins Schlafzimmer löst sich das Handtuch von ihrem Körper. Nackt steht sie vor dem Kleiderschrank, der halb leer ist, nackt vor Schubladen, die sie nicht braucht. Ihre Hände streichen über ihren flachen Bauch. Sie legt sie auf die frierenden Brustspitzen. Dann zieht sie frische Unterwäsche, eine weiche Hose und einen dunklen Pullover an.
Das ist die Kleidung.
Die Espressokanne steht benutzt auf dem Herd in der Küche. Sie klopft den Kaffeesatz aus dem Sieb, füllt Wasser und neues Pulver ein und wartet auf das Fiepen, mit dem der Dampf aus dem Ventil austritt. Draußen beginnt es zu dämmern. Fahles Licht fällt in Küche und Wohnzimmer und löscht den Nachmittag langsam aus. Sie füllt den Kaffee in die Tasse mit den Großbuchstaben. Im Halbdunkel setzt sie sich an den schmalen Tisch im Wohnzimmer, den sie seitlich vor den Balkon geschoben hat. Beim Hinsetzen klappert das Polster des Stuhls. Der Stuhl ist kaputt. Aber es ist alles da, was sie braucht.
Sie sieht Motion Eye an, die schwarze Linse der Kamera. Dann fährt der Laptop hoch. Sie hat lange gebraucht, aber alles ist da. Sie wird eine Aussage machen. Es gibt eine Organisation, die ihr dabei helfen kann, eine Organisation mit Anwälten und Spendengeldern und einer Adresse im Stadtzentrum. Der Weg durchs Internet ist kürzer als der in die Stadt, dafür muss sie auch nicht die Wohnung verlassen. Die Homepage ist auf Finnisch. Aber jemand, der kein Finnisch kann, kann auf eine britische Fahne klicken, dann baut sich die Seite in Englisch auf. Nicht jemand, denkt sie. Kein Mensch klickt diese Fahne an, nur Frauen. Die Organisation richtet sich an Frauen in Not. Und wenn sie auf die Fahne klickt und die Seite hinabscrollt und unter Kontakt eine E-Mail verfasst, dann wird sie eine von ihnen. Sie wird eine Frau in Not sein. Dabei ist sie nie in ihrem Leben jemals eine Frau gewesen. Jedenfalls hat sie nie auf diese Weise an sich gedacht, kleiner Mohikaner. Sie ist auch kein Mann.
»Nur um das klarzustellen«, sagt sie laut. Aber da ist niemand, der das in Zweifel zieht.
Sie steht noch einmal auf. Im Kühlschrank in der Küche steht der Schnaps. Sie hält Tasse und Flasche im richtigen Winkel, um per Augenmaß einen shot abzumessen. In Not ist sie nicht. Das zu behaupten soll sich erst mal jemand trauen. Vielleicht ist sie das einmal gewesen. Aber da hatte sie kein Internet. Da ist sie auch nicht in einer Wohnung gewesen, für die sie die Miete im Voraus bezahlt hat, bar, mit knackigen Scheinen. Wer in Not ist, kennt keine Organisation, an die man sich wenden kann, keine Notrufnummern, keine Beratungshotlines oder E-Mail-Adressen. In Not hat man keine Zeit, sich im Internet zu informieren.
Sie gießt einen schludrigen Schluck in den Kaffee.
Für eine Organisation, die sich die Not der Menschen zur Aufgabe macht, ist sie eine von vielen. Eine, an die sich niemand erinnert. Erinnern können sich immer nur die, von denen man wünschte, sie täten es nicht.
Und ein Jahr ist eine lange Zeit. Sie hatte schon einmal Kontakt aufgenommen, im Sommer vor einem Jahr, mit dem Vorhaben, eine Aussage zu machen, die sie dann nicht gemacht hat. Weil Leonides dazwischenkam. Weil sie dachte, dass Leonides die bessere Alternative ist.
Weil Leonides die bessere Alternative war.
Leon, flüstert sie. Leo. Mein Le.
Le wie –
Leben. Life. Život.
Das hatte er nicht gemocht.
»Das ist ungesund. Da schwingt viel Selbstverleugnung mit«, hatte er gestelzt formuliert. »Jeder lebt sein eigenes Leben, du deines, ich meines. Sonst gibt es in einer Beziehung keine Gerechtigkeit. Das Pendel schlägt immer nur zugunsten des einen aus.«
Einen ganzen Vortrag hatte er daraus in seiner grünen Küche gemacht. Aber es dauerte nicht lange, und er begann, es zu vermissen. Leo, mein Leben. Er wollte es wieder hören. Er wollte hören, wie sie es sagte, flüsterte Leo, mein Le, wie sie es leise und verliebt in sein Ohr sprach. Er gewöhnte sich schnell daran. Er hatte sogar darum gebettelt, einmal, später, auf einem Ausflug in einen Nationalpark mit N.
Das ist die Erinnerung.
Sie hat das Recht, in der Erinnerung zu sein. Auch wenn sie keine Methode hat, dorthin zurückzukehren. Alles geschieht lose und lückenhaft. Schon der Name des Parks fällt ihr nicht mehr ein. Nuri. Nuxi. Nukso. Finnisch ist eine schwierige Sprache. Aber die Birken und die Nordfichten und die Moore rechts und links der aufgeschütteten Wege sieht sie noch vor sich und Leonides in seinem offenen Hemd.
Es kam nicht oft vor, dass sie zusammen Ausflüge machten. Leonides hatte seine Termine, er hatte einen strikten Arbeitsplan, und sie hatte nichts, nur Leo, und war froh, wenn ihn die anderen nicht brauchten. Er hatte einen freien Nachmittag, oder er hatte sich irgendwo losgeeist, und sie waren mit seinem alten Volvo über eine der dreispurigen Straßen gefahren, auf denen man in Kürze den Stadtrand erreicht. Während der Fahrt drehten sie die Stereoanlage auf und hörten in voller Lautstärke finnischen Pop.
Am Parkplatz vor dem Nationalpark wurden Würstchen gegrillt. In einer Blockhütte gab es Getränke und Mückennetze zu kaufen und Wanderkarten, auf denen die Wege verschiedene Schwierigkeitsgrade hatten. Sie waren mit roten oder gelben Dreiecken markiert, und Leonides entschied sich für einen roten.
Die Sonne spiegelte sich in einem kleinen See, und die offenen Feuerstellen am Ufer spiegelten sich in der Sonne im See, und das Wasser war so kalt, als wäre es gestern erst aufgetaut. Und es gab diesen Geruch, diesen frischen Duft nach Moos und feuchtem Holz und Laub. Sie hätte losrennen wollen mit ihm an der Hand, ihn tief hineinziehen zwischen die Bäume, in das Glück, hier zu sein, ganz normal, Leute, die einen Sonntagsausflug machten. Sie hatte Lust, alles zu sehen, den ganzen Park auf einmal zu erkunden, jeden Felsen, jeden See, ohne eine Abzweigung auszulassen, weil sie ganz sicher zur schönsten Aussicht führte.
Leonides hatte nicht die passenden Schuhe an. Das Leder weichte schnell durch. Dennoch kam er überall hin mit. Die Mücken machten ihm nichts aus, die sie nicht einmal bemerkte. Sie wollte weiter, immer so mit ihm gehen, aber Leonides wurde am Abend gebraucht. Die Zeit war begrenzt. Für einen Kaffee auf der Rückfahrt war es schon zu spät.
»Sag es«, hatte er gedrängt, als sie auf einem Plateau saßen, wo es Wind gab und weniger Mücken. »Nur noch einmal.«
Sie packten die Brote aus.
»Komm. Sag es zu mir.«
»Das ist verboten, Leon.«
»Bitte. Nur hier.«
»Da schwingt so viel Selbstverleugnung mit!«
»Gut. Dann werde ich deinen Namen auch nie wieder sagen.«
»Das musst du auch nicht.«
Er lehnte sich vor und nahm ein Brot aus der Folie.
»Adina, Salina, Sala«, sagte er, als handele es sich um einen Abzählreim.
Er sah aus wie ein Kind, was an der komischen Haltung liegen konnte, mit der er auf den Felsen hockte, ein Bein lang ausgestreckt, das andere angewinkelt und unter den Arm geklemmt. Mit der freien Hand führte er das Brot zum Mund.
»Adina, Salina, Sala.«
Sie hatte die Brote eingepackt. Sie hatte sie auf der grünen Marmorplatte geschmiert, erst Frischkäse, dann Schinken und Salami aufgelegt, in der gleichen Reihenfolge wie ihre Mutter beim Vorbereiten der Brotbüchse für die Schule. Und Leonides biss einfach so hinein. Er aß mit Tempo das erste und das zweite Brot, bevor er die leere Folie sorgsam faltete, als wäre es wichtig, hier nicht zu krümeln. Dabei war es viel wichtiger, etwas dagegen zu tun, dass er so beschäftigt war und ihren Ausflug abkürzte wegen irgendwelcher Leute, nicht dass sie etwas gegen Leute hatte. Aber dass sie schon zurückmussten, war nicht fair. Er hätte bleiben, er hätte sein Telefon nehmen und sagen können, er habe sich den Knöchel verstaucht oder sei ins Moor gefallen und leider sofort erkrankt, aber Leonides kam nicht auf solche Gedanken. Es ist ein Akt der Höflichkeit, hätte er gesagt, dass man sich an Verabredungen hält.
»Adina, Salina, Sala«, wiederholte er, dem Klang der Worte lauschend. »Wie findest du das?« Herausfordernd schaute er sie an. »Sala. Klingt streng und klar, finde ich. So wie du.«
Sie sah zu, wie er die Folie im Rucksack verstaute. Dann kniete sie sich hinter ihn auf den Felsen und schob ihre Hände unter sein Hemd.
»Leon«, sagte sie leise. »Leo, mein Le.«
Aber das kann sie nicht in die E-Mail schreiben.
Als die blaue Frau auftaucht, ist niemand am Hafen. Keine Segler. Auch Badende sieht man nicht. Keine Familie, die am Strand ihr Picknick zusammenpackt. Nur sie. Sie trägt einen knöchellangen hellen Wildledermantel, schwarze Stiefel mit Blockabsätzen und ein blaues Tuch.
Sie hebt eine Hand. Sie winkt mir zu, sie meint mich. Es sieht aus, als hätte sie mich erwartet.
Wir setzen uns in den Schatten der Birken und beginnen ein Gespräch. Wir reden vom Wetter. Über die Wettervorhersagen im Radio, die länger als die Nachrichten sind. Niederschlagsmengen und Windstärken gibt man für jede Schäreninsel bekannt, gefolgt von Warnungen für Landesteile, in denen das finnische Militär Manöver abhält. Eine Verbindung von Wetter und Krieg, wie sie das Wort Kugelhagel nahelegt, als wäre beides von derselben Unabdingbarkeit. Es fällt mir schwer, das Wort Kugelhagel ins Englische zu übersetzen.
Hail of bullets, sagt die blaue Frau. Shower of shots. Sie habe ein Faible für Sprachen.
Ich vergleiche den finnischen Wetterbericht mit den Staumeldungen im Deutschlandfunk. In Finnland, sagt die blaue Frau, sei das Wasser das Einzige, was sich staue.
Wir reden über die Klimaerwärmung. Die längeren Sommer im Norden, den heftigen Sturm. Über Bäume und über die Birke, diese Außenseiterin unter den Laubhölzern, ihren geschmeidigen Stamm. Über Bäume zu sprechen bedeute, über Untaten zu schweigen. So habe es ein toter deutscher Dichter einmal formuliert.
Heute, entgegnet die blaue Frau, schließe das die Bäume ein.
Sie redet über Bücher, die sie gelesen hat. Manche kenne ich, andere nicht. Eingeprägt habe sich ihr von den Deutschen nicht Brecht, nicht der mit den Bäumen, sondern Tucholsky. Berührt hätten sie allerdings Romane von Monika Fagerholm und Carson McCullers.
Ich erwähne mein Vorhaben, einen Roman zu schreiben. Gewöhnlich verschweige ich Fremden, dass ich Schriftstellerin bin. Aber die blaue Frau möchte wissen, was mich nach Helsinki bringt, und in Helsinki nahm die Idee zum Roman vor zwei Jahren Form an. Ich erzähle ihr vom Wissenschaftskolleg in der Fabianinkatu, wo ich Stipendiatin war, von der großen Tageslichtlampe im Aufenthaltsraum und den beiden Masseuren Tuomas und Hariis, die die Fellows am Kolleg einmal im Monat kostenlos massieren.
Es freue die Finnen, sagt die blaue Frau, wenn man sich für ihr Land interessiere.
Ihr Englisch ist tadellos. Ob sie selbst Finnin ist, ist schwer zu sagen. Ich spreche sie nicht darauf an.
Ich rühme die Bibliotheken mit ihrer freundlichen Architektur, ihrer offenen Atmosphäre, die mir gefallen, nachdem ich früher immer einen Bogen um Bibliotheken machte, mit ihrer Düsterkeit, den Sprechverboten, dem elitären Staub. Hier sei das anders. Manchmal gehe ich nur dorthin, um die Zeitung zu lesen, die Dagens Nyheter, den Guardian, Die Zeit.
Wir reden über das, was in den Zeitungen steht, was uns düster erscheint in Europa. Sie ist gut über alles informiert.
»Du solltest dich auf den Weg machen«, sagt sie, als es dunkel wird.
Der Kaffee in der Tasse mit den Großbuchstaben ist kalt. Im Wohnzimmer hängt schwach der Widerschein der Straßenlampen. Dear Ladies and Gentlemen leuchtet ihr auf dem Bildschirm entgegen. Sie liest die Anrede laut, bevor sie and Gentlemen wieder löscht. My name is Adina Schejbal. I’m sorry. I’m really sorry. But something came in between.
Das Wort interfere fällt ihr ein, denn etwas ist dazwischengekommen, seit sie die erste kurze E-Mail an die Organisation vor einem Jahr geschrieben hat. Aber auf der Übersetzungsseite im Netz hat interfere etwas mit hindrance und obstacle zu tun, und verhindert hat Leonides nichts. Hindernisse gibt es nur in der Sprache. Wenn sie nervös ist, gehen ihr die englischen Vokabeln aus, die sie in der Schule gelernt hat, weshalb sie mit Leonides manchmal in russischen Brocken oder gleich mit Händen und Füßen spricht.
Gesprochen hat.
Der Schatten des Flugzeugs fliegt über die silberne Welt. Das Flugzeug schickt den Schatten für eine halbe Minute voraus, bevor es ihn einholt und überfliegt. Die Zeit umrundet den Globus. Dort, wo sie sich aufhält, ist es kurz vor acht. Die Wolken sind im Dunkel verschwunden.
Hell leuchtet der Monitor. Frauen strahlen sie an. Frauen in hohen Räumen vor Bildern und Blumen. Unzählige Fotos bezeugen die Arbeit der Organisation, als hätten sie dort extra jemanden angestellt, der sich nur mit dem Hochladen der Fotos befasst. Auf einem Bild halten zwei Frauen eine Urkunde in die Kamera, lächelnd, ein Lächeln für Menschen in Not, ein munteres Lächeln, eines, das Hoffnung machen soll und Mut. Nur eine der Frauen auf den Fotos ist älter. Sie hat eine weiße Haube auf, wie sie Enten haben oder Nonnen. Die Nonne lächelt nicht. Aber ihre Augen leuchten. Es sind gute Augen. Vor solchen Augen legt man gern die Beichte ab, auch wenn man nicht an Gott glaubt. Es ist nicht auszuschließen, dass ein Glaube etwas bewirkt, dass er Berge versetzt, die es in der platten Landschaft vor dem Fenster gar nicht gibt. Nur wenn man nichts zu beichten hat, ist selbst eine gute Nonne die Falsche.
Sie klickt die Seite weg und gerät auf eine Wetterseite mit Warmluftfronten und Hochdruckgebieten. Auch hier ist alles voller Hoffnung, weil schöne Aussichten die Besucherzahlen erhöhen.
Als es klingelt, ist sie zu erschöpft, um sich zu erschrecken.
Es dauert eine Weile, ehe sie das Klingeln an der Tür und die Wohnung, in der sie sich befindet, in einen Zusammenhang bringt. Es könnte die Klingel des Nachbarn sein. In Plattenbauten sind alle Klingeln gleich. Die Wohnungstüren gleichen sich, und zwischen dem Schrillen ihrer Klingel und dem des Nachbarn gibt es keinen Unterschied. Sicher ist sie nicht, weil sie in den Tagen, die sie hier wohnt, noch nie an ihrer eigenen Tür geklingelt hat.
An den Klingelschildern stehen finnische Namen, auch bei ihr.
Das Licht der Peitschenlampen schlägt in die Nacht. Sie kontrolliert, ob die Verbindung noch da ist, manchmal stürzt das Internet ab. Die Datenübertragung ist langsam, ein mobiler Zugang, den sie überall benutzen kann. Auch das ist ein Geschenk von Leonides, das erste. Er hatte den Stick mitgebracht. Er hatte ihn ihr geschenkt, drei Monate, acht Tage und achtzehn Stunden nach ihrer Ankunft in Helsinki.
Leon, mein Le.
Der eines Abends in der Hotellobby saß, auf einem der plüschigen Sofas, umringt von Männern in Anzügen und einigen wenigen Frauen. Sie sahen wie Geschäftsleute aus, wie Banker oder Anwälte, und unterhielten sich auf Englisch. Nur wenn es Gelächter gab, war Russisch zu hören. Dann hatte jemand einen Witz gemacht. Witze gingen besser auf Russisch. Sie stand hinter der Bar. Sie spülte Gläser, und es wurde spät, was an Leonides lag, aber das wusste sie damals noch nicht.
Der Barkeeper hatte Schluss gemacht. Nur sie war noch da. Sie servierte frische Drinks, füllte die Gläser nach, stellte Schalen mit Erdnüssen auf die Tische. Es war nicht das erste Mal, dass sie den Tresen bewachte, bis der letzte Gast gegangen war.
Er winkte ihr zu, als wollte er eine neue Runde bestellen. Eine fast leere Flasche Wein stand vor ihm auf dem Tisch. Er war der Einzige, der Weißwein trank. Die anderen tranken Bier und Vodkatini.
»How kind of you not to leave us alone!«
Er sprach mit einem leichten Akzent. Aber seine Aussprache war klar, auch nach einer ganzen Flasche Wein.
»Please. Feiern Sie mit!«
Sie wehrte ab.
»In Brüssel gab es heute eine wichtige Debatte. In Zukunft wird sich der Westen nicht mehr aufführen können wie der Hüter des Heiligen Grals.«
Sie hätte gern ein Tablett mit Gläsern in der Hand gehalten. Sie hätte gern etwas zu tun gehabt und stand hilflos vor dem Sofa.
»Kommen Sie, stoßen Sie mit uns an! Zweihundert Jahre als Menschen zweiter Klasse zu leben waren zweihundert Jahre zu viel.«
Einige nickten.
»Apropos Hochmut des Westens.« Er wandte sich wieder den anderen zu. »Neulich saß ich mit diesem Kollegen an der Bar. Netter Typ. Hab seit Jahren mit ihm zu tun. Wir treffen uns auf denselben Meetings, sitzen in denselben Bars. Und da schaut er mich auf einmal an, als sähe er mich zum ersten Mal. Plötzlich kommt es ihm ganz erstaunlich vor, dass ich Englisch rede wie er. Dass ich wie er etwas von Wein verstehe, Bach und Dylan höre und weiß, was am Sinai passiert ist. Nach all den Jahren geht ihm auf, dass ich aus demselben Holz geschnitzt bin wie er. Er meinte es nett, ein gebildeter Kollege aus dem Westen Deutschlands. Und auch deshalb, meine Freunde, ist die Erklärung des Europarats vom letzten Jahr so entscheidend. Zwanzig Jahre nach Ende des Kalten Krieges muss endlich Schluss sein mit der fatalen Hierarchie unter Europäern.«
Das sagte dieser Mann in einem dunkelblauen Anzug nachts um zwei in der Lobby eines Helsinkier Hotels, in dem sie seit drei Monaten in einem Abstellraum hauste.
Als sie sich umdrehte, um zum Tresen zurückzugehen, legte er seine Hand auf ihren Unterarm, nur leicht. »Verstehen Sie sich als Europäerin?«
Darüber hatte sie nie nachgedacht. Und auch jetzt dachte sie nicht darüber nach. Sonst hätte er als Nächstes wissen wollen, woher sie kam und was sie hier machte, was für ein Akzent das war, mit dem sie sprach, denn das war kein astreines Englisch, das hörte jeder, und ein finnischer Akzent war es auch nicht.
Er hatte die Frage freundlich wiederholt. Und da nickte sie. Sie war auf dem europäischen Kontinent. Sie war auf diesem Kontinent geboren. Sie hatte einen Teil dieses Kontinents überquert. Sie hatte drei Grenzen zwischen vier europäischen Ländern gekreuzt, im Bus, zu Fuß, mit einer Fähre, als Schwarzfahrerin, per Anhalter und schließlich mit einem regulären Ticket in einem Zug, der weit nach Mitternacht am Hauptbahnhof von Helsinki angekommen war, wo sie bis zum Morgengrauen auf einer Bank kampiert hatte, ehe sie nach einer Katzenwäsche auf der Bahnhofstoilette losgezogen war, um sich einen Job zu suchen. Sie hatte mehr von diesem Kontinent gesehen als jeder andere in dieser Lobby, ob es Banker oder Anwälte oder sonst was waren.
»Wunderbar!«, rief Leonides. »Wir rätseln nämlich, was eine Europäerin heutzutage am nötigsten braucht.«
Er schaute sie an, als wäre ihre Antwort entscheidend für den Europarat. Als wäre, was sie zu sagen hatte, richtungsweisend für das weitere Leben jedes Einzelnen auf den Plüschsofas der Lobby. Sein rechtes Ohr leuchtete unter den dünnen Haaren hervor, und etwas an diesem feuerroten Ohr brachte sie dazu, das Rätsel ohne langes Nachdenken zu lösen.
»Sie braucht eine gute Verbindung. Ich meine ins Netz. Sie muss sich vernetzen.«
Leonides hatte sein Glas gehoben, Weißwein aus der Bretagne, ein Muscadet von der Loire, und ihr anerkennend zugenickt. Vielleicht hatte er sie da bewusst wahrgenommen, hatte sie unterschieden vom Hotelpersonal, das gut war für nächtliche Bestellungen und am nächsten Tag vergessen wie der Großteil einer solchen Nacht.
»Wie kommt es, dass ich Sie hier noch nie gesehen habe?«
»Jetzt haben Sie mich gesehen.«
»Das stimmt.«
Zu ihrer ersten Verabredung schenkte er ihr einen Stick.
Die blaue Frau ist die Anhöhe hinaufgegangen, die vom Ufer zur Straße führt. Sie steht am Eingang der Unterführung.
Vor ihrer hell umrissenen Gestalt bricht das Dunkel des Tunnels jäh ab.
Sie schaut mir entgegen.
Ich frage sie, ob sie in der Nähe wohne. Ob sie oft am Hafen sei.
Die Geste, die ihre Antwort begleitet, beschreibt einen Kreis, keine Richtung.
Sie komme gern hierher. Das Klirren der Segelstangen, das Schreien der Möwen, der Geruch nach Teer, das gefalle ihr. Nur hier könne sie mit mir reden, zwischen den Schienen, den Schuppen und der Badestelle am Ufer, an der eine Bank aufgestellt ist.
Zu ihrer ersten Verabredung stand sie in einer menschenleeren Straße, in einer Gegend, in der sie nie zuvor gewesen war. Sie hatte einen Zettel dabei mit dem Namen und der Adresse des Restaurants, in dem sie verabredet waren. Aber das Restaurant gab es nicht. Sie ging bis ans Ende der Straße. Rechts und links lagen mehrere Restaurants, alle hießen Ravintola. Ein Ravintola hatte stuckverzierte Türbögen. Ein anderes sah aus wie ein Pub, und die Fassade eines weiteren glich einer Burgmauer. Keines trug den Namen, der auf ihrem Zettel stand. Sie lief zur Kreuzung zurück, um die Straßennamen zu vergleichen. Sie war richtig.
Es überraschte sie nicht, dass etwas, das auf einem Zettel stand, nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmte. Aber der Zettel mit seiner Handschrift war das Einzige, was sie zu diesem Zeitpunkt von Leonides besaß. Sie wusste nicht, dass er immer in diesem Hotel abstieg, dass er jedes Mal, wenn er nach Helsinki kam, im selben Hotel ein Zimmer buchte, weil dieses Hotel sein liebstes war.
Es war noch früh am Abend. Das Laub der Bäume leuchtete im späten Licht. Sie kannte sich in dieser Stadt nicht aus. Sie wusste nichts von finnischen Gebräuchen. Sie hatte keine Ahnung, was ein Zettel mit einer Adresse bedeutete, was es in diesem Land bedeutete, wenn ein Mann nachts um zwei etwas auf einen Zettel schrieb. Sie arbeitete schwarz als Aushilfe. Sie händigte Zimmerschlüssel aus, sie leerte Mülleimer, bezog Betten, gab Auskünfte zu Preisen und Frühstückszeiten und dem Bedienen des Kaffeeautomaten. Sie trug eine weiße Schürze über einer schwarzen Bluse, die Uniform des Personals.
Vielleicht hatte sie ihn missverstanden. Vielleicht war er betrunken gewesen, manchen merkte man das Betrunkensein nicht an. Oder er hatte ihr absichtlich eine falsche Adresse gegeben. Er hatte nicht vor, die Aushilfe wiederzusehen, die Aschenbecher leerte und Gläser spülte. Es war ein Zeitvertreib gewesen. Eine Show vor großer Runde in den plüschigen Sofas eines teuren Hotels, die ihm die Genugtuung verschaffte, noch im Rennen zu sein. Er hatte sie benutzt.
Diese Verzweiflung in deinem Blick, hatte er später gesagt, die muss der Mensch erst mal akkumulieren!
Es klingelt an der Wohnungstür. Das Schrillen geht durch Mark und Bein.
Die Verzweiflung, nicht für voll genommen zu werden, hatte Leonides auf der menschenleeren Straße gesagt, die kenne ich gut. Du bist für die anderen einfach nicht da.
Im Treppenhaus steht jemand, der zu wissen scheint, dass sie da ist, dass sie hier in der Wohnung sitzt und das Klingeln hört. Er hat sie hineingehen sehen und wird nicht aufhören, zu klingeln, bis sie aufsteht und öffnet. Sie legt ihre Hände flach auf den Tisch.
Das ist die Angst.
Sie konzentriert sich.
Sie muss nicht an die Tür gehen. Sie braucht nicht aufzumachen. Sie hat das Recht, auf ein Klingeln nicht zu reagieren, so wie sie das Recht hat, in dieser Erinnerung zu bleiben, auf der unbekannten Straße im Stadtzentrum, wo es mehr Ravintolas gibt, als man braucht, und von denen eines schließlich das richtige war.
Im Ravintola auf der gegenüberliegenden Straßenseite hatte Lenin ein Bier getrunken, vor mehr als hundert Jahren, bevor er losgefahren war zur Revolution. Das hatte Leonides gesagt, als er aufgetaucht war. Lachend trat er aus dem Häuserschatten ins letzte Tageslicht.
»Die Leber machen sie dort gut«, sagte Leonides. »Aber ich dachte, du bist vielleicht kein Freund von Leber.«
Sie war kein Freund von Leber, und er hatte sie ins Ravintola mit der Stuckverzierung geführt, zu einem Platz am Kamin. Es war ein Gaskamin mit Scheiten aus Keramik.
»Lenin? Ist das wahr?«
»Auf ein letztes Glas Bier, bevor er den Winterpalast stürmte.«
»Oder erzählt man das nur den Touristen?«
»Es gibt noch den Tisch, an dem er gesessen hat. Aber man stellt ihn nicht mehr aus. An Kommunisten, vor allem russische, wird man hier nicht gern erinnert. Der Tisch steht im Keller. Wenn du willst, lassen wir ihn uns zeigen.«