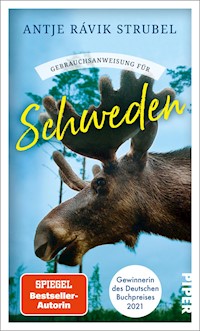Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Wallstein Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Der fremde Ort, die fremde Sprache können zum Schlupfloch werden. Und das ist Literatur im besten Fall auch: Der verlässlichste aller Fluchtwege." Was machen fremde Orte mit uns und was machen wir an fremden Orten? Welche Rolle spielen Orte in der Literatur? Das sind einige der Fragen, die sich Antje Rávik Strubel beim Schreiben stellt. Erst in der Fremde nehmen ihre Romane Gestalt an. Figuren wie die blaue Frau begegnen Strubel in Gegenden, die ihr fremd sind, an denen sie sich nicht wiedererkennt. Die Romanwelten, die so entstehen, sind mehr als bloße Abbildungen der Realität. Manchmal ist es erst die Orientierungslosigkeit, die ein anderes Sehen ermöglicht, eine Befreiung vom Alltäglichen, Gewohnten, Erlernten. Die Welt steht Kopf. In ihren im Februar 2023 gehaltenen Lichtenberg-Poetikvorlesungen in Göttingen setzt sich Antje Rávik Strubel mit den Voraussetzungen des eigenen literarischen Schaffens auseinander. Sie zeigt, wie aus Lebensgeschichte ästhetisches Material wird, wie sich Erfahrung poetisch übersetzen lässt und fragt außerdem danach, wie politisch Literatur heutzutage sein kann oder sogar sein muss. Im Zwiegespräch mit großen Geistern der Literatur erkundet sie die eigenen Pfade, die, wenn das Schreiben gelingt, auf einen Wahrnehmungswandel hinauslaufen und auf die Erweiterung unserer Empathie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 69
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Antje Rávik Strubel
Nah genug weit weg
Inhalt
Titel
Nah genug weit weg
Anmerkungen
Impressum
Nah genug weit weg
Marstrandsö ist eine kleine, an einer Meerenge gelegene Insel, dreißig Kilometer nordwestlich von Göteborg. Die Insel gehört zum Schärengarten der schwedischen Westküste. Glatte Felsen säumen die Ufer. Vom Hafen führt ein von Bäumen gesäumter Paradeweg hinauf zum Grandhotel, einer Holzvilla aus der vorletzten Jahrhundertwende mit einer großen, sonnigen Veranda. Ich bin dort zum Saisonende, kurz nach der Buchmesse in Göteborg, einer der letzten Gäste. Es ist windig. Die Vogelbeeren sind reif. Im Hafen gibt es ein teures, weißes Restaurant. Und es ist dort, wo ich im Klirren der Segelstangen auf einmal von der Existenz der blauen Frau weiß. Eine Freundin begleitet mich, und als das späte Nachmittagslicht, von den Wellen reflektiert, in ihre Augen fällt, sage ich: »Die blaue Frau taucht auf und spricht mit mir. Nichts weiter. Sie kommt zu mir, und wir unterhalten uns, und das ist schon das ganze Buch.«
Damals, im Herbst 2011, suchte ich nicht nach einem Thema. Sturz der Tage in die Nacht war gerade erschienen. Ich war nicht getrieben. Hatte keine Not. Im Roman selbst ist Marstrandsö nicht zu finden.
Auf Lesungen erzähle ich eine andere Version. Ich erzähle von Helsinki. Auch dort ist es Herbst. Der Herbst 2012. Auch dort gibt es einen Hafen. Er liegt jenseits der dreispurigen Schnellstraße, die das Plattenbauviertel umgibt, in dem ich eine kleine, praktisch eingerichtete Wohnung gefunden habe. Das Laub der Birken leuchtet, wenn ich durch die Unterführung gehe, um zur Ostseebucht und zum kleinen Fischerhafen zu gelangen. Dort begegne ich ihr zum ersten Mal. Die blaue Frau spricht zu mir. Oder vielmehr: ein Zwiegespräch entwickelt sich in meinem Kopf, Sätze, die ich mir bei meiner Rückkehr sofort notiere. Und mit der Zeit wird die blaue Frau zu dem, was Sprache im besten Sinne sein kann: einem Ort, an dem ich aufgehoben bin. Eine Gegenwärtigkeit, die sich aus dem Fließen, dem Flüchtigen, dem alltäglichen Dahintreiben heraushebt wie eine, ja, wie eine Insel. Eine Insel der Konzentration, der Intensität.
Beide Versionen stimmen. Entscheidend, Sie werden es ahnen, sind die Orte, die mit dem Ereignis verbunden sind.
Lassen Sie mich von vorn anfangen.
Ich bin in einer Kleinstadt aufgewachsen. Ludwigsfelde ist eine Arbeiterstadt, um ein Autowerk herum errichtet, in dem einmal Flugzeugmotoren, später Mopeds hergestellt wurden, in meiner Kindheit Lkws. Die Lkws waren für Angola oder Nicaragua bestimmt, Bruderländer, in die die Arbeiterinnen und Arbeiter nie kommen würden. Wir schwammen nicht im Karibischen Meer, wir badeten in Kiesgruben. Dieselben Kiesgruben, in denen die NVA-Offiziere des nahe gelegenen Armeegeländes zuweilen ihre Panzer wuschen. Wir schrubbten uns den Schlamm der Bohrmilch von den Händen, die bei den alle vierzehn Tage anfallenden Einsätzen in der Produktion aus einem Schlauch an der Bohrmaschine rann und unter den Fingernägeln von uns Neunt- und Zehntklässlern klebte, eine weiße, ölige Paste. Wir wuschen uns den Geruch der braunen Haarnetze vom Kopf, die verhindern sollten, dass die Bohrer der großen Maschinen eine Haarsträhne erwischten, die sich im rotierenden Gewinde verwickeln und uns skalpieren würde.
Ich schreibe »wir«. Und es gab ja auch ein Klassenkollektiv, eine FDJ-Gruppe, zu denen ich gehörte, es gab Sportvereine und eine Patenbrigade; ein Arbeitskollektiv aus dem Autowerk, Bandarbeiter. Nur lässt Zugehörigkeit nicht automatisch auch ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, nicht ein Gefühl der Wärme, der Zuneigung, des Aufgehobenseins. Wenn ich heute an die Vierzehn-, Fünfzehn-, Sechzehnjährige denke, die ich damals war, sehe ich sie allein. Nicht ohne Menschen um sie, sie beteiligte sich an Arbeitsgemeinschaften, an Kreis- und Bezirksmeisterschaften der Leichtathletik, marschierte auf Befehl in der Kolonne im gefleckten Tarnanzug durch die Stadt, um die Verteidigung der sozialistischen Heimat zu üben. Es gab ein oder zwei Schülerinnen in der Klasse, mit denen sie an der Tischtennisplatte hinter der Schule abhing. Aber in diesen Beziehungen blieb sie, wie auch Jahre später noch in vielen anderen, auf Abstand.
In Ludwigsfelde sehe ich sie allein mit einem Willen, der größer ist als sie. Der Wille, über Grenzen zu gehen. Womit zunächst eine sehr konkrete gemeint war: die Mauer.
Sie legte sich nicht fest, auf niemanden, gehörte keiner Clique an, besuchte keine Discos, und die wenigen Male, wo sie es doch tat, weil sie gern tanzte, hielt sie es nicht lange aus. Sie hatte keine Zeit, jung zu sein. Damals hätte sie gesagt, sie habe keinen Nerv dafür. Das Flüchtige, rein Äußerliche ihrer Beziehungen beruhte auf der Überzeugung, dass alles dort, das Autowerk, die Bohrmilch, die Plattenbauten, die Kiesgruben und auch die Klassenkameradinnen nicht das Eigentliche waren, nicht das Leben. Wo der Besitz eines Mopeds ein Höchstmaß an Freiheit bedeutete und hauptsächlich Jungs solche Mopeds besaßen – Mädchen fuhren auf dem Sozius mit –, legte sie sich mit sechzehn eine 150er-MZ vom »Einheitstyp Zschopau« zu, die schon zur Klasse der Motorräder gehörte. Obwohl sie damit auch nicht weiter als bis Sputendorf kam, zeigt sich bei aller Naivität doch deutlich, dass ihr Verhalten einer gewissen Arroganz nicht entbehrte. Sie schien zu glauben, etwas Besseres zu sein. Das Einzige, was ich heute zu ihrer Entschuldigung sagen kann, ist Folgendes:
Der Drang, sich davonzumachen, so vage das Ziel auch war, hatte schon früh eine so übermächtige Kraft, dass sich ihm alles unterordnen musste, auch die Fähigkeit, tiefere Freundschaften einzugehen. Begünstigt wurde dieses Nicht-Verortetsein am Ort von Kindheit und Jugend durch zwei Dinge. Die Wochenenden, die die Familie auf dem achtzig Kilometer entfernten Grundstück im Havelland verbrachte, waren eine Flucht in eine Gegenwelt – eine Gegenwelt zu Sozialismus und Autowerk, eine Welt des Gartens, des Gärtnerns, des ungestümen Verwilderns, ein Ungebundensein, das so illusorisch war wie klar begrenzt; eine klassische Heterotopie. Und, zweitens, Eltern, die außerhalb von Ludwigsfelde arbeiteten, nicht im Autowerk; der Vater an der Universität in Potsdam, die Mutter als Ingenieurin bei Interflug in Berlin-Schönefeld, die sich also unterschieden von fast allen Eltern in der Schule. Nicht von ungefähr, wie mir heute scheint, denn zumindest im mütterlichen Elternhaus hatte es Distinktionsmerkmale gegeben, die sich, nachdem die Weberei der Großeltern im sächsischen Meerane längst enteignet war, weniger klassistisch als sozialismuskritisch oder eher sozialismusbockig äußerten.
Sicherlich schwante mir schon damals, dass diese Abschottung vom Herkunftsort ihren Preis haben könnte. Doch ich besaß dieselbe Zuversicht, die auch Joan Didion als junge Frau besessen haben musste. Denn »wenn Sie zweiundzwanzig oder dreiundzwanzig sind«, schreibt sie in ihrem großen Essay Das Spiel ist aus, »denken Sie sich, dass Sie später eine große emotionale Stabilität besitzen und in der Lage sein werden, den Preis zu zahlen, koste es, was es wolle«.
Was mich mein Weggehen zunächst kostete, war die Überzeugung, dass die Welt woanders nicht überwiegend aus Kiesgruben bestand, nicht überwiegend aus Frauen, die auf dem Sozius von Mopeds sitzen, nicht aus Bohrmilch und Brüdern und Stillstand am laufenden Band. Der Verlust dieser Überzeugung führte nun nicht etwa dazu, die Flinte ins Korn zu werfen und nach Ludwigsfelde zurückzukehren, um dort ein genügsames Leben zu führen. In mir erwachte vielmehr der Wunsch, mich erstmal von allen Überzeugungen zu lösen. Das Netz aus Sozialisation, aus Erlerntem und Erfahrenem zu zerreißen, soweit das möglich war. Mich irritieren zu lassen. Mir Orientierungslosigkeit zu erlauben, selbst auf die Gefahr hin, vor dem blanken Nichts zu stehen. Mich dort aufzuhalten, mich dort auszuhalten. Um eventuell anders sehen zu können. Um anders zu sehen und das so Gesehene in Sätze zu bringen, die Fluchtwege sein können aus den Kiesgruben dieser Welt.
So ein Vorhaben wird wesentlich erleichtert, wenn sich zum einen die Realität selber gerade auf den Kopf stellt, wie es mit dem Mauerfall geschah. Mit achtzehn ging ich aus Ludwigsfelde nach Berlin, zunächst nach Steglitz in Westberlin. Und ich erinnere mich an einen Augenblick in der U-Bahn, als ich versuchte, den Spiegel zu lesen. Ich las und las, und mit dem Eintauchen der oberirdisch verkehrenden Bahn zurück ins Dunkel begriff ich, dass alles, was ich las, in ein ähnliches Dunkel fiel. Die Worte bedeuteten mir nichts. Ich verstand keine einzige Zeile dieses westdeutschen Nachrichtenmagazins, obwohl ich des Deutschen mächtig war. Noch das Zeitunglesen wollte neu gelernt sein.