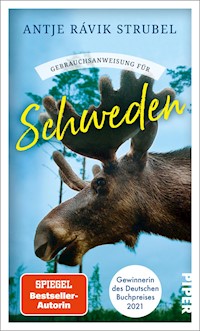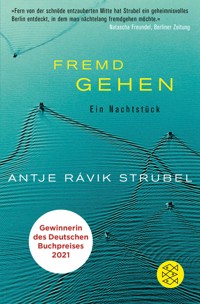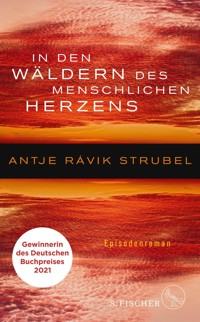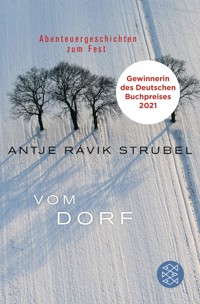9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Geschichte einer faszinierenden deutsch-deutschen Liebe in New York. 1987 ist sie weggegangen aus ihrem Land, weil sie mehr Freiheit brauchte, als es dort gab. Aber bei dem Mann, den sie angeblich heiraten wollte, traf Christiane nie ein. Stattdessen lebt sie illegal in New York und schlägt sich als Kellnerin durch. Dann begegnet sie Jeff, der sie an ihren eigentlichen Ehrgeiz und ihre Begabung erinnert. Unter großen Opfern bauen sie eine Experimentierbühne auf. Acht Jahre später hat sich alles geändert: Die Mauer ist weg. Auf der Suche nach einem wahrhaftigen Bild kommt die Fotografin Leah aus Westdeutschland nach New York. Als sie der eleganten Amerikanerin Jo begegnet, springt der Funke des Begehrens blitzartig über. Aber die Amerikanerin umgibt ein Geheimnis. Sie lässt sich nicht fotografieren. Immer wieder verschwindet sie hinter den Kulissen eines Theaters im Village. Sind die Amerikanerin Jo und Christiane ein und dieselbe Person? Beharrlich entzieht sie sich Leahs Werben, auch wenn ihr das Doppelleben bald unmöglich wird. Die Entwicklung holen Christianes Geheimnisse ein, und mit der Freiheit zu vergessen findet Leah schließlich ein Bild, das bleibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ANTJE RÁVICSTRUBEL
Offene Blende
Roman
Über dieses Buch
Die Geschichte einer faszinierenden deutsch-deutschen Liebe in New York.
1987 ist sie weggegangen aus ihrem Land, weil sie mehr Freiheit brauchte, als es dort gab. Aber bei dem Mann, den sie angeblich heiraten wollte, traf Christiane nie ein. Stattdessen lebt sie illegal in New York und schlägt sich als Kellnerin durch. Dann begegnet sie Jeff, der sie an ihren eigentlichen Ehrgeiz und ihre Begabung erinnert. Unter großen Opfern bauen sie eine Experimentierbühne auf.
Acht Jahre später hat sich alles geändert: Die Mauer ist weg. Auf der Suche nach einem wahrhaftigen Bild kommt die Fotografin Leah aus Westdeutschland nach New York. Als sie der eleganten Amerikanerin Jo begegnet, springt der Funke des Begehrens blitzartig über. Aber die Amerikanerin umgibt ein Geheimnis. Sie lässt sich nicht fotografieren. Immer wieder verschwindet sie hinter den Kulissen eines Theaters im Village. Sind die Amerikanerin Jo und Christiane ein und dieselbe Person?
Beharrlich entzieht sie sich Leahs Werben, auch wenn ihr das Doppelleben bald unmöglich wird. Die Entwicklung holen Christianes Geheimnisse ein, und mit der Freiheit zu vergessen findet Leah schließlich ein Bild, das bleibt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Die Erstausgabe erschien 2001 im Deutschen Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Covergestaltung: bürosüd, München
nach einer Idee von Balk & Brumshagen
Coverabbildung: Martin Rieger
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-490276-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Motto
Prolog
ONE Jahrestage
TWO Auf eigene Hoffnung
THREE Wie der Stahl gehärtet wurde
FOUR Über Fotografie
FIVE Neuland unterm Pflug
SIX Ästhetik des Verschwindens
SEVEN Blow up
EIGHT Die helle Kammer
NINE Links, wo das Herz ist
TEN Was bleibt
ELEVEN Guten Morgen, du Schöne
TWELVE Passagen
Förderung durch Kulturfond
In Erinnerung an Steffi Schneider
1942–1990
»Wirkliches Licht zieht sich bei der
Erinnerung an Licht zurück.«
Column McCann
Prolog
Wenn das Mädchen das rechte Bein etwas hochzieht, kann es unter sich die Furchen des Weges sehen. Der Boden ist gefroren und knirscht unter den Tritten des Tieres, der Esel schiebt Atemwolken vor sich her.
Das Mädchen weiß, daß man es nicht allein reiten lassen wird, obwohl der Waldweg zu beiden Seiten von Holzplanken abgesichert ist und der Esel diesen Weg öfter am Tag geht.
Die Türme der Wartburg sind schon von der Verleihstelle der Esel unten am Parkplatz aus zu sehen. Während des Ritts auf den Miet-Eseln jedoch bleibt die Burg verschwunden, und selbst im Winter, wenn alles Laub von den Bäumen gefallen ist, sieht man die Wartburg erst wieder, wenn man direkt davorsteht.
Die Eselswärter am Parkplatz tragen Wattejacken und sprechen wenig, als könnten sie die Kälte so aus sich heraushalten. Sie wissen genau, daß sie von den Tieren und den Leuten gebraucht werden, es gibt sonst keine Burg, die man mit einem Esel erreichen kann. Das gefällt ihnen. Sie kümmern sich vor allem um den Zustand der Tiere. Sie haben ihnen abgewetzte, karierte Decken über die Rücken gelegt und sie in einer langen Reihe an den Holzzaun gebunden, wo sie Gras aus den Kiepen reißen. Die Köpfe der Tiere gehen dabei ruckartig zur Seite, und die Männer lassen ihnen beim Fressen Zeit. Ständig kommen Leute vom Parkplatz herüber. Sie haben schon eine lange frierende Schlange vor dem Kassenhäuschen gebildet, in der es keine Bewegung zu geben scheint, obwohl es aussieht, als würden die Tierwärter in regelmäßigen Abständen den vordersten Esel losbinden. Die Leute trampeln mit den Füßen den Boden, schlagen die Hacken gegeneinander und haben die Köpfe in die Mantelkragen hineingezogen. Wenn es endlich soweit ist, gehen die Männer nur bis zum Rand des Gatters mit; den Weg zur Burg kennen die Tiere inzwischen besser als sie selbst.
Man muß sich ganz auf die Esel verlassen. Der Weg ist so gewunden, daß Christiane nicht sagen kann, nach welcher Biegung die Burg auftauchen wird, obwohl sie ihn schon dreimal geritten ist; im letzten Jahr und in den beiden Jahren davor. Nur manchmal kann sie ihre Eltern weit vorn zwischen den kahlen Herbststämmen ausmachen.
Es ist ein bißchen wie die andere Hälfte der Stadt, in der sie im Januar 1961 geboren wurde. Diese Hälfte kann man nur umfahren oder vom Flugzeug aus betrachten, obwohl sie sich von dort durch nichts von der eigenen Hälfte zu unterscheiden scheint. Christiane bemerkt diese Teilung erst viel später und auf einer Karte. In den ersten Jahren gibt es vor allem die blinden Stellen in ihrem Kopf, an die sie noch nicht herangewachsen ist. Auf der Karte liegt die andere Hälfte der Stadt in reinlichem Weiß da und ist von einer roten Linie umrahmt. An der südlichen Peripherie, ziemlich dicht an der roten Linie, arbeitet ihre Mutter. Sie fährt mit dem Fahrstuhl zu ihrer Fünf-Stunden-Schicht auf den Tower hoch, der weit draußen auf dem Rollfeld steht. Nach fünf Stunden beginnt die Konzentration nachzulassen, und sie überläßt ihren Platz einem Kollegen. Wenn ihre Mutter arbeitet, sieht sie weder das Rollfeld schräg unter sich noch die Flugzeuge vor ihr auf den Landebahnen. Sie setzt sich in den Drehstuhl und steckt den Kopf unter den schwarzen Bogen der Kopfhörer. Oben im Tower zählt nur der Blendbereich des Monitors. Unzählige weiße Punkte bewegen sich über die Radarkreise. Das sind die Flugzeuge in ihrem Frequenzbereich, Air India, Con-Air, Pan Am, Aeroflot, Interflug, die über Eisenach kommen, über Rostock vielleicht, gestartet in Prag oder in Helsinki, und wenn sie über der anderen Hälfte der Stadt sind, wird ihre Mutter von den Pilotenstimmen über Kopfhörer angerufen. Sie weiß die Flugbahnen schon, kurz bevor der Monitor sie aufzeichnet, sie denkt den Bogen des weißen Punktes um Millimeter voraus, um ihn nicht mit anderen Punkten kollidieren zu lassen, und übersetzt das, was sie sieht, in eine unsichtbare Bewegung in der Luft. Es ist ein Ritual, das in einer Sprache abläuft, die sonst wieder in Namen von Flüssen, griechischen Buchstaben und Männern zerfällt. Ecco, Delta, Charlie. Für die Zeit vor dem Monitor und in Verschaltung mit den Stimmen in den Kopfhörern bilden die Namen feste Luftstraßen. Ihre Mutter denkt dabei nie an die Flugzeuge, sondern immer nur an die Punkte, die auf dem Bildschirm auftauchen.
Wenn das Flugzeug tatsächlich landet, ist der Punkt bereits vom Monitor verschwunden.
Christiane sieht lieber von der Plattform aus den Flugzeugen zu. Den langen Anläufen, bis sie die Abhebegeschwindigkeit erreichen, dem Zögern, mit dem sie aufsteigen, wie die Sonne auf dem Metall strahlt, wenn sie die Räder einziehen und sich seitlich legen, als seien sie jetzt mit allem einverstanden, was kommen würde.
Die Startbahnen sind in braunes Gras hingestreckt, und das Mädchen ist fasziniert von der Geradlinigkeit, mit der sie in das Feld hinausgebaut sind, um dort einfach zu enden. Es ist, als führten sie auf etwas hin, dabei ist es nichts als eine unsauber abgebrochene Kante, mit der der Asphalt belassen worden ist. Das ist anders als der Weg, der sich immer am Berg hält und seitlich zu ihm nach oben führt.
Herbst und der Ritt auf die Wartburg fallen für Christiane zusammen. Es gibt die Krähen im Geäst, ihr rauhes Geschrei, den Dampf, der aus dem Fell des Tieres aufsteigt, je höher sie kommen, den Geruch nach Sattelleder und parfümierten Taschentüchern. Der Geruch nach den Taschentüchern geht von ihren Verwandten aus, die rechts und links neben dem Esel hergehen, ihr Onkel hat sich den Zügel über das Handgelenk gehängt. Das flügelleichte Parfüm ist in der Kälte besonders intensiv, so daß es bis zum Wiedersehen im nächsten Jahr nie vollständig aus Christianes Erinnerung verschwindet. Nur aus den Geschenkpapieren von Tante und Onkel zu Weihnachten riecht es noch mal so. Es ist ein seltener Geruch, und deshalb hält sie es aus, daß man sie nicht allein reiten läßt, obwohl sie schon groß ist.
In Eisenach wohnen sie in einem Hospiz, in dem jedes Zimmer den Namen einer anderen Stadt hat, und man kann von Zimmer zu Zimmer reisen. Ihr Onkel wohnt in Kabul, und wenn er sich auf den Weg zu ihr nach Paris macht, braucht er nicht mal Reiseverpflegung. Ihre Mutter steckt den Kopf aus Kairo heraus, das Handtuch als Schleier fest um den Kopf gewickelt. Christiane geht über die Flure und stellt sich den Ort, an dem ihre Verwandten leben, zuerst wie dieses Hotelzimmer vor. Mit einer abgeschliffenen und weiß lackierten Holztür, und wenn sie sie öffnet, ist auf der rechten Seite eine Duschkabine und geradeaus steht das ausladende Bett. Die Verwandten sind immer schon da, bevor sie mit ihren Eltern ankommt, und fahren nie gleichzeitig mit ihnen wieder ab. Sie besitzen ein Auto, aber man kann nicht sicher sagen, ob sie es überhaupt brauchen, die meiste Zeit steht es unbenutzt im Hinterhof des Hospizes. Christiane vermutet, sie lösen sich jedesmal nach den drei Tagen auf wie die Atemwolken der Tiere.
»Wo wohnt ihr denn eigentlich?«
Der Vater senkt seine Kuchengabel langsam wie einen Kopf.
»Iß erst mal den Quark auf.«
Es gibt ein Café auf der Wartburg, das voll ist und laut, und sie müssen auf einen Tisch warten. Am Eingang ist ein großes Pappschild aufgestellt, vor dem die Leute stehenbleiben, die Schultern angezogen wie ihre Mutter zu Weihnachten vor dem Altar. In der Ferne gehen Kellner mit eckigen Kaffeekannen durch den Raum. Sie sieht ihren Vater auf die Uhr sehen und wie der Onkel abwinkt und laut lacht und ihr Vater nicht mitlacht.
Während sie Löffel auf Löffel in sich hineinschiebt, ist es still am Tisch. Als der Kellner den Kaffee bringt, nimmt die Mutter sie an die Hand. Hinter ihnen schließt sie die Toilettentür.
»Du bist doch jetzt schon richtig groß. Das ist nämlich schwierig zu verstehen. Es ist etwas, was man niemandem erzählen darf. Auch nicht der besten Freundin.« Ihre Mutter dreht den Wasserhahn auf. Sie wäscht sich die Hände. Christiane hat sie bis dahin immer erst danach die Hände waschen sehen.
»Und warum nicht?«
»Ich hätte Probleme auf der Arbeit. Verstehst du? Es darf niemand außerhalb der Familie wissen.«
»Was denn?«
Nürnberg kommt unter den Zimmernamen nicht vor. Dahin geht man nicht über den Flur. Sie stellt sich neben ihre Mutter und fängt auch an, sich die Hände zu waschen. Sie waschen sich eine Weile einträchtig nebeneinander die Hände.
»Sie sind heimlich hier. Verstehst du das?«
Sie nickt. Es muß etwas Ungeheuerliches sein. Vielleicht gehört es zu den Stimmen aus der Luft, mit denen ihre Mutter spricht.
»Wir können da nicht hinfahren, und du darfst auch niemandem erzählen, daß wir uns hier getroffen haben. Das muß dein Geheimnis bleiben.«
Es ist ganz klar. Das erklärt auch diesen Duft. Er ist einzigartig, weil er mit nichts vermischt worden ist.
Ihre Mutter trocknet sich die Hände an der oberen Hälfte des Frotteehandtuchs ab. Christiane schüttelt ihre Hände aus und reibt sie an den Oberschenkeln trocken, weil das Handtuch unten schon naß ist. So ist das also, wenn man erwachsen ist. Man hat ein Geheimnis, von dem niemand sonst etwas wissen darf. Das ist viel besser, als allein reiten zu dürfen. Sie hofft nur, daß die Stimmen aus der Luft auch bald mit ihr sprechen werden, damit sie das Geheimnis besser versteht. Christiane schlendert ganz unauffällig unter dem Arm ihrer Mutter hindurch aus der Toilette hinaus.
Alle ihre Worte werden zukünftig immer erst durch dieses Geheimnis hindurchgehen müssen, ausgedünnt wie Haare unter der Bürste.
ONE Jahrestage
Die Sonne hätte eine Folie sein können, ein dünner, durchsichtiger Belag, der über dem gesamten Flughafengelände hing. Wenn der Wind kam, hob sich die Folie wie Wasser und sprühte Gischt aus glitzernden Schaumtropfen über die Gebäude, die Tankstation, auf die Dächer der Leitfahrzeuge und in die flirrenden Abgase aus den Düsen startender Maschinen. Die Sonne fiel aus den Glasfenstern des Abfertigungsgebäudes auf den Asphalt, sprang von dort auf die Fahrzeuge und traf die beschlagenen Scheiben der Busfenster. In langen Wellen trieb sie über das Rollfeld und verzerrte mit der Entfernung die Sicht. Rollfeld und Grasflächen und die Schrebergärten dahinter verschwammen schon wenige Meter über dem Boden, als sollte eine vorzeitige Entdeckung dessen, was tatsächlich zu sehen war, verhindert werden.
Christiane zog ihren Jackenärmel über den Handballen und wischte ein Guckloch in das beschlagene Busfenster.
Durch das Guckloch strahlten ihr das Rollfeld und der Himmel entgegen. Sauber ineinandergefügte Betonplatten reflektierten die silbernen Körper der Maschinen, und nirgendwo gab es Risse, aus denen Unkraut wuchs. Selbst die Tore der Gepäckabfertigung sahen reinlich und akkurat aus und standen in diesem weißschimmernden wie zusammenphantasierten Licht.
In der Ferne kam eine weiße Boeing in Sicht, die Reifen des Fahrwerks so hoch wie ein Mensch.
Christiane saß in einem Bus, der nicht von Fliegen und Straßenschmutz beflogen war wie die Linienbusse in Eisenach, und die Frau neben ihr trug ein nach West-Orangen duftendes Parfüm.
Sie erinnerte sich an das Kompliment, das ihr vorhin jemand in der Abfertigungshalle gemacht hatte, als gehörte sie schon dazu. Als wäre das die einfachste und selbstverständlichste Sache der Welt.
Aber vielleicht war es das auch. Sie hatte sich so oft in diese Situation hineinphantasiert, daß sie sie perfekter beherrschte als die Menschen um sie herum. Nur für das Kompliment hatte sie sich nicht bedankt, aus Angst, ihre Stimme würde sie verraten. Die Stimme hätte vor Aufregung angefangen zu klirren. Statt dessen hatte sie sich bemüht, die Bordkarte betont gelangweilt und ebenso zwischen Zeige- und Mittelfinger geklemmt vorzuzeigen wie der Geschäftsmann neben ihr.
Durch das Guckloch im Busfenster sah sie das Paradies.
Dann hielt der Bus. Die Türen zischten auf, die Gespräche um sie herum wurden kurz unterbrochen, bevor sie im Inneren des Flugzeuges neu sortiert fortgesetzt werden würden.
Christiane betrat vorsichtig die Gangway. Es kam ihr vor, als dürfte sie sich in diesem Licht nur sehr langsam bewegen. Sie ließ die Frau mit dem Orangenparfüm vorbei und Männer, die sich über ihre Sitzplätze beschwerten.
Eine Hand auf dem Geländer, dachte sie noch einmal an das Mädchen, das sie auch jetzt, 19 Jahre später, noch war. Obwohl das Hospiz und der Entzug der Staatsbürgerschaft und die erste Liebe schon hinter ihr lagen. Aber das Mädchen war immer noch da, als stünde es drüben auf der Plattform des Abfertigungsgebäudes und sähe zu, wie die Maschine ohne es abhob. Kabul, Paris, New York.
Bevor Christiane in den Flugzeugrumpf tauchte, drehte sie sich noch ein letztes Mal um.
Sie stand ganz oben auf der Gangway. Um sie herum waren nur der Morgenhimmel und ihre über den Schläfen verwehten Haare. Sie hielt die Haare über der Stirn zurück und versuchte, von hier aus das Ende der Startbahn zu erkennen. Die abgebrochene Kante, mit der der Asphalt belassen worden war. Aber die Startbahn verschmolz übergangslos mit dem Himmel.
Sie stand hoch oben am Anfang der Startbahn und dachte an ihre Mutter. Ihre Mutter mit den schwarzen Kopfhörern und den weißen Punkten vor sich auf dem Bildschirm. Sie saß in ihrem Tower auf der anderen Seite der Welt und würde den Punkt, in dem ihre Tochter saß, nicht von den übrigen Punkten unterscheiden können.
Mit dem Flug über den Atlantik begann etwas, was sich ihre Mutter nie würde vorstellen können.
Christiane atmete durch und lächelte jedem, der ihr nach die Gangway hochdrängte, ins Gesicht. Als die Stewardeß ihr unbekannte Tageszeitungen anbot, antwortete sie mit einem korrekten, auswendig gelernten englischen Satz.
Sie suchte nach Sitz 9A und schloß dann für einen Moment die Augen. Neben ihr saß die Frau mit dem Orangenparfüm.
Das Paradies begann mit diesem weißen Licht. Die Stewardessen servierten Lachsfilets, sprachen englisch und konnten es sich leisten, die Sonne im Bordfenster zu ignorieren. Als sie sich zu ihr hinüberbeugten, um ein Erfrischungstuch zu reichen, wich Christiane unmerklich zurück. Sie hätte sonst irgend etwas sagen müssen, ohne zu wissen was, dabei hatte sie auf einmal das Gefühl, alles sagen zu müssen, unbedingt der Frau neben ihr sagen zu müssen: Sehen Sie doch mal. Da draußen. Sehen Sie das nicht auch?
Jemanden teilhaben zu lassen, mehr noch, teilhaben lassen zu dürfen, während die Turbinen aufdrehten und das Flugzeug noch einmal zum letzten Bodencheck stehenblieb, bevor es an Geschwindigkeit gewann und abhob.
Zwischen zwei Bissen Lachsfilet sagte Christiane: »Das kriegt man nicht alle Tage, was?«
Die Frau mit dem Orangenparfüm lächelte ein junges, aber unbedeutendes Lächeln. Sie stocherte mit der Gabel im Aluminiumbecher und ließ die Hälfte zurückgehen. Über der Tragfläche leuchtete die Sonne.
Die schönsten Bücher, die es über Amerika gab, waren von Leuten, die niemals da gewesen waren.
Abziehbilder hatte es gegeben, die man sammeln konnte. Aber niemand hatte jemals eine vollständige Reihe besessen. Allein sie zu betrachten war ausreichend. An dem Theater, an dem Christiane gearbeitet hatte, hatte es Menschen gegeben, die nur dafür lebten. Zuerst hatte sie das bei den Garderobenfrauen gesehen.
Wenn Christiane während der Vorstellungen zum Rauchen hinausgegangen war, hatten die Garderobenfrauen ihr manchmal und hinter den Mänteln verborgen die Bilder gezeigt. Sie waren dünn und handflächengroß, mit roten oder grünen Rändern. Man konnte sie nach Automarken, Rockgruppen, Politikern oder Gebäuden ordnen. Sie waren abgegriffen und die Motive darauf kaum noch erkennbar, aber je abgegriffener sie waren, desto mehr liebten sie die Bilder. Es waren die Lücken, die sie daran liebten, die Gesichter der Rockstars oder die Kotflügel der Autos, die sie sich neu zusammendenken mußten.
Christiane verließ sich nicht auf die Lücken, sondern auf die Verbindungen zwischen den Dingen. Wie sie die Schauspieler in ihrer Bewegung über die Bühne herstellten. Sie kamen von der Seite, gingen hinüber zu einem Stuhl in der Mitte, betrachteten ihn, drehten ihn herum, gingen weiter nach vorn an den Bühnenrand. Es war ein Weg, der unterbrochen war von längeren oder kürzeren Pausen, aber schließlich zeichneten ihn die Stühle auf der Bühne nach, sobald die Schauspieler sie streiften. Die Bewegung konnte man auch später noch anhand der Stühle nachvollziehen.
Die Stühle von der letzten Probe würde man inzwischen weggeräumt haben. Nur die Garderobenfrauen würden noch eine Weile über die junge, unauffällige Kollegin reden, hinter den Mänteln versteckt, aber das einzige, was als Erinnerung an sie bleiben würde, wären die Gerüchte über eine Flucht. Auch das hätte sie der Frau mit dem Orangenparfüm gern erzählt.
Sie hätte sie auch um einen Gefallen bitten können. Es war Ende Mai, und Christiane hatte sich absichtlich um drei Wochen verspätet. Trotzdem hatte sie immer noch Angst, der Mann, dem sie die Ehe versprochen hatte, würde auf sie warten. Er würde mit dem Fotoapparat dastehen und jeden Augenblick ihrer Ankunft festzuhalten versuchen. Er würde sie vor alle Sehenswürdigkeiten der Stadt stellen, die dann für ihn eine neue Bedeutung bekamen.
Sie hätte die Frau mit dem Orangenparfüm bitten können, vorauszugehen. Aber sie fiel schon auf wegen des Anoraks, den sie trug.
Die Leute am Laufband trugen Fellmäntel, gefütterte Lederjacken oder Baumwollschals. Sie trugen Hüte oder hauchdünne Seidenhandschuhe, als hätte jeder einen Teil des Körpers, der ihm wichtig war, schmücken wollen.
Das Laufband sprang mit einem Surren an. In ihrem Dederon-Anorak mußte sie zu sehen sein wie ein Leuchtfeuer. Sie zog die beiden Koffer vom Band und stellte sich in die Schlange vor dem Zoll. Niemand sah sie an. Nur der Zollbeamte gab ihr einen kurzen Blick, nahm ihr den Paß aus der Hand und knickte an den Seiten herum. Sie besaß nichts außer ihrer Unterwäsche, den Hemden und einer Vase, von der sie sich nicht trennen wollte.
Als sie in die Empfangshalle kam, durch die automatische Glastür hindurch, dachte sie jeden Moment, in seine Augen zu sehen. Er hielt die Augen halb geschlossen, die dünnen Wimpern berührten fast seine Wange, während er ein ihr unbekanntes Bild in seinem Objektiv sah.
Sie hatte gern mit ihm getanzt. Seine Schulter roch jedesmal warm und nach chemischen Reinigungsmitteln. Sie hatte ihm kleine Zettelchen in die Schuhe gesteckt, die er als Unterpfand daließ bis zur nächsten illegalen Unterbrechung einer Transitreise. Später kam er öfter. Er besuchte sie monatlich, um die Behörden von der verlangten ernsthaften Absicht zu überzeugen. Rein politische Gründe, wie er sagte. Und alle Rechte vorbehalten. Dabei hatte er sie bereits als seine Ehefrau in den Mietvertrag eines New Yorker Apartments eintragen lassen. Das sagte er nicht beim Tanzen. Das sagte er nebenbei und als er, das zweite Paar Schuhe in der Hand, in ihrer offenen Wohnungstür stand. Nach einem Jahr endloser Anträge wäre es selbstmörderisch gewesen, das Verfahren an dieser Stelle abzubrechen.
An der Abspannkordel entlang standen Menschen in Dreierreihen und hielten Schilder vor der Brust. Maxwell-House-Limo. YMCA-Bus. Keines der Schilder sprach sie an, niemand hielt sie auf, niemand wandte sich ihr zu. Die Blicke der Menschen stießen sich an ihr ab. Es waren Blicke, die nicht suchten, sondern sich an jeden zu richten schienen, der sich angesprochen fühlte.
Der Meeting Point bestand aus einer Reihe von rötlich geschwungenen Plastehalbschalen, die eine Ausformung für den Po hatten. Sie blieb eine Weile sitzen. Die Koffer beidseitig neben sich gestellt. Sie wurde ruhiger. Selbst wenn er es geschafft hätte, jeden aus Frankfurt kommenden Flug abzupassen, würde sie der Mann, der sie hatte heiraten wollen, im Gewühl der Menge nicht finden.
Als jemand mit einem Kaffeewagen vorbeikam und nach ihren Wünschen fragte, schüttelte sie den Kopf. Dann ärgerte sie sich, nicht doch etwas gekauft zu haben von diesen paar hundert geschenkten Dollars, und fragte nach einem Donut.
Die Handgriffe waren gewohnt. Aber trotzdem stak sie hervor. Sie stak aus dem Gewohnten hervor, obwohl es die gleichen Hände waren, die über die Plaste strichen, die gleiche Zunge, mit der sie die Zuckerglasur vom Donut leckte. Selbst der Haarschnitt war mitgebracht. Sie konnte sich die Haare hier schneiden lassen, am Ende der Ankunftshalle blinkte ein Friseurspot. Sie konnte sich die Finger maniküren lassen. Sie hätte einen Wagen mieten und in einem Saab oder Lincoln davonrauschen können.
Aber sie konnte es nicht tun. Nicht, weil sie nichts besaß, sondern weil sie zuviel mitgebracht hatte.
Sie fuhr mit dem Flughafenbus zur U-Bahn in Richtung Manhattan. Dann, hoch über Brooklyn, entdeckte sie die Skyline, die gegen den frühen Abendhimmel strahlte. Lichtkränze umstanden die Spitzen der Häuser, und während die Bahn auf einem Hochgleis dahinratterte, drückte Christiane das Gesicht gegen das Fenster, als könnte sie sich das Bild wie einen Abdruck in die Stirn pressen.
Nur der Anblick, als sie aus der U-Bahn kam, überraschte sie wirklich. Aus den Fenstern der Häuser gegenüber war das Glas gebrochen, so daß man in die Räume dahinter sehen konnte; Höhlen mit heraushängenden Kabeln und Graffiti an den Wänden. Die Hochstraße am Hudson war gesperrt und bog sich unter rostenden Stahlträgern. Und überall waren die Penner, die ihre Decken für die Nacht ausbreiteten. Sie lagen eingerollt auf den Lüftungsgittern der U-Bahn, vor verfallenden Fassaden, in Haltestellenhäuschen, und sie rochen schon von weitem, streng und nach süßlichem Tabak. Es war überraschend, weil alles so sehr den Beschreibungen und den Fotos glich, die daheim zur Abschreckung in Umlauf waren. Wenn Christiane zurückgekehrt wäre und davon erzählt hätte, hätte man sie für eine vom Staat gehalten.
Das Obdachlosenheim nördlich der Bowery unterschied sich äußerlich kaum vom Auffanglager der letzten Wochen. Das war ein ebenes, einstöckiges Gebäude gewesen, durch das die Menschen durchgegangen waren wie Güterzüge. Kaum jemand war länger als einen Monat geblieben. Für diese Zeit wurden sie mit Lebensmitteln und Spendenkleidern beladen und bekamen Daten, als hätten sie noch nie welche gehabt.
Christiane hatte auch hier nichts anderes erwartet. Die Vorhalle war leer. Ein Styroporbecher lag umgekippt auf einer Couch in der Ecke, wo ein Fernseher lief. Ein asiatisch aussehender Pförtner lehnte im Kabuff neben der Theke.
Sie mußte einen Fragebogen ausfüllen. Lebensstand, Alter und Beruf, Nationalität und Sprache, und der Pförtner hatte Anweisung, daß alles vollständig und mit Kugelschreiber auszufüllen war. Die Liste war zehn Seiten stark, und Christiane ging sie Punkt für Punkt durch. Zuerst kamen die Nationalitäten, die in Obergruppen wie White oder Hispanic aufgeteilt waren, darunter folgten die Länder. Das Land, aus dem sie kam, war nicht angegeben.
Sie winkte dem Pförtner. Er war ein Stück kleiner als sie, und während sie mit ihm sprach, zupfte er an den Trockenpflanzen auf der Theke. Schließlich tippte er dreimal mit dem Finger auf die Spalte, die sie noch nicht angekreuzt hatte, und schüttelte den Kopf.
Christiane war erschöpft und fremd und mehr als zwei Stunden durch die verrotteten Straßen geirrt. Sie stand da, sah dem Finger des Koreaners zu, wie er sich bewegte, sah ihn den Kopf heben – die Augen auf einen Punkt hinter ihr an der Wand gerichtet. Seitlich neben ihrem Kopf vorbei. Nicht einmal durch sie hindurch. Er konnte nicht einmal durch sie hindurchsehen. Dann hätte sie nämlich da sein müssen. Glas vielleicht oder Luft, aber wenigstens etwas. Er zuckte die Schultern und drehte den Ton des Fernsehers wieder lauter.
Sie zog die Buchstaben auf dem Papier vor ihr mit dem Kugelschreiber nach. Ein einziges Kreuz als Unterpfand für die Nacht. Wenn es aber nichts gab, wo sie herkam, gab es auch nichts, wo sie ankam. Sie hatte oft genug Choreographien ausgearbeitet. Komplizierte Abläufe, aber alle hatten einen Anfangspunkt und ein Ende. Schließlich machte sie ihr Kreuz bei Germany.
Dann ging sie den Fragebogen noch einmal hoch und änderte ihren Vornamen. Sie änderte ihn, ohne besonders darüber nachzudenken. Vielleicht aus einem Gefühl heraus. Vielleicht weil sie sich kurzzeitig nicht mehr an die eigene Unterschrift erinnerte. Vielleicht auch wegen ihrer Angst auf dem Flughafen. Das waren Gründe, die ihr hinterher durch den Kopf gingen, aber keinen fand sie ausreichend. Der Pförtner sah überhaupt nicht hin, als sie ihm den Bogen zurückgab. Er überprüfte nur das Kreuz und legte ihn dann zu anderen in eine Kiste.
Nach der ersten Nacht im Heim war sie wieder ein Kind. Sie riß alles an sich und ließ es fallen, sobald sie genug davon hatte. In den Läden berührte sie das Obst in den Stiegen, fühlte die Colabüchsen in den Eisschränken.
Sie kaufte nichts. Es reichte ihr, die Formen zu verstehen. Sobald sie etwas kaufen würde, dachte sie, wäre alles wieder verschwunden.
Vor einem Klarinettisten in der Straße blieb sie stehen. Aufgehalten von dem plötzlichen Klang, der die Schritte um sie herum in eine einzige Harmonie brachte. Der Klarinettist grinste ihr zu und beugte den Oberkörper über dem Dollarschein, den sie ihm in den Kasten warf. Am Tag darauf fiel ihr der Klarinettist an derselben Stelle nicht mehr auf. Sie fand ein Buch und las die ersten Seiten. Während des Umblätterns vergaß sie, worum es ging. Sie war haltlos. Sie konnte sich Dinge nur dadurch merken, daß sie ihr nicht mehr auffielen.
Die längste Zeit, die sie sich an etwas erfreuen konnte, waren zwei Tage. Sie freute sich über die billige Lederjacke vom Trödelmarkt. Mit dem glatten Leder unter der Wange konnte sie schneller einschlafen abends. Es erinnerte sie an nichts. Sonst lag sie wach und zählte die Rhythmen, die der Verkehr auf der Straße schlug. Gegen vier Uhr morgens, hatte sie herausgefunden, waren die Abstände zwischen den Autos am größten.
Sie saß im Metropolitan Museum auf einer Bank und sah zu, wie die Sonne am Obelisken vor dem Fenster herabging. Der Mann neben ihr erzählte eine Geschichte. Über das Museum. Über den Park draußen. Sein Finger berührte die Spitze des Obelisken. »Der kommt aus Frankreich. Ein Geschenk. So wie Sie.«
»Bitte?«
»Kommen Sie aus Frankreich?«
»Nein.«
»Ich dachte. Sie haben einen europäischen Akzent.«
»Ich komme nicht aus Frankreich.«
»Die Franzosen haben das als ein Geschenk gebracht, und weiter hinten gibt es einen Saal mit einem Tempel. Von den Ägyptern. Auch ein Geschenk. Mögen Sie Tee?«
»Entschuldigen Sie, was haben Sie gesagt?«
»Ich habe gefragt, ob Sie Tee mögen.«
Er folgte ihr bis nach draußen. Sie hörte seine Schritte, ein tappendes Geräusch auf den Steinfliesen. Dann schien es, als käme er nicht mehr hinterher. Die Leute schlossen sich hinter ihr, drängten sie heraus, an die Luft, die Treppenstufen hinunter. Es war früher Abend. An der Ampel holte er sie ein.
»Lassen Sie das!«
»Warten Sie doch. Ich wollte Ihnen noch etwas zeigen.«
»Ich habe keine Zeit.«
»Dann zeige ich es Ihnen morgen. Oder übermorgen. Das spielt keine Rolle. Sie müssen den Tempel sehen, wenn Sie schon mal hier sind.«
»Ich kenne den Tempel.«
»Ach, Sie kennen ihn.«
»Lassen Sie meinen Arm los.«
»Sie haben mir noch nicht gesagt, ob Sie Tee mögen.«
Auf der anderen Seite der Straße ließ er sie los. »Ich bin fast jeden Tag hier. Falls Sie den Tempel doch noch sehen wollen.«
Nach dieser Begegnung war sie besessen von Schaufenstern. Nicht wegen der Auslagen, der teuren Schmuckstücke in den Läden der Lexington Avenue, sondern wegen ihres Kopfes, wegen der Bluse, die sie trug. Sie sah sich über den Auslagen auftauchen und wieder verschwinden und wieder auftauchen. Es kam ihr vor wie ein einziger Schritt von Schaufenster zu Schaufenster; sie war verschwunden, während sie den Fuß anhob, und wenn sie ihn aufsetzte, kehrte sie zurück.
Wenn Harvey sie zwei Tage später nicht angesprochen hätte, wäre sie an ihm genauso vorübergegangen wie an dem Klarinettisten. Sie nahm ihn gar nicht wahr. Sie fühlte nur die Wärme, die von ihm ausging. Sie hätte sich gegen die Wärme lehnen können wie an eine Wand. Er zeigte auf Details in den Bildern, während sie durch die unteren Säle des Metropolitan gingen. Eine Farbe, ein Dreieck, ein zu hell geratener Fleck. Eine Linie, die plötzlich abbrach. Es waren die Details, durch die Christiane eine Vorstellung von ihm bekam.
Harvey, der mindestens siebzig war und kurzatmig, der klaustrophobisch reagierte in U-Bahnen und Bussen, ging die ganze Strecke ins Village mit ihr zu Fuß. Sie wollte kein Taxi, für das er hätte bezahlen müssen.
Wieder griff er nach ihrem Arm. »Wo führst du mich hin, meine Liebe?«
Vor der Tür wollte sie ihn verabschieden, er wußte dann, wo er sie finden konnte, aber er sollte nicht weiter kommen, als bis vor die Haustür. Harvey schob den Hut über die Stirn zurück.
»Was ist? Hast du keinen Schlüssel?«
»Das ist ein Obdachlosenheim.«
»Und? Kommt man da nur zu bestimmten Uhrzeiten rein? Ich muß mich dringend hinsetzen.«
Sie ließ ihn ein, aber die Kabine, in der sie seit zwei Wochen hauste, betrat Harvey nicht. Er sah ihr von dem halbgeöffneten Vorhang aus zu, wie sie darin herumging. Unruhig. Ohne zu wissen, was sie ihm anbieten sollte. Schließlich schob sie ihm einen Stuhl auf den Gang. Eine halbe Stunde später gab sie dem Koreaner den Schlüssel zurück. Sie hatte die Koffer dabei.
Als das Taxi hielt, wollte sie wieder zurücklaufen, mit beiden Koffern in den Händen. Harvey sah sie über das gelbe Autodach hinweg an. Er schwitzte unter der Brille. »Steig ein. Wir haben ein Geschäft gemacht. Wir sind jetzt Vertragspartner.«
»Ich werde dir dankbar sein.«
»Kein Problem. Dankbarkeit ist etwas sehr Angenehmes, wenn man alt wird.«
»Du weißt doch, was ich meine.«
»Komm, steig ein.«
Im Russischen Viertel ließ er das Taxi halten und kaufte Piroggen, während sie wartete. Er dachte, es wäre passend. Vor dem Fenster hörte sie russische Wortfetzen. Russische Musik, die sie kaum ertragen konnte. Die Piroggen, die er brachte, waren klitschig und warm, und das Öl tropfte auf die Ledersitze. »Ich wußte nicht, ob Marmelade oder Nußfüllung besser ist. Ich kenn mich mit den Dingern nicht so aus. Schmeckt’s?«
Sie riß mit den Zähnen Stücke aus dem öligen Teig. Harvey lehnte neben ihr in den Rücksitzen. Der schmale Körper, breit um die Hüfte, wie bei einer Frau. Harvey nahm sie bei sich auf, ohne daß sie ihn danach gefragt hätte. Verpflichtete sie, etwas zu tun. Sich zu bedanken, die Hand mit den Piroggen zum Mund zu heben, zu lächeln. Ab morgen katalogisierte sie seine Bilder, gegen freie Unterkunft. Christiane verkürzte die Pausen zwischen Hinunterschlucken und Abbeißen, bis sie es fast gleichzeitig tat. Krümel und Nußstücke fielen auf ihren Kragen. Sie aß. Das war ihre Antwort.
In seiner Wohnung vor dem Einschlafen, nachdem sie sich das Sofa auseinandergeklappt hatte, klopfte er dünn gegen die Tür. Sie sah nur den Kopf im Türspalt gegen das Flurlicht dahinter. Ein dunkler Fleck genau auf der Hälfte zwischen zwei Linien.
»Du konntest nicht wissen, daß ich den Tempel nicht kenne.«
»Du hättest dich mal sehen sollen. Wie du an den Bildern vorübergegangen bist. Du kannst kein einziges gesehen haben.«
»Ich verstehe nichts von Kunst.«
»Niemand, der so durch die Säle geht wie du, ist da, um sich Bilder anzugucken. Aber jetzt schlaf erst mal ein bißchen.«
Sie zog vorsichtig die Decke hoch. Als müßte sie sich jedes Millimeters versichern. Die Wolle kratzte ein bißchen am Kinn. Sie hörte, wie er die Tür zuklinkte, und dann seine Schritte über den Flur.
Wenn er früh aus dem Haus ging, stellte sie Stühle ins Wohnzimmer. Drei seiner ockerfarbenen Holzstühle. Sie stellte sie im Dreieck der Tür gegenüber und dachte sich verschiedene Wege aus zwischen ihnen. Mal begann sie an der Tür, dann an einem der Stühle, manchmal lief sie hindurch, ohne einen davon zu berühren. Die Gardinen im Zimmer waren hochgezogen, so daß alles Tageslicht hineinfiel. Davon war mehr im Zimmer als von ihr. Viel mehr. Die Choreographie war ein Fehler. Anhand der Stühle ließ sich nichts nachvollziehen. Sie durchwühlte seine Schränke nach Kreide. Mit einem kurzen, abgebrochenen Stück Rosa malte sie in Strichen die Wege auf das Parkett, die sie ging. Sie zog so viele Striche hinter sich her, bis das Dreieck großflächig ausgemalt war. Und weil jetzt die Stühle als Eckpunkte überflüssig waren, nahm sie sie weg.
»Erklär mir die Fehler.«
Harvey stand in der Tür, als sie auf ihr Kunstwerk zeigte. Er stand lange in der Tür. Dann hob er die Schultern.
Die Küste von Long Island lag östlich von New York, und mit dem Auto hatten sie kaum eine Stunde gebraucht. Harvey war auf eine Party eingeladen, und er hatte darauf bestanden, daß sie mitkam. Es war ein kühles Wochenende, vereinzelt kam die Sonne durch, und der Strand bildete eine einzige gerade Linie. So waren Entfernungen nicht auszumachen.
Christianes Füße bewegten sich unter ihr, die Schritte schaufelten Sand in ihre Schuhe und ließen ihn wieder hinaus, sobald sie den Fuß anhob. Der Schlag der Wellen blieb langsam und gleichmäßig und immer auf gleicher Höhe. Es war, als ob nur der Sand durch sie hindurchlief. Und sie stand da, auf einem Bild, links neben den Wellen.
Auf dem Rückweg hob sie Seetang auf, nahm ihn mit für die Stufen der Villa. Auf jede Stufe legte sie eine Pflanze, bis in die Küche hinein, wo sie schon beim Frühstück waren. Harvey und seine beiden Freunde.
Die Freunde sahen auf, als sie ein Messer aus der Schublade nahm.
Sie stellte sich dicht neben Harvey und fing an, Butter langsam und sacht über ein Stück Toast zu streichen. Dann Marmelade. So sacht sie konnte. Er sollte sehen, daß sie die Anspannung von gestern nacht vollständig losgeworden war am Strand.
Gestern nacht auf der Party in einem kleinen Restaurant in der Nähe hatte er sie mit Gesprächspartnern versorgt. New Age Jazz. Sagte man ihr. Cannelloni. Nudeln mit fingerdickem Durchmesser und Fleischfüllung. Sagte man ihr. Schwarzwasserfieber. Erklärte man ihr. In westafrikanischen Steppen. Levis ist besser als Wrangler wegen der rivets. Man muß auf die Nieten achten, wenn man Jeans kauft. Und ›Star Wars‹ hast du nicht gesehen? Die Musiker spielten New Orleans Jazz mit Bass und Saxophon.
Später gingen sie zu viert die Straße bis zur Einfahrt der Villa. Es war zwei Uhr früh, und Christiane war dabei, Witze zu erzählen. Sie versuchte, sich an alle zu erinnern, die sie jemals gehört hatte. Schon im Restaurant hatten ihr plötzlich alle zugehört, und jetzt auf der Straße fielen ihr immer neue ein. Es war überhaupt nicht schwer, die Freunde grinsten und klatschten, wenn sie in gebrochenem Englisch, aber mit der nötigen Spannung die Pointe so lange wie möglich hinauszögerte. Sie achtete nur auf das Lachen der Freunde. Plötzlich unterbrach einer. Sie hatten die Schlüssel im Restaurant vergessen und mußten zurückgehen.
Harvey sah Christiane unter den Lichtern der Straßenlaternen reden, sie war verändert, aufgedreht, ihre Einfälle waren schnell und komisch, aber er ließ sich nichts anmerken. Vielleicht hielt er es für Glück. Er dachte, wenn sie redete, hatte sie einen Anfang gefunden.
Sie gingen nebeneinander die Einfahrt hoch. Es war so dunkel, daß das Weiß vom Haus wie eine Lampe strahlte. Mit dunklen Stellen, wo die Rolläden heruntergelassen waren. In der Ferne fuhren Autos.
Christiane sah Harveys Kopf als Schattenbild auf den Steinen. Dann blieben sie stehen. »Warum dauert das so lange?!«
Harvey hatte nicht reagiert. Er zuckte nicht mal die Schultern. Das Weiß vom Haus setzte seinen Schatten klar und präzise vor sie auf die Steine. Wie mit einer Reißnadel. Wenn sie den Schatten heraushob, würde ein Loch darunter sein, dessen Rand Harveys Form hatte.
»Das ist abgekartet. Alles. Das ist doch alles abgekartet. Und du steckst dahinter. Warum kommen sie denn nicht wieder? Scheiße! Deine verdammten Scheißfreunde. Die lassen uns hier in der Scheißdunkelheit stehen! Was glauben die eigentlich, wer sie sind?!«
Der Alkohol, der in ihr summte wie Strom. Der sie nach dem erstbesten in ihrer Nähe greifen ließ, einem Zweig, mit dem sie auf Harvey losging. Die Blätter am Zweig waren so lose, daß sie abfielen, noch während Christiane ausholte. Der Schwung war ganz leise, nur die Autos in der Ferne waren zu hören, und sie sah, wie Harvey einen Arm hob, um seinen Hut festzuhalten. Der Arm ging nach oben, während der Zweig auf ihn herunterging. Auf den Arm, den Hut, dann war Harvey verschwunden. Sie schlug ins Leere, der Zweig ging nach unten durch. Sie hatte sich auf Widerstand eingestellt, darauf, daß der Zweig aufschlug. Auf ein Geräusch. Eine Antwort. Nichts. Kein Widerstand, keine Grenze, nicht mal der Schatten. Nichts, was sie hielt.
Sie kippte vornüber. Kippte in diese absolute, totale Leere der Nacht.
Als seine Freunde die Auffahrt hochkamen, hielt Harvey die Lippen ins Taschentuch gepreßt.
Sie strich weiter Butter auf einen Toast und hatte dabei einen klaren, erschütternden Gedanken. Klar und geradlinig wie der Strand von Long Island: Sie hatte das Paradies gesehen. Es hatte zwei Monate und vier Tage gedauert. Jetzt wäre sie gern zurückgekehrt.
Aber es gab keine Möglichkeit mehr zurückzukehren.
TWO Auf eigene Hoffnung
Jeff saß am liebsten an jenem Tisch direkt am Fenster, an dem sich einer totgesoffen hatte. Ein Dichter. Obwohl das nicht das Wichtigste daran war. Wichtig war, daß er sich totgesoffen hatte, das zeichnete diesen Tisch aus. Es verlangte Würde, hier zu sitzen. Ketchup klebte am Rand und war hart geworden, die Aschenbecher wurden selten geleert.
Mit der Frau hinter der Bar hatte er bisher kein Wort gewechselt. Obwohl er sie schon vier Monate lang beobachtet hatte. Er ließ sie nicht aus den Augen. Jetzt, wo es draußen schneller dunkel wurde, konnte er ihr im spiegelnden Fensterglas zusehen, und sie würde denken, er sähe auf die Straße.
Vor dem Fenster lag einer dieser hundsleeren Samstagnachmittage. Die abgenagte Schönheit von Häusergittern und Baumstämmen zeigte nur um so deutlicher, wie leer die Stadt war. Dabei herrschte in dieser Gegend der Stadt an den Wochenenden sogar Hochbetrieb. Aber die, die heute unterwegs waren, wohnten meist nicht hier. Sie schritten die letzten dürren Sonnenflecken ab, träge und gelähmt von ihrem Glück. Die Anwohner dagegen machten Bottle-Parties oder fuhren nach Harlem, wo das Bier auch an den Wochenenden den gleichen Preis hatte.
Die Frau hinter der Bar war ihm sofort aufgefallen. Ihr Haar trug sie kurz und ohne erkennbaren Schnitt, als lohnte sich die Mühe nicht, auf die Haare zu achten. Während er ihrer Gestalt im Fensterglas folgte, hielt er den Kopf leicht gesenkt. Inzwischen hatte er jeden ihrer kleinen Fehler ausgekundschaftet. Er war sicher, daß sie im Laufe der Zeit noch viel mehr preisgeben würde.
Nur ein einziges Mal, an ihrem ersten Tag, hatte Jeff etwas zu ihr gesagt. »Kaffee und Käsesandwich. Den Kaffee mit Milch.«
Sie hatte auf seine Bestellung genickt. Jedesmal, wenn Jeff danach das »White Horse« betrat, nickte sie zu ihm herüber, und nach kurzer Zeit brachte sie ihm Kaffee und Sandwich an den Tisch.
Während er hier war, machte er niemals Notizen. Er hatte alles dabei; die schwarze Tasche, die Papiere, Stifte. Aber er mochte das Gefühl einer Situation im Kopf, in der es die phantastischsten Fehler gab, und solange er im »White Horse« war, wollte er nichts daran ändern.
Als er an diesem Nachmittag die Kneipe betrat, war es still, und die Frau nahm zwei Stühle vom anderen Ende der Theke herunter. Als sie ihn hereinkommen sah, winkte sie ihm zu. Nur kurz, als hätte sie eigentlich nach dem nächsten Stuhl greifen wollen. Aber sie hatte bereits alle Stühle heruntergestellt.
Sie hatte ihn oft genug hereinkommen sehen, wie er den Schlips vom Hals zog, sobald er sich hinsetzte. Wie er die Salatblätter aus den Sandwich-Scheiben heraussortierte. Wie er die Haut an den Nagelbetten aufriß, während er so tat, als ob er aus dem Fenster starrte. Als hätte sie ihn nicht längst durchschaut. Sogar die Bewegung seiner Augen konnte sie dirigieren. Immer, wenn sie hinüber zur Spüle ging und von der Spüle zur Küchendurchreiche, ging sein Kopf mit. Nur wenn sie sich schnell zu ihm umdrehte, ging sein Kopf weiter, durchbrach die Konturen ihres Spiegelbilds, als folgte er einem Fußgänger vor dem Fenster. Manchmal ging sie mit Absicht viermal von der Spüle zur Küchendurchreiche, nur um zu sehen, wie sein Kopf hin- und herpendelte.
Ihr Nicken, noch bevor er überhaupt zur Tür herein war, verhinderte, daß er zu ihr herüberkommen konnte. Sie fürchtete, daß er herüberkommen und sie am Arm mit sich zerren würde, während die anderen Gäste verstohlen wegsahen. Sie hatte etwas Falsches gesagt oder zu laut gesprochen, und ihr fremdartiges Sprechen hatte sie bloßgestellt. Er würde kommen, sie nach ihrer Arbeitserlaubnis fragen, nach dem Visum und dann ihren Arm packen, mit den aufgerissenen Nägeln in ihren Oberarm greifen und sie auf die Straße hinausführen wie ein Gentleman; solange sie im Lokal waren ganz wie ein Gentleman, aber waren sie erst draußen, war ihr Gesicht in der Pfütze zu sehen; je häufiger sie nein sagte, desto deutlicher. Kopfüber in der Pfütze, es war eine Verwechslung, das Bild in der Pfütze gehörte in ein anderes Land, und niemand kam und holte sie, befreite sie aus diesem Griff, mit dem Blut unter den Nagelrändern; kleine klumpige Aufwürfe seiner Nervosität am Fenster, als er noch über den reibungslosen Ablauf nachgedacht hatte. Reibungslos und unauffällig.
Samstags blieb er, bis sie zumachten, das war gegen drei Uhr morgens. Die U-Bahnen fuhren um diese Zeit nur noch unregelmäßig, und sie war jedesmal beunruhigt, wenn sie ihn hinter sich her zur selben Station laufen hörte. Sie hatte vermutet, er würde es absichtlich tun, und war an einer Straßenecke stehengeblieben.
Als Jeff an diesem Samstag hereinkam, versuchte sie, ihm einen Platz anzubieten. Sie legte ihre Hand mit der geöffneten Handfläche nach oben auf einen der Barhocker. Die Lichter der Bar waren noch nicht eingeschaltet, und er gab vor, sie nicht zu verstehen, und zeigte zu seinem Tisch am Fenster. Aber ihre Handbewegung aus dem Halbdunkel war eine stumme Verpflichtung. Er mußte schon deshalb zu ihr hinübergehen, weil er nicht wußte, wie er sonst auf diese Handbewegung reagieren sollte.
Die Frau sagte kein Wort, während er umständlich die Tasche abstellte und sich setzte. Er hätte jetzt gern ihre Stimme gehört. Sonst wurde sie geschluckt vom Lärm der Kneipe, in Rauch und Gerede, wo es ihm unmöglich war, sie von den anderen zu unterscheiden. Jetzt, am späten Nachmittag, war es still. Jeff hatte ihre Stimme nie gehört. Sie fehlte einfach.
Der Barhocker, den sie ihm anbot, stand am hinteren Ende der Theke, so daß sie nur in seine Nähe kam, wenn sie Milch aus dem Kühlschrank nehmen mußte. Sie stellte die Espressomaschine an, füllte die Eiswürfel nach und zählte das verbliebene Geld in der Kasse, damit später die Abrechnung stimmte. Er sah weg. Aber er saß genauso eisern dort auf dem Barhocker, die Ellbogen vor sich auf die Theke gestützt, wie er sonst immer an seinem Tisch saß. Sie hätte gern mit jemandem geredet. Jemand, der nicht fragte, wo sie herkam, mit dem sie über ganz normale Dinge reden würde. Er war der einzige nach Monaten, mit dem sie begann, es sich vorzustellen, obwohl sie den Grund nicht hätte nennen können.
Damals an der Straßenecke schien er sie übersehen zu haben. Er war an ihr vorbei über die Straße und zur U-Bahn an der 14.Straße gegangen.
Vielleicht lag es an seiner unbeholfenen Art. Er schien immer noch zu glauben, sie hätte seine Blicke nicht bemerkt. Wenn sich ihre Augen zufällig trafen, tat er so, als müsse er blinzeln.
Während des ganzen Abends versuchte er, ein Gespräch mit ihr anzufangen. Dann ging er nach Hause. Sie konnte sicher sein, daß er wiederkam.
»Sind Sie so was wie ein Agent? Wegen der Tasche.«
»Ich schreibe Softwareprogramme für Architekten. Damit kann man Fertighäuser berechnen. Villen. Was Sie wollen.«
»Tatsächlich.« Sie ging mit dem Lappen über die Bar.
»Ich dachte, ich würde Sie beobachten.«
Jeff war absichtlich noch früher gekommen als gestern. Er saß auf dem Barhocker und sah sie an, wie sie ungeschickt die Gläser über die Bürsten stülpte, die Gesten der Freundlichkeit, die sie überhaupt nicht beherrschte. Er war überrascht, als sie plötzlich anfing mit ihm zu reden.
Sie sprach langsam, merkwürdig akzentuiert und mit altmodischen Worten. Es war eine schwerfällige Melodie, die er als deutsch identifizierte und die ihm klarmachte, daß sie hier noch nicht viel gesprochen hatte. Aber wie sie lächelte und darüber hinwegging, als wäre ihr nichts davon anzumerken, faszinierte ihn. Er beschloß, nichts dazu zu sagen. Außerdem erinnerte ihn die Art, wie sie sprach, an früher.
Er hatte früher mit Beton gearbeitet und ohne Handschuhe. Davon war die Haut an den Fingerkuppen und in den Handflächen aufgerissen, und vom Zusammenwachsen waren schwarze Striche übriggeblieben. Er hatte die Mischmachinen bedient, aus denen der flüssige Beton in die Baugruben schwappte. Dann war er mit einem Brett darübergegangen, bis der Boden eben war und eine feste Schicht die zukünftigen Kellerräume von der Erde ringsherum abtrennte. Bei jeder Berührung mit dem flüssigen Material war die Haut weiter aufgerissen. Das war schmerzhaft gewesen, aber vor allem hatte es ihm das Gefühl gegeben, ganz nah am Leben zu sein.
Er hatte mit Beton gearbeitet, um den Büros zu entkommen und den Anzügen, die jede Woche gewechselt werden mußten. Für ihn waren Anzüge wie Papphäuser. Wie das Papphaus seiner Mutter, das auf einem Feld in Michigan stand. Es war ein großes, gelbes Haus, und es war auf Rädern angeliefert worden. Wenn der Roggen hochstand, war das Haus darin nicht mehr auszumachen. Es war gelb gestrichen wegen der Tiere, die im Herbst gejagt wurden. Auch die Menschen trugen dann gelb. Jede Familie, die in dieses Gebiet zog, bekam zuerst eine Anzahl gelber Westen und Kappen ausgeteilt, die sie von Oktober bis November tragen mußten, sobald sie aus dem Haus gingen. Damit die Jäger sie nicht mit Wild verwechselten. Es war gefüttertes, festes Wetterzeug, von dem der Regen abperlte, und die Leute waren froh, daß sie es auf diese Weise kostenlos bekamen. Die Schüsse der Jäger waren überall im Feld, ununterbrochene Fragen und Antworten, durch die der Schlaf wie durch ein Sieb fiel. Aber wenn er aus dem Fenster seiner Mutter sah, war nur das Korn da. Das Gelb. Sonst nichts. Als gäbe es für zwei Monate keinen Menschen mehr. Selbst ihn gab es nicht mehr, sobald er in dem gelben Haus am Fenster stand. Nur für die Zeit, die er im Beton arbeitete, hob er sich von der Umgebung ab.
Jeff wartete darauf, daß sie weiterredete. »Würstchen mit Ketchup, Scheißwetter draußen«, sagte jemand neben ihm und klopfte mit seinem Schlüsselbund auf den Tresen, und die Frau, deren Namen er noch nicht wußte, ging hinüber zur Küche, um die Bestellung aufzugeben.
»Und Sie müssen hier jedes Wochenende –?« versuchte er es, als sie zurück war. »Ist das nicht anstrengend?« Sie lachte.
Anfangs hatte die Arbeit sie abgelenkt. Die Handgriffe waren ungewohnt. Wenn das Spülen zu lange dauerte, schmolzen die Eiswürfel im Whisky, den sie gerade abgefüllt hatte, oder sie hielt das Bierglas beim Zapfen nicht in der richtigen Schräglage, und der Schaum schwappte über. Aber nach ein paar Tagen kannte sie die Bewegungen schon auswendig, und es kam alles wieder. Die Enttäuschung, die unerwartete Ratlosigkeit darüber, in diesem Land zu sein. Ein endloses Wippen der Gedanken. Und eine Angst, die so aussah, als wäre es die Angst davor, wieder ausgewiesen zu werden. Dann hatte sie angefangen, sich mit Jeff zu beschäftigen.
»Ein bißchen strengt es schon an«, sagte sie. »Da haben Sie recht.«
»Sie klingen nicht sehr begeistert.«
»Nein«, sagte sie, »aber dafür macht man das ja auch nicht, oder?« Sie lachte wieder.
»Nein? Verdient man denn so gut?«
»120 Dollar die Woche. Plus Trinkgeld –«
Jeff sagte nichts darauf. Er dachte an Projekte, in denen er dasselbe in einer Stunde verdiente. Als er nachschenkte, rann ihm der Kaffee über den Tassenrand. Sie kümmerte sich darum ohne ein Wort.
»Sind Sie Schauspielerin?«
»Wieso?«
»Alle Kellnerinnen im Village sind Schauspielerinnen.« Während er seine Ärmel aufknöpfte und umschlug, vermied er es, sie anzusehen. »Ich dachte schon, Sie wollten gar nicht mit mir reden.«
»Bei der Lautstärke –«, sagte sie.
»Drüben am Tisch hätte ich Sie gut verstehen können.«
Jeff war ein gewöhnlicher Gast, ein bißchen verschroben, und niemand sonst im »White Horse« schenkte ihm Beachtung. Er war der einzige hier, der Milch wollte. Sie füllte die Milch in eine Kanne, bevor sie sie ihm hinüberschob.
»Wie haben Sie die Frage gemeint, vorhin?« fragte sie.
»Welche Frage?«
»Ob ich hier jedes Wochenende – Finden Sie das merkwürdig?«
»Ich weiß nicht. Wollten Sie nie was anderes machen?« Seine Augen forschten wie vorher, drüben am Tisch. Nur waren sie jetzt noch näher, und sie konnte die kurzen Wimpern erkennen, eine Narbe an der linken Braue. Die Augen forschten entlang der Nischen ihrer Schlüsselbeine, in ihren Haaren und in den Öffnungen zwischen den Blusenknöpfen. Es waren Augen, die sich für das Öffnen von Blusenknöpfen interessierten. Das beruhigte sie. Vorsichtig rückte sie an der Milchkanne.
»Das ist schon etwas anderes jetzt«, sagte sie.
Als Jeff sich umdrehte, saß ein Mann an seinem Tisch am Fenster und sah auf die Straße.
»Ja«, sagte er. »Das ist schon anders.« Das Gesicht des Mannes spiegelte sich im Glas. Er war die ganze Zeit von hier aus deutlich zu sehen gewesen.
Die Frau tauschte seine Kaffeetasse gegen ein Rotweinglas. Wenn er jetzt mit ihr trank, würde morgen früh nichts korrigiert sein. Er brauchte noch wenigstens drei Stunden. Sie ging mit den Fingern in den Flaschenhals, um einen Korkkrümel herauszufischen, als gingen die Finger in seine Jeans.
»Sie haben recht«, sagte sie und betrachtete den Krümel auf ihrer Fingerspitze. »Ich war mal am Theater. – Nur, weil Sie gefragt haben.« Dann klickte sie ihr Glas gegen seins. »Das haben Sie gut gemacht.«
Er wußte nicht, was sie vorhatte. Das Glas lag in ihrer halbgeöffneten Hand, und sie hob es ihm entgegen. Jeff schob die schwarze Tasche mit der Schuhspitze unter die Bar. »Noch habe ich gar nichts gemacht«, sagte er.
Sie schlief mit ihm, und die Fremdheit verging, nachdem sie sich einmal an den Geruch seiner Haare gewöhnt hatte. Schlehenshampoo. Das Kissen roch danach und das Laken, und wenn er ihren Kopf auf seinen Oberschenkel herunterzog, rochen auch dort die Haare nach Schlehenshampoo.
Er hatte nicht vorgehabt, in seine Wohnung zu gehen. Er konnte sich nicht vorstellen, wie sie dort hineinpaßte. Zwischen die beiden Computer und die riesigen Stehlampen, die er gegen die Nacht draußen gerichtet hatte, um länger arbeiten zu können. Er hatte nur eine Hälfte seines Bettes bezogen, und es war unpassend, diese Frau zu sich zu nehmen, wie er im Laufe der Zeit, die er in New York wohnte, hin und wieder eine Frau mitgenommen hatte.
»Sie haben doch noch hier zu tun.«
»Sie glauben mir nicht?«
»Das sollte kein Vorwurf sein.« Er klappte die Handflächen gegeneinander. »Ich lauf Ihnen ja auch nicht weg.«
»Ich würde gern gleich gehen.« Plötzlich war es das erste, was geklärt werden mußte. Sonst würde es allem übrigen im Weg stehen. Es war etwas Ähnliches wie das Angebot, sich zu duzen. Versäumte man es im richtigen Moment, blieb immer die Unsicherheit in der Anrede. Er trank den Wein nicht hektisch. Er wurde nicht naß auf der Oberlippe, als sie ihm schließlich zunickte und den Mantel nahm. »Wir können nicht zu mir. Ich wohne hier nicht.«
»Was?« Er rannte fast in ein Taxi. »Wo schlafen Sie denn?«
»Bei einem Bekannten.«
»Aber Sie arbeiten doch schon vier Monate hier.«
»Ja. Für 120 Dollar die Woche.«