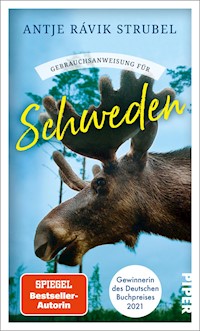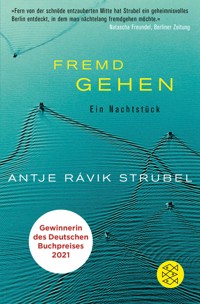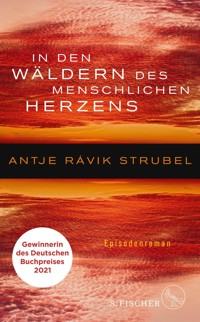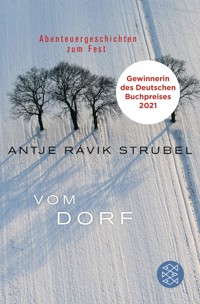8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Antje Rávik Strubel erzählt von einer ungewöhnlichen und unabwendbaren Liebe und von den langen Schatten eines untergegangen politischen Systems. Eine Insel in der Ostsee. Der junge Erik verliebt sich in die scheinbar unergründliche Vogelforscherin Inez. Aber die beiden werden beobachtet. Ohne es zu ahnen, sind sie längst in eine politische Intrige verstrickt. Die geschützte Insel wird zum schutzlosen Ort. Ein Roman, der von einer großen Liebe erzählt, von den Erinnerungen, Legenden und Lügen unserer Gegenwart, aber auch vom Glück, das im Vergänglichen liegt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 484
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Antje Rávik Strubel
Sturz der Tage in die Nacht
Roman
Über dieses Buch
Während eines Tagesausfluges zu einer Vogelschutzinsel in der schwedischen Ostsee begegnet Erik, ein junger Mann Mitte zwanzig, der Ornithologin Inez. Sie fasziniert ihn, und so bleibt er. Doch Inez ist zurückhaltend, scheint von einer Vergangenheit verfolgt, die Erik reizt. Er beginnt, ihr nachzujagen. Mit Erik ist ein Mann auf die Insel gekommen, der ebenfalls nicht abreist, Rainer Feldberg. Nach und nach findet Erik heraus, dass zwischen diesem Mann mit undurchsichtigen Motiven und Inez eine alte Verbindung besteht. Erik wird in diesem Sommer nicht nur in die gefährdete Welt der Vögel, sondern auch in eine Geschichte eingeweiht, die ihn selbst gefährdet und seine Liebe bedroht: die Lebensgeschichte eines ostdeutschen Jungen, die als Stasilegende und Politstory erfunden wird.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Antje Rávik Strubel veröffentlichte u.a. die Romane ›Unter Schnee‹ (2001), ›Fremd Gehen. Ein Nachtstück‹ (2002), ›Tupolew 134‹ (2004), sowie den Episodenroman ›In den Wäldern des menschlichen Herzens‹ (2016). Ihr Werk wurde mit zahlreichen Preisen geehrt, ihr Roman ›Kältere Schichten der Luft‹ (2007) war für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert und wurde mit dem Rheingau-Literatur-Preis sowie dem Hermann-Hesse-Preis ausgezeichnet, der Roman ›Sturz der Tage in die Nacht‹ (2011) stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises. Antje Rávik Strubel wurde mit einem Stipendium in die Villa Aurora in Los Angeles eingeladen sowie als Writer in residence 2012 an das Helsinki Collegium for Advanced Studies. 2019 erhielt sie den Preis der Literaturhäuser. Ihr Roman ›Blaue Frau‹ wurde mit dem Deutschen Buchpreis 2021 ausgezeichnet. Sie übersetzt aus dem Englischen und Schwedischen u.a. Joan Didion, Lena Andersson, Lucia Berlin und Virginia Woolf. Antje Rávik Strubel lebt in Potsdam.
www.antjestrubel.de
Impressum
Erschienen bei Fischer E-Books
© 2011 S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: José María Sicilia. © VG Bild-Kunst, Bonn 2024. Foto: akg-images, Berlin
ISBN 978-3-10-401600-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Für Zaia
I was an infant [...]
maybe we’ll find something
Es hatte begonnen, wie [...]
DIE FLINTKUGEL
PLINTHOSELLA SQUAMOSA
INEZ RAUTER
FELIX TON
INEZ RAUTER
DIE FLINTSCHALE
PLINTHOSELLA SQUAMOSA
INEZ RAUTER
FLINT
DAS MEER
PLINTHOSELLA SQUAMOSA
FELIX TON
RAINER FELDBERG
INEZ RAUTER
DAS MEER
PLINTHOSELLA SQUAMOSA
FELIX TON
DIE FLINTSCHALE
DAS MEER
DIE FLINTKUGEL
DAS MEER
[Dank]
Für Zaia
I was an infant when my parents died.
They both were ornithologists. I’ve tried
So often to evoke them that today
I have a thousand parents.
Vladimir Nabokov
maybe we’ll find something
else entirely, whose exact nature unfurls wing and fin,
eggshell and cocoon/as if the world above became
perilous forever/’for the lack of’/a passage/from dust
to the perceivable, to the obtained
Craig Perez
Es hatte begonnen, wie es immer beginnt. Es beginnt auch jetzt noch immer.
Es beginnt auf diesem Wasser, auf dem Weg zurück. Die Fähre dreht, und ich sehe mich noch einmal um. Ich versuche, mir einzuprägen, wo ich gewesen bin; die Kate, die Felswand, der Leuchtturm, die schwimmenden Pontons am Strand.
Inez ist schon verschwunden. Sie ist langsam über die spitzen Kiesel den Strand hinaufgegangen zum Café. Im Schatten verwischen sich ihre Konturen. Die Sicht verschwimmt.
Beim Abschied drängte sich einer der Journalisten zwischen uns. Er schüttelte Inez die Hand.
Ich flüsterte ihr hastig zu, dass ich wiederkommen würde.
»Ich freu mich drauf«, sagte Inez. Ihre Stimme hatte diesen rauen Klang verloren, in dem sie nachts mit mir geflüstert hatte. Ihr Lachen war nicht mehr ihr Lachen vom Strand. Ich berührte ihren Unterarm flüchtig. Die Sonnenbrille verdeckte die Hälfte ihres Gesichts.
Das Boot nimmt Fahrt auf. Ich schaue zurück.
Inez und die Insel schwanken.
Weiß blitzt die Ostsee in der Ferne auf. Schaumkämme beherrschen die Wellen. Sie werden breiter, zinken länger aus, greifen tief hinein ins graue Wasser. Sie kämmen die Ostsee in Richtung Strand. Lange Strähnen, die der Wind auseinandertreibt und wieder zusammenschiebt, klatschen ans Ufer. Die Ostsee ist verspielt. Im Grunde ist sie nur ein See, aber sie öffnet sich dem Atlantik weit genug, um den Anschein eines Ozeans zu erwecken. Die Ostsee täuscht das Meer gewissermaßen vor. Um die Glaubwürdigkeit der Täuschung zu erhöhen, bringt sie einzelne Elemente des Meeres ins Spiel: Salzwasser. Muscheln. Feuersteine und Lummen.
Inez steht am Strand, die Augen mit der Hand abgeschirmt. Sie will den Jungen noch einmal sehen; das Haar bis zum Nacken, seinen offenen Blick, die verwahrlosten Hände. Aber die Fähre hat schon abgedreht. Von Erik ist nicht einmal mehr der Umriss erkennbar.
Sie dreht sich um und fixiert das Café. Die Bemerkung der Journalistin geht ihr durch den Kopf:
»Sie haben doch was miteinander. Sie und der Junge.«
»Wir haben alles«, hat sie geantwortet.
DIE FLINTKUGEL
Es hatte begonnen, wie es immer beginnt. Es beginnt immer unmerklich. Im Nachhinein lässt sich nicht mehr genau sagen, wann. Der Beginn wird sofort in das Geschehen hinein aufgelöst, in das von der Bootsschraube aufgeworfene Wasser, in den Unsinn, den ich Inez sagte, in das endlose Kreisen der Vögel, die Cirruswolken, den Wind.
In Wahrheit wird es diesen Moment, in dem es begann, nicht gegeben haben. Ich fange an, danach zu suchen, wo alles unwiderruflich geworden ist. Im Nachhinein. Erst jetzt sieht es so aus, als wären die Ereignisse tatsächlich zwangsläufig aufeinander gefolgt, weil es die Geschichte in der Rückschau so verlangt. Ich suche nach einem entscheidenden Auslöser, weil ich die Wahl gehabt haben möchte, weil ich glauben möchte, dass ich irgendwann tatsächlich vor einer Entscheidung stand. Und das ist vielleicht der Irrtum.
Es hätte mit dem türkisfarbenen Leuchten des Wassers am Ufer beginnen können. Mit dem dürren Schatten, den der Ginsterbusch auf die weißverputzte Wand von Inez’ Schlafzimmer wirft. Es hätte mit dem Himmel beginnen können, ein Himmel, der an stillen Mittagen so türkis ist wie das Meer. Dann werden aus den Flecken, die vor der Insel auf dem Wasser treiben, Algen, grüner Schlick, der an der Bootswand hängen bleibt. Später wischt die Gischt ihn wieder ab. Es hätte auch viel früher beginnen können, vor der Reise oder, wenn man an Schicksal glauben will, mit der Geburt. Es hätte damit beginnen können, wie wir, Inez und ich, geboren wurden.
Die Insel liegt da wie vor drei Monaten. Eine umgestülpte Untertasse. Auch der Kapitän ist derselbe, ein blasser Mann in einem roten Pullover, der immer eine Tüte Pistazien dabeihat und die Schalen aus dem offenen Fenster wirft. Der Wind treibt sie ab. Im Passagierraum liegt eine Zeitung von gestern, die Dagens Nyheter, die er vom Festland mitbringt, um sich die Wartezeiten zu vertreiben. Im Sommer legt die Fähre gegen elf Uhr morgens vor der Insel an und bringt Touristen und holt sie abends um fünf wieder ab. Im Herbst wird der Fährplan geändert, und die Fähre kommt seltener, und wenn ab Oktober die Stürme über das Plateau fegen, wird die Fährlinie eingestellt, und die Insel bleibt unbewohnt zurück.
Das gelbe Gras steht starr im Frost.
Es ist dieser Herbst gewesen, in dem alles begonnen hat, dieser nördliche Herbst mit seiner schneelosen Kälte, mit seiner erstickend frühen Dunkelheit, dieser Herbst mit seinem grau aufschäumenden Meer und den windgepeitschten Felsen. Es begann in der Nacht, in der es mich hinaus auf die Klippe trieb, die fünfzig, sechzig Meter über der Ostsee aufragt, in der ich dort oben stand und daran dachte, es zu tun, es mit derselben Leichtigkeit, mit demselben instinktiven Vertrauen zu tun wie die Vögel, die sich im Juni von den Felsen stürzen, denn ich war reich, und dieses Gefühl war grenzenlos, und ich wusste, dass es nicht über den Moment hinaus dauern würde, nicht länger andauerte als diese Minuten, in denen ich hier oben stand und der Wind so eisig war, dass mein Gesicht taub wurde und es mir den Atem zurück in die Lunge drückte. Ich wusste, dass es das war, was mich bis an die Kante der Felsen trieb, nicht Verzweiflung, nicht der Gedanke, entdeckt zu werden, oder die Angst vor dem, was dieser Entdeckung folgte. Wenn ich mich da oben nicht umgedreht hätte zum rotierenden Leuchtfeuer, wenn ich nicht zurückgeschaut und mir vorgestellt hätte, wie sie da lag mit den über die Schultern gerutschten Trägern ihres dünnen Nachthemdes, sondern wenn ich weitergegangen wäre, noch einen Schritt über den Rand der Klippe hinaus, dann wäre dieser Reichtum in mir für immer in der eisigen Kälte aufgehoben gewesen.
»Inez. Betonung auf dem e.«
»Das gefällt mir. Klingt spanisch.«
Der Herbst, nicht der Sommer war es, der mich so ausgeglüht hat, dass ich das Gefühl haben werde, richtungslos über den Asphalt zu treiben, wenn die Fähre mich in einer Stunde in dem verödeten Hafen von Klintehamn absetzen wird, von dem aus ich im Juni aufgebrochen war.
Ich hatte eine Woche auf Gotland verbracht. Ich hatte mir die Stadtmauer von Visby angesehen und das Klostertheater in Roma, ich war nach Fårö, Gotlands nördlicher Spitze, gefahren, die bis vor wenigen Jahren noch militärisches Sperrgebiet gewesen war. An Fårös Stränden ragen Kalksteinsäulen auf. Sie sind schlank und porös und wirken im Nebel wie steif aufgerichtete Leichname. Abends saß ich vor meinem Zelt und sah die Mücken tanzen. Es wurde nicht dunkel. Die Sonne verschwand nur für zwei Stunden hinter dem Horizont, der bis zum Morgen nachglühte. Ich schlief schlecht.
Ich buchte Zeltplätze für eine Nacht. Die Damen an den Rezeptionen händigten mir das Papierschild in Klarsichtfolie aus, das ich außen an mein Zelt hängte als Zeichen dafür, dass ich für den Platz bezahlt hatte. Sie fragten, wie lange ich blieb. Ich fragte, wo die Sanitäranlagen waren und wo ich Kaffee bekam, und tauschte Kleingeld gegen Metallchips, die ich später in die Duschautomaten steckte.
Die Damen an der Rezeption waren einsilbig. Jungen wie mich sahen sie jeden Tag. Sie waren gerade mit der Schule fertig und lagerten vor ihren Zelten, tranken Lättöl und verbrachten die Tage damit, über Musikgruppen und ihre Zukunft als DJs oder Surflehrer zu reden, wenn sie sich nicht schon morgens die Ohren mit ihren iPods verstöpselt hatten. Ich stellte mir meine Zukunft nicht in einem Club vor. Ich stellte mir nicht vor, halbnackt auf einer Bühne im Stroboskoplicht zu stehen oder auf einem Brett Wind und Wellen ausgeliefert zu sein, ich stellte mir meine Zukunft in jedem Fall bekleidet vor, angezogen, mit Hemd und Krawatte, auch wenn ich jetzt noch in Jeans und Kapuzenshirt herumlief. Ich wollte Wirtschaft und Politik studieren, und ich hatte mich dafür entschieden, weil ich hellblaue oder cremefarbene Hemden mit Seidenkrawatten unter leichten Schurwollanzügen tragen wollte, und zwar täglich.
Nach dem Abitur hatte ich es mit Jura probiert, mich nach zwei Jahren aber für Soziologie eingeschrieben und bald festgestellt, dass beides nicht das Richtige war. Auf einer Party hatte ich aus einem Tarotspiel die neun Stäbe gezogen. Seither musste ich an diese Karte denken, sobald man mich fragte, was ich jetzt machen würde, und weil ich immer mal gar nichts machte, wurde ich häufig gefragt. Neun Stäbe bedeuten Kraft, Vernunft und Selbstkontrolle, und seit ich diese Karte gezogen hatte, wusste ich, dass meine Entscheidung diesmal richtig war.
Bis vor drei Monaten klappte das noch. Da wusste ich noch, dass ich mir zuerst eine Auszeit gönnen würde. Ich wollte ein paar Wochen Ruhe, um dann gestärkt das neue Studium anzugehen und es schnell zu beenden. Krawatten und die Art Anzüge, die ich mir vorstellte, kosten Geld. Auch meine beiden besten Kumpel aus Schulzeiten hatten sich vorübergehend abgesetzt. Sie waren auf Weltreisen unterwegs. Hinterher würden sie mit ihren exotischen Abenteuern protzen und mich fragen, ob ich mich nicht zu Tode gelangweilt hätte da oben im menschenleeren Norden. Ich beneidete sie nicht.
Ich war nach Gotland gefahren. Ich war durch die Landschaft gestreift, und die Landschaft mit ihrem Kalkstein, ihrem struppigen Bewuchs, mit ihren verlassen daliegenden Plateaus, den versandeten Tümpeln und Klappersteinfeldern, auf denen es hunderte Millionen Jahre alte Fossilien gab, hatten mich in Trance versetzt. Ich ließ mich treiben.
Es war die Zeit nach meinem Aushilfsjob in einem Jugendprojekt; verglichen mit dem Zivildienst im Altenheim war das eine leichte Arbeit gewesen, auch wenn es täglich neun Stunden Lärm bedeutete, Drogen bedeutete, Messerstechereien und täglich entweder die Polizei oder das Jugendamt, täglich Rap oder Techno, täglich die Frage, ob du ein Hopper oder ein Emo bist, denn Emos sind schwarzgekleidete Schwulis, schwule Chorkinder, du Arsch, auch das täglich, täglich ich hab deine Mutter gefickt, überhaupt deine Mudder und willste was aufs Maul, und erst hier, unter Kiefern und Ostseewind, ließ die Erinnerung daran nach. Die Einsamkeit, die langen Tage, die Stille in den kleinen Ortschaften entspannten mich.
Am Ende der Woche hatte ich in einem Touristenbüro einen Tagesausflug gebucht; eine geführte Tour auf eine Insel, die der Westküste Gotlands vorgelagert war. Ich hatte Lust, wieder mit jemandem zu reden. Wo es hinging, interessierte mich nicht.
Im Hafen von Klintehamn stand ein Kiosk, in dem schon lange nichts mehr verkauft wurde. Die Fenster waren vernagelt, eine verwaschene Preisliste für Lachs und Heringe hing noch am Holz. Der Parkplatz war schattenlos und leer. Am Kai, an dem das Boot zur Insel ablegen sollte, warteten zwei Frauen mit Wanderstöcken und Knickerbocker, Finninen, wie sich herausstellte. Andere Fahrgäste waren nicht zu sehen. Die Finninen verstanden kein Englisch. Sie sprachen schwedisch mit mir. Vielleicht dachten sie, es würde die Verständigung erleichtern, wenn beide Seiten eine ihnen fremde Sprache benutzten. Das war nicht der Fall. Sie glotzten mich an, als sie kapierten, dass ich nichts verstand. Später banden sie ihre Kopftücher ab. Die Haare darunter sahen aus wie das trockene Moosgeflecht, das sich hier zäh auf den Felsen hielt. Im Passagierraum der Fähre saß eine Familie. Die Großeltern sahen vor sich auf den Tisch, die Mutter schlief, dem Kleinkind lief Rotz übers Kinn.
Als der Bootsmann die Taue löste, kam noch ein Mann über den leeren Parkplatz gerannt. Er riss die Arme hoch. Der Kapitän ließ den Motor im Leerlauf stampfen, bis der Mann an Bord gesprungen war. Er trug eine abgewetzte schwarze Arzttasche. Er war verschwitzt. Das rotblonde Haar klebte ihm an der Stirn, der Sommeranzug hatte Flecken. In der Tür zur Passagierkabine blieb er stehen, als nehme er Witterung auf. Er starrte zuerst die Großfamilie an, dann mich. Ich sah diesem Idioten in die Augen, ey, du Chorkind, was aufs Maul?, bis er sich auf eine der vorderen Bänke setzte.
Nach einer knappen Stunde drehte die Fähre vor der Insel bei. Am Ufer ragte eine Felswand auf. Ihr Schatten fiel auf die Ostsee. Dort, wo kein Schatten war, leuchtete das Wasser türkisblau, am Strand verstreut standen ein paar Holzhütten.
Eine Frau in Khakishorts lief zur Anlegestelle. Sie lief auf die Kaimauer zu. Als sie den Steg erreichte, waren die weißen Träger ihres BHs unter dem Shirt zu sehen. Das Weiß blitzte. Es war weißer als der Sand, weißer als die Farbe der Kalksteine, weißer als das Boot.
Einer der zwei Jungen, die am Ufer standen, fing das Tau und befestigte es an einem Boller. Auf den olivgrünen Shirts, die sie trugen, war der Schriftzug »Stora Karlsö« zu sehen.
Die Frau war schlank. Ihre Arme sahen trainiert aus. Wind und Salzluft hatten ihre Haare gebleicht. Ihre Haut war sonnengebräunt. Aber etwas in ihrer Haltung verriet, dass sie in Stadtwohnungen aufgewachsen war.
Ich sah durch die verschmierten Fenster und dachte daran, dass ich schon heute Nachmittag zurückfahren musste, dass die Fähre bereits um fünf wieder ablegte, dass ich nur sechs Stunden Zeit auf dieser Insel hätte, ich dachte daran, wie wenig das war, wie knapp dieser Ausflug kalkuliert war.
Auf der Kaimauer lagen Taue und Haken, die Frau stand in der Mitte zwischen Boot und Strand. Jeder, der ausstieg, kam sehr dicht an ihr vorbei. Ich registrierte die dünnen Spuren der Wolken am Himmel, die Felsen, auf denen Vögel zu Tausenden brüteten, ich sah das türkisfarbene Meer, die Kalksteine, ich sah die Häuser in der Bucht, die Großfamilie, auf den Schultern das Kind, ich schätzte die Entfernung von hier bis zum Strand, zwischen Kaimauer und Boot, ich merkte mir die eisernen Ringe am Hafenbecken, ich studierte die Fluglinie der Möwen, ich merkte mir, aus welcher Richtung der Wind kam, ich kannte mich nach Sekunden sehr gut in dieser Bucht im Norden der Insel aus.
Als ich die Frau auf der Kaimauer passierte, nahm sie mich flüchtig am Arm.
Das Wasser glitzerte.
Auch sie hatte damals keine Vorahnung, dass ich kommen würde. Sie konnte nicht ahnen, dass ich auf einer der Fähren sein würde, die zwischen Gotland und den vorgelagerten Inseln verkehrten. Sie ahnte nicht, dass ich überhaupt kommen würde, sie kannte mich nicht.
Ich registrierte die Berührung ihrer Hand so genau, als hätte ich darüber einen Bericht schreiben müssen. Sie nahm mich flüchtig und grundlos am Arm, mehr ein Reflex, weil es auf dem Kai an dieser Stelle sehr eng war. Dann drehte sie sich um und ging zurück zum Strand. Die Finninnen folgten ihr.
Sie winkte uns vor einen Fahnenmast. Felssteine waren zu einem kleinen Podest errichtet. Als sie das Podest betrat, fiel das Licht, das in der Nähe des Wassers noch von den hohen Klippen zurückgehalten worden war, auf ihr Gesicht.
Sie setzte die Sonnenbrille auf. Es war eine modische große Brille, die ihre Wangen bedeckte.
»Jemand hier, der kein Schwedisch kann?«
Ich hatte mich hinter die Großfamilie gestellt, das Kind war eingeschlafen. Ich trat vor. Der Rucksackriemen rutschte mir von der Schulter, der Riemen blieb in der Ellbeuge hängen.
»Wie heißt du?«
»Erik.«
»Gut, Erik. Du gehst zu Guido. Der übersetzt dir, was ich sage.« Ihr Englisch klang rau und arrogant.
Guido war einer der beiden Scouts. Er stand neben dem Eingang zum Café und hatte den typischen Quadrathaarschnitt der Schweden. Er machte eine nervöse Kopfbewegung, als ich zu ihm kam. Das Café war nur wenige Schritte von der Fahnenstange entfernt, und ich hörte ihre Ansprache, aber ich verstand sie nicht. Ich sah, wie der Rotblonde seine Arzttasche zwischen die Füße schob. Er stand aufdringlich nah am Podest.
Der Scout machte lustlos eine Belehrung mit mir. Er erklärte, dass ich keine Pflanzen abreißen durfte, dass ich nicht in die Vogelschutzzonen laufen sollte, und ich zwang ihn, mir in die Augen zu sehen.
Bis zum Beginn der Führung blieb mir noch Zeit. Ich drehte eine Runde zwischen den Holzhäusern. Ich war allein. Die anderen standen immer noch vor dem Fahnenmast. Ich konnte die Finninnen lachen hören, ich hörte sie noch, als ich schon außer Sichtweite war. Am Ende des Strandes, wo der Sand in dorniges Gestrüpp überging, gab es eine alte Fischerkate, die Tür war offen. Auf einem Tisch stand ein Wasserkrug, an den Wänden sah ich zwei Pritschen, eine Sturmlampe stand auf dem Boden. Vielleicht schlief sie hier, dachte ich. Vielleicht schlief sie bei offener Tür, die Kate hatte keine Fenster. Ich stellte mir alles genau vor, ein Pyjama, weiß wie die Träger ihres BHs, ihr Arm hängt von der Pritsche, so dass ihre Hand fast den Boden berührt, die Haare aufgelöst auf dem Kissen, das Kissen ein mit Stroh gefüllter Sack, der unter dem Gewicht des Kopfes nicht nachgibt, die Feuchtigkeit, die sich im Stroh sammelt und in ihre Träume dringt, Träume, in denen ein Junge den Strand hinaufkommt, sich der Tür nähert und an den Türpfosten gelehnt wartet, bis sie endlich wach wird und ihn sieht.
Ich begann zu schwitzen. Bei der Vorstellung, nicht vor heute Nachmittag hier wegzukommen, schien mein Brustkorb zu schrumpfen, ich bekam keine Luft mehr. Mir wurde übel, und in meiner Panik dachte ich, dass jede medizinische Hilfe, jeder Rettungshubschrauber zu spät käme. Ich fiel in den Sand. Ich versuchte, mich zu beruhigen. Das Wasser war klar. Die Sonne stand hoch. Es war warm. Ich war zufrieden mit meinem Leben, ich hatte nichts versäumt. Also war es egal, ob ich früher oder später starb.
Das half. Die Führung wollte ich nicht mehr mitmachen. Ich konnte mich ins Café setzen und die Überschriften der Dagens Nyheter erraten. Ich hatte das in der letzten Woche oft getan. Ich hatte in Cafés in Visby oder Slite gesessen und mir die Zeitungen angeschaut, und nach einer Weile hatte ich immer mehr Worte verstanden. Mittlerweile erfasste ich sogar, wenn es um einen Raubmord in der Nähe von Uppsala ging, einmal hatten zwei Jungen eine vierköpfige Familie in Stockholm mit Küchenmessern erstochen, ein andermal hatte die Integrationsministerin, eine zierliche, schwarze Frau, von den Ausländern in Schweden größere Anpassungsbereitschaft verlangt. Mein Schwedisch bestand hauptsächlich aus Zeitungsvokabular.
Der Rotblonde trottete in meine Richtung über den Strand. Er hatte Mühe, über die rutschigen Felsen hinaufzukommen. Er blieb stehen und gestikulierte. Aber ich tat, als wäre ich an den Wolkenformationen am Horizont interessiert, und ging dann wie absichtslos auf der anderen Seite der Bucht zum Museum hinauf.
Sie war schon dort. Sie saß auf einer Bank in der Sonne. Sie hatte sich an die Hauswand gelehnt, einer der Scouts stand vor ihr und sah ihr andächtig zu, wie sie beim Reden immer wieder ordnend in die Luft griff.
Als sie mich bemerkte, hielt sie mir die Hand hin und sagte auf Englisch: »Inez. Betonung auf dem e.«
Ich zögerte. Meine Hand schwitzte. Aber sie griff umstandslos zu. Ihr Händedruck war kräftig. Sie musste sich während ihrer Zeit auf der Insel, in der sie mit Männern und Vögeln arbeitete, diesen Händedruck angewöhnt haben. Er war eine sachliche Angelegenheit. Ich musste unwillkürlich daran denken, wie sie mit derselben Hand Vögel beringte, wie sie den Vögeln ins Gefieder griff, wie die Krallen ihre Finger umschlossen.
»Man könnte meinen, hier ist nicht viel los«, sagte sie. »Aber ich bin jetzt schon drei Jahre hier. Und es gibt immer was Neues.« Sie sah mich an. »Jungs wie du fahren doch lieber als Fruitpicker durch Australien!«
»Ich habe keinen Bock auf Himalayas oder prekäre Lebensverhältnisse oder irgendeine abgefahrene Kultur.«
»Was Besonderes also.« Sie tippte mit dem Finger anerkennend auf einen Punkt in der Luft.
»Und ich wette, du bist auch nicht vom Bullerbü-Syndrom befallen.«
»Ich hatte mal Scharlach als Kind.«
Sie lachte. »Bullerbü ist keine Krankheit. Das ist volkstümliche Verharmlosung. Kitsch. Aber du hast recht. Das kann hochansteckend sein. Wenn du willst, können wir übrigens aufhören, englisch zu reden«, sagte sie dann auf Deutsch. »Ich habe mich schon so daran gewöhnt, dass ich es manchmal vergesse.«
»Dann hättest du die Einführung auf Deutsch mit mir machen können.«
»In deiner Gruppe dürfte das außer dir keiner verstehen.«
»Es ist nicht meine Gruppe«, sagte ich.
»Auch noch ein Einzelgänger!« Sie lachte wieder und sagte auf Schwedisch etwas zu dem Scout, der im Museum verschwand und mit dem Modell eines großen, schwarzen Vogels zurückkam.
»Du bist doch auch nicht die einzige Deutsche hier, oder? Und trotzdem sind es nicht deine Leute.«
»Du glaubst gar nicht, wie viele deutsche Forschungsprogramme es in Skandinavien gibt.« Sie klappte die Flügel des Modells auf. »Die skandinavischen Forscher wandern deshalb schon in die USA ab. Deshalb oder weil sie den Regen satt haben«, sagte sie. »Sie haben den Regen satt, und wir Deutschen wollen die Naturidylle, den Bullerbü-Kitsch. Und jeder von uns tut so, als gebe es für unser Herumwandern irgendeine wissenschaftliche Notwendigkeit.« Sie stellte den Vogel mit geöffneten Schwingen auf die Bank. Die anderen kamen den Pfad zum Museum hinauf. »Wir alle gehen einfach dahin, wo es uns am besten gefällt. Die passende Notwendigkeit fällt uns schon ein.«
»Dann ist das hier ein heißes Forschungspflaster«, sagte ich lahm. »Ich kann vor meinen globalisierten Kumpel mit den Forscherinnen auf Gotland protzen!«
»So jung und schon so gezielt auf Brautschau«, sagte Inez ironisch und stand auf. »Aber, tut mir leid. Ich muss dich trotzdem wieder Guido überlassen.«
Sie hatte Guido an diesem Tag die Führung der Tour übertragen, weil an ihrem Minitraktor die Kette gerissen war. Der Fährkapitän hatte ihr vom Festland eine neue mitgebracht und wollte sie einbauen, bevor er wieder ablegte. Als sie hinunter zum Kai ging, drehte sie sich noch einmal um. »Erik!«, rief sie und betonte das i, so dass auch mein Name auf einmal spanisch klang. »Im Museum liegen Infoblätter auf Deutsch. Nimm dir eines. Sie sind schlecht übersetzt, aber da steht alles drauf, was du wissen musst.«
Ich hatte mir eines genommen, und sie waren schlecht übersetzt, aber nichts von dem, was ich hätte wissen müssen, hatte auf diesen Infoblättern gestanden.
Später, wenn wir miteinander schliefen, tauchten diese ersten Eindrücke manchmal vor mir auf, und auch jetzt auf der Fähre, als die Insel in der Ferne verschwindet, kehren sie wieder. Die Festigkeit ihres Händedrucks. Ihr rauer Ton. Die Art, wie sie meinen Namen sagte. Auch ihr in der Sonne vor dem Fahnenmast bloßliegendes Gesicht taucht wieder auf. Im Bett, wenn sie auf mir war und in der Bewegung innehielt und ihr nachspürte, die Augen geöffnet, war ihr Gesicht nackt. Es war hart und wach, und es schien lange her, dass mir jemand erklärt hatte, Sex hätte mit Selbstvergessenheit zu tun. Selbstvergessen war Inez nie.
Jetzt löst sich ihre Gestalt in der Ferne über dem Wasser auf, verschwimmt, wird transparent, eine Lichtspiegelung. Wir haben nicht verabredet, uns aus dem Weg zu gehen. Wir haben überhaupt nichts verabredet. Wir haben nicht auf Wiedersehen gesagt oder uns die Hand gegeben oder umarmt. Wir haben uns nicht verabschiedet. Als würde sich das, was wir erlebt haben, nicht mit dem, was kommt, verbinden lassen. Oder als müsste es offen bleiben, für immer unbeendet.
Inez wird mit niemandem darüber reden, und ich werde Annegret nur das Nötigste erzählen, das, was eine Mutter unbedingt erfahren muss. Aber ich werde auch nie wieder sorglose Affären haben oder One-Night-Stands, die mit einem Milchkaffee morgens in der Küche einer fremden Wohngemeinschaft enden. Ich werde nicht mehr in gelben oder grünen Küchen sitzen und die nächtlichen Eskapaden für das natürlichste Abenteuer der Welt halten, sondern ich werde denken; man merkt mir etwas an, einen Fehler, eine Ungereimtheit, ich werde immer denken, dass ich hier nicht richtig bin.
Ich weiß nicht, was jetzt kommt. In manchen Nächten habe ich mir gewünscht, ich könnte die Zeit zurückdrehen und wieder der Junge sein, der glaubt, Tarotkarten würden ihm die Richtigkeit seiner Entscheidungen bestätigen. Man sucht sich seine Liebhaber nicht aus, hat Inez einmal gesagt, so wenig wie seine Eltern.
Als sie an jenem Tag zum Strand hinuntergelaufen war, um die Kette am Minitraktor auszuwechseln, hatte sich ihr der Rotblonde in den Weg gestellt. Er musste im Café auf sie gewartet haben. Er trat ihr entgegen und griff nach ihrem Arm. Er hielt sie so abrupt fest, dass sie herumgewirbelt wurde. Dann standen sie eine Weile da. Sie versuchte nicht, sich loszumachen. Ich sah ihn grinsen und den Kopf schütteln, ich hörte seine Stimme, aber nicht, worum es ging. Als Inez sich doch losriss und an ihm vorbei wollte, imitierte er jeden Schritt, den sie, ihm rechts oder links ausweichend, machte, so dass es aussah, als stünde sie vor einem Spiegel, der zwar nicht sie, aber jede ihrer Bewegungen wiedergab. Es hätte auch ein Tanz sein können, eine seltsame Choreographie auf einem steinigen Strand, deren Rhythmus der Wind vorgab.
Von heute aus betrachtet, ist dieser Moment am Strand kein Tanz gewesen. Von heute aus betrachtet, war der Rotblonde vielleicht der Grund, warum ich an diesem Tag nicht zurückfuhr. Aber damals dachte ich das nicht. Damals stand ich vor dem Museum, sah Inez nach und hielt mit der linken meine rechte Hand, um ihren Händedruck möglichst lange zu spüren. Vielleicht bildete ich mir ein, meine Schwindelattacken könnten, seit sie mir die Hand gegeben hatte, für immer verschwunden sein.
Im Leuchtturm hatte ich ein schmales Zimmer gemietet, zuerst nur für eine Nacht, dann für die nächste. Auf diese Weise war ich eine Woche geblieben, immer nur noch für eine Nacht, für einen Tag, mein Rucksack stand gepackt in der Ecke. Jeden Abend dachte ich daran, am kommenden Nachmittag mit der Fähre zurückzufahren, jedesmal legte die Fähre ohne mich ab. Ich stand in diesem Leuchtturm am Fenster und wartete darauf, Inez vorbeilaufen zu sehen.
Ich blieb, obwohl ich meiner Mutter versprochen hatte, ihr beim Umzug zu helfen.
Meine Mutter hatte sich eine Wohnung im Zentrum gesucht. Bisher hatte sie noch in der Neubauwohnung aus den siebziger Jahren gelebt, in der ich aufgewachsen war, in einem dieser Wohnklos, wie man früher sagte, zwei Zimmer und Klo an der Ausfallstraße nach Neustrelitz. Die Wohnung war so klein, dass man im Wohnzimmer die Geräusche aus dem Bad hören konnte.
Die neue Wohnung lag in der Altstadt, nicht weit von der Konzertkirche entfernt. Meine Mutter würde abends ausgehen können, ohne sich um Busfahrpläne oder Taxikosten kümmern zu müssen. Sie würde ins Theater, ins Kino, in Bars gehen, sie würde Männer kennenlernen, und sei es nur für eine Nacht. Sie hatte schon lange keine Männer mehr kennengelernt. Sie hatte keine Männer mehr gehabt, so lange ich mich an sie erinnern kann. Sie hatte es sich nicht gestattet. Sie musste von einem Moment auf den anderen damit aufgehört haben. Gelegenheiten hätte es genug gegeben. Sie war schön. Ich hatte als Kind oft gedacht, dass sie etwas Besseres verdient hätte als dieses Neubaugebiet, dass ihre Schönheit verschwendet wäre in diesen schäbigen Plattenbauten mit einheitlich gestrichenen Balkons, Männern in Rippenshirts und Frauen, die nach Buletten rochen und die ich dafür hasste, dass sie meine Mutter, nur weil sie auch hier wohnte, als eine der ihren betrachteten. Ich sah meine Mutter in einer dieser Fernsehserien, in denen blitzende Pools vorkamen und Menschen, die auf Sonnenliegen unter Palmen Cocktails tranken, was ich damals für den Inbegriff von Luxus hielt. Dort gehörte meine Mutter hin. Das sah man an ihren weiten Kleidern, das spürte ich in ihrem weichen, milden Duft, den sie auflegte, wenn sie das Haus verließ, das sah ich jedesmal, wenn sie sich in ihre Haare einen frischen Kastanienton hineinwusch. Mit ihrem ausgreifenden Schritt und den weit vor und zurück pendelnden Armen, was zusammen einen vollkommenen Rhythmus ergab, fiel sie auf. Aber selten hatte sie die Blicke, die sie trafen, erwidert. Anspielungen ignorierte sie. Und wenn sie in meiner Gegenwart einen Zettel zugesteckt bekam, sagte sie lachend: »Schon wieder einer, der seinen Tippschein auf den letzten Drücker abgibt.« Sie arbeitete bei der Post und nahm auch Lottoscheine entgegen. Erst als ich älter wurde, fiel mir auf, wie wenig ihre Arbeit bei der Post in das Bild von Pools und Cocktails passte.
Gelegenheiten hätte es beispielsweise im Sommer gegeben, auf den Grillfesten des Rudersportvereins. Meine Mutter war weder sportlich, noch hätte sie sich je in einem Verein angemeldet. Es war mein Vater, der verschwundene Mann, der dem Verein seines Betriebes beigetreten war, und meine Mutter fuhr zu den Grillfesten immer noch mit. Sie wurde jedesmal eingeladen, und ich habe nie herausgefunden, von wem. Sie gehörte dazu. Sie hatte sich mit einer alleinstehenden älteren Frau angefreundet, in deren geräumigem Hauszelt sie schlief, während ich mir mit zwei anderen Jungs ein Baumwollzelt mit Spitzdach teilte. Der Betrieb hatte ein eigenes Areal mit Sanitärgebäude und Volleyballnetz am Tollensesee. An den Nachmittagen fanden Kinderspiele statt; Sackhüpfen, Eierlaufen, Zwei-Felder-Ball. Die Kinder durften sich ihren Spielleiter wählen. Während meine Mutter, ihre Freundin und ein paar andere Frauen das Volleyballnetz straffzogen, Kippen und Wurstpellen aus dem grauen Sand fischten, stellten sich die Männer in einer Reihe auf. Sie trugen schlabbrige, braune Badehosen. Ich weiß nicht, ob braun in meinen Kindersommern in Mode war oder ob es die einzige Farbe war, die die Textilkombinate produzierten.
Die Männer hielten Bierflaschen vor dem nackten Bauch. Sie kratzten sich unter den Achseln und rotzten in den Sand, um uns abzuschrecken. Nicht alle hatten Bock auf Kinder. Aber die Regeln standen fest. Einer von ihnen wurde ausgewählt. Wir tauften ihn Onkel Pelle, und Onkel Pelle hatte bis zum Abend Alkoholverbot und musste mit uns spielen. Er war Schiedsgericht und Kindergärtner in einer Person. Seine einzige Rettung bestand darin, nach der Wahl wegzulaufen. Aber sobald wir ihn erwischten, gehörte er uns.
Manchmal war unter den Männern einer, der sich nicht in Badehosen in die Reihe stellte, sondern in engen Jeansshorts und seidenem, über der Brust offenem Hemd. Wenn er da war, wollten wir ihn. Er rannte nicht besonders schnell, und ich erwischte ihn oft als Erster, und ich erinnere mich, dass ich das auf eine vage, verschwommene Weise für meine Mutter tat.
Aber weder zu ihm noch zu einem der anderen Männer stieg sie ins Boot. Sie ließ sich von ihrer Freundin über den See rudern, in Sonnenhut und Bikini, bevorzugt bei Sonnenuntergang. Die beiden kehrten spät zurück. Oft saßen sie noch lange am Ufer und rauchten.
Hätte meine Mutter Männer gehabt, hätte sie das kaum vor mir verbergen können. Neubrandenburg ist eine überschaubare Stadt. Sie wollte, dass ich nichts anderes in ihr sah als meine Mutter. Kindliche Liebe, fand sie, muss aufgefangen werden, sie braucht einen Halt. Sie hielt nichts von Müttern, die ihre Söhne früh zu Komplizen machen. Sie wollte keine Gleichheit zwischen uns. Sie nahm sich meiner Probleme an, was sie in umgekehrter Weise nie von mir verlangte. Wenn sie doch mal von Schwierigkeiten erzählte, wenn sie beispielsweise am vierten Advent nicht wusste, ob sie noch eine Gans für Weihnachten auftreiben würde, oder überlegte, ob sie sich zur Vorsitzenden des Kollektivs wählen lassen sollte, dann erzählte sie das als witzige Geschichte, die Geschichte einer Fremden, die ich gern hörte, aber sofort wieder vergaß. Männer hätten dieses Verhältnis gestört. Männer hätten den pubertierenden Sohn eines Tages die gleichen Sehnsüchte und Triebe an seiner Mutter entdecken lassen wie an sich selbst.
Sie musste sich das gut überlegt haben. Als ich schließlich zu ihr kam, hatte sie sich ihrer Rolle schon anverwandelt. Sie füllte sie perfekt aus. Bis heute weiß ich nicht, was für ein Mensch sie ist, was sie mag, was ich ihr schenken könnte. Ich weiß nur, was sie mag, wenn es um mich geht, und obwohl ich wusste, dass sie in unserer alten Wohnung schon zwischen gepackten Koffern und Bücherkisten saß, und obwohl es dieses eine Mal leicht gewesen wäre, ihr etwas zu schenken, war ich geblieben.
Der Leuchtturm stand am Ende des Pfades auf den Klippen. Zwischen Turm und Steilküste gab es ein Plateau. Sonnenstühle waren auf dem Felsen verteilt. Wind und Sonne hatten die Schonbezüge ausgebleicht. Vom Zimmerfenster aus konnte ich die Vogelfelsen sehen. Bei geöffnetem Fenster drangen die Schreie der Vögel laut zu mir herein.
Ich war nicht der Einzige, der geblieben war. Der Rotblonde bezog das Zimmer nebenan. Ich hörte ihn, wenn er seine Zimmertür aufschloss. Ich konnte die Sprungfedern quietschen hören, wenn er sich aufs Bett warf. Ich hörte ihn telefonieren. Er telefonierte immer erst nach Mitternacht. Das Licht in meinem Zimmer war ausgeschaltet. Ich lag im Halbschlaf in der hellen Nacht, hörte das Meer und dachte darüber nach, Inez am nächsten Tag auf ein Bier einzuladen.
Wenn der Rotblonde lauter wurde, mischten sich Wortfetzen in das gleichmäßige Anschäumen der Wellen. Ich bin schließlich hierher geflogen, nicht du, und ich hasse fliegen, mein Lieber. … Du kennst mich doch. Ich werde mir was Schönes einfallen lassen. … Ich kann nicht lauter reden. … Wind? Natürlich ist hier Wind, ich bin in einem Leuchtturm! Seine Stimme verklang. Ich träumte, Inez stünde am geöffneten Fenster, stünde an meinem Zimmerfenster und redete mit der Stimme des Rotblonden, und dann war es der Rotblonde, der hinter ihr stand und ihr grinsend die Arme um den Bauch legte, bevor er heftig das Fenster schloss, und irgendwann musste ich eingeschlafen sein.
An jenem ersten Tag auf Stora Karlsö hatte Inez mich gefragt, ob ich sie zu den Brutstätten der Lummen begleiten wolle. Ich hatte sie auf der kleinen Terrasse vor dem Café unter einem der Sonnenschirme sitzen sehen. Die Tour war vorbei. Die Großfamilie lärmte am Strand. Es war vier. Bis zum Ablegen der Fähre blieb noch eine Stunde Zeit. Inez hatte einen Becher Kaffee vor sich und blätterte in einem Aktenordner.
»Erik«, sagte sie erfreut. »Komm her. Setz dich. Hat er brilliert? – Na, ich seh schon«, sagte sie. »Ich hätte die Führung doch selber machen sollen. Wenn du bleibst, kann ich dich heute Nacht mit zu den Vögeln nehmen.«
»Ich habe die Führung verpasst.«
»Nicht so schlimm.« Die Sonne beleuchtete Wacholderbüsche, Schafsdung, hartes Gras. »Das war sowieso nur die Touristenversion. Erst nachts ist hier wirklich was los. Setz dich doch.«
Die Weidezäune vor den schmalen Fenstern waren niedergetreten. Zwischen Farn und Stechginster lag verrottetes Feldgerät, das längst Teil dieser Landschaft geworden war. Der Schatten vom Vordach mischte sich mit dem Halbschatten des gelben Schirms.
»Wenn du Kaffee willst; der in der linken Kanne ist frisch gebrüht. Die andere steht schon seit heute Morgen auf der Wärmeplatte.« Ich sah eine Gänsehaut auf ihrem nackten Arm. Die Luft war kühl. »Hast du schon mal vom Lummensprung gehört?«
»Was für ein Sprung?«
»Nachts werfen die Altvögel ihre Jungen aus dem Nest«, sagte sie. »Sie können noch nicht fliegen. Eine Trottellumme lernt das Schwimmen vor dem Fliegen.«
»Aha. Und das müssen sie nachts lernen?«
»Tagsüber wären sie ein gefundenes Fressen für die Möwen. Die Möwen würden die Küken aus der Luft wegfangen. Deshalb warten die Altvögel, bis es dunkel wird.«
»Hier wird’s doch nie dunkel«, sagte ich, legte den Rucksack auf die Bank und setzte mich daneben. »Sie haben also nur die Wahl, lebendig gefressen zu werden oder sich das Genick auf den Felsen zu brechen?«
»Sie brechen sich nicht das Genick, Erik. Die Natur hat ihre eigene Logik. Die kleinen Vogelkörper sind gepolstert. Eine Art Airbag schützt ihre Knochen. Der Lummensprung ist eine Attraktion. Überleg’s dir.« Sie klappte den Aktenordner zu und legte eine Hand auf den Deckel. »Du bist keiner von diesen Hobbyornithologen, oder? Gut. Das sind nämlich die ganz Schlauen. Man sagt ihnen, Jungs, ich hab das studiert, und trotzdem glauben sie, ihre Feldstecher um den Hals machen sie zu den wahren Spezialisten.«
Sie trug einen breiten, silbernen Ring. Der Ring ließ ihre Hand schmal erscheinen. Es sah aus, als sei das Aderngeflecht ihres Handrückens an ihm befestigt wie die Schiffstaue an den Eisenringen am Hafen.
»Wenn du mich mit zu den Klippen nimmst«, hatte ich zu Inez gesagt und meine Stimme nicht ganz im Griff gehabt, »bleibe ich hier.«
»Sobald die Sonne untergegangen ist.«
Damals bildete ich mir ein, alles mit Sicherheit zu wissen. Und ich hätte das jedem, der es hätte hören wollen, auch mitgeteilt.
Ich bezog ein Zimmer im Leuchtturm. Ich öffnete das Fenster und sah lange über die Klippen aufs Meer. Am Ufer war das Wasser tiefblau, ehe es weiter draußen in immer dunklere, fast schwarze Farbschatten verlief, dann lichter wurde, silbern, und in der Ferne gleißend hell an den Horizont schloss. Es roch nach Tang und dem Holz der Fensterläden. Ich atmete tief die salzige Luft ein und hatte das Gefühl, dass etwas Neues begann, und ich sagte mir, wie dumm das war, wie pathetisch, wo es sich, nüchtern betrachtet, nur um Chemie handelte, um das Vorgefühl von Verliebtheit, denn ich war sicher, dass es das war, aber in dieser Stärke hatte ich eine solche Ahnung noch nie gehabt. Ich erinnere mich sehr genau an diesen Moment am Fenster. Ich war allein, vor mir die Ostsee, so weit, bis sie außer Sicht geriet, sich auflöste ins Nichts und auch ich mir losgelöst vorkam, schwebend, und gleichzeitig hatte ich das warme Holz unter den Händen, das mir ein Gefühl von Festigkeit und Stabilität gab, das Gefühl, den eigenen Körper gut auszufüllen.
Dieser Moment hat auch jetzt, wo alles vorbei ist, noch immer die gleiche Stärke. Er könnte ebensogut der Anfang gewesen sein.
Auf dem Bett lagen zwei Handtücher aus grobem Stoff. Ein Stück Seife lag in Papier gewickelt darauf. Ich wusch mir Hände und Gesicht und überlegte kurz, mich zu duschen, ehe ich bemerkte, dass es im Zimmer keine Dusche gab. Also zog ich mich bis auf die Unterhosen aus und spritzte mir Wasser über den Körper. Ich wollte sicher sein, dass keine Spur von meiner Panikattacke zurückblieb. Im Hafen legte die Fähre ab.
Ich hatte Inez gesagt, dass mir ihr Name gefiel, dass es mir gefiel, wie sie ihn betonte, und ich hatte sie gefragt, ob sie sich das extra ausgedacht hätte, und sie hatte gesagt: »Ist dein Name nicht ausgedacht?«
Ich hatte ihr gesagt, dass meine Mutter mich nach meinem Großvater benannt hatte, und Inez hatte gesagt: »Na siehst du. Da hat sich doch auch jemand etwas für dich ausgedacht.«
Gegen elf Uhr abends hatten wir uns vor dem Museum getroffen. Die Sonne war untergegangen, überzog den Himmel aber noch mit orangefarbenem Licht. Auch um Mitternacht wurde es nicht dunkel. Inez trug Jeans und eine dunkelgrüne Jacke, später setzte sie ein Basecap auf. Wacholderbüsche standen am Weg. Ihre Umrisse waren gezackt wie die Ränder von Briefmarken. Je näher wir den Klippen kamen, desto schärfer roch die Luft. Die Steine waren weiß von Kot. Man hörte die Vögel. Anfangs klang es noch wie Geschrei aus Vogelkehlen, brüchige, hohe, einsilbige Laute, dann wurden die Schreie schriller. Es klang, als zerfetze ein schmaler Bohrer die Luft, als schneide sich Metall in Gestein und kreische im Abgleiten auf. Man konnte die Schatten der Vögel sehen, wenn sie auf den Felsvorsprüngen starteten und landeten, und ich sehe sie jetzt, während die Fähre sich immer weiter entfernt, wie schmelzende Kreuze über die Wellen gleiten.
»Pass auf, wo du hintrittst, Erik. Hier sind überall Felsspalten.«
Sie lief voran. Sie war geübt, und ich hatte Mühe hinterherzukommen.
Am Anfang des Pfades hatte noch getrockneter Schafsdung gelegen, der, wenn man drauftrat, sofort zerfiel. Weiter oben verschwand der Dung, und die Erde auf dem Pfad wurde dünner. Sie lag jetzt nur noch wie Papier auf dem Fels. Darunter konnte man den Körper der Insel sehen, Kalkstein, der sich aufgeworfen hatte zu Buckeln. An einer flachen Stelle wartete Inez auf mich.
»Rennst du immer so«, sagte ich, als ich wieder Luft bekam.
»Du musst kleine Schritte machen«, sagte sie. »Kleine Schritte und gleichmäßig. Und glatte Sohlen sind ganz schlecht. Das hätte ich dir sagen sollen.«
»Typisch Ossi.«
»Wieso?«
»Ossis haben einen entschlossenen Schritt. Irgendwie tough. Sie gehen immer so vorgebeugt, als wäre Gegenwind. Meine Trefferquote liegt bei achtzig Prozent.«
»Dem Klischee nach sind die Ossis die Jammerlappen.«
»Nicht die Frauen. Bei den Ossis sind die Frauen die toughen.«
»Das ist gut«, sagte sie und lachte. »Das werde ich auf der nächsten Konferenz mal als These vorstellen! Sie werden sagen, zum Verhaltensforscher fehlt da noch ein bisschen was.«
»Aber stimmt doch, oder? Du bist aus dem Osten.«
»Ich bin ein Zugvogel«, sagte sie. »Und ich hätte nicht gedacht, dass das in eurem Alter noch eine Rolle spielt.«
»Ich gehöre auch dazu. Deswegen interessiert’s mich.«
»Bist du nicht zu jung für einen Ossi?«
»Ich bin ein Erbe. Beim Mauerfall war ich fast fünf.«
»Da vorn kommt ein Felsvorsprung. Von dort hat man den besten Blick.«»Dann lieg ich also richtig?«
»Du willst jetzt nicht die ganze Nacht mit mir über deine Herkunft debattieren, oder?«
Eine Steinplatte schimmerte auf. An einer Mulde mit Flechten und Moos blieb sie stehen. Wir setzten uns hin. Vor uns fiel der Felsen senkrecht ab.
»Und wo sind jetzt deine Kamikaze-Vögel?«, sagte ich.
»Duck dich in den Windschatten und sei still.«
Es war so eng, dass meine Hand auf ihrem Oberschenkel lag. Sie lag da wie künstlich, wie eine Puppenhand. Ich hielt meine Klappe.
Die Vögel waren wieder lauter geworden. Sie kamen näher, kreisten tiefer über unseren Köpfen, stießen dicht über den Felsen herab. Dann sah ich die Jungvögel. Kleine Ballen, die von den Felsvorsprüngen rollten.
Jedesmal wenn sich ein Vogel schattenhaft aufrichtete, fiel einer dieser Bälle in die Tiefe. Sie sahen aus wie flauschige Kartoffeln. Sie drehten sich, taumelten im Sturz, bei jeder Drehung klaffte der Flaum auseinander, oder das waren aufgesperrte, kleine Schnäbel, es sind die Schnäbel, schrie Inez in das Schreien der Altvögel, das die Luft zerfetzte, sich ins Gehör schraubte, ins Hirn, Fels spaltete, bis vor Lärm alles still wurde, wie taub.
Inez neben mir bewegte den Mund. Ich verstand sie nicht, und als sie ihre Arme freigekämpft und sich meine Handgelenke gegriffen hatte, merkte ich, dass ich mir die Ohren zuhielt.
»… du nicht«, rief sie.
»Was?«
»Gegen eure Technopartys ist das doch nichts!«
»Was heißt hier eure?«, rief ich zurück und sprang auf, und das Gestein sprang vor mir zurück, buckelte, schlug Falten in der blassen Nacht. Ich rannte über die Steine, was mir wie fliegen vorkam, ich flog auf die Klippe zu, dem Himmel entgegen, dem tiefblauen Horizont, immer weiter hinein in diese irrsinnig helle Nacht, die wie eine Flüssigkeit war, als würde ich sie beim Einatmen trinken, ich flog diesem Gefühl des Neuen entgegen, dem Ungeahnten, ich schwebte, ich sah mich als Schatten neben den fallenden Vögeln, und das Nächste, was ich sah, nach zwei Minuten oder nach zwanzig, waren meine Füße. Blaue Chucks. Ich sah glatte Sohlen auf Steinen, die scharfkantig und abschüssig waren, und hörte Inez. »Bist du verrückt, Erik? Das ist Kalkstein, Fossilien, Skelette, das kann jederzeit abrutschen.«
Meine Muskeln verkrampften. »Ein Tanz auf Skeletten«, brüllte ich in einem letzten Aufwallen dieser irrsinnigen Überdrehtheit, bevor mir kalter Schweiß ausbrach. Ich versuchte, ruhig zu bleiben, zu atmen, die Hitze zu unterdrücken, ich versuchte, mich vorwärtszutasten, den Weg zu finden, den ich gekommen war, es schien unmöglich.
»Komm zurück!«
Alle Todesvorstellungen, die denkbar waren, rauschten gleichzeitig durch mich hindurch, und ich wusste, ich würde bei der kleinsten Bewegung den Halt verlieren, und ab ginge es in die Tiefe.
»Sag mal, du Erbe des Ostens, hast du nicht eine historische Verantwortung? Du kannst nicht einfach lebensmüde in den Klippen rumrennen!«, rief Inez, schon näher. »Alles in Ordnung?«, sagte sie, als sie bei mir war. Mein Gesicht war schweißnass. Sie packte mich fest an den Schultern. »Ganz ruhig. Schön langsam einen Fuß vor den anderen. Du hast alleine hier hochgefunden. Da werden wir gemeinsam auch wieder zurückfinden.«
Sie hielt meine Hand, während sie sich langsam Schritt für Schritt vortastete.
Keinen halben Meter neben uns ging es sechzig Meter in die Tiefe. Die Felsen wirkten rau, frostig und unberührt.
»Was würde deine Freundin zu diesem Todesmut sagen?«
»Wenn ich eine hätte, hätte ich sie mitgenommen.«
»Wäre vielleicht besser«, sagte Inez, »wenn du eine hättest.«
Irgendwann erreichten wir sicheren Boden. Einen Pfad. Es war nicht der, auf dem wir gekommen waren. Inez nahm ihr Basecap ab. »Beim ersten Mal entzündet es bei allen den Traum vom Fliegen.«
»Aber nicht alle fliegen die Klippe runter.«
»Ich nehme auch nicht alle mit«, sagte sie, auf einmal unwirsch. Ich hatte ihr den Moment mit den Jungvögeln versaut. »Da vorn ist der Leuchtturm. Ich bieg hier ab, du findest den Weg.«
Bei meiner Arbeit im Jugendprojekt hatte ich gelernt, dass Menschen, die das Leben auf die harte Tour kennengelernt haben, oft beherrschter sind als andere. Die Kids im Projekt waren noch jung. Aber es gab einige unter ihnen, die zu sich selbst schon eine große Distanz entwickelt hatten. Sie machten zwar das, was die anderen machten, sie rauchten oder warfen Ecstasy ein, aber es war, als ob nur ihre Körper daran beteiligt waren, nicht sie selbst. Die Hand schien eigenständig die Zigarette zum Mund zu führen. Das Gesicht bewegte sich, blieb aber ohne Verbindung zum Lachen. Sie hatten sich hinter mechanischen Bewegungen verschanzt.
So empfand ich Inez nach den ersten Tagen unseres Zusammenseins. Sie zog sich zurück. Sie ging mir aus dem Weg. Es schien, als wollte sie auf einmal nichts mehr von mir wissen. Von einem Moment auf den anderen wandte sie sich ab, verschwand wortlos im Büro, setzte sich auf den Minitraktor und ließ den Motor an. Ich hatte sie in der Nacht auf den Klippen genervt, dachte ich. Aber dann sah ich sie am Strand winken und bildete mir ein, sie würde zu mir herübersehen. Sie trug ein weites, leichtes Hemd, das der Wind blähte. Ein andermal lief sie weiter, als wäre ich nicht da oder als machte der Wind mich unsichtbar.
Sie mochte den Wind. Das sagte sie mir später. Sie mochte sein ständiges Auf und Ab, das leise Aufrauschen der Baumblätter im Inneren der Insel oder die Wirbel über der Steilküste, wo sich der harte, glatte Strom, der über die Ebene fegte und das kurze Gras zu Boden drückte, mit dem Aufwind mischte.
Es war dieser Wind, der sie am Anfang verrückt gemacht hatte, der Wind, der in Böen herankam und den Kopf aufwühlte und ihr die Insel, diese Zuflucht, beinahe vergällt hätte, bis sie verstanden hatte, dass der Wind es möglich machte, sich zu entziehen. Sie empfand ihn als natürlichen Schutz. Er bilde eine akustische Mauer, sagte sie mir, Menschen, die zu ihr durchdringen wollen, halte er ab, Antworten verwehen, Fragen bleiben unvollständig. Wenn sie bei Rückenwind eine Gruppe über die Insel führte, ging sie voran. Sie wollte nicht in Gespräche verwickelt werden. Kam der Wind von vorn, drehte sie das Spiel um. Aber das alles wusste ich am Anfang nicht.
In den Tagen, die dem Ausflug auf die Klippen folgten, kam ich nicht an sie heran.
Ich ging schwimmen. Ich wusch meine Sachen im Meer und legte sie zum Trocknen auf die Felsen. Ich achtete darauf, dort schwimmen zu gehen, wo Inez mich von ihrem Bürofenster im Museum aus sehen konnte, ich legte mich auf die Steine. Auf dem Wasser trieben Federn und weißer Schlick. Sportler waren im Hafen angekommen. Sie zogen kurzärmelige Neoprenanzüge an. Später sah ich sie in roten Hochseekajaks um die Insel jagen, neben ihnen im Motorboot stand der Trainer mit einem Megaphon. Ich sah zu, wie sie sich quälten, ich hörte den Knall, mit dem die Kajaks, von den Wellenkämmen herabgeschleudert, abprallend auf dem Wasser aufsetzten, während meine Badehose langsam trocknete und der Himmel noch blauer wurde und ich für eine Weile alles andere vergaß.
Als ich die Augen wieder öffnete, saß der Rotblonde neben mir.
»Habe ich Sie geweckt?«
Ich schnellte hoch, aber die Sonne blendete mich, und ich ließ mich auf einen Ellbogen zurückfallen.
»Der warme Wind, nicht wahr. Diese Meerluft. Das legt sich alles so schön um die Schläfen. Ich könnte auch ein Nickerchen machen.«
»Ich wollte gerade schwimmen gehen.«
»Sie sind jung.«
»Ich werde auch in zwanzig Jahren noch schwimmen gehen.«
»In zwanzig Jahren wird hier niemand mehr schwimmen. Dann ist das ein stinkendes Schwefelloch.«
»Sagt wer?«
»Tun Sie nicht so. Unsere Inselwärterin redet von nichts anderem!«
»Inez?«
»Sie sind doch schon ganz eng mit ihr.«
»Ich habe sie gerade erst kennengelernt.«
»Ja, mein Lieber, aber Sie wurden schon zu diesem Spektakel in die Klippen geführt.«
»Na und?«
»Ich habe sie beide losgehen sehen«, sagte er. »Und da Inez mich noch nicht mitgenommen hat, vermute ich, dass es etwas Besonderes ist. Dieser Ort. Sie scheint ihn nur guten Freunden zu zeigen. Sie sind aus Deutschland, nicht wahr? Berlin, nehme ich an?«
»Kommt doch jeder aus Berlin, wenn er Deutscher im Ausland ist«, sagte ich, und jetzt verschwinde, du Chorkind, aber das half nicht.
»Ganz schlechter Witz.« Er kniff die Augen zusammen. »Könnte von mir sein. Ich finde es übrigens schön, im Ausland auf Landsleute zu treffen. Würde es Ihnen etwas ausmachen, mich einmal dort auf die Klippen zu führen? Ich bin sehr an diesen nächtlichen Ereignissen interessiert. Inez fährt, wie ich gehört habe, für zwei Tage nach Visby, um Material zu besorgen. Heute oder morgen wäre also eine gute Gelegenheit.«
Ich lachte. »Sie meinen, Inez soll nichts davon erfahren?«
»Frauen können manchmal eigen sein«, sagte er.
»Aber wenn Inez nicht will, dass Sie da hoch gehen, wieso sollte ausgerechnet ich dann Ihr Komplize werden?«
»Weil Sie nett sind, und weil Sie den Weg kennen.«
»Das reicht nicht.«
»Im Tiefenbecken vor Gotland platzen ununterbrochen Schwefelwasserstoffblasen. Bald gibt es hier nur noch Gift.«
»Ich soll also den Mund halten.«
Er zuckte mit den Schultern. »Manche Streiche erfordern eine gewisse Geheimhaltung. Das macht das Leben erst interessant.« Und dann lachten wir, er ein bisschen heftiger, pustend und aus einem mir nicht ganz klaren Grund.
»Was wollen Sie überhaupt da oben?«
Sein Lachen setzte aus. »Was wollten Sie denn da?«
»Oh, Mann«, sagte ich, legte mich zurück und verschränkte die Arme unter dem Kopf. »Ich wollte eigentlich gerade ein bisschen in der Sonne vor mich hindösen.«
»Gleich, mein Lieber, ich lasse Sie gleich Ihr Nickerchen machen. Ich vermute aber, dass Sie nicht zum Dösen auf diese Insel gekommen sind.«
»Nee«, sagte ich. »Um mir Kamikaze-Vögel anzugucken.«
Ich hörte, wie er aufstand, sich die Hosen abklopfte und sagte: »Dann melden Sie sich doch bitte heute Abend bei mir.«
Ich vermied es, vor Mitternacht in mein Zimmer zu gehen. Ich lief in die Wiese hinein, zwischen Wacholderbüschen hindurch, ich hatte die Dagens Nyheter dabei. Ich suchte mir einen Aussichtspunkt. Ich las bis zum letzten Licht und saß dann noch eine Weile da, und als ich zurückkam, war das Fenster des Rotblonden dunkel.
Hier auf der Fähre, im Geruch nach Abgasen, Tang und feuchtem Teppich und mit dem Abstand von drei Monaten, scheint es ganz unnütz, sich zu fragen, ob es einen bestimmten Moment gegeben hat, in dem dieses Fieber, das noch immer andauert, begann. Ob es mit einem Mal da war und ob der Rotblonde es ausgelöst hatte, oder ob solche Fragen nur Splitter sind, die man einsammelt, Splitter auf dem Weg, den man gekommen ist und den man jetzt versucht, zurückzuverfolgen, den ich versuche, zurückzuverfolgen, um einen Anfang zu rekonstruieren, den Anfang einer Geschichte, die, wie mir scheint, die Geschichte eines anderen ist, nicht meine. Es sind Splitter, die sich nie ganz und deshalb auf die unterschiedlichste Weise aneinanderfügen lassen. Und doch kann nicht einer dieser rekonstruierten Anfänge verhindern, dass die Erinnerung an Inez und an ihre Hütte am Strand, in der es immer ein bisschen nach Kaffee roch, mit jedem Mal schwächer wird. Ich werde nie herausfinden, ob ich das, was geschehen ist, hätte verhindern können, weil ich bereits ein Teil davon war, ehe ich es wusste. Nur eines weiß ich jetzt noch mit Sicherheit: Wenn die Fähre in Klintehamn anlegt, wird von all dem nichts weiter übrig geblieben sein als ein Farbring zur Kennzeichnung der Vögel, den Inez mir mitgegeben hat, und eine Aktentasche. Aber in der Aktentasche sind Dokumente über ein Leben, das nicht mich betrifft, sondern andere.
Vielleicht wäre ich ohne den Rotblonden schon nach ein paar Tagen wieder abgefahren. Inez beachtete mich nicht. Niemand beachtete mich. Die Scouts machten jeden Tag ihre Tour. Die Fähre kam und fuhr wieder ab. Die Insel lag da in ihrer windigen Eintönigkeit. Morgens blieb ich im Bett. Ich langweilte mich. Hätte der Rotblonde mich nicht so belagert, hätte ich aufgegeben. Ich hätte Inez nie aufs Plateau eingeladen. Ich war gekränkt.
Am Abend bevor Inez aus Visby zurückkam, klopfte er bei mir an. Er stand in Jacke und Schal vor meiner Tür. Er wirkte ungeduldig.
Und weil ich nichts Besseres vorhatte, ging ich mit ihm denselben Pfad wie zuvor mit Inez. Der Aussichtspunkt auf den Klippen lag östlich vom Leuchtturm. Wir liefen den Pfad zuerst ein Stück abwärts in Richtung Strand und stiegen dann an einer kleinen Abzweigung, die von Schafshufen ausgetreten war, zum Aussichtspunkt hinauf. Er lag nicht sehr versteckt, und der Rotblonde hätte ihn auch allein finden können. Im Grunde war es egal, von welchem Punkt auf der Klippe man sich den Lummensprung ansah, die Vögel nisteten überall in der Steilwand. Aber ihm schien es wichtig. Also führte ich ihn an die Stelle, von der aus ich mit Inez über die Felsen zur Mulde geklettert war. Dort blieben wir stehen.
Die Vögel hatten sich am Abend zu Tausenden auf dem Wasser vor der Steilwand versammelt. Die Wellen hoben die schwimmenden Tiere an und ließen sie wieder herunter, und es sah aus, als wären es nicht die Wellen, sondern eine rhythmische Bewegung, die jeder einzelne Körper in der dunklen Masse der Vögel in regelmäßigen Intervallen vollzog. Der Lärm stieg gewaltig zu uns hoch. Von den Rändern der bewegten Masse kamen immer wieder Tiere zurück zur Klippe geflogen, sie stießen ihre grellen Schreie aus, es stank nach Kot.
»Beim ersten Mal entzündet es bei allen den Traum vom Fliegen«, rief ich.
Auf einem Felsvorsprung nicht weit von uns hockten zwei graufleckige Vogeljunge. Sie reckten ihre Hälse über die Kante, bis eines von ihnen das Gleichgewicht verlor und fiel. Das Küken, das zurückblieb, torkelte. Es drohte, auf die Seite zu schlagen, Kopf und Hals schon über der Tiefe. Sein Körper zitterte, der Wind blätterte im Flaum. Es wurde von einer ausgewachsenen Lumme, die sich flügelschlagend hoch aufrichtete, ebenfalls über die Kante gescheucht. Der Rotblonde schob die Hände in die Taschen.
»Das ist alles?«, sagte er.
»Dachten Sie, hier gibt’s ’ne Würstchenbude?«
»Wenn das alles ist, können wir wieder umkehren. Ich bin nicht so für Natur.«
»Ich dachte, Sie wären ganz scharf drauf.«
»Ich habe gesehen, was ich wollte«, sagte er lächelnd. »Ich kann auf Sie zählen, mein Lieber. Sie sind bereit, einem Landsmann zu helfen.«
Ich kickte einen Kothaufen weg. »Und Inez? Mit einer Landsmännin haben Sie’s nicht so oder was?« Glaubst du Chorkind, du kannst mich gegen sie ausspielen, der Kot zerfiel zu weißem Staub.
»Ach, kommen Sie!« Er stieß mich leicht in die Seite. »Sie sind doch nicht einer von diesen politisch überkorrekten, aber noch ungefestigten jungen Männern?« Seine Augen schimmerten. »Wissen Sie«, er nahm vertraulich meinen Arm, »es ist mir einfach zu laut hier. Man versteht ja sein eigenes Wort nicht!«
Er versuchte, lässig neben mir herzuschlendern, was wegen der Felsen schwierig war.