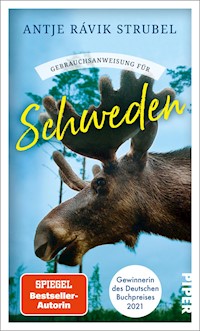13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ideales Ausflugsziel Nach Jahren in New York und Berlin ist Antje Rávic Strubel in ihre Geburtsstadt Potsdam heimgekehrt. In ihrer heiterkritischen Hommage erzählt sie vom Leben zwischen Lausitz und Stechlin, zwischen Schorfheide, Sanssouci und Spreewald, Havelland und Hohem Fläming. Von Lüchen und Brüchen, Wölfen und dem »märkischen Amazonas«. Von Brechts, Kleists und Fontanes Spuren sowie dem Einfluss holländischer Architekten. Vom Siegeszug des Sanddorns und dem Mythos des Beelitzer Spargels. Von Luxusvillen am See oder der Frage, wem das Ufer wirklich gehört. Vom Alltag im Künstlerviertel Babelsberg. Von tropischen Inseln und anderen Spaßbädern. Von landestypischem Humor, der Bedeutung der Kreissäge und den Vorzügen brandenburgischer Wortkargheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Vollständige E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
1. Auflage 2012
ISBN 978-3-492-95536-2
© Piper Verlag GmbH, München 2012
Umschlagkonzept: Büro Hamburg
Umschlaggestaltung: Birgit Kohlhaas, Egling
Umschlagabbildung: Thomas Linkel/laif (Schloss Babelsberg)
Karte: cartomedia, Karlsruhe
Datenkonvertierung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
Karte
Preußen und Märker
Märkische Heide, märkischer SandSind des Märkers Freude, sind sein Heimatland.Steige hoch, du roter Adler, hoch über Sumpf und Sand,Hoch über dunkle Kiefernwälder, Heil dir mein Brandenburger Land.
(Lied vom Roten Adler, 1923, Gustav Büchsenschütz)
Machen Sie sich keine Illusionen: Ich bin kein Fan von Brandenburg. – Ich wurde hier geboren. Ich lebe hier. Das ist alles. Von meiner Geburt bis zu meinem sechzehnten Geburtstag hatte ich vom Land Brandenburg noch nicht einmal gehört, obwohl ich in der Automobilwerkerstadt Ludwigsfelde am Rand des Fläming groß wurde.
Nach der Wende ging ich weg. Und als ich zurückkehrte, stellte ich fest, dass der Landstrich, in dem ich aufgewachsen war, mittlerweile einen Namen bekommen hatte. Dieses Land, das sich zwischen Elbe und Oder, vom Stechlin bis zur Senftenberger Seenplatte erstreckt, das mehr Sand als Menschen hat und mehr Seen als Städte, in dem man Radio »nur für Erwachsene« hört, Weißwein aus dem Tagebau trinkt, im Scherri badet und saure Gurken aus der Dose isst, das Land, in dem es Pyramiden, verbotene Städte und Atombunker gibt, dieses Land mit den meisten Naturschutzgebieten und den meisten militärischen Altlasten aller deutschen Bundesländer, was manchmal dasselbe ist, hieß jetzt Brandenburg.
Ich erinnere mich nicht, wann ich den Namen zum ersten Mal hörte. Vielleicht benutzte der ehemalige Ministerpräsident Manfred Stolpe diese Bezeichnung, als er versuchte, Schwung in die Sache mit den blühenden Landschaften zu bringen. Oder die »Mutter Courage des Ostens«, Regine Hildebrandt, ließ den roten Adler in einer ihrer protestantisch-preußischen Motivationsansprachen aufsteigen. Vielleicht hörte ich den Namen zum ersten Mal in einer Radiosendung des rbb, in der Menschen auf der Straße gefragt wurden, was sie mit dem Land Brandenburg verbinden würden. Die Antworten waren wenig befriedigend. Während die Einheimischen anderer Landstriche bei solchen Fragen fröhlich zu regionalen Glaubensbekenntnissen ansetzen oder ernst die Vorzüge und Nachteile ihrer Heimat abwägen, blieben die Befragten ganz bei sich: »Brannenborch? Na, det iss, wo ich lebe!« Sehen Sie, das meinte ich.
Ich bin gebürtige Potsdamerin. Das habe ich meiner Mutter zu verdanken. Sie fand, das Krankenhaus einer Bezirkshauptstadt mache für die Geburt eines Kindes mehr her als ein lumpiges Kreiskrankenhaus, in dem sie mich korrekterweise hätte zur Welt bringen sollen. So lautete jedenfalls in den Siebzigerjahren die Anordnung für Mütter, die im Kreis Zossen ihren Wohnsitz hatten. Aber meine Mutter kommt aus Sachsen. Das erklärt den laschen Umgang mit Behörden. Einer pflichtbewussten Preußin wäre es nie in den Sinn gekommen, das staatlich verordnete Krankenhaus durch ein selbst gewähltes zu ersetzen. Meine Mutter sah in der querulanten Entscheidung für Potsdam ein letztes Glimmen ihrer sächsischen Herkunft. An diesem Glimmen hielt sie fest, nachdem sie mit einem Niederlausitzer eine Mischehe eingegangen war und sich fleißig das Hochdeutsche antrainierte. Das Brandenburgische zu beherrschen, versuchte sie erst gar nicht. Diesen knackigen, bodenständigen Slang, der sachlich trocken hingerotzt wird und dann zerstäubt wie ein Spuckefleck im Sand, der sich durch das Weglassen ganzer Konsonantengruppen am Ende eines Wortes auszeichnet, bevorzugt das »ch« wie in »weeßickni« und »Lass do’ ma«, beherrsche nicht einmal ich. Ich habe zwar mit den Kindern waschechter Einheimischer im Sandkasten gespielt. Aber zu Hause wurde aus Rücksicht auf meine Mutter Hochdeutsch gesprochen.
Bis zu meinem sechzehnten Geburtstag lebte ich also im Kreis Zossen, Bezirk Potsdam. Vom Land Brandenburg keine Spur. Sie sehen, wie jung das Land ist, in das ich Sie einweihen möchte. Heute erinnert schon nichts mehr daran, dass es erst 1990 auf dem Territorium von drei Bezirken entstand. Potsdam grenzte im Süden an den Bezirk Cottbus und im Osten an Frankfurt/Oder. Cottbus, Frankfurt und Potsdam sind die drei wichtigsten und größten Städte, die das heutige Bundesland vorweisen kann. In meinen jugendlichen Ohren hatten sie den gleichen fahlgrauen, fern-industriellen Klang wie Eisenhüttenstadt, Schwedt, Perleberg oder Guben, weshalb es mich schon damals nicht gewundert hätte, wären sie alle unter einen Hut gesteckt worden. Aber noch zeichnete sich nirgendwo ab, dass der Geburtsort Potsdam mich eines Tages zu einer Brandenburgerin machen würde. Die SED-Führung der DDR ließ nur kurz, zwischen 1946 und 1952, die Bezeichnung Land Brandenburg zu, leistete dadurch aber Pionierarbeit; Brandenburg war vorher schon alles Mögliche gewesen, aber noch nie ein Land. Für die restlichen siebenunddreißig Jahre Sozialismus wurden solche regionalen Bezeichnungen gestrichen, weil in ihnen nach sozialistischem Glauben ein ungewolltes Erbe deutscher Kleinstaaterei zum Ausdruck kam. Die Thüringer oder die Sachsen begegneten dieser ideologischen Engstirnigkeit mit einem gefestigten Regionalstolz. Den Brandenburgern dagegen saß der preußische Untertanengehorsam noch zu tief in den Knochen, um sich gegen die von feudalen Spuren gereinigte Kartografie der neuen Befehlshaber zu wehren. Der Soldatenkönig Friedrich Wilhelm I. hatte seinen Untertanen die Pflicht zum Gehorsam eingebläut. Der Gehorsam hielt mehrere Jahrhunderte lang an. Und die Hymne mit dem roten Adler, dem Wappentier Brandenburgs, blieb den Brandenburgern bis zur Wende im Halse stecken.
Nun ist es mit nationalen und selbst mit regionalen Identifikationen immer etwas heikel. Sie verschwimmen, sobald man beginnt, historisch nachzuforschen. Schon die Nachnamen vieler Brandenburger haben flämische, wendische, polnische, russische oder französische Wurzeln. Ihre Vorfahren sind aus vielen Richtungen eingewandert. Zwei große Migrationswellen haben die brandenburgische Gegend geprägt. Zwischen 1000 und 1200, nach der Eroberung des von Slawen besiedelten Landes durch den Askanier Albrecht den Bären, ließen sich Siedler aus den verschiedensten deutschen Gebieten hier nieder. Und nach dem Dreißigjährigen Krieg strömten unzählige Menschen aus der Schweiz, der Pfalz oder Böhmen ins Land, herbeigelockt von einer Politik, die es sich zum Ziel gesetzt hatte, die stark verwüstete Region neu zu bevölkern. Eine der größten und prägendsten Einwanderergruppen waren die Hugenotten, protestantische Gläubige, die im Frankreich des 17. Jahrhunderts verfolgt wurden. Auch die geografischen und politischen Grenzen Brandenburgs veränderten sich während der Jahrhunderte ständig, abhängig von Kriegen und Eroberungsfeldzügen. So variabel wie die Grenzverläufe, so vage ist auch der Name »Brandenburg«. Noch heute bin ich unsicher hinsichtlich seiner Dimension.
Da gibt es die Stadt Brandenburg und das Land Brandenburg. Da Stadt und Land gleich heißen, unterteilen sich die Brandenburger in Städter und Landeskinder, wobei die Stadtbewohner natürlich auch Land-Brandenburger sind, was ihnen immer noch eine zusätzliche Erklärung abverlangt. Die Neubrandenburger wiederum gehören nicht dazu. Sie können sich hierzulande jede Erklärung sparen, müssen aber im Nachbarland Mecklenburg-Vorpommern für die missverständliche Bezeichnung ihres Herkunftsortes einstehen.
Dann gibt es die Bezeichnungen »Mark Brandenburg« und »Kurmark«. Beides hat nichts mit Geld zu tun. Geld war in diesem ärmlichen Landstrich ohnehin nie ein Thema, außer wenn man es sich borgen musste wie Friedrich II. einst von einem am österreichischen Hof lebenden Prinzen (Prinz Eugen), weil der eigene Vater ihm das Taschengeld strich. Die Mark bedeutet so viel wie Grenzland. Damit ist das an die Stadt Brandenburg grenzende Land gemeint. Als die Stadt 948 gegründet wurde, hieß sie allerdings Brendanburg. Zur Kurmark, auch Churmark, wurde Brandenburg dann ab dem 14. Jahrhundert unter den Hohenzollern. Sie bezeichneten damit das Land, das die brandenburgische Kurfürstenwürde repräsentierte.
Und natürlich gab es Preußen. Preußen war ursprünglich ein Herzogtum in der Gegend des späteren Ostpreußen, bis sich der »Schiefe Fritz« 1701 die Krone selbst aufs Haupt drückte und aus seinem Kurfürstentum auf brandenburgischem Boden einen Staat machte. Innerhalb des Königreichs Preußen wurde die Mark zur Provinz. Außerdem gab es die Altmark und die Neumark. Beide gehören heute allerdings nicht mehr zur Mark. Dabei stammten die ersten Märker aus der Altmark, genauer gesagt, aus Havelberg, das neben Brandenburg die erste deutsche Stadt auf märkischem Boden war. Heute liegt Havelberg in Sachsen-Anhalt und muss sich die märkische Vergangenheit irgendwie ins Sachsen-Anhaltinische zurechtbiegen. Die Neumark östlich der Oder, die mittlerweile polnisch ist, hat ein ähnliches Identitätsproblem, und die Niederlausitz kam überhaupt erst so spät zu Brandenburg hinzu – im frühen 19. Jahrhundert –, dass sie ihrem früheren sächsischen Frohsinn noch immer nachtrauert (was man an der Entscheidung meines Vaters für eine Sächsin gut ablesen kann). Das alles zeigt, wie unzuverlässig solche scheinbar klaren Selbstverortungen sind. Folgt man dem im Spreeland ansässigen märkischen Autor Günter de Bruyn, lässt sich die Sache noch weiter verkomplizieren, denn »märkisch sind, wie es im Liede vom roten Adler heißt, die Heide, der Sand und der Sumpf, die westlichen Tore Berlins und Potsdams dagegen heißen Brandenburger und nicht märkische Tore, weil früher durch sie hindurch musste, wer in die Stadt Brandenburg wollte …«
Sie sehen: Es ist nicht so einfach, eine Märkerin zu sein. Und dennoch gibt es bei vielen Brandenburgern heute eine große Lust, sich regional zu verorten. Vor Kurzem hörte ich eine junge Unternehmerin aus Fürstenberg sagen, sie verstehe sich als Urpreußin und wolle in ihrer Familie das preußische Erbe pflegen. Ich sah sofort die Zinnsoldaten vor mir, wie sie in preußischer Truppenstärke in den Glaskästen des Zinnsoldatenmuseums Potsdam-Bornstedt Aufstellung genommen hatten. Aber im post-postmodernen 21. Jahrhundert läuft wohl selbst der Preußenkult subtiler ab: Da wird kein lebensgroßer Pappaufsteller eines Langen Kerls im Flur stehen, und das Abziehbild eines gegrätschten Adlers klebt auch nicht auf dem Zahnputzbecher. Preußen war nicht nur der selbstgerechte, größenwahnsinnige Militärstaat, dem Verhärtung, Gier und blinder Gehorsam seiner Bürger schließlich zum Verhängnis wurden. Preußen war zunächst einer der ersten europäischen Staaten, der eine allgemeine Volksbildung und regelmäßige Arbeitszeiten für Staatsdiener einführte; die Grundlage des modernen Beamten. Fleiß, Zähigkeit und Toleranz gehörten hier zu den Tugenden, und unter Friedrich dem Großen legte die erste Frau, die Ärztin Dorothea Christiana Erxleben, 1754 ihr Doktorexamen ab.
In trüben Stunden verbinde ich mit Brandenburg strapazierfähige Blusen, weiße Turnschuhe und Lurex-Tücher, wie ich sie mir als Jugendliche um den Hals schlang. Ich verbinde damit eine Düsternis, wie sie eine Kleinstadt im Novemberwetter hervorruft, aus der ich mich mit achtzehn schleunigst davonmachte. Nichts jedenfalls, was Eleganz, Weltläufigkeit und Esprit versprühen würde. Um den Witz der Brandenburger zu verstehen, muss man beide Beine fest auf der Scholle haben. Es ist ein dem rauen Leben auf kargem Boden abgerungener Humor. Aber hat man das einmal verstanden, leuchtet einem der Impuls eines Gastwirtes in Gransee ein, seine Lokalität »Huckeduster« zu nennen. Und der zündende Gedanke der Imbissbudenbesitzerin in Teschendorf, ihre Bude »Karins Kanonenfutter« zu taufen, springt vielleicht ebenfalls über. Beim Biss in die Currywurst fragt man sich nur besser nicht, ob damit das in die Pelle gestopfte Fleisch gemeint ist oder die Kundschaft …
Die Stadt, aus der ich floh, war eine sozialistische Autowerkerstadt, in der achtzig Prozent der Einwohner im IFA- Automobilwerk arbeiteten und LKWs herstellten, die in sozialistische Bruderländer auf der ganzen Welt verschifft wurden. Ich floh aus einer Stadt, in der es für achtundzwanzigtausend Einwohner einen Schuhladen, einen Bäcker und ein Kaufhaus gab. (Für die Nachtbar im Klubhaus war ich noch zu jung. Und die Bücher aus der Bibliothek über dem Kino hatte ich schon alle gelesen.) Ich floh, weil Ludwigsfelde zwar auf märkischem Sand stand, nahe eines Pechpfuhl genannten Hochmoors, das seinen Namen einer Pechhütte aus dem 17. Jahrhundert verdankt und Lebensraum seltener Pflanzen und Vögel war, man von diesem Hochmoor aber nicht mehr viel sah. Jeder Anflug von natürlicher oder kultureller Schönheit wurde den Erfordernissen der werktätigen Produktion oder militärischen Zwecken untergeordnet. Das Wollgras war eingegangen. In den Erlenbruchwald hatte man Plattenbauten für Streitkräfte der Nationalen Volksarmee (NVA) gesetzt. Kettenfahrzeuge hatten quadratische Abdrücke in die Sandwege gestanzt, und der Zaunkönig war längst auf und davon. Im Herbst stieg der Geruch von Rieselfeldern am Stadtrand auf.
Damals hätte ich mir nicht vorstellen können, dass Ludwigsfelde einmal typisch brandenburgisch sein würde. Ich ahnte nicht, dass die Stadt alles enthalten würde, was das heutige Brandenburg auszeichnet: Zentrum und Plattenbausiedlung sind durch Progamme der Städtebauförderung aufgehübscht worden. Es gibt Landschaftsschutzgebiete, die einst militärische Sperrgebiete waren. Es gibt sanierte und verschlankte Industrieanlagen und Industrieruinen, die zu Filmkulissen werden. Es gibt Seen, Kiesgruben und Sanddünen. Es gibt Felder mit Kartoffeln, Getreide und Mais. Es gibt Kuhställe, Kirchen und Kneipen. Und es gibt Landadel. Der Ludwigsfelder Landadel residierte einst in Schloss Genshagen. Das ist, wie viele Schlösser in Brandenburg heute, eine Tagungsstätte.
So gesehen hätte ich gar nicht brandenburgischer aufwachsen können. Um wirklich jeden Zweifel an meiner Identität auszuräumen, erbringt Ludwigsfelde auch den letzten Beweis: vor einigen Jahren eröffnete die Kristalltherme, ein Thermalbad mit ausgedehnter Saunalandschaft. Saunen, Schwimmen und gesundes Baden gehören in Brandenburg zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Mithilfe großzügig gefüllter Nachwende-Fördertöpfe wurden unzählige Wellness-, Spaß- oder Thermalbäder auf den Acker gesetzt. Man sollte jetzt nicht der irrigen Vorstellung erliegen, der märkische Sand sitze besonders hartnäckig hinter den Ohren. Auch die Vorstellung, die ehemaligen Mitarbeiter der Staatssicherheit oder überzeugte SED-Genossen im Land hätten eine Möglichkeit gesucht, sich reinzuwaschen, ist falsch. Wahr ist, dass die Landeshauptstadt Potsdam neben der Hochschule für Staatssicherheit eine juristische Fakultät besaß, in der ausschließlich Marxismus-Leninismus unterrichtet wurde, und dass sich in Strausberg noch immer alte Herren aus Stasi-Seilschaften zum Kaffeekränzchen treffen. Wahr ist auch Wandlitz. Das heute beliebte Ausflugsziel beherbergte einst die Wohnsiedlung der SED-Führung. Aber dass man sich ausgerechnet von Bädern nach der Wende Arbeitsplätze versprach, deutet auf etwas anderes hin: Erstens musste man sich nach der industriellen Bankrotterklärung schnell etwas einfallen lassen. Zweitens sind die Brandenburger beim Baden besonders bei sich. Baden berauscht. Und der Rausch ist in diesen Breitengraden, kommt er nicht vom Alkohol, ein seltener Zustand.
Wie Sie bereits bemerkt haben, ist Brandenburg also ein sehr junges und gleichzeitig ein sehr altes Land. Außerdem ist es ein Land mit einem starken Nord-Süd-Unterschied. Seine Bewohner des Nordens, die Prignitzer oder die Uckermärker, erkennt man an ihrer norddeutschen Zurückhaltung und einer zarten Herbheit. Die Niederlausitzer und die Fläminger aus dem Süden, die dem Preußischen weniger lange ausgesetzt waren, legen die sanfte Gangart von Mittelgebirgsmenschen an den Tag. Ein Riss geht auch beim Wetter durchs Land. Der Nordwesten steht unter dem milden Einfluss des atlantisch-maritimen Klimas, der Südosten befindet sich in der rauen Kontinentalklimazone. So gesehen kann man in Brandenburg von Sibirien nach Italien reisen. König Wilhelm IV., der einzige Romantiker auf dem preußischen Thron, der dummerweise auf der sibirischen Seite stand, glaubte, die Wetterverhältnisse ändern zu können. Gotteshäuser im italienischen Stil wie die Friedenskirche im Potsdamer Park Sanssouci sollten den Himmel gnädig stimmen.
Auch das Brandenburger Tourismusmarketing hat sich des magischen Denkens bedient. Auf den rot-blauen Schildern, die an der Autobahn die Landesgrenze zu Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern markieren, steht: »Brandenburg. Neue Perspektiven entdecken«. Diese Formulierung, die es nicht bis zu einem vollständigen Satz, aber in einen hoffnungsfrohen Imperativ schafft, in dem das preußische Echo nur leise nachhallt, passt zu den spargelstangendünnen Kiefern, die rechts und links der Fahrbahn stramm in den Himmel schießen: Man ist auf dem Weg nach oben. Nur die landesunkundige Autofahrerin mag nun unsicher nach den Perspektiven Ausschau halten, wobei ihr ein Reh auf offenem Feld, ein im Licht gleißender Birkenstamm oder ein trunken stiller See ins Blickfeld gerät. Die Landesbewohner wissen, dass es sich hier um eine Beschwörungsformel handelt: Man entwickelt sich noch. Die Gegenwart ist vielleicht noch etwas trübe, aber anders betrachtet lässt sich darin schon die Zukunft erblicken.
Nun ist von den Bewohnern an den äußeren Grenzen des Landes rein gar nichts zu sehen. Weshalb die kluge Unkundige sich wieder auf die Landschaft konzentriert, auf die Weite des Horizonts, die sanften Wellen der Wiesen, das Gestolper der feldsteinübersäten Äcker, bis sie schließlich immer weiter in die Endlosigkeit vom Wind bewegter Getreideähren hineingezogen wird. Sie fährt durch Lindenalleen und Straßendörfer, über Katzenkopfpflaster, durch Blumenfelder zum Selbstschneiden mit Gladiolen, Rosen und Sonnenblumen, sie fährt an verfallenen Scheunen und an aufgemotzten Garagen vorbei, und ein Storch hebt ab. Am Straßenrand hockt ein Junge mit Zigarette, zwischen den Beinen kein Bier, sondern eine große Flasche Coca-Cola, die im Nachbardorf abgefüllt wurde, im Gewerbegebiet mit Containerbauten und Tankstellen und Billigmärkten, und da tritt sie etwas kräftiger aufs Gas, bis sie zu Sonnenuntergang Pferde in den Schilfgürteln von Flüsschen stehen sieht und Äpfel am Baum, einen Buchenwald, eine lichtdurchströmte Klosterruine, vor der ein Holzfeuer brennt, und wenig später einen Stier, der eine ganze Wiese allein begrast; ein weißer Koloss vor goldenem Mais. Und in der Ferne scheint ein Herrenhaus so barock wie die Sonne im Rückspiegel auf, während im Kulturradio Ian Shaw »Last Night, When We Were Young« zu hören ist, bis sie glauben wird, den Blues habe man in Brandenburg erfunden …
Wege und Wasser
Im Westen schwimmt ein falber Strich,/Der Abendstern entzündet sich,/Schwer haucht der Dunst vom nahen Moore;/Schlaftrunkne Schwäne streifen sacht/An Wasserbinsen und am Rohre.
(Annette von Droste-Hülshoff )
Die Reise
Wer das erste Mal nach Brandenburg kommt, hat entweder berufliche Gründe, fährt gern Fahrrad oder ist auf der Fahrt an die Ostsee aus Versehen falsch abgebogen. Vor der Wende soll es Menschen gegeben haben, die in Ermangelung eines Zeltplatzes an der Ostsee kurzerhand das von Kiefern umstandene Ufer eines brandenburgischen Sees zum begehrten Meeresstrand erklärten. Heute reist selten jemand an, um in der Prignitz, der Schorfheide, der Zauche, im Havelland, im Barnim oder dem Hohen Fläming Strandurlaub zu machen. Es gibt Wochenendausflügler, die sich den Spreewald begucken oder den Stechlin, den berühmtesten See der Mark. Es gibt Kulturinteressierte, die sich für ein, zwei Tage in einer der drei Preußenstädte Potsdam, Rheinsberg oder Neuruppin aufhalten, es gibt Jachtbesitzer, die von der Spree in die Havel und weiter in die Elbe fahren, es gibt Paddler auf den Fließen des Spreewalds, Radler in der Uckermark und Wanderer im Schlaubetal, aber sie alle sind unterwegs irgendwohin. Auf die eine oder andere Weise fährt man als Urlauber meistens durch Brandenburg durch. (Die einzigen Strandurlauber Brandenburgs, die ich kenne, sind Verwandte aus Cottbus, die einen Dauerzeltplatz in Großkoschen gemietet haben, aber Großkoschen liegt schon so gut wie in Sachsen).
Als Kurt Tucholsky auf dem Weg von Berlin nach Schweden durch Brandenburg fuhr, beschrieb er dieses Vergnügen in seinem Roman Schloss Gripsholm so: »Es war ein heller, windiger Junitag – recht frisch, und diese Landschaft sah gut aufgeräumt und gereinigt aus – sie wartete auf den Sommer und sagte: Ich bin karg.«
»Well in order«, sagte eine englische Freundin zu mir, als wir durch die Buchenallee spazierten, die im Park Sanssouci von der Orangerie zum Belvedere auf dem Klausberg führt. Auch sie war von Oxford nach Berlin auf der Durchreise und fand die Natur »gut in Schuss, aufgereiht und ordentlich«.
»Ödes Grün«, nannte Theodor Fontane das Linumer Bruch, durch das er ebenfalls nur durchfuhr. Der berühmteste Chronist Brandenburgs war mit Kahn und Kutsche unterwegs auf seinen Wanderungen durch die Mark Brandenburg. »Nichts Lebendes wird hörbar als die Pelotons der von rechts und links her ins Wasser springenden Frösche«.
Die Allee
Das wichtigste Markenzeichen für Brandenburgs Natur eignet sich auch am besten zum Durchfahren: die Allee. Die Alleen sind neben den Neonazis und Schloss Sanssouci oft das Einzige, wovon Uneingeweihte gehört haben, bevor sie zum ersten Mal nach Brandenburg kommen, und zwar auf eine Weise, die gewöhnlich im Märchen Verwendung findet. Das Märchen über Brandenburg geht so: Um das Schloss-ohne-Sorgen, das güldene Lustschlösschen auf dem Weinberg, zu erreichen, das tief im Inneren des Landes verborgen liegt, muss man erst ein paar Gefahren bestehen. Im Labyrinth der Kiefernwälder treiben haarlose Männer mit straff geschnürten Stiefeln und Fliegerjacken ihr Unwesen. Wenn man unbeschadet zuerst ihnen und dann dem Labyrinth entkommt, gelangt man auf Straßen, auf denen dauernd Leute gegen Bäume fahren: die Allee. Nur die Mutigen, Tapferen und Schönen erreichen schließlich Schloss-ohne-Sorgen.
Die brandenburgische Polizei griff die Grusel-Freude der Menschen dankbar auf. Da auf den zehntausend Kilometern Allee tatsächlich gelegentlich Kollisionen stattfinden, was bei den Ordnungshütern Überstunden und Stress verursacht, half das Verkehrsministerium sich und seinen Beamten aus. Man schaltete hammerharte pädagogische Werbespots im Kino. In einem dieser Spots fährt eine junge Frau mit dem Rad eine luftig durchsponnene, sommerlich stille Allee entlang. Sie radelt so dahin, das Lüftchen lüpft ihr Kleidchen, die Hollerbüsche wiegen sich, die Schmetterlinge schaukeln, aber als sie absteigt, klonkt ihre Beinprothese auf den Asphalt. Nur mit Mühe legt sie eine Blume vor das weiße Kreuz am Straßenrand.
Unterwegs in den grünen Tunneln wird man den Grusel schnell vergessen. Wer in die schattige Überdachung der in den Kronen ineinandergewachsenen Eschen, Buchen oder Linden eintaucht, wird tatsächlich verzaubert, nur anders als erwartet. Wenn der betäubende Geruch der Blütenfülle durch die Klimaanlage ins Auto sickert und das grüngold flackernde Alleenlicht auch das staubigste Amaturenbrett aussehen lässt wie eine Antiquität, spüren die Reisenden einen merkwürdigen Sog. Sie möchten immer weiterfahren. Und das ist seltsam. Denn es passiert nichts. Kein spektakulärer Berg taucht vor der Windschutzscheibe auf. Keine Steilküste, kein Meer verziert die im Quartär während der Weichseleiszeit entstandenen Grundmoränenplatten und Endmoränenzüge, die Sanderflächen und Urstromtäler. Noch nicht einmal eine Höhe gibt es, von der eine atemberaubende Aussicht zu haben wäre. Nur Ebene, nur Talsandflächen, über die eine gelegentlich an- und abfallende Straße führt, auf der sich Schlaglöcher und Kopfsteinpflaster abwechseln. (Der höchste Punkt Brandenburgs, der Hagelberg bei Belzig im Hohen Fläming, bringt es gerade mal auf zweihundertundeinen Meter.) Links und rechts liegen Felder mit Roggen und Mais. Die Wälder des Fläming. Die Wiesen im Löwenberger Land. Die Weizen- und Zuckerrübenäcker der Lehmböden des Oderbruch. Die urwaldartigen Ufer am Flusslauf der Alten Oder, in deren umgestürzten Bäumen Vögel nisten. Die schilfumrankten Seen des Ländchens Glien. Die niedrigwüchsigen, knorrigen Apfel-, Kirsch- und Birnbäume auf den Plantagen des Westhavellands. In der Ferne glänzen rot die Dächer, weiß die Schwingen der Windräder, das Blau der Kornblumen wird vom roten Klatschmohn abgelöst, gelb knallt später der Raps dazwischen. Die Fahrt ist stetig unterlegt mit dem Blättergeflacker des grünen Lichts.
Wird das Geflacker heller, sind die Reisenden in die Uckermark gelangt, auf eine Birkenallee, die es nur hier gibt, denn, so heißt es großspurig auf dem Schild, das an der Grenze zur Uckermark willkommen heißt: »Jetzt wird’s schön!« Und das wird es tatsächlich. Das karge Land, das öde Grün entwickeln mit der Zeit einen Reiz. Die Reisenden sind angerührt, sei es vom flirrenden Straßenstaub, vom Widerschein eines Sees, von der Weite des Himmels, dem blassen, flächigen Licht, von Farnen in der Mittagsstille oder Kranichen im Abendlicht. Sie ahnen, dass die Schlichtheit der Landschaft Schönheiten birgt und das »öde Grün« ein Geheimnis, das dazu verlocken könnte, abzubiegen, sich eine noch kleinere Allee, eine stillere Dorfstraße, einen löchrigen Waldweg, eine sandige Piste zu suchen und schließlich anzuhalten. Um auszusteigen und zu bleiben. (Dass die meisten dann für immer bleiben, steht in einem anderen Kapitel.).
»Ein matter Luftzug geht und nur matter noch geht und klappert die Mühle. Die Wasserente taucht auf, und aus der Tannenschonung steigt ein Habicht, um die letzten Sonnenstrahlen einzusaugen – jetzt aber flimmert es rot und golden im Gewölk und im selben Augenblicke schießt er wieder ins Dunkel seiner Jungtannen nieder. Auch die Mühle schweigt und der Wind. Und alles ist still.« So schrieb es Theodor Fontane, nachdem er selbst dem Sog der märkischen Landschaft erlegen war, dieser »Schwermut, die ihr Zauber ist«.
Reisenden die Reise zu erleichtern ist ein Gedanke aus dem 18. Jahrhundert. Schon damals kam man auf die Idee, die Wege mit Bäumen zu bepflanzen. Sie sollten Schatten spenden und Obst. Zur Aufstockung des Reiseproviants säumte man die Handelsstraßen von Berlin nach Frankfurt/Oder und Küstrin mit Birnen-, Maulbeer- und Apfelbäumen. Friedrich der Große (Friedrich II.) hatte mit den Straßenbäumen noch etwas anderes vor. Um seinen Hofstaat von teuren Seidenimporten unabhängig zu machen, ließ er die Maulbeerbäume auf eine Million aufstocken und von nun an preußische Seidenraupen züchten. Einige der Maulbeerbäume stehen heute noch in Kummersdorf und Alt-Töplitz. Der DDR ist es zu verdanken, dass es die Alleen noch gibt. Wo der sozialistische Staat sonst so gründlich war in der Beseitigung feudaler Überreste, ließ er die Bäume stehen. Das Verkehrsaufkommen war so gering und die Finanzlage so schlecht, dass man es sich nicht wie im Westen Deutschlands leisten konnte, die alten Kopfsteinpflasterstraßen mitsamt ihrer Bepflanzung zugunsten eines massiven Straßenausbaus wegzureißen. Heute sind die Alleen weniger durch die Politik, als durch Überalterung der Bäume bedroht, was übrigens die Lage vieler Orte Brandenburgs schön spiegelt; ihre Einwohner sterben langsam aus. Die Bäume immerhin kann man nachpflanzen. Ein neuer Alleebaum kostete zur Drucklegung dieses Buches vierhundertsiebzig Euro.
Die Kiefer
Damit ist nicht die Kiefer gemeint. Kiefern stehen selten einzeln und noch seltener am Straßenrand. Sie kommen nur in der Gruppe, in der Schonung und als Begriff aus der Forstwirtschaft vor, immer jedoch in der Mehrzahl. Die Kiefer gehört zu Brandenburg wie der Sandboden. Sie ist pflegeleicht, sie wächst schnell, und sie ist der perfekte Holzlieferant. Die Kiefer bringt Geld in Kassen, die in Brandenburg meistens leer sind. Seit dem Mittelalter wurden Brandenburgs Mischwälder dezimiert. Und als das Land mit Köhlereien, Pechsiedereien, später auch mit Ziegeleien und Glashütten den Anschluss ans Industriezeitalter gefunden hatte, setzte ein massiver Raubbau am Wald ein. Die Gewerke brauchten Holz. Berlin machte zur vorletzten Jahrhundertwende ebenfalls einen enormen Wachstumsschub durch, die explodierende Stadt musste beheizt werden. »Der gesamte Menzer Forst«, schrieb Fontane, »flog durch Berliner Schornsteine.« Nach dem Kahlschlag heizte Berlin notgedrungen mit Linumer Torf. War die Kiefer also ursprünglich ein Gewächs unter vielen gewesen, machte sie um 1900 bereits vierundneunzig Prozent des gesamten brandenburgischen Waldbestandes aus. Auf den Kahlschlägen brachte man Kiefersetzlinge eng nebeneinander in den Boden. Unter den jungen Pflanzen brach ein Kampf um Luft und Licht aus. Es kam darauf an, möglichst schnell und astlos in die Höhe zu schießen. So entstand der militarisierte Wald, den man in Reinform noch im Naturpark Nuthe-Nieplitz und im Niederen Fläming besichtigen kann.
Als Kind war das für mich der Inbegriff von Wald: auf Linie stehende Stangen mit Borke, an deren fernem oberen Ende ein Toupet von dünnen Nadeln sitzt. Noch heute befällt mich in einem gedankenlos aufgeforsteten Baumghetto ein starkes Zugehörigkeitsgefühl. Ich möchte mein Zelt aufschlagen und bleiben. Dabei ist mir klar, dass der Wald, an dessen Rändern ich aufwuchs, eigentlich ein Erlenbruchwald hätte sein sollen, typisch für Niederungen und den Spreewald. Im Nordosten bestimmten der Buchenmischwald, Eichen und Birken einmal die Landschaft, im Süden und Osten der Traubeneichenwald. Von diesem ursprünglichen Zustand des Waldes lässt sich heute nur noch in der Schorfheide etwas erahnen. Für Menschen ohne Orientierungssinn eignet sich der militarisierte Kiefernwald allerdings prima zum Wandern. Da es so gut wie kein Unterholz gibt und die Wege schnurgeradeaus und rechtwinkling zueinander verlaufen, findet man auf jeden Fall wieder heraus. Die höchste Kiefer Brandenburgs ist übrigens knapp einundvierzig Meter hoch. Seit hundertsechzig Jahren ist sie der Abholzung entgangen und genießt mittlerweile Exotenschutz: Sie darf weiterhin im Forstrevier Gühlen-Glienicke westlich des Kalksees ungefällt in den Himmel ragen.
Die Wege
Einmal aus dem Auto ausgestiegen, in der Nase den Nadelgeruch, bleibt den Reisenden die Wahl, wie sie bei der Erforschung des Landes weiter vorgehen wollen. Für alle Arten der Fortbewegung wurden in den letzten zwanzig Jahren die Wege und Straßen ausgebaut, ausgenommen das Schienennetz (auch das steht in einem anderen Kapitel). Sie können sich aufs Rad oder ins Boot setzen, auf die Draisine oder aufs Pferdefuhrwerk, sie können sich Skates anschnallen oder zu Fuß losmarschieren. Gemessen an den Tourismusprospekten gehört Brandenburg zu jenen Ländern, in denen es darum geht, unentwegt voranzukommen.
Die Straßengräben der Alleen und die Deichanlagen an Flüssen, die Sandpisten von Tagebaurevieren wurden zu asphaltierten Radler- oder Skaterpisten ausgebaut. Auf einspurigen Schienentrassen entstanden Draisinestrecken. Aus ehemaligen Panzerstraßen wurden Reitwege. Die Kanäle möchte man für die Schifffahrt am liebsten noch tiefer ausbaggern und die Flüsse verbreitern, und nur die Untere Oder, die Stepenitz und das Nonnenfließ dürfen noch natürlich vor sich hin mäandern. Bei schmaleren begradigten Flüsschen und Fließen wird seit einigen Jahren die entgegengesetzte Vorgehensweise eingeschlagen. Hier möchte man, dass sich die Schlinggewächse enger schlingen, die Schmetterlingsraupen verpuppen und die Seerosen miteinander kopulieren, um dem romantischen Vorankommer im Paddelboot verträumte Sonnenuntergänge und kreisende Reiher bieten zu können.
Die Wasserstraßen
Das Image von der »Streusandbüchse des Heiligen Römischen Reiches«, das Brandenburg seit Jahrhunderten anhaftet, wird von den Wasserläufen und Wässerchen, die sich durch Brandenburg ziehen, jedenfalls gehörig unterwandert. Ein zweiunddreißigtausend Kilometer langes Gewässernetz, das auch gern mal über die Ufer tritt und für Auen und Brüche, Lüche und Moore sorgt, ergänzt um über dreitausend Seen machen Brandenburg zum wasserreichsten deutschen Bundesland. Da wird der Streusand aus der Büchse höchstens zum Trocknen der überschwemmten Felder benötigt. Die mächtigen Flüsse Oder und Elbe treten regelmäßig über die Ufer und bescheren dem jeweils amtierenden Ministerpräsidenten vor laufenden Kameras heldische Momente auf brechenden Deichen. Die Spree trullert dagegen gemächlich und in vielen Verzweigungen durchs Land. Ihr Gefälle ist so gering, dass sie hin und wieder auch rückwärts fließen soll. Sie kommt zwar nur langsam voran, hält aber ein ganzes Erholungsgebiet am Leben; den Spreewald. Sobald sie sich in die Havel ergießt, wird das Tempo rasanter. Das etwas stärkere Gefälle der Havel macht den dritten großen Fluss Brandenburgs zum lukrativsten, wie man an den fünfzig angeschlossenen Kanälen und etwa zwölf Schleusen sehen kann. Die Stadt Brandenburg, die »Wiege der Mark«, im Mittelalter eines der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Zentren, liegt mitten in diesem Fluss.
Stockungen und Stauungen
Schon Ende des 14. Jahrhunderts entstanden an der Havel so viele Wassermühlen, dass es einen Rückstau gab und das Wasser sich andere Wege suchen musste. Der Flusslauf verbreiterte sich stellenweise bis auf hundertsechzig Meter. Es entstand ein starker Strom. Aber im Grunde ist der »märkische Amazonas« ein kapriziöser Fluss; zuerst fließt er von Mecklenburg-Vorpommern aus nach Süden ins Brandenburgische hinein, dann fließt er nach Westen und schließlich nach Norden. Es hätte nicht viel gefehlt, und er hätte sich im Kreis gedreht, womit er eine Eigenart der Brandenburger schön illustriert: Man geht vorsichtig durchs Leben. Risiken werden selten eingegangen. Dafür, so das Urgefühl der Brandenburger, ist die eigene Position zu wacklig. Man streckt seine Fühler erst einmal nach allen Seiten aus, bevor eine Entscheidung gefällt wird. Man nimmt Umwege in Kauf. Das kann manchmal tatsächlich so wirken, als drehe man sich im Kreis. Der Grund dafür ist einfach: Man ist der tiefen Überzeugung, dass jede Entscheidung zum eigenen Nachteil ausfällt. Das Ziel steht beharrlich vor Augen, aber ein Grundmisstrauen hindert daran, es auf direktem Wege zu erreichen.
Das hat Auswirkungen auf die Freundlichkeit. Das Misstrauen mildert die Freundlichkeit gewissermaßen ab, was Sie als Landesfremde wissen sollten. Wenn das Hotelpersonal Ihnen auf eine ganz normale Frage eine beleidigte Antwort gibt, ist das nicht persönlich gemeint. Lächeln Sie, bleiben Sie gelassen. Was sich hier zeigt, ist nur die Wirkmächtigkeit eines kollektiven Traumas. Das brandenburgische Misstrauen stammt noch aus vorpreußischer Zeit. Brandenburg musste sich als schwaches Land zwischen großen Mächten wie Schweden, Polen oder Habsburg behaupten. Die Hohenzollern waren seit Beginn ihrer Herrschaft im 15. Jahrhundert abhängig von Bündnispartnern. Immer wieder mussten sie die enttäuschende Erfahrung machen, dass die Partner sie betrogen. Ein gesundes Misstrauen war also angebracht. Da sich dieses kollektive Phänomen schon Jahrhunderte gehalten hat, können Sie nicht davon ausgehen, dass es ausgerechnet im Laufe Ihres Urlaubs verschwindet …
Die Windmühle
Neben den Wassermühlen, die auch an der Spree, der Schlaube, der Schwarzer Elster, der Dahme und der Ucker seit dem Mittelalter klapperten, kommen Reisende durchs Brandenburgische auch an Windmühlen vorbei. Auf den märkischen Ebenen konnte der Wind genug Anlauf holen, um mit voller Kraft in die Mühlenblätter zu fahren. Als Preußen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Gewerbefreiheit einführte, erlebte das Mühlengeschäft einen Aufschwung, die Mühle wurde zu einem weiteren Wahrzeichen Brandenburgs. Es gab Bockwindmühlen, Holländerwindmühlen, Paltrockwindmühlen, Scheunenwindmühlen und Dreifachmühlen. Berühmt sind heute noch die Hochzeitsmühle in Dennewitz, die Mühle des selbstbewussten Müllers neben dem Schloss Sanssouci, der Friedrich II. erfolgreich die Stirn bot, als dieser die Mühle wegen Lärmbelästigung schließen wollte, und eine der letzten produzierenden Dreifachwindmühlen in Straupitz. An den meisten Orten haben Windparks die Mühlen ersetzt. Nachts blinken ihre Warnlichter rot und scheinbar frei schwebend ins Dunkel wie sich öffnende und schließende Augen. Sie bringen so manchen Einwohner um den Schlaf, aus Angst, Brandenburg könne sich zur Steckdose der Bundesrepublik entwickeln.
Die Fortbewegungsmittel
Dass Brandenburger in der Lage sind, ihre Gewässer mit allem zu befahren, was sich einigermaßen an der Wasseroberfläche halten kann, beweisen die Vehikel, die in den Häfen vor Anker liegen. Da gibt es neben Motorbooten, Segeljachten und Ruderkähnen auch Bungalows, Wohnwagen und Zweiräder auf schwimmenden Tonnen. Man kann sich in Tretboote setzen, die wie ein Schwan aussehen, wie eine Colabüchse und manchmal auch wie ein Tretboot. Manche Flöße mit Elektromotor haben eine voll ausgestattete Bar oder eine Tischtennisplatte an Bord. Im Spreewald bevorzugt man den Spreewaldkahn. Und im Lokalfernsehen wurde ein schwimmender Trabant vorgestellt, der sogenannte Schwimmtrabi, gebaut von zwei Männern aus Fürstenberg.
Reisende können diese Gefährte mieten und beispielsweise die älteste Wasserstraße Deutschlands, den Finowkanal, entlangschippern. Schon Anfang des 17. Jahrhunderts wurde diese künstliche Verbindung zwischen Havel und Oder angelegt. Dass die älteste Wasserstraße ausgerechnet in Brandenburg zu finden ist, hat einen Grund. In einem Land mit unberechenbaren Wegen bewegte man sich am sichersten auf dem Wasser fort. Noch bis ins vorletzte Jahrhundert waren Reisen ins Brandenburgische bei Ortsfremden verhasst, weil die Kutschen dauernd im Zuckersand stecken blieben, die Räder im Schlamm versanken, ganze Wegstrecken wegen Überflutung unpassierbar waren. Da stieg, wer konnte, ins Boot.
Und manchmal kommt man mit so einem Boot auch direkt in den Himmel; von unten aus gesehen. Wenn der fünfundachtzig Meter lange, viertausenddreihundert Tonnen schwere, wassergefüllte Trog des Schiffshebewerks Niederfinow auf dem Oder-Havel-Kanal die Boote sechsunddreißig Meter in die Luft hebt, sieht das allemal so aus, als verschwänden sie im Firmament. Die Fahrt dauert nur fünf Minuten. Aber sie verläuft innerhalb einer Stahlkonstruktion, die mit ihren fünf Millionen beeindruckenden Nieten auch locker das Himmelszelt tragen könnte. Bis 2014 soll das alte Hebewerk durch eine moderne Version ersetzt werden, die noch mehr Tonnen in noch kürzerer Zeit noch höher, also über Gott hinaus heben kann, und das zeigt, was Brandenburger alles leisten können, worauf sie, auch wenn sie es nicht offen sagen, sehr stolz sind. Schließlich war Brandenburg bis vor Kurzem und für etwa hundert Jahre eine Industrieregion. Das Land besaß ein Stahlkraftwerk, ein Chemiefaserwerk, ein Dieselkraftwerk, ein Lkw-Werk, ein Nähmaschinenwerk, Raffinerien, Hochöfen und einen Direktanschluss an die Erdöltrasse »Druschba-Freundschaft«. Böse Zungen behaupten, von der herstellenden Industrie sei heute nur das Plastinarium übrig geblieben, und in dem werden Leichen konserviert. Weniger böse Zungen reden davon, dass die Flüsse jetzt unvergiftet durch die Wiesen schießen, während rechts und links im öden Grün, auf kargem Land, auf geordnetem Boden friedlich die Ökokühe weiden.
Verlorenwasser
Auf Verlorenwasser sollte man keinen Bootsausflug machen, nicht einmal mit dem Kanu. Dieses Flüsschen verschwindet gleich an der Quelle. Es geht verloren und taucht erst am Mittelpunkt der DDR wieder auf. Was erneut klingt wie ein Märchen, ist einer Unterhaltungssendung des DDR-Fernsehens zu verdanken. Aufgrund der Zensur herrschte ein solcher Themenmangel, dass der Moderator auf die Idee kam, die Landkarte der DDR auszuschneiden, sie auf Pappe zu kleben, diese mit der Nadel aufzuspießen und so auszutarieren, dass sie im Gleichgewicht hing. Wo die Nadel saß, war der Massemittelpunkt der DDR: Verlorenwasser. Damals befand sich dieser Ort in einem Truppenübungsgelände der Nationalen Volksarmee. Heute befindet er sich in einer Wüstenei, für die nach der Wende große Pläne geschmiedet wurden. Man wollte mit einem Golfplatz den »Breitentourismus« etablieren. Leider gibt es in Brandenburg zu viel Breite und zu wenig Menschen, die sich das Golfen leisten könnten.
Die Nähe zu Amerika
Um das leidige Image von der trockenen Ödnis endgültig loszuwerden, legt man gewässermäßig noch eins drauf: Man flutet alte Tagebaue. Das ehemalige Braunkohlegebiet der Lausitz soll mit vierzehntausend Hektar die größte Seenlandschaft Europas werden. Dann wird Brandenburg sogar eine eigene Ostsee haben: die Cottbusser Ostsee, in der heute noch Abraumbagger stehen. Allerdings hat Brandenburg darauf nicht den Alleinanspruch. Es muss sich die See im Süden mit Sachsen teilen. Für die Bewohner der Dörfer, die die Tagebaukrater verschlungen haben, wird das geflutete Braunkohlerevier eines Tages zu Vineta, der sagenumwobenen Ostseestadt, die einst bei Sturmhochwasser untergegangen sein soll: An der Reling eines Fahrgastschiffs stehend, werden die Heimatlosen ihre alte Kirchturmglocke vom Grund des Ilsesees (offiziell: Großräschener See) herauf läuten hören. Es wird das gleiche sagenhafte Läuten sein wie am Scharmützelsee. Auch dort soll am Grund eine Kirche stehen. Als der zweitgrößte natürliche See Brandenburgs einst entstand, soll er ein ganzes Dorf mitsamt seinen Bewohnern verschlungen haben. Böse Zungen behaupten, selbst das Schicksal wäre von Brandenburg so gelangweilt, dass es sich gelegentlich wiederholt.
Das Braunkohlegebiet veranschaulicht übrigens die große Nähe Brandenburgs zur amerikanischen Prärie. Das Image vom wilden Osten ist nichts Neues. Es entstand mit jenen Besuchern aus den westlichen Regionen Deutschlands, die sich eine Lenkradsperre und Kampfgas kauften, bevor sie ihre Verwandten im Speckgürtel von Berlin besuchten, und wird von Generation zu Generation weiter tradiert. In der Niederlausitz findet dieses Image nun in ein landschaftliches Bild: Wer es sich nicht leisten kann, in die kalifornische Wüste zu reisen, kann die kalifornische Wüste auch in Welzow oder Lakoma erleben. Jedenfalls sagte mein Vater, kaum stand er auf dem Gebirgszug oberhalb des Death Valley, enttäuscht: »Da hätten wir auch zu Hause bleiben können. Hier sieht’s aus wie im Tagebau!«
Die Erlebniswege
Ende der Leseprobe