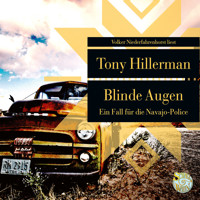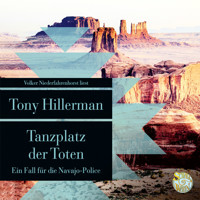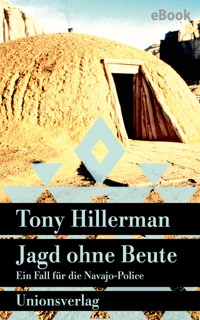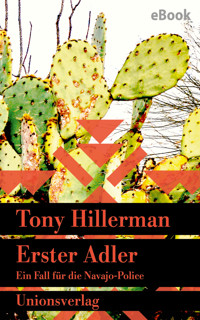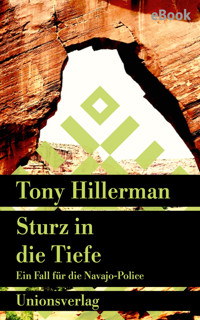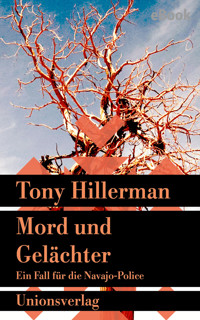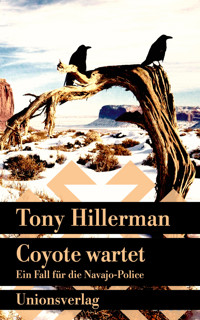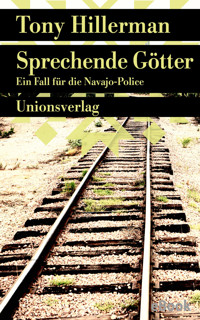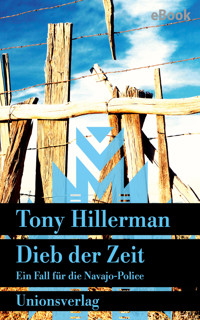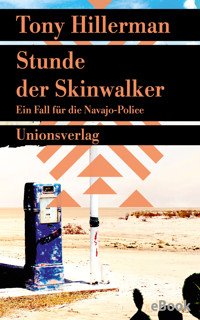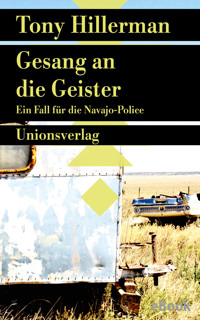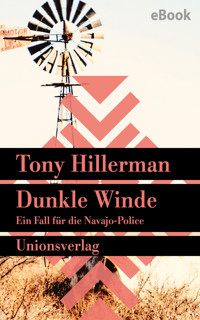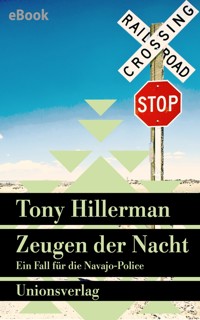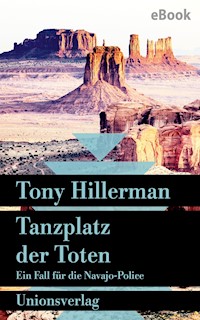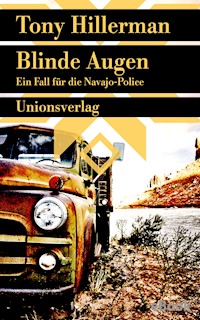
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Bei einer Verkehrskontrolle entgeht Lieutenant Joe Leaphorn von der Navajo-Police nur knapp einem Mordversuch. Während er sich bemüht, den flüchtigen Täter ausfindig zu machen, wird ihm ein neuer Fall übertragen: ein Doppelmord in einem abgelegenen Hogan. Die alte Margaret Cigaret will ihn in einer Vision vorhergesehen haben. Leaphorn folgt den verschlungenen Wegen der beiden Fälle und findet sich bald in einem Labyrinth aus Täuschungen, Widersprüchen und Geheimnissen wieder – ein Labyrinth, das ihn in eine gefährliche Richtung zwingt. Der zweite Fall für Joe Leaphorn führt hoch hinauf ins Monument Valley und hinter die Grenzen des Greifbaren. Verfilmt als Serie »Dark Winds – Der Wind des Bösen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
Lieutenant Joe Leaphorn entgeht nur knapp einem tödlichen Angriff, und kurz darauf wird er zu einem Doppelmord gerufen. Die Zeugin: die alte Margaret Cigaret, die den Mord in einer Vision vorhergesehen hat. Leaphorn folgt den Hinweisen tief ins Monument Valley und gerät in ein gefährliches Labyrinth aus Täuschungen und Geheimnissen.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tony Hillerman (1925-2008) besuchte ein Internat für Native Americans, kämpfte im Zweiten Weltkrieg, studierte Journalismus und war als Journalist und Dozent tätig. Seine Romane um die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee wurden vielfach ausgezeichnet und in siebzehn Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Tony Hillerman.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tony Hillerman
Blinde Augen
Mit einem Nachwort von Claus Biegert
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Friedrich A. Hofschuster
Ein Fall für die Navajo-Police (2)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Worterklärungen und Hintergrundinformationen zu diesem Buch auf https://ehillerman.unm.edu/encyclopedia-main
Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Vroni Straass-Lieckfeld nach dem Original durchgesehen und überarbeitet.
Die Originalausgabe erschien 1978 bei Harper & Row, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1989 im Rowohlt Verlag, Hamburg.
Originaltitel: Listening Woman
© by Tony Hillerman 1978
Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit HarperCollins Publishers LLC
© by Unionsverlag, Zürich 2023
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hintergrund - Arny Raedts (Alamy Stock Foto); Symbol - Tetiana Lazunova (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31160-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.01.2023, 14:32h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
BLINDE AUGEN
1 – Der Südwestwind ließ sich von den San Francisco …2 – Der Lautsprecher des Funkgeräts knackte und knisterte …3 – Die Büroangestellte in der Außenstelle der Navajo-Police in …4 – Es macht keinen Unterschied, ob ein Mann oder …5 – Die Stimme von Listening Woman begleitete Joe Leaphorn …6 – Es erwies sich als unnötig, Theodora Adams zu …7 – Nach den lockeren Standards des Navajo-Reservats galten die …8 – Wäre Leaphorns Zeiteinteilung perfekt gewesen, dann hätte er …9 – Vorsichtig goss sich McGinnis den Bourbon ein …10 – Der Wind folgte Leaphorns Geländewagen den halben Weg …11 – Special Agent George Witover, der Leaphorn in den …12 – Das rechte Auge von John Tull starrte direkt …13 – Die Wolke begann sich gegen Mittag über der …14 – Leaphorn war fast drei Stunden lang gegangen …15 – Das Problem würden die Flammen, die Hitze und …16 – Die Zeiger der Armbanduhr und die Ziffern leuchteten …17 – Leaphorn kroch vorsichtig zurück in das Labyrinth …18 – Nein, nein«, sagte Goldrims. »Schau her. Da muss …Mehr über dieses Buch
Über Tony Hillerman
»Der Angst vor seinem Pferd hat«
Claus Biegert: Die Navajo-Romane — ein Fall von Kultureller Wertschätzung
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tony Hillerman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema USA
1
Der Südwestwind ließ sich von den San Francisco Peaks ein paar heftige Böen und Wirbel mitgeben, er heulte über die Weiten des Moenkopi Plateau und entlockte den Fenstern der alten Hopi-Dörfer in Shongopovi und auf dem Tafelberg, der Second Mesa, tausend seltsame Geräusche. Zweihundert menschenleere Meilen weiter nach Norden und Osten bearbeitete er die Steinskulpturen des Monument Valley Tribal Park wie mit einem Sandstrahler und pfiff weiter östlich durch das Labyrinth der Canyons an der Grenze zwischen Utah und Arizona. Über der ausgedörrten Unendlichkeit der Nokaito Bench erfüllte er den leeren blauen Himmel mit seinem Rauschen. Beim Hogan von Hosteen Tso, genau um 15.17 Uhr, wurden die wirbelnden Böen zum Staubteufel, der quer über den Feldweg strudelte, brüllend über den alten Dodge-Pick-up von Margaret Cigaret hinwegkreiselte und dicht an Tsos Buschlaube vorbeifegte.
Die drei Menschen unter der Laube duckten sich, um sich vor dem dahintreibenden Staub zu schützen. Tso hielt sich die Hände vor die Augen und beugte sich in seinem Schaukelstuhl nach vorn, während der Sand wie mit tausend Nadeln in seine nackten Schultern stach. Anna Atcitty drehte dem Sturm den Rücken zu und legte die Hände schützend auf ihr Haar, denn wenn das hier vorbei war und sie Margaret Cigaret wieder nach Hause gebracht hatte, würde sie sich mit dem neuen, jungen Gehilfen von der Short-Mountain-Handelsstation treffen. Und Mrs Margaret Cigaret, die auch Blind Eyes und Listening Woman genannt wurde, warf ihren Schal über den magischen Krimskrams, den sie auf dem Tisch in der Laube ausgebreitet hatte, und zog die Enden des Schals fest nach unten, damit nichts davonfliegen konnte.
»Verdammter Dreckswind«, sagte sie. »Verdammter Scheißkerl.«
»Das sind die Blue Flint Boys; die haben ihn geärgert«, sagte Hosteen Tso mit seiner zittrigen Altmännerstimme. Er wischte sich mit den Handrücken über die Augen und schaute dem Staubteufel nach. »Das hat mir mein Großvater gesagt. Die Blue Flint Boys sind es, die den Wind zu solchem Unsinn anstacheln, wenn sie ihre Spielchen treiben.«
Listening Woman legte sich den Schal wieder um die Schultern, tastete sich bedächtig durch die Sammlung von Fläschchen, Bürsten und Fetischen auf dem Tisch, wählte ein durchsichtiges Plastikfläschchen aus der Apotheke und schraubte es auf.
»Denkt nicht an die Blue Flint Boys«, sagte sie. »Denkt lieber an das, was wir hier tun. Denk darüber nach, wie du dieses Leiden in deinen Körper bekommen hast.« Sie schüttete eine Portion gelben Maispollen aus dem Fläschchen und wandte ihre blinden Augen dorthin, wo das Mädchen stand. »Pass jetzt gut auf, Tochter meiner Schwester. Wir werden diesen Mann mit dem Pollen segnen. Weißt du noch, wie wir das machen?«
»Du singst das Lied des Talking God«, sagte Anna Atcitty. »Das Lied über Born of Water und den Monster Slayer.« Sie war ein hübsches Mädchen, vielleicht sechzehn Jahre alt. Auf die Vorderseite ihres T-Shirts waren die Worte GANADO HIGH SCHOOL und TIGER PEP gedruckt.
Listening Woman streute den Pollen sorgfältig über die Schultern von Hosteen Tso und sang dazu leise in der melodischen Navajosprache. Die linke Gesichtsseite des alten Mannes war vom Wangenknochen bis zum Haaransatz blauschwarz bemalt. Ein weiterer blauschwarzer Fleck war auf den mageren Brustkorb dorthin gemalt, wo das Herz sitzt, und darüber wölbte sich von einer Brustwarze zur anderen die farbenfrohe Strichmännchen-Gestalt des Regenbogenmannes, die Anna Atcitty in den Ritualfarben Blau, Gelb, Grün und Grau gestaltet hatte. Tsos magerer, sehniger Körper hielt sich jetzt kerzengerade im Schaukelstuhl, sein Gesicht war von Krankheit, Geduld und unterdrückten Schmerzen gezeichnet. Der Gesang von Listening Woman wurde plötzlich lauter. »In Schönheit sei es vollendet«, sang sie. »In Schönheit sei es vollendet.«
»Gut«, sagte sie. »Jetzt gehe ich und lausche der Erde, damit sie mir sagt, was dich krank macht.« Sie tastete wieder vorsichtig auf dem Bohlentisch herum, sammelte die Fetische und Amulette ein, die zu ihrem Beruf gehörten, und suchte dann ihren Gehstock. Margaret Cigaret musste früher einmal schön gewesen sein. Jetzt war sie eine füllige Frau und trug den traditionellen, weiten Rock und die blaue Samtbluse der Diné. Sie steckte die letzten Fläschchen in ihre schwarze Plastikhandtasche, ließ sie zuschnappen und richtete dann ihre blicklosen Augen auf Tso. »Denk jetzt noch einmal genau nach, bevor ich gehe. Wenn du träumst, dann träumst du von deinem Sohn, der tot ist, und von dem Ort, den du die bemalte Höhle nennst – ist das richtig? Kommt in deinem Traum keine Hexe vor?« Sie hielt inne, um Tso für seine Antwort Zeit zu lassen.
»Nein«, sagte er. »Keine Hexen.«
»Keine Hunde? Keine Wölfe? Keine Spur von Navajo-Wölfen?«
»Keine Spur von Hexen«, sagte Tso. »Ich träume von der Höhle.«
»Warst du vielleicht bei den Huren drüben in Flagstaff? Oder hast du es mit einer aus deiner Verwandtschaft getrieben?«
»Zu alt«, erwiderte Tso und lächelte ein wenig.
»Hast du Holz verbrannt, das von einem Blitz getroffen worden ist?«
»Nein.«
Listening Woman starrte mit ihren blinden Augen streng an ihm vorbei. »Hör zu, alter Mann«, sagte sie, »es wäre besser, wenn du mir mehr darüber erzählen würdest, wie diese Sandbilder entweiht worden sind. Wenn du nicht willst, dass andere Leute etwas davon erfahren, kann Anna hinter den Hogan gehen. Dann weiß es niemand außer dir und mir. Und ich verrate keine Geheimnisse.«
Hosteen Tso lächelte wieder, der Hauch eines Lächelns. »Aber jetzt weiß es niemand außer mir«, sagte er, »und ich verrate erst recht keine Geheimnisse.«
»Wenn du mir mehr erzählst, kann ich dir vielleicht sagen, warum du krank bist«, gab ihm Listening Woman zu bedenken. »Mir kommt es wie Hexerei vor. Sandbilder werden entweiht, hast du gesagt. Wenn dort mehr als ein Sandbild war, muss jemand die Zeremonie falsch abgehalten haben. Eine falsch ausgeführte Zeremonie würde den Segen ins Gegenteil verkehren. Das wäre dann Hexerei. Wenn du dich mit Navajo-Wölfen herumgetrieben hast, brauchst du eine andere Behandlung.«
Tsos Miene wurde jetzt störrisch. »Du musst eines begreifen, Mrs Cigaret: Ich habe vor langer Zeit ein Versprechen gegeben. Es gibt Dinge, über die ich nicht reden darf.«
Das Schweigen zog sich hin. Listening Woman sah unterdessen irgendeine der Visionen, wie sie die Blinden oft in ihren Köpfen haben, während Hosteen Tso über die Hochebene starrte und Anna Atcitty mit ausdruckslosem Gesicht auf das Ergebnis dieser Geduldsprobe wartete.
»Eines habe ich vergessen, dir zu sagen«, begann Tso endlich. »An dem Tag, als die Sandbilder zerstört wurden, habe ich einen Frosch getötet.«
Listening Woman sah ihn bestürzt an. »Wie ist das passiert?«, fragte sie. Nach der komplizierten Metaphysik der Navajo waren Frösche heilig, sie standen in Verbindung zu den Holy People und wurden mit großem Respekt behandelt. Wenn man Tiere oder Insekten tötete, die heilige Gedanken verkörperten, verstieß man gegen ein elementares Tabu, und die Folge davon waren Krankheiten, die zu Lähmungen führten.
»Ich bin zwischen den Felsen herumgeklettert«, sagte Tso. »Ein Felsbrocken ist heruntergefallen und hat den Frosch zerquetscht.«
»War das, bevor die Sandbilder entweiht wurden oder danach?«
»Danach«, sagte Tso. Er hielt inne. »Ich werde nicht mehr über die Sandbilder sprechen. Ich habe alles gesagt, was ich sagen kann. Ich habe dieses Versprechen meinem Vater gegeben und dem Vater meines Vaters. Wenn ich eine Geisterkrankheit habe, kommt sie vom Geist meines Urgroßvaters, weil ich dort war, wo sein Geist sein könnte. Mehr kann ich dir wirklich nicht sagen.«
Listening Woman sah finster drein. »Warum willst du dein Geld verschwenden, alter Mann?«, fragte sie. »Du lässt mich den ganzen weiten Weg hierherkommen, damit ich herausfinde, was für eine Behandlung du brauchst. Und jetzt willst du mir nicht sagen, was ich wissen muss.«
Tso saß reglos da und starrte vor sich hin.
Listening Woman wartete stirnrunzelnd.
»Verdammt noch mal!«, sagte sie schließlich. »Ich muss einfach ein paar Dinge wissen. Du glaubst, du seist in der Nähe von ein paar Hexen gewesen. Allein das Beisammensein mit diesen Skinwalkers kann schon krank machen. Ich muss mehr darüber wissen.«
Tso sagte nichts.
»Wie viele Hexen waren es?«
»Es war dunkel«, sagte Tso. »Vielleicht zwei.«
»Haben sie dir etwas angetan? Haben sie etwas auf dich geblasen? Haben sie Leichenpulver auf dich gestreut? Irgendetwas in der Art?«
»Nein«, sagte Tso.
»Und warum nicht?«, fragte Mrs Cigaret. »Bist du vielleicht selbst ein Navajo-Wolf? Bist du einer von den Hexern?«
Tso lachte. Es war ein nervöses Lachen. Er warf einen Blick auf Anna Atcitty – einen Hilfe suchenden Blick.
»Ich bin kein Skinwalker«, sagte er.
»Es war dunkel«, wiederholte Listening Woman fast spöttisch. »Aber vorhin hast du gesagt, dass es Tag war. Bist du vielleicht in der Höhle der Hexen gewesen?«
Tsos Verlegenheit verwandelte sich in Zorn. »Mrs Cigaret«, fuhr er sie an, »ich sagte dir schon, ich kann nicht darüber sprechen, wo es war. Ich habe ein Versprechen gegeben. Wir reden nicht mehr darüber.«
»Großes Geheimnis«, sagte Mrs Cigaret in sarkastischem Ton.
»Jawohl«, bekräftigte Tso. »Es ist ein großes Geheimnis.«
Sie machte eine ungeduldige Handbewegung. »Ach, zum Teufel«, sagte sie. »Du willst offenbar dein Geld vergeuden, aber ich habe keine Lust, meine Zeit zu vergeuden. Wenn ich beim Lauschen nichts höre oder wenn ich mich irre, liegt es daran, dass du mir nicht genug erzählt hast. Anna wird mich jetzt dahin bringen, wo ich die Stimme der Erde hören kann. Lass das Bild auf deiner Brust in Ruhe. Wenn ich zurückkomme, versuche ich dir zu sagen, was für einen Gesang du brauchst.«
»Warte.« Tso zögerte. »Eines noch. Weißt du, wie man einen Brief an jemanden schickt, der auf der Jesus Road geht?«
Listening Woman runzelte wieder die Stirn. »Du meinst jemanden, der aus dem Großen Reservat weggegangen ist? Frag Old Man McGinnis. Er schickt den Brief für dich.«
»Ich habe ihn gefragt. McGinnis weiß nicht, wie man das macht«, erklärte Tso. »Er sagt, man muss draufschreiben, wohin der Brief geschickt werden soll.«
Listening Woman lachte. »Sicher«, sagte sie. »Die Adresse. Wie Gallup, oder Flagstaff, oder wo immer sie leben, und auch noch den Namen der Straße, in der sie wohnen, solche Dinge. Wem willst du denn schreiben?«
»Meinem Enkel«, sagte Tso. »Ich möchte unbedingt, dass er herkommt. Aber ich weiß nur, dass er sich den Jesus People angeschlossen hat.«
»Ich habe keine Ahnung, wie du ihn finden willst«, sagte Listening Woman. Sie hatte ihren Gehstock gefunden. »Mach dir deshalb keine Sorgen. Jemand anderer kann dir einen Singer besorgen und sich auch um alles Weitere kümmern.«
»Aber ich muss ihm etwas sagen«, erklärte Hosteen Tso. »Ich muss ihm etwas sagen, bevor ich sterbe. Dringend.«
»Ich kann dir da nicht weiterhelfen.« Listening Woman wandte sich ab und tastete mit ihrem Stock nach dem Stützpfeiler in der Mitte der Laube, um sich zu orientieren. »Komm jetzt, Anna. Bring mich an die Stelle, wo ich lauschen kann.«
Listening Woman fühlte die Kühle des Felsens schon, bevor sein Schatten auf ihr Gesicht fiel. Sie hatte sich von Anna zu einer Stelle führen lassen, wo die Erosion eine sandbedeckte Ausbuchtung, eine Art Sackgasse im Gestein geschaffen hatte. Dann schickte sie das Mädchen weg. Anna solle erst zurückkommen, wenn sie nach ihr rief. Anna war in mancherlei Hinsicht eine gute Schülerin, dann wieder ließ sie zu wünschen übrig. Aber wenn sie erst einmal nicht mehr so verrückt nach Jungs ist, könnte sie ein guter Listener werden. Die Nichte von Listening Woman hatte wie ihre Tante die seltene Gabe, die Stimmen im Wind zu hören und die Visionen zu empfangen, die aus der Erde kamen. Es war ein Talent, das in der Familie lag – eine Gabe, mit deren Hilfe sich die Ursachen von Krankheiten aufspüren ließen. Der Onkel ihrer Mutter war als Hand-Trembler für die Diagnose der Blitzkrankheit im ganzen Short-Mountain-Gebiet berühmt gewesen. Und Listening Woman selbst war, wie sie sehr wohl wusste, in diesem Teil der Big Reservation weit und breit bekannt. Eines Tages würde auch Anna berühmt sein.
Listening Woman ließ sich auf dem Sand nieder, drapierte dann ihren Rock um sich und lehnte die Stirn gegen den Stein. Er war kühl und rau. Anfangs ging ihr noch durch den Kopf, was Old Man Tso erzählt hatte, und sie versuchte, daraus seine Krankheit zu diagnostizieren. Dieser Tso hatte etwas an sich, das sie beunruhigte und sehr traurig machte. Dann bekam sie endlich den Kopf frei und dachte nur an den Abendhimmel und an das Licht eines einzelnen Sterns. Sie ließ den Stern in ihren Gedanken größer werden und erinnerte sich daran, wie er ausgesehen hatte, bevor die Blindheit über sie gekommen war.
Eine Windbö pfiff durch die Pinien an der Mündung der Felsausbuchtung und wirbelte den Rock von Listening Woman durcheinander, sodass einer ihrer blauen Tennisschuhe zum Vorschein kam. Aber sie atmete jetzt tief und gleichmäßig. Der Schatten des Felsens wanderte Zentimeter um Zentimeter über den sandigen Boden. Listening Woman stöhnte, stöhnte noch einmal, murmelte etwas Unverständliches und verfiel dann in tiefes Schweigen.
Irgendwo weiter unten am Abhang flog krächzend ein halbes Dutzend Raben auf. Irgendetwas hatte sie erschreckt. Der Wind frischte kurz auf und verebbte dann wieder. Eine Eidechse kam aus einer Spalte im Felsen, sah die Frau, ohne zu blinzeln, aus ihren kalten Augen an und huschte dann zu ihrem Nachmittags-Lauerplatz unter dem Stängelgewirr eines Steppenläufergewächses. Halb verweht von den Windgeräuschen, drang ein Ton von weit her bis in den sandigen Winkel. Der Schrei einer Frau. Er schwoll an und verklang in einem Schluchzen. Dann war alles wieder still. Die Eidechse fing eine Pferdebremse. Listening Woman atmete gleichmäßig.
Als der Schatten des Felsens fünfzig Meter hangabwärts gewandert war, rappelte sich Listening Woman mühsam aus dem Sand hoch auf die Beine. Einen Moment lang blieb sie mit gesenktem Kopf stehen, beide Hände aufs Gesicht gepresst und noch halb versunken in diese seltsame Trance. Es war, als wäre sie in den Felsen hineingegangen und durch ihn in die Schwarze Welt gelangt, wo einst der Anfang aller Dinge gewesen war – damals, als es nur Holy People gab und als das, was später einmal die Navajo werden sollten, noch Nebel war. Schließlich hatte sie die Stimme gehört und sich in der Vierten Welt wiedergefunden. Sie hatte durch das Ausstiegsloch im Felsen hinuntergeschaut und Hosteen Tso in dem gesehen, was Tsos bemalte Höhle gewesen sein musste. Ein alter Mann hatte auf dem Boden der Höhle in einem Schaukelstuhl gesessen und geschaukelt, und dabei hatte er sein Haar mit Bändern geflochten. Zuerst war es Tso gewesen, aber als der Mann dann zu ihr aufschaute, hatte sie gesehen, dass das Gesicht des Mannes tot war. Rings um den Schaukelstuhl quoll unaufhaltsam Schwärze nach oben.
Listening Woman rieb sich mit den Händen die Augen, schüttelte den Kopf und rief nach Anna. Sie wusste jetzt, welche Diagnose sie stellen musste. Hosteen Tso brauchte Gesänge, einen Mountain Way Chant und einen Black Rain Chant. In der bemalten Höhle war eine Hexe gewesen, und Tso war dort gewesen und hatte sich mit irgendeiner Geisterkrankheit angesteckt. Das bedeutete, dass er sich einen Singer – wie man die rituellen Sänger nennt – suchen musste, der den Mountain Way singen konnte, und einen, der den Black Rain beherrschte. Sie wusste es – aber zugleich fürchtete sie, dass es zu spät sein würde. Wieder schüttelte sie den Kopf.
»Mädchen«, rief sie, »ich bin jetzt so weit.«
Was würde sie Tso sagen? Mit dem sensiblen Gehör der Blinden lauschte sie auf Anna Atcittys Schritte, doch sie hörte nichts als das Säuseln des Windes.
»Mädchen!«, brüllte sie. »Mädchen!« Als sie immer noch nichts hörte, tastete sie sich am Felsen entlang und fand ihren Stock. Vorsichtig fanden ihre Füße zurück auf den Weg, der zum Hogan führte. Sollte sie Tso von der allumfassenden Dunkelheit berichten, die sie gesehen hatte, als die Stimme zu ihr sprach? Sollte sie von den Schreien der Geister berichten, die sie im Inneren des Felsens gehört hatte? Sollte sie ihm sagen, dass er bald sterben würde?
Zurück auf dem Pfad, rief sie wieder nach Anna, dann brüllte sie nach Old Man Tso, er solle herkommen und sie führen. Wieder wartete sie, doch sie hörte nichts als die Bewegung der Luft. Vorsichtig arbeitete sie sich mit dem Stock den Schafspfad entlang, während sie wütend vor sich hinmurmelte. Ihre Stockspitze warnte sie vor einem Kaktus, half ihr, einer Senke und gleich danach einem Felsvorsprung auszuweichen. Der Stock tippte gegen eine ausgetrocknete Grasbulte und berührte den kleinen Finger der ausgestreckten, linken Hand von Anna Atcitty. Ihre Hand lag mit der Handfläche nach oben, der Wind hatte etwas Sand hineingeweht, und selbst für Listening Woman, die darin geübt war, ihre Umwelt über feinste Berührungen wahrzunehmen, fühlte sich der Finger nur wie ein Stückchen Holz an. Und so tastete sie sich weiter den Pfad hinunter, rief immer wieder und brummte unwillig vor sich hin. Schließlich kam sie zu der Stelle, wo der Leichnam von Hosteen Tso ausgestreckt neben dem umgekippten Schaukelstuhl lag. Noch immer hatte er die Zeichnung des Rainbow Man auf der Brust.
2
Der Lautsprecher des Funkgeräts knackte und knisterte, und dann hörte man: »Tuba City.«
»Einheit neun«, antwortete Joe Leaphorn. »Habt ihr was für mich?«
»Einen Moment, Joe.« Die Stimme, die aus dem Lautsprecher kam, klang angenehm feminin.
Der junge Mann, der auf dem Beifahrersitz im Wagen der Navajo-Police saß, starrte durchs Fenster auf den Sonnenuntergang. Das restliche Licht der untergehenden Sonne umrahmte die zerklüfteten San Francisco Peaks am Horizont mit leuchtenden Konturen, färbte das feine Gespinst hoher Wolken leuchtend rosa und hinterließ auf der Wüstenlandschaft und auf dem Gesicht des Mannes einen rötlichen Widerschein. Es war ein flaches, mongolisches Gesicht mit feinen Linien um die Augen, die ihm einen etwas spöttisch boshaften Ausdruck verliehen. Er trug einen schwarzen Stetson aus Filz, dazu eine Jeansjacke und ein Cowboyhemd im Rodeostil. An seinem linken Handgelenk saß eine Timex für 12.95 $ mit einem schweren silbernen Uhrenarmband in Sandgusstechnik, außerdem eine Polizei-Handschelle in Standardausführung, die sein linkes ans rechte Handgelenk fesselte. Er warf Leaphorn einen kurzen Blick zu und nickte Richtung Sonnenuntergang.
»Ja«, sagte Leaphorn. »Hab ich schon gesehen.«
Das Funkgerät fing wieder an zu knacken. »Also, zwei oder drei Dinge liegen an«, sagte die Frauenstimme. »Der Captain hat gefragt, ob Sie den Begay-Typen haben. Er meinte, Sie sollten ihn nicht wieder entwischen lassen.«
»Jawohl, Ma’am«, sagte jetzt der junge Mann. »Sie können dem Captain sagen, dass der Begay-Typ verhaftet ist.«
»Ich hab ihn hier«, bestätigte Leaphorn.
»Und sagen Sie ihr, dass ich diesmal die Zelle mit Aussicht buchen will«, fügte der junge Mann hinzu.
»Begay sagt, er möchte die Zelle mit Aussicht«, gab Leaphorn durch.
»Und mit Wasserbett«, sagte Begay.
»Und der Captain möchte mit Ihnen sprechen, wenn Sie hier sind«, kam es aus dem Lautsprecher.
»Worüber?«
»Das hat er nicht gesagt.«
»Aber ich wette, Sie wissen es.«
Der Lautsprecher schepperte, so sehr lachte sie. »Na ja«, sagte die Stimme. »Window Rock hat angerufen und den Captain gefragt, warum Sie nicht drüben sind und bei den Pfadfindern aushelfen. Wann können Sie hier in Tuba City sein?«
»Wir sind auf der Navajo-Route 1 westlich von Tsegi«, sagte Leaphorn. »In ungefähr einer Stunde sind wir in Tuba City.« Er schaltete den Sender aus.
»Was ist das für eine Sache mit den Pfadfindern?«, fragte Begay.
Leaphorn seufzte. »In Window Rock hatte man die grandiose Idee, die Boy Scouts of America zu einer Art regionalem Feldlager im Canyon de Chelly einzuladen. Die Jungs kommen aus dem ganzen Westen und fallen ein wie ein Schwarm Heuschrecken. Und natürlich soll sich der Hüter des Gesetzes darum kümmern, dass sich niemand verläuft oder von einer Klippe fällt oder sonst was.«
»Na ja«, sagte Begay. »Dafür bezahlen wir euch ja auch.«
Weit links, vielleicht zehn Meilen das dunkle Klethla Valley hinauf, glitt ein Lichtpunkt über die Route 1 genau auf sie zu. Begay unterbrach sich und beobachtete das Licht. Dann pfiff er durch die Zähne. »Da kommt ein schneller Indianer.«
»Ja«, sagte Leaphorn. Er ließ den Kombi den Hügel hinunter auf den Highway zurollen und schaltete dann die Scheinwerfer aus.
»Das ist hinterlistig«, sagte Begay.
»Aber es schont die Batterie«, erwiderte Leaphorn.
»Genauso hinterlistig, wie Sie mich geschnappt haben«, fügte Begay hinzu. In seinen Worten lag kein Groll. »Parkt auf der anderen Seite des Hügels und kommt dann einfach harmlos auf den Hogan zu, sodass kein Mensch ihn für einen Polizisten hält.«
»Yeah«, sagte Leaphorn.
»Wieso haben Sie überhaupt gewusst, dass ich auf dem Fest bin? Haben Sie rausbekommen, dass die Endischees meine Leute sind?«
»So ist es«, sagte Leaphorn.
»Und außerdem sind Sie dahintergekommen, dass eine Kinaalda-Zeremonie für dieses Endischee-Mädchen gefeiert wird?«
»Yeah«, bestätigte ihm Leaphorn. »Und ich habe damit gerechnet, dass du dazukommst.«
Begay lachte. »Selbst wenn nicht, wäre das immerhin viel besser gewesen, als überall rumzurennen und nach mir zu suchen.« Er warf einen Blick auf Leaphorn. »Lernt man so was auf dem College?«
»Ja«, sagte Leaphorn. »Wir haben ein Extra-Seminar absolviert: Wie fängt man Begays.«
Der Kombi holperte über einen Weiderost, dann das Gefälle am Straßenrand hinunter, wo Leaphorn den Wagen parkte und den Motor abschaltete. Es war inzwischen fast dunkel geworden. Nur am westlichen Horizont war noch ein letztes Nachglimmen zu sehen; die Venus stand hell auf halber Höhe am Himmel. Mit dem Licht war auch die Hitze verschwunden. Jetzt machte sich die Kühle der Nacht in der dünnen Höhenluft bemerkbar. Eine Brise wehte durch die offenen Wagenfenster herein und brachte leise Insektengeräusche mit und den Ruf eines Ziegenmelkers, der seine nächtliche Jagd begonnen hatte. Die Brise verebbte, und als sie wieder auffrischte, trug sie das hohe Heulen eines Motors und das Kreischen von Reifen heran – noch ein paar Meilen entfernt.
»Der Schweinehund kommt ganz schön voran«, sagte Begay. »Hören Sie sich das an.«
Leaphorn lauschte.
»Hundert Meilen pro Stunde.« Begay kicherte. »Wahrscheinlich sagt er Ihnen, dass sein Tacho kaputt ist.«
Das Scheinwerferlicht kam über den Hügel, kippte dann nach unten und raste die kleine Anhöhe hinter ihnen hinauf. Leaphorn ließ den Motor an und schaltete seine Scheinwerfer und die rote Warnblinkleuchte auf dem Dach ein. Einen Augenblick lang blieb das Heulen des heranrasenden Wagens gleich. Dann veränderte sich plötzlich die Tonhöhe. Man hörte kurzes Quietschen von Gummi auf dem Asphalt und das Aufjaulen eines Motors, der abrupt runtergeschaltet wird. Der Fahrer steuerte den Wagen auf den Seitenstreifen und brachte ihn etwa fünfzehn Meter hinter dem Polizeiwagen zum Stehen. Leaphorn nahm sein Notizbrett von der Ablage und stieg aus.
Zuerst konnte er im aufgeblendeten Scheinwerferlicht nichts sehen. Dann erkannte er den Mercedesstern auf der Motorhaube und dahinter die Windschutzscheibe, die alle zwei Sekunden von Leaphorns rotierendem Blinklicht beleuchtet wurden. Leaphorn ging über den Kies des Seitenstreifens auf den Wagen zu und ärgerte sich über die unhöflich aufgeblendeten Scheinwerfer. In der pulsierenden roten Beleuchtung des Warnlichts sah er das Gesicht des Fahrers, der ihn durch runde Brillengläser mit Goldrand anstarrte. Und dahinter, auf dem Rücksitz, sah er ein anderes Gesicht, ungewöhnlich groß und merkwürdig in seiner Form.
Der Fahrer lehnte sich aus dem Fenster. »Officer«, brüllte er, »Ihr Wagen rollt zurück.« Er grinste über beide Ohren, breit und voller Vorfreude, während das Warnlicht des Polizeiwagens sein Gesicht rhythmisch rot beleuchtete. Und hinter dem grinsenden Mann starrte aus dem Halbdunkel vom Rücksitz ein weiteres Augenpaar nach vorn – mit einem Ausdruck, der irgendwie gierig wirkte.
Geblendet vom Fernlicht des fremden Wagens, drehte sich Leaphorn rasch nach seinem eigenen Wagen um. Sein Verstand sagte ihm, dass er natürlich die Handbremse angezogen hatte, und seine Augen bestätigten ihm, dass der geparkte Wagen keineswegs auf ihn zurollte. Dann hörte er, wie Begay ihm eine Warnung zubrüllte. Und während Leaphorn instinktiv auf den Straßengraben zuhechtete, hörte er den aufheulenden Motor des anfahrenden Mercedes und kurz darauf ein dumpfes Geräusch, als der vordere Kotflügel des Mercedes sein Bein traf, seinen Körper mitten im Sprung erfasste und ins Gebüsch am Straßenrand schleuderte. Seltsamerweise fühlte er keinen Schmerz.
Einen Moment später versuchte er aufzustehen. Der Mercedes war längst über den Highway davongeschossen. Nur das leiser werdende Heulen eines Motors an seiner Leistungsgrenze war noch in der Ferne zu hören. Begay versuchte, Leaphorn auf die Beine zu helfen.
»Vorsicht, mein Bein«, sagte Leaphorn. »Lass mich erst mal sehen, was damit ist.«
Es war taub, aber es trug sein Gewicht. Schmerzen hatte er fast nur in den Händen, mit denen er seinen Sturz im Gestrüpp und auf dem rauen Boden des Straßengrabens abgebremst hatte. Außerdem hatte seine Wange einen langen, aber nicht sonderlich tiefen Schnitt abbekommen. Er brannte.
»Der Schweinehund hat versucht, Sie zu überfahren«, sagte Begay. »Was sagt man dazu?«
Leaphorn humpelte zu seinem Wagen, setzte sich ans Lenkrad und schaltete mit der einen, blutenden Hand das Funkgerät wieder ein und mit der anderen die Zündung. Bis er eine Straßensperre am Red Lake organisiert hatte, stand die Tachonadel schon auf mehr als neunzig Meilen.
»So eine Höllenfahrt hab ich mir schon immer mal gewünscht«, brüllte Begay über das Jaulen der Polizeisirene hinweg. »Hat der Stamm eine Insassen-Versicherung abgeschlossen, falls mir was passiert?«
»Nur eine Sterbegeldversicherung«, antwortete Leaphorn.
»Den erwischen Sie nie«, rief Begay. »Haben Sie sich den Wagen angeschaut? Der Wagen eines reichen Mannes.«
»Hast du dir vielleicht das Kennzeichen gemerkt? Oder hast du diesen sonderbaren Kerl auf dem Rücksitz gesehen?«
»Das war ein großer Hund«, sagte Begay. »Sah riesig und ziemlich übel aus. An das Kennzeichen hab ich nicht gedacht.«
Der Lautsprecher räusperte sich. Tomas Charley berichtete, dass er eine einspurige Sperre an der Kreuzung Red Lake aufgebaut hatte. Charley fragte in korrektem Navajo, ob man davon ausgehen müsse, dass der Mann im grauen Mercedes eine Schusswaffe habe, und wie man in diesem Fall vorgehen solle.
»Gehen Sie davon aus, dass er bewaffnet und gefährlich ist«, sagte Leaphorn. »Der Schweinehund hat versucht, mich zu überfahren. Wenn er nicht abbremst, schießen Sie erst mal auf die Reifen. Aber passen Sie auf, dass Ihnen nichts passiert.«
Charley versicherte ihm, er werde aufpassen, und schaltete das Funkgerät ab.
»Da wir gerade von bewaffneten Schweinehunden reden«, sagte Begay. Er hielt Leaphorn die Hände mit den Handschellen hin. »Es ist vielleicht doch besser, wenn Sie mir die Dinger abnehmen, für den Fall, dass Sie Hilfe brauchen.«
Leaphorn warf ihm einen Blick zu, fischte in seiner Tasche nach dem Schlüsselbund und warf ihn rüber. »Es ist der kleine, glänzende.«
Begay sperrte sich die Handschellen auf und legte sie dann ins Handschuhfach.
»Warum kannst du bloß das Schafestehlen nicht lassen?«, fragte Leaphorn. Er wollte das Bild des Mercedes, der auf ihn zugerast kam, aus seinen Gedanken verscheuchen.
Begay massierte sich die Handgelenke. »Es sind doch nur die Schafe der Weißen. Die merken gar nicht, dass sie fehlen.«
»Und dann auch noch aus dem Gefängnis ausbrechen! Wenn du das noch mal machst, bist du dran, ist das klar?«
Begay zuckte die Achseln.
»Ich hab einfach nicht drüber nachgedacht«, sagte er. »Außerdem: Das Schlimmste, was einem passieren kann, wenn man aus dem Gefängnis abhaut, ist, dass sie einen wieder reinstecken.«
»Aber das ist jetzt schon das dritte Mal«, hielt ihm Leaphorn vor. Der Polizeiwagen schlidderte durch eine flache Kurve, kam ins Schlingern und fing sich wieder. Leaphorn drückte das Gaspedal durch.
»Dieser Vogel wollte sicher bloß keinen Strafzettel bekommen«, sagte Begay. Er schaute Leaphorn an und grinste. »Oder es macht ihm Spaß, Bullen zu überfahren. Ich könnte mir vorstellen, dass man auf den Geschmack kommen kann.«
Sie schafften die letzten zwanzig Meilen bis zur Kreuzung Red Lake in weniger als dreizehn Minuten und kamen so punktgenau auf dem Randstreifen neben Charleys Streifenwagen zum Stehen, dass der Kies nur so spritzte.
»Was ist los?«, brüllte Leaphorn. »Ist er euch entkommen?«
»Er ist gar nicht hier aufgetaucht«, sagte Charley. Er war ein untersetzter Mann mit den Streifen des Korporal-Dienstgrades an den Ärmeln seines Uniformhemds. Jetzt hob er missbilligend die Augenbrauen. »Er kann aber nirgends abgebogen sein«, sagte er. »Die Abzweigung bei Kayenta liegt mindestens fünfzig Meilen zurück und –«
»Er war schon dran vorbei, als ich ihn aufgehalten habe«, unterbrach ihn Leaphorn. »Also muss er doch irgendwo abgefahren sein.«
Begay lachte. »Dieser Hund auf dem Rücksitz. Vielleicht war das ein Navajo-Wolf.«
Leaphorn sagte nichts. Im Nu hatte er den Wagen auf dem Highway gewendet und nahm die Verfolgung auf.
»Das sind Zauberer, und die können fliegen, wissen Sie«, sagte Begay. »Glauben Sie, dass die dabei auch einen so großen Wagen mitschleppen können?«
Es dauerte über eine halbe Stunde, bis sie die Stelle gefunden hatten, wo der Mercedes vom Highway abgebogen war. Es war auf dem nördlichen Randstreifen, wo der Highway eine Anhöhe hinaufführte. Der Wagen hatte die asphaltierte Straße verlassen und war durch dünnes Kreosot-Gestrüpp gebrochen. Leaphorn folgte der Spur, in der einen Hand eine Taschenlampe, in der anderen seinen 38er-Revolver. Begay und Charley trotteten hinter ihm her – und Begay trug Leaphorns 30-30er-Gewehr. Etwa fünfzig Meter vom Highway entfernt war der Wagen auf einem herausragenden Sandsteinbrocken aufgesessen. Von da an war die Spur mit Ölflecken markiert; offenbar war die Ölwanne aufgerissen worden.
»Wie kann man einen so teuren Wagen so schlecht behandeln«, sagte Begay kopfschüttelnd.
Sie fanden ihn dreißig Meter weiter in einem flachen ausgetrockneten Bachbett, das vom Highway aus nicht zu sehen war. Leaphorn sah sich den Wagen erst eine Weile im Licht seiner Taschenlampe genau an, dann ging er vorsichtig darauf zu. Die Fahrertür stand offen, der Kofferraum ebenso. Die Vordersitze und der Rücksitz waren leer. Der vordere Fußraum war übersät mit Zeug, wie es bei einer längeren Fahrt anfällt: Kaugummipapier, Pappbecher, die Verpackung eines Hamburgers von der »Lotaburger«-Kette. Leaphorn hob das Papier auf, schnupperte daran. Es roch nach Zwiebeln und gebratenem Fleisch. Er ließ es fallen. Die nächste »Lotaburger«-Filiale war in Farmington, ungefähr 175 Meilen östlich von hier in New Mexico. Die Prüfplakette an der Innenseite der Windschutzscheibe war im District of Columbia ausgegeben worden. Darauf standen der Name Frederick Lynch und eine Adresse in Silver Spring in Maryland. Leaphorn schrieb sie in sein Notizbuch. Der Wagen roch, wie er feststellte, nach Hundepisse.
»Er hat nicht viel zurückgelassen«, sagte Charley. »Aber hier ist ein Maulkorb für einen Hund. Einen großen Hund.«
»Wahrscheinlich hat er einen Spaziergang gemacht«, meinte Leaphorn. »Platz zum Spazierengehen gibt’s hier mehr als genug.«
»Dreißig Meilen bis zur nächsten Wasserstelle«, sagte Charley. »Wenn man weiß, wo sie ist.«
»Begay«, sagte Leaphorn, »schau mal nach hinten und sag mir, was auf dem Nummernschild steht.«
Während er das sagte, merkte Leaphorn, dass sein verletztes Bein jetzt nicht mehr taub war und zu schmerzen anfing. Außerdem fiel ihm auf, dass er Begay nicht mehr gesehen hatte, seit sie den Wagen gefunden hatten. Leaphorn kletterte etwas mühsam vom Fahrersitz ins Freie und leuchtete mit seiner Taschenlampe die Umgebung ab. Da war Corporal Charley, der noch immer den Rücksitz inspizierte. Und da war Leaphorns 30-30er, die am Kofferraum des Mercedes lehnte. Am Gewehrlauf hing Leaphorns Schlüsselbund.
Leaphorn legte beide Hände an den Mund und brüllte in die Dunkelheit: »Begay, du dreckiger Bastard!« Begay war irgendwo da draußen, aber er lachte wahrscheinlich zu sehr, um antworten zu können.
3
Die Büroangestellte in der Außenstelle der Navajo-Police in Tuba City war ein bisschen rundlich und außerordentlich hübsch. Sie legte eine gelbe DIN-A4-Mappe und drei dicke, braune Faltordner auf den Schreibtisch des Captains, warf Leaphorn ein Lächeln zu und verschwand mit raschelnden Röcken in ihrem Büro.
»Einen Gefallen sind Sie mir schon schuldig«, sagte Captain Largo. Er nahm die gelbe Mappe und warf einen Blick hinein.
»Dann sind es also insgesamt zwei«, erwiderte Leaphorn.
»Vorausgesetzt, dass ich mitspiele«, sagte Largo. »Aber vielleicht bin ich nicht so dumm.«
»Sie spielen bestimmt mit«, meinte Leaphorn.
Largo ging nicht darauf ein. »Hier haben wir eine kleine Sache, die erst heute reingekommen ist«, sagte der Captain und vertiefte sich in den Inhalt der Mappe. »Es geht darum, sich diskret nach dem Wohlergehen einer Frau namens Theodora Adams zu erkundigen, die bei der Short-Mountain-Handelsstation sein soll. Jemand im Vorsitz des Tribal Council wäre uns sehr verbunden, wenn wir uns unauffällig ein bisschen umhörten, damit er weitergeben kann, dass alles in Ordnung ist.«
Leaphorn zog die Stirn in Falten. »In Short Mountain? Wer könnte sich dafür –«
Largo unterbrach ihn. »Dort draußen finden anthropologische Ausgrabungen statt. Vielleicht hat sie sich mit einem der Anthropologen angefreundet. Wer weiß? Ich weiß nur so viel, dass ihr Daddy Arzt beim Public Health Service ist, und ich glaube, er hat jemanden beim Bureau of Indian Affairs angerufen, und das BIA hat sich mit jemandem in –«
»Okay«, sagte Leaphorn. »Sie ist also da draußen im Indianerland, ihr Daddy macht sich Sorgen, und wir sollen uns mal nach ihr umsehen – richtig?«
»Aber diskret«, betonte Largo. »Wenn Sie sich darum kümmern, spart mir das ein bisschen Arbeit. Aber wahrscheinlich ist es keine glaubwürdige Ausrede, wenn Sie sich in Window Rock von der Überwachung dieser Pfadfinder freistellen lassen wollen.« Largo reichte Leaphorn die Mappe und angelte sich dann die beiden Faltordner. »Vielleicht gibt es hier drin eine bessere Ausrede«, sagte er. »Suchen Sie sich was aus.«
»Ich hätte gern was Einfaches«, sagte Leaphorn.
»Hier haben wir schon was: Jemand hat Heroin in einem herrenlosen Autowrack versteckt, drüben bei den Keet-Seel-Ruinen«, sagte Largo nach einem Blick in einen der Ordner. Dann klappte er ihn zu. »Wir haben einen Tipp bekommen und haben das Wrack eine Weile beobachtet, aber es ist nie jemand aufgetaucht, um sich das Zeug abzuholen. Das war im vergangenen Winter.«
»Und keine Festnahmen?«
»Nope.« Largo nahm ein Bündel Papiere und zwei Tonbandkassetten aus einem anderen Segment heraus. »Das ist der Mordfall Tso/Atcitty«, sagte er. »Erinnern Sie sich? Es war im vergangenen Frühjahr.«
»Ja«, sagte Leaphorn. »Ich wollte Sie schon danach fragen. Hat man irgendetwas Neues gehört?«
»Nada«, antwortete Largo. »Nichts. Nicht einmal halbwegs brauchbare Gerüchte. Aber hier und da gab’s wohl ein bisschen Gerede, dass Hexerei im Spiel gewesen sei. Genau die Art Tratscherei, die bei so was ja gerne aufkommt. Im Grunde haben wir gar nichts in der Hand.«
Sie saßen da und grübelten.
»Und – haben Sie irgendwelche Vermutungen?«, fragte Leaphorn. Largo dachte noch eine Weile nach. »Nein, das ergibt alles keinen Sinn«, erklärte er schließlich.
Leaphorn sagte nichts dazu. Natürlich musste es einen Sinn haben. Einen vernünftigen Grund. Es musste in ein Muster aus Ursache und Wirkung passen. Leaphorns Ordnungssinn beharrte darauf. Und wenn die Ursache nach menschlichem Ermessen verrückt war, musste Leaphorns Intellekt eben die Harmonie in der kaleidoskopischen Wirklichkeit des Wahnsinns aufspüren.
»Glauben Sie, dass das FBI etwas übersehen hat?«, fragte Leaphorn. »Oder – verpatzt?«
»Das tun sie doch meistens«, antwortete Largo. »So oder so, es ist lange genug her, dass wir uns die Sache wieder vorknöpfen sollten.« Er sah Leaphorn tief in die Augen. »Glauben Sie, dass Sie das besser können als Gefangene aufs Revier bringen?«
Leaphorn ignorierte die Anspielung. »Okay«, sagte er. »Sagen Sie in Window Rock Bescheid, dass Sie mich im Fall Tso/Atcitty einsetzen wollen, und ich fahre rüber zur Short-Mountain-Handelsstation und höre mich dort nach dieser Miss Adams um. Und ich schulde Ihnen einen Gefallen.«
»Zwei!«, sagte Largo.
»Wofür ist der Zweite?«
Largo hatte sich eine Bifokalbrille mit dickem Horngestell aufgesetzt, die seinem Gesicht etwas Eulenhaftes gab, und blätterte den Tso/Atcitty-Bericht durch. »Also, erstens: Ich habe nicht gerade gejubelt, dass Sie diesen Begay wieder haben entwischen lassen.« Er warf Leaphorn einen Blick zu. »Und zweitens – ja, da bin ich nicht einmal so sicher, ob ich Ihnen damit wirklich einen Gefallen tue. Ich lasse mir Ausreden einfallen, um Sie von Window Rock auszuleihen, damit Sie den Kerl jagen können, der versucht hat, Sie zu überfahren. Das ist alles andere als schlau – ich meine, dass Sie in eigener Sache losziehen. Wir sollten diesen Kerl suchen, nicht Sie.«
Leaphorn sagte nichts dazu. Irgendwo auf der Rückseite des Gebäudes war plötzlich metallisches Lärmen zu hören – ein Zelleninsasse schlug mit irgendeinem Gegenstand gegen die Gitterstäbe. Vor den westlichen Fenstern von Largos Büro rollte ein alter, grüner Kleinlaster die Asphaltstraße entlang Richtung Tuba City und hinterließ eine dünne, bläuliche Rauchfahne. Largo seufzte und steckte die Tso/Atcitty-Papiere und die Tonbänder wieder in den Ordner.
»Es ist doch nicht so schlecht, einen Haufen Pfadfinder zu bewachen«, meinte Largo dann. »Ein paar Beinbrüche und Schlangenbisse, ein oder zwei, die sich verlaufen, das ist alles, worum es geht.« Stirnrunzelnd sah er Leaphorn an. »Sie haben doch kaum etwas in der Hand, wenn Sie diesen Kerl jagen wollen. Sie wissen ja nicht mal, wie er aussieht. Eine Brille mit Goldrand – du meine Güte! Ich glaube, ich bin der Einzige hier, der nicht so ein Ding trägt. Das heißt, eigentlich wissen Sie nur, dass es ein Metallrahmen war. Wenn sich in so ’ner Brille das rote Warnlicht spiegelt, kann man über die Farbe kaum was sagen.«
»Sie haben recht«, sagte Leaphorn.
»Klar habe ich recht, und trotzdem werden Sie weitermachen«, seufzte Largo. »Vorausgesetzt, ich finde eine brauchbare Ausrede für Sie.«
Er tippte mit der Fingerspitze auf die letzte Akte, die im dritten Ordner steckte. »Anderes Thema. Da haben wir eine Sache, die immer gut ankommt: Das Geheimnis des verschwundenen Hubschraubers«, sagte Largo. »Ein Lieblingskind des FBI. Jeden Monat müssen wir dort einen Bericht abgeben, in dem wir unseren Freunden sagen, dass wir den Hubschrauber zwar noch nicht gefunden haben, dass wir ihn aber bestimmt nicht vergessen. Und diesmal gibt es einen neuen Augenzeugenbericht, den wir überprüfen müssen.«
Leaphorn runzelte die Stirn. »Ein neuer? Ist es dafür nicht ein bisschen zu spät?«
Largo grinste. »Ach, ich weiß nicht«, sagte er. »Was sind schon ein paar Monate? Mal sehen: Es war Dezember, als wir uns im Schnee den Arsch abgefroren haben, weil wir in den Canyons in alle Richtungen nach dem verdammten Ding gesucht haben. Jetzt ist es August, und jemand nimmt sich endlich die Zeit und kreuzt in Short Mountain auf und erwähnt, dass er den Hubschrauber gesehen hat.« Largo zuckte die Achseln. »Neun Monate? Genau die richtige Zeit für einen Navajo von Short Mountain.«
Leaphorn lachte. Die Short Mountain Navajo waren unter ihren Diné-Brüdern seit Langem dafür bekannt, wenig kooperativ, langsam, streitsüchtig, vom Hexenwahn besessen und überhaupt rückständig zu sein.
»Es gibt drei verschiedene Zeiten.« Largo grinste immer noch. »Die Echtzeit, die Navajozeit und die Short-Mountain-Navajozeit.« Das Grinsen verschwand. »Da draußen leben vor allem Bitter Water Diné und Leute vom Salt Water Clan und vom Many Goats Clan«, sagte er.
Das war eigentlich keine Erklärung. Es bedeutete, dass hiermit die übrigen siebenundfünfzig Navajo-Clans, darunter auch der Clan der Slow Talking Diné, von diesen Vorwürfen freigesprochen waren. Die Slow Talking Diné waren der Clan, in den Howard Largo hineingeboren worden war. Auch Leaphorn gehörte zu den Slow Talking People. Das machte ihn und Largo zu so etwas wie Brüdern im Sinne des Navajo Way, und es erklärte, warum Leaphorn Largo um einen Gefallen bitten konnte und warum Largo ihn kaum abschlagen konnte.
»Komisches Volk«, stimmte Leaphorn zu.
»Da leben auch viele Paiute«, fügte Largo hinzu. »Und es wird ständig hin und her geheiratet.« Largos Gesicht sah wieder so verdrießlich aus wie immer. »Da gibt’s sogar Ehen mit den Ute.«
Durch die staubigen Fenster von Largos Büro hatte Leaphorn zugesehen, wie sich über der Tuba Mesa eine Gewitterwolke aufbaute. Jetzt drang schon ferner Donner aus der Wolke, als ob die Holy People selbst dagegen protestierten, dass sich das Blut der Diné mit dem ihrer Erzfeinde vermischte.
»Jedenfalls hat sich die Frau, die den Hubschrauber gesehen haben will, gar nicht um neun Monate verspätet«, erklärte Largo. »Sie hat es dem Tierarzt erzählt, der zu ihr rausgefahren war, um nach ihren Schafen zu sehen. Das war im Juni.« Largo hielt inne und warf einen Blick auf die Aufzeichnungen in der Akte. »… und der Tierarzt hat es dann dem Typen gesagt, der da draußen den Schulbus fährt. Und der hat es Shorty McGinnis gesagt, das war im Juli. Und vor ungefähr drei Tagen war Tomas Charley dort, und dem hat es dann McGinnis erzählt.« Largo sah Leaphorn durch seine Bifokalbrille an. »Kennen Sie diesen McGinnis?«
Leaphorn lachte. »Vor vielen Jahren habe ich ihn kennengelernt, als ich noch ein blutiger Anfänger war und hier in Tuba City eingesetzt worden bin. Er war Radarstation, Lauschposten und Gerüchtesammler in einer Person. Ich hab immer gedacht, es könnte nicht so schwer sein, ihn bei etwas zu erwischen, das ihm zehn Jahre Knast einbringt. Versucht er immer noch, seine Handelsstation zu verkaufen?«
»Das versucht er nun schon seit vierzig Jahren«, sagte Largo. »Ich glaube, wenn ihm jetzt jemand ein Angebot macht, trifft ihn der Schlag.«
»Und der Bericht dieser Augenzeugin – bringt der uns irgendwas?«, fragte Leaphorn.