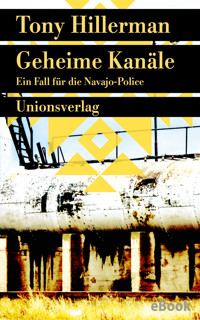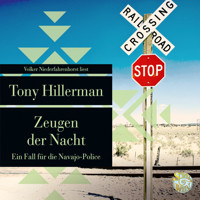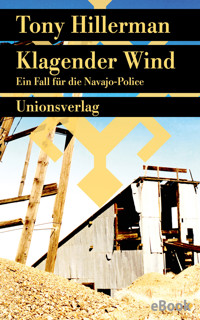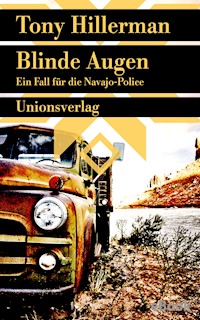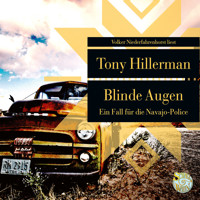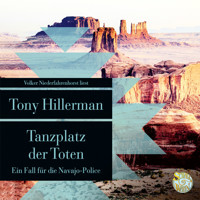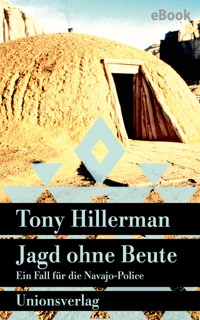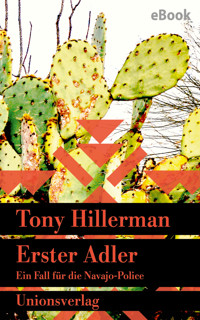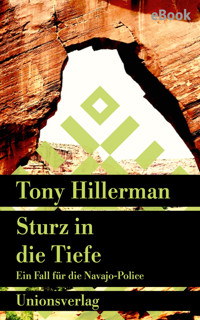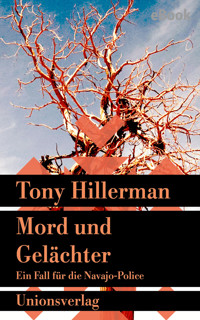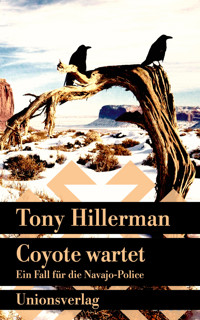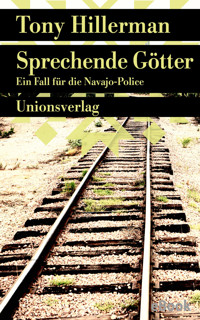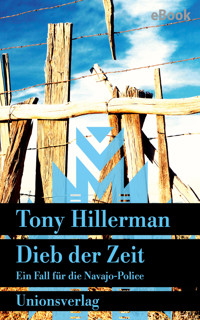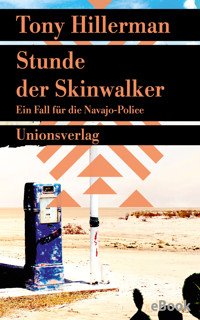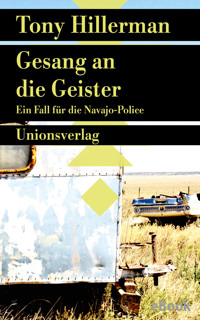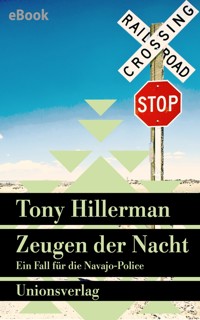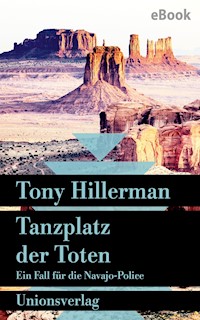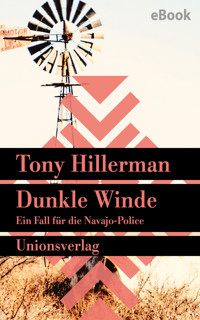
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Auf den staubigen Pfaden der Black Mesa wird eine Leiche im Unterholz entdeckt, Hände und Füße geschunden. Kurz darauf wird Officer Jim Chee vor den Umrissen des Low Mountain Zeuge eines nächtlichen Flugzeugabsturzes. Eigentlich soll Chee nur einen Fall von Vandalismus aufklären und sich mit dem zunehmenden Gerede um Hexerei in der Gegend befassen. Doch am Flugzeugwrack findet er etliche Spuren, die dem FBI entgangen sind. Als er den Hinweisen nachgeht, wird er vom Verfolger zum Verfolgten. Ein dunkler Wind treibt Gier und Gewalt über den Südwesten im zweiten Fall für Jim Chee. Verfilmt als Serie »Dark Winds – Der Wind des Bösen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
Auf den staubigen Pfaden der Black Mesa wird eine unidentifizierbare Leiche gefunden, zeitgleich wird Officer Jim Chee Zeuge eines nächtlichen Flugzeugabsturzes vor dem Low Mountain. Eigentlich soll er sich raushalten, aber er findet etliche Spuren, die dem FBI entgangen sind. Als er den Hinweisen nachgeht, wird er vom Verfolger zum Verfolgten.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tony Hillerman (1925-2008) besuchte ein Internat für Native Americans, kämpfte im Zweiten Weltkrieg, studierte Journalismus und war als Journalist und Dozent tätig. Seine Romane um die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee wurden vielfach ausgezeichnet und in siebzehn Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Tony Hillerman.
Klaus Fröba (*1934) ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Übersetzer, er veröffentlichte Jugendbücher und Kriminalromane. Er übersetzte aus dem Englischen, u. a. Werke von Jeffrey Deaver, Ira Levin, Tony Hillerman und Douglas Preston. Fröba lebt in der Nähe von Bonn.
Zur Webseite von Klaus Fröba.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tony Hillerman
Dunkle Winde
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Klaus Fröba
Ein Fall für die Navajo-Police (4)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Worterklärungen und Hintergrundinformationen zu diesem Buch auf https://ehillerman.unm.edu/encyclopedia-main
Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Andreas Heckmann nach dem Original durchgesehen und grundlegend überarbeitet.
Die Originalausgabe erschien 1982 bei Harper & Row, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1989 unter dem Titel Der Wind des Bösen im Rowohlt Verlag, Reinbek.
Originaltitel: The Dark Wind
© by Tony Hillerman 1982
Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Klaus Fröba beim Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
© by Unionsverlag, Zürich 2023
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hintergrund – Hugh Mitton (Alamy Stock Foto); Symbol – Valerii Egorov (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31162-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 13.06.2023, 15:27h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DUNKLE WINDE
Vorbemerkung des Autors1 – Der Junge aus dem Flute Clan sah es …2 – Als er die Balakai Mesa erreichte, warf Pauling …3 – Anfangs achtete Jim Chee nicht weiter auf das …4 – Herber Benzingeruch stieg Jimmy Chee in die Nase …5 – Captain Largo stand vor der Wandkarte und stieß …6 – Die junge Navajofrau hatte wohl nur etwas aus …7 – Im Morgengrauen parkte Chee den Pick-up beim Windrad …8 – Hinunter ins Flussbett wäre Jimmy Chee nur gestiegen …9 – Schräg fiel die Spätnachmittagssonne durch die Fenster der …10 – Wie das Gerücht aufgekommen war, dass ein Hexer …11 – Chee fuhr nach Tuba City zurück, schrieb seinen …12 – Wenn Captain Largo sich Sorgen machte, legte sich …13 – Nach Lage der Dinge hielt Chee es für …14 – Als Erstes stellte Chee fest, dass bereits jemand …15 – Nun musste er nicht mehr nach Spuren suchen …16 – Warten Sie einen Augenblick«, sagte der Mann von …17 – Der Name Black Mesa lässt eine schwarze Hochebene …18 – Am nächsten Morgen hatte Largo Aufträge für Chee …19 – Ungefähr vierhundert Meilen fährt man von Tuba City …20 – Für den Heimweg nahm Chee nicht wieder die …21 – Chee und Cowboy waren an der Kreuzung der …22 – Chee hatte die Reifenspuren schon bemerkt, als er …23 – Die Funkzentrale meldete sich bei Chee, als er …24 – Alles Nachdenken schien nichts zu helfen. Abends beim …25 – Die Antwort war dann kein eindeutiges Ja …26 – Chee verbrachte die Nacht neben seinem Pick-up in …27 – Den Mann schnappen, der für den Einbruch in …28 – Jim Chee lauerte, wie ein Berglöwe an der …29 – Sityatki war – wie viele Pueblosiedlungen im Südwesten …30 – Anfangs rannte Chee, so schnell er konnte …Mehr über dieses Buch
Über Tony Hillerman
»Der Angst vor seinem Pferd hat«
Claus Biegert: Die Navajo-Romane — ein Fall von Kultureller Wertschätzung
Über Klaus Fröba
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tony Hillerman
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema USA
Dieses Buch ist den Menschen im Coyote Canyon, in den Navajo Mountains, in Littlewater, bei Two Gray Hills und am Borrego-Pass gewidmet – vor allem aber denen, die entwurzelt und in der Fremde leben, weit entfernt vom Land ihrer Väter, dem Gebiet, das man den Navajo und den Hopi zur gemeinsamen Nutzung überlassen hat.
Vorbemerkung des Autors
Niemand soll glauben, ich hielte mich für einen profunden Kenner der Hopireligion. In den Hopi Mesas bin ich – wie Jim Chee von der Navajo-Police – ein Fremder. Ich weiß über den Glauben der Hopi nur, was alle lernen können, wenn sie lange genug hinschauen und aufmerksam zuhören. Wer mehr darüber erfahren will, wie die Hopi den Sinn des Seins verstehen, der greife zum Beispiel zu The Book of the Hopi meines guten Freundes Frank Waters.
Ihr religiöses Jahr und den umfangreichen Kalender ritueller Pflichten teilen die Hopi in zwei Hälften, wobei sich – dem Wechsel in der Natur folgend – in jedem Halbjahr Ereignisse aus dem anderen widerspiegeln. Darauf nehme ich in einigen Szenen Bezug, ohne mich jedoch strikt an den Kalender der Rituale zu halten.
Die Zeit hat dem Dorf Sityatki viel schlimmer mitgespielt, als ich es beschreibe. Es ist seit Langem verlassen, die Ruinen sind vom Sand, den der Wind übers Land treibt, begraben.
Die Romanfiguren sind frei erfunden, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind nicht beabsichtigt.
1
Der Junge aus dem Flute Clan sah es zuerst. Er blieb stehen und starrte.
»Da hat jemand einen Stiefel verloren«, sagte er.
Albert Lomatewa war ein gutes Stück weiter entfernt, etwa fünfzehn Meter den Pfad hinunter, aber er erkannte sofort, dass der Stiefel nicht verloren gegangen war. Er war nicht auf den Boden gefallen, jemand hatte ihn dort hingestellt. Er stand mitten auf dem Pfad, sauber aufgerichtet, mit der Spitze zu ihnen gekehrt. Und dann entdeckte Lomatewa unter den abgestorbenen Zweigen eines Kaninchenbuschs gleich neben dem Pfad den zweiten Stiefel. Gestern waren sie hier vorbeigekommen, aber da waren die Stiefel noch nicht dagewesen.
Albert Lomatewa war der Sendbote, er hatte die Verantwortung. Eddie Tuvi und der Junge aus dem Flute Clan würden genau das tun, was er ihnen auftrug.
»Geht da nicht hin«, sagte Lomatewa, »bleibt, wo ihr seid.«
Er lud sich das schwere Bündel Fichtengeäst vom Rücken und legte es mit gebührender Ehrfurcht neben dem Pfad ab. Dann ging er auf den Stiefel zu. Er war fast neu, aus braunem Leder, ein Cowboystiefel mit geschwungenem hohem Absatz und floralen Steppnähten. Lomatewa warf einen Blick auf den anderen Stiefel unter den dürren Zweigen.
Das passende Gegenstück. Dahinter führte der Pfad in einem scharfen Bogen um einen verwitterten Granitblock. Lomatewa holte vernehmlich Luft. Hinter dem Felsen ragte ein Fuß vor, ein nackter Fuß, mit dem, das konnte Lomatewa sogar aus der Entfernung erkennen, etwas Schreckliches geschehen war.
Lomatewa wandte sich zu den beiden um, die seine Kiva ihm zur Seite gestellt hatte, damit er, als er sich auf den Weg machte, um die heilige Pflicht des Fichtenholzsammelns zu erfüllen, nicht ohne Geleitschutz wäre. Sie waren stehen geblieben, wie er es ihnen aufgetragen hatte. Tuvis Miene war ausdruckslos, das Gesicht des Jungen aber verriet gespannte Neugier.
»Bleibt, wo ihr seid«, rief er noch einmal, »hier ist jemand, und ich muss etwas tun.«
Der Mann lag auf der Seite, die Beine gekrümmt und steif, der linke Arm starr vorgestreckt, der rechte angewinkelt, die Handfläche neben dem Ohr. Er trug Bluejeans, eine Jacke aus Jeansstoff und ein blau-weiß kariertes Hemd mit bis zu den Ellbogen hochgekrempelten Ärmeln. Aber seine Kleidung nahm Lomatewa erst später wahr. Zunächst starrte er nur auf die Füße. Die Haut der Sohlen war abgeschnitten. Jemand hatte ihm die Socken aufgetrennt und nach oben geschoben, sie bauschten sich wie weiße Stulpen um die Knöchel. Dann hatte man ihm an beiden Füßen die Haut von der Ferse, vom Ballen und unter den Zehen abgezogen.
Lomatewa hatte neun Enkelkinder und einen Urenkel, er lebte lange genug, um vieles gesehen zu haben, aber so etwas hatte er noch nie gesehen. Wieder holte er vernehmlich Luft, atmete aus und schaute sich dann die Hände des Mannes an. Er ahnte es, bevor er es sah: Auch die Hände waren geschunden. Die Haut war weggeschnitten, genau wie an den Füßen. Danach erst sah Lomatewa dem Mann ins Gesicht. Er war noch jung gewesen. Kein Hopi. Ein Navajo, mindestens zu einem Teil. Über seinem rechten Auge war ein kleines Loch mit schwarzem Rand.
Lomatewa stand da, sah auf den Toten hinunter und überlegte, was zu tun war. Was immer sie unternahmen, das Niman Kachina durfte nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Obwohl es noch früh am Morgen war, brannte die Sonne bereits heiß, es roch nach Staub. Staub, immerzu Staub. Deshalb durfte das Zeremoniell keinesfalls gestört werden.
Seit fast einem Jahr war das Himmelsgeschenk des Regens ausgeblieben. Dreimal hatte Lomatewa sein Korn ausgedünnt, aber was geblieben war, stand trotzdem kümmerlich und dürr auf dem Halm. Die Trockenheit wollte kein Ende nehmen. Die Quellen versiegten. Es gab kein Weidegras für die Pferde. Das Niman Kachina musste in der vorgeschriebenen Weise abgehalten werden. Er drehte sich um und ging zu seinen beiden Weggefährten zurück.
»Ein toter Tavasuh«, sagte er. Das hieß so viel wie Dickschädel und war ein verächtlicher Ausdruck der Hopi für die Navajo. Lomatewa benutzte es absichtlich, um die beiden auf das einzustimmen, was er tun musste.
»Was ist mit seinem Fuß passiert?«, fragte der Junge aus dem Flute Clan. »Die Sohle ist weggeschnitten.«
»Legt die Holzbündel ab und setzt euch«, sagte Lomatewa. »Wir müssen darüber reden.« Wegen Tuvi machte er sich keine Sorgen, der war ein geachteter Mann in der Antelope Kiva, ein frommes Mitglied der One-Horn-Bruderschaft. Aber der Junge aus dem Flute Clan war noch ein halbes Kind. Obwohl er nun stumm dasaß, das Bündel neben sich, brannten die Fragen in seinen Augen. Lass ihn warten, dachte Lomatewa, lass ihn lernen, geduldig zu sein.
»Dreimal hat Sotuknang die Welt zerstört«, begann Lomatewa schließlich. »Die erste Welt hat er durch Feuer zerstört, die zweite Welt durch Eis und die dritte durch eine Flut. Jedes Mal hat er die Welt zerstört, weil sein Volk nicht tun wollte, was er von ihm verlangt hatte.« Lomatewa behielt, während er sprach, den Jungen aus dem Flute Clan im Auge.
Der hatte die Schule in Flagstaff besucht und war jetzt bei der Post. Es hieß, er pflanze seine Getreidestreifen nicht in der vorgeschriebenen Weise und verstehe es nicht, sich der Gemeinschaft der Kachina anzupassen. Er brauchte Anleitung. Und der Junge hörte ihm zu, als habe er die alte Sage nicht schon tausendmal gehört.
»Sotuknang hat die Welt zerstört, weil die Hopi ihre Pflichten vernachlässigten. Sie vergaßen die Gesänge, die gesungen, die pahos, die Gebetsstäbe, die dargebracht, und die Zeremonien, die getanzt werden müssen. Jedes Mal wurde die Welt vom Bösen infiziert, und die Menschen stritten in einem fort. Sie wurden powaqas – Magier – und bekämpften sich mit Zauberei. Die Hopi wichen vom vorgeschriebenen Weg des Lebens ab, nur wenige gab es noch in den Kivas, die das Richtige taten. Und jedes Mal warnte Sotuknang die Hopi. Er hielt den Regen zurück, sodass die Menschen seinen Groll erkennen konnten, aber niemand scherte sich darum. Alle jagten weiter dem Geld nach, stritten, führten böse Reden und vergaßen den rechten Weg des Lebens. Und so wurde Sotuknangs Geduld immer wieder mit Füßen getreten. Nur wenige Hopi rettete er, einige der Besten, bevor er alles andere zerstörte.«
Lomatewa blickte dem Jungen fest in die Augen. »Verstehst du das alles?«
»Ja«, sagte der Junge, »ich verstehe es.«
»Diesen Sommer müssen wir das Niman Kachina richtig abhalten«, fuhr Lomatewa fort. »Sotuknang hat uns gewarnt. Unser Getreide verkümmert auf den Feldern. Es gibt kein Gras mehr. Die Brunnen trocknen aus. Die Wolken hören uns nicht mehr, wenn wir nach ihnen rufen. Wenn wir das Niman Kachina nicht in der vorgeschriebenen Weise abhalten, wird Sotuknang abermals die Geduld verlieren. Dann wird er auch die vierte Welt zerstören.«
Lomatewa warf rasch einen Blick auf Tuvi, dessen Miene unergründlich war. Dann wandte er sich wieder dem Jungen zu. »Bald wird für die Kachinas die Zeit kommen, da sie dieses Erdenstück verlassen und heimkehren in die San Francisco Peaks. Wir bringen unsere Bündel in die Kivas, und sie werden das Holz nehmen, um alles für die Heimkehrtänze feierlich herzurichten. Tagelang wird es in den Kivas rastlos zugehen, denn die Gebete müssen ausgewählt und die pahos, die Gebetshölzer, vorbereitet werden. Alles muss in der rechten Weise getan werden.« Lomatewa schwieg, damit die Stille die Bedeutung seiner Worte unterstreichen konnte. »Unser aller Denken muss in die richtigen Bahnen gelenkt werden. Wenn wir aber diesen Toten melden, diesen hingemetzelten Navajo, kann nichts in der rechten Weise getan werden. Die Polizei wird kommen, die bahana-Polizei, und uns Fragen stellen. Ousm Sothe Kivas werden sie uns nennen. Alles wird gestört. Alle werden an die falschen Dinge denken, an Tod und Zorn, während doch ihre Gedanken nur auf heilige Dinge gerichtet sein sollten. So wird das Niman Kachina nicht gelingen, so wenig wie die Heimkehrtänze. Niemand wird seine Gedanken zum Gebet sammeln.«
Wieder schwieg er und richtete seine Augen auf den Jungen aus dem Flute Clan. »Wenn du der Sendbote wärst, was würdest du tun?«
»Ich würds der Polizei nicht sagen«, antwortete der Junge.
»Und würdest du in der Kiva darüber reden?«
»Ich würd nicht drüber reden.«
»Du hast die Füße des Navajo gesehen«, sagte Lomatewa. »Weißt du, was das zu bedeuten hat?«
»Dass ihm die Haut abgeschnitten wurde?«
»Ja. Weißt du, was das bedeutet?«
Der Junge senkte den Blick. »Ich weiß es«, antwortete er.
»Darüber zu reden wäre das Schlimmste, was du tun könntest. Die Menschen würden an das Böse denken, obwohl ihre Gedanken sich mit dem Guten beschäftigen sollen.«
»Ich werde nicht darüber reden«, sagte der Junge.
»Nicht vor den Niman-Tänzen. Nicht bevor die Zeremonie vorüber ist und die Kachinas verschwunden sind«, schärfte Lomatewa ihm ein. »Danach kannst du darüber reden.«
Lomatewa nahm sein Bündel aus Fichtengeäst auf, streifte sich die Träger über die Schultern und zuckte zusammen, weil seine Gelenke schmerzten. Er spürte jedes einzelne seiner dreiundsiebzig Jahre und hatte noch fast dreißig Meilen vor sich, über den Wepo Wash und dann den langen Anstieg über die Felsen zur Third Mesa hinauf. Er führte seine Gefährten den Pfad entlang an dem Toten vorbei. Warum auch nicht? Sie hatten die verstümmelten Füße gesehen und wussten, was das bedeutete. Dieser Tod hatte nichts mit den Hopi zu tun. Dieses Böse betraf nur die Navajo; sie mussten sehen, wie sie damit fertigwurden.
2
Als er die Balakai Mesa erreichte, warf Pauling einen Blick auf den Chronometer. 3:20:15. Uhrzeit und Kurs stimmten. Er hielt die Cessna rund sechzig Meter über dem Boden, ungefähr genauso hoch ragten die Felsen am Rand der Hochebene über der Maschine auf. Direkt vor ihm der Mond, gelb und ein wenig schief über dem Horizont, warf er sein Licht auf das Gesicht des Mannes neben ihm und ließ es wächsern erscheinen. Der Mann schaute starr geradeaus, den Blick auf den Mond gerichtet, und nagte an seiner Unterlippe. Knapp hundert Meter von der rechten Tragfläche entfernt sah Pauling die Felsen vorbeirasen – schwarze Schatten, von den Strahlen des Mondlichts schraffiert. Pauling spürte die Geschwindigkeit, die man gewöhnlich bei einem Flug am Tag weniger empfindet, und er genoss es.
Unten auf dem Wüstenboden musste das Motorengeräusch von den Felsen widerhallen. Aber meilenweit gab es niemanden, der es hörte. Er hatte die Route ausgewählt, zweimal war er sie tagsüber abgeflogen und einmal bei Nacht, um sich die Landschaft und markante Punkte einzuprägen. In seinem Geschäft gab es keine absolute Sicherheit, aber Pauling war ihr immerhin recht nahegekommen. Hier schirmte ihn zum Beispiel die Balakai Mesa gegen den Radar in Albuquerque und am Salt Lake ab. Vor ihm, gleich links vom untergehenden Mond, ragte der Low Mountain auf, über zweitausend Meter hoch, und die Little Black Spot Mesa dahinter war sogar noch höher. Nach Süden dehnte sich auf über hundert Meilen die Black Mesa und blockte mit ihren Felsformationen den Radarschirm in Phoenix ab. Auf der ganzen Strecke von der Startbahn in Chihuahua bis zum Ziel konnte der Radar ihn auf höchstens hundert Meilen erfassen. Es war eine gute Route, es hatte Spaß gemacht, sie auszutüfteln. Und er flog gern so tief, er liebte es, wenn auf einmal, vom Licht des untergehenden Mondes beschienen, ein markanter Geländepunkt aus der konturlosen Dunkelheit aufragte. Das machte den Reiz des Fliegens aus: die Gefahr, die Herausforderung, die Geschwindigkeit, das Gefühl, steuerndes Hirn einer tadellos funktionierenden Maschine zu sein.
Die Balakai Mesa lag nun hinter ihm, der dunkle Umriss des Low Mountain schob sich vor die gelbe Scheibe des Mondes. In der Nachtschwärze unter ihm konnte er ein scharf funkelndes Licht ausmachen: den einsamen Punktstrahler, der die Zapfsäule am Handelsposten von Low Mountain beleuchtete. Er zog die Cessna in eine leichte Linkskurve und folgte dem Lauf des Tse Chizzi Wash, um dem einzigen Ort auszuweichen, an dem das Motorengeräusch jemanden aus dem Schlaf reißen könnte.
»Sind wir bald da?«, fragte der Passagier.
»Ja, bald«, sagte Pauling. »Hinter dem Felsgrat vor uns liegt der Oraibi Wash, dann kommen noch ein paar Bergrücken und danach der Wepo Wash. Dort landen wir. Dauert noch sechs, sieben Minuten.«
»Einsame Gegend«, meinte der Passagier. Er schaute durchs Seitenfenster nach unten und schüttelte den Kopf. »Keine Menschenseele. Als ob wir allein auf dem Planeten wären.«
»Leute gibts hier kaum. Nur ein paar Indianer, weit verstreut. Darum wurde die Gegend ausgesucht.«
Der Passagier starrte wieder auf den Mond. »Jetzt kommt der Teil, vor dem Sie Bammel haben«, sagte er.
»Tja«, meinte Pauling. Es klang zustimmend, aber er fragte sich: Was meint er mit »der Teil«? Die Landung in der Dunkelheit? Oder das, was sie da unten erwartete? Auf einmal wünschte Pauling, er hätte ein bisschen mehr über die ganze Sache gewusst. Das meiste konnte er sich freilich denken. Marihuana hatten sie jedenfalls nicht geladen. Was immer in den Koffern steckte, musste enorm wertvoll sein, damit all die Zeit und die besonderen Vorkehrungen gerechtfertigt waren. So einen schwierigen Landeplatz auszuwählen und ihm einen Passagier in die Maschine zu setzen …
Seit Jahren war er stets allein geflogen, nur anfangs nicht, als er frisch in dieses Geschäft eingestiegen war, weil sie ihn wegen schlechter EKG-Befunde bei Eastern rausgeworfen hatten. Aber da hatte der neben ihm zu den eigenen Leuten gehört, der aufpasste, dass er die Fracht nicht stahl. Diesmal saß ein Fremder neben ihm. Der Boss hatte den Mann zu ihm ins Motel bei Sabinas Hidalgo gebracht, als Pauling gerade zum Flugplatz fahren wollte. Vermutlich einer, der für den Käufer arbeitete. Dessen übrige Leute sollten am Ort der Landung auf ihn warten, zusammen mit Jansen, hatte der Boss gesagt. »Zwei Lichtsignale, dann eine Pause, dann noch mal zwei Lichtsignale. Wenn du die nicht siehst, gehst du nicht runter.« Der Boss schickte Jansen an den Landeplatz, und diesen Fremden hatte der Käufer geschickt. Beide galten als vertrauenswürdig. Vermutlich kam sein Passagier aus der Verwandtschaft des Käufers, war vielleicht ein Sohn oder ein Bruder. Bei Jansen wars genauso. Wem sonst konnte man in diesem Geschäft über den Weg trauen? Oder überhaupt?
Der Oraibi Wash huschte unter ihnen vorbei, ein gewundener trockener Flusslauf, wie eine Schattenspur ins Dunkel geschnitten und mit Mondlicht besprenkelt. Pauling zog die Maschine leicht hoch, bis der Wüstenhang hinter ihnen lag und das Gelände wieder abfiel. Jetzt war die Landschaft zerfurcht, tief eingekerbte Bachläufe durchzogen den Boden und trugen nach heftigen Regenfällen die Sturzfluten der Black Mesa in den Wepo Wash. Pauling hatte die Maschine gedrosselt, flog nur noch mit minimaler Geschwindigkeit. Links vor ihm ragte ein gewaltiger Basaltkegel auf, die richtige Landmarke am richtigen Ort. Und dann tauchte unter der Tragfläche das Windrad auf, an dem sich der trockene Flusslauf wie ein Schattenriss vorbeischlängelte.
Jetzt müsste er gleich die Leuchtsignale sehen. Jansens Blinkzeichen – eigentlich sollte er sie schon sehen. Da waren sie. Ein Dutzend gelber, aufgereihter Lichter, batteriebetriebene Leuchten, für ihn aufgestellt. Und gleich danach blinkte zweimal weißes Licht auf, dann wieder. Jansens Zeichen, dass alles in Ordnung war.
Er schwebte dicht über den Bodenleuchten ein, zog die Maschine in einer leichten Kurve herum, flog erneut an und erinnerte sich genau, wie das trockene Flussbett aussah, konzentrierte sich darauf, aus dem Gedächtnis das Dunkel zu hellem Tag zu machen.
Er merkte, dass sein Passagier ihn anstarrte. »Ist das alles?«, fragte der nun. »Die paar beschissenen Funzeln genügen Ihnen zur Landung?«
»Es geht darum, dass niemand uns bemerkt«, sagte Pauling. Das Licht im Cockpit war schwach, aber es genügte, um die Bestürzung in der Miene des anderen zu zeigen.
»Haben Sie das schon mal gemacht?«, fragte der Mann. Seine Stimme klang ein wenig schrill. »Ich meine, haben Sie die Mühle schon mal blind gelandet in der Dunkelheit?«
»Nur ein-, zweimal«, sagte Pauling. »Als es unbedingt nötig war.« Aber er wollte den Mann beruhigen. »Früher war ich in der Tactical Air Force. Da mussten wir mit unseren Transportmaschinen das Landen bei Dunkelheit üben. Aber das hier ist keine Blindlandung, wir haben ja die Lichter.«
Sie flogen jetzt genau auf die Bodenleuchten zu. Pauling trimmte die Maschine aus. Fahrgestell raus. Landeklappen runter. Seine Erinnerung lieferte ihm das Bild des trockenen Flusslaufs. Er zog die Nase des Flugzeugs nach oben, spürte, wie der Auftrieb unter den Tragflächen nachließ. Der Mann neben ihm machte sich auf alles gefasst in diesem kurzen Moment vor dem Aufsetzen, wenn das Flugzeug mehr fällt als fliegt.
»Ihre Zuversicht möchte ich haben«, sagte der Mann. »Großer Gott!« Es klang wie ein Gebet.
Sie waren jetzt tiefer als die Uferböschung, und die Lichter rasten auf sie zu. Holpernd setzten die Räder auf, die Bremsen kreischten. Perfekt, dachte Pauling. Man muss lernen zu vertrauen. Doch noch in derselben Sekunde erkannte er, dass dieses Vertrauen ein schrecklicher Fehler gewesen war.
3
Anfangs achtete Jim Chee nicht weiter auf das Flugzeuggeräusch. Etwas hatte sich hinter Windrad Nummer sechs bewegt. Bewegt und wieder bewegt – ein leises, verstohlenes Geräusch. Aber jetzt, in der Stille vor der Morgendämmerung, trug selbst das leiseste Geräusch ungewöhnlich weit. Vor einer halben Stunde hatte er einen Wagen gehört, der sich durch den sandigen Boden des Wepo Wash quälte, bis er, vielleicht eine Meile das trockene Flussbett hinunter, anhielt. Und dieses neue Geräusch legte die Vermutung nahe, dass der Fahrer jetzt auf das Windrad zuhielt. Chee spürte das Jagdfieber erwachen.
Auf das störende Brummen des Flugzeugmotors versuchte er anfangs nicht zu achten. Aber schließlich wurde es so laut, dass Chee nicht mehr weghören konnte. Die Maschine flog tief, kaum dreißig Meter über dem Boden, und wenn sie auf diesem Kurs blieb, musste sie zwangsläufig knapp westlich des Verstecks vorbeikommen, das Chee sich zwischen kümmerlichen Mesquitebäumen eingerichtet hatte. Da kam sie auch schon, genau zwischen Chee und dem Windrad. Sie flog ohne Navigationslichter so dicht vorbei, dass er den Lichtschimmer im Cockpit sah. Er prägte sich die Umrisse ein: die hoch angesetzten Tragflächen, das steile Seitenruder, den nach unten gebogenen Bug. Für einen Flug um diese Zeit konnte es nur einen Grund geben: Schmuggel. Vermutlich Drogen, was sonst? Die Maschine brummte weiter auf den Wepo Wash zu, dem untergehenden Mond entgegen, und verschwand rasch in der Nacht.
Chee konzentrierte sich wieder auf das Windrad. Das Flugzeug ging ihn nichts an. Für Schmuggel war die Navajo-Police nicht zuständig, erst recht nicht für illegalen Drogenhandel. Das war Sache der U. S. Drug Enforcement Agency, die sollte ihren Krieg führen – einen Krieg des weißen Mannes gegen Verbrechen des weißen Mannes. Er hatte sich darum zu kümmern, wenn blinde Zerstörungswut sich an Windrad Nummer sechs austobte, dem sperrigen, hässlichen Stahlgerüst, das sich keine hundert Meter entfernt dem Sternenhimmel entgegenreckte und dessen Metallflügel bei jeder seltenen Brise in dieser lauen Sommernacht leise quietschten.
Das Rad stand erst seit einem Jahr hier. Die für die Hopi zuständige Landverteilungsbehörde hatte es errichten lassen – zur Wasserversorgung für die Hopifamilien, die anstelle der zwangsumgesiedelten Navajofamilien entlang dem Wepo Wash angesiedelt worden waren. Nach gerade mal zwei Monaten hatte jemand die Haltebolzen zwischen Betonfundament und Stahlaufbau gelöst und mithilfe eines Seils und mindestens zweier Pferde das Gerüst umgestürzt. Die Reparatur dauerte zwei Monate, man brachte sogar eine spezielle Bolzensicherung an, trotzdem tobte sich die Zerstörungswut drei Tage nach Abschluss der Arbeiten erneut aus: Jemand rammte, als die Pumpe bei steifer Brise auf vollen Touren lief, die Kurbel einer Winde ins Getriebe.
Das brachte die Dinge ins Rollen. Die Landverteilungsbehörde meldete den Vorfall an das Zentralbüro für das gemeinsam von Hopi und Navajo besiedelte Reservat am Keams Canyon; von dort aus wurde das FBI in Flagstaff alarmiert; die von der Bundespolizei riefen im Bureau of Indian Affairs an; dessen Ordnungsabteilung gab die Sache an die Regionaldienststelle der Navajo-Police in Window Rock weiter; dort schrieb man einen Brief an die zuständige Dienststelle in Tuba City. Aus dem Brief wurde schließlich eine Notiz, die auf Jim Chees Schreibtisch landete und schlicht besagte: Melden Sie sich bei Largo.
Captain Largo blätterte in einem Aktenordner. »Tja, wollen mal sehen«, sagte er zu Chee, »wie stehts mit der Identifikation des unbekannten Toten oben in der Black Mesa?«
»Da haben wir nichts Neues«, antwortete Chee. Was bedeutete, dass sie überhaupt nichts hatten.
»Ich meine den, der durch einen Kopfschuss umgekommen ist«, hakte Largo nach, als hätten sie es in Tuba City mit wer weiß wie vielen Fällen nicht identifizierter Mordopfer zu tun, »den Mann ohne Brieftasche und Ausweispapiere.«
»Nichts«, sagte Chee. »Keine Vermisstenbeschreibung passt auf ihn. Auch anhand der Kleidung konnten wir nichts feststellen. Nichts, was uns weiterbringt.«
»Aha.« Largo blätterte wieder in seinem Aktenordner. »Und was ist mit dem Einbruch im Handelsposten Burnt Water? Hast du da was rausgebracht?«
»Nein, Sir«, sagte Chee, ohne seine Verärgerung hörbar werden zu lassen.
»Der Angestellte dort hat die als Pfand hinterlegten Wertgegenstände gestohlen und ist seitdem unauffindbar. Ist das der Stand der Dinge?«
»Ja, Sir.«
»Musket, hieß er nicht so?«, fragte Largo. »Joseph Musket. Auf Bewährung aus dem Staatsgefängnis in Santa Fe entlassen. Aber das Silber wurde nirgendwo zum Verkauf angeboten. Und kein Mensch hat Musket gesehen.« Largo sah zu ihm hoch. »So ist es doch? Bist du an der Sache dran?«
»Bin ich«, antwortete Chee.
Damals im Sommer, als dieses Gespräch stattgefunden hatte, ungefähr sechs Wochen nach Chees Versetzung von Crownpoint nach Tuba City, war er aus Captain Largo nicht schlau geworden. Aber im Grunde war es jetzt, am Ende des Sommers, immer noch so.
»Ein komischer Vogel«, fuhr Largo stirnrunzelnd fort. »Was will er nur mit dem Kram anfangen? Warum versucht er nicht, das Zeug zu verhökern? Und wo ist der Bursche geblieben? Glaubst du, er ist tot?«
Genau diese Fragen gingen Chee, seit er den Fall übernommen hatte, dauernd durch den Kopf. Bisher wusste er keine Antworten darauf.
Largo blätterte seufzend weiter. »Wie siehts mit der Schwarzbrennerei aus?«, fragte er, ohne aufzusehen. »Hast du Priscilla Bisti überführt?«
»Wir waren nahe dran«, sagte Chee. »Aber sie und ihre Jungen hatten den Pick-up schon entladen, als wir kamen. Da konnten wir natürlich nicht beweisen, dass das Zeug von ihnen stammt.«
Largo faltete die Hände über dem Bauch, ließ die Daumen auf und nieder schnippen, schürzte die Lippen und sah Chee an. »Du musst schlau vorgehen, wenn du die alte Priscilla schnappen willst.« Er nickte selbstzufrieden. »Sehr schlau.«
Chee sagte nichts.
»Was ist mit den Gerüchten über Zauberei? Die ganze Black Mesa ist voll davon. Bist du da ein Stück weitergekommen?«
»Nichts Konkretes«, antwortete Chee. »Sieht so aus, als wäre es mehr als das übliche Geschwätz. Aber das kann damit zusammenhängen, dass jetzt so viele Leute entwurzelt werden und Platz für die Hopi machen müssen. Ich bin leider noch zu neu in dieser Gegend, da will niemand mit mir über Hexerei reden.« Das sollte Largo nicht vergessen. Es war nicht fair, wenn der Captain ausgerechnet von ihm Ergebnisse in so einer Sache erwartete. Die Clans im Nordwesten des Reservats kannten ihn noch nicht gut genug, er war für die Leute ein Fremder. Er konnte genauso gut selbst ein Skinwalker sein.
Largo ging nicht darauf ein, sondern nahm einen anderen Ordner: »Vielleicht hast du damit mehr Erfolg. Jemand scheint was gegen Windräder zu haben.« Er zog einen Brief aus den Unterlagen und gab ihn Chee.
Es war der Bericht aus Window Rock. Chee überflog ihn, war aber gedanklich immer noch dabei, sich ein Bild von Largo zu machen. Nach dem Verständnis der Navajo war der Captain weitläufig mit ihm verwandt, es gab Verbindungen zwischen den Clans. Chees Vater gehörte den Bitter Water People an, also war das der Clan, in dem Chee geboren war. Wichtiger war für ihn allerdings die Familie seiner Mutter, die Slow Talking Diné, der Clan, für den er geboren war. Largo war im Standing Rock Diné, aber – genau wie Chees Vater – für die Red Forehead Diné geboren. Also waren Chee und Largo verwandt, entfernt natürlich, aber eben doch verwandt, und zwar in einer Kultur, in der Familienbande den höchsten Stellenwert haben und es als wichtigste Pflicht gilt, sich für einen Verwandten verantwortlich zu fühlen. Andererseits erinnerte er sich gut daran, dass ausgerechnet ein Onkel väterlicherseits ihn beim Kauf eines gebrauchten Kühlschranks übers Ohr gehauen hatte und er in der Internatsschule von Two Gray Hills die schlimmsten Prügel seines Lebens von einem Vetter mütterlicherseits bezogen hatte. Er gab Largo den Brief kommentarlos zurück.
»Wenn es draußen in der Joint Use Reservation Ärger gibt, stecken meist die Gishis dahinter«, sagte Largo. »Die oder jemand von Yazzies Leuten.« Er dachte nach. »Oder die Begays«, fiel ihm ein, »die haben auch überall ihre Finger drin.« Er legte den Brief in die Akte zurück und drückte Chee die Unterlagen in die Hand. »Es könnte praktisch jeder sein. Jedenfalls sieh zu, dass du Licht in die Sache bringst.«
»Licht in die Sache bringen«, murmelte er.
Largo sah ihn mit sanfter Miene an. »Ganz recht. Wir dürfen nicht zulassen, dass jemand dieses Windrad zerstört. Wenn die Hopi auf unserem Land angesiedelt werden, brauchen sie eben Wasser für ihre Rinder.«
»Gibt es Anhaltspunkte für einen konkreten Verdacht?«
Largo schürzte die Lippen. »Insgesamt werden rund neuntausend Navajo aus der Joint Use Reservation umgesiedelt. Ich würde sagen, von mehr als neuntausend Verdächtigen müssen wir nicht ausgehen.«
»Danke«, sagte Chee.
Largo nickte. »Freut mich immer, wenn ich behilflich sein kann. Neuntausend, damit fängst du mal an, und dann fischst du den Richtigen raus.« Mit breitem Grinsen zeigte er seine schiefen weißen Zähne. »Das ist nun mal dein Job: den Richtigen finden und festnehmen.«
Den Richtigen finden und festnehmen – darum saß Chee jetzt hier und schlug sich die lange Nacht um die Ohren. Das Flugzeug war verschwunden, und drüben am Windrad schien auch alles ruhig zu sein, jedenfalls war nichts zu sehen oder zu hören. Er gähnte, zog die Pistole aus dem Holster und kratzte sich mit dem Lauf zwischen den Schulterblättern, anders kam er da nicht hin. Der Mond war untergegangen, am schwarzen Nachthimmel gab es nur noch das Funkeln der Sterne. Es war rasch kühler geworden, Chee griff nach der Wolldecke und legte sie sich, nachdem er ein paar Zweige abgezupft hatte, um die Schultern. Er dachte über das Windrad nach, darüber, dass es ziemlich gemein war, es zu zerstören, und warum der Rowdy sich nicht auch mal eins der sieben anderen Windräder vornahm.
Und dann dachte er an Joseph Musket, der ungefähr fünfundsiebzig Pfund Silber gestohlen hatte und nun offenbar nichts mit all den schweren getriebenen Gürteln und Schnallen und reich verzierten Hals- und Armreifen anzufangen wusste. Ein Rätsel, über das Chee sich wieder und wieder das Hirn zermartert hatte und mit dem er, immer in der Hoffnung, etwas übersehen zu haben, auch jetzt wieder beschäftigt war.
Warum hatte Jake West ihn angestellt? Weil Musket mit Wests Sohn befreundet war. Und warum hatte er ihn entlassen? Weil er ihn des Diebstahls verdächtigt hatte. So weit, so logisch. In der Nacht nach dem Rausschmiss war Musket dann zur Burnt-Water-Handelsstation zurückgekehrt und hatte das Pfandsilber aus dem Lagerraum gestohlen. Auch das ließ sich nachvollziehen. Aber solcher Schmuck taucht irgendwann wieder auf. Der Dieb schenkt seiner Freundin ein Stück aus der Beute, oder er verkauft das Zeug oder hinterlegt es an einem anderen Handelsposten als Pfand für eine unbezahlte Rechnung oder verscherbelt es in einem der Leihhäuser ringsum, in Albuquerque oder Phoenix oder Durango oder Farmington zum Beispiel. Das war so logisch, so zwangsläufig, so eindeutig vorherzusehen, dass es bei der Polizei im Südwesten bereits ein Standardverfahren für derartige Fälle gab. Man verteilte genaue Beschreibungen der Beutestücke und wartete ab. Und wenn etwas vom Diebesgut auftauchte, verfolgte man die Spur rückwärts. So war das immer, warum diesmal nicht? Was war bei Musket anders? Chee erinnerte sich an das, was ihm Muskets Bewährungshelfer erzählt hatte, wenig genug. Die Rätsel fingen schon bei seinem Spitznamen an: Iron Finger. Navajo hängen einander gern Beinamen an, eine Art Kurzbeschreibung. Ein gertenschlankes Mädchen hieß zum Beispiel Slim Girl oder einer mit dünnem Schnurrbart Little Whiskers. Aber wieso nannte man einen jungen Mann Iron Finger? Wichtiger natürlich: Lebte Musket überhaupt noch? Wenn nicht, erklärte das alles.
Bis auf die Frage, warum er tot war.
Chee seufzte, hüllte sich fester in die Decke und dachte unversehens an einen anderen seiner ungelösten Fälle, die unbekannte männliche Leiche. Todesursache: Schusswunde in der Schläfe mit Kaliber achtunddreißig. Größe des Toten: 1,70 m, Gewicht: etwa siebzig Kilo (geschätzt anhand der sterblichen Überreste, die Chee und Cowboy Dashee am Fundort abgeholt hatten). Was die Identität betraf, wusste keiner etwas. Vermutlich ein Navajo. Wohl ein ausgewachsener junger Mann. Ein Mann jedenfalls.
Die Sache war Chees erste Amtshandlung im Bezirk Tuba City gewesen, einen Tag nach der Versetzung aus Crownpoint. »Fahr einfach ein Stück raus und lern die Gegend kennen«, hatte Largo gesagt, aber ein paar Meilen westlich von Moenkopi war er per Funkspruch ins Joint-Use-Gebiet umdirigiert worden. »An der Burnt-Water-Handelsstation hat jemand eine Leiche gemeldet«, teilte die Funkzentrale ihm mit. »Fahren Sie hin, Deputy Sheriff Dashee erwartet Sie.«
»Worum gehts denn?«, hatte Chee zurückgefragt. »Ich denke, für die Gegend sind wir nicht mehr zuständig?«
Darauf wusste die Funkzentrale keine Antwort; erst Deputy Sheriff Albert (Cowboy) Dashee konnte ihm die geben, als Chee zum Handelsposten kam.
»Die Leiche ist ein Navajo«, hatte er ihm erklärt, »hat man uns jedenfalls gesagt. Soll an einer Schusswunde gestorben sein. Und da hat wohl jemand gedacht, es wäre gut, einen von euch zu rufen.«
Als sie schließlich bei der Leiche standen, konnten sie sich nicht erklären, woher jemand wissen wollte, zu welchem Stamm der Tote gehört hatte und ob es ein Mann oder eine Frau war. Verwest lagen die Überreste da. Aasfresser hatten sich über die Leiche hergemacht, Kojoten, Vögel, Insekten. Übrig war nur ein Haufen blanker Knochen, Sehnen, Knorpel, ein wenig Muskelfleisch. Sie hatten sich die Reste angesehen und sich gefragt, warum sein Stiefel auf dem Pfad stand. Die Suche nach Gegenständen, die der Identifizierung des Toten dienen oder das Loch in seinem Schädel erklären konnten, war vergeblich gewesen. Und dann hatte Cowboy Dashee, während er den Sack aufrollte, in dem der Tote geborgen werden sollte, etwas getan, wofür Chee ihm dankbar war.
Chee wollte ihm helfen, aber Dashee winkte ab. »Auch wir Hopi haben unsere inneren Sperren, aber uns graut es nicht so wie euch Navajo, mit einem Toten umzugehen.« Und so hatte Dashee die Leiche allein in den Sack gepackt. Jetzt blieb nur noch herauszufinden, wer der Tote war, wer ihn umgebracht hatte und warum er sich vor seiner Ermordung die Stiefel ausgezogen hatte.
Ein Geräusch riss Chee aus seinen Grübeleien, ein Geräusch von weit her, ungefähr von der Stelle, wo vorhin der Wagen gehalten hatte, ein Stück weit den Flusslauf hinunter. Ein Geräusch vielleicht wie von Metall, das an Metall stößt. Aber viel zu schwach und zu weit weg, um das genau zu sagen. Und dann hörte Chee wieder das Flugzeug, diesmal südlich von ihm, unterwegs nach Osten. Offenbar hatte es eine Wende geflogen. Über dem Grat des Big Mountain lag ein heller orangefarbener Streifen, das letzte Licht des untergegangenen Mondes. Für einen Augenblick spiegelte sich das Restlicht an einer Tragfläche. Das Flugzeug kam zurück, wieder direkt auf Chee zu, verlor an Höhe, verschwand aus dem orangeroten Lichtstreifen ins Finstere. Der Motor schnurrte so leise, dass ein klackendes Geräusch zu hören war. Das herausgeklappte Fahrgestell? Erkennen konnte Chee in der Dunkelheit nichts. Die Maschine war knapp zweihundert Meter entfernt, tief unter dem Bergrücken. Sie folgte dem Lauf des Wepo Wash, und dann war sie verschwunden.
Plötzlich war das Schnurren nicht mehr da. Chee runzelte die Stirn. War der Motor abgestellt worden? Nein, jetzt hörte er ihn wieder, leiser als vorher.
Und dann … Der Schall braucht ungefähr fünf Sekunden für eine Meile. Aber was Chee fünf Sekunden später hörte, eine Meile weit weg und durch die Entfernung gedämpft, dröhnte ihm wie ein Donnerschlag in den Ohren. Eine Explosion. Als würden Tonnen von Metall gegen Gestein prallen.
Ein oder zwei Sekunden Stille, vielleicht sogar drei. Dann ein scharfes Geräusch, das auch über eine Meile weg unverkennbar blieb: der Knall eines Schusses.
4
Herber Benzingeruch stieg Jimmy Chee in die Nase. Er blieb atemlos stehen und leuchtete mit der Taschenlampe das trockene Flussbett ab, um festzustellen, woher der Geruch kam. Knapp fünfzehn Minuten hatte er von seinem Versteck aus gebraucht. Er war gerannt, so schnell er konnte, hatte, wo immer es ging, den festen Boden des Wasserlaufs genutzt und sich, wenn er dort nicht weiterkam, durch sperriges Buschwerk gezwängt und an Kakteen vorbeigedrückt. Kurz vor Erreichen der Uferböschung hatte er das trockene Keuchen eines Anlassers gehört, den anspringenden Motor, das Geräusch eines Wagens, der sich – dem Lauf des Flussbetts folgend – rasch entfernte. Sogar die Rücklichter hatte er noch kurz aufleuchten sehen, aber sonst nichts. Der Strahl seiner Taschenlampe traf auf eine Metallfläche. Dahinter lag noch mehr Metall – eine verbogene dunkle Masse. Als Chee, immer noch außer Atem, betrachtete, was er da sah, hörte er wieder ein Geräusch: abbröckelnde Erde. Jemand hatte die Uferböschung oberhalb des Flussbetts erklommen. Chee schwenkte die Taschenlampe herum. Nur Staub hing noch über dem Boden. Was immer ihn aufgewirbelt hatte, war verschwunden.
Chee näherte sich jetzt vorsichtig den Trümmern.
An dieser Stelle schob sich eine Basaltnase vor, das trockene Flussbett verlief in einem scharfen Bogen nach Norden. Das Flugzeug hatte den Fels offenbar zunächst mit der linken Tragfläche gerammt, ein Teil davon war abgerissen worden, die Maschine hatte sich gedreht, der Rumpf war gegen das Gestein geschlagen. Das Licht der Taschenlampe fiel auf das Cockpitfenster, es war nicht zersplittert. Chee machte einen Kopf aus, nach vorn gesunken, blondes lockiges Haar. Kein Blut, man hätte denken können, der Mann schliefe. Aber der Bug der Maschine war tief eingedrückt. So tief, dass das Metall sich ihm in die Brust gebohrt haben musste. Daneben, auf dem Pilotensitz, saß ein zweiter Mann, dunkelhaarig mit grauen Strähnen, das Gesicht blutverschmiert. Aber hatte er sich nicht eben bewegt?
Geduckt zwängte Chee sich durch die Öffnung der herausgerissenen Kabinentür, drückte die nach vorn gekippte hintere Sitzbank zurück und erreichte den Piloten. Der Mann atmete anscheinend noch. Verbogenes Metall ragte ins Cockpit, es war nicht einfach, den Schnappverschluss des Gurts zu erreichen, aber schließlich konnte Chee ihn lösen. Überall klebte warmes Blut. Er beugte sich weit genug zwischen die Vordersitze, um das Gesicht des Piloten abzuleuchten. Er hatte viel Blut verloren, hauptsächlich aus einer tiefen Schnittwunde am Hals, die weit klaffte. Aber die Blutung hatte fast ganz aufgehört. Zum Abbinden der Wunde war es zu spät, denn das Herz hatte nichts mehr zu pumpen.
Chee lehnte sich zurück. Die Situation war klar. Der Mann vor ihm starb. In einem Operationssaal, mit allen Möglichkeiten moderner Medizin, hätte er vielleicht eine Chance gehabt. Aber Chee konnte ihm nicht helfen.
Doch man kann nicht einfach neben einem Menschen kauern und warten, bis er stirbt. Vorsichtig hob er den Piloten aus dem Sitz, zog ihn behutsam aus dem Cockpit, legte ihn auf den festen Sand. Er fasste nach dem Handgelenk, um den Puls zu fühlen. Nichts. Chee schaltete die Taschenlampe aus.
Hier unten im Wepo Wash war die Dunkelheit ohne Mondlicht undurchdringlich. Über ihm dagegen funkelten Abertausende Sterne. Der Pilot lebte nicht mehr. Sein chindi hatte sich davongemacht, um durch die Dunkelheit zu irren. Wieder ein Geist mehr, um die Navajo mit Krankheit zu infizieren und die Nächte gefährlich zu machen. Aber Chee hatte seinen Frieden mit den Geistern schon während der Schulzeit im Internat geschlossen.