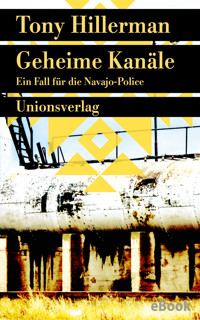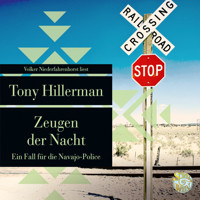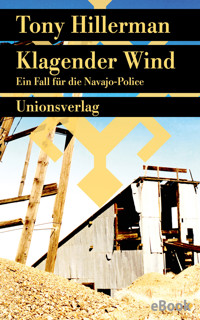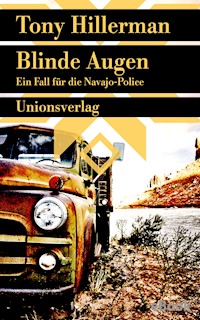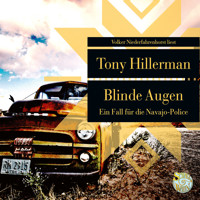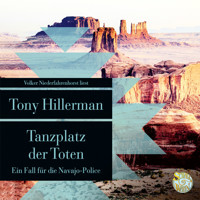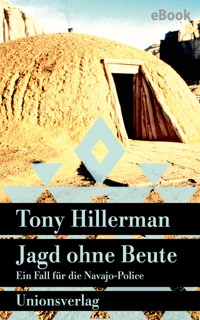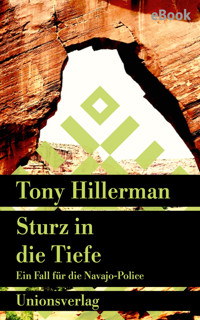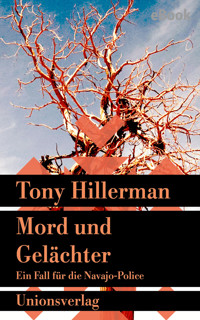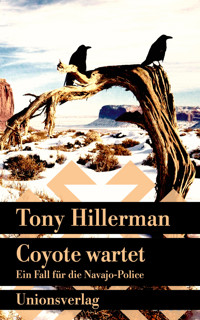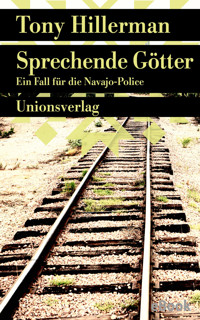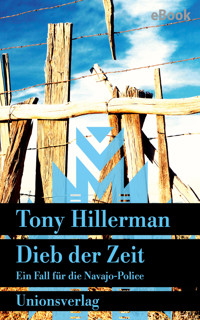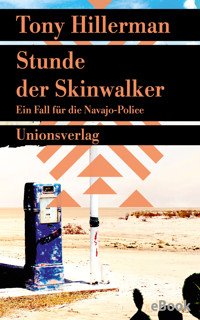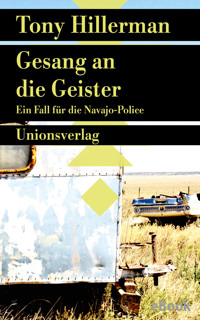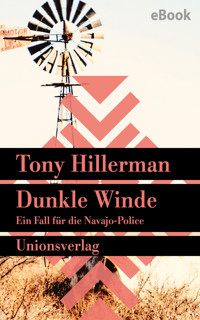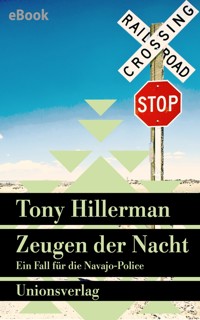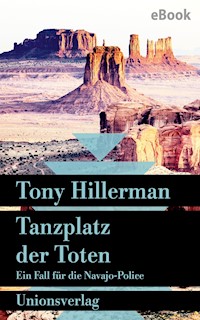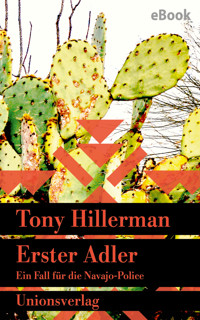
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im Hopi-Reservat wird ein Navajo-Cop erschlagen, der hinter einem Wilderer her war. Als Jim Chee den Toten zwischen staubigen Sandsteinfelsen findet, kniet der mutmaßliche Mörder noch neben dem Opfer: ein Hopi, der illegal einen Adler gefangen hat. Gleiches mit Gleichem zu vergelten, liegt den Hopi und Navajo fern, dennoch droht dem Mann, der seine Unschuld beteuert, die wieder eingeführte Todesstrafe. Für das FBI ist der Fall klar, aber Lieutenant Leaphorn, obwohl pensioniert, geht einer anderen Spur nach: Verschwand nicht zeitgleich eine Biologin, die ganz in der Nähe des Tatorts nach Seuchenüberträgern suchte? Jagte die Biologin Nagern nach, um ein Mittel gegen eine tödliche Mutation der Beulenpest zu finden, die in der Gegend wütet – oder ist sie einer gefährlicheren Fährte gefolgt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 463
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch
Ein Navajo-Cop wurde erschlagen, und der mutmaßliche Täter kniet noch neben ihm: ein Hopi, der illegal Adler fängt. Dem Mann droht die wieder eingeführte Todesstrafe. Der Fall scheint klar, nur Leaphorn und Chee zweifeln. Doch während die beiden einer neuen Fährte folgen, greift eine alte Seuche um sich, die ihrer aller Todesurteil bedeuten könnte.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tony Hillerman (1925–2008) besuchte ein Internat für Native Americans, kämpfte im Zweiten Weltkrieg, studierte Journalismus und war als Journalist und Dozent tätig. Seine Romane um die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee wurden vielfach ausgezeichnet und in siebzehn Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Tony Hillerman.
Fried Eickhoff ist Übersetzer aus dem Englischen, er hat u. a. Werke von Tony Hillerman, Paula Gosling und Philip Kerr ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Fried Eickhoff.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tony Hillerman
Erster Adler
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Fried Eickhoff
Ein Fall für die Navajo-Police (12)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Worterklärungen und Hintergrundinformationen zu diesem Buch auf https://ehillerman.unm.edu/encyclopedia-main
Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Veronika Straaß-Lieckfeld nach dem Original durchgesehen und grundlegend überarbeitet.
Die Originalausgabe erschien 1998 bei HarperCollinsPublishers, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1998 unter dem Titel Die Spur des Adlers im Rowohlt Verlag, Reinbek.
Originaltitel: The First Eagle
© 1998 by Tony Hillerman
Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Fried Eickhoff beim Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hintergrund - Jennifer Wright (Alamy Stock Foto); Symbol - Valerii Egorov (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31170-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 29.10.2024, 12:04h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ERSTER ADLER
1 – Die Leiche von Anderson Nez lag, mit einem …2 – Der stellvertretende Lieutenant Jim Chee von der Navajo-Police …3 – Die blau-schwarze Limousine, die heute Morgen vor Joe …4 – Chee stand nicht deshalb am Fenster des Wartezimmers …5 – Könnten wir vielleicht irgendwo hingehen, wo es etwas …6 – Für Leaphorn war klar, dass er wohl am …7 – Sie hatten sich zeitig zum Frühstück verabredet …8 – Eins kann ich Ihnen sagen – und da …9 – In seinem ersten Semester an der Arizona State …10 – Leaphorn schob es darauf, dass er zu viel …11 – Ein schriller, rhythmischer, fiepender Ton bohrte sich in …12 – Der Felsbrocken, auf den Chee etwas unbedacht mit …13 – Der Van parkte im Schatten einer Gruppe von …14 – Während sie Cameron Richtung Norden verließen, erklärte Leaphorn …15 – Der stellvertretende Lieutenant Jim Chee saß im Schatten …16 – Ist das nicht merkwürdig?«, sagte Leaphorn. »Wie kann …17 – Der stellvertretende Lieutenant Jim Chee hatte ungefähr ein …18 – Hast du sein Gesicht gesehen, als er das …19 – Chee starrte voll Widerwillen auf das Telefon …20 – Leaphorn erwachte von den Strahlen der Morgensonne …21 – Von einem Tag auf den anderen war mit …22 – Wo der stellvertretende Lieutenant Jim Chee zu erreichen …23 – Der Stellvertretende Lieutenant Jim Chee kam zeitig und …24 – Chee verbrachte in seinem dunklen, kleinen Wohnwagen eine …25 – Es war ein frustrierender Tag für Leaphorn …26 – Als Chee am nächsten Morgen in sein Büro …27 – Dr. Woody öffnete nach dem zweiten Klopfen. »Guten …28 – Chee hatte in den nächsten Stunden alle Hände …DankMehr über dieses Buch
Über Tony Hillerman
»Der Angst vor seinem Pferd hat«
Claus Biegert: Die Navajo-Romane — ein Fall von Kultureller Wertschätzung
Über Fried Eickhoff
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tony Hillerman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema USA
Seit ich begann, in meinen Büchern über die Navajo-Police zu schreiben, sind sechs ihrer Officer in Ausübung ihres Dienstes getötet worden. Die Navajo-Police ist nur eine kleine Truppe, die ein riesiges Gebiet, bestehend aus Bergen, Canyons und Wüste, zu betreuen hat. Die Officers sind deshalb in der Regel allein unterwegs. Falls Gefahr droht, dauert es oft Stunden, bis Unterstützung kommt, selbst wenn ihr Funkruf gehört wird.
Ich widme dieses Buch den sechs toten Opfern und ihren Familien. Sie gaben ihr Leben, um andere zu schützen.
Burton Begay, Tuba City, 1975
Loren Whitehat, Tuba City, 1979
Andy Begay, Kayenta, 1987
Roy Lee Stanley, Kayenta, 1987
Hoskie Gene Jr., Kayenta, 1995
Samuel Redhouse, Crownpoint, 1996
1
Die Leiche von Anderson Nez lag, mit einem Tuch abgedeckt, abholbereit auf einer Trage.
Wenn Shirley Ahkeah von ihrem Schreibtisch im Stationszimmer der Intensivstation des Northern Arizona Medical Center in Flagstaff zu der Trage hinübersah, erinnerte sie der Umriss von Mr Nez’ verhülltem Leichnam an den Sleeping Ute Mountain, so wie sie ihn vom Hogan ihrer Tante in der Nähe von Teec Nos Pos aus sehen konnte. Wo die Füße des Toten das Tuch anhoben, sah sie den Gipfel des Berges. Dahinter bildete das Laken unregelmäßige Höcker und Falten – genau wie die schneebedeckten Berghänge, die Shirley aus ihren Kindertagen in Erinnerung hatte.
Shirley schob den angefangenen Bericht über ihre Nachtschicht beiseite. Sie musste ständig an Anderson Nez denken und an das, was mit ihm geschehen war. Sie überlegte, ob er wohl mit den Nez des Bitter Water Clans verwandt war, die bei Short Mountain gleich neben dem Haus ihrer Großmutter Weideland gepachtet hatten. Ob diese Familie tatsächlich mit einer Autopsie einverstanden wäre? Soweit sie sich erinnern konnte, lebten sie in einem Schäferwagen auf ganz traditionelle Art. Aber Dr. Woody, der Nez eingeliefert hatte, behauptete, die Familie habe ihr Einverständnis zu einer Autopsie gegeben.
In diesem Augenblick sah Woody auf seine Uhr, ein billiges Digitalding aus schwarzem Plastik, das er ganz offensichtlich nicht gekauft hatte, um die Sorte Menschen zu beeindrucken, die sich von teuren Uhren beeindrucken lassen.
»Also noch mal«, sagte er, »ich muss wissen, wann der Mann gestorben ist.«
»In den frühen Morgenstunden«, antwortete Dr. Delano. Er wirkte überrascht – ebenso überrascht wie Shirley. Wieso fragte er, wo er die Antwort doch schon wusste?
»Nein, nein, nein«, sagte Woody gereizt, »ich brauche die genaue Zeit.«
»Wahrscheinlich gegen zwei Uhr nachts«, antwortete Delano. Seine Miene verriet deutlich, dass er es nicht gewohnt war, in derart ungeduldigem Ton befragt zu werden. Er zuckte die Achseln. »So ungefähr.«
Woody runzelte ärgerlich die Stirn. »Wer könnte das wissen? Ich meine, bis auf ein paar Minuten genau.« Er sah rechts und links den Krankenhausflur entlang und zeigte dann auf Shirley. »Irgendjemand muss doch Nachtwache gehabt haben. Der Mann war im Endstadium. Ich weiß genau, wann er sich infiziert hat, und ich weiß, wann das Fieber eingesetzt hat. Jetzt muss ich herausfinden, wie schnell die Infektion ihn umgebracht hat. Ich brauche jede noch so kleine Information über die verschiedenen körperlichen Prozesse im präfinalen Stadium. Ich muss wissen, wie sich die verschiedenen Vitalfunktionen verändert haben, Atmung, Herz und Kreislauf. Außerdem brauche ich die Ergebnisse der Untersuchungen, die ich angeordnet habe, als ich ihn eingeliefert habe. Und zwar vollständig.«
Merkwürdig, dachte Shirley. Wenn Woody so genau wusste, wann Nez sich infiziert hatte, wieso hatte er ihn dann nicht früher gebracht, als man noch eine Chance gehabt hätte, ihn zu retten? Bei seiner Einlieferung gestern hatte Nez vor Fieber geglüht und lag schon im Sterben.
»Ich bin mir sicher, dass alle Angaben, die Sie suchen, in seiner Patientenakte stehen«, sagte Delano und wies mit einer Kopfbewegung auf das Klemmbrett in Woodys Hand.
Shirley verzog schuldbewusst das Gesicht. Die Angaben, die Woody brauchte, waren nicht in der Akte eingetragen. Noch nicht. Sie hätten dort stehen sollen und würden dort auch stehen, selbst nach dieser ungewöhnlich hektischen Nachtschicht, wenn nicht plötzlich Woody hereingestürmt wäre und eine Obduktion verlangt hätte. Keine gewöhnliche Obduktion, sondern außerdem noch eine Menge Extras. Deshalb hatte man dann Delano dazugeholt, der schlaftrunken und unkonzentriert wirkte und als stellvertretender ärztlicher Leiter nicht gerade eine gute Figur gemacht hatte. Delano zog seinerseits Dr. Howe hinzu, der gestern auf der Intensivstation Dienst gehabt und Nez behandelt hatte. Shirley stellte fest, dass sich Howe von Woodys Ungeduld nicht im Mindesten beeindrucken ließ. Dafür hatte er wohl einfach schon zu viel gesehen. Howe betrachtete jeden Fall als seinen ganz persönlichen Kampf gegen den Tod. Aber wenn der Tod dann doch siegte, wie das auf einer Intensivstation nicht selten vorkam, zog er einfach Bilanz und wandte sich neuen Fällen zu. Noch vor wenigen Stunden hatte er sich um Nez gesorgt und war ihm nicht von der Seite gewichen, doch schon jetzt war er für ihn nur noch eine weitere der unzähligen schicksalhaften Niederlagen.
Warum also machte Dr. Woody so einen Aufstand, fragte sich Shirley. Warum bestand er auf einer Autopsie? Und nicht nur das. Er bestand sogar darauf, den Pathologen bei ihrer Arbeit zuzusehen. Die Todesursache war doch vollkommen klar. Nez war an der Pest gestorben. Sofort nach seiner Ankunft im Krankenhaus hatte man ihn auf die Intensivstation gebracht. Da waren die infizierten Lymphdrüsen aber schon stark angeschwollen, und subkutane Blutungen bildeten auf Unterleib und Beinen die charakteristischen dunklen Flecken, die der Seuche den Namen »schwarzer Tod« eingebracht hatten. Damals, im mittelalterlichen Europa, waren ihr zig Millionen Menschen zum Opfer gefallen.
Wie die meisten medizinischen Fachkräfte im Four-Corners-Gebiet hatte auch Shirley Ahkeah schon früher Pestkranke gesehen. Drei oder vier Jahre lang war die Big Reservation von Infektionen mit Yersinia pestis verschont geblieben, aber dieses Jahr waren schon drei Fälle gemeldet worden. Einer davon war in dem Teil der Big Rez aufgetreten, die zu New Mexico gehörte; sie hatten ihn gar nicht zu Gesicht bekommen. Auch dieser Fall war tödlich ausgegangen, und man hörte überall vom Comeback dieses altertümlichen Bakteriums, das neuerdings auch noch in ungewöhnlich virulenter Form auftrat.
Nez hatte sich eindeutig mit der virulenten Form des Erregers infiziert. Anfangs hatte das Bakterium wie üblich die Drüsen befallen, hatte sich dann aber rasend schnell zu einer sekundären Pestpneumonie entwickelt. In Nez’ Sputum und Blut hatte es von Erregern nur so gewimmelt, und niemand wagte sich ohne Atemschutzmaske in sein Krankenzimmer.
Delano, Howe und Woody waren langsam über den Flur davongegangen – zu weit entfernt, als dass Shirley sie noch hätte verstehen können, aber aus dem ruhigen Gemurmel, das zu ihr herüberdrang, schloss sie, dass sie sich irgendwie geeinigt hatten. Vermutlich bedeutete das zusätzliche Arbeit für sie. Ihr Blick wanderte zu dem Laken, unter dem Nez auf der Trage lag, und sie sah ihn wieder vor sich, wie er sich Stunde um Stunde dem Tod entgegengequält hatte. Sie wünschte, man würde seine Leiche endlich abholen. Shirley Ahkeah stammte aus Farmington, einer Stadt im Nordwesten des Bundesstaates New Mexico. Ihr Vater, ein Grundschullehrer, war zum Katholizismus konvertiert. Deshalb war aus ihrer Sicht das »Leichen-Tabu« der Navajo einfach so etwas Ähnliches wie die jüdischen Speisevorschriften: eine kluge Methode, um die Ausbreitung von Krankheiten zu verhindern. Doch auch wenn sie nicht an den bösen chindi glaubte, der nach Überzeugung traditioneller Navajo vier Tage lang den Verstorbenen begleitete, fühlte sie sich dennoch unbehaglich. Beim Anblick des Toten unter seinem Laken musste sie an die Endlichkeit des menschlichen Lebens und das tiefe Leid denken, das jeder Todesfall mit sich bringt.
Howe kam wieder zurück. Er sah alt und müde aus. Wie immer, wenn sie ihn sah, fühlte sie sich an eine rundlichere Ausgabe ihres Großvaters erinnert.
»Shirley, meine Liebe, wissen Sie vielleicht noch, ob ich Ihnen gestern eine Liste mit besonderen Untersuchungen gegeben habe, die wir an Nez vornehmen sollten? Ich erinnere mich, dass Woody ein paar spezielle Blutbilder haben wollte. Wir sollten zum Beispiel jede Stunde den Interleukin-6-Wert ermitteln. Können Sie sich vorstellen, was die vom Indian Health Service für einen Tanz aufführen, wenn wir ihnen so was auf die Rechnung setzen?«
»O ja«, sagte Shirley, »das kann ich mir lebhaft vorstellen. Aber diese Liste habe ich nie gesehen. An dieses Interleukin-6 würde ich mich bestimmt erinnern.« Sie lachte. »Das hätte ich nämlich erst einmal nachschlagen müssen. Es hat irgendetwas damit zu tun, wie das menschliche Immunsystem arbeitet, oder?«
»Ich bin da auch nicht besonders bewandert«, antwortete Howe. »Aber ich glaube, Sie haben recht. Ich weiß, dass dieser Wert wichtig ist, wenn man Aids und Diabetes und bestimmte andere Krankheiten behandeln will, bei denen das Immunsystem eine Rolle spielt. Aber egal. Die Liste wird in Ihrem Bericht eben einfach nicht auftauchen; dann ist klar, dass sie nie auf Ihrem Schreibtisch angekommen ist. Ich glaube, ich habe den Zettel zusammengeknüllt und weggeworfen.«
»Wer ist überhaupt dieser Dr. Woody?«, wollte Shirley wissen. »Was ist seine Fachrichtung? Und warum hat es so lange gedauert, bis er Nez eingeliefert hat? Der arme Kerl muss doch schon tagelang Fieber gehabt haben.«
»Woody praktiziert überhaupt nicht als Arzt«, sagte Howe. »Ich glaube, er hat einen medizinischen Doktortitel, aber er arbeitet in der Forschung. Mikrobiologie, Pharmakologie, organische Chemie – das sind seine Gebiete. Er schreibt in medizinischen Fachzeitschriften laufend Artikel über das Immunsystem, über die Evolution von Krankheitserregern, die Antibiotikaresistenz von Bakterien und all so was. Vor ein paar Monaten hat er in Science einen Artikel für interessierte Laien veröffentlicht: eine Warnung an alle, dass die bekannten Wundermittel ihre Wirkung verlieren. Wenn die Viren uns nicht umbringen, dann bestimmt die Bakterien.«
»Oh, ja, den Artikel habe ich auch gelesen«, sagte Shirley. »Der war also von ihm. Aber wenn er so gut Bescheid weiß, wie kann es ihm dann passieren, dass er Nez’ Fieber nicht bemerkt hat?«
Howe nickte. »Das habe ich ihn auch gefragt. Er sagte, er habe Nez sofort eingeliefert, als sich die ersten Symptome zeigten. Weil bei ihrer Arbeit im Labor das Risiko besonders hoch ist, hat Nez sowieso schon regelmäßig vorbeugend Doxycyclin bekommen. Als dann das Fieber einsetzte, habe er ihm noch zusätzlich Streptomycin gespritzt und ihn auf dem schnellsten Weg hierhergebracht.«
»Aber das glauben Sie doch nicht etwa, oder?«, fragte Shirley.
Howe zog ein Gesicht. »Ungern. Aber ich denke, es stimmt, was er sagt«, antwortete er. »Die gute alte Pest war doch wenigstens berechenbar. Die ließ sich zu Anfang immer Zeit, und das hat uns die Möglichkeit gegeben, etwas gegen sie zu unternehmen. Und genau darum geht’s in Woodys Artikel. Er schreibt so ungefähr ›Zerbrecht euch nicht den Kopf wegen des Klimawandels. Bevor sich die Folgen abzeichnen, haben uns die fiesen kleinen Biester längst erledigt.‹«
»Soweit ich mich erinnere, hat mir vieles eingeleuchtet, was in dem Artikel stand«, sagte Shirley. »Ich sehe ja jeden Tag, wie manche von euch Ärzten sofort Breitband-Antibiotika verschreiben, wenn eine Mama ihr Kind mit Ohrenschmerzen in die Klinik bringt. Kein Wunder …«
Howe hob die Hand. »Ist gut, Shirley. Bei mir rennen Sie offene Türen ein.« Er machte eine Kopfbewegung zur Trage hinüber. »Der tote Mr Nez hier ist doch der beste Beweis, dass wir gerade jede Menge resistente Bakterien heranzüchten. Bei Pasteurella pestis, wie wir den Erreger früher genannt haben, konnten wir zwischen einem halben Dutzend verschiedener Antibiotika auswählen, und sie sind alle spielend mit ihrem Gegner fertiggeworden. Heute nennen wir die Biester Yersinia pestis, und die haben im Fall von Nez sämtliche Gegenmittel, die wir angewandt haben, ignoriert. Dieser Patient hätte tatsächlich von einer eurer Navajo-Heilungszeremonien mehr gehabt als von unserer Behandlung.«
»Er ist einfach zu spät hergebracht worden«, meinte Shirley. »Man kann der Pest nicht zwei Wochen Vorsprung geben und dann erwarten …«
Howe schüttelte den Kopf. »Es waren keine zwei Wochen, Shirley. Wenn Woody keinen Mist erzählt hat, dann war es eher ein Tag.«
»Das kann nicht sein«, sagte Shirley heftig. »Woher will Dr. Woody überhaupt so genau wissen, wann sich Nez infiziert hat?«
»Er sagte, er habe Nez den Floh selbst runtergepflückt. Woody führt eine groß angelegte Studie über Nagetierkolonien durch. Das Geld dafür kommt vom National Institute of Health und ein paar Pharmafirmen. Er forscht gerade zum Thema ›Tiere als Reservoir für Krankheitserreger‹. Da gibt’s zum Beispiel Kolonien von Präriehunden, die eine Infektion mit Pesterregern überleben, während andere Kolonien vernichtet werden. Ähnlich ist es bei den Kängururatten oder den Weißfußmäusen, die eine Infektion mit dem Hanta-Virus überleben. Jedenfalls hat Woody erzählt, dass er und Nez immer vorbeugend ein Breitbandantibiotikum genommen haben, wenn die Gefahr bestand, dass sie sich einen Flohstich einfangen könnten. Wenn einer der beiden dann tatsächlich gestochen wurde, fing Woody den Floh und untersuchte ihn, um notfalls eine Behandlung einzuleiten. Woody hat mir erzählt, dass Nez gestern an der Innenseite seines Oberschenkels einen Floh entdeckt hat. Unmittelbar danach hat er sich unwohl gefühlt und gespürt, wie er Fieber bekam.«
»Aber das wäre ja Wahnsinn«, sagte Shirley leise.
»Das ist Wahnsinn«, bestätigte Howe.
»Aber ich wette, dass er schon einmal vor ein paar Wochen von einem Floh gestochen worden ist, ohne dass er es gemerkt hat«, sagte Shirley. »Sind Sie mit einer Autopsie einverstanden?«
Howe nickte. »Sie sagten doch, dass Sie die Familie vielleicht kennen. Oder Sie kennen jedenfalls ein paar von der Familie Nez. Meinen Sie, dass sie etwas dagegen haben könnten?«
Sie zuckte die Achseln. »Ich bin das, was man eine ›urbane Indianerin‹ nennt. Von meiner Abstammung her bin ich zwar zu drei Vierteln Navajo, aber über unsere Kultur weiß ich kaum etwas. Die Tradition verbietet es zwar, Leichen zu öffnen. Dafür gibt’s dann kein Problem mit der Bestattung.«
Howe seufzte tief, lehnte sich mit seinem ausladenden Hinterteil gegen ihren Schreibtisch, schob die Brille hoch und rieb sich die Augen. »Das bewundere ich so an euch Navajo«, sagte er. »Wenn jemand stirbt, dann trauert und weint ihr vier Tage lang um seinen Geist und seine Seele, aber danach geht das Leben weiter. Was hat uns Weiße bloß dazu gebracht, diesen fürchterlichen Leichenkult einzuführen? Eigentlich ist eine Leiche doch nichts als totes Fleisch und außerdem noch schwierig zu entsorgen.«
Shirley nickte stumm.
»Gibt’s irgendeinen Hoffnungsschimmer für das Kind auf Nummer vier?«, fragte Howe. Er nahm sich die Krankenakte, überflog sie, schnalzte kurz mit der Zunge und schüttelte den Kopf. Schwerfällig kam er wieder auf die Beine, stand einen Moment lang mit hängenden Schultern einfach nur da und starrte die verhüllte Gestalt auf der Trage an.
»Wissen Sie eigentlich«, fragte er, »welche Heilungsmethoden die Ärzte im Mittelalter für so was hatten? Sie dachten, dass man krank wird, wenn man üble Dünste einatmet. Also haben sie den Leuten empfohlen, sich mit reichlich Parfüm und Blumen davor zu schützen. Natürlich sind die Menschen trotzdem gestorben wie die Fliegen, aber diese Methode hat jedenfalls bewiesen, dass Menschen Humor haben.«
Shirley kannte Howe lange genug, um zu wissen, dass er jetzt so was wie einen Aufschlag von ihr erwartete, damit er mit einem witzigen Return antworten konnte. Eigentlich war sie heute nicht in der Stimmung, aber sie tat ihm den Gefallen: »Wie denn?«
»Sie haben ein sarkastisches kleines Lied gedichtet, das sich bis heute erhalten hat – allerdings nur als Kinderlied.«
Er begann, mit brüchiger Altmännerstimme zu singen:
»Ringel rangel Rose
Wir tanzen auf dem Moose
Pflücken uns ein Veilchen
Freun uns noch ein Weilchen …
Staub, Staub, wir alle geh’n dahin.«
Er sah sie fragend an. »Das haben Sie doch bestimmt auch im Kindergarten gesungen?«
Shirley schüttelte den Kopf. Sie hatte das Lied noch nie gehört.
Und Dr. Howe wandte sich schweigend ab und ging den Gang hinunter zu einem anderen Patienten, der im Sterben lag.
2
Der stellvertretende Lieutenant Jim Chee von der Navajo-Police, traditionsbewusst aus tiefster Seele, hatte seinen Wohnwagen so abgestellt, dass sich die Tür nach Osten öffnete. In der frühen Morgenstunde des 8. Juli wandte er sein Gesicht der aufgehenden Sonne zu, verstreute ein wenig Maispollen aus seinem Medizinbeutel, um den Tag zu segnen, und sann darüber nach, was er ihm wohl bringen mochte.
Er bedachte zuerst den unangenehmen Teil. Auf seinem Schreibtisch im Büro in Tuba City wartete noch der monatliche Report für den Juni auf ihn – sein erster Bericht, seit er stellvertretend die Leitung einer Polizeinebenstelle der Navajo-Police übernommen hatte. Der Bericht war erst halb fertig, aber längst überfällig. Doch der verhasste Papierkram wäre geradezu ein Vergnügen im Vergleich zu der anderen Aufgabe, die heute anstand: Er musste Officer Ben Kinsman klarmachen, dass er künftig gefälligst sein Testosteron zu kontrollieren habe.
Der angenehme Teil des Tages hatte, zumindest indirekt, mit seinem eigenen Testosteron zu tun. Janet Pete hatte beschlossen, Washington zu verlassen und ins Navajo-Land zurückzukehren. Ihr Brief war freundlich, aber ziemlich unpersönlich gewesen, ohne die geringste Andeutung irgendwelcher romantischen Gefühle. Aber immerhin, sie kam wieder zurück. Wenn er die Sache mit Kinsman hinter sich gebracht hatte, würde er sie anrufen, um vorsichtig die Lage zu sondieren. Betrachtete sie sich noch als seine Verlobte? Hatte sie vor, ihre komplizierte Beziehung wieder aufzunehmen? Wollte sie die Differenzen zwischen ihnen überbrücken? Konnte sie sich vielleicht sogar vorstellen, ihn zu heiraten? Und falls ja, wäre er selbst dazu überhaupt bereit? Aber wie immer auch die Antwort auf diese Frage ausfallen mochte, die Hauptsache war, sie kehrte zurück, und deshalb lächelte Chee glücklich vor sich hin, während er das Frühstücksgeschirr abspülte.
Doch kaum hatte er sein Büro in Tuba City betreten, war die gute Laune verflogen. Officer Kinsman, der ihn in seinem Büro erwarten sollte, war nicht da. Claire Dineyahze lieferte die Erklärung. »Er hat mir gesagt, er müsse gleich rausfahren zur Yells Back Butte und den Hopi festnehmen, der dort wieder mal Adler wildert.«
Chee holte tief Luft und öffnete den Mund, schloss ihn aber gleich wieder. Er wollte Mrs Dineyahze die obszönen Flüche ersparen, mit denen er Kinsman gerne bedacht hätte – zu Recht, wie er fand.
Mrs Dineyahze sah gequält drein und schüttelte den Kopf. Offenbar missbilligte auch sie Kinsmans Verhalten.
»Ich nehme an, es ist derselbe Hopi, den er letzten Winter schon mal da draußen festgenommen hat«, sagte sie. »Den mussten sie ja damals gleich wieder laufen lassen, weil Benny vergessen hatte, ihn über seine Rechte aufzuklären. Aber er wollte mir ja nichts Genaues sagen. Hat mir nur diesen ganz bestimmten Blick zugeworfen. So ungefähr …!« Sie setzte eine ungemein überhebliche Miene auf. »Seinen Informanten dürfe er nicht nennen, hat er behauptet, das sei vertraulich.« Es war nicht zu übersehen, dass Mrs Dineyahze Kinsmans Ausgrenzung als kränkend empfand. »Bestimmt eine von seinen Freundinnen.«
»Ich werde das herausfinden«, sagte Chee. Es war an der Zeit, das Thema zu wechseln. »Ich muss heute endlich diesen Juni-Bericht abschließen. Gibt es sonst noch was Neues?«
»Na ja …«, begann Mrs Dineyahze und verstummte dann.
Chee wartete.
Mrs Dineyahze zuckte die Achseln. »Ich weiß, dass Sie Klatsch nicht mögen«, sagte sie, »aber Sie werden’s sowieso bald offiziell erfahren.«
»Was?«
»Suzy Gorman hat heute Morgen angerufen. Sie wissen, wen ich meine? Die Sekretärin bei der Arizona Highway Patrol in Winslow. Einer ihrer Trooper wurde gestern Abend nach Flagstaff gerufen, weil sich dort zwei Männer prügelten. Der eine war Benny Kinsman, der andere irgendjemand von der Northern Arizona University.«
Chee seufzte. »Hat Kinsman jetzt eine Anklage am Hals?«
»Sie sagte, nein. Die Kollegen hätten ein Auge zugedrückt.«
»Na, Gott sei Dank«, sagte Chee. »Das hätte gerade noch gefehlt.«
»Die Sache ist aber vielleicht noch nicht ganz ausgestanden«, meinte Mrs Dineyahze. »Suzy sagte, der Grund für die Schlägerei sei gewesen, dass Kinsman eine junge Frau angemacht hat und nicht lockerlassen wollte, und diese Frau will offenbar Anzeige erstatten. Sie sagte, Kinsman hätte sie schon früher belästigt. Bei der Arbeit.«
»Zum Teufel«, sagte Chee. »Was denn noch? Wo arbeitet die Frau?«
»Sie arbeitet von einem kleinen Labor aus, das das Arizona Health Department hier eingerichtet hat, nachdem die beiden Fälle von Beulenpest aufgetreten sind. Ihr Job besteht darin, die Überträger der Krankheit aufzuspüren.« Sie lächelte. »Sie fangen Flöhe.«
»Bis heute Mittag muss ich diesen Bericht vom Schreibtisch haben«, sagte Chee. Was Kinsman anging, war er fürs Erste bedient.
Aber Mrs Dineyahze war mit Kinsman noch nicht fertig. »Hat Bernie Sie schon auf Kinsman angesprochen?«
»Nein«, sagte Chee. »Bis jetzt nicht«, aber er hatte schon gehört, dass es in der Gerüchteküche brodelte.
»Ich habe ihr schon gesagt, dass sie sich an Sie wenden soll, aber sie wollte Sie nicht damit behelligen.«
»Was wollte oder sollte sie mir denn sagen?« Bernie, genauer gesagt Officer Bernadette Manuelito, war jung und noch unerfahren und außerdem in ihn verknallt, wenn er verschiedenen Bemerkungen glauben konnte, die er dann und wann aufgeschnappt hatte.
Mrs Dineyahze sah säuerlich drein. »Es geht um sexuelle Belästigung.«
»Wie bitte?«
»Er macht sie an.«
Chee wollte nichts davon hören. Jedenfalls nicht jetzt. »Sagen Sie ihr, sie soll mir einen Bericht schreiben«, sagte er und ging in sein Büro, um seinen Papierkram in Angriff zu nehmen. Wenn er ein paar Stunden in Ruhe und Frieden daran arbeiten könnte, wäre er bis Mittag fertig damit. Doch schon nach einer halben Stunde meldete sich die Funkzentrale.
»Kinsman fordert Unterstützung an«, sagte der weibliche Officer.
»Wobei?«, wollte Chee wissen. »Und wo steckt er überhaupt?«
»Ziemlich weit draußen, hinter Goldtooth«, sagte sie. »Westlich von der Black Mesa irgendwo. Die Funkverbindung ist abgebrochen.«
»Das passiert da draußen immer«, sagte Chee. Die ständigen Probleme mit der Funkverbindung waren einer der Punkte, über die er sich in seinem Bericht beschweren wollte.
»Ist jemand in der Nähe?«
»Ich fürchte, nein.«
»Dann übernehme ich das selbst«, sagte Chee.
Kurz nach zwölf Uhr mittags rumpelte er in einer Staubwolke die Schotterstraße entlang und hielt Ausschau nach Kinsman. »Melden Sie sich, Benny!«, sagte er ins Mikrofon. »Ich bin acht Meilen südlich von Goldtooth, wo sind Sie?«
»Unter der Südwand der Yells Back Butte«, antwortete Kinsman. »Nehmen Sie den alten Fahrweg zum Tijinney-Hogan. Sie kreuzen dann bald ein trockenes Bachbett. Dort müssen Sie den Wagen stehen lassen und zu Fuß weiter. Eine halbe Meile das Bachbett hoch. Und vor allem – leise!«
»Ach, zum Teufel«, sagte Chee, aber nur zu sich selbst, nicht ins Mikrofon. Das Jagdfieber wegen dieses Hopi-Wilderers oder hinter wem auch immer er her war, musste Kinsman den Verstand vernebelt haben, sonst hätte er seine Informationen nicht in diesem kaum verständlichen Flüsterton übermittelt. Aber was Chee noch mehr ärgerte, war, dass Kinsman sein Gerät gleich wieder abgeschaltet hatte, damit seine »Beute« nicht durch laute Rückfragen aus dem Funkgerät alarmiert werden konnte. Natürlich wäre so ein Vorgehen in Notsituationen die angesagte Methode, aber Chee bezweifelte, dass die Situation ernst genug für solche Albernheiten war.
»Kommen Sie, Kinsman«, sagte er. »Werden Sie erwachsen!«
Wenn er Benny bei dem, was er vorhatte, Rückendeckung geben sollte, wäre es ganz hilfreich gewesen zu wissen, worum es eigentlich ging und was ihn erwartete. Außerdem wäre ihm damit gedient, wenn er wüsste, wo genau dieser Fahrweg zum Tijinney-Hogan abzweigte. Chee kannte so ziemlich jeden Feldweg im östlichen Teil der Big Rez, auf der Checkerboard Rez kannte er sich sogar noch besser aus, und das Gebiet um den Navajo Mountain war ihm auch einigermaßen vertraut. Aber in Tuba City und Umgebung war er nur als ganz junger Polizist für kurze Zeit im Einsatz gewesen, und erst jetzt vor sechs Wochen war er wieder hierher zurückversetzt worden. Deshalb war ihm die zerklüftete Gegend, die an das Hopi-Reservat angrenzte, noch relativ fremd.
Er erinnerte sich noch, dass die Yells Back Butte eine Felsformation der Black Mesa war. Es sollte also nicht allzu schwer sein, den Fahrweg zum Tijinney-Hogan, das trockene Bachbett und Kinsman zu finden. Sobald er ihn aufgestöbert hatte, würde er mit ihm erst mal ein paar deutliche Takte reden, wie man ein Funkgerät benutzte und wie man sich in Gegenwart von Frauen zu benehmen hatte. Und bei der Gelegenheit konnte er ihm auch gleich sagen, dass er sich gefälligst seine Anti-Hopi-Haltung verkneifen sollte.
Diese Abneigung war die Folge von Kinsmans Familiengeschichte: Nachdem der Kongress entschieden hatte, die Joint Use Areas aufzuteilen, die bis dahin von Navajo und Hopi gemeinsam genutzt worden waren, wurde das Gelände, auf dem die Kinsmans lebten, dem Hopi-Reservat zugeschlagen. Kinsmans Großmutter, die nur Navajo sprach, war in die Gegend von Flagstaff umgesiedelt worden, wo kaum jemand Navajo verstand. Jedes Mal, wenn Kinsman sie dort besuchte, kam er stocksauer und empört zurück.
Einer jener vereinzelten Schauer, mit denen sich die bevorstehende Regenzeit im Wüstenland ankündigt, war wenige Minuten zuvor über das Moenkopi Plateau hinweggezogen, und Chee konnte weit im Osten immer noch den Donner grollen hören. Die Schotterstraße war hier feucht und staubte nicht mehr, und die Luft, die durchs Autofenster hereinwehte, duftete würzig nach Beifuß und nasser Erde.
Chee beschloss, sich durch die Probleme mit Kinsman nicht den Tag verderben zu lassen. Er wollte glücklich sein, und er war es tatsächlich. Janet Pete würde zurückkommen. Was bedeutete das? Glaubte sie, dass sie inzwischen auf das kulturelle Leben und die High Society von Washington verzichten könnte? Möglich. Aber vielleicht kam sie auch nur zurück, um ihn wieder in ihre andere Welt hineinzuziehen? Und wenn dem so war, würde sie es diesmal schaffen? Plötzlich fühlte er sich unbehaglich.
Bevor gestern ihr Brief gekommen war, hatte er oft tagelang kaum an sie gedacht. Nur frühmorgens, wenn er sich zum Frühstück seinen Dosenschinken briet, oder nachts kurz vor dem Einschlafen. Aber er hatte der Versuchung widerstanden, ihren alten Brief immer wieder hervorzukramen und noch einmal zu lesen. Er kannte den Inhalt ohnehin auswendig. Einer der vielen einflussreichen Bekannten ihrer Mutter hatte berichtet, dass Janets Stellenbewerbung im Justizministerium wohlwollend aufgenommen worden sei. Da sie eine halbe Navajo war, habe sie gute Aussichten für eine Anstellung im Indianergebiet. Dann kam der letzte Absatz: »Vielleicht werde ich nach Oklahoma geschickt. Wegen der vielen Streitigkeiten der Cherokee untereinander braucht man dort dringend Juristen. Es ist aber auch möglich, dass die Diskussionen im Bureau of Indian Affairs über die Methoden der Strafverfolgung mich noch in Washington festhalten.«
Keine Zeile in dem Brief ließ erkennen, dass zwischen ihnen vor ihren Streitereien so etwas wie Zuneigung bestanden hatte. Chee verbrauchte fast ein Dutzend Blatt Papier bei seinen fruchtlosen Versuchen, ihr verständlich zu machen, was er dachte und fühlte. In seinen ersten Entwürfen drängte er sie noch, auf ihre Erfahrung hinzuweisen, die sie bei ihrer Arbeit für das Rechtshilfeprogramm der Navajo gemacht hatte, um eine Anstellung in der Big Rez anzustreben. Er schrieb ihr, sie solle so schnell wie möglich wieder nach Hause kommen; er sehe inzwischen ein, dass er ihr zu Unrecht misstraut habe. Er habe die Situation einfach missverstanden, seine dumme Eifersucht habe ihm den Blick getrübt.
In anderen Entwürfen schrieb er: »Bleib, wo du bist. Du wirst hier nie glücklich werden. Und zwischen uns beiden wird es nie wieder so sein wie früher. Komm nicht zurück, wenn du nicht wirklich überzeugt bist, auch ohne die kulturellen Events im Kennedy Center, ohne deine Freunde aus den Elite-Universitäten, ohne Vernissagen, Modeschauen und Cocktailpartys mit den Reichen und Schönen, ohne die versnobte, intellektuelle Upper Class leben zu können. Komm nicht zurück, wenn du dir nicht wirklich vorstellen kannst, mit einem Typen glücklich zu werden, der weder sozial aufsteigen möchte noch besonderen Luxus anstrebt, sondern sehr zufrieden damit ist, in einem rostigen Trailer zu wohnen.«
Aber war er denn wirklich zufrieden? Oder machte er sich nur etwas vor? Wie auch immer, er war froh, dass es ihm nach einiger Zeit gelungen war, sie zu vergessen. Und bei dem Brief, den er schließlich abschickte, hatte er sorgfältig darauf geachtet, nur ja nichts von seinen widerstreitenden Gefühlen zu verraten. Er war freundlich und nichtssagend. Dann war plötzlich gestern ihr Brief gekommen, und in der letzten Zeile stand: »Ich komme nach Hause!!«
»Nach Hause«. Nach Hause mit zwei Ausrufezeichen. Daran hatte er gerade gedacht, als Kinsmans albernes Geflüster ihn in die Gegenwart zurückholte. Jetzt war Kinsmans Flüstern wieder da. Chee konnte zuerst nicht verstehen, was er sagte, doch dann hörte er plötzlich deutlich die Worte: »Lieutenant! Machen Sie schnell!«
Chee trat aufs Gas. Eigentlich hatte er vorgehabt, in Goldtooth anzuhalten und nach dem Weg zu fragen, aber der Ort bestand nur noch aus zwei verfallenen Steinhäusern mit weit offenen Türen und Fenstern und ohne Dach und einem traditionellen runden Hogan, der so verlassen aussah wie die Häuser. Fahrspuren führten von den Hausruinen weg und verschwanden rechts und links in den Dünen. Er hatte kein Auto mehr gesehen, seit er von der Asphaltstraße abgebogen war, aber auf der mittleren Spur waren Reifenabdrücke zu erkennen. Chee beschloss, ihnen zu folgen. Er fuhr, so schnell er konnte. Er raste. Er hatte den Regen hinter sich gelassen und zog jetzt eine weithin sichtbare Staubfahne hinter sich her. Zu seiner Rechten, ungefähr vierzig Meilen entfernt, erhoben sich am Horizont die San Francisco Mountains, über deren höchstem Gipfel, dem Humphreys Peak, sich gerade eine Gewitterfront aufbaute. Die zerklüftete Silhouette der Hopi Mesas zu seiner Linken verschwand immer wieder hinter Regenschleiern, die eine Wolke hinter sich herschleppten. Überall auf der leeren Hochebene, über die er jetzt jagte, hatte die formende Kraft des Windes ihre Spuren hinterlassen. Auf den Dünen hatten sich Mormonentee und Schlangenkraut, Beifuß und Yucca angesiedelt und hielten den Sand zwischen ihren Wurzeln fest. Plötzlich stieg Chee wieder der typische Duft in die Nase, der nach Regenschauern in der Luft liegt. Es staubte nicht mehr, die Fahrspuren waren noch feucht. Der Feldweg bog jetzt nach Osten ab und führte direkt auf die Felsen der Mesa zu, aus denen eine massive Steinkuppe herausragte. Die Reifenspuren, die darauf zuführten, waren von einem so dichten Gestrüpp aus Mormonentee überwuchert, dass Chee die Abbiegung fast übersehen hätte. Er setzte ein Stück zurück und versuchte noch einmal, über Funk mit Kinsman Kontakt aufzunehmen, doch aus dem Gerät kam nur Knacken und Rauschen. Chee folgte den Wagenspuren in Richtung auf den Felskegel. Kurz vor dem Fuß der Felswand kam er zu dem ausgetrockneten Bachbett, von dem Kinsman gesprochen hatte.
Kinsmans Streifenwagen parkte neben einer Gruppe Wacholderbüsche, und Kinsmans Fußspuren führten flussaufwärts. Chee folgte ihnen das sandige Bachbett entlang, dann aus dem Bachbett heraus, den Abhang hinauf und auf die steil aufragende Sandsteinwand zu. Der drängende Ton von Kinsmans Stimme ging ihm nicht aus dem Kopf. Jetzt war keine Zeit für lautloses Anschleichen. Chee begann zu rennen.
Officer Kinsman lag hinter einem Sandsteinfelsen. Chee sah als Erstes ein Bein in einer Uniformhose, teilweise verdeckt von wuchernden Quecken. Er rief laut seinen Namen, dann hielt er inne. Jetzt konnte er auch einen Stiefel sehen, mit der Spitze nach unten. Da stimmte etwas nicht. Er zog die Pistole aus dem Holster und schob sich langsam näher.
Plötzlich hörte er hinter dem Felsen ein leises Knirschen, so als ob jemand auf lose Steinchen getreten wäre, dann eine Art Knurren, mühsames Atmen und einen Ausruf. Er entsicherte die Waffe und trat aus der Deckung.
Benjamin Kinsman lag mit dem Gesicht nach unten, der Rücken seines Uniformhemdes war mit einem schmierigen Gemisch aus Sand, Gras und Blut verklebt. Neben ihm kauerte ein junger Mann; auch sein Hemd war blutverschmiert. Er drehte sich um und sah zu Chee auf.
»Hände auf den Kopf!«, befahl Chee.
»Hey«, sagte der Mann, »dieser Mann hier …«
»Hände auf den Kopf«, schnauzte Chee. Seine eigene barsche und zittrige Stimme klang fremd in seinen Ohren. »Und jetzt auf den Boden, mit dem Gesicht nach unten!«
Der Mann starrte erst Chee an, dann die Pistole, die auf seinen Kopf gerichtet war. Er trug die Haare zu zwei Zöpfen geflochten. Ein Hopi, dachte Chee. Natürlich. Das musste der Adlerjäger sein, den Kinsman hatte stellen wollen. Das hatte er ja nun geschafft.
»Runter«, blaffte er. »Gesicht nach unten.«
Der junge Mann beugte sich vor und legte sich langsam auf den Boden. Ganz schön gelenkig, dachte Chee. Ein Ärmel seines Hemdes war zerfetzt, und über den rechten Unterarm zog sich eine lang gezogene, klaffende Wunde – ein roter Bogen aus geronnenem Blut auf sonnenverbrannter Haut.
Chee zog die rechte Hand des Mannes auf den Rücken, ließ eine Handschelle über dem Handgelenk zuschnappen und fixierte auch die zweite Hand. Dann griff er ihm in die Gesäßtasche, zog ein abgewetztes Portemonnaie aus braunem Leder hervor und klappte es auf. Von einem in Arizona ausgestellten Führerschein lächelte ihm das Gesicht des jungen Mannes entgegen. Robert Jano Mishongnove, Second Mesa.
Robert Jano rollte sich vorsichtig auf die Seite, holte Schwung mit seinen Beinen und machte Anstalten, aufzustehen.
»Unten bleiben«, befahl Chee. »Robert Jano, Sie haben das Recht zu schweigen. Sie haben das Recht …«
»Wofür verhaften Sie mich?«, fragte Jano. Ein Regentropfen klatschte auf den Felsen neben Chee. Dann noch einer.
»Wegen Mordes«, sagte Chee. »Sie haben das Recht, sich einen Anwalt zu nehmen. Sie haben das Recht …«
»Ich glaube nicht, dass er tot ist!«, sagte Jano. »Als ich hier ankam, hat er jedenfalls noch gelebt.«
»Ja, davon gehe ich aus«, bemerkte Chee sarkastisch.
»Ich habe doch gerade noch seinen Puls gefühlt. Vor höchstens einer halben Minute.«
Chee kniete schon neben Kinsman und legte ihm die Hand an den Hals. Zuerst fiel ihm nur das klebrige Blut auf, doch dann fühlte er den schwachen Puls unter seinen Fingerspitzen und die Wärme von Kinsmans Körper unter seiner Hand.
Chee starrte Jano an. »Du Mistkerl!«, schrie er. »Warum hast du ihm den Schädel eingeschlagen?«
»Das war ich nicht«, sagte Jano. »Ich habe ihn nicht angerührt. Als ich hier hochkam, hat er schon dagelegen.« Er wies mit dem Kopf auf Kinsman. »Genauso wie jetzt.«
»Einen Teufel hat er«, sagte Chee. »Wie kommt’s dann, dass Sie überall mit Blut beschmiert sind? Und woher kommt die Verletzung …«
Ein durchdringender rauer Schrei und metallisches Scheppern hinter ihm unterbrachen ihn. Chee fuhr herum und brachte die Pistole in Anschlag. Dann hörte er ein quäkendes Geräusch hinter dem Felsvorsprung, wo Kinsman lag. Hinter dem Fels lag ein umgestürzter Vogelkäfig. Er war ungewöhnlich groß, aber kaum groß genug, um den wild flatternden Adler darin zu bändigen. Chee griff in den Ring, der oben am Käfig befestigt war, stellte ihn auf eine Sandsteinplatte und starrte Jano herausfordernd an. »Adler gehören zu den bedrohten Arten«, sagte er. »Sie zu wildern ist eine Straftat gegen ein Bundesgesetz. Die Strafen sind nicht so hart wie bei schwerer Körperverletzung eines Polizeibeamten, aber …«
»Vorsicht!«, schrie Jano.
Zu spät. Die Krallen des Adlers hatten schon Chees Hand seitlich aufgerissen.
»Genau dasselbe ist mir auch passiert«, sagte Jano. »Daher kommt das ganze Blut.«
Eisige Regentropfen fielen auf Chees Ohren, Wangen, Schultern und seine blutende Hand. Ein Regenschauer, vermischt mit Hagelkörnern, hüllte sie ein. Chee deckte Kinsman mit seiner Jacke zu und stellte den Käfig unter einen Felsvorsprung. Er musste so schnell wie möglich Hilfe für Kinsman holen und außerdem den Adler in seinem Käfig so unterbringen, dass er vor dem Regen geschützt war. Falls Jano die Wahrheit sagte, was allerdings äußerst unwahrscheinlich war, dann würden sich auch irgendwo an dem Vogel Blutspuren finden lassen. Auf keinen Fall wollte er sich von Janos Verteidiger den Vorwurf anhören, er hätte ein wichtiges Beweismittel vom Regen abwaschen lassen.
3
Die blau-schwarze Limousine, die heute Morgen vor Joe Leaphorns Haus parkte, strahlte in makellosem Glanz, und im polierten Chrom spiegelte sich die Sonne. Leaphorn hatte hinter der Fliegengittertür verstohlen die Ankunft des Wagens beobachtet und inständig gehofft, dass seine Nachbarn in diesem Wohnviertel am Stadtrand von Window Rock nichts bemerkt hatten. Genauso gut hätte er hoffen können, dass den Kindern, die am Ende der Schotterstraße auf dem Schulhof spielten, eine Herde vorbeitrottender Giraffen nicht auffallen würde. Da die Limousine so früh am Morgen hier vorgefahren war, musste der Fahrer, der jetzt geduldig hinter dem Lenkrad saß, wohl gegen drei Uhr früh von Santa Fe aufgebrochen sein. Diese Überlegung brachte Leaphorn ins Grübeln. Wie das Leben wohl aussah, wenn man im Dienst der Superreichen stand? Denn zu denen zählte Millicent Vanders ganz bestimmt.
Nun ja, in ein paar Minuten würde er vielleicht mehr wissen. Der Wagen bog jetzt von der schmalen Asphaltstraße ab, die sich durch die Vorberge im Nordosten von Santa Fe schlängelte, rollte in eine klinkergepflasterte Einfahrt und hielt vor einem kunstvoll geschmiedeten eisernen Tor.
»Sind wir da?«, fragte Leaphorn.
»Ja«, sagte der Chauffeur knapp – genauso knapp, wie er alle Fragen beantwortet hatte, die Leaphorn ihm unterwegs gestellt hatte. Schließlich gab Leaphorn auf, irgendetwas von ihm erfahren zu wollen. Er hatte mit dem üblichen Small Talk begonnen. Wie viel Sprit der Wagen verbrauche, wie er sich denn so fahre und ähnliche Dinge. Dann hatte er sich erkundigt, wie lange der Fahrer schon für Millicent Vanders arbeite. Es waren, wie sich herausstellte, einundzwanzig Jahre. Doch mit allen weiteren Fragen biss er auf Granit.
»Wer ist Mrs Vanders eigentlich?«, hatte Leaphorn wissen wollen.
»Meine Chefin.«
Leaphorn hatte gelacht. »So war meine Frage nicht gemeint.«
»Das dachte ich mir.«
»Wissen Sie etwas über den Job, den sie mir anbieten will?«
»Nein.«
»Aber vielleicht können Sie sich ungefähr denken, worum es sich handelt?«
»Das geht mich nichts an.«
Leaphorn sah ein, dass es zwecklos war. Er sah sich die Landschaft an und stellte fest, dass sich selbst reiche Leute damit zufriedengeben mussten, fast nur Sender mit Country & Western empfangen zu können. Schließlich wählte er KNDN und hörte sich ein Navajo-Call-in-Programm an. Jemand hatte in Farmington an der Bushaltestelle seine Brieftasche verloren und bat den Finder, doch wenigstens Führerschein und Kreditkarte zurückzugeben. Eine Frau lud alle Angehörigen des Bitter Water Clans, des Standing Rock Clans und alle Verwandten und Freunde ein, zu einem yeibichai-sing für Emerson Roanhorse zu kommen, der bei ihm zu Hause, etwas nördlich von Kayenta, stattfinden sollte. Dann teilte ein offenbar schon älterer Mann mit etwas brüchiger Stimme mit, dass Billy Etcittys Rotschimmelstute von ihrer Weide in der Nähe von Burnt Water verschwunden sei, und bat darum, die Augen offen zu halten und ihm Bescheid zu geben, falls man sie irgendwo sah. »Zum Beispiel auf einer Pferdeauktion«, fügte die Stimme hinzu, was darauf schließen ließ, dass Etcitty davon ausging, beim Verschwinden der Stute müsse jemand nachgeholfen haben. Es dauerte nicht lange, und Leaphorn ließ sich einfach in den weichen, einladenden Sitz zurücksinken und döste ein. Als er erwachte, fuhren sie schon auf der Interstate 25 und passierten gerade die ersten Vororte.
Leaphorn fischte Millicent Vanders’ Brief aus seiner Jackentasche und las ihn noch einmal durch.
Millicent Vanders hatte ihn natürlich nicht selbst geschrieben. Der Briefkopf lautete vielmehr »Peabody, Snell & Glick«, gefolgt von den üblichen Kürzeln, mit denen Anwaltskanzleien sich gerne schmücken. Sitz der Kanzlei war Boston. Der Brief war mit FedEx geschickt worden. Eilzustellung/Overnight.
Sehr geehrter Mr Leaphorn,
hiermit bestätige ich unsere telefonische Übereinkunft vom heutigen Tag und fasse sie noch einmal schriftlich zusammen. Ich schreibe Ihnen im Auftrag von Mrs Millicent Vanders. Unsere Kanzlei nimmt in einigen Angelegenheiten die Vertretung ihrer Interessen wahr. Mrs Vanders hat mich beauftragt, einen Ermittler zu finden, der mit den Gegebenheiten im Navajo-Reservat vertraut ist und in Bezug auf Integrität und Umsicht einen untadeligen Ruf genießt.
Sie sind uns als jemand empfohlen worden, der diesen Anforderungen in vollem Umfang entspricht. Meine Frage an Sie lautet deshalb, ob Sie bereit wären, Mrs Vanders in ihrem Sommersitz in Santa Fe aufzusuchen, um gemeinsam herauszufinden, auf welche Art und Weise Sie für Mrs Vanders tätig werden könnten. Lassen Sie mich bitte telefonisch wissen, ob Sie mit einer Zusammenkunft einverstanden sind, damit die nötigen Vorkehrungen getroffen werden können, um Sie mit dem Wagen abholen zu lassen und Ihnen Ihre Auslagen zu erstatten. Ich muss hinzufügen, dass Mrs Vanders bezüglich der infrage stehenden Angelegenheit ein Gefühl der Dringlichkeit zum Ausdruck gebracht hat.
Leaphorns erster Impuls war gewesen, Christopher Peabody eine höfliche Absage im Tenor – »Vielen Dank, doch zu meinem Bedauern muss ich Ihre Anfrage ablehnen« – zu schicken. Darüber hinaus könnte er dem Anwalt empfehlen, sich unter den zugelassenen Privatdetektiven umzusehen, statt einen ehemaligen Polizisten zu kontaktieren.
Aber …
Da war die Tatsache, dass Peabody, sicherlich der Seniorpartner, den Brief selbst unterschrieben hatte, außerdem seine Feststellung, dass er, Leaphorn, den Anforderungen an einen untadeligen Ruf in Bezug auf Integrität und Umsicht in vollem Umfang gerecht werde. Ausschlaggebend aber war für ihn das »Gefühl von Dringlichkeit«, das Mrs Vanders geäußert hatte. Das klang, als könnte die Sache interessant sein, und Leaphorn brauchte endlich wieder etwas, das ihn faszinierte und gefangen nahm. Bald war es ein Jahr her, dass er seinen Dienst bei der Navajo-Police quittiert hatte. Er langweilte sich.
Und so hatte er Mr Peabodys Anruf dann doch erwidert, und nun war er also hier. Auf Knopfdruck des Fahrers glitt das Tor geräuschlos zur Seite, und sie rollten durch eine üppig grüne Parklandschaft auf ein ausladendes zweistöckiges Gebäude zu. Mit seinem lohfarbenen Putz und den ziegelgekrönten Mauern war es ein beeindruckendes Beispiel für das, was man in Santa Fe gemeinhin den Territorial Style nannte, seine imposante Größe legte die Bezeichnung »Herrenhaus« nahe.
Der Fahrer öffnete Leaphorn den Schlag. Zwischen den weit geöffneten Flügeln der gewaltigen Eingangstür stand lächelnd ein junger Mann in Jeans und einem ausgeblichenen blauen Hemd, die blonden Haare zum Pferdeschwanz gebunden. »Mr Leaphorn«, sagte er, »gestatten Sie, dass ich Sie gleich zu Mrs Vanders führe.«
Millicent Vanders erwartete ihn in einem Raum, den man vermutlich als Studierzimmer oder Salon bezeichnen würde – zumindest nach dem, was Leaphorn aus Film und Fernsehen wusste. Mrs Vanders war eine kleine, zerbrechlich wirkende Frau, und sie stand neben einem kleinen, zerbrechlich wirkenden Sekretär. Mit den Fingerspitzen der Linken stützte sie sich leicht auf seiner polierten Oberfläche ab. Ihr Haar war fast weiß, und sie begrüßte ihn mit einem blassen, kleinen Lächeln.
»Mr Leaphorn«, sagte sie, »wie schön, dass Sie kommen konnten, und wie freundlich von Ihnen, dass Sie bereit sind, mir zu helfen.«
Leaphorn, der noch nicht einmal wusste, ob er ihr helfen wollte oder nicht, lächelte einfach ebenso unverbindlich zurück und setzte sich auf den Stuhl, den sie ihm mit einer Handbewegung angeboten hatte.
»Darf ich Ihnen Tee bringen lassen? Oder Kaffee? Oder lieber eine andere Erfrischung? Und soll ich Sie mit Mr Leaphorn ansprechen, oder ziehen Sie ›Lieutenant‹ vor?«
»Kaffee, wenn es keine Mühe macht. Vielen Dank«, sagte Leaphorn. »Und ich werde nur noch mit ›Mister‹ angeredet. Ich habe bei der Navajo-Police meinen Abschied genommen.«
Millicent Vanders sah an ihm vorbei zur Tür. »Kaffee also, und für mich Tee«, sagte sie und nahm mit langsamen, sehr vorsichtigen Bewegungen hinter ihrem Schreibtisch Platz. Leaphorn schloss daraus, dass seine Gastgeberin an einer der vielen Formen von Arthritis leiden musste. Doch wieder lächelte sie – wohl in dem Versuch, ihre Umgebung zu beruhigen. Leaphorn sah die Schmerzen hinter dem Lächeln. In der Zeit, als Leaphorn seine Frau bis zu ihrem Ende begleitet und beobachtet hatte, war er sehr feinfühlig für solche Dinge geworden. Auch Emma hatte nicht zeigen wollen, dass sie litt. Immer wieder hatte sie seine Hand genommen, hatte ihm gesagt, dass er sich keine Sorgen machen solle, hatte behauptet, schmerzfrei zu sein, und ihm versprochen, dass sie bald wieder ganz gesund sein würde.
Mrs Vanders sah in aller Ruhe einige Papiere durch, die sie vor sich auf dem Schreibtisch ausgebreitet hatte, und sortierte sie in einen Aktenordner ein. Das Schweigen zwischen ihnen schien sie nicht zu stören. Leaphorn hatte die Erfahrung gemacht, dass Weiße normalerweise mit Schweigen nicht gut umgehen konnten. Umso mehr wusste er es zu schätzen, wenn ihm Ausnahmen von dieser Regel begegneten. Mrs Vanders nahm aus einem Umschlag zwei Aufnahmen im Format 20 x 25, sah eine davon prüfend an, legte sie in den Aktenordner und betrachtete die zweite. Ein dumpfer Schlag unterbrach die Stille – ein leichtsinniger Blauhäher war gegen die Fensterscheibe geflogen. Torkelnd flatterte er davon. Doch Mrs Vanders hatte nicht einmal aufgesehen. Sie war ganz in das Foto vertieft und schien mit ihren Gedanken weit weg, vermutlich bei Sorgen und Kümmernissen, die sie vor langer Zeit beschäftigt hatten. Weder der Vogel noch die Anwesenheit des fremden Mannes störten sie bei ihrer Gedankenreise. Eine bemerkenswerte Persönlichkeit, dachte Leaphorn.
Unvermittelt tauchte neben ihm eine rundliche junge Frau mit einem Tablett auf. Sie deckte ein kleines Tischchen zu seiner Linken mit Serviette, Tasse, Untertasse und Kaffeelöffel und goss ihm aus einer weißen Porzellankanne Kaffee ein. Dann ging sie zum Schreibtisch, deckte dort ebenfalls auf und schenkte aus einer silbernen Kanne Tee ein. Mrs Vanders unterbrach ihre Betrachtung des Fotos, legte es in den Ordner und reichte ihn der jungen Frau.
»Ella«, sagte sie, »würden Sie den bitte Mr Leaphorn geben?«
Ella nickte, brachte Leaphorn den Aktenordner und verschwand so lautlos, wie sie gekommen war. Er legte den Ordner auf seinen Schoß und nahm einen Schluck Kaffee. Die Tasse war aus durchscheinendem Porzellan, dünn wie Papier. Der Kaffee war heiß, frisch und schmeckte ausgezeichnet.
Mrs Vanders sah ihn prüfend an. »Mr Leaphorn«, begann sie, »ich habe Sie gebeten herzukommen, weil ich hoffe, dass Sie sich bereit erklären, etwas für mich zu tun.«
»Möglicherweise«, antwortete Leaphorn bedächtig. »Wollen Sie mir sagen, worum es sich handelt?«
»Alles muss ganz und gar vertraulich behandelt werden«, fuhr sie fort. »Ich wünsche, dass Sie nur mit mir in Verbindung treten. Nicht mit meinen Anwälten. Nicht mit irgendjemandem sonst.«
Leaphorn dachte darüber nach, was sie gesagt hatte, nahm noch einen Schluck Kaffee und setzte dann langsam die Tasse ab. »Unter dieser Bedingung kann ich vermutlich nicht für Sie tätig werden.«
Mrs Vanders sah ihn überrascht an. »Warum nicht?«
»Ich bin den größten Teil meines Lebens Polizist gewesen«, antwortete Leaphorn. »Wenn ich bei dem, was ich für Sie tun soll, auf irgendetwas Ungesetzliches stoße, dann …«
»Wenn das geschähe, würde ich selbstverständlich die zuständigen Behörden davon in Kenntnis setzen«, sagte sie kühl.
Wie für einen Navajo üblich, wartete Leaphorn zunächst eine Weile schweigend ab, um sicher zu sein, dass sie alles gesagt hatte, was sie sagen wollte. Offenbar hatte sie ihm mitgeteilt, was ihr wichtig war, doch Leaphorns ruhiges Abwarten schien sie verunsichert zu haben.
»Natürlich würde ich das«, bekräftigte sie noch einmal. »Selbstverständlich.«
»Aber für den Fall, dass Sie es aus irgendeinem Grund doch unterlassen sollten, möchte ich Ihnen schon jetzt sagen, dass ich es dann tun müsste. Wären Sie damit einverstanden?«
Sie sah Leaphorn eine Weile konzentriert an, dann nickte sie. »Ich denke, wir sehen Probleme, wo gar keine sind.«
»Wahrscheinlich«, stimmte Leaphorn zu.
»Ich möchte, dass Sie für mich den Aufenthaltsort einer jungen Frau herausfinden. Oder, falls das nicht möglich ist, dass Sie in Erfahrung bringen, was mit ihr geschehen ist.«
Sie deutete mit einer Handbewegung auf den Aktenordner. Leaphorn öffnete ihn. Obenauf lag eine Studioaufnahme, das Porträt einer dunkeläugigen, dunkelhaarigen jungen Frau mit einem Doktorhut auf dem Kopf, in Universitätskreisen »Mörtelbrett« genannt. Ihr Gesicht war schmal und intelligent, der Gesichtsausdruck ernst. Kein Gesicht, das man als niedlich bezeichnet hätte, überlegte Leaphorn. Und wohl auch nicht hübsch, wenn er es recht bedachte. Vielleicht gut aussehend. Ausdrucksvoll. Auf jeden Fall ein Gesicht, das man nicht vergaß.
Die zweite Aufnahme zeigte dieselbe junge Frau, aber diesmal in einem Jeansanzug. Sie lehnte an der Tür eines Pick-ups und sah über ihre Schulter in die Kamera. Sie sah sportlich aus, dachte Leaphorn, durchtrainiert, und sie schien auf diesem Bild älter zu sein als auf dem ersten Foto. Er schätzte sie auf Anfang dreißig. Auf der Rückseite beider Bilder stand derselbe Name: Catherine Anne.
Leaphorn sah Mrs Vanders fragend an.
»Meine Nichte«, erklärte sie, »das einzige Kind meiner verstorbenen Schwester.«
Leaphorn legte die Aufnahmen in den Aktenordner zurück und nahm ein paar zusammengeheftete Blätter heraus. Auf dem obersten standen biografische Angaben zu Catherine.
Ihr voller Name lautete Catherine Anne Pollard. Sie war dreiunddreißig Jahre alt, geboren in Arlington, Virginia. Ihr derzeitiger Wohnsitz war Flagstaff, Arizona.
»Catherine hat Biologie studiert und sich auf Säugetiere und Insekten spezialisiert«, sagte Mrs Vanders. »Sie hat für den Indian Health Service gearbeitet, aber ich glaube, dass sie eigentlich für das Arizona Health Department arbeitet, für die Umwelt-Abteilung. Sie ist eine sogenannte Vector Control Spezialistin, sie bekämpft Seuchenüberträger. Ich nehme an, Sie wissen, was damit gemeint ist?«
Leaphorn nickte.
»Sie sagt, man nennt sie Flohfänger«, sagte Mrs Vanders mit säuerlicher Miene. »Ich glaube, sie hätte als Tennisspielerin Karriere machen können, an all den großen Grand-Slam-Turnieren teilnehmen können. Catherine war immer eine begeisterte Sportlerin, besonders Soccer. Und während ihrer Collegezeit hat sie in der Volleyballmannschaft gespielt. Ganz früher, als sie noch zur Junior Highschool ging, hat sie sehr darunter gelitten, dass sie ein Stück größer war als die anderen Mädchen. Ich habe oft gedacht, dass ihr sportlicher Ehrgeiz vielleicht ein Versuch war, diesen ›Makel‹ wettzumachen.«
Leaphorn nickte wieder.
»Als sie mich das erste Mal besucht hat, nachdem sie gerade ihre Stelle angetreten hatte, fragte ich sie, wie man ihre Tätigkeit denn nenne, und sie antwortete einfach, wir heißen bei den Leuten ›Flohfänger‹.« Mrs Vanders sah ihn traurig an. »Sie hat sich selbst so genannt, also nehme ich an, dass es ihr nichts ausmacht.«
»Das ist eine wichtige Arbeit«, sagte Leaphorn.
»Sie wollte schon immer als Biologin arbeiten, aber wieso musste sie ausgerechnet ›Flohfängerin‹ werden?« Mrs Vanders schüttelte den Kopf. »Soviel ich weiß, arbeiteten sie und ein paar Kollegen gerade daran, die Auslöser für die Beulenpestfälle in diesem Frühjahr herauszufinden. Sie haben ein kleines Labor in Tuba City und untersuchen jede Stelle und jeden Fleck, wo die Pestopfer sich angesteckt haben könnten. Dort stellen sie Fallen auf, um Nagetiere zu fangen.« Mrs Vanders hielt inne, an ihrem Gesicht war abzulesen, wie sehr sie sich ekelte. »Von den gefangenen Tieren sammeln sie dann die Flöhe ab, daher der Name ›Flohfänger‹. Und sie nehmen Blutproben.« Sie machte eine ungeduldige Handbewegung. »So ähnlich hat es mir meine Nichte jedenfalls erklärt. Vergangene Woche ist sie wie gewöhnlich frühmorgens aufgebrochen, aber nicht wieder zurückgekehrt.«
Sie sah Leaphorn schweigend an.
»Ist sie allein weggefahren?«
Mrs Vanders nickte. »So wurde es mir gesagt. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es wirklich stimmt.«
Leaphorn äußerte sich nicht weiter dazu. Erst einmal brauchte er Tatsachen, mit Vermutungen würde er sich später beschäftigen.
»Und wohin ist sie aufgebrochen?«
»Der Mann, mit dem ich am Telefon gesprochen habe, sagte mir, sie sei nur kurz ins Büro gekommen, um Ausrüstung abzuholen, die sie für ihre Arbeit braucht, und sei dann weggefahren. Irgendwohin draußen auf dem Land, wo sie Nagetiere fangen wollte.«
»Hat sie sich dort, wo sie arbeiten wollte, mit irgendjemandem verabredet?«