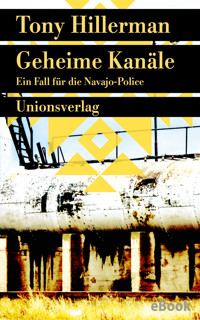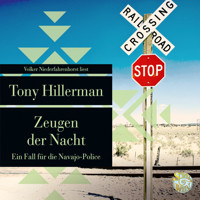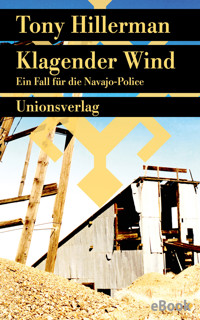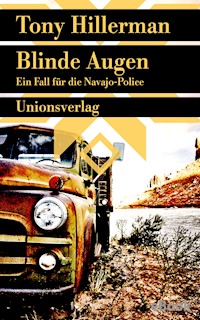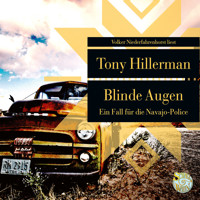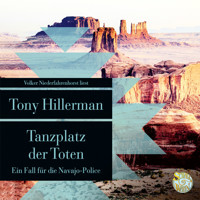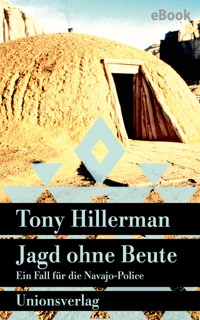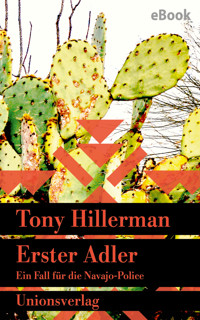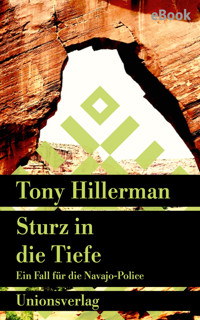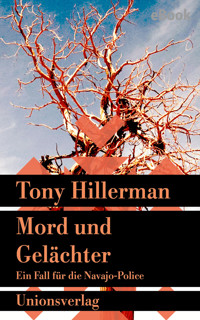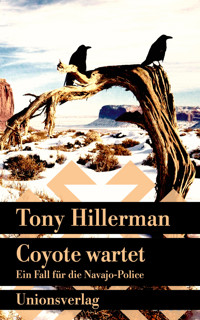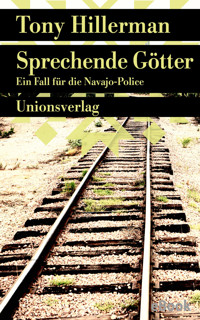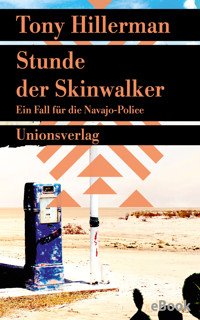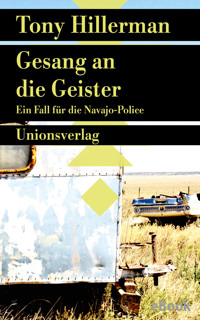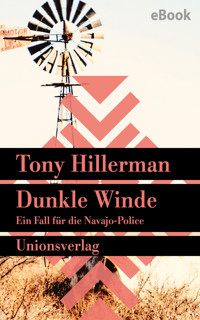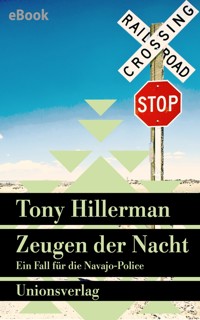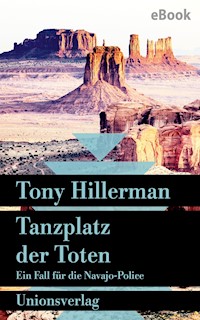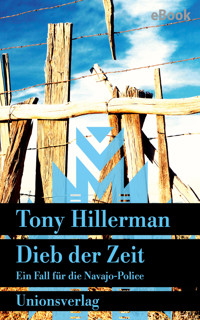
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Unzählige Fundstätten uralter Anasazi-Siedlungen überziehen das Colorado Plateau, staubige Zeugnisse einer untergegangenen Zivilisation. Die Anthropologin Eleanor Friedman-Bernal wähnt sich in ihrer Forschung kurz vor einem bedeutenden Durchbruch, als sie eine unheilvolle Entdeckung macht: Eine der Grabstätten wurde geplündert und ein grausiges Zeichen hinterlassen. Kurz darauf wird die Wissenschaftlerin als vermisst gemeldet. Auf der Suche nach einem Anhaltspunkt beginnt Lieutenant Joe Leaphorn, dem Verbleib der wertvollen Anasazi-Artefakte nachzuspüren. Als Officer Jim Chee in einer weiteren Ausgrabungsstätte auf zwei Leichen stößt, stellt sich die Frage: Haben es die beiden Ermittler der Navajo-Police mit einem skrupellosen Dieb zu tun – einem Dieb, der die Vergangenheit stiehlt?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch
In einer antiken Ausgrabungsstätte der Anasazi macht eine Anthropologin eine unheilvolle Entdeckung: Jemand hat die Stätte geplündert und ein grausiges Zeichen hinterlassen. Kurz darauf wird die Wissenschaftlerin als vermisst gemeldet. Ermitteln Joe Leaphorn und Jim Chee gemeinsam gegen einen Dieb, der die Vergangenheit stiehlt?
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tony Hillerman (1925-2008) besuchte ein Internat für Native Americans, kämpfte im Zweiten Weltkrieg, studierte Journalismus und war als Journalist und Dozent tätig. Seine Romane um die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee wurden vielfach ausgezeichnet und in siebzehn Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Tony Hillerman.
Klaus Fröba (*1934) ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Übersetzer, er veröffentlichte Jugendbücher und Kriminalromane. Er übersetzte aus dem Englischen, u. a. Werke von Jeffrey Deaver, Ira Levin, Tony Hillerman und Douglas Preston. Fröba lebt in der Nähe von Bonn.
Zur Webseite von Klaus Fröba.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tony Hillerman
Dieb der Zeit. Verfilmt als Serie »Dark Winds – Der Wind des Bösen«.
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Klaus Fröba
Ein Fall für die Navajo-Police (7)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Worterklärungen und Hintergrundinformationen zu diesem Buch auf https://ehillerman.unm.edu/encyclopedia-main
Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Andreas Heckmann nach dem Original durchgesehen und grundlegend überarbeitet.
Die Originalausgabe erschien 1988 bei Harper & Row, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1990 unter dem Titel Wer die Vergangenheit stiehlt im Rowohlt Verlag, Reinbek.
Originaltitel: A Thief of Time
© by Anthony G. Hillerman 1988
Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Klaus Fröba beim Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hintergrund – Agefotostock (Alamy Stock Photo); Symbol – Tetiana Lazunova (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31165-7
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 02.03.2024, 13:30h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIEB DER ZEIT. VERFILMT ALS SERIE »DARK WINDS – DER WIND DES BÖSEN«.
Vorbemerkung des Autors1 – Der Mond war über den Klippen aufgegangen …2 – Eleanor Friedman Bindestrich Bernal.« Thatcher trennte die Worte …3 – Für Officer Jim Chee von der Navajo-Police war …4 – An diesem trockenen Samstag im Herbst wurde es …5 – Junge, wenn es dir schwerfällt, bergauf zu gehen« …6 – Es war lange nach Mitternacht, als Leaphorn zu …7 – Jim Chee saß auf der Bettkante, rieb sich …8 – Die ganze Nacht hatte ein heftiger Südostwind geweht …9 – Ungefähr so hat der Lastwagen gestanden.« Chee schaltete …10 – Nicht einmal fünfundzwanzig Meilen wären es von der …11 – Fast sein ganzes Leben lang, schon mit höchstens …12 – In New York regnete es. L. G …13 – Reverend Slick Nakai aufzuspüren, war nicht so einfach …14 – Zwar hatte Leaphorn beim Umsteigen auf dem Flughafen …15 – Die junge Frau, mit der Chee bei der …16 – Von dem Sattel hatte Leaphorn sich einiges versprochen …17 – Wenn der Herbst geht und der Winter kommt …18 – Eleanor Friedman-Bernals Kajak zu finden, stellte Leaphorn sich …19 – Harrison Houks letzte Nachricht für Leaphorn erwies sich …Mehr über dieses Buch
Über Tony Hillerman
»Der Angst vor seinem Pferd hat«
Claus Biegert: Die Navajo-Romane — ein Fall von Kultureller Wertschätzung
Über Klaus Fröba
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tony Hillerman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema USA
Für Steven Lovato,den erstgeborenen Sohn von Larry und Mary Lovato.Ich wünsche ihm ein Leben in Harmonie mit allem,was ihn umgibt.
Vorbemerkung des Autors
Die Personen in diesem Buch sind frei erfunden. Aber es stimmt, dass Drayton und Noi Vaughn jeden Morgen achtzig Meilen weit mit dem Schulbus fahren müssen. Nur sind die beiden natürlich in Wirklichkeit viel großartigere Kinder als die, die ich in meinem Buch schildere.
Die meisten Schauplätze dieses Romans habe ich wirklichkeitsgetreu geschildert. Der Name Many Ruins Canyon aber ist erfunden, und seine Lage ist absichtlich irreführend beschrieben, um die Felswohnungen vor Plünderung und Verwüstung zu schützen.
Besonders danken möchte ich Dan Murphy vom U. S. Park Service, der mich auf die Ruinen am Flusslauf des San Juan River aufmerksam gemacht hat; Charley und Susan DeLorme und all den anderen begeisterten Wildwasserfahrern, Kenneth Tsosie vom White Horse Lake, Ernie Bulow und Tom und Jan Vaughn und ihrer Familie im Chaco Culture National Historical Park.
1
Der Mond war über den Klippen aufgegangen. Sein fahles Licht fiel auf die Gestalt im trockenen Flusslauf, malte überlebensgroße, bizarre Formen auf den festen Sandboden. Bald ließ der Schatten den Umriss eines Reihers erahnen, bald sah er schmächtig und dünnbeinig aus wie die Strichzeichnungen auf den Felsmalereien der Anasazi. Manchmal, wenn der Ziegenpfad einen Bogen schlug und die Gestalt ihr Profil dem Mondlicht zuwandte, verwandelte sich ihr Schatten in Kokopelli. Der Rucksack wurde im Schattenspiel zum Buckel des Geistes, der Wanderstock war Kokopellis gekrümmte Flöte. Hätte in solchen Augenblicken ein Navajo von oben, von den Bergen aus, auf die Szene geblickt, wäre die Gestalt ihm wie der große yei erschienen, den sie in den Clans des Nordens Watersprinkler nannten. Und genauso hätte ein Anasazi ihn sehen müssen, als den Buckligen Flötenspieler, den gewalttätigen Raufbold, den sein verschwundenes Volk als Gott der Fruchtbarkeit verehrt hatte. Aber ein Anasazi konnte ihn nicht sehen, es sei denn, er wäre nach tausend Jahren Grabesruhe aus den Schutthalden unter den Ruinen der Felsenwohnungen auferstanden. Das Schattenbild aber war nur der Umriss von Dr. Eleanor Friedman-Bernal im Licht des Oktobermondes.
Jetzt legte sie eine Pause ein, setzte sich auf einen geeigneten Felsblock, nahm den Rucksack ab, massierte sich die Schultern, ließ sich von der kalten Luft der Bergwüste das verschwitzte T-Shirt trocknen und dachte über den langen Tag nach, der hinter ihr lag.
Niemand konnte sie gesehen haben. Sicher, als sie aus Chaco weggefahren war, hatten die Kinder sie bemerkt, die schon vor Tau und Tag auf den Beinen sein mussten, weil der Schulbus so früh fuhr. Und die Kinder hatten es bestimmt ihren Eltern erzählt. In der isolierten Welt des Park Service, in der ein Dutzend Erwachsene und zwei Kinder auf engem Raum lebten, sprach sich eben alles herum. Völlig ausgeschlossen, sich dort so etwas wie eine Privatsphäre zu bewahren.
Aber sie hatte alles gründlich vorbereitet. Sie war von Haus zu Haus gegangen und hatte dafür gesorgt, dass im Grabungsteam alle Bescheid wussten. Sie wollte nach Farmington fahren, hatte sie gesagt und sich die Post für die Sammelstelle am Handelsposten Blanco mitgeben lassen. Und sie hatte sich alles aufgeschrieben, was die Leute brauchten. Zu Maxie hatte sie gesagt, sie habe das Chaco-Fieber, müsse einfach mal weg, ins Kino, abends in einem Restaurant essen, Abgase riechen, andere Stimmen hören, zum Telefon greifen in der Gewissheit, dass es auch funktionierte, und anrufen, wo die Zivilisation zu Hause war. Einfach mal eine Nacht woanders schlafen, an einem Ort, an dem nichts an die eintönige Stille von Chaco erinnerte. Maxie konnte das gut verstehen. Falls sie sich überhaupt etwas dabei dachte, dann nur, dass Dr. Eleanor Friedman-Bernal sich wahrscheinlich mit Lehman träfe. Und das sollte Maxie ruhig denken.
Der Griff des Klappspatens, den sie am Rucksack befestigt hatte, drückte schmerzhaft. Sie blieb stehen, rückte das Tragegestell zurecht und zurrte die Gurte anders fest. Ab und an zerriss der Schrei eines Sägekauzes, der oben im Cañon Jagd auf Nagetiere machte, die Stille der Nacht. Eleanor sah auf ihre Armbanduhr. 10.11 Uhr, nein, 10.12 Uhr. Sie hatte Zeit genug.
In Bluff hatte niemand sie gesehen, dessen war sie sich sicher. Sie hatte von Shiprock aus angerufen, um sich zu vergewissern, dass niemand sich in Bo Arnolds altem Haus draußen am Highway aufhielt. Das Telefon war nicht abgenommen worden, und als sie ankam, lag das Haus im Dunkeln. Sie hatte kein Licht gemacht, nur unter dem Blumenkasten nach dem Schlüssel getastet, Bo versteckte ihn immer dort. Dann hatte sie sich genommen, was sie brauchte. Sie war sehr vorsichtig zu Werke gegangen, hatte nichts durcheinandergebracht. Später würde sie es zurückbringen, und Bo würde nie auf die Idee kommen, dass es weg gewesen war.
Nicht, dass das besonders wichtig gewesen wäre. Bo war Biologe. Seinen Lebensunterhalt verdiente er als Teilzeitbeschäftigter des Bureau of Land Management und verbrachte seine übrige Zeit damit, eine Dissertation zu schreiben – über Flechten in Wüstengebieten oder so. Schon in Madison hatte er nur seine Flechten im Kopf gehabt, und hier war es nicht anders.
Sie gähnte, reckte sich, langte nach dem Rucksack und beschloss, lieber noch ein wenig auszuruhen. Seit neunzehn Stunden war sie auf den Beinen, und ungefähr zwei Stunden lagen bis zum Ziel noch vor ihr. Dort würde sie den Schlafsack ausrollen und erst wieder herauskriechen, wenn sie sich erholt hätte. Jetzt musste sie sich nicht mehr beeilen.
Sie dachte an Lehman. Ein Koloss. Hässlich. Schlau. Grauhaarig. Sexy. Lehman kam sie bald besuchen. Sie würde ihm ein gutes Essen und guten Wein vorsetzen und ihm zeigen, was sie hatte. Das musste Eindruck auf ihn machen, es konnte nicht anders sein. Er würde zugeben müssen, dass sie recht gehabt hatte. Sie war nicht darauf angewiesen, jedenfalls nicht für die Veröffentlichung. Aber aus anderen Gründen legte sie Wert darauf. Sie brauchte seine Anerkennung. Was eigentlich ein Widerspruch in sich war. Und während sie das feststellte, musste sie an Maxie denken. An Maxie und Elliot.
Sie lächelte und strich sich übers Gesicht. Es war still hier, nur ein paar Insekten summten. Kein Windhauch war zu spüren. Kalte Luft sank in den Cañon. Fröstelnd griff Eleanor nach dem Rucksack und schlüpfte in die Trageriemen. Das heisere Bellen eines Kojoten, weit entfernt, am Berghang über dem Comb Wash. Dann stimmte ein zweiter ein; auf der anderen Seite des Cañons, noch weiter weg, heulte er den Mond an.
Sie ging rasch auf dem festen Sandboden, hob bei jedem Schritt die Beine, um die Muskeln zu lockern, und zwang sich, nicht an das zu denken, was sie heute Nacht vorhatte. Sie hatte lange genug darüber nachgedacht. Vielleicht zu lange. Stattdessen dachte sie wieder an Maxie und Elliot. Kluge Köpfe, alle beide. Und trotzdem Narren. Der Sohn aus gutem Haus und die Aufsteigerin. Ein Mann, dem alles gelang, was er anfasste. Und der besessen war von einer Frau, die ihm sagte, was immer er anfasse, zähle nichts. Armer Elliot! Dieses Spiel konnte er nicht gewinnen.
Am östlichen Horizont zuckte ein Blitz – weit weg, den Donner hörte man nicht, und aus einer Richtung, aus der kein Regen drohte. Der Sommer bringt sich ein letztes Mal in Erinnerung, dachte sie. Der Mond hing jetzt höher, sein bleiches Licht dimmte die Farben des Cañons zu verschiedenen Grautönen herunter. Die Thermounterwäsche und das schnelle Gehen hielten sie warm, doch ihre Hände waren eiskalt. Sie musterte sie. Nicht gerade die Hände einer Dame. Stumpfe, abgebrochene Fingernägel. Raue Haut, narbig, schwielig. Von Anthropologenhaut hatten sie im Studium gesprochen. So wird die Haut, wenn man dauernd draußen in der Sonne ist und mit den Händen im Boden wühlt. Ihre Mutter hatte sich immer darüber aufgeregt – genau wie über alles andere an ihr. Dass Eleanor Anthropologin wurde und nicht Ärztin. Und keinen Arzt heiratete. Nein, ein Archäologe musste es sein. Aus Puerto Rico. Und nicht mal ein Jude. Den sie dann an eine andere Frau verloren hatte.
»Zieh um Himmels willen Handschuhe an, Ellie«, hatte ihre Mutter gepredigt, »du hast ja die Hände einer Bäuerin.« Und obendrein ein Bauerngesicht, hatte Eleanor gedacht.
Der Cañon war so, wie sie ihn in Erinnerung hatte, von jenem Sommer, in dem sie beim Vermessen und Kartografieren geholfen hatte. Eine Fundgrube für alle, die sich für Felszeichnungen begeisterten. Gleich drüben hinter den Pappeln, an der steilen Sandsteinwand vor dem scharfen Knick, gab es eine Menge davon. Die Wand hieß Baseball Gallery, wegen der dominierenden Gestalt eines Schamanen. Jemand war auf die Idee gekommen, er sehe aus wie die Karikatur eines Baseballschiedsrichters.
Das Mondlicht fiel nur auf einen Teil der Sandsteinwand und war so schwach, dass man kaum etwas erkennen konnte. Trotzdem blieb sie stehen und betrachtete die Malereien. Im diffusen Licht wirkte die breitschultrige, nach unten verjüngte Gestalt des mystischen Schamanen der Anasazi farblos und düster. Über ihm befanden sich tanzende Figuren, Strichzeichnungen, abstrahiert: Kokopelli, der nirgendwo fehlen durfte, unter der Last seines Buckels gebeugt, die Flöte beinahe bis zum Boden gesenkt; ein fliegender Reiher; ein stehender Reiher; eine farbige, im Zickzack verlaufende Linie, die eine Schlange darstellte. Dann entdeckte sie das Pferd.
Ein gutes Stück links von dem großen Baseballschamanen war es auf die Felswand gemalt, schwer zu erkennen, weil das Mondlicht diesen Teil kaum beleuchtete. Offensichtlich eine spätere Zeichnung von einem Navajo, denn die Anasazi waren, als die ersten Spanier auf ihren Pferden auftauchten, schon seit dreihundert Jahren verschwunden. Es war ein stilisiertes Pferd mit plumpem Rumpf und steifen Beinen, keine Zeichnung nach Art der Navajo, die sich stets bemühten, in allen Abbildungen Schönheit und Harmonie widerzuspiegeln. Der Reiter sollte wohl Kokopelli sein, den die Navajo Watersprinkler nannten – er schien jedenfalls auf einer Flöte zu spielen. War das Bild früher schon da gewesen? Sie konnte sich nicht daran erinnern. Es kam vor, dass die Navajo Felszeichnungen der Anasazi durch eigene Darstellungen ergänzten, aber diese hier gab ihr Rätsel auf.
Dann entdeckte sie an dreien der vier Pferdebeine jeweils eine winzige liegende Figur, bestehend aus einem Kopf in Form eines Kreises und einem davon getrennten Körper. Und jeder der drei Gestalten fehlte ein Bein.
Krank. Und diese drei waren vier Jahre zuvor noch nicht da gewesen. Daran hätte sie sich erinnert.
Nun erst wurde sich Eleanor Friedman-Bernal der Dunkelheit bewusst, der Stille, der Abgeschiedenheit. Sie hatte, während sie vor der Felswand rastete, den Rucksack abgenommen. Jetzt hob sie ihn rasch auf und war schon mit einem Arm in den Tragegurt geschlüpft, als ihr etwas einfiel. Sie zog den Reißverschluss der Seitentasche auf und nahm die Pistole heraus, ein handliches .25er Kaliber, Automatik. Im Waffengeschäft hatten sie ihr gezeigt, wie man sie lud, entsicherte, hielt. Eine belgische Waffe, hatten sie ihr gesagt, einfach zu bedienen, zielgenau. Was sie ihr nicht gesagt hatten: Die Munition war schwer zu bekommen, weil sie unüblich war.
In Madison hatte sie die Waffe nie ausprobiert. Sie hatte dort einfach keinen geeigneten Ort für Schießübungen gefunden. Aber als sie nach New Mexico kam, war sie am ersten Tag, an dem starker Wind den Schall verwehte, ins menschenleere Land Richtung Crownpoint gefahren und hatte zu üben begonnen. Sie hatte die Waffe auf Felsbrocken abgefeuert, auf Totholz und auf Schatten im Sand. So lange und so oft, bis ihr die Pistole geschmeidig und vertraut in der Hand lag und sie die anvisierten Ziele traf – oder jedenfalls beinahe traf. Als die Schachtel mit den Patronen leer war, hatte sich herausgestellt, dass das Sportgeschäft in Farmington keine passende Munition führte. Nicht mal in Albuquerque konnte sie die Patronen auftreiben. Schließlich hatte sie sie aus einem Katalog bestellen müssen. Siebzehn Patronen waren noch übrig, sechs davon hatte sie dabei, ein gefülltes Magazin. Jetzt lag die Pistole kalt in ihrer Hand. Kalt, hart und beruhigend.
Sie steckte die Waffe in die Jackentasche. Als sie auf dem sandigen Boden des trockenen Flusslaufs weiterging, spürte sie den Druck des Metalls an der Hüfte. Die Kojoten waren jetzt näher, zwei mussten da oben herumstreichen, auf der Hochebene hinter den Felsklippen. Eine leichte Brise war aufgekommen, von Zeit zu Zeit hörte sie den Wind im Gebüsch neben dem Flussbett. Er raschelte in den Blättern der Ölweiden und flüsterte im flaumigen Grün der Tamarisken. Aber meist war es still. In Vertiefungen des Felsbodens standen Pfützen und größere Lachen, nach den schweren Regenfällen des Sommers war das Wasser dort zusammengelaufen. Viel davon war schon verdunstet. Aber bisweilen hörte sie noch Frösche quaken, Grillen zirpen und Insekten summen. Und dann war da ein klickendes Geräusch in der Dunkelheit. Hinten, wo Steppenläufergras sich in einem Felswinkel verfangen hatte. Und da war noch ein Geräusch, ein leises Pfeifen. Ein Nachtvogel?
Der Cañon schlug einen Bogen, der trockene Flusslauf führte aus dem Mondlicht ins Dunkel. Sie schaltete die Taschenlampe ein. Dass jemand den Lichtschein sehen könnte, musste sie nicht befürchten. Wie weit mochte der nächste Mensch entfernt sein? Luftlinie vielleicht fünfzehn bis zwanzig Meilen. Und es war nicht leicht, hierherzukommen. Durch eine Landschaft, in der es fast nur Fels und Geröll gibt, baut man keine Straßen, wozu auch? Warum waren die Anasazi eigentlich hergezogen? Es gab keinen vernünftigen Grund, es sei denn, sie hätten vor einer Bedrohung Zuflucht gesucht. Die Anthropologen wussten keine Antwort darauf, nicht einmal die Kulturanthropologen, die sonst immer gleich mit einer Theorie zur Hand waren, ohne sich groß um ihre Beweisbarkeit zu scheren. Aber gekommen waren die Anasazi. Und mit ihnen ihre Künstlerin, die den Chaco Canyon verlassen hatte, um hier weitere Keramiken zu schaffen und zu sterben.
Dr. Friedman-Bernal brauchte nur hochzuschauen, dann sah sie rechter Hand, auf halber Höhe der zerklüfteten Steilwand, eine der Ruinen. Und bei Tageslicht, erinnerte sie sich, hätte sie von hier aus noch zwei andere sehen können – drüben, auf der linken Seite, in der Felsbucht, in der die Klippen wie die Stufen eines Amphitheaters übereinander gereiht waren. Jetzt aber lag die Felsbucht wie ein riesiges, gähnendes Maul im Dunkel.
Sie hörte quiekendes Pfeifen. Fledermäuse. Kurz nach Sonnenuntergang hatte sie ein paar davon gesehen. Hier waren ganze Schwärme unterwegs und flatterten über den Felsvertiefungen, in denen sich das Wasser gesammelt hatte, das wiederum Brutstätte von Insekten war. Bis zu ihr zogen die Fledermäuse ihre Kreise, strichen dicht vor ihrem Gesicht vorbei, streiften fast ihr Haar. Während sie dem aufgeregten Geflatter zusah, achtete sie nicht auf den Weg.
Ein Stein gab unter ihrem Fuß nach. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte hart und ungelenk, ihre gewohnte Körperbeherrschung ließ sie im Stich, der Rucksack war schuld daran. Sie schlug mit der rechten Hand auf, mit der Hüfte, dem Ellbogen. Dann lag sie im ausgetrockneten Flussbett auf dem Rücken, verletzt, aufgewühlt und tief erschrocken.
Der Ellbogen schmerzte am heftigsten. Er war über den Sandstein geschrammt, das T-Shirt war aufgerissen, die Haut aufgeschürft. Vorsichtig tastete sie danach und fühlte Blut. An der Hüfte spürte sie nur einen dumpfen Schmerz, aber sie ahnte, dass ihr die Prellung noch genug Ärger machen würde. Erst als sie sich aufgerappelt hatte, merkte sie, dass sie sich in die Handfläche geschnitten hatte. Sie leuchtete mit der Taschenlampe auf die Wunde, schnalzte und setzte sich, um die Verletzung zu behandeln. So gut sie konnte, las sie den Steingrieß aus der Wunde, spülte sie mit Wasser aus der Trinkflasche und verband sie mit einem Taschentuch. Um den Knoten festzuziehen, nahm sie die Zähne zu Hilfe. Dann ging sie den trockenen Flusslauf weiter aufwärts, achtete nun aber besser auf den Weg. Sie ließ die Fledermäuse hinter sich, folgte dem nächsten Knick des Cañon zurück in den vollen Schein des Mondlichts und dem übernächsten wieder ins Dunkel. Dann kletterte sie eine Abflachung in der Uferböschung hinauf und setzte ihr Gepäck ab. Diesen Platz kannte sie. Eduardo Bernal und sie hatten hier vor fünf Sommern ihr Zelt aufgeschlagen, Doktoranden beide, Teil des Vermessungsteams und frisch verliebt. Eddie Bernal. Der zähe kleine Eddie. Eine Menge Spaß hatten sie miteinander gehabt, solange es gut gegangen war. Aber es war nicht lange gut gegangen. Nicht mal bis Weihnachten. Und als sie den Schlussstrich zog, nahm Ed das kaum zur Kenntnis. Höchstens, dass er erleichtert aufseufzte über das Ende jener kurzen Phase, in der er geglaubt hatte, eine Frau könne ihm genügen.
Sie schob ein paar Steine und dürres Holz beiseite, strich mit den Stiefelsohlen den Boden glatt, grub da, wo ihre Hüften liegen sollten, eine kleine Kuhle und rollte den Schlafsack aus. Und zwar an der gleichen Stelle, an der sie mit Eddie gelegen hatte. Weshalb? Ein bisschen aus Trotz, ein bisschen aus Sentimentalität und auch, weil es der geeignetste Platz war. Am nächsten Tag wartete harte Arbeit auf sie. Und mit ihrer verletzten rechten Hand würde das Graben schwer und schmerzvoll werden. Aber sie konnte noch nicht schlafen. Sie war zu angespannt, zu besorgt.
Erst als sie im Dunkeln neben dem Schlafsack stand, fiel ihr auf, wie viele Sterne am Himmel glitzerten. Sie hielt nach den Gestirnen des Herbstes Ausschau, fand den Polarstern, bestimmte nach seinem Stand die Nordrichtung. Dann starrte sie über das trockene Flussbett in die Dunkelheit, deren Grauschwarz verbarg, was Eddie und sie Hühnerstall genannt hatten. In einem schmalen Felskamin hatten Anasazi-Familien eine zweistöckige Behausung errichtet, so groß und geräumig, dass an die dreißig Menschen dort untergekommen sein mochten. Und darüber, in einem anderen Felskamin, hatten sich die Anasazi eine kleine Fluchtburg gebaut. Sie lag so versteckt, dass sie beide sie nur entdeckt hatten, weil Eddie eines Abends ein Schwarm Fledermäuse aufgefallen war, der dort herausstob. Das Felsennest war nur nach einer waghalsigen Kletterpartie zu erreichen, bei der wenige Vorsprünge im Gestein ausreichen mussten, um den Händen Halt und den Füßen spärliche Stütze zu geben. Bei den unteren Felswohnungen hatte Eleanor Friedman-Bernal damals die seltsamen Tonscherben entdeckt. Dort wollte sie tags darauf zu graben beginnen, sobald es hell genug war. Was eine glatte Verletzung des Navajo-Rechts, der Bundesgesetze und ihres Berufsethos darstellte. Zumal sie inzwischen nicht mehr nur auf ihr Gedächtnis angewiesen war, sondern sogar Beweisstücke besaß.
Sie konnte nicht bis zum Morgengrauen warten. Jetzt nicht mehr. Nicht, nachdem sie endlich da war. Das Licht ihrer Taschenlampe musste genügen.
Ihr Erinnerungsvermögen erwies sich als ausgezeichnet. Auf Anhieb fand sie den Aufstieg, der, ohne ihr besondere Anstrengungen abzuverlangen, zur Geröllhalde hinauf und weiter auf den schmalen Steinpfad führte, am Rand der oberen Felsklippen entlang. Auch die Felszeichnungen entsprachen genau dem Bild, das sich in ihr Gedächtnis eingegraben hatte. Die Spirale – vielleicht sollte sie sipapu darstellen, den Aufstieg der Menschen aus dem Schoß von Mutter Erde? Die zu einer langen Linie gereihten Punkte – markierten sie die Stationen auf der Wanderschaft des Clans? Viele breitschultrige Gestalten – nach der Deutung der Ethnologen: Kachinas. Und auch hier war wieder eine halb von einem rot gesprenkelten Schild verdeckte Gestalt ins dunkle Wüstengestein geschnitten, die den Körper eines Menschen besaß, aber die Füße und den Kopf eines Reihers. Big Chief hatte Eddie dieses Bild genannt, das Eleanor – zusammen mit der Abbildung Kokopellis – für die schönste Felszeichnung hielt. Und es war eine so rätselhafte Darstellung, dass selbst die Kulturanthropologen keinen Deutungsversuch wagten.
Kokopelli sah im Grunde stets gleich aus, wo immer man sein Bild fand. Und man fand es überall, es fehlte an keinem Ort, an dem dieses verschwundene Volk seine Geister in die Felsklippen geritzt oder auf Steinwände gemalt hatte. Der mächtige, durch einen Buckel beschwerte Rumpf ruhte auf Strichbeinen. Ebenso schmächtige Arme hielten die Flöte, die oft nicht mehr als eine gerade Linie zwischen den Armen und dem winzigen runden Kopf war. Es gab nur unwesentliche Variationen, mal war die Flöte nach oben gerichtet, mal nach unten auf eine imaginäre Bodenlinie, aber sonst erschien die Gestalt bei aller Individualität des künstlerischen Ausdrucks immer gleich. Nur hier nicht. Hier lag Kokopelli auf dem Rücken, die Flöte himmelwärts gereckt. Eddie hatte auch dafür eine Erklärung gewusst: »Nun hast du endlich Kokopellis Zuhause gefunden. Hier ist der Ort, an dem er schläft.«
Doch in dieser Nacht warf Eleanor Friedman-Bernal kaum einen Blick auf Kokopelli. Der Hühnerstall gleich hinter der nächsten Biegung zog sie an wie ein Magnet.
Das Erste, was sie sah, als das Taschenlampenlicht die Dunkelheit im Felskamin aufriss, schimmerte weiß. Aber hier konnte, hier durfte es nichts Weißes geben. Sie leuchtete die eingefallenen Mauern ab, schwenkte den Lichtstrahl nach unten, auf einen trüben Tümpel, in dem sich das Wasser aus vielen kleinen Rinnsalen gesammelt hatte, und wieder nach oben, auf das Weiß. Keine Sinnestäuschung. Es war genau das, was sie befürchtet hatte.
Knochen. Überall lagen Knochen verstreut.
»Scheiße!«, entfuhr es Eleanor Friedman-Bernal, die sonst nie fluchte.
Hier hatte schon jemand gegraben. Geplündert. Einer, der hinter Tongefäßen her war. Der die Vergangenheit stahl. Und der schneller gewesen war als sie.
Sie konzentrierte sich auf das nächstgelegene Weiß, den Schulterknochen eines Menschen. Eines Kindes. Auf einem locker aufgeschütteten Erdhaufen, direkt vor einer eingestürzten Mauer. Dort hatten die Anasazi ihren Müll vergraben. Und ihre Toten, das war so üblich. Erfahrene Grabräuber gruben dort zuerst. Aber hier war nur ein kleines Loch ausgehoben. Die Erde sah frisch aus. Eleanor atmete innerlich auf. Vielleicht war der Schaden nicht so groß. Vielleicht war das, was sie suchte, noch da. Sie leuchtete das Terrain mit der Taschenlampe ab.
Nein, sonst war nirgendwo gegraben worden, nur an dieser Stelle. Es gab auch keine Anzeichen, dass jemand darauf aus gewesen wäre, Beute zu machen.
Sie richtete den Lichtstrahl in den Erdaushub. Steine. Hier und da Tonscherben. Und noch mehr Knochen – der Teil eines Fußes, soweit sie das erkennen konnte, und ein Stück Wirbelsäule. Neben der Grube lagen auf einer Sandsteinplatte vier Unterkiefer aufgereiht, einer von einem sehr jungen Menschen. Stirnrunzelnd blickte sie auf die ordentlich ausgerichteten Knochen. Was mochte das bedeuten? Sie sah sich nachdenklich um. Es hatte nicht geregnet, seit hier gegraben worden war. Wobei zu bedenken blieb, dass der enge Felskamin wie ein Dach vor Regen schützte. Wann hatte es eigentlich zuletzt geregnet? In Chaco jedenfalls war seit Wochen kein Schauer mehr niedergegangen. Chaco lag allerdings fast zweihundert Meilen südöstlich.
Die Nacht war still. Hinter sich hörte sie das eintönige Quaken der kleinen Frösche, die hier im Cañon offenbar von jedem Tümpel und jeder Lache stehenden Wassers angezogen wurden. Leopardfrösche hatte Eddie sie genannt. Dann hörte sie wieder das Pfeifen. Der Nachtvogel. Diesmal ziemlich nahe. Eine Folge von fünf, sechs Tönen. Sie stutzte. War das wirklich ein Vogel? Was sonst? Sie hatte auf dem Weg vom Fluss hierher mindestens drei Eidechsenarten gesehen. Auch sie waren nachtaktiv. Aber stießen sie so ein Pfeifen aus?
Als sie den Strahl zum Tümpel richtete, glühten ringsum winzige Punkte auf: Froschaugen, vom Taschenlampenlicht reflektiert. Sie sah den Tieren zu, wie sie – durch die plötzliche Gegenwart eines Menschen in Panik versetzt – loshüpften, auf das rettende Wasser zu. Dann runzelte sie die Stirn. Etwas stimmte hier nicht.
Keine zwei Meter vor ihr plumpste ein Frosch mitten im Sprung zu Boden. Dann ein Zweiter und noch sechs andere. Eleanor kauerte sich neben einem der Frösche nieder und sah ihn sich genauer an. Dann den nächsten. Und noch einen.
Sie waren festgebunden. Weißliche Fäden, vielleicht aus Yukkafasern, waren zwischen den Hinterbeinen der kleinen schwarzgrünen Frösche und einem fest in den feuchten Boden gerammten Stock gespannt.
Eleanor Friedman-Bernal sprang auf und umkreiste den Tümpel hektisch mit dem Lichtkegel ihrer Lampe. Überall Frösche, die in panischer Angst zu fliehen versuchten und mitten im Sprung zu Boden gerissen wurden. Ein paar Atemzüge lang weigerte sich ihr Verstand zu glauben, was ihre Augen sahen: etwas Verrücktes, Widernatürliches, Sinnloses. Wer mochte so etwas getan haben? Natürlich war es das Werk eines Menschen. Aber es gab keinen vernünftigen Grund dafür. Und wann hatte er es getan? Wie lange überlebte ein Frosch, der stets zurückgerissen wurde, bevor er das rettende Wasser erreichte?
In diesem Augenblick hörte sie wieder das Pfeifen. Direkt hinter sich. Nein, das war nicht der Gesang eines Nachtvogels. Das war eine Melodie aus dem Repertoire der Beatles, »Hey, Jude«. Aber Eleanor erkannte den Song nicht, so erschrocken war sie über die bucklige Gestalt, die aus dem Mondlicht in ihr Dunkel kam.
2
Eleanor Friedman Bindestrich Bernal.« Thatcher trennte die Worte deutlich voneinander. »Gefällt mir nicht, wenn Frauen einen Bindestrich im Namen haben.«
Lieutenant Joe Leaphorn sagte nichts. War er je einer Bindestrich-Frau begegnet? Nicht, dass er sich erinnern konnte. Aber seinen Namen so zu schreiben, erschien ihm sinnvoll. Und nicht so seltsam wie Thatchers Getue deswegen. Leaphorns Mutter, all seine Tanten und überhaupt alle Frauen im Clan der Red Forehead, aus dem er mütterlicherseits stammte, hätten den Gedanken, ihren Namen aufzugeben und damit ihre Familienidentität in der ihres Ehemanns aufgehen zu lassen, weit von sich gewiesen. Er überlegte, ob er das Thatcher sagen sollte. Aber er war nicht in der Stimmung dazu. Schon als Thatcher ihn bei der Dienststelle der Navajo-Police abgeholt hatte, war er müde gewesen. Und inzwischen lagen noch mal fast hundertzwanzig Meilen Fahrt hinter ihm. Von Window Rock über Yah-Ta-Hey und Crownpoint bis zum Chaco Culture National Historical Park. Die letzten zwanzig Meilen auf der staubigen Schlaglochpiste waren die reinste Schinderei gewesen. Anfangs hatte er gar nicht mitkommen wollen. Aber Thatcher hatte ihn gebeten, ihm diesen Gefallen zu tun.
»Es ist mein erster Fall im Außendienst«, hatte er gesagt, »da kann ich ein bisschen Unterstützung brauchen.« Was gar nicht stimmte, Thatcher war selbstsicher genug. Leaphorn wusste, was in Wirklichkeit dahintersteckte. Thatcher wollte ihm helfen, aus alter Freundschaft. Denn wenn er nicht mitgefahren wäre, hätte er bloß auf dem Bett gesessen, allein in dem Zimmer, das auf einmal so still war, wäre die Dinge durchgegangen, die ihm von Emma geblieben waren, und hätte zu entscheiden versucht, was er damit tun sollte.
Also hatte Leaphorn gesagt: »Natürlich. Kann sein, dass mir die Fahrt guttut.«
Jetzt saßen sie im Besucherpavillon in Chaco auf unbequemen Stühlen und warteten, dass jemand käme, mit dem sie alles besprechen könnten. Von einem Plakat am Schwarzen Brett starrte sie ein Gesicht durch eine Sonnenbrille an. Über dem Gesicht stand: Ein Dieb der Zeit – Raubgräber zerstören Amerikas Vergangenheit.
»Stimmt«, sagte Thatcher und wies mit dem Kopf auf das Plakat. »Aber auf dem Poster müsste man jede Menge Leute sehen. Cowboys, Beamte aus örtlichen Verwaltungsstellen, Lehrer, Pipelinearbeiter – praktisch alle, die eine Schaufel halten können.« Er musterte Leaphorn von der Seite, wartete auf Antwort und versuchte es seufzend mit einem anderen Thema. »Die Straße, die wir gekommen sind … Ich fahr da schon seit dreißig Jahren lang, und sie wird und wird nicht besser.« Wieder sah er zu Leaphorn hinüber.
»Ja«, sagte Leaphorn. Thatcher hatte von Steinzeug-Schlaglöchern gesprochen und gemeint: »Das Ding müsste mal richtig eingeweicht werden, damit sich der Boden glättet. Aber wenn es einfach nur regnet, werden die Löcher noch heimtückischer.« Was nicht ganz stimmte. Leaphorn erinnerte sich an einen Abend vor langer Zeit, als er als junger Polizist in Crownpoint stationiert gewesen war. Damals hatte die Schneeschmelze den Boden so durchfeuchtet, dass die Steinzeug-Schlaglöcher weich geworden waren. Mit dem Erfolg, dass Leaphorns Dienstwagen sich festfuhr. Er hatte Crownpoint über Funk gerufen, aber die konnten ihm keine Hilfe schicken. Also war er losmarschiert, zwei Stunden lang, bis zu einer Ranch. Damals war er frisch verheiratet gewesen und hatte befürchtet, Emma könnte sich Sorgen machen. Ein Rancharbeiter hatte einen allradgetriebenen Pick-up aus dem Schuppen geholt, Ketten aufgezogen und Leaphorns Wagen aus dem Schlamm geschleppt. Und heute war immer noch alles wie damals. Nein, schlimmer. Denn die Straße hatte ein paar Jahrzehnte mehr auf dem Buckel. Und Emma war tot.
Wieder hatte Thatcher etwas gesagt und ihn dann gespannt angesehen, statt auf die miserable Fahrbahn zu achten.
Und Leaphorn hatte nur zerstreut genickt.
»Du hast gar nicht zugehört«, hielt Thatcher ihm vor. »Ich hab gefragt, warum du aufhören willst.«
Leaphorn hatte eine Zeit lang geschwiegen. »Weil ich müde bin.«
Thatcher schüttelte den Kopf. »Es wird dir fehlen.«
»Nein. Man wird älter. Oder vernünftiger. Und sieht ein, dass es im Grunde nicht so wichtig ist.«
»Emma war eine wundervolle Frau«, sagte Thatcher. »Und das bringt sie auch nicht zurück.«
»Nein, sicher nicht.«
»Wenn sie noch am Leben wäre, würde sie sagen: ›Joe, schmeiß nicht alles hin. Du darfst nicht aufgeben und einfach vor dich hinleben.‹ So was habe ich oft genug aus ihrem Mund gehört.«
»Vermutlich. Aber ich will einfach nicht mehr weitermachen.«
»Okay.« Thatcher konzentrierte sich eine Weile auf das Fahren. »Lass uns über was anderes reden. Ich glaube, Frauen mit einem Bindestrich im Namen sind reich. Von Haus aus, verstehst du? Ist nicht so einfach, mit denen zurechtzukommen. Ich kann mir nicht helfen, so sehe ich das eben. Obwohl das natürlich ein Klischee ist.«
Dann waren sie in ein tiefes Schlagloch gedonnert. Was Leaphorn davor bewahrt hatte, sich eine Antwort ausdenken zu müssen.
Und jetzt blieb ihm die Antwort wieder erspart, weil endlich die Tür mit dem Schild Nur für Mitarbeiter aufgestoßen wurde. Ein Mann in sauberer, frisch gestärkter Uniform des U. S. Park Service kam auf sie zu. Vor einem der großen Fenster, im milden Gold der Herbstsonne, blieb er stehen und sah sie erwartungsvoll an.
»Bob Luna«, stellte er sich vor. »Kommen Sie wegen Ellie?«
Thatcher hielt ihm ein Ledermäppchen mit der Dienstmarke des Bureau of Land Management hin. »L. D. Thatcher. Und das ist Lieutenant Leaphorn von der Navajo-Police. Wir haben etwas mit Mrs Friedman-Bernal zu besprechen.« Er fischte einen Umschlag aus der Jacke. »Hier, der richterliche Durchsuchungsbeschluss.«
Luna guckte verblüfft. Auf den ersten Blick war er Leaphorn erstaunlich jung vorgekommen, jedenfalls für jemanden, dem man die Leitung einer solchen Dienststelle anvertraut hatte. Wie ein großer Junge, glatthäutig, mit einem runden, gutmütigen Gesicht. Im Sonnenlicht aber waren die Fältchen um Augen und Mundwinkel zu sehen. Auf dem Colorado Plateau zeichnen Sonne und Trockenheit die Gesichter der Weißen schnell, aber bis die Spuren tief geworden sind, dauert es eine Weile. Luna war älter, als er aussah.
»Sie wollen etwas mit ihr besprechen?«, fragte Luna. »Ist sie denn hier? Ist sie zurückgekommen?«
Jetzt war es Thatcher, der verdutzt aussah. »Arbeitet sie denn nicht hier?«
»Doch, aber sie ist verschwunden. Ich dachte, deswegen sind Sie gekommen. Wir haben das gemeldet. Vor einer Woche. Eher schon vor zwei Wochen.«
»Verschwunden?«, wiederholte Thatcher. »Wie meinen Sie das?«
Lunas Gesicht war nun leicht gerötet. Er schien etwas erwidern zu wollen, schluckte es aber runter und atmete stattdessen tief durch. Als Dienststellenleiter hatte er gelernt, dass einem manchmal viel Geduld abverlangt wird.
»Am Mittwoch der vorvorigen Woche … Also vor zwölf Tagen haben wir Ellie als vermisst gemeldet. Wir hatten sie am Montag, also vor vierzehn Tagen, zurückerwartet, aber sie war nicht gekommen. Und hatte auch telefonisch keine Nachricht gegeben. Sie war übers Wochenende nach Farmington gefahren. Für Montagabend hatte sie eine Besprechung vereinbart, hier in der Parkverwaltung. Aber zu der ist sie nicht erschienen. Und auch zwei Tage später nicht, zum nächsten Termin. Das passt gar nicht zu ihr. Ihr muss was zugestoßen sein, und genau das haben wir gemeldet.«
»Sie ist gar nicht da?« Thatcher spielte unschlüssig mit dem Umschlag.
»Wen haben Sie angerufen?«, fragte Leaphorn und staunte selbst darüber, dass er sich einmischte. Die Sache ging ihn nichts an. Und sie war ihm im Grunde gleichgültig. Er war nur mitgekommen, weil Thatcher ihn darum gebeten hatte – so dringend, dass es ihm einfacher erschienen war, klein beizugeben statt sich zu widersetzen. Und er hatte sich nicht einmischen wollen. Sondern sich nur darüber geärgert, dass das Gespräch der beiden nicht vom Fleck kam.
»Den Sheriff«, sagte Luna.
»Welchen?«, fragte Leaphorn, denn ein Teil des Parks gehörte zum McKinley County, der andere Teil zu San Juan.
»Den vom San Juan County. In Farmington. Aber es hat niemand reagiert. Also haben wir letzten Freitag wieder angerufen. Ich dachte, deswegen wären Sie jetzt hier.«
»Na ja, mehr oder weniger«, sagte Leaphorn. »Jedenfalls sind wir jetzt da.«
Thatcher wandte sich an Luna. »Es liegt eine Beschwerde gegen Mrs Friedman-Bernal vor. Oder eigentlich eine Anzeige. Ziemlich handfest. Mit allen möglichen Details. Sie soll gegen das Gesetz zum Schutz von Kulturgütern verstoßen haben.«
»Dr. Friedman?«, fragte Luna. »Behauptet jemand, sie habe Grabungsstätten geplündert?« Er grinste, konnte ein Kichern kaum unterdrücken. »Ich glaube, wir fahren besser zu Maxie Davis raus.«
Der Weg führte am Chaco Wash entlang. Luna saß am Steuer und redete, Thatcher, neben ihm, hörte aufmerksam zu. Leaphorn saß auf der Rückbank und starrte nach draußen. Die Spätnachmittagssonne ließ die zerklüfteten Felsen der Sandsteinklippen und das fahle Gramagras am Steilhang leuchten, und der Schatten, den der Fajada Butte auf das Tal warf, wurde länger. Was werde ich heute Abend machen, wenn ich wieder in Window Rock bin?, überlegte Leaphorn. Und morgen? Und im Winter? Was werde ich mit mir anfangen, wenn es wieder Frühling geworden ist? Werde ich überhaupt je wieder etwas mit mir anzufangen wissen?
Luna erzählte gerade, dass Maxie und Eleanor Friedman Nachbarinnen in der Unterkunft für befristet angestellte Mitarbeiter waren. Beide hatten einen Zeitvertrag beim archäologischen Team. Ihre Aufgabe war die Erfassung, Grobdatierung und erste Bestandsaufnahme von Fundstellen der Anasazi-Kultur. Es gab Tausende Fundorte, deshalb mussten sie bei ihrer Arbeit mitentscheiden, welche Grabungsstätten vorläufig unerforscht bleiben sollten – in der Hoffnung, dass Wissenschaftler späterer Generationen über neue, bessere Methoden verfügen würden, um die Spuren der Vergangenheit zu lesen und zu deuten.
»Und sie sind befreundet, schon seit Langem«, sagte Luna. »Sind zusammen zur Schule gegangen, arbeiten jetzt zusammen – wie das so ist. Maxie war es, die im Sheriffbüro angerufen hat.« Heute arbeitete Maxie Davis bei BC 129. Leider liege BC 129 denkbar ungünstig, fügte Luna hinzu, auf der anderen Seite der Chaco Mesa, beim Escavada Wash, am Ende eines sehr steinigen Wegs.
»BC 129?«, wiederholte Thatcher.
»BC 129«, bestätigte Luna, »das ist nur eine interne Kennzeichnung, damit wir wissen, welche Stelle gemeint ist. Es gibt zu viele davon, wir können nicht für jede einen Namen erfinden.«
BC 129 lag bei den Klippen der Hochebene, ein flacher Hügel, von dem aus sich ein weiter Blick ins Chaco Valley öffnete. Luna parkte seinen Wagen neben einem alten grünen Pick-up. Eine Frau, offenbar gerade mit Grabungsarbeiten beschäftigt und bis zu den Hüften in einem Graben verschwunden, schaute neugierig zu ihnen herüber. Sie hatte eine Schirmmütze über das kurze dunkle Haar gezogen. Leaphorn fiel sofort auf, dass sie schön war. Es war nicht nur die Schönheit junger, gesunder Menschen – etwas machte sie einzigartig, auffallend. Es war eine Schönheit, die er auf dem Campus der Arizona State University auch an Emma gleich bemerkt hatte; neunzehn war sie damals gewesen. Solche Schönheit war selten und wertvoll. Hinter dem Graben saß ein junger Navajo auf den Resten einer Mauer; der Schatten eines breitkrempigen schwarzen Hutes fiel auf sein Gesicht, auf seinen Knien lag eine Schaufel. Thatcher und Luna stiegen aus.
»Ich warte hier«, sagte Leaphorn.
Auch so etwas, das ihm in letzter Zeit zu schaffen machte: Es gab nichts mehr, was ihn wirklich interessierte. Und zwar seit sein Verstand begonnen hatte, zögernd zu begreifen, was Emmas Arzt ihm mitgeteilt hatte.
»Es fällt mir nicht leicht. Ihnen das zu sagen, Mr Leaphorn«, hatte er begonnen. »Sie ist gestorben. Gerade eben. Es war ein Blutgerinnsel. Die Infektion war zu schwer. Und die Belastung zu groß. Aber falls es Ihnen ein Trost ist: Es ist alles sehr schnell gegangen.«
Er sah das Gesicht noch vor sich. Rosig helle Haut. Buschige blonde Brauen. Blaue Augen hinter der Hornbrille, in deren Gläsern sich das kalte Licht des Warteraums vor dem Operationssaal spiegelte. Ein schmaler, unpersönlich strenger Mund. Und er hörte noch die Worte, laut und deutlich, vom Summen der Klimaanlage unterlegt. Der ganze Albtraum wurde wieder lebendig. Doch was dann gewesen war, wusste Leaphorn nicht mehr. Er erinnerte sich weder, wie er zum Parkplatz gekommen, ins Auto gestiegen, durch Gallup und nach Hause gefahren war, noch an die nächsten Stunden. Umso bewusster waren ihm die Tage vor der Operation. Emmas Tumor sollte entfernt werden. Eine Erleichterung nach der quälend langen Sorge, Alzheimer werde ihre Persönlichkeit langsam und unaufhaltsam zerstören. Nun war es also nur ein Tumor. Wahrscheinlich kein bösartiger. Leicht auszuheilen. Die Gedächtnisstörungen würden aufhören, Emma würde bald wieder so sein wie früher. Glücklich. Gesund. Schön.
»Die Chancen? Sehr gut«, hatte der Chirurg gesagt, »neunzig Prozent Wahrscheinlichkeit für eine vollständige Genesung. Eine ausgezeichnete Prognose. Falls nichts schiefgeht.«
Aber es war etwas schiefgegangen. Der Tumor war größer, als sie gedacht hatten. Und er lag ungünstig. Darum dauerte die Operation so lange. Und dann kam die Infektion dazu. Und das tödliche Blutgerinnsel.
Seitdem hatte ihn nichts mehr interessiert. Irgendwann würde er wieder zum Leben zurückfinden. Vielleicht. Jetzt war er noch nicht so weit. Er saß hinten im Wagen, streckte die Beine zur Seite, lehnte sich gegen die Tür, starrte nach draußen.
Thatcher und Luna sprachen mit der weißen Frau im Graben. Maxie – ein ausgefallener Name für ein Mädchen. Wahrscheinlich eine Kurzform, wofür auch immer. Maxie redete lebhaft und gestenreich auf Thatcher und Luna ein, kletterte aus dem Graben und ging zum Pick-up. Der Navajo hörte aufmerksam zu, sein ovales Gesicht mit dem lang gezogenen Unterkiefer wirkte seltsam, hämisch geradezu. Er zog sich die Jeansjacke an, schulterte die Schaufel und marschierte beinahe parodierend hinter ihr her. Aus dem tiefen Schatten unter der breiten Hutkrempe leuchteten weiße Zähne. Er grinste, fand offenbar etwas spaßig.
Hinter ihm fiel das Sonnenlicht jetzt schräg aufs Chaco Plateau; die Konturen wurden härter, wie mit einem dunklen Rand markiert. Der trockene Flusslauf lag fast ganz im Schatten des Fajada Butte; nur auf die gelben Pappeln schien noch die Herbstsonne, sie wirkten wie mit glitzerndem Flitter geschmückt. Die Pappeln waren die einzigen Bäume in einer Ebene, in der es sonst nur Gras gab, fahlgrau mit ein paar eingeflochtenen Silbersträhnen.
Wo haben die Menschen dieses alten, längst verschwundenen Stamms eigentlich ihr Feuerholz herbekommen?, fragte sich Leaphorn. Glaubte man den Anthropologen, dann hatten sie die Dachbalken am Mount Taylor oder in den Chuskas geholt und auf den Schultern fünfzig Meilen weit hergeschleppt. Eine großartige Leistung. Aber womit hatten sie den Mais gekocht, das Wild gebraten, ihre Tongefäße gebrannt, im Winter geheizt? Leaphorn erinnerte sich, was für eine Plackerei es für seinen Vater und ihn gewesen war, jeden Herbst mit dem Wagen bis zu den Hügeln zu ziehen, wo sie abgestorbene Pinien und Lärchen klein hackten, um dann die schwere Ladung den weiten Weg bis zum Hogan zurückzukarren. Aber die Anasazi hatten weder Pferde noch das Rad gekannt.
Thatcher und Luna stiegen wieder ein. Thatcher warf die Tür zu, klemmte seine Jacke ein, murmelte etwas in sich hinein, stieß die Wagentür auf und schloss sie wieder. Als Luna den Motor anließ, ertönte ein Warnzeichen. »Der Sicherheitsgurt«, sagte Thatcher.
Luna legte ihn an. »Ich mag die Dinger nicht.«
Der grüne Pick-up zog an ihnen vorbei und wirbelte Staub auf.
»Wollen uns mal im Apartment von Mrs Soundso umsehen«, sagte Thatcher so laut, dass auch Leaphorn es hörte. »Mrs Davis hält es für ausgeschlossen, dass die Frau mit dem Bindestrich Grabungsstätten geplündert hat. Sie habe zwar Tongefäße gesammelt, aber rein beruflich, für wissenschaftliche Zwecke. Völlig legal. Und Raubgräber habe sie geradezu gehasst, diese Mrs … Bernal.«
»Hm«, sagte Leaphorn. Durch das Heckfenster des Pick-ups sah er den breitkrempigen Hut des jungen Navajo. Seltsam, dass ein Navajo bei Grabungsarbeiten half. Denn dadurch störte er die Ruhe der Anasazi-Geister. Wahrscheinlich war er auf dem Jesuspfad. Oder gehörte zur Peyote Church. Jemand, der gemäß den alten Traditionen lebte, hätte nicht riskiert, sich mit dem Übel des Bösen zu infizieren. Oder, schlimmer noch, sich dem Verdacht auszusetzen, ein Hexer zu sein. Denn wer sonst grub nach Gebeinen? Skinwalker, an deren Existenz traditionsgebundene Navajo nicht zweifelten, pflegten aus den Knochen Verstorbener winzige Pfeile zu schnitzen und auf ihre Opfer abzufeuern. Leaphorn glaubte nicht daran. Aber die vielen, die seine Skepsis nicht teilten, hatten ihm die Polizeiarbeit oft genug mehr als schwer gemacht.
»Sie glaubt, Mrs Bernal müsse etwas zugestoßen sein«, sagte Thatcher und prüfte im Rückspiegel, ob Leaphorn zuhörte. »Du kannst ruhig auch dahinten den Gurt anlegen.«
»Ja«, sagte Leaphorn, zerrte sich den Beckengurt über den Bauch und dachte, dass der Frau vermutlich nichts zugestoßen war. Auslöser für Thatchers Fahrt nach Chaco war ein anonymer Anruf gewesen. Bestimmt hing Dr. Soundsos Verschwinden mit diesem Anruf zusammen.