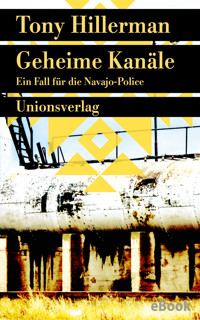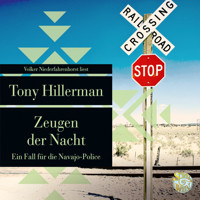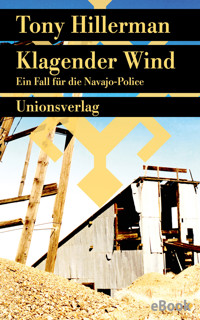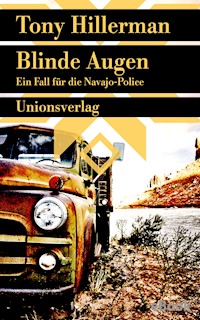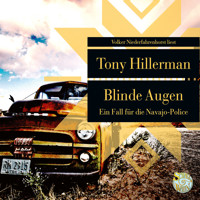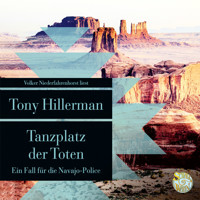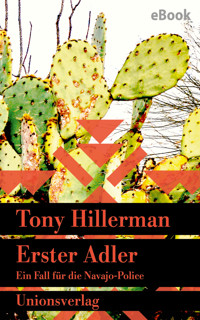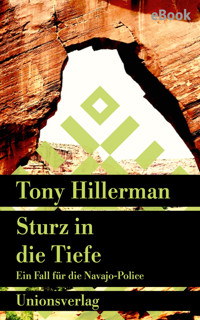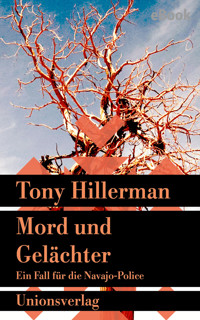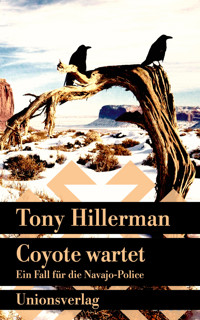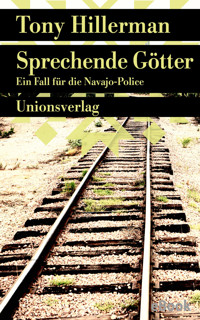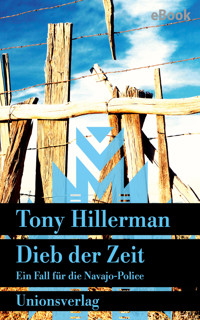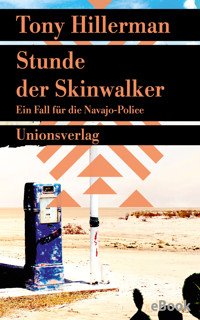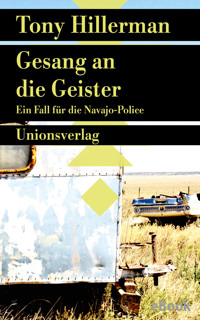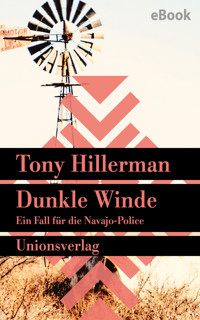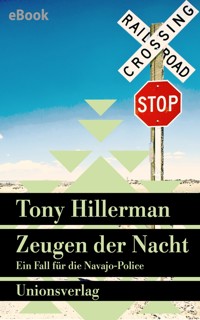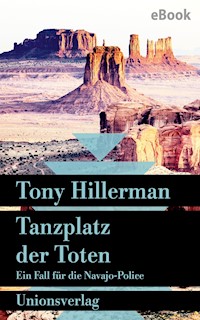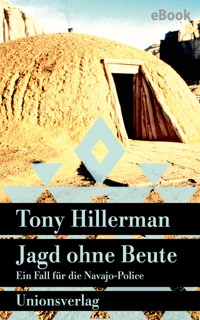
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Samstagnacht im Ute-Reservat: Drei maskierte Männer überfallen ein Spielcasino, töten einen Wachmann, verletzen einen weiteren schwer und entkommen mit reicher Beute. Das FBI vermutet die Banditen im zerklüfteten Labyrinth der Canyons an der Grenze von Utah und Arizona und startet eine beispiellose Großfahndung. Bei Jim Chee und seinem ehemaligen Vorgesetzten Joe Leaphorn weckt der Fall düstere Erinnerungen an die gescheiterte Großfahndung nach einer Gangsterbande im Vorjahr, bei der ein Navajo-Cop sein Leben ließ. Und tatsächlich: Leaphorn und Chees Ermittlungen führen noch weiter zurück in die Vergangenheit. Vor fast hundert Jahren soll in der Gegend ein Bandit sein Unwesen getrieben haben – ein Hexer, der nachts aus den Canyons schlich, um zu töten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 363
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch
Samstagnacht im Ute-Reservat: Drei maskierte Männer überfallen ein Kasino und entkommen mit reicher Beute ins Labyrinth der Canyons. Das FBI ruft eine Großfahndung aus, doch Joe Leaphorn und Jim Chee folgen einer anderen Spur: Vor hundert Jahren schon trieb in der Gegend ein Bandit sein Unwesen, der nachts aus den Canyons schlich, um zu töten …
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tony Hillerman (1925–2008) besuchte ein Internat für Native Americans, kämpfte im Zweiten Weltkrieg, studierte Journalismus und war als Journalist und Dozent tätig. Seine Romane um die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee wurden vielfach ausgezeichnet und in siebzehn Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Tony Hillerman.
Fried Eickhoff ist Übersetzer aus dem Englischen, er hat u. a. Werke von Tony Hillerman, Paula Gosling und Philip Kerr ins Deutsche übertragen.
Zur Webseite von Fried Eickhoff.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tony Hillerman
Jagd ohne Beute
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Fried Eickhoff
Ein Fall für die Navajo-Police (13)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Worterklärungen und Hintergrundinformationen zu diesem Buch auf https://ehillerman.unm.edu/encyclopedia-main
Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Veronika Straaß-Lieckfeld nach dem Original durchgesehen und grundlegend überarbeitet.
Die Originalausgabe erschien 1999 bei HarperCollinsPublishers, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 2001 unter dem Titel Dachsjagd im Rowohlt Verlag, Reinbek.
Originaltitel: Hunting Badger
© 1999 by Tony Hillerman
Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Fried Eickhoff beim Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hintergrund - REDA &CO srl (Alamy Stock Foto); Symbol - LadadikArt (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31171-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 11.12.2024, 11:07h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
JAGD OHNE BEUTE
Vorbemerkung des Autors1 – Deputy Sheriff Teddy Bai lehnte im Türrahmen und …2 – Sergeant Jim Chee von der Navajo-Police war in …3 – Im Speiseraum des Navajo Inn in Window Rock …4 – Captain Largo sah von seinen Unterlagen hoch …5 – Officer Bernadette Manuelito hatte Chee völlig zu Recht …6 – Eigentlich gab es für Leaphorn keinen Grund …7 – Oliver Potts’ bescheidenes Steinhaus stand ungefähr fünf Meilen …8 – Als Chee zum Streifenwagen No. 4 des Apache …9 – Die kleine Kartenskizze, die Potts ihm auf einen …10 – Jim Chee bog im höher gelegenen Stadtteil von …11 – Der Halbmond versank schon im Westen hinter den …12 – Kurz nach Mittag des nächsten Tages bekam Captain …13 – Chee hatte schon zweimal alle Tische im Speiseraum …14 – Von seinem Platz aus konnte Leaphorn durch ein …15 – Auf amtlichen Landkarten heißt es Colorado Plateau …16 – Leaphorn hatte ihm den Standort der Straßensperre genau …17 – Der Himmel im Osten glühte leuchtend rosa und …18 – Die Stimme am Telefon gehörte unverkennbar zu Captain …19 – Joe Leaphorn hatte sich innerlich damit abgefunden …20 – Chees Plan, sich mit den Leuten in Verbindung …21 – Chee hatte Glück. Es klappte mit der Verabredung22 – Joe Leaphorn räumte das Frühstücksgeschirr ab, goss sich …23 – Als Sergeant Jim Chee in Largos vollgestopftes Büro …24 – Joe Leaphorn hatte sich früh schlafen gelegt …25 – Sergeant Chee hatte sich in seinem Wohnwagen auf …26 – Sergeant Jim Chee hatte es sich auf der …27 – Bernie ließ Streifenwagen Nummer 11 genau vor Timms’ …28 – Es war unschwer zu erkennen, wo Gershwin mit …29 – Wieder streckte sich Chee lang auf der Rückbank …DankMehr über dieses Buch
Über Tony Hillerman
»Der Angst vor seinem Pferd hat«
Claus Biegert: Die Navajo-Romane — ein Fall von Kultureller Wertschätzung
Über Fried Eickhoff
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tony Hillerman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema USA
Für Officer Dale Claxton
Er starb tapfer und allein, in Erfüllung seiner Pflicht.
Vorbemerkung des Autors
Am 4. Mai 1998 stoppte Officer Dale Claxton von der Polizeistation Cortez, Colorado, einen gestohlenen Wassertankwagen. Die drei Männer in der Fahrerkabine hatten automatische Waffen und eröffneten sofort das Feuer. Claxton war auf der Stelle tot. Bei der Jagd nach den Tätern wurden drei weitere Polizeibeamte verletzt. Einer der Flüchtigen beging kurz darauf Selbstmord, den beiden anderen gelang es, in der menschenleeren Wildnis aus Bergen, Mesas und Canyons im Grenzgebiet zwischen Utah und Arizona unterzutauchen. Das FBI, das Federal Bureau of Investigation, übernahm die Verfolgung, und schon bald waren mehr als fünfhundert Beamte von mindestens zwanzig verschiedenen Strafverfolgungsbehörden des Bundes, der Einzelstaaten und der Stämme an der Suche beteiligt, außerdem etliche Kopfgeldjäger, die es auf die vom FBI ausgesetzte Belohnung in Höhe von 250 000 Dollar abgesehen hatten.
Leonard Butler, der kluge und besonnene Chef der Navajo-Police, bezeichnete die Fahndung damals als »Zirkus«. Meldungen, nach denen die Täter irgendwo gesehen worden sein sollten, ließ man unbeachtet in der Zentrale liegen, statt sie an die Einsatzkräfte vor Ort weiterzuleiten. Suchmannschaften stellten fest, dass sie irrtümlich den Fährten anderer Suchmannschaften gefolgt waren, weil die Funkfrequenzen zwischen ihnen nicht abgestimmt waren und sie deshalb nicht miteinander kommunizieren konnten. Lokale Polizei, die mit der Gegend vertraut war, schickte man an die Straßensperren, während Kollegen, die man zur Verstärkung aus den Städten herbeigeholt hatte, orientierungslos in den Canyons herumstolperten. Die Kleinstadt Bluff wurde evakuiert, und im Tal des San Juan entfachte man ein Buschfeuer, um die Verbrecher zur Aufgabe zu zwingen. Monat um Monat verstrich, ohne dass man einen Schritt weitergekommen wäre. Im Juli hieß es dann plötzlich, das FBI gehe davon aus, dass die Täter mittlerweile tot seien. (Vielleicht vor Lachen tot umgefallen, lästerte einer meiner Cop-Freunde.) Im August suchten nur noch einige Scouts der Navajo-Police nach den Flüchtigen.
Ein gutes Jahr später (ich schreibe das im Juli 1999) sind die Täter noch immer auf freiem Fuß. In diesem Roman taucht die Fahndungsaktion von 1998 allerdings nur als fiktive Erinnerung mit fiktiven Romangestalten auf.
1
Deputy Sheriff Teddy Bai lehnte im Türrahmen und sah in die Nacht hinaus. Erst nach ein paar Minuten merkte er, dass Cap Stoner ihn beobachtete.
»Nur mal Luft schnappen«, erklärte Bai. »Ziemlich verqualmt da drinnen.«
»Sie sind so nervös heute Abend«, sagte Cap. Er stand auf und stellte sich neben Bai in den Eingang. »Ihr jungen Singles dürftet doch eigentlich noch keine Sorgen haben.«
»Hab auch keine«, entgegnete Teddy.
»Außer weiter Single zu bleiben«, sagte Cap, »das kann schon ein Problem werden.«
»Für mich nicht«, antwortete Teddy und warf Cap einen kurzen, prüfenden Blick zu. Was ließ sich aus seinem Gesicht ablesen? Doch Cap sah unverwandt auf den Parkplatz des Ute-Kasinos. Teddy konnte nur die linke Seite seines Gesichts sehen mit dem etwas buschigen Schnurrbart, dem kurz geschnittenen weißen Haar und der hervortretenden Narbe entlang des Wangenknochens, die, so erzählte Cap jedenfalls, von einer Schusswunde herrührte. Eine Frau, die er wegen Trunkenheit am Steuer festnehmen wollte, hatte plötzlich eine Pistole aus ihrer Handtasche geangelt und auf ihn geschossen. Das alles lag jetzt schon über vierzig Jahre zurück. Damals war Stoner erst ein paar Jahre bei der New Mexico State Police gewesen und hatte noch nicht begriffen, dass man nur überleben konnte, wenn man all seinen Mitmenschen zunächst mit Skepsis begegnete. Jetzt war er Captain im Ruhestand und besserte seine Pension als Leiter des rent-a-cop-Sicherheitsdienstes vom Southern-Ute-Spielkasino auf. Teddy dagegen stand noch im aktiven Polizeidienst und arbeitete nur in seinen dienstfreien Nächten als Security-Mann im Kasino.
»Was haben Sie dem randalierenden Saufbold am Blackjack-Tisch gesagt?«
»Das Übliche«, erwiderte Teddy. »Er soll sich beruhigen, sonst fliegt er raus.«
Cap antwortete nicht. Er starrte hinaus in die Nacht. »Da drüben hat es eben geblitzt«, sagte er und deutete mit der Hand in die Richtung. »War kaum zu sehen. Muss ziemlich weit weg gewesen sein, drüben über Utah. Wird auch langsam Zeit.«
»Ja«, sagte Teddy knapp. Er wollte, dass Cap wieder ging.
»Wird Zeit, dass der Regen kommt«, sagte Cap. »Heute war der Dreizehnte, oder? Wundert mich, dass so viele hier sind und ausgerechnet an einem Freitag, dem Dreizehnten, ihr Glück versuchen.«
Teddy nickte nur knapp. Er wollte keinen Anlass geben, die Unterhaltung fortzusetzen, doch Cap plauderte unbeeindruckt weiter. »Andererseits war gestern Zahltag, und sie müssen das Geld in ihren Lohntüten ja irgendwie unter die Leute bringen.« Er sah auf die Uhr. »Drei Uhr dreiunddreißig«, sagte er. »Bald Zeit für den Geldtransporter, die Einnahmen abzuholen und zur Bank zu schaffen.«
Und, dachte Teddy, schon ein paar Minuten über die Zeit, da ein kleiner blauer Ford Escort auf dem westlichen Parkplatz hätte eintreffen sollen. »Na dann, ich werd mal draußen eine Runde drehen und die Diebe verscheuchen«, sagte er.
Teddy entdeckte auf dem westlichen Parkplatz weder Diebe noch den kleinen Ford Escort. Als er zu der Tür, auf der »Nur für Angestellte« stand, zurückschaute, war Cap nicht mehr da.
Ein paar Minuten Verspätung. Dafür konnte es tausend Gründe geben. Nicht der Rede wert.
Nach der Hitze des Tages genoss er die saubere Nachtluft, die Kühle des Hochlandes kurz vor Sonnenaufgang, das Wetterleuchten über den Bergen. Er ging ein paar Schritte weit, bis er den erleuchteten Bereich um das Kasino hinter sich gelassen hatte, sah zum hochsommerlichen Sternenhimmel auf und suchte nach den vertrauten Sternbildern. Die meisten befanden sich dort, wo sie seiner Erinnerung nach sein mussten. Ihre amerikanischen Namen fielen ihm sofort wieder ein und auch ein paar in der Navajo-Sprache, die ihn seine Großmutter gelehrt hatte. Doch von den Namen, die er aus seinem Kiowa-Komantschen-Vater herausgeleiert hatte, waren ihm nur zwei im Gedächtnis geblieben.
Jetzt war die Stunde gekommen, die seine Großmutter die »tiefe Dunkelheit« genannt hatte, aber von dem spät aufgegangenen Mond ging ein schwaches Glimmen aus, das die Umrisse des Sleeping Ute Mountain deutlich hervorhob. Irgendwo hörte er ein Lachen. Eine Autotür wurde zugeschlagen. Dann noch eine. Zwei Wagen verließen den östlichen Parkplatz und fuhren Richtung Ausfahrt. Zwischen den Pinyon-Kiefern auf den Hügeln hinter dem Kasino begannen Kojoten jiffend, jodelnd und heulend eine Unterhaltung.
Auf dem Highway unterhalb des Kasinos wurde ein Lastwagen in einen tieferen Gang geschaltet. Ein Pick-up fuhr auf den Mitarbeiter-Parkplatz und hielt an. Teddy hörte ein schepperndes Geräusch, so als würde etwas ausgeladen. Er drückte den Beleuchtungsknopf an seiner Timex. 3.46 Uhr. Der kleine blaue Ford hatte jetzt so viel Verspätung, dass er anfing, sich Sorgen zu machen. Ein Mann in einem Overall, eine Ausziehleiter unter dem Arm, trat in den Lichtschein. Er stellte die Leiter gegen die Kasinowand und kletterte ohne große Eile hoch aufs Dach.
»Was soll das denn jetzt?«, sagte Teddy halblaut. Vielleicht ein Elektriker. Irgendein Defekt an der Klimaanlage. »Hey!«, rief er und setzte sich Richtung Leiter in Bewegung.
Ein weiterer Pick-up mit einer auffallend großen Fahrerkabine fuhr auf dem Mitarbeiter-Parkplatz vor. Zwei Männer stiegen aus. Offenbar Soldaten der Nationalgarde in ihrer Dienstkleidung. Was trugen die denn da? Jetzt gingen sie rasch auf die Tür mit der Aufschrift »Nur für Angestellte« zu. Doch die Tür ließ sich von außen nicht öffnen. Dahinter lag der Kassenraum, der sich nur von innen aufschließen ließ, und zwar nur von wenigen befugten Leuten wie Cap Stoner.
In diesem Moment kam Stoner aus dem Seiteneingang. Er deutete auf das Dach und rief: »Was sucht der da oben? Was zum Teufel …«
»Hey!«, schrie Teddy und begann, auf die beiden Männer zuzulaufen, während er die Lasche seines Holsters löste. »Was …«
Die beiden blieben stehen. Teddy sah Mündungsfeuer, sah, wie Cap Stoner hintenüberfiel und ausgestreckt auf dem Boden liegen blieb. Die beiden Männer drehten sich blitzschnell zu ihm um und brachten ihre Waffen in Anschlag. Er nestelte immer noch an seinem Pistolenholster herum, als ihn die ersten Kugeln trafen.
2
Sergeant Jim Chee von der Navajo-Police war in bester Stimmung. Er war gerade von einem siebzehntägigen Urlaub zurückgekehrt. Und er war froh, dass man ihn von seinem Posten als amtierender Lieutenant in Tuba abgelöst und wieder ins vertraute Shiprock versetzt hatte. Außerdem hatte er noch fünf freie Tage vor sich, bevor er wieder an seiner Arbeitsstelle erscheinen musste.
Ein Rest Hammelragout, den er gerade aus dem Kühlschrank geholt hatte, köchelte auf dem Propankocher leise vor sich hin. Aus dem dampfenden Kaffeetopf stieg der köstliche Duft von frisch gebrühtem Kaffee. Aber das Beste war, diesmal würde ihn kein bisschen Papierkram erwarten, wenn er wieder seinen Dienst antrat.
Während er seine Schale mit Essen füllte und sich Kaffee eingoss, verfolgte er nebenbei die Fernsehnachrichten, und was er da erfuhr, steigerte noch sein Wohlbefinden. Seine Sorge – ja, man konnte schon sagen, sein Grauen davor –, dass er schon bald wieder genötigt werden könnte, im unwegsamen Hinterland an einer vom FBI geleiteten Großfahndung teilzunehmen, hatte sich erledigt. Die Fernsehreporterin, die live vom Federal Court House berichtete, teilte mit, die Gangster, die die Spielbank im Southern Ute Reservat ausgeraubt hatten (während Chee in Fairbanks gerade sein Flugzeug bestieg), seien inzwischen »vermutlich mehrere Hundert Meilen entfernt«. Mit anderen Worten, sie hatten das Four-Corners-Gebiet um Shiprock hinter sich gelassen und waren somit nicht mehr Chees Problem.
Wie die hübsche junge Reporterin auf dem 17-Zoll-Bildschirm in Chees Wohnwagen berichtete, hatte sich das FBI den Tathergang des Raubüberfalls folgendermaßen zusammengereimt: »Wie wir von an der Suche beteiligten Beamten erfahren haben, ist es den drei Tätern offenbar gelungen, auf einer Ranch südlich von Montezuma Creek in Utah ein kleines einmotoriges Flugzeug zu stehlen. Die Fahndung läuft, und das FBI bittet alle, die die Maschine gestern oder heute Morgen gesehen haben, um Mitteilung.«
Chee kostete einen Löffel von seinem Ragout, nippte an seinem Kaffee und hörte aufmerksam zu, wie die Nachrichtensprecherin das Flugzeug beschrieb: ein schon etwas älterer dunkelblauer einmotoriger Hochdecker eines Typs, den die Armee in Korea und während der ersten Jahre des Vietnamkriegs für Aufklärungsflüge eingesetzt hatte – vor allem, um feindliche Geschütze am Boden auszumachen. Die bereits erwähnten FBI-Beamten vermuteten, dass die Täter das Flugzeug aus dem Hangar des Ranchers entwendet und dazu benutzt hatten, die Gegend zu verlassen.
Das klang beruhigend, fand Chee. Je weiter weg, desto besser. Nach Kanada zum Beispiel. Oder auch nach Mexiko. Chee war alles recht, solange es nur nicht das Four-Corners-Gebiet war. Im Frühjahr 1998 hatte er an einer vom FBI geleiteten, ebenso ermüdenden wie erfolglosen Großfahndung nach zwei Polizistenmördern teilgenommen. Als die Menschenjagd ihren chaotischen Tiefpunkt erreichte, waren schließlich Beamte aus über zwanzig Strafverfolgungsbehörden des Bundes, der Einzelstaaten, Countys und verschiedener Reservate im Einsatz gewesen und hatten sich wochenlang abgemüht, ohne dass irgendjemand festgenommen worden wäre. Endlich beendete das FBI die ganze Aktion und erklärte, die Tatverdächtigen seien »vermutlich tot«. Das war eine Erfahrung gewesen, die Chee nicht noch einmal machen wollte.
Hinter ihm klapperte die kleine, an Gummistreifen aufgehängte Luke, die er in den unteren Teil der Wohnwagentür eingebaut hatte. Die Katze kam heute ungewöhnlich früh. Das konnte entweder bedeuten, dass ein Kojote in der Nähe umherstreifte und sie nervös machte oder dass er Besuch bekam. Chee lauschte. Im Fernsehen lief lautstark ein Werbespot für Handyverträge, doch dahinter hörte Chee das schwache Geräusch von rollenden Reifen auf der Schotterpiste, die seinen Wohnwagen unter den Pappeln am Ufer des San Juan River mit dem Shiprock-Cortez-Highway verband.
Wer konnte das sein? Vielleicht Cowboy Dashee? Unwahrscheinlich. Cowboy war Deputy Sheriff von Coconino County und hatte heute Dienst. Chee genehmigte sich noch einen Löffel voll Ragout, dann ging er zur Tür und zog den Vorhang zur Seite. Ein ziemlich neuer 150er-Ford-Pick-up hielt genau unter dem nächsten Baum. Am Steuer saß Officer Bernadette Manuelito und sah starr geradeaus. Wie es bei den Navajo Sitte ist, wartete sie zuerst eine Weile, damit er sich auf ihre Ankunft einstellen konnte.
Chee seufzte. Er war innerlich noch nicht bereit für Bernie. Sie erinnerte ihn daran, dass er sich früher oder später mit dem heiklen Thema Beziehung auseinandersetzen musste, aber wenn es nach ihm ging, eher später. Die Welt der Polizei ist klein; jeder kennt jeden. Hinter Chees Rücken tratschten die Kollegen darüber, dass Bernie in ihn verliebt sei. Das stimmte vermutlich, aber er wollte jetzt nicht darüber nachdenken. Er brauchte Zeit – Zeit, um erleichtert die Tatsache zu genießen, dass er vom Lieutenant zum Sergeant zurückgestuft worden war. Zeit, um über die Erstarrung wegzukommen, die ihn erfasst hatte, seit er begriffen hatte, dass er seine Beziehung zu Janet Pete, seiner eleganten, klugen, betörenden, treulosen Freundin, endgültig zerstört hatte. Er wollte nicht schon wieder Komplikationen. Doch er öffnete die Tür.
Manuelito hatte offenbar dienstfrei und war ohne Uniform unterwegs. In Jeans, Stiefeln, einem roten Hemd und einer Baseball Cap der Cleveland Indians stieg sie aus ihrem Pick-up. Sie sah zierlich, hübsch und ein wenig zerzaust aus – genau wie er sie in Erinnerung hatte. Doch sie wirkte bedrückt. Sogar ihr Lächeln sah angespannt aus. Chee verzichtete auf den Scherz, mit dem er sie hatte begrüßen wollen, bat sie stattdessen einfach herein und bot ihr den Stuhl an seinem Tisch an. Er selbst setzte sich auf die Kante seines Klappbetts und wartete.
»Willkommen zurück in Shiprock«, sagte sie.
»Ich bin froh, dass ich aus Tuba weg bin«, antwortete Chee. »Wie geht es Ihrer Mutter?«
»Unverändert«, sagte Bernie.
Im vergangenen Winter war ihre Mutter mehr und mehr im dunklen Nebel der Alzheimer-Krankheit versunken, und Bernie hatte darum gebeten, wieder nach Shiprock versetzt zu werden, um besser für sie sorgen zu können. Chees Transfer im Spätsommer dagegen hatte mit seiner Rückstufung vom stellvertretenden Lieutenant zum Sergeant zu tun. In Tuba brauchte man keinen zweiten Sergeant, in Shiprock schon.
»Eine furchtbare Krankheit«, bemerkte Chee.
Bernie nickte, sah ihn kurz an und wandte den Blick dann wieder ab. »Ich habe gehört, dass Sie oben in Alaska gewesen sind«, sagte sie. »Wie war’s?«
»Sehr eindrucksvoll. Ich bin mit dem Schiff die Küste hochgefahren.« Er wartete. Bernie war bestimmt nicht hergekommen, um zu hören, wie er seinen Urlaub verbracht hatte.
»Ich weiß nicht, wie ich mit der Sache umgehen soll«, begann sie und streifte ihn mit einem Seitenblick.
»Mit welcher Sache?«, fragte Chee.
»Sie sind mit dem Überfall auf das Spielkasino dienstlich nicht befasst, oder?«
Chee sah Probleme auf sich zukommen. »Nein«, antwortete er.
»Wie auch immer. Ich brauche einen Rat.«
»Ich würde sagen, Sie stellen sich am besten, geben das Geld zurück, legen ein umfassendes Geständnis ab und …« Chee hielt inne. Er wünschte, er hätte den Mund gehalten. Bernies Blick zeigte deutlich, dass dies nicht der richtige Augenblick für faule Witze war.
»Kennen Sie Teddy Bai?«
»Bai? Ist das dieser Mietpolizist, der bei dem Überfall verletzt wurde?«
»Teddy ist Deputy Sheriff in Montezuma County«, entgegnete Bernie kühl. »Den Job als Wachmann im Kasino hat er bloß nebenbei gemacht, und es sollte auch nur vorübergehend sein. Er wollte sich ein bisschen was dazuverdienen.«
»Ich wollte nicht …«, begann Chee und verstummte dann. Ehe er nicht wusste, worum es eigentlich ging, war es klüger, sich mit Äußerungen zurückzuhalten. So sagte er schließlich nur: »Ich kenne ihn nicht persönlich«, und wartete ab.
»Teddy liegt im Krankenhaus in Farmington auf der Intensivstation«, sagte Bernie. »Er hat drei Schüsse abbekommen. Einen Lungendurchschuss. Einen durch den Magen. Einen durch die rechte Schulter.«
Bernie schien Bai ja gut zu kennen, dachte Chee. Er selbst hatte alles, was er über den Fall wusste, aus Zeitung und Fernsehen, und diese Details über Bais Verwundung waren nirgendwo erwähnt worden. »Das San Juan Medical Center hat einen guten Ruf«, sagte er. »Ich denke, er wird …«
»Sie glauben, dass Teddy in den Überfall auf das Kasino verwickelt war«, unterbrach ihn Bernie. »Das heißt, das FBI glaubt das. Sie haben einen Polizeibeamten vor seinem Zimmer postiert.«
Chee sagte nur: »Oh?«, und wartete wieder. Falls Bernie wusste, wie das FBI zu dieser Vermutung kam, würde sie es ihm sagen. Aus den Medien hatte er nur erfahren, dass bei dem Überfall der Sicherheitschef des Kasinos getötet und ein Wachmann schwer verletzt worden war. Auf der Flucht hatten die Täter dann noch auf einen Polizisten geschossen, der sie in Utah auf dem Highway wegen überhöhter Geschwindigkeit hatte stoppen wollen.
Bernie sah aus, als würde sie gleich anfangen zu weinen. »Das ergibt doch keinen Sinn«, sagte sie.
»Ja, scheint mir auch so«, stimmte Chee ihr zu. »Warum sollten sie auf ihren eigenen Mann schießen?«
»Sie denken, dass Teddy ihnen den Tipp gegeben hat«, fuhr Bernie fort. »Und sie glauben, dass die Gangster ihn niedergeschossen haben, weil er ihre Namen kannte und weil sie ihm nicht trauten.«
Chee nickte. Er fragte sie nicht, woher sie diese vertraulichen Informationen hatte, er konnte es sich denken. Selbst wenn sie mit diesem Fall nichts zu tun hatte, so war sie doch Polizistin, und wenn sie etwas unbedingt erfahren wollte, dann wusste sie, an wen sie sich wenden musste.
»Klingt ziemlich schwach, finde ich«, sagte er. »Auf Stoner haben sie doch auch geschossen, und der war immerhin der Sicherheitschef. Man sollte meinen, dass eher er als Spitzel verdächtigt worden wäre.«
Er stand auf, goss Kaffee in eine Tasse und reichte sie Bernie. Das gab ihr ein wenig Zeit, um über ihre Antwort nachzudenken.
»Stoner war bei allen beliebt«, sagte sie. »Jedenfalls bei allen Älteren, die schon lange dabei sind. Und Teddy ist schon früher mal in Schwierigkeiten geraten. Als Jugendlicher ist er mal verhaftet worden, weil er einen Laster geklaut hat und einfach zum Spaß damit losgedüst ist.«
»Die Sache kann ja nicht so schlimm gewesen sein«, meinte Chee, »sonst hätte ihn der Bezirk wohl kaum als stellvertretenden Sheriff eingestellt.«
»Ja, das fiel noch unters Jugendstrafrecht«, sagte Bernie.
»Dann hat das doch heute überhaupt kein Gewicht mehr«, sagte Chee. »Haben sie sonst noch etwas gegen ihn in der Hand?«
»Nicht wirklich«, antwortete Bernie.
Chee wartete. Etwas in Bernies Gesicht sagte ihm, dass da noch etwas Schlimmeres kommen würde. Oder auch nicht. Vielleicht wollte sie es lieber für sich behalten.
Sie seufzte. »Die Angestellten des Kasinos sagen, er hätte sich merkwürdig verhalten. Sie sagen, er sei auffällig nervös gewesen. Anstatt die Kasino-Gäste im Auge zu behalten, sei er immer wieder nach draußen auf den Parkplatz gegangen. Und als seine Schicht zu Ende war, blieb er immer noch dort. Er sagte jemandem vom Reinigungsservice, dass er gleich abgeholt würde.«
»Ah so«, sagte Chee, »ich fange langsam an zu verstehen. Das FBI glaubt natürlich, dass Bai darauf gewartet hat, dass die Gangster aufkreuzen würden. Für den Fall, dass sie seine Hilfe brauchen.«
»Aber das stimmt nicht. Er hat auf jemand anderen gewartet.«
»Das lässt sich doch leicht klären. Wenn Bai wieder so weit hergestellt ist, dass er eine Aussage machen kann, dann erzählt er den Leuten vom FBI, auf wen er tatsächlich gewartet hat. Die prüfen das nach, und wenn seine Angaben bestätigt werden können, ziehen sie den Polizisten vor seinem Zimmer wieder ab«, sagte Chee und dachte bei sich, dass das Ganze wohl noch einen Haken hatte.
»Ich glaube nicht, dass er ihnen etwas erzählen wird«, sagte Bernie.
»Oh. Das heißt, er wartete an dem Abend auf eine Frau, oder?« Er fragte nicht, woher Bernie diese Einzelheiten wusste oder warum sie das alles nicht an das FBI weitergegeben hatte. Er fragte sie auch nicht, warum sie ihm das alles erzählte.
»Ich weiß nicht, was ich tun soll«, begann Bernie wieder.
»Am besten nichts«, meinte Chee. »Wenn Sie damit zum FBI gehen, werden die sofort fragen, woher Sie diese Informationen haben. Dann werden sie mit Bais Frau reden, und es wird eine gewaltige Ehekrise geben.«
»Teddy ist nicht verheiratet.«
Chee nickte. Es konnte alle möglichen Gründe geben, warum ein Mann geheim halten wollte, dass er gegen vier Uhr morgens von einer Frau abgeholt werden sollte. Allerdings fiel ihm selbst auf die Schnelle kein nachvollziehbarer Grund ein.
»Sie werden ihm zusetzen, damit er ihnen sagt, wer die Gangster waren«, fuhr Bernie fort. »Sie werden einen Grund finden, ihn festzuhalten, bis er ausgepackt hat. Aber Teddy kann ihnen nichts sagen, weil er die Männer gar nicht kennt. Ich habe Angst, dass die Feds ihm dann irgendetwas anhängen, damit sie ihn nicht gehen lassen müssen.«
»Ich bin gerade erst aus Alaska zurück«, sagte Chee, »deshalb weiß ich über die Ermittlungen so gut wie nichts. Aber ich wette, dass die beim FBI inzwischen eine ziemlich genaue Vorstellung haben, nach wem sie suchen müssen.«
Bernie schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube nicht«, sagte sie. »Nach allem, was ich gehört habe, tappen sie zurzeit wieder völlig im Dunkeln. Anfangs haben sie einen politischen Hintergrund vermutet. Sie sind davon ausgegangen, dass die Täter aus einer der rechtsgerichteten paramilitärischen Gruppen kommen. Aber die Ermittlungen in dieser Richtung haben wohl nichts gebracht. Im Augenblick haben sie keine konkreten Spuren, denen sie nachgehen könnten.«
Chee nickte. Das würde erklären, wieso das FBI die Öffentlichkeit so schnell über das gestohlene Flugzeug informiert hatte. Auf diese Weise wurde der Agent, der mit dem Fall betraut war, etwas entlastet.
»Sind Sie sicher, dass Bai auf eine Frau gewartet hat? Wissen Sie, wer das war?«
Bernie zögerte einen Moment. »Ja.«
»Und wären Sie bereit, das den FBI-Leuten zu sagen?«
»Das würde ich wohl tun, wenn es unbedingt sein muss.« Sie stellte die Kaffeetasse auf den Tisch zurück, ohne davon getrunken zu haben. »Wissen Sie, was mir durch den Kopf gegangen ist? Ich hab darüber nachgedacht, dass Sie ja lange Zeit hier gearbeitet haben, bevor Sie nach Tuba versetzt worden sind. Sie kennen bestimmt immer noch eine Menge Leute in der Gegend. Jetzt, wo die Feds glauben, dass sie schon wissen, wer der Spitzel war, werden sie sich wohl nicht sonderlich anstrengen, nach dem richtigen Mann zu suchen. Ich dachte, Sie könnten vielleicht herausfinden, wer vom Kasinopersonal tatsächlich den Gangstern geholfen hat. Wenn Sie’s nicht können, kann es niemand.«
Jetzt zögerte Chee. Er nippte an seinem Kaffee, der inzwischen kalt geworden war, und versuchte, seine widerstreitenden Empfindungen in dieser Sache zu sortieren. Bernies Vertrauen in ihn war sicherlich schmeichelhaft, aber durch nichts gerechtfertigt. Und warum empfand er so etwas wie Enttäuschung bei dem Gedanken, dass Bernie mit diesem Mietcop ein Verhältnis hatte? Eigentlich sollte er doch erleichtert sein. Stattdessen überkam ihn ein Gefühl von Leere und Verlassenheit.
»Ich werde mich mal umhören«, versprach er.
3
Im Speiseraum des Navajo Inn in Window Rock saß nur ein einziger Gast. Er hatte ganz hinten an einem Ecktisch Platz genommen. Auf dem Kopf trug er einen Stetson aus grauem Filz, der schon bessere Tage gesehen hatte, vor ihm stand ein Glas Milch, und er hatte sich in den Gallup Independent vertieft.
Eine Weile blieb Joe Leaphorn in der Tür stehen und musterte den Mann eingehend. Roy Gershwin sah älter, sehr viel verwitterter und weit abgekämpfter aus, als er ihn in Erinnerung hatte. Aber es war ja auch schon einige Jahre her, seit er ihn zuletzt getroffen hatte. Damals hatte Gershwin ihm geholfen, einen Ranger des US-Forstdienstes zu überführen, der sein Gehalt dadurch aufbesserte, dass er Anasazi-Grabstätten plünderte, die auf Gershwins Weideland lagen. Das war mindestens sechs Jahre her, etwa um die Zeit, als sich Leaphorn allmählich mit dem Gedanken anfreundete, sich vom aktiven Dienst zurückzuziehen. Doch die Bekanntschaft der beiden Männer reichte sehr viel weiter zurück – bis in jenen Sommer, als Leaphorn, damals noch neu im Polizeidienst, einen von Gershwins Arbeitern unter dem Verdacht der Vergewaltigung verhaftet hatte. Gershwin hatte wütend protestiert, er habe einen Unschuldigen festgenommen. Er hatte recht gehabt. Nach diesem schlechten Start war die Sache dann doch noch gut ausgegangen. Das war das erste Mal, dass er Gershwins tiefe, immer ein wenig barsche, vom Whisky gegerbte Stimme gehört hatte. Als Leaphorn an diesem Morgen seinen Anruf erhielt, erkannte er diese unverwechselbare Stimme sofort wieder.
»Lieutenant Leaphorn«, hatte Gershwin begonnen, »man hat mir gesagt, Sie seien jetzt im Ruhestand. Stimmt das? Wenn ja, dann dürfte ich Sie wohl eigentlich gar nicht behelligen.«
»Ja, das stimmt, Mr Gershwin«, hatte Leaphorn geantwortet. »Lassen Sie den Lieutenant also ruhig weg, und nennen Sie mich einfach Mr Leaphorn. Ich freue mich, mal wieder von Ihnen zu hören.«
Was er da sagte, hatte ihn selbst überrascht. So weit hatten ihn also der Ruhestand und seine Zukunftsaussichten gebracht. Der alte Rancher war nie ein Freund im eigentlichen Sinne gewesen. Er war nur einer von den vielen Tausend Menschen, mit denen er im Laufe seines langen Polizistenlebens zu tun gehabt hatte. Aber inzwischen war er tatsächlich froh über jeden Anruf, froh, überhaupt mit jemandem reden zu können.
Doch Gershwin schwieg. Er schwieg lange. Endlich räusperte er sich und begann zu erzählen. »Wahrscheinlich sind Sie darüber nicht sonderlich überrascht. Ich habe Sie angerufen, weil ich ein Problem habe. Als Polizist haben Sie diesen Satz bestimmt schon von vielen Leuten gehört.«
»Das bringt der Job so mit sich«, bestätigte Leaphorn. Vor zwei Jahren noch hätte er über solche Anrufe nur ärgerlich gebrummelt. Heute nicht mehr. Die Einsamkeit hatte vieles verändert.
»Also«, fuhr Gershwin fort, »es gibt da etwas, von dem ich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll. Ich würde gerne mit Ihnen darüber reden.«
»Na, dann fangen Sie mal an.«
»Leider geht es dabei um eine Sache, die man lieber nicht am Telefon besprechen sollte«, entgegnete Gershwin.
Sie hatten sich dann für drei Uhr im Navajo Inn verabredet. Jetzt war es genau drei Minuten vor drei. Gershwin blickte auf, sah Leaphorn kommen, stand auf und bot ihm einen Stuhl an.
»Verdammt nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind«, sagte er. »Ich hatte schon Angst, Sie würden mir sagen, dass ich, jetzt, da Sie aus dem Polizeidienst ausgeschieden sind, mit meinen Problemen jemand anderem auf die Nerven gehen soll.«
»Wenn ich helfen kann: gerne«, antwortete Leaphorn.
Sie brachten die obligatorischen sozialen Formalitäten zügiger als sonst hinter sich, sprachen über den kalten, trockenen Winter, über die mageren Weidegründe, über die Waldbrandgefahr und waren sich einig, dass der Wetterbericht von gestern Abend ganz danach geklungen hatte, als ob nun bald die Regenzeit einsetzen würde. Dann kamen sie zur Sache.
»Und was hat Sie nun den weiten Weg hierher nach Window Rock geführt?«, wollte Leaphorn wissen.
»Ich habe gestern im Radio gehört, dass das FBI die Ermittlungen wegen des Überfalls im Ute-Spielkasino in den Sand gesetzt hat. Wissen Sie was darüber?«
Leaphorn schüttelte den Kopf. »Was die Polizeiarbeit angeht, bin ich inzwischen ganz draußen. Ich weiß nicht, wie weit die mit ihren Ermittlungen sind. Aber es wäre ja nicht das erste Mal, dass eine Untersuchung schiefgeht.«
»Im Radio haben sie gesagt, dass sie nach einem Flugzeug suchen«, sagte Gershwin. »Aber diese Gangster würden doch nichts fliegen können, das komplizierter ist als ein Kinderdrachen.«
Leaphorn hob die Augenbrauen. Allmählich wurde es interessant. Nach allem, was er zuletzt gehört hatte, hatten die Ermittler absolut keinen Hinweis auf die Täter. Aber Gershwin war vielleicht gekommen, um ihm etwas über sie zu erzählen. Er würde ihn einfach reden lassen.
»Möchten Sie etwas trinken?«, fragte Gershwin und winkte den Kellner heran. »Wirklich ein Jammer, dass ihr hier noch Alkoholverbot habt. Vielleicht eins von diesen Pseudo-Bieren?«
»Einen Kaffee, bitte«, sagte Leaphorn.
Der Kellner brachte ihm den Kaffee, und Leaphorn trank einen Schluck. Gershwin nippte an seiner Milch.
»Ich kannte Cap Stoner«, sagte er. »Man darf seine Mörder nicht davonkommen lassen. Diese Leute stellen eine Gefahr dar, solange sie frei herumlaufen.«
Er schien auf eine Reaktion zu warten.
Leaphorn nickte.
»Besonders die beiden Jüngeren. Die sind halb verrückt.«
»Das klingt, als ob Sie sie kennen«, bemerkte Leaphorn.
»Ja, ziemlich gut.«
»Haben Sie das schon dem FBI gesagt?«
Gershwin studierte eingehend sein Glas Milch und stellte fest, dass es halb leer war. Er nahm es in die Hand und schwenkte es langsam. Seinem langen, schmalen Gesicht mit den unzähligen Fältchen und den Sonnenbrandspuren sah man an, dass es gut siebzig Jahre lang der trockenen Luft, der brennenden Sonne und dem Sand ausgesetzt gewesen war. Er richtete seine hellen, blauen Augen auf Leaphorn und schüttelte den Kopf.
»Es gibt da ein Problem«, sagte er. »Wenn ich dem FBI Bescheid sage, spricht sich das hier in der Gegend bald herum. Eher früher als später. Die Feds würden auf die Ranch kommen, um mich auszufragen, oder sie würden versuchen, mich über Sprechfunk zu erreichen. Und Sie wissen ja, wie der funktioniert – jeder kann mithören. Das ist schlimmer als die alten Sammelanschlüsse.«
Leaphorn nickte. Wenn er sich richtig erinnerte, war von Gershwins Ranch aus die nächste kleine Gemeinde entweder Montezuma Creek oder Bluff. In so einer Gegend blieben Besuche von gut gekleideten FBI-Agenten mit Sicherheit nicht unbemerkt, und dann würde garantiert das Gerede losgehen.
»Erinnern Sie sich noch, wie die Sache im Frühjahr ’98 ausging?«, fuhr Gershwin fort. »Das FBI hat irgendwann bekannt gemacht, dass die Männer tot seien, nach denen sie gefahndet hatten. Aber die Leute, die der Polizei damals Tipps gegeben oder den Cops sonst wie geholfen haben, achten bis heute verdammt genau darauf, dass die Türen verschlossen, die Gewehre geladen und die Wachhunde auf dem Posten sind.«
»Hat das FBI nicht gesagt, dass die Bande von 1998 zu den Preppern gehört hat? Sind das jetzt wieder dieselben Leute?«, fragte Leaphorn.
Gershwin lachte. »Dieselben können es nur dann sein, wenn die Feds das letzte Mal die falschen Leute erwischt haben.«
»Ich komme mal auf den Punkt, um den es vermutlich geht«, sagte Leaphorn, »und Sie sagen mir, ob ich richtigliege: Sie wollen, dass das FBI die Männer fasst, aber es soll nicht bekannt werden, wer den Hinweis gegeben hat. Und deshalb wollen Sie mich bitten, dass ich …«
»Egal, ob das FBI die Männer nun fasst oder nicht«, unterbrach ihn Gershwin.
»Also, das FBI behauptet, dass die Banditen von 1998 zu einer Survivalist-Organisation gehörten. Glauben Sie das auch?«, hakte Leaphorn noch einmal nach.
»Ich glaube, sie nennen sich die Rights Militia, und sie reiten ständig auf der Bill of Rights herum. Sie setzen die Leute von der Forstverwaltung, vom Bureau of Land Management und vom Park Service gewaltig unter Druck, damit die Leute hier draußen das Land so bewirtschaften und nutzen können, wie sie es für richtig halten.«
»Sie wollen mir also die Namen der Männer nennen, und ich soll sie dann ans FBI weitergeben. Und was soll ich sagen, wenn die Feds mich fragen, woher ich die Information habe?«
Gershwin grinste ihn an. »Ich habe mir das Vorgehen ein bisschen anders vorgestellt«, sagte er. »Ich habe die Namen auf einem Zettel notiert. Und Sie geben mir Ihr Ehrenwort, dass Sie mich aus allem raushalten. Wenn Sie sich nicht darauf einlassen, nehme ich den Zettel wieder mit. Wenn Sie mir aber mit Handschlag Ihr Ehrenwort geben, lasse ich den Zettel hier auf dem Tisch liegen, bevor ich gehe. Wenn Sie wollen, können Sie ihn dann an sich nehmen.«
»Und Sie meinen, Sie können mir trauen?«
»Aber sicher«, sagte Gershwin. »Ich habe ja meine Erfahrung mit Ihnen. Wissen Sie noch? Außerdem kenne ich noch eine Reihe anderer Leute, die Ihnen vertraut haben, ohne es zu bereuen.«
»Warum ist es Ihnen so wichtig, dass diese Männer gefasst werden?«, wollte Leaphorn wissen. »Rache für Cap Stoner?«
»Ja, aber nur zum Teil«, antwortete Gershwin. »Diese Typen sind mir einfach unheimlich. Jedenfalls einige von ihnen. Ganz zu Anfang habe ich ja selbst eine Weile bei diesen politischen Geschichten mitgemacht. Aber im Laufe der Zeit wurden sie immer unberechenbarer.«
Gershwin wollte jetzt seine Milch austrinken, aber dann setzte er das Glas wieder ab. »Diese Mistkerle von der Forstverwaltung haben sich aufgeführt, als ob ihnen die Berge gehören würden«, sagte er. »Wir haben hier gelebt, solange wir zurückdenken können, aber auf einmal durften wir unser Vieh nicht mehr weiden lassen. Wir durften kein Holz mehr schlagen. Durften keine Wapitihirsche mehr jagen. Und die Bürokraten vom Bureau of Land Management waren noch schlimmer. Die haben uns behandelt, als wären wir Leibeigene und sie wären die Lords. Anfangs ging’s uns nur darum, beim Kongress zumindest gehört zu werden. Irgendjemand sollte diese Schreibtischhengste endlich mal wieder daran erinnern, wer eigentlich ihr Gehalt bezahlt. Aber dann tauchten irgendwann all diese Spinner und durchgeknallten Typen auf. Diese Earth-First-Kerle wollten die Brücken sprengen, die von den Holzfirmen benutzt wurden. Solche Aktionen waren ihr Ding. Und als dann noch New-Age-Typen und Survivalists und Stop-World-Government-Leute dazugekommen sind, habe ich mich zurückgezogen.«
»Sie meinen, dass ein paar von diesen Leuten für den Überfall auf das Kasino verantwortlich sind? Hatte die ganze Aktion einen politischen Hintergrund?«
Gershwin zuckte die Achseln. »Soweit ich gehört habe, wollten sie mit dem Überfall ihr großes Vorhaben finanzieren. Aber ich glaube, dass wenigstens ein paar aus der Gruppe ganz einfach Geld brauchten, um über die Runden zu kommen.« Er lächelte ironisch. »Wenn man überhaupt nicht arbeitet, könnte man so einen Überfall vielleicht als politische Aktion hinstellen. Aber wer weiß? Vielleicht hatten sie tatsächlich vor, Gewehre, Munition, Sprengstoff und all so was zu kaufen. Das behaupten jedenfalls die Leute aus der Gruppe, die ich kenne: Sie sagten, sie hätten Geld gebraucht, um sich gegen die Regierung zu bewaffnen.«
»Ich frage mich, wie viel sie wohl erbeutet haben«, sagte Leaphorn.
Gershwin leerte sein Glas. Er stand auf und zog ein zusammengefaltetes Stück Papier aus seiner Hemdtasche. »Hier ist der Zettel mit den Namen, Joe. Kann ich mich auf Sie verlassen? Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie mich nicht reinreiten?«
Leaphorn hatte in Gedanken alles schon durchgespielt. Er könnte dem FBI von diesem Gespräch berichten. Die würden dann Gershwin ausfragen. Und der würde selbstverständlich alles abstreiten. Ergebnis – gleich null.
»Legen Sie ihn hin«, sagte er.
Gershwin ließ den Zettel auf den Tisch fallen, warf eine Dollarnote neben sein Milchglas und ging davon, vorbei an dem Kellner, der gerade an den Tisch gekommen war, um Leaphorns Tasse nachzufüllen.
Leaphorn trank einen Schluck Kaffee. Dann nahm er den Zettel und faltete ihn auseinander. Drei Namen standen darauf, jeder mit einer kurzen Beschreibung dahinter. Die beiden ersten, Buddy Baker und George Ironhand, sagten ihm nichts. Am dritten aber blieb er hängen. Everett Jorie. Den Namen hatte er irgendwann vor langer Zeit schon mal gehört.
4
Captain Largo sah von seinen Unterlagen hoch, die er gerade gelesen hatte, musterte Chee über den Rand seiner Brille hinweg und sagte: »Sie sind ein paar Tage zu früh, oder? Mit Ihrem Kalender was nicht in Ordnung?«
»Captain, Sie haben ganz vergessen zu sagen: ›Willkommen daheim. Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Setzen Sie sich doch, machen Sie es sich bequem.‹«
Largo grinste und wies auf den Stuhl vor seinem Schreibtisch. »Ich trau mich kaum zu fragen, aber wieso haben Sie es so eilig, wieder an die Arbeit zu kommen?«
Chee setzte sich. »Ich dachte, ich gewöhne mich schön langsam wieder an das normale Arbeitstempo. Außerdem wollte ich rausfinden, was ich in der Zwischenzeit verpasst habe. Und wie Sie es geschafft haben, dass wir nicht in eine neue Großfahndung reingezogen worden sind. Da wären wir mal wieder die Spürhunde fürs FBI gewesen.«
»Die Meldung über das gestohlene Flugzeug ist gerade noch rechtzeitig gekommen«, sagte Largo. »Zum Glück. Andererseits ist es natürlich unerträglich, dass diese Verbrecher auf Polizisten schießen und einfach so davonkommen. Wirft nach dem Fiasko vom Frühjahr ’98 schon wieder ein schlechtes Licht auf die Polizei. Wollen Sie einen Kaffee? Holen Sie sich eine Tasse, und dann unterhalten wir uns. Erst sagen Sie mir, warum Sie hier aufgekreuzt sind, und dann erzählen Sie mir von Alaska.«
Chee kam mit seinem Kaffee zurück. Er setzte sich, nahm einen Schluck und wartete. Auch Largo wartete – aber noch hartnäckiger als Chee.
»Na gut«, sagte Chee, »erzählen Sie mir von dem Überfall auf das Kasino. Ich weiß bis jetzt nur das, was ich in der Zeitung gelesen habe.«
Largo lehnte sich auf seinem Stuhl zurück und verschränkte die Arme über seinem ausladenden Bauch. »Letzten Samstag, kurz vor vier Uhr nachts, fährt ein Pick-up auf den Parkplatz des Kasinos. Ein Mann steigt aus, nimmt eine Leiter von der Ladefläche, klettert aufs Dach und kappt Strom- und Telefonleitungen – einfach alles. Während er noch am Arbeiten ist, fährt ein zweiter Pick-up vor, und zwei Männer in Tarnanzügen steigen aus. Nicht weit von ihnen steht ein Wachmann, ein Typ namens Bai, hauptberuflich Deputy Sheriff von Montezuma County. In diesem Augenblick kommt der Chef des Wachdienstes, Cap Stoner, aus dem Gebäude gerannt, und die Tarnanzug-Männer schießen auf Bai und Stoner. Erinnern Sie sich noch an Stoner? Er war Captain bei der New Mexico State Police. Ist von Gallup aus eingesetzt worden. Ein wirklich anständiger Kerl. Die zwei Gangster dringen in den Kassenraum ein. Das Geld liegt schon fertig verpackt da für den Geldtransporter von Brinks. Die Gangster befehlen allen, sich auf den Boden zu legen, schnappen sich die Geldsäcke und verschwinden. Offenbar sind die drei Typen Richtung Westen nach Utah geflohen. Jedenfalls versucht bei Tagesanbruch ein Streifenpolizist der Utah-Highway-Police auf der Route 262 westlich von Aneth, einen Pick-up zu stoppen, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs ist, und fängt sich Schüsse in den Kühler ein. Utah sagt, es sei großkalibrige Munition mit starker Durchschlagskraft gewesen.«
Largo legte eine Pause ein und wuchtete seinen massigen Körper ächzend aus seinem Drehstuhl. »Jetzt brauche ich selber einen Schluck von meinem Kaffee«, murmelte er und nahm Kurs auf das Vorzimmer, wo die Kaffeemaschine stand.
Ein gutes Gefühl, wieder unter Largo zu arbeiten, dachte Chee. Largo war schon in Chees erstem Jahr bei der Polizei sein Chef gewesen. Er hatte seine Launen gehabt, aber er verstand seine Sache.