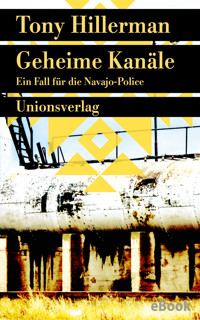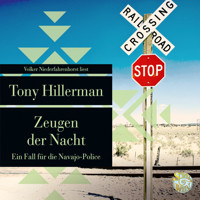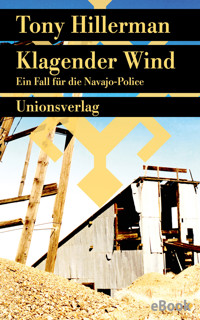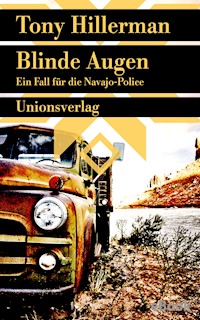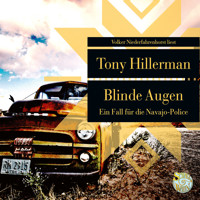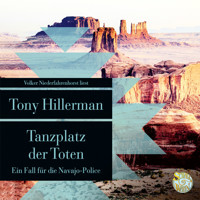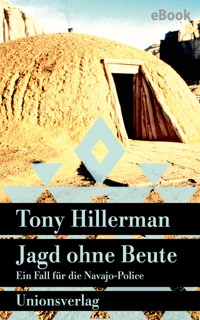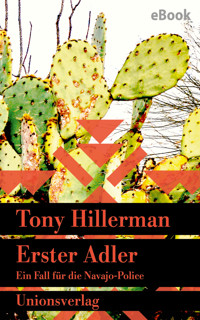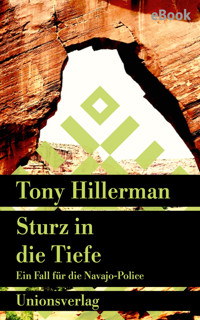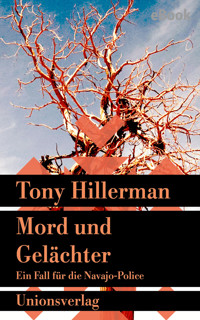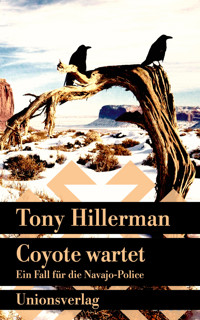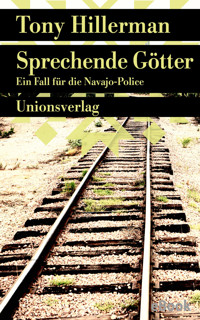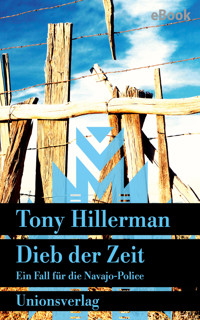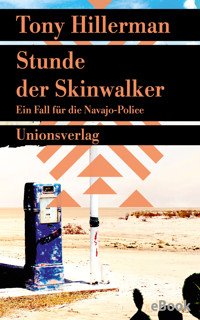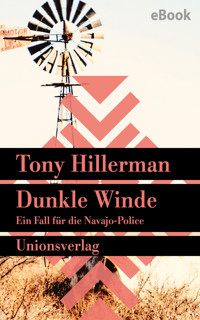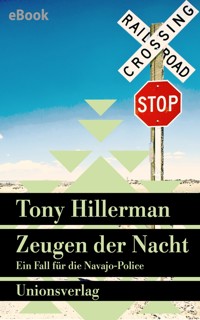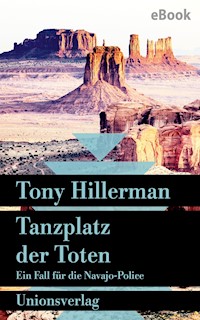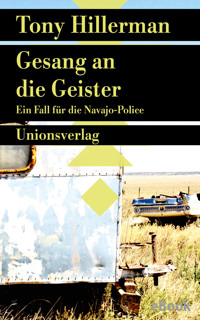
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Über der Colorado-Hochebene geht gerade die Sonne unter, als der alte Joseph Joe vor der Münzwäscherei Zeuge eines Mordes wird. Ein Mann wird auf offener Straße erschossen, der Täter flieht in die Schatten des umliegenden Shiprock-Massivs. Officer Jim Chee von der Navajo-Police soll den Mann aufspüren. Joes Beschreibungen führen ihn zu einem abgelegenen Hogan, der Chee vor ein Rätsel stellt: Warum wurde der Ort, entgegen den Navajo-Traditionen, dem Tod überlassen? Die Ermittlungen zwingen Chee, die Tabus seiner eigenen Religion zu hinterfragen und führen ihn weit über die Grenzen der Navajolands hinaus – bis in die schummrige Unterwelt von Los Angeles. Verfilmt als Serie »Dark Winds – Der Wind des Bösen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 379
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
Auf der Colorado-Hochebene beobachtet der alte Joseph Joe eine Schießerei vor dem Waschsalon, der Täter flieht in den Schatten des umliegenden Shiprock-Massivs. Joes Beschreibungen führen Jim Chee zu einem abgelegenen Hogan, in dem der Tod wohnt, und über die Grenzen der Navajolands hinaus in die schummrige Unterwelt von Los Angeles.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tony Hillerman (1925-2008) besuchte ein Internat für Native Americans, kämpfte im Zweiten Weltkrieg, studierte Journalismus und war als Journalist und Dozent tätig. Seine Romane um die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee wurden vielfach ausgezeichnet und in siebzehn Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Tony Hillerman.
Klaus Fröba (*1934) ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Übersetzer, er veröffentlichte Jugendbücher und Kriminalromane. Er übersetzte aus dem Englischen, u. a. Werke von Jeffrey Deaver, Ira Levin, Tony Hillerman und Douglas Preston. Fröba lebt in der Nähe von Bonn.
Zur Webseite von Klaus Fröba.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tony Hillerman
Gesang an die Geister
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Klaus Fröba
Ein Fall für die Navajo-Police (5)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Worterklärungen und Hintergrundinformationen zu diesem Buch auf https://ehillerman.unm.edu/encyclopedia-main
Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Frank Schmitter nach dem Original durchgesehen und grundlegend überarbeitet.
Die Originalausgabe erschien 1984 bei Dennis McMillan Publications, San Diego.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1987 unter dem Titel Das Tabu der Totengeister im Rowohlt Verlag, Reinbek.
Originaltitel: The Ghostway
© by Tony Hillerman 1984
Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Klaus Fröba beim Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
© by Unionsverlag, Zürich 2023
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hintergrund – Sheryl Savas (Alamy Stock Foto); Symbol – Tetiana Lazunova (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31163-3
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 23.08.2023, 18:20h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
GESANG AN DIE GEISTER
1 – In Hosteen Joseph Joes Erinnerung hatte es sich …2 – Komische Sache, so eine Vorahnung«, sagte der Deputy …3 – In der trockenen Gebirgsregion der Colorado-Hochebene ist Nebel …4 – Jetzt kommts darauf an, dass wir die Leiche …5 – Der beginnende Winter drängte von Kanada zum Colorado …6 – Das Mädchen hieß Sosi. Margaret Billy Sosi …7 – Joseph Joe zu finden, erwies sich nicht als …8 – Das Licht spielte ins Rötliche hinüber. Die Sonne …9 – Jim Chee war bei seinem Vortrag über das …10 – Einen silberfarbenen Wohnwagen zu finden, der irgendwo in …11 – Es würde sogar mehr Zeit und Mühe erfordern …12 – Die Adresse »elf-sieben-eins-dreizehn La Monica Street«, die Sharkey …13 – Zeit zu vertrödeln war nicht Vaggans Art …14 – Chee erwachte abrupt, das war immer so bei …15 – Der Mann, den McNair Henry nannte, brachte Vaggan …16 – Jim Chee hatte sich immer für einen ausgezeichneten …17 – Die Sonne, die sich allmählich zum westlichen Horizont …18 – Chee fuhr sehr langsam. Unter einem Himmel …19 – Vaggan hatte, schon als er auf den brüchigen …20 – Chee hörte draußen auf dem Flur Shaws laute …21 – Am Nachmittag rief er Mary Landon an …22 – Die Entfernung von Flagstaff, das am westlichen Rand …23 – Drei Stunden brauchte Chee für die Rückfahrt aus …24 – Während der Kaffee durch die Maschine lief …25 – Es war fast dunkel, als Chee bei der …26 – Chee öffnete das Handschuhfach und zog unter den …27 – Als Chee nach Shiprock zurückkam, lag das Kuvert …Mehr über dieses Buch
Über Tony Hillerman
»Der Angst vor seinem Pferd hat«
Claus Biegert: Die Navajo-Romane — ein Fall von Kultureller Wertschätzung
Über Klaus Fröba
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tony Hillerman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema USA
Für Margaret Mary
Mit besonderem Dank an Sam Bingham und die Schüler der Rock Point Community School, die mir geduldig erläuterten, wie die Navajo unserer Zeit mit den chindis von Diné Bike’yah umgehen.
1
In Hosteen Joseph Joes Erinnerung hatte es sich so abgespielt:
Er kam gerade aus der Shiprock-Münzwäscherei, als er den grünen Wagen bemerkte. Der rote Schein der untergehenden Sonne spiegelte sich in seiner Windschutzscheibe. Über der Linie der gelben Pappeln am San Juan River ragte bläulich schwarz die Silhouette des Shiprock in den glühenden Himmel. Der Wagen sah brandneu aus, er rollte langsam über den Schotter, der Fahrer lehnte sich leicht aus dem Seitenfenster. Und dann rief er zu Joseph Joe: »He, du!«, schrie er beinahe. »Komm mal her.«
Joseph Joe erinnerte sich daran ganz genau. Der Fahrer sah wie ein Navajo aus. Aber ihn so anzubellen, passte nicht zu einem Navajo, denn Joseph Joe war einundachtzig Jahre alt, und die Leute rund um Shiprock und oben in den Chuska Mountains nannten ihn Hosteen – das bedeutete »alter Mann« und war ein Ausdruck ihres großen Respekts.
Joseph Joe stellte den Wäschesack hinten auf die Ladefläche des Pick-ups, der seiner Tochter gehörte, und ging zu dem Wagen hinüber. Dabei bemerkte er, dass er keine gelben Nummernschilder hatte wie in New Mexico und keine weißen wie in Arizona. Diese hier waren blau.
»Ich suche einen Mann namens Gorman«, sagte der Fahrer. »Leroy Gorman. Ein Navajo. Ist kürzlich hergezogen.«
»Ich kenne ihn nicht«, sagte Joseph Joe. Er sagte es auf Navajo, denn beim Näherkommen hatte er festgestellt, dass sein erster Eindruck stimmte. Der Mann war ein Navajo. Aber der Fahrer runzelte nur die Stirn.
»Sprichst du Englisch?«, fragte er.
»Ich kenne keinen Leroy Gorman.« Diesmal sprach Hosteen Joe Englisch.
»Er muss seit ein paar Wochen hier sein«, meinte der Fahrer, »so ein junger Bursche. Nicht viel älter als ich. Mittelgroß. Verdammt, in so einem kleinen Nest müsstest du ihn eigentlich gesehen haben.«
»Ich kenne ihn nicht«, wiederholte Joseph Joe. »Und ich wohne nicht hier. Ich lebe bei meiner Tochter, draußen am Shiprock.« Dazu wies er mit einer unbestimmten Geste zur Grenze nach Arizona hinüber, auf den alten Vulkan, dessen Kegel sich scharf gegen den Sonnenuntergang abzeichnete. »Ich kenne die Leute hier nicht alle«, ergänzte er.
»Ich wette, du hast ihn doch schon gesehen«, sagte der Mann im Auto. Er nahm seine Brieftasche und zog ein Foto heraus. »Das ist er.« Er gab Hosteen Joe das Foto.
Joseph Joe betrachtete es aufmerksam, höflich – wie es sich gehörte. Es war ein Polaroid, genauso wie die, die seine Enkelin immer machte. Auf der Rückseite stand etwas, und auch eine Adresse war dort notiert. Das Bild zeigte einen Mann an der Tür eines Wohnwagens, das Ganze halb im Schatten einer Pappel. Hosteen Joe nahm seine Brille heraus, putzte die Gläser sorgfältig an seinem Ärmel und sah sich lange das Gesicht des jungen Mannes an. Es kam ihm nicht bekannt vor, und das sagte er dem Mann im Auto auch, als er ihm das Foto zurückgab. An das, was danach geschah, erinnerte er sich nicht mehr so genau, weil sich die Dinge plötzlich überstürzten.
Der Mann im Auto sagte gerade etwas über den Wohnwagen, möglicherweise, dass Gorman darin wohne oder dass er ihn verkaufen wolle oder so etwas, und dann war da das scharfe Bremsgeräusch eines Wagens auf dem Highway, Reifen quietschten, ein Motor heulte auf, der Wagen setzte zurück und fuhr auf den Parkplatz der Münzwäscherei. Auch dieser Wagen war ganz neu, eine Ford-Limousine.
Der Ford hielt dicht vor dem anderen Wagen. Ein Mann in einem karierten Mantel stieg aus, kam auf sie zu und blieb dann plötzlich stehen. Offenbar hatte er Joseph Joe erst jetzt bemerkt. Er sagte etwas zu dem im Auto. Soweit Joseph Joe sich erinnerte, war es »Hallo, Albert«, aber der im Auto erwiderte nichts. Der Typ im Mantel redete auf ihn ein. »Du hältst dich nicht an unsere Anweisungen. Du hast hier nichts verloren. Du kommst jetzt mit mir.« Oder so etwas in der Art. Dann wandte er sich an Joseph Joe und sagte: »Wir haben was zu regeln, Alter. Verzieh dich.«
Hosteen Joe drehte sich um und ging zurück zum Pick-up seiner Tochter. Er hörte, wie eine Wagentür geöffnet wurde. Dann zugeschlagen. Danach ein Schrei. Der scharfe Knall eines Pistolenschusses. Und dann noch ein Schuss – noch einer und noch einer. Als er sich umdrehte, sah er, dass der Mann im karierten Mantel auf dem Schotter lag und der andere, der aus dem grünen Auto ausgestiegen war, sich kurz an der Wagentür festhielt, bevor er wieder einstieg und losfuhr. Oben an der Straße bog er zum Fluss ab, in Richtung Kreuzung. Von dort konnte er entweder nach Westen fahren, Richtung Teec Nos Pos, oder nach Süden, auf Gallup zu.
Aus der Münzwäscherei kamen jetzt Leute gerannt und schrien durcheinander. Hosteen Joe aber schaute nur auf den Mann, der seitlich verkrümmt auf dem Schotter lag, die Pistole neben ihm auf dem Boden, aus seinem Mund floss Blut. Dann stieg er in den Pick-up seiner Tochter.
Der Fahrer war ein Navajo gewesen. Aber um diese ganze Angelegenheit hier mussten sich die Weißen kümmern.
2
Komische Sache, so eine Vorahnung«, sagte der Deputy. »In den fast dreißig Jahren, die ich schon dabei bin, hatte ich vorher nie eine.«
Jim Chee ging nicht darauf ein. Er versuchte gerade, sich in genau den Augenblick zurückzuversetzen, als ihm klar geworden war, dass mit Mary Landon alles schiefging. Für die Vorahnungen des Deputy war kein Platz in seinen Gedanken. Er hatte zu Mary irgendetwas über seinen Wohnwagen gesagt, dass er zu klein sei für sie beide, und Mary hatte gefragt: »He, Moment mal, Jim Chee, was hast du eigentlich wegen deiner Bewerbung beim FBI unternommen?« Und er hatte ihr gesagt, dass er sich entschlossen habe, sie nicht abzuschicken. Und Mary hatte neben ihm im Crownpoint Café gesessen und schweigend an ihm vorbeigeguckt, schließlich geseufzt, den Kopf geschüttelt und gesagt: »Warum solltest du auch anders sein als alle anderen?« Sie hatte gelacht, aber es war ein bitteres Lachen.
All das ging ihm durch den Kopf, während er sich gleichzeitig aufs Fahren konzentrierte, immer den steinigen Weg entlang, der hoch auf den Bergrücken der Chuska Mountains führte. Der Mond stand tief, es waren die Nachtstunden unerbittlich kalter Dunkelheit, kurz vor dem ersten grauen Licht des neuen Tages. Chee fuhr nur mit Standlicht, Sharkey hatte das so gewollt. Das bedeutete, dass er langsam fahren musste und dass er Gefahr lief, irgendwo an einer Weggabel die falsche Abzweigung zu nehmen, die dann zu einer Quelle führte oder zu einem einsamen Hogan oder zu einer Schaftränke oder wer weiß wohin. Dass sie so langsam vorankamen, machte Chee keine Sorgen. Sharkeys Plan sah vor, dass sie rechtzeitig vor Tagesanbruch bei Hosteen Begays Hogan waren, um noch ihre Positionen einnehmen zu können. Sie hatten eine Menge Zeit. Sorgen machte ihm nur, dass er den falschen Weg erwischen könnte. Und Mary Landon spukte durch seine Gedanken. Außerdem hatte der Deputy all das schon einmal gesagt.
Und nun kaute er ihm das Ganze zum zweiten Mal vor.
»Ich hab von Anfang an so ’n komisches Gefühl gehabt«, sagte der Deputy. »Schon als Sharkey uns in Captain Largos Büro davon erzählt hat. Da hats bei mir zu kribbeln angefangen, dahinten im Genick. Als wärs da auf einmal eiskalt. Und in den Armen hab ich so ein Prickeln gehabt. Heute erwischts einen, hab ich gedacht. Heute schießen sie einem den Arsch ab.«
Chee spürte, dass der Deputy ihn ansah und auf eine Reaktion wartete. »Mhm«, machte er.
»Ich hab das Gefühl«, fuhr der Deputy fort, »dass dieser Gorman schon da oben mit der geladenen Pistole auf uns lauert. Und wenn wir näher kommen, muss einer von uns dran glauben.«
Chee lenkte den Geländewagen der Navajo-Police langsam um eine tiefe Auswaschung im Boden. Im Rückspiegel konnte er die Standlichter von Sharkeys Kombi sehen. Der FBI-Mann blieb ungefähr hundert Meter hinter ihm. Der Deputy unterbrach jetzt seinen Monolog, weil er sich eine Zigarette anzündete. Im Licht der Streichholzflamme sah sein Gesicht gelb aus, alt und düster. Der Deputy hieß Bales und war wirklich schon alt, wenn auch nicht so alt wie seine Haut, die so viele Jahre der Hochlandsonne des San Juan County ausgesetzt war. Aber verbittert war er nicht. Er stand eher im Ruf, gutmütig und ein bisschen geschwätzig zu sein. Jetzt stieß er den Rauch seiner Zigarette aus.
»Es ist nicht direkt das Gefühl, dass ausgerechnet ich abgeknallt werde«, sagte Bales. »Mehr so allgemein, dass es irgendeinen erwischt.«
Chee war sich bewusst, dass Bales von ihm irgendeine Reaktion erwartete. Bei den Weißen war es eben üblich, dass derjenige, der zuhörte, sich nicht nur aufs Zuhören beschränkte, und das war genau das Gegenteil von dem, was Chee bei den Navajo als höfliches Benehmen gelernt hatte. Als Erstsemester an der Uni von New Mexico war ihm das bereits aufgefallen. Er hatte sich mit einem Mädchen aus dem Soziologiekurs verabredet, und sie hatte ihm vorgeworfen, er höre ihr überhaupt nicht zu. Erst nach einer Weile hatte er begriffen, welches Missverständnis dahintersteckte. Während seine Leute erwarteten, dass man einfach nur zuhörte, solange sie redeten, legten die Weißen Wert darauf, dass man von Zeit zu Zeit irgendeine Reaktion zeigte. So wie Deputy Sheriff Bales in diesem Augenblick. Chee versuchte, sich irgendetwas einfallen zu lassen, was er sagen könnte.
»Einen hat es doch schon erwischt«, sagte er schließlich. »Es gibt immer Leute, die was abkriegen, wie Gorman zum Beispiel.«
»Ich meine jemanden, den es bisher noch nicht erwischt hat«, sagte Bales.
»Nun, wenn Sie’s nicht sind«, meinte Chee, »dann bleiben nur Sharkey oder ich übrig oder der andere FBI-Mann, den er mitgebracht hat. Oder eben Old Man Begay.«
»Glaub ich nicht«, sagte Bales. »Meiner Vorahnung nach müsste es eigentlich einer von uns sein.« Zufrieden, dass Chee ihm endlich zuhörte, nahm Bales abermals einen tiefen Zug aus der Zigarette, offenbar ganz auf den Geschmack des Tabaks konzentriert.
Mary Landon hatte ihren Kaffee umgerührt und die Tasse angestarrt, statt ihn anzusehen. »Du hast dich also entschlossen zu bleiben, nicht wahr?«, hatte sie gefragt. »Und wann hätte ich es erfahren?« Was hatte er ihr darauf geantwortet? Wahrscheinlich irgendetwas Dummes, ohne jedes Feingefühl. Er wusste es nicht mehr so genau. Aber was sie gesagt hatte, daran erinnerte er sich umso genauer. Klar und deutlich glaubte er es jetzt noch zu hören.
»Du kannst mir erzählen, was du willst, es läuft immer aufs selbe raus. Ich komme nur an zweiter Stelle. Für Jim Chee ist das Wichtigste, dass er ein Navajo ist. Ich bin so eine Art Anhängsel in seinem Leben. Mrs Chee und die Navajokinder.« Er war ihr ins Wort gefallen und hatte den Vorwurf zurückgewiesen. Aber sie hatte gesagt, dass er sich doch um das Gesetz der Navajo nur dann scherte, wenn es ihn in seiner vorgefassten Meinung bestärkte. Das Argument kannte er schon, sie hatte das schon einmal zu ihm gesagt. Die Navajo, hatte sie ihm vorgehalten, heirateten in den Clan ihrer Frauen ein. Der Ehemann zählte fortan zur Familie seiner Frau. »Wie hältst du’s denn damit, Jim Chee?«, hatte sie gefragt. Und er hatte keine Antwort geben können.
Der Deputy stieß wieder den Rauch aus und kurbelte das Fenster ein Stück herunter, damit die kalte Nachtluft den Rauch vertreiben konnte. »Ich könnt mich jedes Mal in den Hintern beißen, wie diese FBI-Leute einen für dumm verkaufen wollen. ›Der Gesuchte heißt Albert Gorman.‹« Mit leicht erhöhter Stimmlage versuchte Bales, nicht besonders erfolgreich, Sharkeys westtexanische Sprechweise nachzuahmen. »›Gorman ist vermutlich mit einer Kaliber .38 bewaffnet.‹« Und dann hatte seine Stimme wieder den gewohnten rostigen Klang. »Vermutlich! – Zum Teufel. Dem Kerl, den er umgelegt hat, haben sie ’ne achtunddreißiger Kugel rausgeholt.« Und wieder Sharkey imitierend: »›Los Angeles legt großen Wert darauf, dass wir den Gesuchten lebend in die Finger kriegen. Er wird für eine Vernehmung benötigt.‹« Bales ließ ein Knurren hören. »Haben Sie je einen festgenommen, den sie nicht irgendwo wegen irgendwas vernehmen wollten?« Er lachte glucksend. »Und wenn’s nur darum ging, wie viele Biere er intus hatte, bevor er sich ans Steuer gesetzt hat.«
Chee brummte irgendetwas vor sich hin. Er kurvte mit dem Geländewagen um eine Stelle, an der das Erdreich weggewaschen war und das nackte Gestein zutage trat. Ein Blick in den Rückspiegel bestätigte ihm, dass Sharkeys Kombi immer noch hinter ihnen fuhr.
»Ich seh nicht, wie wir einen Kompromiss finden können«, hatte Mary Landon gesagt. »Ich seh einfach nicht, wie es funktionieren kann.« – »Doch, Mary, doch, wir finden eine Lösung.« Aber sie hatte recht. Was für einen Kompromiss konnte es denn geben? Entweder er blieb bei der Navajo-Police, oder er nahm einen Job außerhalb des Reservats an. Entweder er blieb ein Navajo, oder er wurde ein Weißer. Entweder zogen sie ihre Kinder in Albuquerque oder in Albany oder in irgendeiner anderen Stadt auf – als Kinder von Weißen, oder sie ließen sie auf dem Colorado Plateau groß werden – als Navajokinder, als Diné. Jeder Versuch, sich auf halbem Wege entgegenzukommen, war schlimmer als eine klare Entscheidung. Chee wusste das genau, er hatte oft genug entwurzelte Navajofamilien und ihre Kinder in den Grenzstädten gesehen. Es gab keine Lösung irgendwo in der Mitte.
»Wissen Sie, was uns zu Ohren gekommen ist?«, fragte der Deputy. »Die Geschichte hat irgendwas mit einem FBI-Mann zu tun, den sie drüben in L. A. umgebracht haben. Wir haben gehört, dass Gorman und Lerner – das ist der Kerl, den er bei der Wäscherei umgelegt hat – beide für dieselbe Bande gearbeitet haben, unten an der Küste. Eine Organisation, die auf Autodiebstahl spezialisiert ist. Ganz große Sache. Ein paar von den Bossen sind unter Anklage gestellt worden. Und einer vom FBI hat dran glauben müssen. Darum sind die so scharf drauf, mit Gorman zu reden.«
»Mhm«, machte Chee. Er lenkte den Geländewagen vorsichtig um einen Wacholderbusch herum. Aber nicht vorsichtig genug. Das linke Vorderrad rutschte in ein Loch, das Chee im schwachen Licht des Standlichts nicht erkannt hatte. Bei dem heftigen Schlag rutschte dem Deputy der Hut über die Augen.
»Der Wagen, den Lerner gefahren hat, war am Farmington Airport gemietet worden«, sagte der Deputy. »Hat man Ihnen das gesagt?«
»Nein«, antwortete Chee. Tatsächlich hatte man ihm überhaupt nicht viel gesagt. Das war, wie er aus Erfahrung wusste, immer so, wenn es um irgendwelche FBI-Angelegenheiten ging. »Hab eine Kleinigkeit, die du erledigen müsstest«, hatte Captain Largo gesagt. »Wir müssen diesen Burschen vom Parkplatz finden.« Das war eine etwas seltsame Formulierung, weil nicht nur die Dienststelle der Navajo-Police in Shiprock, sondern jeder einzelne Polizist im Grenzgebiet von Arizona und New Mexico sowieso schon hinter ihm her war. Aber auch mit Captain Largos seltsamen Formulierungen hatte Chee seine Erfahrungen. Anstelle irgendwelcher weiteren Erklärungen hatte Largo ihm einen Aktendeckel in die Hand gedrückt. Er enthielt ein Foto von Albert Gorman, das das FBI besorgt hatte, ein Vorstrafenregister mit ein paar Festnahmen und einer Verurteilung, bei der es um Autodiebstahl gegangen war, und ein paar Angaben zur Person. Das Formblatt, das man beim Los Angeles Police Department verwendete, enthielt keine Spalten für die Angaben, die Chee in so einem Fall gebraucht hätte: den Namen von Gormans Mutter und ihren Clan, in dem er geboren wurde, und den Clan seines Vaters, für den er geboren wurde. Obwohl Albert Gorman in Los Angeles verlernt hatte, wie ein Navajo zu leben, oder es – was außerhalb des Reservats häufig vorkam – überhaupt nie gelernt hatte, musste Chee dort nach ihm suchen, wo die Leute seines Clans wohnten. Largo wusste das.
»Ich will, dass du alles, was du sonst noch am Hals hast, stehen und liegen lässt«, hatte Largo gesagt. »Schaff mir nur den Burschen ran. An der Straßensperre am Teec Nos Pos ist er nicht aufgetaucht. Und wir hatten dort fünfzehn Minuten nach der Schießerei einen Wagen postiert. Also hat er’s nicht nach Westen rüber versucht. Auch an der Sperre bei Sheep Springs hat er sich nicht blicken lassen. Also kann er uns auch nicht nach Süden entwischt sein. Wenn er es nicht in östlicher Richtung versucht hat, nach Burnham rüber …, und dort führt die Straße ins Nichts, dann muss er hoch in die Chuskas gefahren sein.«
Chee hatte ihm zugestimmt, allerdings im Stillen gedacht: Er muss nicht, aber er wird es wahrscheinlich getan haben.
Largo wuchtete sich aus dem Stuhl hoch und ging zur Wandkarte. Er war ein kräftiger Mann mit breitem Oberkörper und schmalen Hüften – der Typ mit keilförmigem Körperbau, wie er bei den westlichen Navajo häufig ist. Er beschrieb mit dem Finger auf der Karte einen Kreis rund um das Shiprock-Massiv, den Carrizo, die Lukachukai Mountains und die nördlichen Ausläufer der Chuskas. »Das engt die Sache auf dieses kleine Stück ein«, sagte er. »Sieh zu, dass du ihn so schnell wie möglich findest.«
Das kleine Stück entsprach ungefähr der Größe von Connecticut, allerdings lebten nur ein paar Hundert Leute dort. Und diese paar Hundert würden unweigerlich alles bemerken, was irgendwie ungewöhnlich war, und sich daran erinnern. Wenn Gorman mit seinem grünen Wagen in das Gelände südlich von Teec Nos Pos oder westlich von Littlewater gefahren war, dann hatten ihn die Leute gesehen. Und dann redeten sie darüber und tauschten Vermutungen aus. Alles, was man tun musste, war fahren und fahren und fahren und mit den Leuten reden und reden und wieder reden, ganz egal, wie viele Tage es dauerte, bis er auf eine Spur gestoßen war. »Reine Glückssache, wie schnell ich ihn finde«, sagte er.
»Dann gib dir Mühe, Glück zu haben«, sagte Largo. »Und wenn du ihn findest, sag mir Bescheid. Versuch nicht, ihn festzunehmen. Rück ihm nicht zu nahe auf die Pelle, scheuch ihn nicht auf. Gib uns einfach über Funk Nachricht, und wir sagen den FBI-Leuten Bescheid.« Largo lehnte sich gegen die Karte, sah Chee in die Augen und gab sich Mühe, einen annähernd neutralen Gesichtsausdruck aufzusetzen. »Hast du kapiert, was ich will? Vermassle es nicht. Das ist ein Fall vom FBI, keiner – ich wiederhole: keiner – für die Navajo-Police. Nicht unsere Angelegenheit, nicht die Angelegenheit von Officer Jim Chee. Haben wir uns verstanden.«
»Sicher«, sagte Chee.
»Chee findet ihn. Chee setzt seinen Funkspruch ab. Und belässt es dabei. Unternimmt nichts, absolut nichts auf eigene Faust«, sagte Largo.
Chee nickte. »In Ordnung.«
»Ich meine, was ich sage. Ich weiß nicht viel darüber, aber nach dem, was ich so läuten höre, ist der Bursche irgendwie in eine andere große Sache in Los Angeles verwickelt. Und einer vom FBI ist ermordet worden.« Largo ließ Chee einen Augenblick Zeit, darüber nachzudenken, was das bedeutete. »Das heißt, wenn das FBI sagt, sie wollen mit ihm reden, dann wollen sie wirklich mit ihm reden. Du sollst ihn einfach nur finden.«
Und so hatte Chee ihn gefunden, und jetzt führte er die Männer vom FBI hin, damit sie die Sache zu Ende bringen konnten. Und Deputy Bales war der Ordnung halber dabei, damit jemand den Sheriff vom San Juan County vertrat.
»Also.« Bales unterdrückte ein Gähnen. »Der Mann, den es erwischt hat, kam mit einer gecharterten Privatmaschine an. Die Leute auf dem Flugplatz sagen, er ist einfach mit dem Vogel angerauscht gekommen, ausgestiegen und hat sich einen Mietwagen genommen. Ein Gangster aus Los Angeles. Einer mit einem langen Vorstrafenregister.«
»Mhm«, machte Chee. Über das Flugzeug und den Mietwagen und über das, was der Polizeibericht darüber meldete, war er auf dem Laufenden. Wenn bei einem Fall einer ins Gras beißen musste, liefen jedes Mal die Telefondrähte heiß. Nicht etwa, dass das FBI was verlauten ließ. Die nicht, aber der Polizeiposten in Farmington gab alles an die New Mexico State Police weiter, und von dort erfuhr es brühwarm der Sheriff, der unterrichtete die Navajo-Police, die gab die Meldung ans Bureau of Indian Affairs, und dort verlor man keine Zeit, die Streifenwagen auf den Arizona-Highways zu informieren. In der kleinen, oft eintönigen Welt der Strafverfolgung ist alles, was auch nur ein bisschen aus dem Rahmen fällt, willkommener Anlass für eine wochenlange Kommunikation.
»Ich frag mich, ob er wirklich verwundet ist«, sagte der Deputy.
»Das ist ziemlich sicher«, antwortete Chee. »Old Joseph Joe soll gesehen haben, wie er sich an die Wagentür geklammert hat. Und er hat ganz so ausgesehen, als hätte er was abgekriegt. Übrigens habe ich im Wagen Blutspuren gefunden, auf dem Fahrersitz.«
»Das hat mich sowieso gewundert. Wie haben Sie den Wagen gefunden?«, fragte der Deputy.
»War nur eine Frage der Zeit«, sagte Chee. »Sie wissen ja, wie das läuft. Man fragt sich so lange durch, bis man den Richtigen fragt.«
Drei Tage hatte er gebraucht, um den Richtigen zu finden, einen Jungen, der gerade aus dem Toadlena-Schulbus stieg. Er hatte eine grüne Limousine auf der Straße von Two Gray Hills nach Süden Richtung Owl Springs fahren sehen. Chee hatte am Postbüro von Two Gray Hills haltgemacht und herausgefunden, wer alles unterhalb der Straße wohnte und wie man zu den Behausungen kam. Dann hatte er noch einen anstrengenden Nachmittag hinter dem Lenkrad verbracht, auf Wegen, bei denen man nicht mal ahnen konnte, wo sie hinführten. »Gestern habe ich ihn gefunden«, sagte er, »kurz bevor es dunkel wurde.«
Bales hatte den Hut weit ins Genick geschoben. »Tja, Sharkey will also, dass wir warten und ihn beim ersten Tageslicht schnappen, während er noch schläft. Das heißt, wir hoffen, dass er noch schläft. Dabei wissen wir nicht mal, ob er überhaupt da ist.«
»Nein«, bestätigte Chee. Aber er zweifelte nicht daran, dass Albert Gorman da war. Dieser lausige Weg führte zu Begays Hogan und von dort nicht mehr weiter. Und Gormans Spuren wiesen von der Stelle, an der er den Wagen zurückgelassen hatte, eindeutig zu Begay. Es waren die unsicher schwankenden Spuren eines Mannes, der entweder betrunken oder schwer verletzt ist. Dazu kam noch das, was er in Two Gray Hills erfahren hatte. Der Besitzer war nicht da, aber die Frau an der Kasse hatte ihm berichtet, Old Man Begay habe einen Gast.
»Vor drei, vier Tagen ist Hosteen Begay hergekommen und hat gefragt, welche Medizin er für einen kaufen soll, der sich bei einem Unfall verletzt hat und unter starken Schmerzen leidet«, hatte sie erzählt. Sie hatte ihm eine Packung Aspirin verkauft – und außerdem eine Briefmarke, weil er einen Brief abschicken wollte.
Auf dem letzten Teil der Strecke, ein paar Hundert Meter lang, war der Boden mit ausgelaufenem Getriebeöl gesprenkelt, schwarz glänzend im schwachen Schein der Standlichter. Und jetzt fiel das Licht auf eine grüne Plymouth-Limousine, die den Weg versperrte. Chee parkte den Geländewagen dahinter, schaltete die Scheinwerfer und den Motor ab und stieg aus.
Sharkey hatte das Seitenfenster heruntergekurbelt. Er lehnte sich hinaus und sah Chee an.
»Ungefähr eine Dreiviertelmeile«, sagte Chee. Und mit einer Handbewegung: »Immer den Weg lang.«
Erst jetzt merkte er, dass Dunst aufkam. Wie grauer Rauch wallte ein dünner Schwaden durch den Lichtkegel von Sharkeys Scheinwerfern, ehe er sie ausschaltete. Chee nahm nun auch den Geruch des Nebels wahr und spürte die Feuchtigkeit auf dem Gesicht.
3
In der trockenen Gebirgsregion der Colorado-Hochebene ist Nebel eine Seltenheit. Er entsteht durch eine Art klimatischen Zusammenprall, wenn nämlich auf der einen Seite eine Kaltfront die Berghänge hinunterkriecht und auf warme Luft stößt, die von den gegenüberliegenden Hängen herangeführt wird. Aber der Nebel ist kurzlebig wie ein Fisch auf dem Trockenen.
Als die vier im ersten Morgengrauen in der Nähe von Hosteen Begays Behausung ankamen, war der Nebel schon keine geschlossene Wand mehr. Nur halb verwehte Fetzen hingen noch in der Luft, und in den tieferen Lagen waren ein paar bauschige Tupfen übrig geblieben. Dort, wo Chee genau nach Sharkeys Anweisung Aufstellung genommen hatte – am Berghang westlich der Weidefläche, auf der Begays Hogan stand, hingen noch ein paar dieser Nebelschwaden. Falls Gorman versuchen sollte zu fliehen, hatte Chee dafür zu sorgen, dass er dort nicht durchkam.
Chee lehnte sich an einen Findling. Er wartete und beobachtete. Im Augenblick beobachtete er Deputy Bales, der unter einer Goldkiefer stand, die rechte Hand gegen den Stamm gestützt, in der linken einen schweren Revolver, die Mündung auf den Boden gerichtet. Das untere Ende des Baumstammes und Bales’ Beine von den Knien abwärts waren in Nebel getaucht. Im schwachen Dämmerlicht hätte man meinen können, Mann und Baum hätten sich von der Erde gelöst. Über dem Weideland hing der Dunst als zusammenhängendes, wallendes Tuch, nur hier und da schon ein wenig ausgefranst vom ersten Hauch einer kalten Morgenbrise. Chee warf einen Blick auf die Uhr. Noch elf Minuten bis Sonnenaufgang.
Der Hogan lag, von Chee und auch vom Deputy aus gesehen, etwas tiefer. Durch den aufreißenden Nebel konnte Chee das kegelförmige Dach erkennen. Es war anscheinend mit Holzschindeln gedeckt; man nahm dafür den äußeren, noch mit dem Borkenrand versehenen Anschnitt der Kiefern. Der Nebel ballte sich jetzt, fiel wieder in sich zusammen und wallte noch einmal auf. Der kurze Schornstein aus verzinktem Weißblech, der mitten auf dem Dachfirst saß, schien verschlossen zu sein. Irgendetwas war von unten in den Rauchfang gestopft worden. Chee fokussierte seinen Blick, um ganz sicher zu sein, dass er sich nicht täuschte. Ihm fiel nur ein Grund ein, den Rauchfang eines Hogans zu verschließen.
Chee machte einen unauffälligen Schnalzlaut mit der Zunge, so leise, dass nur der Deputy ihn hören konnte. Dann, als Bales zu ihm herübersah, machte er eine Geste, dass sie jetzt aufbrechen sollten. Der Deputy guckte erstaunt und tippte auf seine Armbanduhr: Es waren noch ein paar Minuten Zeit, bedeutete er Chee. Genau bei Sonnenaufgang sollte es losgehen. Sharkey und sein Mann wollten sich bei der Tür an der Ostseite des Hogans postieren, und sobald Hosteen Begay ins Freie trat, um nach der Tradition der Navajo den neuen Tag zu preisen, wollten sie ihn packen, aus der Gefahrenzone zerren, dann blitzschnell in den Hogan eindringen und Gorman überwältigen. Falls der alte Mann sich nicht vor der Tür blicken ließ, mussten sie eben so hineinstürmen. Das war der Plan. Aber Chee hatte auf einmal das Gefühl, dass er scheitern würde, sollten sie so vorgehen.
Er ging los, immer der bogenförmig geschwungenen Linie des Berghangs folgend, von Bales weg, Richtung Norden. Nach allem, was man ihm bei Two Gray Hills über Hosteen Begay erzählt hatte, war der alte Mann fest in den Traditionen verwurzelt. Er kannte das Gesetz der Navajo und lebte danach. Bestimmt hatte er diesen Hogan entsprechend den Lehren von Changing Woman gebaut, mit einer einzigen Tür, die nach Osten lag, zur Morgenröte hin, dahin, wo stets alles seinen Anfang nahm. Norden war dagegen die Himmelsrichtung der Finsternis und des Übels. Sollte jemand im Inneren eines Hogans sterben, musste man ein Loch in die Nordwand brechen und den Leichnam dort hinausschaffen. Man musste den Rauchfang verstopfen und den Eingang mit Brettern vernageln. Dann wurde der Hogan verlassen. Das Loch in der Nordwand blieb offen – als Warnung für die Menschen, dass dies ein Totenhogan geworden war. Nur den Leichnam konnte man herausholen, nicht aber den bösen chindi des Verstorbenen. Der Geist hauste für immer dort.
Chee war ungefähr hundert Meter weit gegangen, immer oben am Berghang entlang, wo man ihn vom Hogan aus nicht entdecken konnte. Jetzt hatte er fast die Nordseite der Behausung erreicht. Durch den dünnen Nebel konnte Chee das dunkle Loch erkennen, die Stelle, wo die Holzkloben aus der Wand herausgehauen waren. Also war wirklich jemand in Hosteen Begays Hogan gestorben und hatte seinen Geist dort zurückgelassen.
4
Jetzt kommts darauf an, dass wir die Leiche finden – falls es überhaupt eine gibt«, sagte Sharkey. »Kümmern Sie sich darum, Chee. Ich schau mich inzwischen hier bei der Hütte um.« Sharkey stand an der Tür des Hogans, ein schlanker, durchtrainierter Mann Mitte vierzig, das blonde, kurz geschnittene Haar leicht gewellt.
»Hier liegt noch mehr altes Verbandszeug rum«, rief ihnen Bales aus dem Hogan zu. »Und da ist getrocknetes Blut dran.«
»Können Sie sonst noch was entdecken?«, fragte Chee. »Irgendwelches Bettzeug?«
Sharkey fuhr ungeduldig dazwischen. »Sehen Sie zu, dass Sie herausfinden, wo die Leiche geblieben ist.«
»In Ordnung«, sagte Chee. Er ahnte bereits, wo er die Leiche finden konnte. Nach der vorliegenden Personenbeschreibung war Gorman nicht besonders schwer gewesen. Allerdings war Begay ein alter Mann, dem es bestimmt nicht leichtfiel, den Körper eines Toten zu tragen. Vielleicht hatte er ihn auf eine Decke aus seinem Bett gelegt und weggeschleift. Einen geeigneten Platz für die Bestattung zu finden, möglichst nicht weit vom Hogan entfernt, war nicht schwierig. Im Nordwesten wurde Begays kleines Stück Weidefläche von einem Felsgrat aus Sandstein begrenzt, und aus dieser natürlichen Wand waren irgendwann vor langer Zeit mächtige Gesteinsbrocken herausgebrochen, die jetzt verstreut am Fuß der Felswand herumlagen. Es konnte gar keinen besseren Platz geben, um einen Leichnam – sicher vor hungrigen Tieren – zur Ruhe zu betten. Dorthin machte sich Chee auf den Weg.
Sharkeys Mann stemmte sich aus dem trockenen Wasserlauf hoch, der hinter dem Hogan entlangführte. Er nickte Chee zu und ließ ihn wissen: »Im Pferch ist nichts. Und auch im Schafstall nicht. Der Schafsmist scheint schon alt zu sein.«
Chee nickte zurück, versuchte vergeblich, sich an den Namen des Mannes zu erinnern, und widmete sich dann einen Augenblick lang der Frage, was wohl in diesem Zusammenhang »alt« heißen sollte. Stammten die Schafsköttel von gestern oder vom letzten Jahr? Im Grunde war ihm das ziemlich egal. Das Ganze war Sharkeys Sache, nicht seine. Von seiner Abstammung her mochte Gorman ein Navajo sein, aber er hatte unter Weißen gelebt und wie sie. Lass den weißen Mann die weißen Männer begraben – hieß nicht so ein Sprichwort? Auf Chee wartete in Shiprock eine Menge eigene Arbeit. Und seine eigenen Probleme. Zum Beispiel fragte er sich, wie er die Sache mit Mary Landon ins Reine bringen konnte.
Es gab einen Trampelpfad, der ins Steingewirr unterhalb der Felswand führte. Chee folgte ihm und stellte bald fest, dass seine Vermutung richtig gewesen war. Jemand hatte etwas Schweres hier entlanggeschleift, das war an den Spuren auf dem Boden und am platt gedrückten Bewuchs leicht zu erkennen. Dann entdeckte er – ein Stück weiter oben am Berghang – eine Stelle, wo jemand offenbar die unteren Stützsteine an einem Geröllhaufen so herausgehebelt hatte, dass die ganze Halde ins Rutschen geraten und ein paar Meter bergab gepoltert war. Das war eine probate Methode, wenn man etwas unter Gesteinsbrocken verbergen wollte, zum Beispiel einen Leichnam. Und schließlich sah Chee das Stück blauen Baumwollstoff.
Der Tote lag auf einen abgeflachten Steinbrocken gebettet, der irgendwann vor langer Zeit aus dem Felsgrat herausgebrochen war. So konnten die Kojoten dem Leichnam nichts anhaben, und vor den Vögeln war er durch das Geröll geschützt, das ihn bedeckte. Bei näherem Hinsehen stellte sich heraus, dass das blaue Stück Stoff zum Hosenbein einer Jeans gehörte. Chee ging um den Bestattungsplatz herum. Der Kopf war ganz unter den Steinen verborgen. Auch vom Körper des Toten sah Chee nur wenig. Die rechte Schuhsohle ragte heraus, und weiter oben, da wo die Schultern sein mussten, schimmerte wieder ein Stück Jeansstoff durch.
Aber irgendetwas passte nicht ins Bild. Nur was? Er kletterte ein Stück den Hügel hinauf und sah sich den Platz von oben an. Der Steinhaufen sah irgendwie unnatürlich aus, das war alles. Er ließ den Blick in die Senke schweifen, dahin, wo Hosteen Begay seinen Hogan gebaut hatte. Die Sonne war inzwischen über den Bergrücken gekommen, er spürte, wie sie ihm das Gesicht wärmte. Der Hogan dort unten lag noch im Schatten. Ein Platz, an dem sichs gut leben ließ, sorgfältig gebaut, mit einer Laube daneben und einem fast neuen Lagerschuppen, mit Ölfässern, in denen Hosteen Begay Trink- und Kochwasser gesammelt hatte – eine geschweißte Rohrleitung führte sogar direkt zum Hogan –, und mit einem zweiten Schuppen fürs Viehfutter, ein guter Platz. Durch lockeres Kieferngehölz fiel der Blick hinunter in das Becken des San Juan, auf formloses Grau, das im Licht der Morgensonne wie matt schimmernder Samt erschien. Weideland für Schafe – Büffel- und Grammagras, Salbei, Scheinheide und Schlangenkraut. Dahinter ragte der Shiprock mit seinen bizarren schwarzen Spitzen auf, wie die Türme einer gotischen Kathedrale. Und hinter Shiprock, fünfzig Meilen weiter, der schwebende Schmutzfleck aus den Schornsteinen des Kraftwerks im Grenzgebiet Four Corners.
Chee nahm das Bild in sich auf, er fühlte, wie die erhabene Weite der Landschaft seinen Geist erfüllte. Und dennoch war da immer noch etwas, was ihm innerlich keine Ruhe ließ. Irgendetwas, was nicht stimmte. Etwas, was einen Missklang in die Harmonie brachte.
Er lenkte den Blick noch einmal auf den Hogan, sah ihn sich genau an. Bales machte sich neben der Laube zu schaffen. Die beiden FBI-Männer konnte er nicht sehen. Vielleicht waren sie im Inneren des Totenhogans; ihre Ahnungslosigkeit würde sie vor dem Geist des Bösen schützen, das von Gormans chindi ausging. Die Lage des Hogans war wirklich optimal. Es war alles da. Feuerholz. Und im Sommer Gras und frisches Wasser fürs Vieh im Bachlauf hinter dem Hogan. Ein schöner Ort, mit einem herrlichen Blick. Und die Abgeschiedenheit, das Gefühl, von Weite umgeben zu sein – das, was die Pueblo-Indianer und die Weißen Einsamkeit nannten, die Navajo aber schätzten. Freilich, die Winter konnten hier schneereich und kalt sein. Der Hogan lag in gut zweieinhalbtausend Metern Höhe. Aber er war so gebaut, dass er dem Winter trotzen konnte. Es musste für den alten Mann hart gewesen sein, ihn zu verlassen. Warum hatte er es dennoch getan?
Chee wurde klar, dass es diese Frage war, die ihn schon die ganze Zeit über umtrieb. Warum hatte der alte Mann nicht gehandelt, wie die Diné seit Hunderten von Generationen handelten, sobald sich der Tod näherte? Warum hatte er den sterbenden Gorman nicht nach draußen geschafft, hinaus aus dem Hogan, in die reine, klare Luft, unter die Sonne, das Auge unseres Vaters? Warum hatte er seinem Blutsverwandten nicht ein Lager in der Laube bereitet, wo es keine Mauern gab, die im erlösenden Augenblick des Todes den chindi einpferchen und daran hindern konnten, sich in der grenzenlosen Weite des Himmels zu verlieren? Gorman musste einen langsamen Tod gestorben sein, verursacht durch den Blutverlust seiner inneren Verletzungen und vermutlich einer Infektion. Und was den alten Mann betraf – für ihn konnte der Tod nichts Fremdes sein. Bei den Navajo ist es nicht üblich, sterbende Angehörige in Hospitäler abzuschieben. Von Jugend an erlebt ein Navajo, dass alte Menschen sterben. Ein Navajo kennt den Tod, wartet auf ihn, respektiert ihn. Begay musste schon lange gesehen haben, dass es mit Gorman zu Ende ging, musste es in seinem Atem gelesen haben, in seinen Augen. Warum hatte er also den Mann nicht, wie es Brauch war, nach draußen geschafft? Warum hatte er zugelassen, dass dieser solide gebaute, herrlich gelegene Hogan für alle Zeiten durch das chindi verunreinigt wurde?
Unten in der Senke kam Sharkey wieder ins Blickfeld, er stand an der Tür des Hogans und starrte zu Chee hinauf. Chee, zwischen den Findlingen verborgen, rührte sich nicht. Wo waren Bales und der andere FBI-Mann geblieben? Wie hieß er doch gleich? Auf einmal fiel ihm der Name wieder ein: Witry. Und noch etwas fiel Chee ein, ebenso plötzlich: War der Tote unter den Steinen womöglich Begay? Konnte es sein, dass Gorman den alten Mann getötet hatte? Ziemlich unwahrscheinlich. Trotzdem, Chees unpersönliche Distanz war verflogen, auf einmal begann ihn die Sache zu interessieren.
Er trat ein paar Schritte vor, sodass Sharkey ihn sehen konnte, und rief: »Hierher! Kommt hierher!«
Steine und Geröll waren rasch weggeräumt.
Die Fotos habe ich im Kombi gelassen«, sagte Sharkey. »Aber der hier sieht aus wie Gorman.«
Hosteen Begay konnte es jedenfalls nicht sein. Viel zu jung, Mitte dreißig, schätzte Chee. Der Tote ruhte mit dem Gesicht nach oben auf dem Stein, die Beine ausgestreckt, die Arme am Körper. Neben seiner rechten Hand lag ein Frühstücksbeutel aus Plastik, oben gezwirbelt und mit einem Clip verschlossen.
»Hier ist die tödliche Wunde«, stellte Bales fest. »Hat ihn genau an der Seite erwischt. Alles aufgerissen. Er ist verblutet.«
Sharkey sah Chee fragend an. »Mit dem Wagen werden wir wohl hier nicht raufkommen? Ich denke, wir müssen ihn nach unten schleppen.«
»Wir könnten ein Pferd holen und ihn damit runterschaffen«, meinte Chee.
Sharkey öffnete den Plastikbeutel. »Scheint ein Behältnis für Wasser zu sein. Und Maismehl. Sagt Ihnen das was?«
»Ja«, antwortete Chee, »das entspricht dem Brauch.«
Sharkey leerte den Beutel vorsichtig über dem Stein aus, sodass nun Gormans Seele ohne Nahrung und ohne Wasser die vier Tage währende Reise in die Unterwelt des Todes antreten musste. »Und hier haben wir noch seine Brieftasche. Feuerzeug. Autoschlüssel. Kamm. Ich nehme an, das hat er in seinen Taschen gehabt.« Sharkey öffnete die Brieftasche, zog alles, was er fand, heraus und legte es neben Gormans Knie auf den Stein. Zuerst den Führerschein. Er hielt ihn in der linken Hand, zog mit der rechten Gormans Kopf zu sich herüber und verglich das Foto mit dem Aussehen des Toten.
»Albert A. Gorman«, las er vor. »Elf-sieben-eins-dreizehn La Monica Street, Hollywood.« Dann zählte er flüchtig das Geld und pfiff durch die Zähne. Anscheinend waren es hauptsächlich Hundertdollarnoten. »Zweitausendsiebenhundertvierzig und noch was«, sagte er. »Verbrechen lohnt sich also doch.«
»Seht mal, er hat die Schuhe verkehrt rum an!«, rief Bales.
Sharkey unterbrach seine Überprüfung und schaute auf Gormans Füße. Der Tote trug flache braune Joggingschuhe mit Gummisohlen, das Obermaterial aus Segeltuch. Die Schuhe waren tatsächlich vertauscht, der rechte am linken, der linke am rechten Fuß.
»Das ist richtig so«, sagte Chee.
Sharkey starrte ihn verblüfft an.
»Ich meine, das macht man so«, erklärte Chee. »Die Tradition verlangt, dass man die Mokassins vertauscht, wenn man einen Toten für die Bestattung vorbereitet.« Er spürte, wie er unter Sharkeys bohrendem Blick rot wurde. »Man tut es, damit der Geist den Toten nicht verfolgen kann.«
Schweigen. Sharkey wandte sich wieder Gormans Habseligkeiten zu.
Chees Blick fiel auf Gormans Kopf. Die Stirn war schmutzig und das Haar voller Staub vom Geröll, das den Leichnam zugedeckt hatte. Aber das Haar war nicht nur staubig, sondern auch fettig und verklebt – die Haare eines Mannes, der tagelang mit dem Tode gerungen hatte.
»Jede Menge Geld«, stellte Sharkey fest, »VISA, Mastercard, Führerschein und Jagdlizenz, beides aus Kalifornien. Eine Mitgliedskarte vom Olympic Health Club. Schnappschüsse von zwei Frauen. Gutschein für zwei Burger King zum halben Preis. Sozialversicherungskarte. Das ist alles.«
Sharkey überprüfte Gormans Jackentaschen, knöpfte die Jacke auf, durchsuchte die Hosentaschen – nichts, absolut nichts.
Auf dem Rückweg zum Geländewagen dachte Chee darüber nach, dass es nun ein zweites Rätsel gab. Eine Frage, die genauso unbeantwortet blieb wie die, warum Hosteen Begay seinen Hogan nicht vor dem Geist geschützt hatte. Noch so etwas, was nach unverständlicher Sorglosigkeit aussah. Begay hatte einige Mühe aufgewendet, um seinen Verwandten auf den Weg in die Unterwelt vorzubereiten. Das Bündel Geld nützte Albert A. Gorman freilich nichts mehr, wenn er die Finsternis der Unterwelt betrat. Aber kein Geist konnte den verwirrenden Fußspuren folgen. Gorman war mit Nahrung und Wasser für die letzte Reise versorgt. Nur die Riten der Reinigung fehlten, wenn er dort unten ankam. Sie schrieben vor, sein schmutziges Haar mit einem Sud aus Yuccawurzeln zu waschen, es zu kämmen und zu flechten. Yuccawurzeln zu kochen, brauchte Zeit. Hatte Hosteen Begay es so eilig gehabt?
5
D