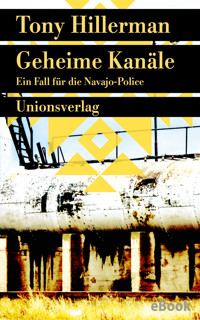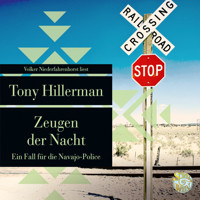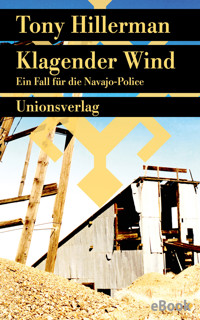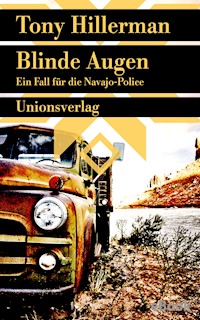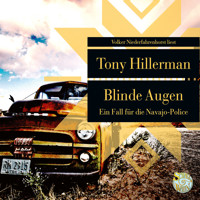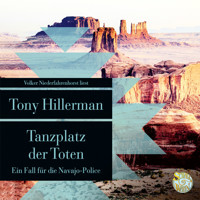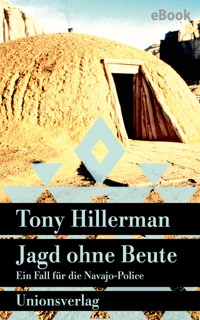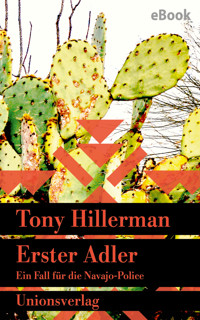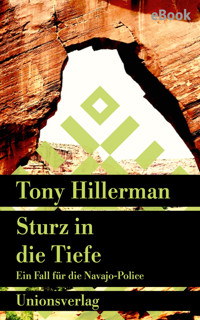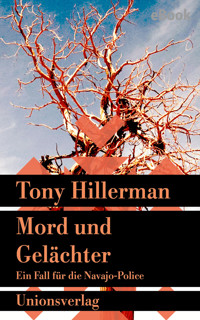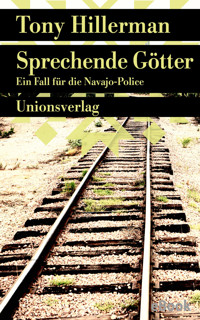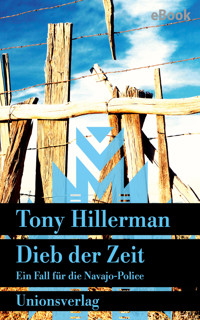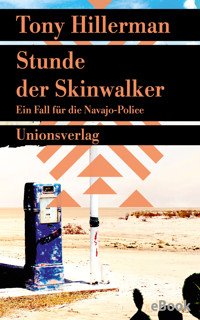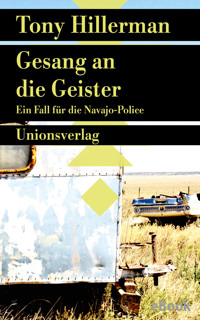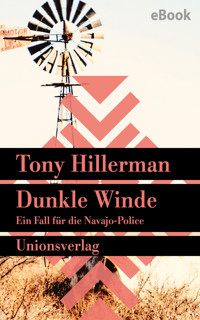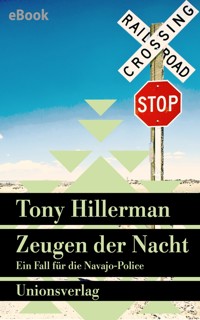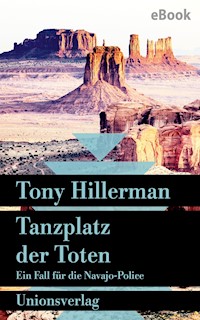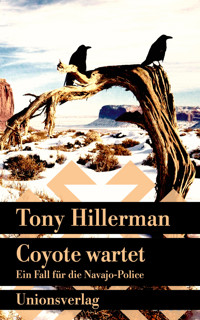
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein junger Officer der Navajo-Police ist einem Unbekannten auf der Spur, der Vulkanschlote östlich der Chuska Mountains weiß anmalt. Keine große Sache. Doch dann wird der Cop erschossen, und Jim Chee muss seinen Kollegen aus dem brennenden Dienstwagen ziehen. In der Nähe des Tatorts verhaftet Chee den stockbetrunkenen Schamanen Ashie Pinto, der trotz Tatwaffe im Hosenbund jede Aussage verweigert. Für das FBI ist der Fall klar. Leaphorn und Chee aber kommen zunehmend Zweifel: Ein vermisster Geschichtsprofessor war anscheinend hinter Pintos Wissen um die Navajo-Mythologie her. Kreuzte nicht ein zweites Paar Autoscheinwerfer Chee in der Tatnacht? Und was meint der Schamane, wenn er sagt, Coyote liege draußen ständig auf der Lauer?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch
Als ein Navajo-Cop erschossen wird, scheint der Täter sofort gefasst: Jim Chee verhaftet den Schamanen Ashie Pinto. Doch Chee und Leaphorn zweifeln an seiner Schuld. Denn seit der Tat wird auch ein Geschichtsprofessor vermisst, der über alte Navajo-Legenden forschte – und der Schamane redet immerzu von einem Coyoten, der auf der Lauer liegt.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tony Hillerman (1925–2008) besuchte ein Internat für Native Americans, kämpfte im Zweiten Weltkrieg, studierte Journalismus und war als Journalist und Dozent tätig. Seine Romane um die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee wurden vielfach ausgezeichnet und in siebzehn Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Tony Hillerman.
Wulf Bergner (*1939 in Dresden) ist Übersetzer aus dem Englischen und war als Herausgeber tätig. Er hat u. a. Werke von Stephen King, Dale Brown und Lee Child ins Deutsche übertragen. Er lebt bei München.
Zur Webseite von Wulf Bergner.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tony Hillerman
Coyote wartet
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Wulf Bergner
Ein Fall für die Navajo-Police (9)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Worterklärungen und Hintergrundinformationen zu diesem Buch auf https://ehillerman.unm.edu/encyclopedia-main
Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Veronika Straaß-Lieckfeld nach dem Original durchgesehen und grundlegend überarbeitet.
Die Originalausgabe erschien 1990 bei Harper & Row, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1992 unter dem Titel Der Kojote wartet im Goldmann Verlag, München.
Originaltitel: Coyote waits
© by Anthony G. Hillerman 1990
Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Wulf Bergner beim Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hintergrund - Shotshop GmbH (Alamy Stock Foto); Symbol - Tetiana Lazunova (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31167-1
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 31.05.2024, 17:01h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
COYOTE WARTET
1 – Officer Jim Chee dachte, dass vielleicht der Luftdruck …2 – Wagen 44 stand mitten auf der Schotterstraße …3 – Nichts fürchtete Lieutenant Joe Leaphorn mehr als dies …4 – Jim Chee kam ziemlich niedergeschlagen aus dem Untersuchungsraum …5 – Joe Leaphorn stand an der Tür von Ashie …6 – Der verbeulte weiße Jeepster war bemerkenswert leicht aufzuspüren …7 – In einem seltsamen Singsang schallte Ashie Pintos Stimme …8 – Jim Chee in Albuquerque war ein Jim Chee …9 – Redd war am Apparat. »Chee?«, wiederholte er. »Jim …10 – Als praktisch veranlagter Mensch erledigte Joe Leaphorn die …11 – Der Handchirurg genoss in der Fachwelt einen hervorragenden …12 – Wie es Leaphorns Art war (es sei denn …13 – Als sie in die Straße einbogen, in der …14 – Janet Pete hatte seine Idee gar nicht gefallen …15 – Jim Chee war noch nicht so oft geflogen …16 – Deputy T. J. Birdie hatte Dienst, als Chee …17 – Das gelbe Plastikband, mit dem Tatorte von der …18 – Chee hatte gehofft, Janet Pete abfangen zu können …19 – Es war einer jener frustrierenden Vormittage, an denen …20 – William Odell Redd war nicht zu Hause …21 – Die Adresse der Familie Ha, die Leaphorn ihm …22 – Taka Ji hatte Chees Landkarte ebenso präzise markiert …23 – Kurz nach 10.30 Uhr fuhr Chee im Federal …24 – Leaphorn hatte den ganzen Morgen in seinem Büro …Mehr über dieses Buch
Über Tony Hillerman
»Der Angst vor seinem Pferd hat«
Claus Biegert: Die Navajo-Romane — ein Fall von Kultureller Wertschätzung
Über Wulf Bergner
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tony Hillerman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema USA
Für meinen großartigen Freund und Schwager Charles Unzner und für unsere Weltklasse-Nachbarn Jim und Marry Reese und Gene und Geraldine Bustamante.
1
Officer Jim Chee dachte, dass vielleicht der Luftdruck im rechten Vorderreifen zu niedrig war. Oder dass etwas mit dem rechten Stoßdämpfer nicht stimmte. Denkbar war auch, dass ein Arbeiter der Straßenmeisterei seine Planiermaschine nicht richtig eingestellt hatte und der Straßenoberfläche aus Versehen eine leichte Schräglage verpasst hatte. Jedenfalls zog Officer Jim Chees Streifenwagen aus irgendeinem Grund nach rechts. Stirnrunzelnd lenkte er dagegen. Er war hundemüde.
Aus dem Lautsprecher des Funkgeräts kam ein unbestimmtes Rauschen, dann war die Stimme von Officer Delbert Nez zu hören, »… fast beim letzten Tropfen Sprit. Ich muss noch in Red Rock tanken, obwohl’s da sauteuer ist. Oder ich muss zu Fuß heimgehen.«
»Falls du dort tankst, dann zahl den Sprit lieber selber«, sagte Chee. »Das ist immer noch besser, als dem Captain erklären zu müssen, dass du vergessen hast aufzutanken.«
»Ich glaube …«, antwortete Nez. Dann war seine Stimme kaum noch zu hören.
»Die Verbindung ist gestört«, sagte Chee. »Ich höre dich nicht mehr.« Nez fuhr Wagen 44, einen notorischen Spritschlucker. Wahrscheinlich war irgendetwas mit seiner Benzinpumpe nicht in Ordnung. Der Wagen musste immer wieder in die Werkstatt, aber bis jetzt hatte niemand den Fehler finden können.
Schweigen. Rauschen. Schweigen. Der Rechtsdrall von Chees Wagen war jetzt fast verschwunden. Wahrscheinlich hatte es doch nichts mit dem Reifendruck zu tun gehabt. Möglich, dass … Und dann war die Verbindung plötzlich wieder da.
»… den Hundesohn auf frischer Tat schnappen, mit gezückter Sprühdose in der Hand«, sagte Nez gerade. »Ich möchte wetten, dass er …« Dann brach der Funkkontakt wieder ab. Stille.
»Ich höre dich nicht mehr«, sagte Chee in sein Mikro. »Die Verbindung ist wieder unterbrochen.«
Das war nichts Ungewöhnliches. In dem 25 000 Quadratmeilen großen Gebiet, das die Navajo »Big Rez« nannten, gab es mindestens ein Dutzend Stellen, die aus allen möglichen Gründen im Funkschatten lagen. Eine davon war hier, zwischen den monolithischen Vulkantürmen von Ship Rock, der Carrizo Range und den Chuska Mountains. Chee vermutete, dass die umliegenden Berge der Grund für den schlechten Empfang waren, aber es gab auch andere Theorien. Deputy Sheriff »Cowboy« Dashee behauptete steif und fest, die Funklöcher hätten etwas mit dem Magnetismus in den alten Vulkanschloten zu tun, die hier und da wie riesige schwarze Kathedralen aus der Landschaft ragten. Die alte Thomasina Bigthumb hatte ihm einmal erzählt, da steckten bestimmt Hexen und Zauberer dahinter. Es stimmte zwar, dass dieser Teil des Reservats wegen seiner Hexengeschichten verrufen war, es stimmte aber auch, dass die alte Bigthumb hinter allem, was passierte, eine Hexenattacke vermutete.
Dann konnte Chee Delbert Nez auf einmal wieder hören. Anfangs klang seine Stimme sehr leise. »… sein Auto«, sagte Delbert gerade. (Oder war es »… sein Laster«? Oder »… sein Pick-up«? Was genau hatte Delbert Nez eigentlich gesagt?) Doch plötzlich war er klar zu verstehen, und Chee hörte Delbert sogar lachen. »Diesmal krieg ich ihn!«, sagte Delbert Nez.
Chee griff nach dem Mikrofon. »Wen willst du kriegen?«, fragte er. »Brauchst du Verstärkung?«
»Meinen Phantomschmierer«, schien Nez zu sagen. Zumindest klang es so. Der Empfang ließ wieder nach; die Stimme wurde leiser und ging schließlich im Rauschen unter.
»Ich kann dich kaum noch hören«, sagte Chee. »Brauchst du Verstärkung?«
Durch das Rauschen und die miese Funkübertragung glaubte Chee, ein Nein von Nez zu verstehen. Dann lachte er wieder.
»Okay, dann sehen wir uns in Red Rock«, antwortete Chee. »Und diesmal zahlst du.«
Statt einer Antwort kam nur noch Rauschen aus dem Funkgerät, aber Chee brauchte auch keine Antwort. Delbert Nez kam von der Zentrale der Navajo-Police in Window Rock, und sein Einsatzgebiet war die U. S. 666 von Yah-Ta-Hey nach Norden. Chee fuhr Streife von der untergeordneten Polizeistation in Ship Rock aus auf der 666 nach Süden, und wenn sie sich begegneten, tranken sie zusammen einen Kaffee und plauderten ein bisschen. Sie hatten ausgemacht, sich an diesem Abend in Red Rock zu treffen, was Tankstelle, Poststelle und Lebensmittelgeschäft in einem war; dorthin waren nun beide Streifenwagen unterwegs. Chee folgte der Schotterstraße, die von Biklabito aus Richtung Süden führte und dabei mehrmals die Grenze zwischen Arizona und New Mexico kreuzte. Nez fuhr von der U. S. 666 aus auf der asphaltierten Navajo Route 33 nach Westen. Da Nez die bessere Straße hatte, würde er vermutlich eine Viertelstunde früher ankommen. Aber jetzt hatte er anscheinend vor, noch jemanden festzunehmen. Das würde ihn seinen Vorsprung kosten.
In den Wolken über den Chuska Mountains flackerte ein Wetterleuchten, und Chees Streifenwagen zog nicht mehr nach rechts, sondern stattdessen nach links. Mit dem Reifen hatte das wohl nichts zu tun, dachte er. Vermutlich hatte der Fahrer der Planiermaschine gemerkt, dass sein Blatt falsch eingestellt war und hatte bei der Korrektur übertrieben. Wenigstens war dabei nicht der übliche Waschbretteffekt entstanden, der einem die Nieren durchrüttelte.
Als Chee von der Schotterstraße auf die asphaltierte Route 33 einbog, hatte das heraufziehende Gewitter ein eigenartiges Zwielicht entstehen lassen. Nez war nirgends zu sehen. Auch sonst sah Chee keine Scheinwerfer, nur das letzte Nachglühen eines feuerroten Sonnenuntergangs. Er rollte an den Zapfsäulen der Red-Rock-Tankstelle vorbei und parkte hinter dem Handelsposten. Kein Streifenwagen 44 stand dort, wo Nez sonst immer seinen Wagen abstellte.
Chee stieg aus und inspizierte die Vorderreifen. Offenbar alles in Ordnung. Dann sah er sich um. Drei Pick-ups und eine blaue Chevy Limousine. Der Chevy gehörte der neuen Angestellten der Handelsstation. Ein hübsches Mädchen, aber er konnte sich nicht an ihren Namen erinnern. Wo Nez wohl steckte? Vielleicht hatte er seinen farbsprühenden Vandalen tatsächlich geschnappt. Vielleicht hatte auch die Benzinpumpe seiner Rostlaube endgültig den Geist aufgegeben.
Auch im Laden keine Spur von Nez. Chee nickte dem Mädchen zu, das hinter der Kasse in einer Zeitschrift blätterte. Sie schenkte ihm ein schüchternes Lächeln. Wie hieß sie gleich wieder? Sheila? Suzy? Irgendwas in dieser Richtung. Sie war eine Towering House Diné, war also mit Chees eigenem Slow Talking Clan weder verwandt noch verschwägert. Chee erinnerte sich noch zu gut daran. Ob Mann oder Frau: Jeder junge Navajo ohne Partner checkte so etwas ganz automatisch. Schließlich musste man ja sichergehen, dass jemand, der einem gefiel, nach dem komplizierten Clansystem des Stammes keine Schwester, Cousine oder Nichte war und damit unter das Inzest-Tabu fiel.
Die Glaskanne der Kaffeemaschine war zu zwei Dritteln voll, was grundsätzlich ein gutes Zeichen war, und der frische Kaffee duftete. Chee griff sich einen Styroporbecher für fünfzig Cent, füllte ihn und nippte. Gut, dachte er. Dann nahm er sich eine Doppelpackung Twinkies mit Schokoüberzug. Genau das Richtige zum Kaffee.
An der Kasse gab er dem Mädchen aus dem Towering House Clan einen Fünfdollarschein.
»Ist Delbert Nez da gewesen? Erinnerst du dich an ihn? So ein Stämmiger mit kleinem Schnäuzer. So ein richtig potthässlicher Polizist.«
»Ich fand ihn eigentlich ganz niedlich«, sagte die Kassiererin und strahlte Chee an.
»Vielleicht hast du einfach ’ne Schwäche für Polizisten?«, sagte Chee. Verdammt noch mal, wie hieß das Mädchen gleich wieder?
»Nicht für alle«, wehrte sie ab. »Kommt drauf an.«
»Kommt drauf an, ob sie gerade deinen Freund verhaftet haben, oder?«, sagte Chee. Die Kleine war ledig – das wusste er von Delbert. (»Warum kriegst du so was nicht selber raus?«, hatte Nez sich beschwert. »Bevor ich geheiratet hab, wusste ich so was immer genau. Ich hätte niemand zu fragen brauchen. Wenn meine Frau rauskriegt, dass ich mich umhöre, zu welchem Clan die Miezen gehören, sitze ich ganz schön in der Scheiße!«)
»Ich hab keinen Freund«, sagte das Mädchen aus dem Towering House Clan. »Im Augenblick jedenfalls nicht. Und: Nein, Delbert ist heute Abend noch nicht da gewesen.« Kichernd gab sie Chee das Wechselgeld heraus. »Hat er seinen Felsenmaler eigentlich schon geschnappt?«
Chee fragte sich, ob er für kichernde Mädchen nicht vielleicht schon ein bisschen zu alt war. Aber sie hatte große braune Augen, lange Wimpern und eine makellose Haut. Und sie verstand sich aufs Flirten. »Vielleicht ist er gerade dabei, ihn festzunehmen«, antwortete er. »Über Funk hat er vorhin davon gesprochen.« Ihm fiel auf, dass sie ihm einen Dime zu viel herausgegeben hatte, was irgendwie zu ihrem Gekicher passte. »Zu viel«, sagte er und gab ihr die Münze zurück. »Hast du eine Idee, wer der Maler sein könnte?« Dann fiel ihm ein, wie sie hieß: Shirley. Shirley Thompson.
Shirley schüttelte sich entsetzt. Es sah hinreißend aus. »Irgendein Verrückter«, meinte sie.
Das war auch Chees Theorie. Aber er fragte trotzdem: »Warum ein Verrückter?«
»Na ja, einfach so«, meinte Shirley, die plötzlich ernst geworden war. »Du weißt schon. Wer würde sich sonst die Mühe machen, einen Berg weiß anzumalen?«
Das Wort Berg war leicht übertrieben. Eigentlich war es so etwas wie ein Vulkanschlot – eines der vielen zerklüfteten Gebilde aus schwarzem Basalt, die östlich der Chuska Mountains hier und da aus der Prärie aufragten.
»Vielleicht versucht er, etwas Schönes zu malen«, meinte Chee. »Bist du schon mal draußen gewesen und hast dir aus der Nähe angesehen, was er so macht?«
Shirley schauderte. »Da würd ich nie hingehen!«, sagte sie.
»Warum nicht?«, fragte Chee, obwohl er den Grund schon kannte. Wahrscheinlich klebte an dem Basaltkegel irgendeine Legende aus dieser Gegend. Irgendetwas Gruseliges. Wahrscheinlich war dort jemand ermordet worden und hatte seinen chindi zurückgelassen, der seither dort herumspukte. Außerdem gingen Gerüchte um, es gäbe dort Hexen. Delbert war im Chuska-Hochland westlich von hier aufgewachsen und hatte einmal erzählt, dass dieser Kegel – oder ein anderer in der Nähe – zu den Orten gehörte, an denen der Skinwalker Clan angeblich seine Zusammenkünfte abhielt. Jedenfalls war das ein Ort, um den man lieber einen großen Bogen machen sollte – und gerade das war einer der Gründe, warum der Felsenmaler für Delbert Nez so interessant war.
»Was der Kerl da tut, ist nicht nur völlig durchgeknallt«, hatte Delbert gesagt. »Dass er eine Felswand anmalt, meine ich. Die Sache hat auch was Unheimliches an sich. Da draußen ist es nicht geheuer. Es ist egal, wie man über Hexen denkt, aber da geht einfach niemand hin. Wenn du da hingehst und jemand sieht dich dabei, halten sie dich selbst für einen Skinwalker. Ich glaube, dass die Malerei einen bestimmten Zweck hat. Da muss etwas dahinterstecken. Und ich möchte verdammt noch mal rauskriegen, wer das ist – und warum er es tut.«
Chee, der genauso beharrlich sein konnte, verstand nur zu genau, worauf es Nez ankam. Er warf einen Blick auf seine Uhr. Wo blieb Delbert nur so lange?
Die Tür ging auf. Eine Frau mittleren Alters, das Haar mit einem blauen Tuch zusammengebunden, kam herein. Sie zahlte ihre Tankrechnung, klagte über den hohen Preis und verwickelte Shirley in ein Gespräch über den geplanten Sing- und Tanzabend in der Schule in Newcomb. Chee holte sich noch einen Becher Kaffee. Zwei Jugendliche kamen herein, hinter ihnen ein alter Mann, auf dessen T-Shirt in großen Lettern DON’T WORRY, BE HAPPY prangte. Die nächste Kundin war etwa in Shirleys Alter. Als sie die Tür öffnete, drang für einen Moment Donnergrollen von draußen herein. Die beiden Mädchen schwatzten kichernd miteinander. Chee warf wieder einen Blick auf seine Uhr. Delbert ließ sich wirklich verdammt viel Zeit.
Chee trat in die Nacht hinaus.
Der leichte Wind roch nach Regen. Chee bog rasch um die Ecke, wo hinter dem Handelsposten im Stockdunkeln sein Wagen stand. Im Auto schaltete er das Funkgerät ein und versuchte, Nez zu erreichen. Nichts. Er ließ den Motor an und legte mit durchdrehenden Rädern einen Kavaliersstart hin, was eigentlich gar nicht seine Art war. Auch diese plötzliche Sorge war sonst gar nicht sein Ding. Er schaltete Sirene und Blaulicht ein.
Chee war erst wenige Minuten unterwegs, als ihm auf der Route 33 Scheinwerfer entgegenkamen. Erleichtert nahm er den Fuß vom Gas. Aber bevor ihn die Scheinwerfer erreichten, sah er den Fahrer des anderen Wagens rechts blinken. Das Auto, das da vor ihm nach Norden abbog, war nicht Delberts Streifenwagen mit dem Emblem der Navajo-Police auf der Tür, sondern ein verbeulter weißer Jeepster. Chee erkannte ihn. Der Wagen gehörte dem Vietnamesen (oder Kambodschaner oder was auch immer er war), der an der Ship Rock Highschool unterrichtete. Chees Scheinwerfer huschten über das Gesicht des Fahrers.
Dann setzte der Regen ein. Zuerst klatschte ein Schauer aus großen, einzelnen Tropfen an die Windschutzscheibe, dann kam der Wolkenbruch. Route 33 war breit und ohne Schlaglöcher oder Bodenwellen, und an dem frisch markierten Mittelstreifen hätte er sich gut orientieren können, aber diesen Sturzbächen vom Himmel waren Chees Scheibenwischer nicht gewachsen. Er fuhr langsamer und lauschte dem Regen, der aufs Dach trommelte. Eigentlich war Regen für Chee ein Anlass zu jubeln. Diese natürliche Begeisterung für Regen empfinden alle Menschen, die in trockenen Landstrichen zu Hause sind. Aber diesmal wollte sich die Freude nicht einstellen. Chee war besorgt und ein wenig schuldbewusst. Nez war durch irgendetwas aufgehalten worden. Nach dem Abreißen der Funkverbindung hätte er sich auf die Suche nach ihm machen sollen. Aber wahrscheinlich gab es dafür einen harmlosen Grund. Eine Panne. Ein verstauchter Knöchel, als er den Felsenmaler in der Dunkelheit verfolgt hatte. Jedenfalls nichts Ernstes.
Ein Blitz erhellte den regennassen Highway vor Chee. Außer ihm war weit und breit niemand zu sehen. Der Blitz beleuchtete die zerklüftete Basaltformation, die Richtung Süden aus der Prärie aufragte – der Berg, auf den Nez’ Felsenschmierer seine Farbe geklatscht hatte. Dann rollte der Donner über Chee hinweg. Der Regen ließ kurz nach, prasselte noch einmal los und flaute dann wieder ab, als die Sturmfront des Gewitters vorbeigezogen war.
Irgendwo rechts sah Chee einen Lichtschein. Er spähte in die Dunkelheit. Der Lichtschein kam von einer Schotterstraße, die sich von der Route 33 über eine Hügelkette nach Süden schlängelte und schließlich zu den Hütten von Old Lady Gorman führte. Mit einem Zischen ließ Chee die angestaute Luft aus seinen Lungen. Erleichterung. Das war vermutlich Nez. Seine Schuldgefühle verflogen.
An der Einmündung fuhr er langsamer und starrte die Schotterstraße entlang. Scheinwerferlicht hätte gelb sein müssen. Dieses Licht war rot. Und es flackerte.
Feuer!
»Großer Gott!«, stöhnte Chee. Es war ein Stoßgebet. Er schaltete in den zweiten Gang zurück und rutschte mit aufheulendem Motor die schlammige Fahrspur entlang.
2
Wagen 44 stand mitten auf der Schotterstraße. Der Kühler zeigte Richtung Route 33, aus dem Heck schlugen rote Flammen, und die Reifen brannten lichterloh. Chee trat das Bremspedal durch, ließ den Wagen aus den schlammigen Fahrrillen herausschliddern und kam zwischen Grasbüscheln und verkümmerten Salbeibüschen zum Stehen. Noch ehe der Wagen stand, stieß Chee die Fahrertür auf, den Feuerlöscher in der Hand.
Jetzt regnete es wieder heftiger, kalte Tropfen klatschten ihm ins Gesicht. Dann hüllte ihn der unerträgliche schwarze Rauch von brennendem Gummi, brennendem Öl und brennenden Sitzen ein. Das Fahrerfenster war zersplittert. Chee richtete den Feuerlöscher ins Innere, sah, wie der weiße Schaum durch den Rauch schoss und erkannte durch den Rauch die undeutlichen Umrisse von Nez, der über dem Lenkrad zusammengesackt war.
»Del!«
Chee packte den Türgriff, ohne die beißenden Schmerzen so richtig wahrzunehmen. Als er die Tür aufriss, schlugen ihm sofort die Flammen entgegen. Er sprang zurück und schlug das Feuer auf seinem brennenden Uniformhemd aus. »Del!«, schrie er noch einmal. Wieder richtete er den Schaumstrahl in den Wagen, ließ den Feuerlöscher fallen, griff durch die offene Tür, bekam Officer Delbert Nez am Arm zu fassen und zerrte daran.
Nez war angeschnallt.
Chee tastete nach dem Gurtschloss, bekam es auf, zerrte wieder mit aller Kraft an Dels Arm und spürte dabei in seiner Handfläche so heftige Schmerzen, wie er sie noch nie zuvor gehabt hatte. Er taumelte rückwärts in den strömenden Regen, er und Delbert Nez. Einen Moment lang blieb er keuchend liegen, die Lungen voller Rauch. Ihm war bewusst, dass irgendetwas mit seiner Hand nicht in Ordnung war, und er spürte Delberts Gewicht, der teilweise auf ihm lag. Dann fühlte er Hitze. Sein Hemdärmel brannte. Er schlug die Flammen aus und arbeitete sich mühsam unter Nez hervor.
Delbert lag mit ausgebreiteten Armen und Beinen auf dem Rücken. Chee sah ihn nur kurz an, dann wandte er den Blick ab. Er griff nach dem Feuerlöscher und besprühte die Stellen, an denen Delberts Hose brannte. Mit dem restlichen Inhalt versuchte er, den brennenden Streifenwagen zu löschen. Delbert Nez hatte gesagt, er fahre »mit dem letzten Tropfen Sprit«. Das war sein Glück gewesen. Chee hatte oft genug brennende Wagen gesehen, um zu wissen, was ein voller Tank anrichten konnte. Sein Glück? Auch die letzten Tropfen Sprit hatten für ein Feuer ausgereicht, das Nez das Leben gekostet hatte.
Er schnappte sich das Funkgerät, machte Meldung nach Ship Rock und forderte Verstärkung an. Erst dann nahm er die Schmerzen seiner eigenen Brandwunden richtig wahr.
»Da war auch Blut«, sagte Chee gerade. »Möglicherweise ist er erschossen worden. Ich glaube, sein Hemd ist am Rücken voller Blut – und vorn auch.«
Captain Largo war zufällig gerade in der Dienststelle, um den anfallenden Papierkram zu erledigen. Als Chee die Meldung durchgab, übernahm er selbst das Mikro in der Ship-Rock-Funkzentrale.
»Wir schicken jeden rüber, den wir hier entbehren können«, versicherte Largo, »auch aus Window Rock, und ich frage nach, ob eine Streife aus Crownpoint zufällig in deine Richtung unterwegs ist. Ist das Blut noch frisch?«
Chee sah sich seine Hand an und verzog das Gesicht. »Jedenfalls ist es noch klebrig«, antwortete er. »Irgendwo zwischen glitschig und klebrig.« Von seiner Handfläche hing ein großes Stück Haut herunter. Das muss der Türgriff gewesen sein, dachte er. Es fühlte sich an, als hätte sich der glühende Griff fast bis auf die Knochen durchgebrannt.
»Du hast sonst keine Scheinwerfer gesehen?«
»Doch, einen Wagen. Kurz nachdem ich aus Red Rock losgefahren bin, ist ein weißer Jeepster von der 33 auf die Straße nach Biklabito abgebogen. Es saß nur eine Person drin. Ich glaube, der Fahrer war dieser vietnamesische Mathelehrer von der Ship Rock Highschool. Jedenfalls war es sein Wagen, glaube ich.« Jeder Atemzug verursachte Schmerzen. Chees Rachen und Lunge und Augen brannten, und seinem Gesicht ging es nicht besser. Mit tauben Fingern tastete er es ab. Die Augenbrauen waren weggesengt.
»Okay, wir übernehmen das«, sagte Largo gerade. »Mit der Spurensuche lassen wir uns Zeit, bis es wieder hell ist. Bring in der Umgebung des Wagens nichts durcheinander, verstanden?« Der Captain hielt inne. »Ist das klar?«, fragte er dann.
»Ja, natürlich«, bestätigte Chee. Er wollte dieses Gespräch beenden.
Er wollte diesen Kerl aufspüren, der Delbert Nez umgebracht hatte. Er, Chee, hätte bei Nez sein sollen. Er hätte hinfahren sollen und ihm helfen.
»Du bist auf der 33 Richtung Osten gefahren? Von Red Rock aus? Fahr zurück auf die 33 und dann weiter Richtung Osten. Bleib drauf bis zur 666. Vielleicht fällt dir unterwegs irgendwas auf. Falls der Täter motorisiert war, kann er sich nur auf diesem Weg davongemacht haben.« Largo hielt kurz inne. »Es sei denn, es war dein vietnamesischer Lehrer.«
Doch Chee kam nicht bis zum U. S. Highway 666. Etwa drei Meilen östlich der Einmündung tauchte im aufgeblendeten Scheinwerferlicht die Gestalt eines Mannes auf, der die Asphaltstraße entlangmarschierte. Chee stieg auf die Bremse und starrte ihn an. Der Mann schwankte mitten auf der nach Westen führenden Fahrspur dahin. Er trug keine Kopfbedeckung, seine grauen Haare waren zu einem Knoten zusammengebunden, das regennasse Hemd klebte an seinem Rücken. Der Mann hatte anscheinend die Scheinwerfer, die jetzt bis auf wenige Meter herangekommen waren, überhaupt nicht bemerkt. Er sah sich nicht um und machte keinerlei Anstalten, am Straßenrand weiterzugehen. Er marschierte einfach unbeirrt weiter. Dabei schwang er etwas in der rechten Hand. Er bewegte sich in leichten Schlangenlinien, aber mit dem gleichmäßigen, ruhigen Schritt eines Mannes, der schon viele Kilometer hinter sich gebracht hat und noch viele Kilometer schaffen will.
Chee steuerte den Streifenwagen neben ihn und kurbelte sein Fenster herunter. Der Gegenstand, den der Mann schwang, war eine bauchige Flasche, die er am Hals festhielt. »Yaa’ eh t’eeh!«, rief Chee – den unter den Navajo üblichen Gruß. Der Mann ignorierte ihn und stapfte unbeirrt weiter über den Asphalt. Als er den Streifenwagen passiert hatte und wieder ins Scheinwerferlicht trat, sah Chee, dass hinten in seinem Hosenbund etwas Klobiges steckte. Es sah wie ein Revolvergriff aus.
Chee entsicherte seinen eigenen Revolver, nahm ihn aus dem Halfter und legte ihn auf den Beifahrersitz. Dann schaltete er die Sirene an. Aber der Grauhaarige schien das plötzliche Aufheulen nicht zu hören.
Chee griff zum Mikrofon, rief Ship Rock und gab seinen Standort durch. »Vor mir marschiert ein älterer Mann – etwa eins fünfundsiebzig groß, grauhaarig – vom Brandort weg, nach Westen, die Straße entlang. Er hat etwas im Hosenbund stecken, das wie ein Revolver aussieht, hält in der rechten Hand eine Flasche, wahrscheinlich eine Whiskeyflasche, und benimmt sich ziemlich eigenartig.«
»Benimmt sich ziemlich eigenartig«, wiederholte der diensthabende Beamte.
»Ich halte ihn für betrunken«, sagte Chee. »Er tut so, als würde er mich weder hören noch sehen.«
»Der Verdächtige ist betrunken«, wiederholte sein Kollege.
»Vielleicht«, stellte Chee richtig. »Ich nehme ihn jetzt fest.« Was leichter gesagt ist als getan, dachte Chee. Er fuhr an dem schwankenden Wanderer vorbei und wendete dann, sodass seine Scheinwerfer dem Mann direkt ins Gesicht strahlten. Dann stieg er mit dem Revolver in der Hand aus. Ihm war schwindlig. Er konnte nur verschwommen sehen.
»Halt! Bleiben Sie stehen!«, rief Chee.
Der Alte blieb stehen und starrte Chee an, als versuche er, sich auf ihn zu konzentrieren. Dann seufzte er, setzte sich auf die Straße, schraubte den Verschluss von seiner Flasche und genehmigte sich glucksend einen großen Schluck Whiskey. Schließlich sah er zu Chee auf und murmelte: »Baa yanisin, shiyaazh.«
»Du schämst dich?«, wiederholte Chee mit erstickter Stimme. »Er schämt sich!« Mit der unverletzten Hand griff er über die Schulter des Grauhaarigen und zog ihm mit einem Ruck den Revolver aus dem Hosenbund. Die Mündung roch nach verbranntem Pulver. Dann überprüfte er die Trommel. Patronen in allen sechs Kammern, aber drei Patronen waren abgefeuert und leer. Chee steckte den Revolver in seinen Hosenbund, riss dem Grauhaarigen die Flasche aus der Hand und warf sie in hohem Bogen in die Salbeibüsche am Straßenrand.
»Dreckiger Coyote!«, blaffte Chee auf Navajo. »Steh auf!« Seine Stimme klang scharf.
Der Mann sah verwirrt zu ihm auf. Das grelle Scheinwerferlicht spiegelte sich in dem Regenwasser, das ihm in Bächen übers Gesicht lief und von seinen Haaren und Augenbrauen tropfte.
»Los, steh auf!«, schrie Chee ihn an.
Er riss den Mann hoch, stieß ihn vor sich her zum Streifenwagen, suchte ihn rasch nach weiteren Waffen ab, nahm ein Taschenmesser und ein paar Münzen aus einer Brusttasche und eine abgegriffene Geldbörse aus einer Gesäßtasche. Als er ihm Handschellen anlegte, merkte er, wie mager die knochigen Handgelenke des alten Mannes waren. Wieder wurde er sich der Schmerzen in seiner linken Handfläche bewusst und registrierte, dass seine rechte Hand fast gefühllos war. Er bugsierte den Mann auf den Rücksitz, warf die Tür hinter ihm zu, blieb noch einen Augenblick stehen und starrte ihn durch die Scheibe an.
»Shiyaazh«, wiederholte der Mann, »baa yanisin.« Mein Sohn, ich schäme mich.
Chee stand mit hängendem Kopf da, während der Regen auf seine Schultern prasselte. Er fuhr sich mit dem Handrücken über das nasse Gesicht und leckte sich über die Lippen. Es schmeckte salzig.
Dann machte er sich auf die Suche nach der Whiskeyflasche, die er in die Salbeibüsche geworfen hatte. Sie wäre später ein wichtiges Beweismittel.
3
Nichts fürchtete Lieutenant Joe Leaphorn mehr als dies: dass er Leuten Hilfsbereitschaft vorgaukeln musste, obwohl er ihnen nicht helfen konnte. Doch diesmal ging es um Mitglieder einer Familie aus Emmas Clan, dem Bitter Water Clan, mit denen er verschwägert war. Nach dem weit gefassten Verwandtschaftsbegriff der Navajo waren sie alle Emmas Brüder und Schwestern. Zwar hatte Emma kaum jemals von ihnen gesprochen, aber das spielte keine Rolle. Belanglos war auch, dass Emma ihn niemals gebeten hätte einzugreifen. Schon gar nicht in diesem Fall, bei dem es um den Mord an einem ihrer eigenen Polizisten ging. Allerdings hätte sie selbst bestimmt versucht zu helfen. Sie wäre dabei so unauffällig wie möglich vorgegangen – und wäre genauso machtlos gewesen wie Leaphorn. Aber Emma war tot, und damit lastete die ganze Verantwortung nun auf ihm.
»Wir wissen, dass er den Polizisten nicht umgebracht hat«, hatte Mary Keeyani gesagt. »Nicht Ashie Pinto.«
Nach den Verwandtschaftsbegriffen der Weißen war Mrs Keeyani eine Nichte von Ashie Pinto. Sie war tatsächlich die Tochter von Ashies Schwester, und das verlieh ihr im Turning Mountain Clan den Status einer leiblichen Tochter. Sie war eine magere kleine Frau, die für ihren Besuch in der Stadt extra ihren altmodischen traditionellen Sonntagsstaat angezogen hatte. Aber die langärmelige Samtbluse war viel zu weit, als stamme sie noch aus fetteren Jahren; als Schmuck trug sie nur ein einzelnes schmales Silberarmband, und die Halskette mit der stilisierten Kürbisblüte war nur mit sehr wenigen Türkisen besetzt. Nun saß sie steif und sehr gerade in dem blauen Plastikstuhl vor Leaphorns Schreibtisch, und man sah ihr an, wie unwohl und befangen sie sich fühlte.
Wie es sich für eine traditionelle Navajo gehört, hatte Mary Keeyani ihm erklärt, in welcher verwandtschaftlichen Beziehung sie zu Ashie Pinto stand und wie sehr demzufolge Hosteen Pintos Problem auch ihr Problem war. Louisa Bourebonette dagegen hatte überhaupt nichts erklärt. Sie saß neben Mary Keeyani und sah Leaphorn mit entschlossener Miene an.
»Das ist alles ein großer Irrtum, das steht völlig außer Zweifel.« Louisa Bourebonette sprach langsam, deutlich und mit leichtem Südstaatenakzent. »Aber beim FBI sind wir keinen Schritt weitergekommen. Wir haben versucht, mit jemandem in der Außenstelle Farmington zu reden, und dann sind wir nach Albuquerque gefahren. Aber die FBI-Leute weigern sich, mit uns über den Fall zu reden. Und wir wissen nicht, wer uns dabei helfen könnte, Beweise für seine Unschuld zu sammeln. Wir haben darüber nachgedacht, einen Privatdetektiv zu engagieren. Vielleicht können Sie uns jemanden empfehlen, den Sie für vertrauenswürdig halten?«
Louisa Bourebonette hatte Leaphorn ihre Karte gegeben. Er nahm sie und warf noch einmal einen Blick darauf.
Dr. Louisa Bourebonette
A. O. Professor
American Studies
Northern Arizona University
Flagstaff, Arizona
Aber das waren nicht die Informationen, um die es Leaphorn ging. Ihn interessierte, was diese schlanke Grauhaarige mit dem durchdringenden Blick mit dem traurigen Fall Delbert Nez zu tun hatte, bei dem ein junger Mann ermordet und das Leben eines alten Mannes zerstört worden war. In jahrzehntelanger Polizeiarbeit hatte er die Erfahrung gemacht, dass Menschen für alles, was sie tun, einen Grund haben – und dass der Grund umso gewichtiger sein muss, je mehr Aufwand mit ihrem Einsatz verbunden ist. Für Navajo waren die Familienbande so ein triftiger Grund, der alles andere in den Schatten stellte. Bourebonette war keine Navajo. Was sie tat, war mit erheblichem Arbeitsaufwand verbunden. Er legte ihre Karte in seine Schreibtischschublade.
»Haben Sie schon mit Hosteen Pintos Anwalt gesprochen?«
»Mit seiner Verteidigerin, die anscheinend nicht sonderlich gut informiert ist«, antwortete Bourebonette. Sie machte ein etwas abfälliges Gesicht und schüttelte den Kopf. »Mr Pinto hat natürlich eine Anwältin bekommen, die in ihrem Job noch völlig neu ist. Sie ist erst vor Kurzem aus Washington hierhergezogen. Hat gerade erst ihre Stelle angetreten. Sie hat uns gesagt, dass es beim Federal Public Defender’s Office – dem Bundesamt für Pflichtverteidiger – zwei Ermittler gibt, die uns helfen könnten. Aber …«
Professor Bourebonette ließ den Satz unvollendet, als sei ihr skeptischer Unterton Aussage genug. Leaphorn saß schweigend hinter seinem Schreibtisch. Er sah sie an. Dann wandte er den Blick wieder ab. Er wartete.
Bourebonette zuckte mit den Schultern. »Aber ich hatte den Eindruck, dass sie sich nicht allzu viel von den beiden verspricht. Ich glaube, dass sie diese Leute noch nicht sonderlich gut kennt. Alles in allem hat sie uns nicht gerade den Eindruck vermittelt, dass Mr Pinto vor Gericht gut vertreten sein wird.«
Leaphorn kannte einen der Cops im Amt des Federal Public Defenders: einen ehrlichen, fleißigen, zuverlässigen Hispano namens Felix Sanchez. Er war früher in El Paso Polizeibeamter gewesen, und er wusste, wie man ermittelt. Aber auch Sanchez hätte den beiden Frauen nicht viel helfen können. Und Leaphorn konnte erst recht nichts für sie tun. Er hätte ihnen die Namen von Privatdetektiven in Farmington, Flagstaff oder Albuquerque geben können. Lauter Weiße. Was konnten sie schon tun? Was konnte irgendjemand tun? Ein alter Mann war durch Whiskey gemeingefährlich geworden und hatte einen Polizeibeamten erschossen. Wozu das bisschen Geld vergeuden, das seine Familie vielleicht besaß? Oder das Geld dieser rabiaten Weißen? Welche Rolle spielte sie in dieser Geschichte?
»Wenn Sie einen Privatdetektiv beauftragen, wird das eine Stange Geld kosten«, sagte Leaphorn. »Er würde gleich mal einen Teil seines Honorars als Vorschuss verlangen. Mindestens fünfhundert Dollar, schätze ich. Und Sie müssten ihm seine Auslagen erstatten. Fahrtkosten, Mahlzeiten, Übernachtungen und all das. Und dazu käme dann noch das eigentliche Honorar auf Stundenbasis.«
»Wie viel?«, fragte Professor Bourebonette.
»Genau weiß ich das nicht. Schätzungsweise fünfundzwanzig bis dreißig Dollar pro Stunde.«
Mrs Keeyani schnappte nach Luft. Sie war sichtlich erschrocken. Dr. Bourebonette legte ihr tröstend eine Hand auf den Arm.
»Damit haben wir ungefähr gerechnet«, sagte Professor Bourebonette mit steifer, unnatürlich klingender Stimme. »So viel können wir zahlen. Wen würden Sie uns empfehlen?«
»Kommt drauf an«, meinte Leaphorn. »Was haben Sie …«
Professor Bourebonette unterbrach ihn zornig.
»Eigentlich sollte man erwarten, dass die Polizei die Ermittlungen selbst in die Hand nimmt. Anscheinend ist es inzwischen so, dass man einen Privatdetektiv engagieren muss, um Licht in einen Mordfall zu bringen.«
Dem hatte Leaphorn wenig entgegenzusetzen. Also sagte er das, was offensichtlich war.
»Bei Fällen dieser Art, wo ein Verbrechen in einem Reservat verübt worden ist, ist für die Rechtsprechung ausschließlich das …«
Sie hob abwehrend die Hand. »Dafür ist das FBI zuständig. Das hat man uns bereits gesagt – übrigens wussten wir das schon selbst, weil wir nicht auf den Kopf gefallen sind. Aber immerhin ist einer Ihrer eigenen Männer ermordet worden.« Ein leicht sarkastischer Ton hatte sich in ihre Stimme geschlichen. »Sind Sie nicht ein kleines bisschen neugierig, wer ihn wirklich umgebracht hat?«
Leaphorn spürte, wie er rot wurde. Diese arrogante Weiße erwartete doch nicht etwa, dass er ihre Frage beantwortete? Nicht in Anwesenheit der Nichte des Täters.
Aber die Professorin wartete tatsächlich auf eine Antwort. Sollte sie doch warten! Leaphorn wartete selbst. Schließlich sagte er: »Fahren Sie fort.«
»Da Sie offenbar nicht ermitteln und sich das FBI damit zufriedengibt, Ashie Pinto einfach vor Gericht zu bringen, ohne den geringsten Versuch zu unternehmen, den wahren Täter zu finden, können Sie uns hoffentlich wenigstens raten, wen wir engagieren sollen. Jemand, den Sie für integer halten.«
Leaphorn räusperte sich. Er versuchte, sich diese überhebliche Lady im eleganten Büro des zuständigen FBI-Beamten in Albuquerque vorzustellen. Dort war es bestimmt ausgesucht höflich und manierlich zugegangen.
»Ganz recht«, sagte er. »Darüber haben wir ja vorhin gesprochen. Aber um Sie beraten zu können, muss ich einiges wissen. Was können Sie diesem Privatdetektiv erzählen? Welche Informationen können Sie ihm geben, mit denen er dann arbeiten kann? Soll er Hinweisen im Reservat nachgehen – in der Gegend, wo Hosteen Pinto zu Hause war? Oder soll er sich eher rund um Ship Rock und Red Rock auf die Suche machen, wo der … wo es passiert ist? Mit anderen Worten: Was wissen Sie, das ihm nützlich sein könnte? Was wissen Sie, das ihm helfen könnte, Zeugen zu finden? Oder was könnte beispielsweise beweisen, dass Hosteen Pinto ganz woanders war, als das Verbrechen begangen wurde? Welche Informationen können Sie dem privaten Ermittler liefern, damit er einen Ansatzpunkt für seine Nachforschungen hat?«
Leaphorn hielt inne und dachte, dass er sich wohl besser nicht in diese Sache hineinziehen lassen sollte. Das war nicht sein Fall, das ging ihn nichts an. Jede Einmischung konnte ihm nur Ärger einbringen, denn diese gesamte Abteilung der Navajo-Police wollte, dass der Tod eines Kollegen durch die Verurteilung seines Mörders gesühnt würde. Er war dabei, eine Tür zu öffnen, und er wusste genau, dass er das besser bleiben lassen sollte. Am besten erklärte er diesen beiden Frauen einfach, dass er ihnen nicht helfen konnte – was zufällig die traurige Wahrheit war. Trotzdem: Mary Keeyani war eine Verwandte von Emma. Und im Fall Delbert Nez gab es seines Wissens etliche Ungereimtheiten und unbeantwortete Fragen.
»Hören Sie«, sagte er, »sollten Sie brauchbare Informationen haben – über mögliche Zeugen, über irgendetwas, das zu belastbaren Beweisen führt, für die sich das FBI aber nicht interessiert hat –, können Sie es mir sagen. Ich werde mich beim FBI persönlich dafür einsetzen, dass man diese Informationen mit der angemessenen Sorgfalt behandelt. Wenn Sie also irgendetwas wissen …«
»Wir wissen, dass er es nicht getan hat«, antwortete Bourebonette. Aber ihr Zorn war jetzt verraucht. Sie brachte ein kleines, schwaches Lächeln zustande. »Wir können Ihnen nur erzählen, warum wir uns so sicher sind, dass er den Polizeibeamten nicht umgebracht haben kann. Es geht schlicht und einfach darum, was für ein Mann Ashie Pinto ist. Immer gewesen ist.«
Aber vor langer Zeit hat er einen Mann getötet, dachte Leaphorn. Wenn ich mich recht erinnere, stand in seiner Akte, dass er vor Jahren wegen Totschlags zu einer Haftstrafe verurteilt wurde.
»Sind Sie eine Verwandte?«, fragte er Bourebonette.
»Eine Freundin«, antwortete die Professorin.
Leaphorn sah sie über seine Lesebrille hinweg an und wartete auf eine ausführlichere Antwort.
»Seit fünfundzwanzig Jahren«, fügte sie hinzu. »Mindestens.«
»Ah«, sagte der Lieutenant.
Professor Bourebonette sah ungeduldig aus, so als halte sie weitere Erläuterungen für reine Zeitverschwendung. Aber dann überlegte sie es sich doch anders.
»Mein Spezialgebiet ist die vergleichende Mythologie. Die Entstehung von Mythen in den Kulturen. Und die Veränderung von Mythen, wenn Kulturen aufeinandertreffen und sich miteinander vermischen. Die Interaktion der Mythologie einer Gesellschaft mit ihren wirtschaftlichen Grundlagen und ihrer Umwelt. Mr Pinto ist einer meiner Informanten gewesen. Seit vielen Jahren.« Sie machte eine Pause.
Leaphorn warf ihr einen Blick zu. War sie fertig? Nein, sie erinnerte sich nur an vergangene Zeiten.
»Er würde niemals einen Menschen töten«, fügte sie hinzu. »Er hat einen wundervollen Sinn für Humor. Und ein großartiges Gedächtnis für lustige Dinge. Er hat überhaupt ein ausgezeichnetes Gedächtnis.« Sie sah Leaphorn in die Augen und sprach langsam und deutlich, als wäre er der Richter. Als verkörperte er die Geschworenenbank. Aber könnte Whiskey nicht auch einen Spaßvogel zum Mörder machen? Genauso wie er Traurige und Zornige zu Morden anstiftete?
»Er hat einen wundervollen Sinn für Humor«, wiederholte Bourebonette.
Das beweist überhaupt nichts, dachte der Lieutenant. Aber es war interessant. Ebenso interessant war, dass sie ihm das alles erzählte. Sie war weit gereist, hatte sich viel Zeit genommen, und sie würde noch viel Geld ausgeben müssen, falls sie tatsächlich einen Privatdetektiv engagieren wollte. Und sie hatte nur eine sehr fadenscheinige Erklärung dafür, warum sie bereit war, all das zu tun.
Deshalb bat Leaphorn seine Verwandte aus dem Turning Mountain Clan und die Professorin um einen Augenblick Geduld. Er rief eine Etage tiefer an und ließ sich die Akte MORD: DELBERT NEZ bringen.
Er selbst war nicht da gewesen, als es passierte. Er hatte in einem Hotelzimmer in Phoenix, Arizona, darauf gewartet, bei einer Berufungsverhandlung vor dem dortigen Bundesgericht als Zeuge auszusagen. Trotzdem erinnerte er sich an viele Einzelheiten. Selbstverständlich hatte er jeden Tag die Berichterstattung in der Phoenix Gazette und der Arizona Republic verfolgt. Und er hatte in der Polizeidienststelle in Ship Rock angerufen und mit Captain Largo über den Fall gesprochen. Die Navajo-Police bestand nur aus rund hundertzehn vereidigten Beamten, daher ging der Mord an einem Kollegen jedem Einzelnen von ihnen persönlich sehr nahe. Leaphorn hatte Delbert Nez kaum gekannt, aber er erinnerte sich gut an den kleinen, ruhigen und äußerst peniblen Polizisten. Da sie beide in Window Rock stationiert gewesen waren, hatte Leaphorn ihn oft gesehen. Nez hatte versucht, sich einen Schnäuzer wachsen zu lassen. Das war für Navajo mit ihrem spärlichen Bartwuchs keine einfache Sache, und seine kümmerlichen Stoppeln hatten ihm Spott und Hänseleien eingebracht.
Den Beamten, der den Tatverdächtigen festgenommen hatte, kannte Leaphorn weit besser. Jim Chee hatte schon bei mehreren Ermittlungen seinen Weg gekreuzt. Ein hochintelligenter junger Mann. Clever. Vielversprechend. Aber er hatte eine Schwäche, die bei einem Polizisten fatale Folgen haben kann. Er war ein Individualist, der sich nur dann an Regeln hielt, wenn sie in seine Vorstellungen passten. Außerdem war er ein Romantiker. Er wollte sogar Medizinmann werden. Leaphorn lächelte über diese Idee. Polizist und Schamane in einer Person. Diese beiden Berufe waren absolut nicht miteinander vereinbar.
Leaphorn ertappte sich bei der Frage, ob er wohl Chees erster Klient gewesen war. Damals, als er gerade einen schwierigen Fall abgeschlossen hatte und selbst wegen Emmas Tod in einer furchtbaren Verfassung war, hatte er Chee gebeten, für ihn einen Blessing Way zu zelebrieren. Es war eine durch und durch impulsive Entscheidung gewesen, was eigentlich gar nicht seiner Art entsprach. Zum einen hatte er dem jungen Mann eine Gelegenheit geben wollen, sich als Schamane zu erproben, zum anderen verstand er die Zeremonie als Geste an Emmas Verwandtschaft. Die Yazzie gehörten zum Bitter Water Clan und waren Traditionalisten. Die Zeremonie sollte eine unausgesprochene Entschuldigung für das Leid sein, das er ihnen zugefügt haben musste. Schon am zweiten Morgen, nachdem sie den Leichnam in den Canyon hinausgetragen hatten, hatte Leaphorn den Hogan seiner Schwiegermutter verlassen. Vier Tage schweigender Trauer im Familienkreis, wie es die Tradition verlangte, war mehr, als er ertragen konnte. Er hatte die Yazzie damit schwer gekränkt und sein Verhalten später bereut. Und so hatte er Agnes angerufen und ihr erzählt, dass er einen Singer bestellt hatte. Ob sie wohl die Zeremonie arrangieren könnte? Sie hatte diese Aufgabe nur allzu gern übernommen, denn sie wusste recht gut, dass sein eigener Clan – die Slow Talking Diné – jetzt weit verstreut und fast ausgelöscht war und dass Leaphorn kaum noch nahe Verwandte hatte. In Gegenwart von Agnes hatte er sich etwas befangen gefühlt. Agnes hatte nie geheiratet, und als Witwer hätte er nach alter Sitte eigentlich die ledige Schwester seiner verstorbenen Frau heiraten müssen.
Leaphorn sah zu den beiden Frauen hinüber, die geduldig wartend vor seinem Schreibtisch saßen, und warf dann wieder einen Blick in die Akte Nez. Aber er dachte an Officer Jim Chee, dessen Haar zu einem Knoten am Hinterkopf zusammengebunden war, wie er sein Zubehör auf dem frisch gefegten Lehmboden des Yazzie-Hogans ausgebreitet hatte. Chee war nervös gewesen. Er hatte Leaphorn gezeigt, wo er mit dem Rücken an die Westwand des Hogans gelehnt sitzen musste und hatte einen kleinen Teppich vor ihm ausgebreitet. Dann hatte Chee aus seinem hirschledernen jish einen kleinen Lederbeutel genommen, der sein Four-Mountain-Bündel war, außerdem zwei Paar sogenannte talking prayersticks, eine Schnupftabakdose mit Feuersteinpfeilspitzen und ein halbes Dutzend Säckchen mit Pollen. Feierlich hatte er die Umrisse von Fußspuren auf dem Boden markiert und dann mit dem Pollen darauf die Symbole der Sonnenstrahlen gezeichnet, auf denen Leaphorn künftig gehen würde. Hinter Chee im Eingang des Hogans Richtung Osten hatte Leaphorn die zerklüfteten Wände der Carrizo Mountains gesehen, rosig angestrahlt vom Dämmerlicht. Er hatte den Pinienduft gerochen, der von den Kochfeuern von Emmas Verwandten und seinen eigenen Freunden herüberwehte. Sie alle waren gekommen, um ihn auf seinem Vorstoß in die spirituelle Welt seines Volkes zu begleiten.
In diesem Augenblick hatte er sich nichts sehnlicher gewünscht, als die Zeremonie abbrechen zu können. Er war ein Heuchler. Er glaubte nicht daran, dass die rituellen Gesänge, die Officer Jim Chee vortragen würde, oder die Sandbilder, die er auf dem Boden des Hogans gestalten würde, die bösen Mächte bannen und sie dazu zwingen könnten, Joe Leaphorn ein Leben in Harmonie und Schönheit zurückzugeben. Das Schöne war aus seinem Leben gewichen, irgendwohin in die Felsen des Canyons, als sie Emmas Leichnam forttrugen. Es war für immer fort, und Leaphorn wünschte sich von Herzen, Emma folgen zu können.
Aber er hätte das einmal begonnene Zeremoniell nicht mehr abbrechen können. Und als er nach einer langen Nacht mit rituellen Gesängen bei Tagesanbruch die vier zeremoniellen tiefen Atemzüge in frischer Morgenluft getan hatte, war ihm anders zumute gewesen als seit Wochen. Die Zeremonie hatte ihn nicht geheilt, aber sie hatte den Heilungsprozess eingeleitet. Dafür hatte er vermutlich dem Schamanen Jim Chee zu danken. Zumindest für seinen Beitrag zu diesem Erfolg.
Aber Officer Jim Chee war eine andere Sache. Hätte Officer Jim Chee seine Pflicht getan, wäre Delbert Nez vielleicht noch am Leben.
»Brustdurchschuss links oben«, hieß es in dem Bericht. »Offenbar aus nächster Nähe erschossen.«
Leaphorn sah wieder zu Mary Keeyani und der Professorin hinüber. »Tut mir leid, dass ich so lange brauche«, entschuldigte er sich.
»Oh, wir haben Zeit«, versicherte ihm Mary Keeyani.
Von Captain Largo wusste er, dass Chee nach dem Mord den Polizeidienst hatte quittieren wollen. Bei der Bergung des Toten aus dem brennenden Fahrzeug hatte Chee Verbrennungen an beiden Händen, an einem Arm, einem Bein und am Oberkörper davongetragen. Der Captain war nach Farmington gefahren, um ihn im Krankenhaus zu besuchen. Da Largo und Leaphorn alte Freunde waren, hatte er ihm die ganze Geschichte erzählt.
»Er hat seinen Rücktritt nicht nur angeboten«, hatte Largo dem Lieutenant erzählt, »er hat darauf bestanden. Er hat mir seine Dienstmarke zurückgegeben. Er habe total versagt. Er hätte losfahren und Nez unterstützen müssen, als er hörte, dass der jemanden festnehmen wollte. Und das stimmt natürlich.«
»Warum ist er nicht hingefahren, verdammt noch mal?«, hatte Leaphorn gefragt. »Dieser Schwachkopf! Welche Entschuldigung hat er dafür?«