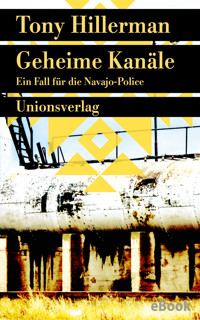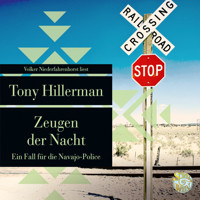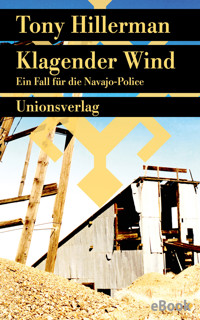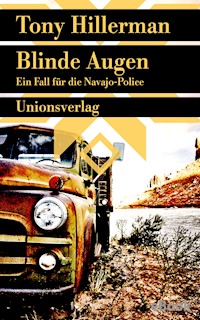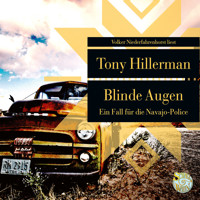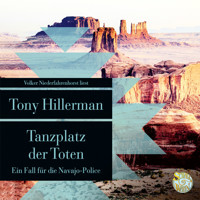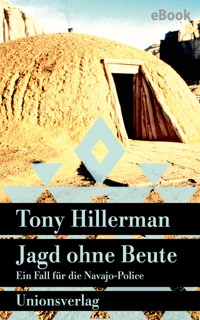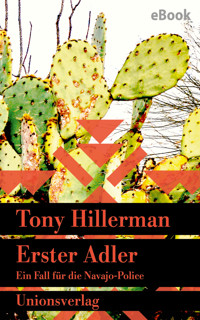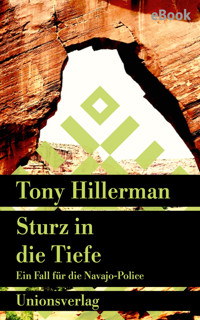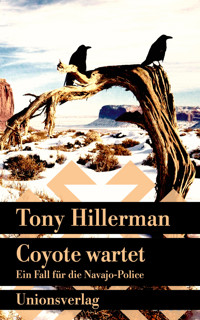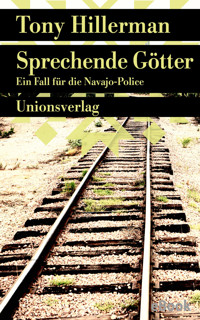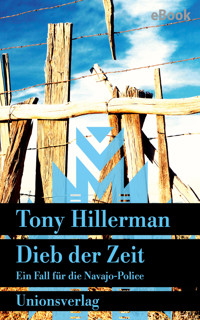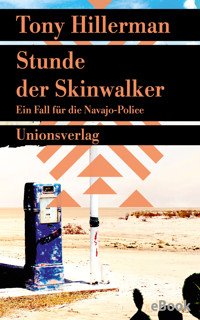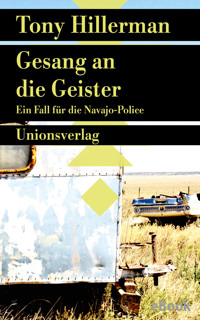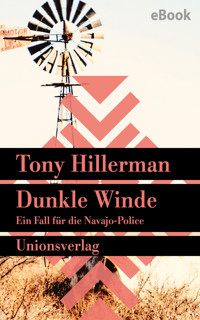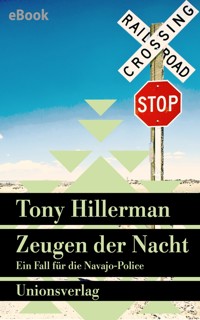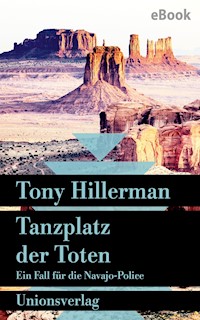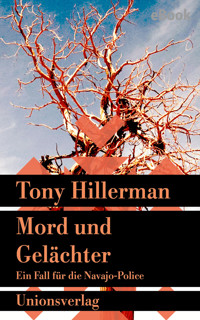
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Assistent von Lieutenant Leaphorn hat Jim Chee Aufregenderes erwartet, als den entlaufenen Enkel einer einflussreichen Großmutter zu suchen. Immerhin aber ist der junge Delmar schnell gefunden: Jim Chee entdeckt ihn inmitten maskierter Tänzer auf einer Zeremonie im Tano-Reservat. Doch noch bevor er den Jungen aufgreifen kann, unterbricht ein Klageschrei die ausgelassenen Feierlichkeiten: Einer der heiligen Clowns wurde erschlagen – kein anderer als Delmars Onkel. Eigentlich liegt der Fall nicht in Leaphorn und Chees Zuständigkeitsbereich, aber im Navajo-Reservat wurde ein Lehrer auf ganz ähnliche Weise ermordet. Zufall? Leaphorn wittert einen Zusammenhang, und Chee heftet sich an Delmars Fersen. Der Junge scheint die Schlüsselfigur zu sein, doch er ist wie vom Erdboden verschluckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 447
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch
Im Navajo-Reservat wurde ein Lehrer getötet; nur wenige Tage später bei einer Zeremonie im Tano-Reservat ein heiliger Clown. Beide starben durch einen Schlag auf den Hinterkopf – Zufall? Leaphorn und Chee wittern einen Zusammenhang. Ein junger Ausreißer scheint als einziger die Antworten zu kennen, doch der ist wie vom Erdboden verschluckt.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tony Hillerman (1925–2008) besuchte ein Internat für Native Americans, kämpfte im Zweiten Weltkrieg, studierte Journalismus und war als Journalist und Dozent tätig. Seine Romane um die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee wurden vielfach ausgezeichnet und in siebzehn Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Tony Hillerman.
Klaus Fröba (*1934) ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Übersetzer, er veröffentlichte Jugendbücher und Kriminalromane. Er übersetzte aus dem Englischen, u. a. Werke von Jeffrey Deaver, Ira Levin, Tony Hillerman und Douglas Preston. Fröba lebt in der Nähe von Bonn.
Zur Webseite von Klaus Fröba.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tony Hillerman
Mord und Gelächter
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Klaus Fröba
Ein Fall für die Navajo-Police (10)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Worterklärungen und Hintergrundinformationen zu diesem Buch auf https://ehillerman.unm.edu/encyclopedia-main
Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Frank Schmitter nach dem Original durchgesehen und grundlegend überarbeitet.
Die Originalausgabe erschien 1993 bei HarperCollinsPublishers, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel Geistertänzer im Goldmann Verlag, München
Originaltitel: Sacred Clowns
© by Anthony G. Hillerman 1993
Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Klaus Fröba beim Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hintergrund - Jon Bower (Alamy Stock Foto); Symbol - Valerii Egorov (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31168-8
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 29.06.2024, 15:00h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
MORD UND GELÄCHTER
Vorbemerkung des Autors1 – Es war Officer Jim Chee zunächst reichlich komisch …2 – Sie haben also auf dem Dach gesessen?« …3 – Fakt ist«, sagte Sergeant Harold Blizzard, »dass dieser …4 – Leaphorn und David W. Streib hatten es nicht …5 – Er heißt Eugene Ahkeah«, sagte Lieutenant Toddy. »Seine …6 – Janet trug einen blauen Rock, eine weiße Bluse …7 – Der Kellner im Dowager Empress hatte schon vor …8 – Als Jim Chee sein Büro betrat, fiel sein …9 – Virginia Toledo musterte Chee über den Rand ihrer …10 – Der Haken war nur, dass Chee Delmar Kanitewa …11 – Im Rückblick, bei dem Versuch, sich klarzumachen …12 – Officer Jim Chee hatte seinen freien Tag …13 – Als Chee am nächsten Morgen ins Büro kam …14 – Dilly Streib stand im Türrahmen von Dorseys Werkraum …15 – Sammie Yazzie schien der Chef vom Dienst beim …16 – Auf dem Weg zum Parkplatz entschied Chee über …17 – Noch ehe er Chees Notiz ganz gelesen hatte …18 – Und Bert Penitewa, der Governor im Tano Pueblo …19 – Das Projekt der Navajo Agriculture Industries löste bei …20 – Viel geschlafen hatte Joe Leaphorn nicht. Bis spät …21 – Leaphorn legte den Hörer auf und warf einen …22 – Pater Haines war schon in Hut und Mantel …23 – Das Haus war ihm noch nie so leer …24 – Jim Chee, im Slow Talking Diné und für …25 – Als Joe Leaphorn klar geworden war, dass der …26 – Das alte Schlachtross hat eine Menge erzählt« …27 – Geduldig zu warten war eine Tugend, in der …28 – Aus Dorseys Wohnwagen rief Leaphorn seinen alten Freund …Mehr über dieses Buch
Über Tony Hillerman
»Der Angst vor seinem Pferd hat«
Claus Biegert: Die Navajo-Romane — ein Fall von Kultureller Wertschätzung
Über Klaus Fröba
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tony Hillerman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema USA
Dieses Buch ist Pater Dough McNeill gewidmet, dem Direktor der Saint Bonaventure Indian Mission in Thoreau, und all seinen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die ungezählte Stunden in Klassenzimmern und Gemeinschaftsküchen oder hinter dem Lenkrad von Schulbussen und Wassertransportern ihrer Mission widmeten. Ihnen gilt mein ganzer Respekt. Sie kommen aus allen Teilen des Landes, gehören unterschiedlichen Generationen und Religionen an, aber sie eint der Wunsch, ihren Mitmenschen zu helfen.Dies waren die Menschen, die Pater Dough McNeill zu der Zeit, als dieses Buch entstanden ist, zur Seite standen und halfen: Theresa Arsenault, Christine Behnke, Lonnie Behnke, Frances Behr, Ireen Brayman, Jim Brayman, Ken Brewer, Mary Brewer, Barbara Burdick, Natalie Bussiere, Andrew Campbell, Ann Carter, Jan Charles, Maria Cravedi, Ernest Duran, George Erickson, Yoshiko Erickson, Jennifer Farrell, Al Feng, Christine Fitzpatrick, Bob Gallagher, Helen Gallagher, Stu Healy, Cynthia Higbee, Rick Juliani, Juli McKee, Kathy Murray, Bud und Grace Ouelette, Chris Pietraszewski, John Rauch, Carola Rintala, John Seckinger, Dan Skendzel, Bob Sparapani und Tim Thompson.
Vorbemerkung des Autors
Die Charaktere in diesem Buch sind frei erfunden, sie haben keine Ähnlichkeit mit lebenden Personen. Auch das Dorf Tano Pueblo gibt es nicht. In den zeremoniellen Ereignissen, die sich dort abspielen, spiegeln sich die Erfahrungen des Autors in anderen Pueblos.
Dr. Louis Hieb von der University of Arizona, Autor mehrerer Werke über die Kosharen und die Clownsriten der Hopi, schulde ich tiefen Dank für seine Hilfe und seine Anregungen. Tano ist jedoch kein Hopi-Dorf, und die Geschehnisse und Beschreibungen spiegeln nicht die religiösen Bräuche der Hopi wider.
1
Es war Officer Jim Chee zunächst reichlich komisch vorgekommen, bei wildfremden Leuten auf dem Dach zu sitzen. Aber das hatte sich rasch gelegt. Mittlerweile hielt er den Aussichtspunkt in luftiger Höhe für eine der wenigen guten Ideen von Cowboy Dashee. Von hier oben konnte Chee alles überblicken. Die Trommler direkt unter den Spitzen seiner frisch gewienerten Stiefel, den Zug der maskierten Tänzer, der gerade zur Linken auf die Plaza einbog, die Zuschauer, die sich entlang der Hausmauern drängten, und die Verkaufsbuden, die das Gewirr der schmalen Straßen säumten. Über die Köpfe der dicht gedrängten Zuschauer auf den flachen Dächern konnte er den Blick auf den unregelmäßig gepflanzten Pappeln in goldenem Herbstschimmer ausruhen lassen, die sich am Flussufer aneinanderreihten, oder auf den blauen Bergen am Horizont oder auf dem Flickenteppich, den die grünen, braunen oder silbern glänzenden Vierecke des künstlich bewässerten Farmlands der Tano bildeten.
Ein exzellenter Hochsitz, um den Tano-Kachina-Tanz zu beobachten – sei es aus persönlichen oder eben dienstlichen Motiven. Besonders, weil sich Janet Petes Oberschenkel so schön warm an ihn schmiegte. Falls Delmar Kanitewa hier auftauchte, würde er ihn sicher nicht verpassen. Und wenn der Junge sich nicht blicken ließ, hatte er zumindest den besten Platz erwischt, um die Zeremonie zu beobachten.
Solche mystischen Rituale hatten schon immer eine große Faszination auf Chee ausgeübt. Seit frühester Jugend hatte er sich gewünscht, in die Fußstapfen von Hosteen Frank Sam Nakai zu treten. Nach dem Familienverständnis der Navajo war Nakai als älterer Bruder von Chees Mutter sein »Kleiner Vater«. Ein Schamane, ein hataalii – oder, wie die Weißen sagten, ein Singer oder Medizinmann, der in hohem Ansehen stand, weil er das Wissen um die traditionelle Religion bewahrte und die segensreichen Gesänge kannte, die die Holy People einst die Menschen gelehrt hatten, damit sie Heilung erlangten und in Harmonie blieben mit allem, was uns auf Erden umgibt. Nakai wirkte auf dem schmalen Grat zwischen Körper und Geist – das hatte Chee schon als kleinen Jungen so fasziniert.
»Sie möchten, dass die Fremden beim Kachina-Tanz oben auf den Dächern sitzen«, hatte Cowboy gesagt, »weil ihr Touristen ihnen dann wenigstens nicht auf den Füßen herumtretet. Vorausgesetzt, ihr fallt nicht herunter, könnt ihr weniger Unsinn machen und die Zeremonie stören. Die Tano brauchen Platz für ihre Tänze, unter anderem, weil sie mit den Kachinas Geschenke austauschen müssen.«
Dashee war vereidigter Deputy Sheriff im Apache County in Arizona, ein Hopi aus dem alten Side Corn Clan – und Chees bester Freund. Obwohl er manchmal eine richtige Nervensäge sein konnte.
»Aber was ist, wenn ich den Jungen irgendwo entdecke?«, hatte Chee gefragt. »Denkst du etwa, er wartet brav, bis ich runtergeklettert bin?«
»Warum nicht? Er weiß ja nicht, dass du ihn suchst.« Mit gespielter Vertraulichkeit, so, dass Chee es hören musste, hatte er Janet Pete zugeflüstert: »Der denkt doch, dass unser Detective Chee drüben in Thoreau an diesem spektakulären Mordfall arbeitet.«
Asher Davis hatte gesagt: »Ich glaub, ich kenne den Ermordeten. Da gab es einen Lehrer an dieser Saint Bonaventure School, einer von diesen Freiwilligen, und der hat mich ein-, zweimal angerufen, weil ein älterer Herr was verscherbeln wollte, und ich sollte zusehen, dass er einen guten Preis dafür rausschlagen kann. Das eine Mal handelte es sich um ein kleines silbernes Blütenstaubdöschen, hat ganz nach neunzehntem Jahrhundert ausgesehen. Und irgendein schräger Vogel in Farmington wollte dem alten Mann lausige zwei Dollar dafür zahlen. Ich hab glatt zweihundertfünfzig für ihn ausgehandelt. Kann es der sein, der umgebracht worden ist?«
»Sein Name war Dorsey«, hatte Chee gesagt, eher griesgrämig klingend, weil er Davis nicht kannte und sich noch nicht sicher war, ob er den Mann mochte. Aber das war vielleicht nur seiner Laune geschuldet.
»Dorsey«, hatte Davis gesagt. »Ja, das ist er.«
»Seht ihr.« Dashee grinste. »Mit diesen schweren Verbrechen befasst sich Officer Chee. Und er hat dazu noch die Zeit, dem Herausgeber der Zeitung Briefe zu schicken, damit der Rat der Tano endlich kapiert, was er mit den alten Uranminen anfangen soll.«
»Hey!«, sagte Janet. »Nun halt aber mal die Luft an, Cowboy. Das war ein verdammt guter Brief. Mit einem verdammt gescheiten Vorschlag. Die bei der Zeitung haben das genauso gesehen. Sie haben sogar eine fette Balkenüberschrift drüber gesetzt.« Sie stieß Cowboy in die Rippen. »Willst du vielleicht, dass wir für den Rest der Welt zur Giftmüllhalde werden?«
Den ganzen Vormittag über hatte Chee geflissentlich Dashees Sticheleien überhört. Zuerst war es um den Brief gegangen, der an diesem Morgen in der Navajo Times erschienen war. Darin hatte Chee dem Vorschlag widersprochen, eine offene Grube der nicht mehr genutzten Jacks-Wild-Mine als Giftmülldeponie zu verwenden. Er hatte die Idee als »symptomatisch für den verächtlichen Umgang mit Stammesland« bezeichnet. Dann war die Sache mit dem Lehrer in Thoreau dazugekommen – der Mord im Werkraum der Schule; sie hatten im Autoradio davon gehört. Der Mann war an den Folgen eines schweren Schlages auf den Schädel gestorben. Den ersten Meldungen zufolge waren verschiedene Verkaufsobjekte verschwunden, einen Tatverdächtigen gab es noch nicht.
Ein ziemlich aufsehenerregendes Verbrechen, gemessen daran, was sonst so im Reservat passierte. Mit Sicherheit ein Fall, der es eher lohnte als dieser Auftrag hier. Die Sache war zwar gestern passiert, an Chees freiem Tag, aber Lieutenant Leaphorn hätte ihn trotzdem in die Ermittlungen einbeziehen können. Oder zumindest mit ihm reden können. Das wurmte Chee.
Aber noch mehr wurmte ihn Janet, weil sie Cowboy Dashee mit ihrem Grinsen und amüsiertem Kichern zu seinen Hänseleien ermuntert hatte. Nachdem sie seinen Brief gelobt hatte, war er allerdings bereit, ihr alles zu vergeben und sogar Cowboy nicht länger zu grollen. Zumal er zugeben musste, dass er durch die flapsige Bemerkung, dass die Hopi dazu neigten, in die Breite statt in die Länge zu wachsen, selber mit den Sticheleien angefangen hatte. So wie er auch zugeben musste, dass Cowboy mit dem Dach recht hatte. Falls Kanitewa da unten in der Menge auftauchte, weil er dabei sein wollte, wenn sein Pueblo dieses Herbstfest beging, würde sich der Junge inmitten seiner Familie und seiner Freunde absolut sicher fühlen. Andererseits wissen Kids, die aus einem Internat weglaufen, im Allgemeinen genau, dass jemand hinter ihnen her ist.
Chee war selber mal so ein Junge gewesen. Dieses Gefühl der Angst, das Wissen, gejagt zu werden, würde er nie vergessen. Man kann einfach nicht mehr ruhig durchatmen, selbst wenn die Jagd, wie in Chees Fall, kurz war und die Angst nicht viel Zeit hatte, um erdrückend zu werden. Der Mann aus dem Internat hatte, versteckt hinter dem Schafstall, im Wagen auf ihn gelauert, als Chee auf den Hogan seiner Mutter zugegangen war. Ihn zu sehen, war beinahe eine Erlösung gewesen. Die Erinnerung daran bot eine weitere Ausrede, um nicht dort oben auf dem Flachdach zu sitzen.
»Kanitewa wird ganz schön nervös sein«, meinte Chee, »und sich nicht so einfach schnappen lassen.«
Dashee sah das anders. »Ich sag dir was. Wir werden hier auf dem Dach sitzen. Wenn wir ihn entdecken, behältst du ihn im Auge, und ich klettere runter und greif ihn mir.«
Chee ließ sich das durch den Kopf gehen.
»Wenn diese Leute echte Hopi wären, müssten wir uns bei der ganzen Geschichte gar keine grauen Haare wachsen lassen«, sagte Dashee. »Bei uns Hopi sitzen alle Männer auf dem Dach – und die Frauen und Kinder unten auf den Treppenstufen rund um den Tanzplatz. So gehört sich das bei uns.«
»Nicht in allen Hopi-Dörfern«, widersprach Chee.
»In meinem ist es so, weil wir uns an die alten Traditionen halten.«
»Aber darum geht es doch jetzt gar nicht. Auf dem Dach wird er mich sehen. Ich sitze hier, rudere mit den Armen und deute auf ihn. Da muss er ja Verdacht schöpfen.«
Und alle anderen würden ihn auch sehen – einen Navajo, der sich bei einer Tano-Zeremonie zum Narren macht.
Asher Davis hatte schon die ganze Zeit zur Traufe des Daches hochgeblinzelt, offenbar ziemlich beunruhigt. Unter dem Kragen des Sporthemds wölbte sich sein sonnengebräunter Nacken zu einem dicken Wulst, und der Hemdrücken spannte bedenklich über seinem breiten Kreuz, obwohl Asher vorsichtshalber schon Größe »3XL« trug.
»Ich frag mich, ob mich das trägt?«, sinnierte er mit hörbarem Zweifel in der Stimme.
»Keine Sorge.« Dashee deutete mit weit ausholender Geste rund um die Plaza. »Gucken Sie sich doch all die Leute da oben an. Solche Dächer sind eigens für gestandene Mannsbilder wie uns beide gemacht oder – nach einem kritischen Seitenblick auf Chee und Janet Pete – für doppelt so viele der Sorte, die nichts auf den Rippen hat.«
Asher blieb skeptisch. »Für mich sind die bestimmt nicht gemacht. Und ich muss sowieso ein paar Leute hier treffen. Muss mich um meine Geschäfte kümmern. Die Ökonomie der Tano ankurbeln, ein paar hübsche Sachen aufkaufen.«
Janet Pete hatte die Diskussion beendet. »Kommen Sie, Asher, seien Sie nicht so träge. Wir setzen uns aufs Dach. Ihre Geschäfte können Sie auch später noch machen.«
»Stopp. Ich sehe gerade eine weitere Ausrede in Gestalt des guten alten Roger da drüben.« Er schaute Janet direkt an. »Den müssten Sie doch kennen? Ist ebenfalls Anwalt. Beackert das Indianerterritorium bei Santa Fe. Und setzt sich seit Jahren für die Rettung unseres Planeten ein.«
»Roger – wie weiter?«, fragte Janet und schaute in die Menge.
»Applebee. Die große Nummer bei der Umweltbewegung.«
»Ach ja, jetzt seh ich ihn«, sagte Janet. »Letztes Jahr hat er mit mir über den Vorschlag der Continental-Giftmülldeponie gesprochen.«
Davis lachte. »Vermutlich hat er Sie schon allein damit in die Bredouille gebracht. So kenne ich ihn seit etlichen Jahren. Rog und ich kennen uns nämlich seit Urzeiten, von der Santa-Fe-Highschool. Haben bei den Santa-Fe-Demons gespielt, er als Quarterback, ich als Fullback. Und in der zweiten Klasse hat er mir einen Rausschmiss eingebrockt. Genau der Typ Freund, den man braucht, damit einem das Leben nicht zu langweilig wird.«
Chee hatte nur mit halbem Ohr zugehört, zum Hausdach hochgestarrt und nach weiteren Gründen gesucht, nicht dort raufklettern zu müssen. Aber jetzt war er neugierig geworden.
»Wie ist denn das passiert, das mit dem Rausschmiss?«
»Na ja, wir hatten einen Algebra-Test, soweit ich mich erinnern kann, und Roger hatte gerade den Wagen von seinem Onkel in Verwahrung. Sollte ihn, glaub ich, polieren oder so. Da sind wir eben ein bisschen durch die Gegend gejuckelt, statt die Schulbank zu drücken. Ich solle mir bloß keine Sorgen machen, hat Rog gesagt, wir würden den Test einfach verschieben. Wir haben den Schulleiter angerufen und ihm weisgemacht, wir wären vom Gaswerk, und da wäre leider ein Leck in der Leitung, genau in dem Haus, wo der Mathekurs stattfand.« Davis grinste erinnerungsselig. »Hat auch geklappt.«
»Hat funktioniert, aber Sie sind trotzdem rausgeflogen?«, fragte Chee.
»Tja, so läuft das immer bei den Davis-Applebee-Projekten. Er heckt sie aus, aber nachher stellt sich dann raus, dass er doch irgendwas nicht einkalkuliert hat. Diesmal ging es nur einen einzigen Tag gut. Ich hatte bei der Schule angerufen, weil meine Stimme tiefer klang. Und als rauskam, dass es gar kein Leck in der Gasleitung gab, hatte die Sekretärin sich erinnert, dass ihr die Stimme irgendwie bekannt vorgekommen war.«
»Ich würde Applebee gern kennenlernen«, sagte Chee. »Könnte ja sein, dass ich ihm dabei helfen kann, dieses Deponie-Projekt zu stoppen.«
Aber in dem Augenblick hatte Davis »Hey, Rog!« gerufen und sich winkend durch die Menge gedrängt.
Und so waren sie dann, jetzt nur noch zu dritt, die Leiter hinter dem Haus hochgeklettert, aufs flache Dach, wo schon die Hausbesitzerin saß – eine pummelige Mittvierzigerin, offenbar eine Bekannte von Cowboy Dashee. Und so saßen sie auf dem Dach aus gestampftem Lehm, ganz vorn an der Brüstung, und ließen die Beine baumeln – mit der perfekten Aussicht und mit Chees schlechter Laune.
Nach alter Gewohnheit versuchte Chee, die Gründe dafür zu analysieren. Ein Grund war wohl, dass Lieutenant Leaphorn ihn mit diesem Allerweltsauftrag nach Tano Pueblo geschickt hatte. Zugegeben, er gehörte der Sonderkommission erst seit drei Tagen an, und sie waren nur zu zweit, und er war die Nummer zwei. Aber die Vorzeichen waren nicht gut, weil der Lieutenant ihn offenbar nicht ernst nahm. Nicht zur Aufklärung des Mordes hinzugezogen zu werden, war nur ein Indiz. Leaphorns ganzes Verhalten sprach Bände.
Die Sonderkommission war eingesetzt worden, weil sich ein Netzwerk aus Firmen, dem Bureau of Land Management und Jimmy Chester, Mitglied im Stammesrat, offensichtlich anschickte, durch Konspiration und geheime Absprachen aus dem Checkerboard-Reservat eine nationale Müllhalde zu machen. Darum hätte Chee sich kümmern sollen, nicht um einen weggelaufenen Jungen, der nicht mal ein Navajo war. Jedenfalls kein echter. Und überhaupt musste er nur hinter dem Burschen herlaufen, weil dessen Großmutter ein hohes Tier im Navajo-Stammesrat war.
Dass er hier nur seine Zeit verschwendete, war aber nur ein Teil der Antwort. Wenn er ehrlich mit sich selbst war, lag es wesentlich daran, wie sich die Dinge hier entwickelt hatten.
Nachdem Leaphorn ihm nun mal den Auftrag gegeben hatte, wollte Chee das Beste daraus machen. Da Janet Petes Rechtshilfebüro geschlossen war, hatte er bei ihr zu Hause angerufen und sie eingeladen, mitzufahren und sich die Zeremonie anzusehen. Ja, sehr gerne, hatte sie gesagt und sich mit ihm vor dem Navajo Nation Inn verabredet.
Und da stand sie auch. Aber, wie das Schicksal eben so spielt, nicht allein, sondern im Gespräch mit Cowboy Dashee und Asher Davis, und da hatte Chees vermeintlich so gute Idee im Nu eine Menge von ihrem Reiz verloren.
Cowboy machte sie miteinander bekannt. »Kennst du den Burschen neben mir? Asher Davis heißt er. Er ist, wie ihr blasierten College-Absolventen es bezeichnen würdet, ein Oxymoron, ein Widerspruch in sich selbst, nämlich ein ehrlicher indianischer Händler.« Während Davis und Chee sich die Hand schüttelten, schien Cowboy seine Wertung noch einmal kritisch zu überdenken. »Okay, sagen wir, halbwegs ehrenhaft. Als wir draußen bei den Hopi Mesas waren, hat Asher Davis versucht, ein paar von meinen Stammesbrüdern über den Tisch zu ziehen.«
Davis war solche Bemerkungen offenbar gewohnt. »Tatsache bleibt, dass es mir noch nie gelungen ist, einen von Cowboys Stammesbrüdern über den Tisch zu ziehen. Beispielsweise hat mir sein Onkel in Mishongnovi eine echt antike Eulen-Kachina verkauft, und als ich nach Hause kam und unter die Federn guckte, hab ich einen von diesen ›Made in Taiwan‹-Aufklebern entdeckt.«
Dashee grinste. »Genau genommen stand ›Made in Taiwan 1889 by Hopi‹ drauf. Alt war das Ding also vielleicht tatsächlich.«
Chee hatte nur zerstreut genickt. »War nett, Sie kennenzulernen. Leider sind wir ein bisschen in Eile.«
Und da hatte Cowboy gefragt, wo sie denn hinwollten, und Chee hatte gesagt, nach Tano, um sich die Zeremonie anzusehen, und Cowboy hatte gesagt, das Ritual in Tano habe er noch nie miterlebt, aber schon oft gehört, es sei besonders sehenswert, und Davis hatte bestätigt, ja, das sei es wirklich, und in Tano gebe es einen überdurchschnittlich guten Markt, auf dem er schon herrliche alte Krüge erworben habe, und die Jicarillas brächten ihre Korbwaren dorthin, und Janet hatte leider – leider – schließlich gefragt: »Warum wollt ihr nicht bei uns mitfahren? Platz haben wir genug.«
Und so war aus Chees Plänen für ein ruhiges Duett mit viel Zeit zum Reden über ihre Beziehung ein schnatterndes Quartett geworden. Und dann hatte Janet über Cowboys blöde Sticheleien gegrinst, und bei der Frage, ob sie aufs Dach klettern sollten, Dashees Partei ergriffen. Und um das Maß voll zu machen: Jetzt, wo sie schließlich oben waren, musste Chee zugeben, dass Cowboy Dashee recht gehabt hatte. Hol’s der Teufel.
Chee zog das Foto von Delmar Kanitewa aus der Jackentasche, um sich das Gesicht einzuprägen. Es war die körnige Kopie eines Fotos aus dem letzten Jahrbuch der Crownpoint Highschool, nicht ganz scharf, aber das Wesentliche kam deutlich heraus: ein breites Grinsen, weiße, ein wenig unregelmäßige Zähne, hohe Wangenknochen, ein schmales Grübchen im Kinn und ein miserabler Haarschnitt. Die Erbanlagen seiner Tano-Mutter hatten über die seines Navajo-Vaters klar gesiegt. Er sah aus wie Dutzende Teenager in Tana Pueblo und wie Hunderte Teenager aus anderen Pueblos und wie, ja, wie ein beliebiger Hopi-Junge. Aber Chee würde ihn trotzdem erkennen. Wenn es darauf ankam, war er gut darin, ein Gesicht in einer Menge zu erkennen.
Leaphorn hatte ihm klare Anweisungen mit auf den Weg gegeben.
»Das Haus seiner Mutter liegt eine Straße südlich der Plaza. Aber dort lassen Sie sich nicht blicken. Die für Tano zuständigen Leute vom Bureau of Indian Affairs haben das schon gecheckt. Kanitewas Mutter sagt, sie habe ihn nicht gesehen. Es könnte trotzdem sein, dass sie ihn versteckt. Also, halten Sie sich bedeckt, klar?«
Chee hatte angemerkt: »Kommt mir irgendwie komisch vor. War es nicht seine Mutter, die ihn in diese Schule gesteckt hat? Da sollte man doch annehmen, ihr müsste daran liegen, ihn schleunigst wieder zurückzuschicken.«
Leaphorn hatte das keines weiteren Kommentars gewürdigt und nicht mal von seinen Akten hochgeguckt.
»Wenn Sie ihn finden, tun Sie genau das: Fragen Sie ihn lediglich, warum er aus der Schule weggelaufen ist und wo er sich zurzeit aufhält. Machen Sie ihm klar, dass Sie nicht auf ihn angesetzt sind, damit er nicht wieder abhaut. Dann rufen Sie mich an und sagen mir, wo er ist. Sonst unternehmen Sie nichts.«
»Ich soll ihn nicht mitnehmen? Nicht zurück in die Schule bringen?«
Der Lieutenant hatte ihn wieder mit jenem Gesichtsausdruck gemustert, dem Chee entnahm, etwas Dummes gesagt zu haben.
»Sie befinden sich außerhalb des Navajo-Reservats. Der Junge hat gegen kein Gesetz verstoßen. Wir tun lediglich dieser Ratsfrau, seiner Großmutter, einen kleinen Gefallen. Meiner Meinung nach geht es bei der Sache um familiären Hickhack, also vermutlich um das Sorgerecht.«
Und Leaphorn hatte ihm geduldig den Hintergrund erläutert.
Kanitewas Mutter, eine Tano, hatte sich vom Navajo-Vater des Jungen scheiden lassen, offensichtlich im Einvernehmen. Der Junge war bei seiner Mutter geblieben und hatte den Tano-Namen behalten. Als er aber ins Highschool-Alter gekommen war, hatte er plötzlich beschlossen, bei seinem Vater zu leben.
»Unglücklicherweise ist dieser Vater der Sohn von Bertha Roanhorse, die mit der Budgetkommission des Stammesrats über unseren Lebensunterhalt entscheidet. Und sie macht sich Sorgen, weil der Junge keinem seiner Freunde ein Sterbenswörtchen davon gesagt hat, dass er abhauen will. Im Gegenteil. Er hat bei einer gemischten Tanzgruppe mitgemacht, die demnächst bei einem Rodeo in Durango auftreten soll. Deshalb ist das tatsächlich ein komischer Zeitpunkt, um abzuhauen.«
»Vielleicht wollte er unbedingt bei der Tano-Zeremonie dabei sein«, hatte Chee eingewandt. »Wenn er auf der Highschool ist, hat er vielleicht bestimmte Aufgaben in einer der Tano-Kivas wahrzunehmen.«
»Seine Großmutter sagt, dem sei definitiv nicht so. Er hat sie immer wieder gedrängt, weiter an seinem Kostüm für die Tanzvorführung in Durango zu arbeiten. Er sei ganz närrisch darauf gewesen.«
»Da sollte man eigentlich annehmen, dass sie selber loszieht, um den Jungen zu suchen.«
»Sollte man nicht. Jedenfalls nicht, wenn man die Ratsfrau kennt. Sie lässt das lieber von uns erledigen.«
Und das war das Ende der Unterredung gewesen.
Eine ärgerliche Geschichte. Einen Schulschwänzer einzufangen, entsprach nicht Chees Qualifikation. Aber die anderen hatten es ihm ja vorausgesagt. Leaphorn als Boss zu haben, konnte eine Strafe des Himmels sein.
Er spürte Janet Petes Ellbogen in den Rippen. »Warum so griesgrämig? Willst du lieber wieder runterklettern?«
»Sorry«, sagte Chee. »Nein. Cowboy hatte recht.«
»Cowboy hat oft recht«, meinte Cowboy. »Lerne einfach, darauf zu vertrauen.«
Die Doppelreihe der Kachinas hatte den Kreis um die Plaza geschlossen und bewegte sich jetzt unterhalb des Hauses. In seiner perspektivischen Verzerrung sah Chee die turbanartigen hohen Ledermasken, die Farmer, Lastwagenfahrer, Holzfäller, Polizisten und Büroangestellten – Väter, Söhne und Großväter – in jene Geister verwandelten, die für die Tano die Verbindung zum Jenseits aufrechterhielten. Chee sah auf ihren Schultern gewöhnlichen irdischen Schweiß glänzen und erspähte eine keineswegs transzendentale Tätowierung – den Anker des Marine Corps – auf dem Arm der siebten Kachina, und auch der Staub, den sie beim rhythmischen Stampfen mit ihren Mokassins aufwirbelten, sah ganz nach gewöhnlichem Dreck aus. Dennoch schienen die tanzenden Gestalten – sogar für einen Außenseiter wie ihn, einen Navajo – etwas Übermenschliches auszustrahlen. Vielleicht lag es am dumpfen Trommelschlag, vielleicht auch nur an der verzerrten Perspektive. Er ließ den Blick in die Runde schweifen. Die Zuschauer aus dem Dorf verharrten in andächtigem Schweigen, sogar die Kinder verhielten sich still.
Und plötzlich brach rund um die Plaza lautes Gelächter aus.
»Jetzt kommen die Kosharen«, sagte Cowboy.
Jenseits der Plaza waren auf einem Hausdach vier Gestalten aufgetaucht. Sie hatten sich Lendenschurze umgebunden, ihre Körper waren mit schwarzen und weißen Streifen bemalt und die Gesichter weiß getüncht, mit einem riesigen schwarzen Lachmund um die Lippen, das Haar war zu zwei konischen Hörnern nach oben gedreht … und was da an den Hörnern baumelte, mussten wohl Maiskolben sein. Kosharen – die heiligen Narren der Pueblo-Indianer. Ähnliche Clownsnummern hatte Chee als Kind bei einer Hopi-Zeremonie in Moenkopi gesehen, und später auch bei anderen Hopi-Tänzen. Was sich da drüben auf dem Dach abspielte, schien im Grunde nicht viel anders zu sein.
Zwei von ihnen standen jetzt auf dem Dachgesims und deuteten wild gestikulierend nach unten, auf den Kreis der Kachina-Tänzer. Zwei andere, ein Fettwanst und ein jüngerer Typ mit Gewichtheberfigur, schleppten eine Leiter heran, drehten die Leiter mit Schwung hin und her, ohne sich viel darum zu scheren, dass sie das Ding ihren Partnern ein paar Mal kräftig um die Ohren schlugen, zum Vergnügen des Publikums unten auf der Plaza. Endlich hatten sie’s dann geschafft, die Leiter über die Dachkante nach unten rutschen zu lassen – allerdings verkehrt herum, mit dem schmalen Ende zuerst. Dann begann ein simuliertes Gerangel darum, wer zuerst hinunterklettern durfte, und schließlich hatte der Fettwanst sich durchgesetzt. Kopfüber rutschte er die Leiter hinunter, vier, fünf Sprossen weit. Ein anderer, ein Klappergestell, nur Haut und Knochen, kletterte – ebenfalls mit dem Kopf nach unten – über ihn hinweg. Die beiden verhedderten sich mit den Beinen, es sah aus, als müssten sie jeden Augenblick abstürzen. Aber zum Glück waren da noch die beiden auf dem Dach, und einer von ihnen packte gerade noch rechtzeitig zu. Der Gewichtheber-Typ löste sich vom Dach und kletterte ebenfalls die Leiter herunter, natürlich auf der Innenseite und wieder mit dem Kopf voran. Die Leute auf der Plaza lachten aus vollem Hals und feuerten die Kosharen lauthals an.
Unten dröhnten die Trommeln in ihrem dumpfen Rhythmus, und die Kachinas tanzten unbeirrt weiter – entrückte Geister, die sich von der Zurschaustellung menschlicher Unzulänglichkeiten nicht ablenken ließen.
»Irgendwann wird sich einer von denen den Hals brechen«, sagte Janet Pete.
Und Chee dachte: Ja, ein Sturz aus dieser Höhe würde böse Folgen haben. Die Kletterer turnten etwa zwei Stockwerke hoch, und der festgestampfte Lehm auf der Plaza war hart wie Beton.
Cowboy sagte: »Die machen das schon seit tausend Jahren so. Da hat sich noch nie einer verletzt.« Und mit einem Stirnrunzeln: »Ist ja alles ganz okay, was die Jungs da oben machen, aber ihr solltet erst mal die in Shongopovi oder in Hotevilla oder in Walpi sehen, oder die in …«
»Oder die in irgendeinem x-beliebigen Hopi-Dorf. Ich kenne doch Cowboys Wahlspruch: Hopi können alles besser.«
Cowboy schüttelte den Kopf. »Chee kriegt es einfach nicht in seinen Kopf. Korrekt lautet es: Hopi können alles am besten.«
»Machen die das immer so?« Janets Stimme drückte Zweifel und Missbehagen aus. »Das stört doch die ganze Feierlichkeit.«
»Es ist keine Unterbrechung, es ist Teil des Rituals. Das Ganze ist symbolisch gemeint. Die Narren repräsentieren uns Menschen, die alles falsch machen im Gegensatz zu den Geistern.«
Janet schien nicht überzeugt. Inzwischen hatten die Clowns den Abstieg über die Leiter geschafft, nun standen sie am Rand der Plaza, deuteten auf die Kachinas, gestikulierten begeistert und unterhielten sich übertrieben laut in einer Sprache, die Chee nicht verstand. Wahrscheinlich Tewa, ein Dialekt der Tano, überlegte er. Oder war es Keresan? Einer der Kosharen rannte zu den Kachina-Tänzern, schlang einem der maskierten Männer die Arme um den Leib, zerrte ihn aus der Formation der Tänzer und rief den anderen Kosharen irgendetwas zu. Janet sah Cowboy fragend an.
»Er ruft ›Der gehört mir, der gehört mir‹ oder so was«, erklärte ihr Cowboy.
»Verstehen Sie denn Tewa?«
»Nein«, sagte Cowboy, »aber die Zeremonie läuft fast genauso ab wie bei uns. Die Idee ist, sich darüber lustig zu machen, dass die Menschen alles in Besitz nehmen wollen.«
Den Leuten auf der Plaza schien es zu gefallen. Ein Unmaskierter, in einen festlichen Zeremonienmantel gehüllt (Cowboy hatte ihnen erklärt, er sei der »Vater der Kachinas«), packte den Kosharen am Arm, befreite den Kachina und ließ sich auf eine kurze Rangelei ein, was den Leuten anscheinend noch mehr gefiel, jedenfalls brachen sie in schallendes Gelächter aus. Aus der Gasse zwischen zwei Häusern tauchten drei junge Burschen auf und stellten sich hinter die Tano-Frauen, die dort auf Stühlen die Zeremonie verfolgten. Der Längste von den dreien war Delmar. Zumindest konnte er es sein.
Chee tippte an Janets Knie. »Hey, siehst du die drei Jungs da drüben? Ziemlich genau auf der anderen Seite der Plaza, hinter den Frauen. Schau dir mal den im roten Hemd genauer an.«
»Mhm. Sieht so aus, als wäre er’s. Aber ist er nicht ein bisschen zu groß?«
»Der Beschreibung nach ist er über einen Meter siebzig. Für ein Pueblo-Kid ziemlich groß«, sagte Chee.
Cowboy stemmte sich hoch vom Dach. »Ich hol ihn mir. Behaltet ihn im Auge.«
Das Ganze schien ein Kinderspiel. Das Rothemd und seine beiden Freunde lehnten an einer Hausmauer. Chee ließ sie nicht aus den Augen. Das Rothemd sagte was zu seinen Freunden und deutete auf die Tanzfläche. Offenbar ging es um den Mann, der gerade auf einem Steckenpferd aus einer Gasse getrabt kam und sich zu den Tänzern gesellen wollte.
Von hier oben konnte Chee nicht viel mehr von ihnen erkennen als den riesigen Cowboyhut, der ihm fast bis auf die Schultern hing. Hinter ihm tauchte ein anderer Mann auf, der sich einen Homburger auf den Kopf gestülpt hatte und sich in einem Tretmobil fortbewegte – einem Spielzeugauto, das viel zu klein für ihn war; er stieß sich, während er strampelte, beinahe die Knie ans Kinn. Das rote Spielzeugauto war – genau wie der flache Anhänger, den es hinter sich herzog – über und über mit weißen Dollarsymbolen bemalt. Dicht hinter den beiden folgte ein Mann mit einem Strohhut und einem Handwagen, beladen mit allerlei Plunder. An den Seitenflächen waren Schilder angebracht, aber Chee konnte sie aus der Entfernung nicht lesen. Die drei paradierten an den Zuschauern entlang. Lautes Gelächter, gefolgt von einem Moment der Stille, und dann wieder ein wildes Stimmengewirr.
»Nanu«, fragte Janet. »Verstehst du, was da vor sich geht?«
»Ein bisschen«, antwortete Chee. »Bei solchen Zeremonien arbeiten gewöhnlich andere Gruppen mit den Kosharen zusammen, und die kommen irgendwann anmarschiert und führen kleine Sketche auf. Damit soll bei den Leuten auf spaßige Art das Bewusstsein geweckt werden für Dinge, die im Pueblo nicht in Ordnung sind.«
»Guck mal, der mit dem Cowboyhut auf dem Steckenpferd tut so, als würde er von allen möglichen Leuten Fotos machen«, sagte Janet. »Man könnte denken, er hätte eine versteckte Kamera im Hut.« Und tatsächlich klappte auf einmal die Hutspitze auf. Der Mann auf dem Steckenpferd neigte den Kopf, richtete die Hutspitze auf eine Gruppe Tano-Mädchen, und dann flammte ein Blitzlicht auf. Die Mädchen kicherten, Janet lachte laut mit.
»Hast du das gesehen?«, fragte sie. »Das ist mal ein witziger Einfall.«
»Hab ich verpasst«, sagte Chee. Er beobachtete gerade, wie der Mann mit dem Homburger – er war inzwischen aus seinem winzigen Tretauto geklettert – irgendetwas aus dem alten Plunder auf dem flachen Anhänger fischte. Ein überdimensionales Portemonnaie, aus dem er ein Bündel nachgemachter, riesengroßer Dollarnoten zog. Er winkte den dritten Mann heran, den mit dem Handwagen. Und als er näher kam, konnte Chee lesen, was auf den Schildern an den Seitenflächen des Handwagens stand:
HEILIGE GEGENSTÄNDE ZU VERKAUFEN.
Das Gelächter war jäh erstorben, jedenfalls unter den Tano. Jetzt schien es um etwas sehr Ernstes zu gehen. Ein nervöses Murmeln lief durch die Menge.
Der Mann mit dem Leiterwagen mimte einen Verkäufer, er bot zunächst eine fast kindsgroße, plump zusammengenähte Wollpuppe feil, und dann begann er, um einen schwarzen Stock – dem Aussehen nach ein ganz gewöhnlicher Spazierstock – zu feilschen, bis er nach langem Hin und Her eine Tüte voll Pseudodollars als Kaufpreis akzeptierte. Danach wühlte er wieder in seinem Wagen und brachte eine ovale Steinplatte zum Vorschein. Der Mann, der den Käufer spielte, hüpfte entzückt von einem Bein aufs andere.
Die Zuschauer verhielten sich jetzt so mucksmäuschenstill, dass Chee den Dialog der Clowns verfolgen konnte. Auch die Kinder und die Fremden, die als Besucher ins Dorf gekommen waren, verfolgten die Szene mit atemloser Spannung.
Janet beugte sich mit breitem Grinsen zu Chee. »Hoffentlich guckt unser Freund Asher genau zu. Die Parodie ist vermutlich auf ihn gemünzt.«
»Geld! Geld! Noch mehr Geld!«, schrie der Mann mit dem Leiterwagen.
Der Käufer schüttelte sein Portemonnaie aus, die grünen Scheine flatterten auf den festgestampften Lehmboden, und im Nu lagen beide Clowns auf Händen und Knien und rafften hektisch zusammen, was sie erwischen konnten.
»Ups«, sagte Janet, »da muss ich mich wohl doch geirrt haben.«
Chee nickte. »Und ob. Oder kannst du dir vorstellen, dass Asher sein Portemonnaie ausleert wie –«
Er brach mitten im Satz ab. Unten auf der Plaza stand Cowboy, starrte zu ihm hoch und signalisierte Ratlosigkeit.
Chee deutete quer über die Plaza und zeigte auf die Hauswand, an der die drei Kids standen. Das heißt, gestanden hatten. Jetzt standen nur noch zwei dort. Der im roten Hemd war verschwunden.
»Aaaah …«, entfuhr es Chee.
»Was ist denn los?«, fragte Janet.
Chee legte die Hände wie einen Trichter vor den Mund. »Ich hab ihn aus den Augen verloren«, rief er Cowboy zu.
Cowboy zuckte mit den Achseln und trabte los, an den Zuschauern entlang, auf der Suche nach dem Jungen.
Chee spürte Janets Blick. »Ich habe es versemmelt. Wie konnte ich mich nur ablenken lassen? Jetzt muss ich Cowboy helfen, den Jungen zu suchen.«
»Ich geh mit dir«, sagte Janet. »Ach, guck mal – da drüben, wo die kleine Gasse anfängt, da steht Applebee. Er hat sich bei den ›Rettet die Umwelt‹-Leuten engagiert, Davis hat vorhin von ihm erzählt. Du wolltest ihn doch kennenlernen.«
Chee stolperte schon die Leiter hinunter. »Vielleicht später.«
Sie suchten die Plaza ab, die Verkaufsbuden in den Seitenstraßen und die geparkten Autos – zumeist Pick-ups –, die sich in jede freie Lücke gezwängt hatten. Sie warfen auch einen Blick durch die offene Tür und die Fenster ins Haus der Kanitewa-Familie. Der Lieutenant hatte zwar gesagt, Chee solle sich dort nicht blicken lassen, aber er war ja nicht vor Ort. Auf dem langen Tisch in der Wohnküche standen Schüsseln und Platten mit Essen, nur war offenbar niemand zu Hause.
Als sie wieder zur Tanzfläche zurückkamen, wartete Cowboy schon auf sie, die Augenbrauen fragend hochgezogen.
»Pech gehabt«, sagte Chee.
Cowboy: »In welche Richtung ist er denn abgehauen? Ich meine, als du ihn zuletzt gesehen hast?«
»Ich hab nicht hingeguckt«, musste Chee eingestehen. »Ich hab zu den Clowns rübergesehen. Und plötzlich war er wie vom Erdboden verschluckt.«
»Na ja, er wird schon wiederkommen«, sagte Cowboy, aber seine Miene verriet Skepsis.
Hinter Cowboy Dashee brandete wieder Gelächter auf. Ein Kachina-Tänzer, der eine Maske mit riesigen Augen und Federbüscheln an den Ohren trug, bedrohte einen der Kosharen mit einer Peitsche aus Yuccazweigen. Der Koshare bot dem Tänzer eine Schale an. Die anderen Kosharen kamen eilends angerannt, offenbar entschlossen, den Kampf mit dem Tänzer aufzunehmen.
»Was soll das nun wieder?«, fragte Janet Pete.
»Die Hopi nennen das die Eulen-Kachina«, erklärte ihr Cowboy. »Manchmal sagen sie auch ›der Strafende‹. In Mafiakreisen heißen die Typen Vollstrecker. Wenn das, was hier passiert, so ist wie bei uns in den Hopi-Dörfern, dann ermahnt er die Kosharen, sich ordentlich zu benehmen, und der Chef der Narren hat gerade versucht, ihn zu bestechen. Die anderen Kosharen verdächtigen ihren Chef, sie zu verraten.«
Cowboy klopfte Janet Pete lachend auf die Schulter. »Tja, wir Pueblo machen uns nun mal keine Illusionen über die wahre menschliche Natur.«
»Die Erbsünde«, kommentierte Janet. »Der aus der Schöpfung gefallene Mensch.«
Chee hatte die Szene gar nicht beachtet, sondern weiter die Zuschauermenge abgesucht. Er hoffte immer noch, irgendwo Kanitewas rotes Hemd zu entdecken. Im Geiste sah er sich schon in Leaphorns Büro stehen. Er stellte sich vor, wie der Lieutenant hinter dem Schreibtisch saß und ihn mit undurchdringlicher Miene anstarrte, während er zu erklären versuchte, wie es zu der Panne mit Kanitewa gekommen war. Dann langes Schweigen. Und schließlich Leaphorns Frage, was zum Teufel er denn auf dem Dach zu suchen gehabt habe. Und das zu erklären, würde zwangsläufig zu dem Eingeständnis führen, dass er diese Dienstfahrt nach Tano Pueblo zu einem kleinen Ausflug mit Freunden umfunktioniert hatte.
»Hört auf«, sagte er. »Vergesst eure theologischen Diskussionen. Konzentrieren wir uns auf den Jungen.«
Und so fingen sie wieder an zu suchen, teilten sich, nahmen die Zuschauergruppen unter die Lupe, klapperten die Buden ab, spitzelten durch die Scheiben unzähliger Pick-ups und steckten ihre Nasen in die Scheunen und die Schafställe am Dorfrand.
Um drei Uhr nachmittags wollten sie sich wieder oben auf dem Dach treffen. Chee kletterte die Leiter hoch, Janet und Cowboy waren schon da und aßen ihren mit Sirup übergossenen Schneekegel. Unnötig zu sagen, dass sie mehr Glück gehabt hatten als er.
»Ich hab die beiden Kids aufgetrieben, die mit ihm zusammen waren«, erzählte Janet. »Sie wussten nicht, wo er steckt. Behaupteten es zumindest. Aber sie haben bestätigt, dass der Junge im roten Hemd unser verschwundener Delmar ist.«
Cowboy sagte: »Bei mir ist es ausgegangen wie das Hornberger Schießen. Nichts.«
»Versuchen wir es weiter«, drängte Chee.
Die Kachinas waren nicht mehr auf der Plaza, die Menge hatte sich zerstreut, die Leute drängten sich jetzt vor den Verkaufsbuden. Chee entdeckte einen der beiden Jungen, die er zusammen mit Kanitewa gesehen hatte, wie er an einer Hauswand lehnte, eine Papiertüte in der einen, eine geröstete Brotscheibe in der anderen Hand. Ein Stück weiter unten sah er Asher Davis an einem Verkaufstisch stehen, offenbar hatten es ihm die sandgeschliffenen silbernen Gürtelschnallen angetan, die ein Navajo dort feilbot. Drei, vier Verkaufsbuden weiter sah er einen Polizisten vom BIA, den er mal bei einem Schulungskurs in Albuquerque kennengelernt hatte, er wühlte in einem Korb auf dem Verkaufstresen einer Apachenfrau. Zwei rote Hemden machte er auch aus. Aber das eine gehörte zu einer jungen Frau, und im anderen steckte ein alter Mann.
Chee kletterte vom Dach. Er patrouillierte durch die engen Straßen, suchte noch einmal die Schafställe, die Pferdekoppeln und die Heuschober ab, schlenderte an den parkenden Fahrzeugen entlang und spähte durch die Windschutzscheiben.
Keine Spur von Kanitewa. Schließlich lief er Cowboy in die Arme, der gerade einen neuen Schneekegel gekauft hatte, und kurz darauf stieß Janet zu ihnen.
»In ungefähr einer halben Stunde werden die Kachinas ihre Tänze fortsetzen«, sagte Cowboy. »Wahrscheinlich kommt der Junge zum zweiten Teil wieder her. Oder er taucht, wenn der letzte Tanz vorbei ist, zu Hause bei seiner Mutter auf. Dann schnappen wir ihn dort.«
»Möglich.« Chee versuchte, sich seinen Pessimismus nicht anmerken zu lassen. »Kann aber auch gut sein, dass seine Mutter ihn irgendwo außerhalb versteckt. Den Leuten vom BIA hat sie gesagt, er sei nie bei ihr zu Hause angekommen.« Bis jetzt konnte man diesen Tag vergessen. Und viel besser, fürchtete Chee, würde er wohl auch nicht werden.
»Da ist ja wieder Applebee.« Janet zeigte auf eine Imbissbude. »Der mit dem Hotdog in der Hand. Soll ich dich mit ihm bekannt machen?«
Aber in diesem Augenblick musste in der Gasse rechts von ihnen irgendetwas passiert sein. Die Leute rannten hin und her und riefen aufgeregt durcheinander. Der Koshare, der vorhin auf dem hölzernen Steckenpferd geritten war, kam angerannt, immer noch im Kostüm, nur die Maske musste er irgendwo verloren haben. Er schrie irgendetwas. Es hörte sich an wie: »Holt einen Krankenwagen.« Tatsächlich war es genau das: »Holt einen Krankenwagen.«
»Jemand muss verletzt sein«, sagte Cowboy.
Und dann kamen zwei Männer und eine Frau aus der Gasse gelaufen, die Frau schluchzte.
»Sie haben ihn umgebracht«, sagte sie. »Sie haben ihn umgebracht.«
2
Sie haben also auf dem Dach gesessen?«, fragte Lieutenant Joe Leaphorn in bewusst neutraler Tonlage.
»Ja, Sir. Von dort oben kann man die ganze Plaza überblicken.«
Zweifellos ein Vorteil. Der Nachteil lag allerdings darin, dass man den Jungen, hatte man ihn entdeckt, nicht fassen konnte. Ein Punkt, auf dem Leaphorn nicht weiter herumritt, zumal Chees verlegene Miene verriet, dass er sich dessen bewusst war. Also legte Leaphorn das erste Blatt von Chees Meldung beiseite und sah sich noch einmal das zweite und letzte an. Tadellos getippt, nur mangelte es – gemessen an Leaphorns Maßstäben – deutlich an Vollständigkeit.
»Als Sie die Frau schreien hörten, schreiben Sie hier, sei Ihnen spontan der Verdacht gekommen, es könnte sich bei dem Getöteten um den Kanitewa-Jungen handeln. Weshalb haben Sie auf Anhieb an ihn gedacht?«
»Nun ja, ich hatte mich die ganze Zeit über mit ihm beschäftigt. Wir hatten ja nach ihm gesucht. Wir wollten rausfinden, wohin er so plötzlich verschwunden war.«
Leaphorn sah hoch, schielte über das Horngestell seiner Brille und fragte: »Wir?«
Chee zögerte. »Ich hatte Deputy Sheriff Dashee dabei. Vom Sheriffbüro in Apache County.« Wieder ein Zögern. »Und Janet Pete. Sie kennen sie. Die Anwältin vom DNA.«
»Ich kenne sie.« In ihrer Rolle als Pflichtverteidigerin war Miss Pete, bezahlt aus öffentlichen Mitteln, hin und wieder ein Stachel im Fleisch der Navajo-Police. Das Kürzel DNA stand für Dinebeina Nahiilna be Agadithe, was sinngemäß hieß, »Leute, die schnell reden, um anderen Leuten aus der Patsche zu helfen«. Leaphorn hatte allerdings den Eindruck, dass die Leute, denen das DNA half, gewöhnlich diejenigen waren, hinter denen die Navajo-Police her war.
»Sie haben also aus der Dienstfahrt einen kleinen Ausflug gemacht?«, fragte Leaphorn. »So eine Art Picknick zu dritt?«
»Zu viert«, korrigierte Chee. »Asher Davis war noch dabei. Sie wissen schon, dieser bullige Typ, der …«
Entgegen seinen persönlichen Gepflogenheiten und allen Navajo-Traditionen fiel Leaphorn ihm ins Wort. »Der Händler aus Santa Fe? So ein bulliger Typ?«
Chee nickte. Ein denkbar schlechter Start in die Woche. Die erste Woche im neuen Job und vielleicht auch seine letzte, wer weiß. Und wenn es so kam? Dann ging er wieder zurück in den normalen Streifendienst. Aber er hatte ja befürchtet, dass es schwierig werden würde mit diesem Typen. Diesem Super-Cop.
»Hört sich an, als wäre das Ganze mehr ein kleiner Spaß für Sie gewesen. Und ganz nebenbei mal den Jungen einfangen.« Leaphorns Miene blieb vollkommen ausdruckslos.
Chee versuchte, dem Blick standzuhalten, aber er fühlte, wie er errötete. Kollegen, die früher mit Leaphorn zusammengearbeitet hatten, bevor der Lieutenant mit der Leitung der Sonderkommission betraut worden war, hatten ihn gewarnt, dass der Kerl ein arroganter Hundesohn sein konnte.
»Nein, Sir. Es hat sich zufällig so ergeben. Sie sagten mir, ich solle ihn aufspüren. Ich hatte vor, zunächst festzustellen, ob er nach Hause gefahren ist, wegen der Zeremonie. Wenn ja, hätte ich ihn mir geschnappt und mit ihm geredet, um herauszufinden, wo er untergetaucht ist. Ich hätte ihm gesagt, dass er seine Großmutter anrufen soll, entsprechend Ihren Instruktionen. Aber dann wollte Miss Pete sich den Kachina-Tanz ansehen. Sie hat Dashee gefragt, ob er nicht Lust hätte, mitzufahren. Und dann …« Den Rest ließ er in der Luft hängen.
»Ein Verstoß gegen die Dienstvorschrift«, sagte Leaphorn.
»Ja, Sir.«
»Der Sinn der Dienstvorschrift ist Ihnen klar?«
»Selbstverständlich, Sir.«
Leaphorn stemmte sich aus dem Schreibtischsessel hoch, ging zum Fenster, kehrte Chee den Rücken zu und starrte hinaus.
Jetzt denkt er darüber nach, wie er’s mir beibringen soll, räsonierte Chee. Dass ich suspendiert bin. Er bastelt nur noch an der Formulierung.
»Es bewölkt sich«, sagte Leaphorn. »Sieht aus, als könnten sie drüben im Hopi-Reservat Regen abkriegen.«
Chee ließ es unkommentiert. Das Schweigen zog sich in die Länge.
»Oder vielleicht auch ein bisschen Schnee. Ich hatte verlernt, mit jemandem zusammenzuarbeiten, als man mir diesen Posten gegeben hat.« Er redete immer noch mit der Fensterscheibe. »Ich war ein Einmannbetrieb. Nun sind wir zu zweit. Ich denke, wir müssen uns auf einige Grundsätze verständigen.« Er ging zurück zum Schreibtisch. »Oder nennen Sie’s Verfahrensregeln.«
»Zusätzlich zum offiziellen Regelwerk?«
»Vereinbarungen zwischen uns beiden. Über die Paragrafen hinaus. Zum Beispiel in diesem Fall«, sagte Leaphorn. »Sie hatten einen Auftrag auszuführen. Ich erwarte einen vollständigen Bericht. Das zu tun, impliziert, dass Sie Dinge mitteilen, die Sie normalerweise Ihrem Captain im Streifenbezirk nicht mitgeteilt hätten.«
Er machte eine kleine Pause und musterte Chee. »Sie hätten ja Ihrem Boss nicht so schnell auf die Nase gebunden, dass Sie aus einem dienstlichen Auftrag eine Art geselliges Beisammensein gemacht haben. Weil Sie sich dadurch einigen Ärger einhandeln können. Möglicherweise einige Tage Gehaltskürzung. Da neigt man schnell dazu, im Bericht ein paar Details zu vergessen oder sich etwas abgewandelt daran zu erinnern. Zum Beispiel, dass Sie Miss Pete, Dashee und Asher Davis zufällig getroffen haben, erst beim Kachina-Tanz. Das hätte sich doch plausibel angehört. Ich bin froh, dass Sie es nicht auf die Tour versucht haben.« Wieder musterte er Chee. »Sie haben sich offenbar vorher darüber Gedanken gemacht.«
Er wartete auf Chees Antwort.
Chee, der sich vorher keine Gedanken darüber gemacht hatte, zuckte nur mit den Achseln. Er versuchte zu erkennen, worauf der Lieutenant hinauswollte, und hätte gewettet, dass er genau wusste, was jetzt kam.
»Der Punkt ist: Wenn wir einen Fall gemeinsam bearbeiten, möchte ich, dass Sie mir alles mitteilen. Alles. Lassen Sie nichts weg, weil Sie denken, es wäre belanglos oder hätte nichts mit unseren Ermittlungen zu tun. Ich will alles erfahren.«
Chee nickte und dachte bei sich: Genauso hab ich mir das vorgestellt. Chee als Auge, Ohr und Nase, als Datenschnüffler, darf die Fakten zusammentragen, während der Lieutenant die Rolle des Gehirns übernimmt. Auch gut. Ich hab zwar einen Haufen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Jungs vom BIA und vom Sheriffbüro im Apache County und von der Arizona State Police. Gute Beurteilungen, gute Personalakte. Nun ja, ziemlich gute Personalakte.
Leaphorn studierte Chees Gesichtsausdruck. »Und nun«, sagte er, »schildern Sie mir in allen Einzelheiten, was Francis Sayesva getan hat.«
Es dauerte einen Moment, bis Chee den Namen mit dem plumpen Mann, den er gestern auf dem Dach herumalbern gesehen hatte, verband. Der mit schwarzen und weißen Streifen bemalte Koshare, den irgendjemand totgeschlagen hatte, gut dreißig Meter von Chee entfernt.
»In allen Einzelheiten?«, fragte er. Und dann begann er, alles herunterzubeten, woran er sich erinnern konnte.
Leaphorn ließ es auf sich wirken. Dann sagte er: »Und nun alles über den Jungen. Vom ersten bis zum letzten Augenblick. Alles, woran Sie sich erinnern können.«
Das dauerte nicht lange.
»Gab es irgendwas, was auf eine Verbindung zwischen Kanitewa und Sayesva hindeutet?«, wollte Leaphorn wissen. »Ein Zeichen. Irgendetwas in dieser Richtung?«
Chee dachte nach. »Nichts. Der Junge schien einfach nur einer unter den vielen Zuschauern.«
»Sayesva war sein Onkel mütterlicherseits.«
»Oh«, sagte Chee. »Das wusste ich nicht.« Ein Onkel mütterlicherseits – das bedeutete, dass sie einander sehr nahegestanden haben. Bei den Navajo war das jedenfalls so. Ob es allerdings bei den Tano genauso war …
Leaphorn sagte: »Ich hab das selber gerade erst herausgefunden.«
Also im Klartext: am Telefon. Bei dem Gespräch, das er geführt hat, als ich kam. Aber wer hätte ihn wohl von sich aus angerufen, um ihm so etwas mitzuteilen? Also war es wohl eher umgekehrt gewesen. Leaphorn hatte jemanden angerufen und genau danach gefragt. Aber wieso hatte er das getan?
»Hatten Sie vermutet, dass die beiden verwandt sind?«, fragte er den Lieutenant.
»Zwei Morde, da sucht man doch automatisch nach irgendeinem Zusammenhang, oder?« Er wandte sich um und tippte auf die Landkarte an der Wand hinter ihm. »Der eine draußen im Checkerboard-Reservat, und der andere weit entfernt im Tano Pueblo. Keine Verbindung zu erkennen, stimmt’s?«
Chee konnte sich jedenfalls keine vorstellen, und das sagte er auch. »Um ganz ehrlich zu sein, über den Mord in Thoreau weiß ich nicht mehr, als ich im Radio gehört habe.«
Leaphorn bemerkte einen gewissen Missmut in Chees Stimme. »Ja. Das tut mir leid.« Er hielt Chee eine Aktenmappe hin. »Wir dürfen bei dem Fall fürs FBI die Laufburschen machen.«
Die ganze Akte bestand bisher nur aus zwei Schreibmaschinenseiten. Zwei Bogen Papier, auf denen ein Officer von der Navajo-Police in Crownpoint seinen vorläufigen Bericht vom Tatort zusammengefasst hatte. Und viel mehr als das, was Chee bereits im Radio gehört hatte, stand nicht darin. Eric Dorsey, siebenunddreißig Jahre, Lehrer für Holz- und Metallbearbeitung an der Saint Bonaventure Indian Mission – und außerdem Schulbusfahrer und Wartungstechniker –, war von seinen Schülern, als sie zum Nachmittagsunterricht kamen, tot auf dem Fußboden seiner Werkstatt aufgefunden worden. Todesursache: ein Schlag auf den Hinterkopf. Offensichtliches Motiv: Raub. Die gewöhnlich verschlossene Tür eines Vorratsschranks hatte offen gestanden. Eine noch nicht ermittelte Menge an Silberbarren galt als verschwunden. Keine Zeugen. Keine Tatverdächtigen.
»Ich sehe einfach keinen Zusammenhang«, sagte Chee.
»Sayesva war einer der Kosharen, nicht wahr?«
»Ja«, bestätigte Chee, leicht perplex.
»Finden Sie im Tatortbericht über den Dorsey-Mord irgendwas über Kosharen?«
Chee überflog die beiden Seiten des Berichts noch einmal. »Nichts.«
»War ja auch nicht zu erwarten«, sagte Leaphorn. »Mir fiel auf, dass in diesem Werkraum, in dem Dorsey seinen Unterricht abgehalten hat, alles Mögliche gelagert war. Lauter Dinge, die seine Schüler hergestellt haben. Sandschliffarbeiten aus Silber, kunsthandwerkliche Arbeiten aus Leder oder Holz und zwei, drei halb fertige Kachinapuppen. Eine davon stellt einen Kosharen dar. Ungefähr dreißig Zentimeter groß. Im Bericht steht nichts davon.«
»Na ja, warum auch?«, meinte Chee. »Da war der Mord in Tano noch nicht passiert. Der Officer, der an den Tatort geschickt worden war, konnte den Zusammenhang nicht ahnen, und Sie hätten keine Liste mit …«
Den Rest verschluckte er. Er begriff, worauf Leaphorn abzielte. So unsinnig es klingen mochte: einfach alles in den Bericht aufnehmen, auch wenn es belanglos zu sein scheint.
»Das mit der Kosharenpuppe … dafür fallen einem natürlich alle möglichen Erklärungen ein«, sagte Leaphorn. »Kids versuchen beim kunsthandwerklichen Unterricht immer, irgendwas herzustellen, das sie verkaufen können. Für Kosharenfiguren findet man leicht Interessenten. Das Kolorieren macht auch nicht viel Mühe. Und so weiter.«
Chee stimmte zu. »Eine sehr dünne Verbindungslinie. Ich sehe sie nicht einmal.«