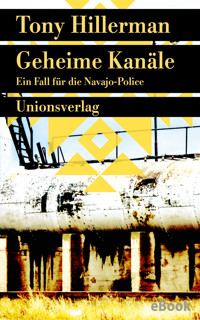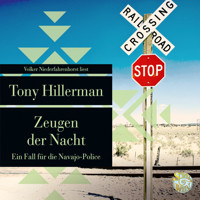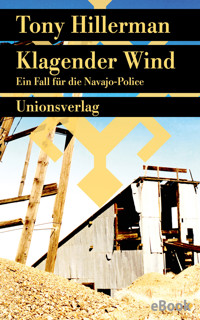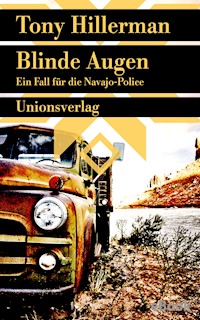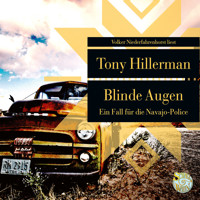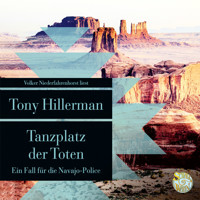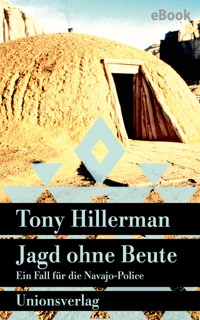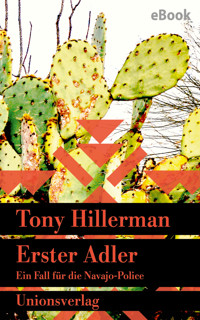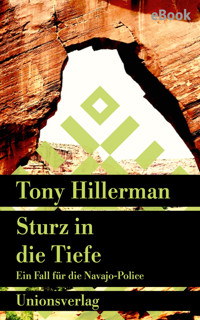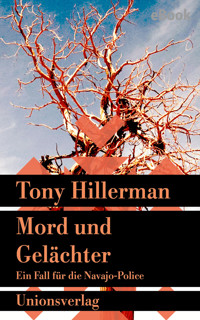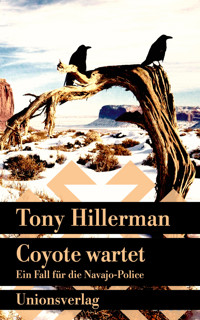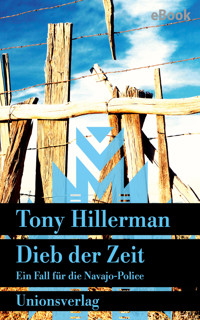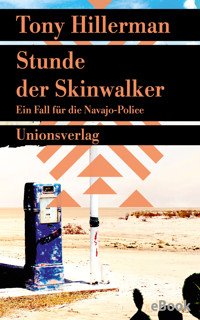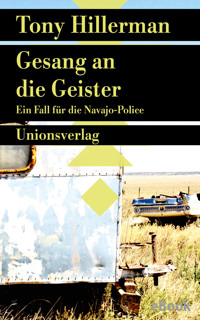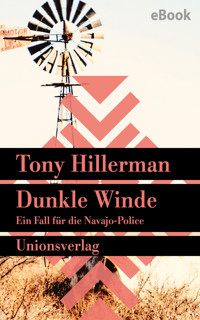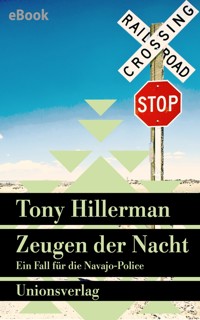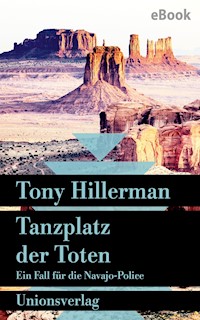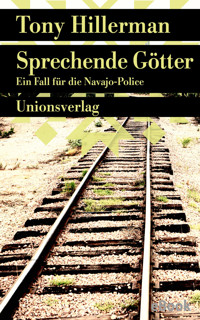
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Officer Jim Chee hat einen eigenartigen Haftbefehl auf dem Tisch: Ein Restaurator namens Henry Highhawk protestiert in Washington mit radikalen Methoden für die Rückgabe von Navajo-Gebeinen aus dem Smithsonian Museum. Auf einer Nachtgesang-Zeremonie im Reservat soll Chee den Mann stellen. Lieutenant Joe Leaphorn versucht unterdessen, die Identität einer seltsam zugerichteten Leiche aufzudecken, die ermordet im Wüstengesträuch neben Bahngleisen liegt. Während sich unerwartete Verbindungen zwischen den beiden Fällen ergeben, kocht der Streit um die Rückgabe von Kulturgütern immer höher, und Chee und Leaphorn finden sich im Kern eines brisanten Konflikts wieder.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch
Der Restaurator Henry Highhawk protestiert mit radikalen Methoden für die Rückgabe von Navajo-Gebeinen aus dem Smithsonian Museum. Officer Chee sucht den Mann mit offiziellem Haftbefehl, während Lieutenant Leaphorn sich bemüht, eine seltsam zugerichtete Leiche zu identifizieren. Bald finden sich die beiden im Kern eines brisanten Konflikts wieder.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tony Hillerman (1925-2008) besuchte ein Internat für Native Americans, kämpfte im Zweiten Weltkrieg, studierte Journalismus und war als Journalist und Dozent tätig. Seine Romane um die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee wurden vielfach ausgezeichnet und in siebzehn Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Tony Hillerman.
Peter Prange, geboren 1955 in Altena, ist Drehbuchautor, Übersetzer und Schriftsteller. Er studierte Germanistik, Romanistik und Philosophie in Göttingen, Perugia, Paris und Tübingen. Er lebt in Tübingen.
Zur Webseite von Peter Prange.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tony Hillerman
Sprechende Götter. Verfilmt als Serie »Dark Winds – Der Wind des Bösen«.
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Peter Prange
Ein Fall für die Navajo-Police (8)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Worterklärungen und Hintergrundinformationen zu diesem Buch auf https://ehillerman.unm.edu/encyclopedia-main
Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Frank Schmitter nach dem Original durchgesehen und grundlegend überarbeitet.
Die Originalausgabe erschien 1989 bei Harper & Row, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1990 unter dem Titel Die sprechende Maske bei der Edition Weitbrecht im Thienemanns Verlag, Stuttgart.
Originaltitel: Talking God
© by Anthony G. Hillerman 1989
Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Peter Prange beim Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hintergrund – Mark Lucey (Alamy Stock Foto); Symbol – Tetiana Lazunova (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31166-4
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 02.03.2024, 13:40h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
SPRECHENDE GÖTTER. VERFILMT ALS SERIE »DARK WINDS – DER WIND DES BÖSEN«.
Vorbemerkung des Autors1 – Schon im Gang zwischen Sekretariat und ihrem eigenen …2 – Am letzten Donnerstag im August teilte der behandelnde …3 – Wie ich hörte, hast du dich entschieden …4 – Hinter sich im Medizin-Hogan hörte Officer Jim Chee …5 – Leroy Fleck genoss es, wenn seine Schuhe geputzt …6 – Das Dumme war, dass es niemanden wirklich interessierte …7 – Es wird nicht gern gesehen, wenn man sich …8 – Am Sonntag hatte Lieutenant Joe Leaphorn sich wesentlich …9 – Janet Pete erwartete ihn am Continental-Gate des National …10 – Leaphorn hatte seinen Regenschirm vergessen. Er hatte an …11 – Janet Pete entschied, dass sie die Metro von …12 – Seit seiner Kindheit gehörte Fleck zu jenen Menschen …13 – Da Joe Leaphorn und Dockery etwas zu früh …14 – Am Tag nach ihrem Besuch bei Highhawk hatten …15 – Leaphorn rief Kennedy von seinem Hotelzimmer aus an …16 – Leroy Fleck konnte keine innere Ruhe finden …17 – Für den Anfang«, sagte Joe Leaphorn, »möchte ich …18 – Als Erstes rief Leroy Fleck seinen Bruder an …19 – Der Sicherheitsdienst des Museums hatte Dr. Hartman ausfindig …20 – Leroy Fleck ging anderthalb Straßenzüge bis zu der …21 – Miguel Santero, so hieß er doch, oder …22 – Jim Chee saß auf seinem Bett, angelehnt an …Mehr über dieses Buch
Über Tony Hillerman
»Der Angst vor seinem Pferd hat«
Claus Biegert: Die Navajo-Romane — ein Fall von Kultureller Wertschätzung
Über Peter Prange
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tony Hillerman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema USA
Dieses Buch ist Delbert Kedelty, Terry Teller,David Charley, Donald Tsosieund den anderen Kindern der Tsaile-Schule gewidmet. Sie haben die yeibichai-Bilder gemalt,die mich inspirierten, über Talking God nachzudenken.
Ferner ist es Will Tsosie, Tsosie Tsinijinnie,Melvin Bightumb, Mitglied des Stammesrates,und all den anderen zugeeignet, die darum kämpfen, Hajiinei-Dineta mit seinen Ruinen und Bildzeichenfür nachkommende Generationen zu bewahren.
Vorbemerkung des Autors
Alle Personen in diesem Buch, mit Ausnahme von Bernard St. Germain und Ernie Bulow, entstammen meiner Fantasie. Auch ihre Funktionen sind frei erfunden, wenngleich sie sich an der Wirklichkeit orientieren.
Ich danke Caroline L. Rose, Martin Burke, Don Ortner, Jo Allyn Archambault und anderen Direktoren, Konservatoren sowie sämtlichen hilfreichen Geistern am Smithsonian National Museum of Natural History dafür, dass sie meine Anwesenheit geduldig ertrugen und mich hinter die Kulissen schauen ließen, wenn große Museen ihre Ausstellungen vorbereiten.
1
Schon im Gang zwischen Sekretariat und ihrem eigenen Büro sah Catherine Morris Perry den Karton auf ihrem Schreibtisch. Er war ziemlich sperrig – ungefähr einen Meter lang und fast genauso hoch. Der aufgedruckte Schriftzug verriet, dass er ursprünglich einen Mikrowellenherd von General Electric enthalten hatte. Braune Streifen Packband zogen sich kreuz und quer über das Paket. Der Karton war schäbig, ein derber Kontrast zu den Pastelltönen und geschmackvollen Einrichtungsgegenständen in Catherine Perrys elegantem Büro.
»Wie war das Wochenende?«, fragte Markie.
Catherine Morris Perry hängte ihren Regenmantel an den Haken, den Regenhut darüber, streifte die durchsichtigen Plastiküberzieher von ihren Schuhen und sagte: »Hallo, Markie.«
»Wie war’s in Vermont?«, wollte Markie wissen. »Auch so nass da oben?«
»Wo kommt das her?«, fragte Catherine und zeigte auf den Karton.
»Federal Express«, sagte Markie. »Ich habe den Empfang bestätigt.«
»Habe ich etwas erwartet?«
»Nicht, dass ich wüsste. Wie war’s in Vermont?«
»Nass«, sagte Catherine. Sie wollte mit Markie Bailey nicht über Vermont oder irgendetwas anderes sprechen, was das Leben außerhalb dieses Büros betraf. Worüber sie mit Markie Bailey sprechen wollte, war Geschmack. Oder Mangel an Geschmack. Den großen braunen, hässlichen Karton auf ihren antiken Schreibtisch zu stellen, wie Markie es getan hatte, war beispielhaft für das Problem. Er stand da, hässlich und abstoßend fehl am Platz. So fehl am Platz wie Mrs Bailey in diesem Büro. Aber sie loszuwerden würde fast unmöglich sein. Und nur jede Menge Ärger mit den Vorschriften für den öffentlichen Dienst bedeuten. Mrs Perrys juristisches Spezialgebiet betraf zwar nicht das Personalrecht, aber sie hatte einiges gelernt bei den Bemühungen, Henry Highhawk loszuwerden, den streitsüchtigen Konservator am Natural History Museum. Was war das für ein endloses Fiasko gewesen.
»Da war ein Anruf für Sie«, sagte Markie. »Das Büro des Kulturattachés der chilenischen Botschaft. Er will einen Termin.«
»Ich rufe später zurück«, sagte Catherine. Sie wusste, worum es ging. Wieder ein Problem mit einer Spende von Indio-Artefakten. Ein General Soundso, der Stücke wiederhaben wollte. Er behauptete, sein Urgroßvater hätte sie irgendeinem hohen Tier von United Fruit nur geliehen, und der habe kein Recht gehabt, sie dem Smithsonian Museum weiterzugeben. Es handle sich um nationale Kunstschätze, und sie müssten zurückgegeben werden. Inka-Kunst, wie sie sich erinnerte. Gold natürlich. Goldmasken, eingelegt mit Juwelen, und der General würde wahrscheinlich beschließen, dass sie zu seinem persönlichen Besitz gehörten, sollte er sie in die Hände bekommen. Sie dachte, dass er ihr nicht allzu viel Arbeit bereiten würde – ein bisschen Recherche in den Unterlagen und im internationalen Privatrecht, sie sollte das am besten gleich abarbeiten.
Aber da stand der Karton mitten auf ihrem Schreibtisch. Er war an sie adressiert als »Pressesprecherin des Museums«. Catherine Morris Perry mochte es nicht, als »Pressesprecherin« tituliert zu werden. Dass sie so bezeichnet wurde, rührte wahrscheinlich von der Erklärung her, die sie der Washington Post über die Politik des Museums gegeben hatte. Die ganze Sache war mehr oder weniger ein Versehen gewesen. Der Anruf des Reporters war nur deshalb an sie weitergeleitet worden, weil jemand in der Presseabteilung krank war und jemand anders gerade nicht an seinem Schreibtisch saß und derjenige, der den Anruf entgegengenommen hatte, zu dem Schluss gekommen war, ein Jurist müsse sich darum kümmern. Der Anruf betraf wieder Henry Highhawk, zumindest indirekt. Er betraf den Staub, den er um die Rückgabe der Überreste von Eingeborenenskeletten aufwirbelte. Und die Post hatte angerufen und fälschlicherweise Catherine für die Pressesprecherin gehalten, und in dieser Funktion zitiert, obwohl man eigentlich den Verwaltungsrat des Museums hätte zitieren sollen. Die Politik in der Skelettsache entsprach schließlich der offiziellen Richtlinie des Verwaltungsrates. Eine vernünftige Richtlinie.
Der Frachtbrief von Federal Express, der an dem Karton haftete, war, abgesehen von dem irrigen Titel, korrekt. Sie war »Kommissarische Assistenz-Justiziarin, Öffentlichkeitsreferat«, abgestellt vom Innenministerium. Sie setzte sich und sah rasch die übrige Post durch. Nicht viel. Da war allem Anschein nach eine Einladung von der Nationalen Ballettgesellschaft zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung. Dann etwas von der American Civil Liberties Union. Ein Vermerk vom Chefkonservator des Museums mit einer Erklärung, warum es ihm nicht möglich sei, sich mit einer Personalklage zu befassen, wie das Gesetz es von ihm verlange. Ein weiterer Brief betraf die Versicherung von Leihgaben für eine Ausstellung, die nächste Woche eröffnet würde, und drei Briefe schienen von privaten Absendern zu stammen, die sie nicht kannte.
Catherine Morris Perry schob alle Umschläge ungeöffnet beiseite, schaute auf den Karton und verzog das Gesicht. Sie öffnete die Schreibtischschublade und holte ihren Brieföffner hervor. Dann drückte sie auf den Summer, um Mrs Bailey zu rufen.
»Ja, Madam.«
»Mrs Bailey, wenn Pakete wie dieses ankommen, bringen Sie sie bitte nicht herein und stellen Sie sie nicht auf meinen Schreibtisch. Machen Sie sie auf und holen Sie den Inhalt heraus.«
»In Ordnung«, sagte Mrs Bailey. »Ich mach’s gleich auf. Ganz schön schwer, das Ding.« Sie machte eine Pause. »Mrs Paterson wollte immer, dass ich ihr alle Post auf den Schreibtisch lege.«
»Ich mach’s schon selbst auf«, sagte Catherine. »Ich meinte, von jetzt an. Und Mrs Paterson ist im Urlaub. Sie ist zurzeit nicht im Dienst.«
»In Ordnung«, sagte Mrs Bailey. »Haben Sie die Telefonnotizen gesehen? Zwei? Auf Ihrem Schreibtisch?«
»Nein«, sagte Catherine. Sie waren wahrscheinlich unter dem Karton.
»Dr. Hebert rief an und sagte nur, er wolle Ihnen gratulieren, wie Sie die Skelettsache gedeichselt hätten. Und dazu, was Sie der Post gesagt haben.«
Den Brieföffner in der Hand, schlitzte Catherine Perry die Packbandstreifen auf. Sie dachte, der Karton sei eine Reaktion auf den Artikel in der Washington Post. Jedes Mal, wenn das Museum in die Zeitungen kam, erinnerten sich Tausende alter Damen an Sachen auf ihrem Speicher, die für die Nachwelt aufbewahrt werden mussten. Da sie zitiert worden war, hatte eine Leserin vermutlich dem Museum ihren Krempel unter Catherines Namen zugeschickt. Was war es wohl? Ein verstaubtes altes Butterfass? Ein Stoß Familienalben?
»Der andere Anruf war von einer Kollegin aus der anthropologischen Abteilung. Ich habe ihren Namen auf den Zettel geschrieben. Sie sollen zurückrufen. Meinte, es sei wegen der Indianer, die ihre Skelette zurückhaben wollen.«
»Gut«, sagte Catherine. Sie zog die oberen Kartonlaschen hoch. Darunter war eine Ausgabe der Washington Post, und zwar so gefaltet, dass sie den Artikel zeigte, in dem sie zitiert worden war. Ein Teil davon war schwarz eingerahmt.
Museum bietet Kompromiss an in altem Streit um Gebeine.
Catherine ärgerte sich über die Schlagzeile. Es hatte keinen Kompromiss gegeben. Sie hatte schlicht und einfach die Politik des Museums erklärt. Wenn ein Indianerstamm die Gebeine von Vorfahren wiederhaben wollte, musste er nur einen Antrag stellen und einen schlüssigen Beweis beibringen, dass die betreffenden Gebeine tatsächlich einer Grabstätte des Stammes entnommen waren. Der ganze Streit war lächerlich und erniedrigend. Im Grunde war es schon erniedrigend, sich überhaupt auf diesen Highhawk einzulassen. Auf ihn und seine Paho Society. Ein kleiner Museumsangestellter und eine Organisation, die, soweit bekannt war, nur in seiner Einbildung existierte. Und alles nur, um Ärger zu machen. Sie schaute auf den eingerahmten Abschnitt.
»Mrs Catherine Perry, eine Justiziarin des Museums und dessen Pressesprecherin in dieser Angelegenheit, ließ erklären, dass der Antrag der Paho Society auf die Wiederbestattung der vollständigen Museumssammlung von über achtzehntausend Skeletten amerikanischer Ureinwohner ›mit Blick auf die Aufgabe des Museums einfach nicht erfüllbar‹ sei.
Ferner sagte sie, das Museum sei sowohl eine Forschungseinrichtung als auch eine Galerie für öffentliche Ausstellungen, und die Museumssammlung von alten menschlichen Gebeinen sei eine potenziell wichtige Quelle anthropologischer Erkenntnisse. Sie meinte, Mr Highhawks Vorschlag, das Museum möge Gipsabdrücke von den Skeletten nehmen und die Originale wieder bestatten, sei nicht praktikabel, ›aufgrund von Forschungsbelangen ebenso wie aufgrund der Tatsache, dass die Öffentlichkeit Anspruch auf Authentizität hat, statt nur Reproduktionen gezeigt zu bekommen.‹«
Die Formulierung »Anspruch auf Authentizität« war unterstrichen. Catherine Morris Perry runzelte die Stirn, der Vorwurf darin war offenkundig. Sie nahm die Zeitung hoch. Darunter lag auf einem Bogen braunen Packpapiers ein Umschlag mit ihrem Namen darauf, fein säuberlich geschrieben. Sie machte das Kuvert auf und zog ein einzelnes Blatt Schreibmaschinenpapier hervor. Während sie las, räumte ihre freie Hand die Schicht Packpapier beiseite, die den Umschlag vom übrigen Inhalt des Kartons getrennt hatte.
Sehr geehrte Mrs Perry, Sie wollen die Gebeine unserer Vorfahren nicht bestatten mit der Begründung, die Öffentlichkeit habe Anspruch auf Authentizität, wenn sie in das Museum komme, um sich Skelette anzuschauen. Deshalb schicke ich Ihnen hiermiteinige authentische Skelette verstorbener Vorfahren. Ich bin zum Friedhof im Waldgebiet hinter der Episkopalkirche von St. Lukas gegangen. Ich habe authentische anthropologische Methoden angewendet, um die Grabstätten authentischer weißer Angelsachsen aufzuspüren …
Mrs Morris Perrys Finger waren jetzt unter dem Packpapier. Sie ertasteten Dreck, ertasteten glatte, kalte Oberflächen.
»Mrs Bailey!«, rief sie. »Mrs Bailey!« Aber ihre Augen wanderten hinunter an das Briefende. Es war unterzeichnet mit Henry Highhawk vom Bitter Water Clan.
»Ja?«, rief Mrs Bailey. »Was ist denn?«
… und um sicherzustellen, dass sie vollkommen authentisch sind, habe ich zwei ausgewählt, deren Identität Sie persönlich bestätigen können. Ich möchte Sie deshalb bitten, diese beiden Skelette als authentische Exponate für Ihr Publikum anzunehmen und dafür die Gebeine von zweien meiner Vorfahren herauszugeben, damit sie an ihren rechtmäßigen Platz im Schoß von Mutter Erde zurückgebracht werden können. Die Namen dieser beiden authentischen …
Mrs Bailey stand jetzt neben ihr. »Herzchen«, sagte sie, »was ist los?« Mrs Bailey stutzte. »Das sind ja Knochen in dem Karton«, sagte sie dann. »Und alle so dreckig.«
Mrs Morris Perry legte den Brief auf den Schreibtisch und blickte in den Karton. Durch ein Wirrwarr hindurch, das aus Arm- und Beinknochen zu bestehen schien, starrte sie eine einzelne leere Augenhöhle an. Sie sah, dass Mrs Bailey den Brief zur Hand genommen hatte. Sie sah den Dreck. Feuchte, hässliche kleine Klümpchen lagen über die polierte Schreibtischplatte verstreut.
»Mein Gott«, sagte Mrs Bailey. »John Neldine Burgoyne. Jane Burgoyne. Waren das nicht – sind das nicht Ihre Großeltern?«
2
Am letzten Donnerstag im August teilte der behandelnde Arzt im öffentlichen Krankenhaus von Fort Defiance seiner Patientin Agnes Tsosie mit, dass sie sterben müsse und er nichts mehr für sie tun könne.
»Ich wusste es«, sagte Agnes Tsosie. Und sie lächelte ihn an, tätschelte seine Hand und bat ihn, in der Verwaltung des Lower-Greasewood-Reservats anzurufen und dort eine Nachricht für ihre Familie zu hinterlassen, damit ihre Angehörigen kämen und sie holten.
»Ich werde Sie nicht entlassen können«, sagte der Arzt. »Wir müssen Ihnen weiter Medikamente verabreichen, um die Schmerzen unter Kontrolle zu halten, und das muss überwacht werden. Sie können nicht nach Hause gehen. Noch nicht.«
»Überhaupt nicht«, sagte Agnes Tsosie und lächelte auch jetzt. »Aber richten Sie die Nachricht trotzdem für mich aus. Sie brauchen sich deshalb nicht schlecht zu fühlen. Der Gott Born for Water hat Monster Slayer gesagt, er soll den Tod am Leben lassen, um alte Leute wie mich loszuwerden. Sie müssen Platz schaffen für die neuen Babys.«
Agnes Tsosie kehrte aus dem Krankenhaus von Fort Defiance am letzten Montag im August heim, indem sie sich mit ihrer berühmt-berüchtigten Willensstärke über die Einwände ihres Arztes und des Krankenhauspersonals hinwegsetzte.
In diesem Teil des Navajo-Reservats westlich der Chuska-Gebirgskette und nördlich der Wüste Painted Desert wusste fast jeder Bescheid über Agnes Tsosie. Old Woman Tsosie war zweimal Abgeordnete des Reservationsbezirks Lower Greasewater beim Navajo-Stammesrat gewesen. Die Zeitschrift National Geographic hatte ihr Bild in einem Artikel über das Volk der Navajo benutzt. Mit ihrem eisernen Willen hatte sie viel dazu beigetragen, dass in ihrem Stamm Programme in Angriff genommen wurden, Brunnen zu bohren und Wasserreservoirs in jedem Bezirk anzulegen, wo die Förderung von Trinkwasser schwierig war. Über Jahre hinweg war ihre entschiedene Klugheit von großem Wert für die Mitglieder ihres Bitter Water Clans gewesen. Beim Bitter-Water-Stammesrat setzte sie ihre strengen Friedensregeln durch. Einmal hatte sie eine Versammlung zweier Familien zu einer elftägigen Sitzung ausgedehnt, bis die beiden Parteien – zermürbt von Hunger und Erschöpfung – eine Fehde um Weiderechte beilegten, die hundert Jahre lang geschwelt hatte.
»Zu viele Menschen kommen tot aus den belagaana-Krankenhäusern des Weißen Mannes heraus«, hatte Agnes Tsosie ihrem Arzt gesagt. »Ich will hier lebend raus.« Und niemand war überrascht, dass sie darauf beharrte. Sie verließ das Gebäude, auf ihren eigenen Füßen, unterstützt von ihrer Tochter und ihrem Mann. Sie setzte sich auf den Beifahrersitz des Pick-ups ihrer Tochter und witzelte herum, und erzählte, ironisch wie immer, komische Geschichten über das Gehabe im Krankenhaus. Aber auf der langen Fahrt durch die Beifuß-Ebenen in Richtung Lower Greasewood verebbte das Lachen. Schwer lehnte sie gegen die Wagentür, und ihr Gesicht wurde grau vor Erschöpfung.
Ihr Schwiegersohn wartete vor ihrem Hogan. Sein Name war Rollie Yellow, und Agnes Tsosie, die fast jeden Menschen mochte, mochte Yellow sehr. Sie hatten das Navajo-Tabu ignoriert, wonach Schwiegersöhne die Begegnung mit ihren Schwiegermüttern vermeiden sollten. Agnes Tsosie hatte beschlossen, dass diese Regelung nur böswillige Schwiegermütter mit schlechten Schwiegersöhnen betraf. Mit anderen Worten, sie betraf Leute, die nicht miteinander auskommen konnten. Agnes Tsosie und Yellow waren dreißig Jahre lang wunderbar miteinander ausgekommen, und jetzt half Yellow ihr in ihren Sommer-Hogan. Dort verbrachte sie den ganzen Nachmittag und die Nacht in einem unruhigen Schlaf.
Am nächsten Morgen machte Rollie Yellow die lange holprige Fahrt um die Mesa herum zum Büro des Lower-Greasewood-Reservats. Er rief das Büro von Many Farms an und hinterließ dort die Nachricht, dass Nancy Yabenny gebraucht werde.
Nancy Yabenny war Sekretärin im Büro der Navajo Timber Industries und Hellseherin. Sie gehörte zu den Navajo-Schamanen, die sich darauf verstanden, schwierige Fragen zu beantworten, verlorene Gegenstände wiederzufinden, Hexen auszumachen und Krankheiten zu diagnostizieren, damit die geeigneten Heilungszeremonien eingeleitet werden konnten.
Nancy Yabenny kam am Donnerstagnachmittag am Steuer ihres blauen Dodge-Ram-Pick-ups an. Sie war eine dickliche Frau mittleren Alters und trug einen gelben Hosenanzug, der ihr früher, als sie noch schlanker gewesen war, besser gepasst hatte. Sie trug ihre Kristallscheibe, ihr Vier-Berge-Bündel und die anderen Utensilien ihres Standes in einer Aktentasche bei sich. Sie rückte einen Küchenstuhl in den Schatten neben Agnes Tsosies Bett. Yellow hatte das Bett aus dem Hogan in die Heckenlaube gestellt, sodass Agnes Tsosie zusehen konnte, wie sich die Gewitterwolken über den Spitzkuppen der Hopi-Berge bildeten und dann davonzogen. Yabenny und Old Woman Tsosie redeten über eine Stunde miteinander. Dann legte Nancy Yabenny die Kristallscheibe auf die Erde, nahm ihr jish mit den geheiligten Gegenständen aus ihrer Tasche und holte daraus eine Arzneiflasche mit Getreidepollen hervor. Damit bestäubte sie den Kristall, sang dazu den vorgeschriebenen Segen, hielt die Fläche so, dass das Himmelslicht darauf fiel, und starrte hinein.
»Ah«, sagte sie und drehte den Kristall, damit auch Agnes Tsosie sehen konnte, was sie gerade sah. Dann tauschten sie sich darüber aus.
Als die Sonne unterging, trat Nancy Yabenny aus der Heckenlaube ins Freie. Sie sprach mit Tsosies Mann, ihrer Tochter und mit Rollie Yellow. Sie sagte ihnen, dass Agnes Tsosie ein Yeibichai brauche, um Frieden und Schönheit wiederzuerlangen.
Rollie hatte das zwar halb erwartet, dennoch war es ein ziemlicher Schlag. Die Weißen sagten Night Chant dazu, aber die Zeremonie wurde nach ihrem wichtigsten Teilnehmer benannt – nach yeibichai, dem großen Talking God, dem Sprechenden Gott der Navajo-Religion. Als Großvater mütterlicherseits aller anderen Götter diente er häufig als ihr Sprecher. Es war eine kostspielige Zeremonie; neun Tage und Nächte lang mussten die zuschauenden Stammesmitglieder und Freunde beköstigt, der Medizinmann mitsamt seinen Gehilfen versorgt werden, dazu nicht weniger als drei Gruppen von yei-Tänzern. Weit gravierender als die Kosten war in Rollie Yellows Augen allerdings die Bedeutung von Yabennys Worten, dass nämlich der Belagaana-Arzt, also der Doktor der Weißen, wahrscheinlich recht hatte. Agnes Tsosie war sehr, sehr krank. Gleichgültig, was es kostete, er musste einen Singer finden, der den Night Chant beherrschte. Es gab nicht viele davon, aber sie hatten glücklicherweise noch Zeit. Das yeibichai durfte nicht vor dem ersten Frost stattfinden, erst wenn die Schlangen ihren Winterschlaf hielten, erst in der Zeit, da der Donner ruhte.
3
Wie ich hörte, hast du dich entschieden, doch nicht zu kündigen«, sagte Jay Kennedy. »Stimmt’s?«
»So ungefähr«, antwortete Lieutenant Joe Leaphorn.
»Freut mich zu hören. Hast du gerade viel zu tun?«
Leaphorn zögerte. Seine Augen glitten über den Stapel Papierkram auf seinem Schreibtisch, während er im Geiste den Tonfall von Kennedys Stimme am Telefon analysierte.
»Nicht mehr als gewöhnlich«, sagte er.
»Hast du von der Leiche draußen vor Gallup gehört?«
»Hab was läuten hören«, sagte Leaphorn – das hieß, es gab einen Bericht aus zweiter Hand von dem, was der Funk-Dispatcher unten mitgehört hatte. Gerade genug, um zu wissen, dass es kein alltäglicher Leichenfund war.
»Es dürfte zwar kaum ein Fall für das FBI sein«, meinte Kennedy. »Aber er ist interessant.«
Es war Kennedys Art zu sagen, dass etwas seiner Meinung nach sehr bald sein Fall sein würde. Kennedy leitete das FBI-Büro von Gallup und war lange genug mit Leaphorn befreundet, dass solche Dinge nicht mehr ausdrücklich erklärt werden mussten.
»Soweit ich gehört habe, fanden sie ihn neben der Eisenbahnlinie«, sagte Leaphorn. »Also außerhalb des Reservats. Folglich auch kein Fall für uns.«
»Nein, könnte aber einer werden«, meinte Kennedy.
Leaphorn wartete auf eine Erklärung. Es kam keine.
»Wie das denn?«, fragte er. »Und war es Mord?«
»Wir kennen die Todesursache noch nicht«, sagte Kennedy. »Und wir haben auch die Identität noch nicht festgestellt. Aber es sieht so aus, als ob irgendeine Verbindung zwischen dem Burschen und einem Navajo besteht.« Er machte eine Pause. »Es gab eine Notiz. Nun, keine richtige Notiz.«
»Ist das Interessante daran?«
»Nun, es ist schon eigenartig. Aber was mich interessiert, ist die Frage, wie die Leiche dorthin gekommen ist.«
Leaphorns Gesicht entspannte sich allmählich zu einer Art Lächeln. Er schaute über die Arbeit auf seinem Schreibtisch. Durch das Fenster seines Büros im zweiten Stock des Navajo-Police-Building, Sitz der Polizei des Reservats, sah er wattige weiße Herbstwolken über der Sandsteinformation, die dem Ort Window Rock, Arizona, seinen Namen gab. Es war ein herrlicher Morgen. Hinter dem Schreibtisch, jenseits der Fensterscheibe, war die Welt kühl, klar und freundlich.
»Leaphorn. Bist du noch dran?«
»Willst du, dass ich nach Spuren suche? Ist es das?«
»Ihr sollt angeblich gut darin sein«, meinte Kennedy. »Das erzählt ihr uns doch immer.«
»Okay«, sagte Leaphorn. »Sag mir, wo es ist.«
Die Leiche lag beschützt von einem Dickicht aus Wüstengesträuch, abgeschirmt von der schräg einfallenden Morgensonne durch einen angrenzenden Busch. Von der Stelle aus, wo er auf dem mit Schotter befestigten Straßendamm stand, konnte Leaphorn die Sohlen zweier Schuhe sehen, deren eng zulaufende Spitzen nach oben zeigten, zwei dunkelgraue Hosenbeine, ein weißes Hemd, einen Schlips, ein noch zugeknöpftes Anzugjackett und darüber ein blasses schmales Gesicht mit seltsam eingefallenen Wangen. In Anbetracht der Umstände wirkte die Leiche bemerkenswert ordentlich.
»Adrett und gepflegt«, sagte Leaphorn.
Vize-Sheriff Delbert Baca nahm an, er meine den Schauplatz des Verbrechens, und nickte. »Pures Glück«, sagte er. »Ein Bursche, der mit seinem Güterzug unterwegs war, hat ihn zufällig gesehen. Der Zug war in Fahrt, deshalb konnte er nicht abspringen und hier auf allem herumtrampeln. Jackson da« – Baca deutete mit dem Kinn auf einen dicklichen jungen Mann in der Uniform eines Deputy Sheriffs von McKinley County, der auf den Schienen stand – »fuhr hier auf der Autobahn vorbei.« Er zeigte in Richtung des Highways, der Interstate 40, die eine Viertelmeile weiter westlich das gedämpfte Brummen von Lastwagenverkehr hören ließ. »Er stieg hier aus, bevor die Staatspolizei alles durcheinanderbringen konnte.«
»Dann hat also keiner die Leiche angerührt?«, fragte Leaphorn. »Was ist mit der Notiz, von der du gesprochen hast? Wie habt ihr sie gefunden?«
»Baca hat ihn nach Ausweispapieren durchsucht«, sagte Kennedy. »Dabei hat er unter ihn gegriffen, um an die Gesäßtaschen zu kommen. Er hat zwar keine Brieftasche oder so was gefunden, dafür aber das da in der äußeren Brusttasche seines Jacketts.« Kennedy hielt ihm einen kleinen, zusammengefalteten Zettel aus gelbem Papier hin. Leaphorn nahm ihn.
»Ihr wisst also nicht, wer er ist?«
»Keine Ahnung«, sagte Kennedy. »Die Brieftasche fehlt. In seinen Taschen war nichts, außer einem bisschen Kleingeld, einem Kugelschreiber, ein paar Schlüsseln und einem Taschentuch. Und dann eben diese Notiz.«
Leaphorn faltete den Zettel auseinander.
»Man denkt nicht daran, in der Taschentuchtasche eines Jacketts nachzuschauen, wenn man jemandem die Papiere wegnimmt«, meinte Baca. »Nun, so ist es wenigstens meiner Meinung nach gewesen.«
Die Notiz sah aus, als sei sie mit einem Kugelschreiber mit sehr feiner Mine geschrieben worden. Sie lautete: »Yeabechay? Yeibeshay? Agnes Tsosie (korrekt). Angeblich in der Nähe von Window Rock, Arizona.«
Leaphorn drehte den Zettel um. Stic Up war oben darauf gedruckt, der Markenname eines Herstellers von Notizblöcken, die an Pinnwänden haften blieben.
»Kennst du die?«, fragte Kennedy. »Agnes Tsosie. Kommt mir irgendwie bekannt vor.«
»Tsosies gibt’s hier wie Kennedys in Boston«, meinte Leaphorn. Er runzelte die Stirn. Ja, er kannte eine Agnes Tsosie. Nur ein wenig und schon lange her. Eine alte Frau, die vor langer Zeit zum Stammesrat gehört hatte. Als Abgeordnete des Bezirks Lower Greasewood, wenn er sich richtig erinnerte. Eine gute Frau, aber inzwischen wahrscheinlich tot. Und es musste andere Agnes Tsosies geben, in und außerhalb des Reservats. Agnes war ein gebräuchlicher Name, und Tsosies kamen zu Tausenden vor. »Vielleicht können wir sie trotzdem finden. Und sogar ziemlich leicht, wenn sie etwas mit einem yeibichai zu tun hat. Davon werden nicht mehr viele abgehalten.«
»Das ist doch die Zeremonie, die auch Night Chant heißt, stimmt’s?«, wollte Kennedy wissen.
»Oder Night Way«, sagte Leaphorn.
»Die neun Tage lang dauert?«, meinte Kennedy. »Und wo diese maskierten Tänzer auftreten?«
»Genau«, sagte Leaphorn. Aber wer war der Mann mit den spitzen Schuhen, der allem Anschein nach eine Agnes Tsosie kannte? Leaphorn ging hinter das Dickicht aus Wüstengesträuch und setzte dabei seine Füße vorsichtig auf, um nicht zu zerstören, was Baca noch nicht beschädigt hatte, während er die Taschen des Opfers durchsucht hatte. Er hockte sich hin, die Absätze am Gesäß, und stöhnte über den Schmerz in seinen Knien. Er sollte sich mehr bewegen, dachte er. Diese Gewohnheit hatte er seit Emmas Tod vernachlässigt. Sie waren früher immer zusammen spazieren gegangen – fast jeden Abend, wenn er vom Büro nach Hause kam. Gehen und reden. Doch jetzt …
Das Opfer hatte keine Zähne. Sein ohnehin schmales Gesicht hatte das eingefallene, spitze Aussehen zahnloser Greise. Dabei war der Mann gar nicht besonders alt. Sechzig vielleicht. Und keiner von der Sorte, die zahnlos herumläuft. Sein Anzug, nachtblau mit mikroskopisch feinen, grauen Nadelstreifen, wirkte zwar altmodisch, aber teuer, die Kleidung jener sozialen Schicht, die über ausreichend Zeit und Geld verfügt, um ihre Zähne fest zwischen den Kiefern zu behalten. Bei diesem nahen Abstand bemerkte Leaphorn, dass die Anzugjacke einen kleinen Flicken in der Nähe des mittleren Knopfes hatte und das Revers abgetragen aussah. Auch das Hemd sah abgetragen aus. Aber teuer. Wie der schlichte, breite Goldring am Mittelfinger seiner linken Hand. Sogar das Gesicht selbst machte einen edlen Eindruck. Leaphorn hatte seit fast vierzig Jahren mit Weißen zu tun, und Leaphorn studierte Gesichter. Der Mann hatte zwar einen dunklen Teint – trotz der Totenblässe –, doch es war ein aristokratisches Gesicht. Eine schmale, leicht hochmütig wirkende Nase, feine Knochen, hohe Stirn.
Leaphorn wechselte seine Position und untersuchte die Schuhe des Opfers. Das Leder war teuer, und unter dem dünnen Staubfilm des Tages glänzte es von tausendmaligem Polieren. Handgemachte Schuhe, glaubte Leaphorn. Aber vor langer Zeit gefertigt. Und jetzt waren die Absätze abgelaufen, und eine Sohle war vom Schuhmacher erneuert worden.
»Sind dir die Zähne aufgefallen?«, fragte Kennedy.
»Ihr Fehlen ist mir aufgefallen«, sagte Leaphorn. »Hat jemand ein Gebiss gefunden?«
»Nein«, meinte Baca. »Aber es hat auch keiner richtig nachgeschaut. Noch nicht. Ich dachte, als Erstes müsste die Frage untersucht werden, wie der Kerl hierhergekommen ist.«
Leaphorn fragte sich, warum das Büro des Sheriffs wohl das FBI verständigt hatte. War Baca am Tod dieses ordentlichen Mannes irgendetwas aufgefallen, das auf einen Fall für die Bundespolizei schließen ließ? Er blickte sich um. Die Gleise liefen endlos nach Osten, endlos nach Westen – die Santa-Fe-Hauptlinie vom Mittleren Westen nach Kalifornien. Im Norden die roten Sandsteinwälle der Iyanbito Mesa, im Süden die Piñon-Hügel, die zum Zuñi-Plateau und den Zuñi-Bergen hin anstiegen. Und direkt hinter den belebten Fahrbahnen der Interstate 40 stand Fort Wingate. Das alte Fort Wingate, in dem die US Army seit dem spanisch-amerikanischen Krieg Munition hortete.
»Wie kam er hierher? Das ist die Frage«, sagte Kennedy. »Vom Amtrak-Zug wurde er jedenfalls nicht runtergeworfen, das ist offensichtlich. Und der sieht mir auch nicht nach einem Burschen aus, der auf einem Güterzug mitfährt. Also würde ich meinen, dass ihn wahrscheinlich jemand hierhergebracht hat. Aber warum zum Teufel sollte das einer tun?«
»Könnte das mit Fort Wingate zu tun haben?«, fragte Leaphorn. Ungefähr eine halbe Meile weiter an der Hauptlinie konnte er das Nebengleis sehen, das Richtung Militärstützpunkt abzweigte.
Baca lachte und zuckte die Schultern.
»Wer weiß«, sagte Kennedy.
»Ich habe gehört, sie wollen das Fort schließen«, sagte Leaphorn. »Es ist obsolet.«
»Das habe ich auch gehört«, meinte Kennedy. »Glaubst du, dass du irgendwelche Spuren finden kannst?«
Leaphorn versuchte es. Er ging den Bahndamm gut zwanzig Schritte hinab und setzte zu einem Kreis durch das Dickicht von Beifuß, Natternwurz und Wüstensträuchern an. Der Boden hier war typisch für eine Beifuß-Ebene: locker, leicht und mit genügend feinen Kalkpartikeln, um eine Kruste zu bilden. Ein früher Herbstschauer war vor einer Woche über dem Gebiet niedergegangen und erleichterte nun die Spurensuche. Leaphorn kehrte im Kreis zum Damm zurück, doch ohne etwas zu finden, außer den Spuren, die Nagetiere, Echsen und Schlangen zurückgelassen hatten. Er war überzeugt, dass es nichts zu finden gab. Er lief noch ein Dutzend Schritte das Gleis hinunter und setzte zu einem weiteren, diesmal größeren Kreis an. Wieder fand er nichts, was nicht zu alt war oder von einem Tier herrührte. Dann ging er im Zickzack durch das Gestrüpp rund um die Leiche, mit langsamen Schritten, die Augen auf den Boden geheftet.
Kennedy, Baca und Jackson warteten auf ihn, auf dem Damm oberhalb der Leiche. Hinter ihm, weit unten am Gleis, hatte ein Krankenwagen geparkt, dahinter eine weiße Limousine – der Wagen, den der Pathologe vom öffentlichen Krankenhaus in Gallup fuhr. Leaphorn machte ein schiefes Gesicht und schüttelte den Kopf.
»Nichts«, sagte er. »Wenn ihn jemand von dieser Seite hergebracht hat, dann über die Schienen.«
»Beziehungsweise die Schienen herunter«, sagte Baca mit einem Grinsen.
»Wonach hast du gesucht?«, fragte Kennedy. »Außer nach Spuren.«
»Nach nichts Besonderem«, meinte Leaphorn. »Man schaut eigentlich nach nichts Besonderem. Wenn man das tut, übersieht man die Dinge, nach denen man nicht sucht.«
»Also glaubst du, dass er über die Schienen hergebracht wurde?«, fragte Kennedy.
»Ich weiß nicht«, sagte Leaphorn. »Warum sollte das jemand tun? Das ist ein hartes Stück Arbeit. Und dann das Risiko, dabei gesehen zu werden. Warum sollte dieses Gestrüpp besser als irgendein anderes Gestrüpp sein?«
»Vielleicht haben sie ihn von der anderen Seite herübergeschleppt«, meinte Kennedy.
Leaphorn blickte auf die andere Seite der Schienen. Auch drüben gab es keine Straße. »Vielleicht haben sie ihn von einem Zug runtergelassen?«
»Der Amtrak rauscht hier mit ungefähr fünfundsechzig Meilen durch«, sagte Kennedy. »Erst viel später verlangsamt er, vor dem Halt in Gallup. Auf einem Güterzug kann ich mir den Mann nicht vorstellen, und hier draußen halten sie auch nicht an. Das bin ich alles schon mit der Eisenbahn durchgegangen.«
Sie standen auf dem Damm oberhalb der Leiche, die Gegenwart des Todes ließ sie für einen Moment verstummen. Die Krankenwagenfahrer kamen mit einer Bahre die Schienen herauf, gefolgt von dem Pathologen, der eine Tasche trug. Er war ein kleiner, junger Mann mit einem blonden Schnurrbart. Leaphorn kannte ihn nicht, aber er stellte sich auch nicht vor.
Der Pathologe hockte sich neben die Leiche, untersuchte die Haut am Hals, die Erstarrung der Handgelenke, bog die Fingergelenke um, blickte in den zahnlosen Mund.
Dann schaute er zu Kennedy hoch. »Wie ist er hierhergekommen?«
Kennedy zuckte die Schultern.
Der Arzt knöpfte die Anzugjacke und das Hemd auf, schob das Unterhemd hoch, inspizierte Brust und Unterleib. »Es gibt nirgendwo Blut. Nicht die kleinste Spur.« Er schnallte den Gürtel auf, machte die Hosenträger los, fühlte. »Wisst ihr Jungs, woran er gestorben ist?«, fragte er, ohne einen Bestimmten zu meinen.
»Was?«, erwiderte Baca. »Woran er gestorben ist?«
»Zum Teufel, ich weiß es jedenfalls nicht«, sagte der Arzt, immer noch mit der Leiche beschäftigt. »Ich bin gerade erst angekommen. Ich habe euch gefragt.«
Er stand auf und trat einen Schritt zurück. »Legt ihn auf die Bahre«, ordnete er an. »Gesicht nach unten.«
Mit dem Gesicht auf der Bahre wirkte der Mann mit den spitzen Schuhen noch kleiner. Der Rücken seines dunklen Anzugs war mit grauem Staub gepudert, seine Würde schien geschrumpft. Der Arzt ließ seine Hand über den Körper gleiten, die Wirbelsäule hinauf, tastete den Hinterkopf ab, massierte den Nacken.
»Aha«, sagte er. »Da haben wir’s ja.«
Der Arzt teilte das Haar des Mannes an der Stelle des Hinterkopfs, die Rückgrat und Schädel verband. Das Haar, bemerkte Leaphorn, war struppig und verfilzt. Der Arzt richtete sich auf und schaute mit einem selbstzufriedenen Grinsen zu ihnen hoch. »Sehen Sie?«
Leaphorn konnte nur sehr wenig sehen – nur eine kleine Stelle, wo der Nacken in den Schädel überging und wo er schwarzes, geronnenes Blut zu erkennen glaubte.
»Was ich sehe?«, fragte Kennedy, hörbar verärgert. »Nicht die Bohne, verdammt noch mal.«
Der Pathologe wischte sich im Stehen die Hände ab und schaute auf den Toten hinunter. »Was Sie sehen, ist die Stelle, wo jemand, der mit einem Messer umzugehen versteht, jemanden sehr schnell töten kann«, sagte er. »Blitzschnell. Man sticht in den kleinen Spalt zwischen dem letzten Rückenwirbel und der Schädelbasis. Schneidet das Rückenmark durch.« Er lachte in sich hinein. »Zip.«
»So ist es also passiert?«, fragte Kennedy. »Wie lange ist das her?«
»Sieht ganz so aus«, meinte der Arzt. »Ich würde sagen, wahrscheinlich gestern. Aber wir werden eine Autopsie machen. Dann bekommen Sie Ihre Antwort.«
»Eine Antwort«, sagte Kennedy. »Oder zwei. Wie und wann. Bleibt aber noch: wer.«
Und warum, dachte Leaphorn. Warum war immer die Frage, die ins Herz der Dinge führte. Das war die Antwort, nach der Joe Leaphorn immer suchte. Warum hatte dieser Mann – der offensichtlich kein Navajo war – den Namen einer Navajo-Frau auf einen Notizzettel in seiner Tasche geschrieben? Und den falsch geschriebenen Namen einer Navajo-Zeremonie? Das yeibichai. Das war die Zeremonie, bei der die großen mystischen, mythischen, magischen Geister, die die Kultur der Navajo geformt und ihre ersten vier Clans geschaffen hatten, in Erscheinung traten, personifiziert durch die Masken der Tänzer. War der Ermordete unterwegs zu einem yeibichai? Aber das konnte er nicht gewesen sein. Dafür war es Wochen zu früh. Das Yeibichai war eine Winterzeremonie. Es konnte erst durchgeführt werden, wenn die Schlangen ihren Winterschlaf hielten, erst in der Jahreszeit, da der Donner ruhte. Aber warum sonst sollte er die Notiz bei sich tragen? Leaphorn dachte nach, ohne dass ihm eine plausible Antwort einfiel. Er würde Agnes Tsosie ausfindig machen und sie fragen.
Die Agnes Tsosie, an die Leaphorn sich erinnert hatte, war offensichtlich die Richtige. Als Leaphorn sich umhörte – der erste Schritt einer Untersuchung, von der er fürchtete, dass sie zu einer zeitverschlingenden Jagd ausarten würde –, erfuhr er immerhin, dass die Familie eine yeibichai-Zeremonie für sie vorbereitete. Er verbrachte ein paar Stunden mit Telefonrecherchen, dann kam er zu dem Schluss, dass er einen Glückstreffer gelandet hatte. Bis jetzt schienen erst drei große Nachtgesang-Zeremonien geplant. Eine würde auf der Navajo Nation Fair in Window Rock für einen Mann namens Roanhorse abgehalten, und eine andere war im Dezember unweit von Burnt Water für ein Mitglied der Gorman-Familie vorgesehen. Damit blieb Agnes Tsosie aus Lower Greasewood als die einzige Möglichkeit übrig.
Die Fahrt von seinem Büro in Window Rock nach Lower Greasewood führte Leaphorn in westlicher Richtung durch die Goldkieferwälder des Defiance Plateaus, über die Piñon-Juniper-Hügel in der Umgebung von Ganado und dann südöstlich in die Beifuß-Landschaft, die zur Wüste hin abfiel. Vor der Internatsschule von Lower Greasewood stiegen gerade die Kinder, die nah genug wohnten, um zu pendeln, in einen Bus, um zurück nach Hause zu fahren. Leaphorn fragte die Busfahrerin, wo er Agnes Tsosie finden würde.
»Zwölf Meilen weiter bis zur Kreuzung nördlich von Beta Hochee«, sagte die Fahrerin. »Dann fahren Sie ungefähr zwei Meilen zurück nach Süden Richtung White Gone und nehmen die unbefestigte Straße hinter der Na-Ah-Tee-Niederlassung. Nach ungefähr drei, vier Meilen kommt rechts eine Straße, die zur Rückseite der Tesihim-Butte abbiegt. Das ist die Straße, die zu Old Lady Tsosies Verein führt. Ungefähr zwei Meilen, schätze ich.«
»Straße?«, fragte Leaphorn.
Die Busfahrerin war eine adrette junge Frau von vielleicht dreißig Jahren. Sie wusste genau, was Leaphorn meinte, und grinste.
»Nun ja, eigentlich sind’s eher zwei Fahrspuren durchs Gestrüpp. Aber es ist leicht zu finden. Es gibt dort jede Menge blühender Astern. Gleich oben auf einem Hang.«
Die Wegkreuzung zu Tsosies Hogan war tatsächlich leicht zu finden. Astern blühten überall entlang der unbefestigten Straße nach der Na-Ah-Tee-Handelsstation, aber die Stelle, wo der Weg von der Straße abbog, war außerdem durch einen Pfosten markiert, den die Busfahrerin nicht erwähnt hatte. Ein alter Stiefel war oben an dem Pfosten festgemacht, um zu signalisieren, dass jemand zu Hause war. Leaphorn schaltete einen Gang runter und bog in den Weg ein. Er fühlte sich ausgezeichnet. Alles bei dieser Ermittlung, warum ein toter Mann Agnes Tsosies Namen in seiner Tasche bei sich trug, schien glattzugehen.
»Ich habe keine Ahnung, wer das sein könnte«, sagte Agnes Tsosie. Dünn und grauhaarig lag sie, aufgestützt auf Kissen, in einem Metallbett unter einer Heckenlaube neben ihrem Haus und hielt eine Polaroidaufnahme des Mannes mit den spitzen Schuhen in der Hand. Sie reichte sie an Jolene Yellow weiter, die neben ihrem Lager stand. »Tochter, kennst du diesen Mann?«
Jolene Yellow blickte prüfend auf das Foto, schüttelte den Kopf und gab Leaphorn das Bild zurück. Er war schon zu lange in dem Geschäft, um Enttäuschung zu zeigen.
»Haben Sie irgendeine Idee, warum ein Fremder hierher zu Ihrem yeibichai kommen könnte?«
»Nein.« Sie schüttelte den Kopf. »Nicht dieser Fremde.«
Nicht dieser Fremde. Leaphorn dachte über die Antwort nach. Agnes Tsosie würde sie ihm zu gegebener Zeit erklären. Jetzt wandte sie den Blick von ihm ab, schaute hinaus über den sanften Hang, der von der Tesihim-Butte abfiel und dann nach und nach in westlicher Richtung vor der kantigen Silhouette der Nipple-Butte wieder anwuchs. Der Salbei war vom Herbst grau und silbern, der späte Nachmittag verwob ihn mit den schräg fallenden Schatten, und überall leuchteten das Gelb des blühenden Natternwurzes und das Purpurrot der Astern. Sie hat Schönheit vor ihren Augen, dachte Leaphorn. Schönheit rings um sich. Aber Agnes Tsosies Gesicht zeigte keinerlei Anzeichen, dass sie die Schönheit genoss. Es sah angespannt und krank aus.
»Wir haben einen Brief«, sagte Agnes Tsosie. »Er ist im Hogan.« Sie blickte Jolene Yellow an. »Meine Tochter holt ihn, damit du ihn anschauen kannst.«
Der Brief war auf normalem Briefpapier geschrieben:
13. September
Sehr geehrte Mrs Tsosie,
ich habe über Sie in einer alten Ausgabe des »National Geographic« gelesen – die mit dem langen Artikel über das Volk der Navajo. Darin hieß es, dass Sie ein Mitglied des Bitter Water Clans sind. Das war auch der Clan meiner Großmutter, und auf dem Bild, das dort von Ihnen gezeigt wurde, ist mir die Ähnlichkeit zwischen Ihnen aufgefallen. Ich schreibe Ihnen, weil ich Sie um einen Gefallen bitten möchte.
Ich bin nach meiner Abstammung zu einem Viertel ein Navajo. Meine Großmutter sagte mir, dass sie eine reinblütige Navajo-Frau war. Aber sie heiratete einen weißen Mann, und dasselbe tat meine Mutter. Ich aber fühle, dass ich ein Navajo bin, und ich möchte gern erfahren, was ich tun kann, um offiziell ein Mitglied des Stammes zu werden. Ich würde auch gern nach Arizona kommen und mit Ihnen über meine Familie sprechen. Ich erinnere mich, dass meine Großmutter mir gesagt hat, sie selber sei die Enkeltochter von Ganado Mucho und dem Bitter Water Clan zugehörig, und der Clan ihres Vaters sei das Streams-Come-Together-Volk gewesen.
Lassen Sie mich bitte wissen, ob ich kommen und Sie besuchen darf, und Sie mir alles darüber sagen, wie ich ein Navajo werde.
Hochachtungsvoll
Henry Highhawk
PS: Anbei ein frankierter und an mich adressierter Rückumschlag.
Leaphorn las den Brief nochmals und versuchte, diese Worte, diese merkwürdige Bitte mit dem arroganten Gesichtsausdruck des Mannes mit den spitzen Schuhen in Verbindung zu bringen.
»Haben Sie darauf geantwortet?«
»Ich habe ihm gesagt, er soll kommen«, erwiderte Agnes Tsosie. Mit einem Seufzer verlagerte sie ihr Gewicht und verzog das Gesicht.
Leaphorn wartete.
»Ich habe ihm gesagt, nach dem ersten Frost würde es ein yeibichai für mich geben. Wahrscheinlich Ende November. Dann solle er kommen. Es würden andere Leute vom Bitter Water Clan da sein, mit denen er reden kann. Ich sagte, er könne mit dem hataalii reden, der dort singen wird. Vielleicht wäre es gut für ihn, durch die Maske zu sehen und die Initiation zu beginnen, wie sie es mit den Jungen in der letzten Nacht des Singens tun. Ich sagte, ich wisse das alles nicht. Er müsse das den hataalii fragen. Und dann könne er nach Window Rock gehen und schauen, ob er als richtiges Stammesmitglied aufgenommen werden kann. Er könne von den Leuten da erfahren, welche Nachweise er braucht.«
Leaphorn wartete. Aber Agnes Tsosie hatte gesagt, was sie zu sagen hatte.
»Hat er auf Ihren Brief geantwortet?«
»Noch nicht«, sagte sie. »Oder vielleicht hat er, und sein Brief ist noch unten in Beta Hochee. Da holen wir unsere Post ab.«
»Niemand ist in letzter Zeit bei der Handelsstation gewesen«, sagte Jolene Yellow. »Nicht seit letzter Woche.«
»Haben Sie eine Ahnung, wer die Großmutter dieses Mannes war?«, fragte Leaphorn.
»Vielleicht«, sagte Agnes Tsosie. »Ich erinnere mich, dass es hieß, meine Mutter habe eine Tante, die in die Internatsschule gegangen war und nie zurückkam.«
»Auf jeden Fall«, meinte Jolene Yellow, »ist es nicht derselbe Mann.«
Leaphorn schaute sie überrascht an.
»Er hat uns ein Bild geschickt«, sagte sie. »Ich hole es.«
Es war ungefähr fünf Zentimeter im Quadrat, ein Farbfoto von der Art, wie sie von Fotoautomaten aufgenommen und in Pässe eingeklebt werden. Es zeigte ein längliches mageres Gesicht, große blaue Augen und langes blondes Haar, das zu zwei festen Zöpfen geflochten war. Ein Gesicht, das immer jungenhaft aussehen würde.
»Der sieht ganz bestimmt nicht wie ein Navajo aus«, sagte Leaphorn. Und im Stillen dachte er, dass dieser Henry Highhawk erst recht nicht aussah wie der Mann mit den spitzen Schuhen.
4
Hinter sich im Medizin-Hogan hörte Officer Jim Chee die ersten Tänzer singen, während sie sich die Bemalung für die Zeremonie auflegten. Das interessierte Chee. Er hatte sich eine Stelle ausgesucht, von der aus er durch den Eingang des Hogans schauen und den Darstellern zusehen konnte, wie sie sich vorbereiteten. Es waren acht Männer mittleren Alters aus dem Reservationsdistrikt Naschitti in New Mexico, der weit entfernt im Osten von Agnes Tsosies Hogan unter der Tesihim-Butte lag. Sie hatten sich zuerst ihre rechten Hände angemalt, dann von der Stirn abwärts ihre Gesichter und schließlich ihre Körper, um die Heiligen Wesen der Navajo-Mythologie zu verkörpern, die yei, die mächtigen Geister. Chee hoffte, die Zeremonie des Night Chants eines Tages selber zu erlernen. yeibichai nannte sein Volk sie nach Talking God, dem Sprechenden Gott und Großvater mütterlicherseits von allen Geistern. Die neuntägige Zeremonie umfasste fünf komplizierte Sandmalereien und Gesangsfolgen. Sie zu lernen würde viel, viel Zeit brauchen, genauso wie das Finden eines hataalii, der bereit war, ihn als Schüler anzunehmen. Wenn es so weit wäre, müsste er bei der Navajo-Police seinen Abschied einreichen. Aber das lag irgendwo in ferner Zukunft. Jetzt war es sein Job, nach dem verrückten Vogel aus Washington Ausschau zu halten. Henry Highhawk lautete der Name auf dem Haftbefehl des FBI.
»Henry Highhawk …«, hatte Captain Largo gesagt, als er ihm den Aktendeckel reichte. »… Edler Falke. Wenn sie beschließen, Indianer zu werden, und sich Weiße Wolke oder Sitzender Bär oder Edler Falke nennen, wollen sie üblicherweise Tscherokesen werden. Oder Mitglied von irgendeinem anderen würdevollen Stamm, den jeder kennt. Aber dieser Komiker musste sich unbedingt die Navajo aussuchen.«
Chee las die Akte durch. »Flucht über die Staatsgrenze, um sich der Strafverfolgung zu entziehen«, sagte er. »Strafverfolgung wegen was?«
»Grabschändung«, antwortete Largo. Er lachte und schüttelte seinen Kopf, zutiefst amüsiert über die Ironie der Dinge. »Ist das nicht das ideale Verbrechen für einen Mann, der von sich behauptet, ein Navajo zu sein?«
Chee war etwas in der Akte aufgefallen, was ihm noch ironischer vorkam als ein weißer Grabräuber, der von sich behauptete, ein Navajo zu sein – also Mitglied eines Stammes, der zufällig eine heftige Abneigung gegen Leichen hegte und alles, was mit dem Tod in Verbindung stand.
»Ist er ein Grabräuber?«, fragte Chee. »Sollte das FBI wirklich einmal versuchen, einen Grabräuber zu fangen?« Das Öffnen von Gräbern zu dem Zweck, präkolumbianische Töpferwaren für den Sammlermarkt zu stehlen, war seit Generationen auf der Hochebene von Colorado sowohl ein FBI-Delikt als auch ein großes Geschäft, und die Apathie der Bundesbehörde in dieser Sache war ebenso unerschütterlich wie allseits bekannt. Chee stand vor Largos Schreibtisch und versuchte, sich vorzustellen, was die FBI-Agenten wohl aus dieser schon sprichwörtlichen Trägheit aufgeschreckt haben könnte.
»Er war kein Grabräuber«, sagte Largo. »Das ist ein Politischer. Er hat belagaana-Skelette drüben im Osten ausgebuddelt.« Largo erklärte, was Highhawk mit den Skeletten angestellt hatte. »Das waren also nicht nur Skelette von Weißen, sondern VIP-belagaana-