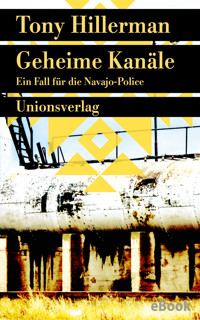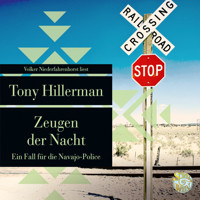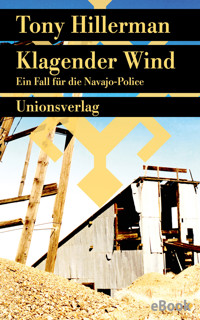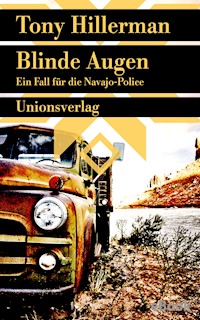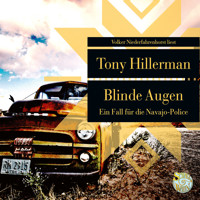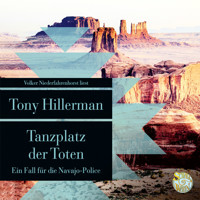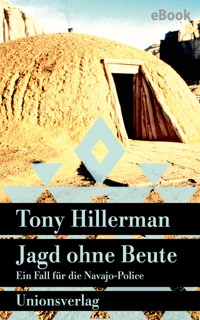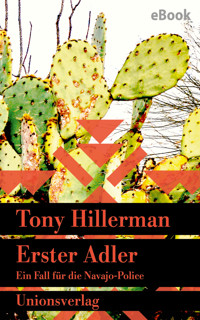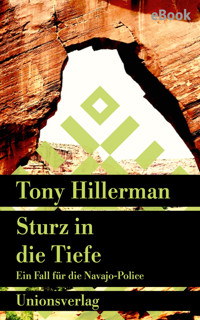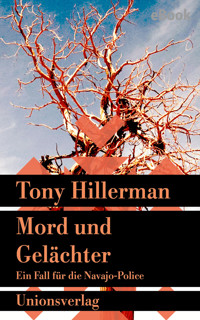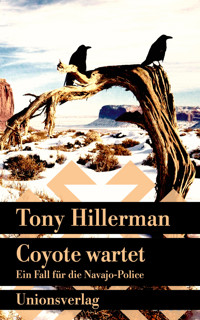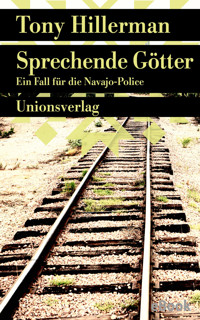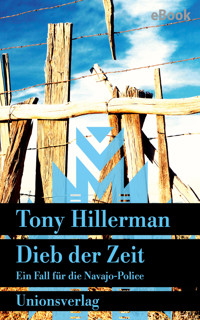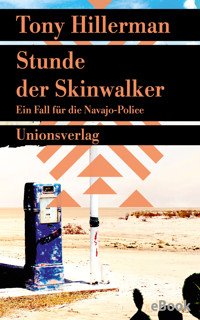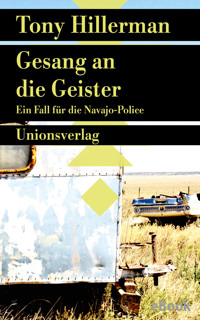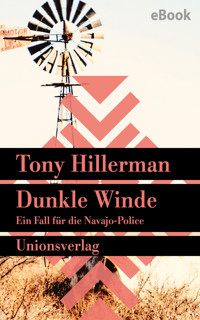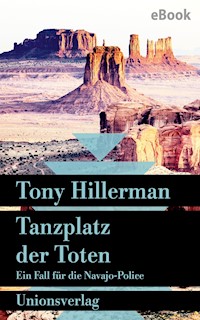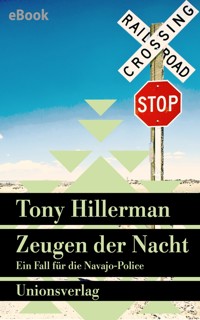
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Zu seiner Überraschung wird der junge Officer Jim Chee beim FBI angenommen, doch eigentlich will er bei der Navajo-Police bleiben und sich gleichzeitig zum rituellen Singer ausbilden lassen. Während er über einer Entscheidung brütet, wird er mit den Ermittlungen in einem scheinbar unbedeutenden Diebstahl beauftragt, für den sich aber auffällig viele Leute interessieren. Chees Nachforschungen führen ihn zu einer dreißig Jahre alten Vision und einer mysteriösen Gruppe, die sich »Volk der Finsternis« nennt. Und ins Visier eines Profikillers, dessen Auftraggeber nicht an der Lösung dieses Rätsels interessiert sind. Die Vergangenheit wirft düstere Schatten auf die Navajo-Borderlands im ersten Fall für Jim Chee. Verfilmt als Serie »Dark Winds – Der Wind des Bösen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Über dieses Buch
Der junge Officer Jim Chee brütet eigentlich über der Entscheidung, ob er zum FBI gehen oder bei der Navajo-Police bleiben soll, als ein scheinbar unbedeutender Diebstahl seine Neugier weckt. Seine Nachforschungen führen ihn über eine dreißig Jahre alte Vision zu einem mysteriösen »Volk der Finsternis« – und ins Visier eines Profikillers.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Tony Hillerman (1925-2008) besuchte ein Internat für Native Americans, kämpfte im Zweiten Weltkrieg, studierte Journalismus und war als Journalist und Dozent tätig. Seine Romane um die Navajo-Cops Joe Leaphorn und Jim Chee wurden vielfach ausgezeichnet und in siebzehn Sprachen übersetzt.
Zur Webseite von Tony Hillerman.
Klaus Fröba (*1934) ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Übersetzer, er veröffentlichte Jugendbücher und Kriminalromane. Er übersetzte aus dem Englischen, u. a. Werke von Jeffrey Deaver, Ira Levin, Tony Hillerman und Douglas Preston. Fröba lebt in der Nähe von Bonn.
Zur Webseite von Klaus Fröba.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Tony Hillerman
Zeugen der Nacht
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Klaus Fröba
Ein Fall für die Navajo-Police (3)
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 2 Dokumente
Worterklärungen und Hintergrundinformationen zu diesem Buch auf https://ehillerman.unm.edu/encyclopedia-main
Für die vorliegende Ausgabe wurde die Übersetzung von Andreas Heckmann nach dem Original durchgesehen und grundlegend überarbeitet.
Die Originalausgabe erschien 1980 bei Harper & Row, New York.
Die deutsche Erstausgabe erschien 1982 unter dem Titel Tod der Maulwürfe im Goldmann Verlag, München.
Originaltitel: People of Darkness
© by Anthony G. Hillerman 1980
Alle Rechte an der deutschen Übersetzung von Klaus Fröba beim Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
© by Unionsverlag, Zürich 2023
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Hintergrund – Cultura RM (Alamy Stock Foto); Symbol – Tetiana Lazunova (Alamy Vektorgrafik)
Umschlaggestaltung: Sven Schrape
ISBN 978-3-293-31161-9
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 25.05.2023, 12:20h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ZEUGEN DER NACHT
1 – Warten zu müssen brachte ihr Beruf mit sich …2 – Der Regen ging unvermittelt in Graupel über …3 – Als Chee nach vorsichtiger Fahrt von den Bergen …4 – Jimmy Chee hatte die Stiefelabsätze auf den Rand …5 – An einiges kann ich mich sehr gut erinnern« …6 – Als Chee am nächsten Morgen zum Dienst kam …7 – Die Pueblo-Indianerin öffnete Chee die Tür. Während sie …8 – Colton Wolf war ein wenig hinter seinem Zeitplan …9 – Colton verließ den Wohnwagen, als auf Kanal sieben …10 – Colton kam kurz vor zwei Uhr morgens auf …11 – Jim Chee hatte den Zweihundert-Dollar-Scheck von Ben Vines …12 – Es war nach Sonnenuntergang, als Chee am Navajo …13 – Malpaís bedeutet, wörtlich aus dem Spanischen übersetzt, »schlechtes …14 – Colton Wolf hatte Spuren hinterlassen. Zwei Zeugen hatten …15 – Aus dem Fenster des Krankenzimmers im vierten Stock …16 – Als Martin gegangen war, hängte Chee sich etwa …17 – Als Chee auf die Uhr sah, war es …18 – Colton Wolf hatte den Wagen draußen im Dunkeln …19 – Chee war im Waschraum gewesen, um noch einen …20 – Schon auf der Treppe zur Wäscherei hinunter beschlich …21 – Chee schob den Hebel des Lesegeräts nach rechts …22 – Tags darauf startete Chee auf gut Glück eine …23 – Meinen Bruder?« Fannie Kinlicheenie sah ihn erstaunt an …24 – Sie holperten über den unbefestigten Weg zu der …25 – Die Ärztin hieß Edith Vassa. Morgensonne fiel durch …26 – Der rote Plastiksack lag mit vielen anderen …27 – Dr. Huffs Sekretärin kam auf sie zu …28 – Es kostete Jimmy Chee etliche Stunden Fahrt kreuz …29 – Colton Wolf war endlich bereit. Der CB-Funk im …30 – Der Handelsposten Bisti war vor vielen Jahren niedergebrannt …31 – Chee hatte den Platz sorgfältig ausgesucht und sich …32 – Chee informierte Sheriff Sena per Funk aus einem …Mehr über dieses Buch
Über Tony Hillerman
»Der Angst vor seinem Pferd hat«
Claus Biegert: Die Navajo-Romane — ein Fall von Kultureller Wertschätzung
Über Klaus Fröba
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Tony Hillerman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema USA
1
Warten zu müssen brachte ihr Beruf mit sich. Warten, bis Kulturen heranwuchsen, Gifte sich entwickelten, Antikörper entstanden, Reagenzien miteinander reagierten. Und immer wenn sie warten musste, fuhr die Bakteriologin ihren Rollstuhl an eins der Fenster und schaute hinunter auf die Welt. Die Welt da unten – das war der Parkplatz der Klinik für Krebsforschung und -therapie auf dem nördlichen Campus der University of New Mexico, gleich gegenüber dem Labor, in dem sie arbeitete. Ein stark frequentierter Parkplatz, das Gerangel um die Stellplätze war groß.
Über ein Jahr hatte die Bakteriologin sich den täglichen Kampf nun angesehen und wusste, wie die Sache lief. Sie wusste, wann die Politessen ihre Runden drehten, wie lange es normalerweise dauerte, bis ein Abschleppwagen kam, was man riskieren durfte, bis überhaupt einer kam, und welche Fahrzeuge notorisch falsch parkten. Sogar über die Romanze zwischen einer Datsun-Fahrerin und dem Besitzer des blauen Mercedes-Cabrios (einem der eingebildeten Verwaltungsschnösel, die reservierte Stellplätze hatten) wusste sie Bescheid. Irgendwann in diesem zweiten Jahr hatte sie auch angefangen, ihr Fernglas mit ins Büro zu nehmen, und es schließlich dort gelassen – das Fernglas, das sie auch jetzt in den Händen hielt und auf einen schmutzig grünen Pick-up richtete. Der schob seine Nase gerade zögerlich in eine Parklücke mit dem Schild:
Reserviert für den Stellvertretenden Direktor
Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt
Schon vor geraumer Zeit hatte die Bakteriologin die Erfahrung gemacht, dass Krebskranke sich nicht groß um Verbote scheren. Sie sind Todgeweihte, und sie wissen es. In einer solchen Situation verliert alles andere an Bedeutung. Trotzdem, im entscheidenden Augenblick benehmen sie sich dann doch immer wieder wie zivilisierte Bürger. Macht der Gewohnheit. Die Spielregeln so mutwillig zu verletzen wie der da unten in seinem Pick-up, das kam selten vor.
Es war ein Mann, ein Indianer, der sich da so herausfordernd benahm. Durch das Fernglas wirkte er gar nicht frech. Eher abgestumpft und krank. Schwerfällig kletterte er aus dem Fahrerhaus. Die Bakteriologin sah einen Koffer auf dem Beifahrersitz liegen und spürte unvermittelt einen Anflug von Bewunderung. Er kam, um sich in die Klinik aufnehmen zu lassen. Da mochten die Gesetzeshüter mit seinem Pick-up anstellen, was sie wollten. Dem Schicksal eine lange Nase drehen. Aber dann ließ der Mann den Koffer liegen.
Er war groß, mit wuchtigem Rumpf und schmalen Hüften, ein Navajo, sie kannte die typischen Merkmale. Er trug Jeans und – trotz der Augusthitze – eine Baumwolljacke. Langsam ging er auf den Patienteneingang zu, mit dem schleppenden Gang eines kranken Mannes. Er wird sich anmelden, dachte die Bakteriologin, und dann zurückkommen, den Koffer holen und den Pick-up wegfahren.
Jetzt tauchte noch ein Fahrzeug auf, das sich genauso wenig um die Vorschriften scherte. Ein Chevrolet, silbergrau, neu. Er rollte an dem grünen Pick-up vorbei bis auf den Platz, der für den Klinikdirektor reserviert war. Die Fahrertür ging auf, und ein schmächtiger Mann stieg aus, weiß gekleidet, einen Strohhut ins Genick geschoben. Der Mann blieb stehen und musterte offenbar den Pick-up. Dann ging er um seinen Wagen herum und öffnete die Beifahrertür. Er beugte sich hinein und machte sich am Vordersitz zu schaffen. Schließlich holte er eine große, oben zugefaltete Lebensmitteltüte heraus, stellte sie zwischen Bretter und Kartons auf die Ladefläche des Pick-ups, ziemlich dicht hinter das Fahrerhaus, schaute sich um, beobachtete den Parkplatz und die Gehwege und starrte am Schluss direkt zu der Bakteriologin hoch. Er war auffallend blond, fast ein Albino. Im nächsten Moment saß er wieder in seinem grauen Chevy und fuhr langsam davon.
Es war schon fast Mittag, als die Bakteriologin feststellte, dass die Lebewesen, die sich in ihrer Petrischale reproduziert hatten, keine giftigen Salmonellen, sondern harmlose, nichtpathogene Escherichia coli waren. Sie machte die erforderlichen Eintragungen, schloss den Bericht ab und schob ihren Rollstuhl wieder zum Fenster. Ein Abschleppwagen war gekommen. Die Bakteriologin stellte die Sehschärfe am Fernglas ein. Der Gehilfe des Fahrers hatte gerade ein Abschleppseil hinten an dem grünen Pick-up festgemacht. Mit der linken Hand gab er Zeichen, dann ging er neben dem Hinterrad in die Hocke und beobachtete, was sich tat. Bei dieser Entfernung und durch das Isolierglas der Fenster war das Geräusch der Schleppwinde nicht zu hören. Aber die Bakteriologin sah, wie sich das Heck des Pick-ups langsam hob.
Plötzlich ein blendend greller Blitz. Der Knall folgte eine Sekunde später, wie ein Kanonenschuss. Die Scheibe, hinter der die Bakteriologin saß, wurde so stark nach innen gedrückt, dass sie sprang, dann wölbte sie sich mit Wucht nach außen und regnete mit den Scherben unzähliger weiterer Fenster auf die leeren Gehwege hinab.
2
Der Regen ging unvermittelt in Graupel über. Die Hagelkörner prasselten auf Jim Chees Uniformhut, sprangen vom Kragen der Dienstjacke und ließen ihn frösteln. Es war der 3. November – so zeigte es der Kalender der First National Bank von Grants auf Chees Schreibtisch. Nach dem traditionellen Kalender der Navajo, der sich nicht so streng an Tagen orientierte, begann jetzt die »Zeit-wenn-der-Donner-schläft«. Nach beiden Kalendern allerdings war es zu früh für solches Wetter, selbst hier in etwa zweitausendvierhundert Metern Höhe am Hang des Mount Taylor. Howard Morgan hatte in seiner Wettervorhersage auf Kanal sieben mögliche Schneeschauer angekündigt, aber Chee hatte das nicht geglaubt und seine Winterjacke in der Polizeistation gelassen.
Er sah zu seinem Auto, einem weißen Chevrolet mit dem Siegel der Navajo Nation und dem Schriftzug »Navajo Police« auf der Tür. Sich in den Wagen zu setzen und die Heizung einzuschalten, wäre eine Möglichkeit gewesen. Eine andere, sich unter das Vordach der Villa von Benjamin J. Vines zu flüchten und in der Hoffnung, dass doch jemand auf ihn aufmerksam würde, noch ein paar Mal zu klingeln. Die Glocke machte ein seltsam singendes Geräusch, dessen angenehmes Echo er durch die schwere Tür hörte. Obwohl er bisher nichts damit erreicht hatte, war Chee versucht, noch einmal zu läuten, nur um diesen Klang zu hören. Als dritte Alternative blieb, den Kragen der Jacke hochzuschlagen, um den Graupelschauer abzuhalten, und weiter zu versuchen, etwas über dieses Haus herauszufinden.
Es war, hatte er gehört, nach Plänen von Frank Lloyd Wright gebaut und galt als das teuerste Haus in New Mexico. Und es machte Chee so neugierig wie alles andere, das zur Welt der Weißen gehörte. Im Augenblick war die Faszination besonders stark, weil er womöglich bald selbst zu dieser fremden Welt gehören würde. Bis zum 10. Dezember, in weniger als sechs Wochen also, musste er sich für oder gegen eine Anstellung beim FBI entscheiden und damit auch für oder gegen einen Platz in der Welt der singenden Haustürglocken.
Chee zog den Kragen seiner Jacke enger und die Hutkrempe tiefer und setzte seine Inspektion fort. Er stand neben einer angebauten Dreiergarage. Wie das Haus selbst war sie aus heimischem Granit und mit dem Hauptgebäude durch eine niedrige, geschwungene Mauer aus dem gleichen Baustoff verbunden. Gleich hinter der Mauer, auf einer knapp fünf Meter langen Grasfläche, standen zwei Gedenktafeln aus schwarzem Marmor, die Chees Aufmerksamkeit erregten. Grabsteine. Er beugte sich über die Mauer. In den Stein gleich rechts von ihm war der Name DILLON CHARLEY gemeißelt. Darunter hieß es:
Sein Geburtsdatum kannte er nicht
Gestorben am 11. Dezember 1953
Ein guter Indianer
Chee grinste. War der hämische Doppelsinn beabsichtigt? Hatte Vines – oder wer immer diese Inschrift hatte anfertigen lassen – General Sheridans Ausspruch gekannt, nur ein toter Indianer sei ein guter Indianer?
Auf dem Stein links von Chee stand:
MRS BENJAMIN J. VINES (ALICE)
Geboren am 13. April 1909
Gestorben am 4. Juni 1949
Eine treue Frau
Wem treu? B. J. Vines? Seltsam, so etwas auf einen Grabstein zu schreiben, aber letztlich kam Chee alles merkwürdig vor, was mit den Beerdigungsbräuchen der Weißen zusammenhing. Die Navajo kannten diese Sentimentalität gegenüber Toten nicht. Der Tod nahm dem Körper seinen Wert. Und selbst die Identität ging mit dem Verschwinden des chindi verloren. Was der Geist zurückgelassen hatte, musste so beseitigt werden, dass die Lebenden möglichst wenig Gefahr liefen, sich damit zu verunreinigen. Nie sprach jemand die Namen von Toten aus, und in Stein wurden sie ganz bestimmt nicht gemeißelt.
Chee sah sich noch einmal den Charley-Grabstein an. Der Name zerrte an seinem Gedächtnis. Es gab keine Charleys in Chees Stamm, dem Slow Talking Diné, und auch keinen bei den anderen Stämmen im Rough Rock Country, der Heimat seiner Familie. Aber hier, am östlichen Rand des Reservats, beim Salt Diné, beim Many Goats Diné, beim Mud Clan und beim Standing Rock Clan, war der Name ziemlich verbreitet. Und irgendein Charley hatte vor Kurzem etwas getan, woran Chee sich eigentlich erinnern müsste.
»Ein ziemlich ungewöhnlicher Platz für einen Friedhof, was?«, sagte jemand hinter ihm.
Es war eine Frau, etwa Mitte fünfzig, mit schmalem, hübschem, ernstem Gesicht. Sie trug eine teure Pelzjacke über ihren Jeans. Eine blaue Strickmütze bedeckte die Ohren. »Eine von B. J.s kleinen Verschrobenheiten, Leute neben der Garage zu beerdigen. Sind Sie Sergeant Chee?«
»Jim Chee«, stellte er sich vor. Die Frau sah ihn an, runzelte kritisch die Stirn und machte keine Anstalten, ihm die Hand zu geben.
»Sie sind jünger, als ich dachte«, sagte sie. »Man hat mir erzählt, Sie sind so etwas wie ein Amtsträger in Ihrer Religion. Habe ich das richtig verstanden?«
»Ich möchte ein yataalii werden«, sagte Chee. Er benutzte das Navajowort, weil nur dieser Begriff richtig ausdrückte, was es bedeutete. Die Anthropologen nannten die yataalii »Schamanen«, die meisten Leute in der Umgebung des Reservats sagten »Singer« oder »Medizinmänner«, aber keine dieser Bezeichnungen passte wirklich zu der Rolle, die er bei seinem Volk einnehmen würde, falls er es je schaffen sollte, sie spielen zu können. »Sind Sie Mrs Vines?«, fragte er.
»Ja, sicher«, sagte die Frau. »Rosemary Vines.« Sie blickte auf den Grabstein. »Die zweite Mrs Vines. Aber jetzt raus aus diesem Schneeregen.«
Das Haus hatte Chee Rätsel aufgegeben. Die Front bestand aus einer schwungvollen, fensterlosen Krümmung und ließ an gewachsenen Fels denken. Aber als sie das massive Portal und die Eingangshalle hinter sich hatten, löste sich das Rätsel von selbst. Die Front war in Wirklichkeit die Rückseite. Die Decke erhob sich in einer aufsteigenden Kurve bis zu einer riesigen Glaswand. Jenseits der Glaswand fiel der Berghang steil ab. Gerade war die Sicht durch Wolken und böige Schneeschauer verhängt, doch Chee war klar, dass sie an einem normalen Tag sehr weit reichte, über die Reservate der Laguna und Acoma hinweg nach Süden und Osten; südlich auf das vierzig Meilen lange Meer aus erstarrter Lava, das Malpaís genannt wurde, bis zu den Zuñi Mountains; ostwärts über die Cañoncito Reservation bis zum gewaltigen blauen Buckel der Sandia Mountains hinter Albuquerque.
Der Raum war fast ebenso spektakulär wie die Aussicht. Ein Kamin beherrschte die Innenwand aus Naturstein links von Chee, mit einem Eisbärenfell auf dem Teppich neben der Feuerstelle. Von der Wand zur Rechten starrten aus den Köpfen von Jagdtrophäen unzählige Glasaugen auf ihn herab. Chee starrte zurück: Wasserbüffel, Impala, Gnu, Steinbock, Oryx-Antilope, Wapiti, Maultierhirsch und ein Dutzend anderer Spezies, deren Namen er nicht kannte.
»Man braucht eine Weile, um sich daran zu gewöhnen«, sagte Mrs Vines. »Die Schrecklichsten bewahrt er zum Glück in seinem Trophäenzimmer auf. Das hier sind die, die nicht zurückbeißen konnten.«
»Ich hörte schon, dass er ein berühmter Jäger ist. Hat er nicht sogar die Weatherby Trophy gewonnen?«
»Zweimal«, antwortete Rosemary Vines. »1962 und 1971. Das waren schlechte Jahre für alles, was Hauer, Fell oder Federn hat.« Sie warf ihren Nerz über eine Sofalehne. Darunter trug sie ein kariertes Männerhemd. Sie war eine schlanke Frau, die sich pflegte. Aber sie wirkte angespannt. Das zeigte sich in ihrem Gesicht, ihrer Haltung und ihrer Kiefermuskulatur. Und sie rang die Hände in Höhe des Gürtels.
»Ich brauche einen Drink«, sagte sie. »Wollen Sie auch einen?«
»Nein, vielen Dank.«
»Kaffee?«
»Wenn’s keine Mühe macht.«
»Maria?«, sagte Mrs Vines in ein Sprechgitter neben dem Kamin. Das Sprechgitter surrte zur Antwort.
»Bring uns einen Scotch und Kaffee.«
Und wieder an Chee gewandt: »Sie sind ein erfahrener Ermittler. Stimmt doch, oder? Und Sie sind in Crownpoint stationiert. Und wissen alles über die Navajoreligion.«
»Ich bin dieses Jahr nach Crownpoint versetzt worden«, sagte Chee, »und ich kenne mich ein bisschen in den Bräuchen meines Volkes aus.« Es war nicht der geeignete Moment, dieser arroganten Weißen zu erklären, dass die Navajo keine Religion hatten, jedenfalls nicht in dem Sinne, in dem sie dieses Wort verstand. Dass sie nicht einmal ein eigenes Wort für Religion kannten. Zuerst musste er herausfinden, was sie von ihm wollte.
»Setzen Sie sich.« Rosemary Vines wies mit der Hand auf ein riesiges blaues Sofa und nahm selbst auf einem Sessel aus Stahl und glattem Leder Platz.
»Verstehen Sie auch was von Hexerei?« Sie rutschte auf die Sesselkante, lächelnd, angespannt, und rang die Hände jetzt im Schoß. »Von solchen Sachen wie Navajowölfen oder Skinwalkers oder wie man die nennt. Verstehen Sie viel davon?«
»Etwas schon«, antwortete Chee.
»Dann möchte ich Sie engagieren«, sagte sie. »Sie haben noch Urlaub gut …«
Eine ältere Frau – eine Pueblo-Indianerin, aber Chee war sich nicht sicher, von welchem Pueblo – kam mit einem Tablett herein. Mrs Vines nahm ihr Glas, der Farbe nach mehr Scotch als Wasser, und Chee bekam seinen Kaffee. Die Indianerin taxierte ihn mit scheuer Neugier aus den Augenwinkeln.
»Sie haben noch dreißig Tage Urlaub«, fuhr Mrs Vines fort. »Das müsste völlig reichen.«
Wofür?, fragte sich Chee. Aber er sagte nichts. Seine Mutter hatte ihn gelehrt, dass man mit den Ohren lernt, nicht mit der Zunge.
»Wir hatten hier einen Einbruch. Jemand ist ins Haus eingedrungen, hat sich in B. J.s Räumlichkeiten geschlichen und ein Kästchen aus seiner Andenkensammlung gestohlen. Ich möchte Sie engagieren, weil ich es wiederhaben will. B. J. liegt im Krankenhaus in Houston. Ich will das Ding zurück, ehe er nach Hause kommt. Ich zahle Ihnen fünfhundert Dollar jetzt und zweitausendfünfhundert, wenn Sie mir das Kästchen übergeben. Schaffen Sie’s nicht, gibts auch die zwei fünf nicht. Das ist nur fair.«
»Der Sheriff macht Ihnen das kostenlos«, erwiderte Chee. »Was sagt er denn zu der Sache?«
»Gordo Sena«, sagte Mrs Vines. »Mit dem hat B. J. nichts am Hut. Ich auch nicht. B. J. wäre es bestimmt nicht recht, wenn ausgerechnet er eingeschaltet würde. Und außerdem, was soll das bringen? Man schickt einen unfähigen Deputy, der eine Menge Fragen stellt, ein bisschen herumschnüffelt und wieder geht, damit hat sich’s.« Sie nippte an ihrem Scotch. »Die Polizei wird keine Anhaltspunkte finden.«
»Ich gehöre auch zur Polizei.«
»Aber für Sie wird es einfach sein«, sagte Mrs Vines. »Das Volk der Finsternis hat das Kästchen gestohlen. Finden Sie die Leute, und bringen Sie es zurück.«
Chee hatte das Gefühl, das Sofa verschlinge ihn und er versinke in einer königsblauen Bequemlichkeit aus Samt. Er überdachte Mrs Vines’ Worte und versuchte, einen Sinn darin zu entdecken. Sie ließ ihn nicht aus den Augen. In der einen Hand hielt sie das Glas, und ihr leichtes Zittern übertrug sich auf die Flüssigkeit und das Eis darin. Mit der anderen Hand zupfte sie nervös an ihrem Hosenbein. Graupel trommelte an die große Glasscheibe. Dahinter zog die Dunkelheit auf.
»Das Volk der Finsternis«, sagte Chee.
»Ja. Die müssen es gewesen sein. Habe ich schon erwähnt, dass außer dem Kästchen nichts gestohlen wurde? Schauen Sie sich um.« Sie wies mit großer Geste in den Raum. »Sie haben weder das Silber noch die Gemälde, noch sonst etwas mitgenommen. Nur das Kästchen. Nur deswegen sind sie gekommen. Und nun haben sie es.«
Das Silber stand auf dem Sideboard – eine große Schale und ein Dutzend Pokale auf einem massiven Tablett. Ziemlich wertvoll, dachte Chee. Und an der Wand dahinter hing eine wunderschöne Navajo-yei-Brücke, die man im Reservat selbst beim knauserigsten Händler für zweitausend Dollar loswerden konnte.
Chee widerstand dem Drang, Mrs Vines zu fragen, was sie mit »Volk der Finsternis« meinte. Er hatte nie davon gehört. Aber wahrscheinlich brachte es im Augenblick mehr, sie einfach reden zu lassen.
Und sie redete auf ihrer Sesselkante und nippte hin und wieder an ihrem Drink. Sie erzählte, dass zu der Zeit, als sie hierhergezogen war – das Haus war damals noch nicht ganz fertig –, ein Navajo namens Dillon Charley Vorarbeiter auf der Ranch von B. J. Vines gewesen war, der Mann, der jetzt neben Vines’ erster Frau bei der Garage unter der Erde lag. Vines und Charley seien Freunde gewesen.
»Der alte Mann hatte so eine Art Kirche gegründet«, sagte Mrs Vines. »B. J. interessierte sich dafür. Mir kams wenigstens so vor. Er hat das immer abgestritten. Angeblich amüsierte es ihn nur, zuzusehen, was der alte Mann trieb. Aber er hatte ganz offensichtlich Interesse an der Sache. Ich habe selber gehört, wie die beiden darüber geredet haben. Und ich weiß, dass B. J. Geld gespendet hat. Und als eure Polizisten einige Mitglieder dieser Kirche verhaftet haben, hat B. J. ihnen geholfen, wieder freizukommen.«
»Verhaftet?«, fragte Chee. Er fing an zu verstehen. »Ging es da um Peyote?«
Wenn ja, gehörte Dillon Charleys Kult zur Native American Church, die nach dem Zweiten Weltkrieg im Checkerbord-Reservat großen Zuspruch gefunden hatte, aber schließlich vom Stammesrat wegen des Gebrauchs einer psychedelischen Droge bei den Ritualen verboten worden war. Der Bundesgerichtshof hatte das Verbot aber wieder aufgehoben, weil es die Freiheit der Religionsausübung verletzte.
»Peyote. Ja, darum ging es«, sagte Rosemary Vines. »Drogenmissbrauch.« Ihre Stimme klang spöttisch. »B. J. ist nie zimperlich, wenn er sich für eine Sache engagiert. Er hat jedenfalls etwas aus diesem Kästchen, das sein Ein und Alles ist, herausgenommen und diesen Leuten gegeben. Ich habe ihn und Dillon mehrmals mit dem Kästchen gesehen. Worum es ging, weiß ich nicht, aber es muss wohl im Zusammenhang mit diesem Kult ziemlich wichtig gewesen sein. Und nun wurde es ihm gestohlen.«
»Was war denn drin?«, fragte Chee.
Mrs Vines nahm einen Schluck. »Bloß Andenken.«
»Was für Andenken? Irgendwas Wertvolles? Hinter was waren diese Leute her?«
»Ich habe nie in das Kästchen gesehen.« Sie lachte. »B. J. hat seine kleinen Geheimnisse. Er legt Wert auf seine Privatsphäre, ich übrigens auch auf meine.« Ihr Ton ließ ahnen, dass das oft ein Streitpunkt zwischen ihnen gewesen war. »B. J. nannte es sein Andenkenkästchen und behauptete, was da drin sei, habe für keine Menschenseele den geringsten Wert, nur für ihn.« Sie lachte wieder. »Womit er sich offensichtlich geirrt hat.«
»Haben Sie eine Idee, was er Dillon Charley aus dem Kästchen gegeben haben könnte? Wenigstens einen Anhaltspunkt?«
Sie sah ihn über ihr Glas hinweg ironisch an. »Maulwürfe – sagt Ihnen das was?«
Jetzt lachte Chee. Diese Unterhaltung erinnerte ihn mehr und mehr an seine Lieblingsgeschichte aus der Kultur der Weißen, an Alice im Wunderland.
»Maulwürfe? Nein, das sagt mir nichts.«
»Wie lautet euer Wort für Maulwürfe?«
»Dine’etse-tle«, sagte er und betonte besonders die Kehllaute.
Sie nickte. »So nannte Dillon Charley sie auch. Ich fragte ihn mal, was B. J. ihm gegeben habe, und genau das bekam ich zur Antwort. Wir hatten damals eine Navajo als Dienstmädchen – das war zu der Zeit, als noch Navajo für B. J. arbeiteten –, und ich habe sie nach der Bedeutung des Wortes gefragt. ›Maulwürfe‹, sagte sie.«
»Das stimmt«, bestätigte Chee. Eigentlich bedeutete der Begriff sogar noch etwas mehr, denn »Diné« war das Wort für »Volk«. Demnach bedeutete der Ausdruck auch »Volk der Maulwürfe«.
»Warum nennen Sie Dillon Charleys Kirche ›Volk der Finsternis‹?«, fragte Chee.
»B. J. nannte sie so. Oder so ähnlich. Das ist viele Jahre her, so genau weiß ich das nicht mehr.«
Du weißt es noch genau, dachte Chee. Er sagte: »Es könnte noch ein anderes Motiv für den Diebstahl des Kästchens geben. Das hier …«, er deutete in den Raum, »… ist ein legendärer Ort. Und B. J. Vines ist eine lebende Legende. Darum ist es durchaus möglich, dass man sich Geschichten über sein Andenkenkästchen erzählt. Vielleicht gibt es Gerüchte, dass es mit Gold oder Diamanten oder Tausend-Dollar-Noten gefüllt ist. Was erklären würde, warum sich der Einbrecher für Gemälde und Silber und Navajobrücken nicht interessiert hat. War das Kästchen abgeschlossen? Hat der Dieb es mitnehmen und aufbrechen müssen, um zu sehen, was drin ist?«
»Es war immer verschlossen«, antwortete sie. »Man hätte denken können, dass B. J. die Kronjuwelen darin aufbewahrte. Aber er behauptete, es seien nur Erinnerungsstücke, sentimentaler Krimskrams. Und warum hätte er lügen sollen?« Sie lächelte ihr angespanntes, humorloses Lächeln. »B. J. ist groß darin, Andenken zu sammeln. Er hebt einfach alles auf. Wenn er es nicht rahmen kann, stopft er es irgendwohin.« Das humorlose Lächeln wurde zu einem humorlosen Glucksen. »Man könnte denken, er habe Angst, eines Tages sein Gedächtnis zu verlieren.«
»Aber jemand, der sich nicht auskennt …«
»Jemand, der sich nicht auskennt, hätte nicht gewusst, wo B. J. das Kästchen aufbewahrt.« Mrs Vines klang gereizt. »Dillon Charley wusste es aber. Er muss es seinem Sohn gesagt haben, anders kann ich mir das nicht erklären.« Sie erhob sich. »Kommen Sie, ich zeige es Ihnen.«
Chee folgte ihr. »Noch was«, sagte er. »Ihr Mann kennt sich doch gut mit diesem Volk der Finsternis aus. Wäre es da nicht besser, er würde selbst nach dem Kästchen suchen?«
»Wie gesagt, er liegt im Krankenhaus«, erwiderte Mrs Vines. »Letzten Sommer hatte er einen Schlaganfall. Bei der Jagd in Alaska. Man hat ihn zurückgeflogen. Er ist linksseitig teilweise gelähmt. Sie haben ihm in Houston ein Gerät verpasst, mit dem ihm das Gehen leichter fällt. Aber dass er hinter Dieben herjagt, möchte ich wirklich nicht.«
»Verstehe.«
An der Tür blieb sie stehen und winkte ihm, ihr zu folgen. »Er ist ein Typ, der das auch auf Krücken tun würde. Sogar in einer eisernen Lunge würde er versuchen, die Diebe zu erwischen. Deshalb möchte ich das Kästchen umgehend zurückhaben. Es muss wieder da sein, wenn er nach Hause kommt. Ich will ihm Aufregung ersparen.«
Ein mit Teppichboden ausgelegter Flur führte in den Raum, den Rosemary Vines »B. J.s Büro« nannte. Es war ein großes Zimmer mit einer Balkendecke, einem steinernen Kamin, den zum Berghang gelegene Fenster flankierten, und einem riesigen Schreibtisch mit Glasplatte. Drei Wände waren mit Trophäen von Raubkatzen behängt, die alle im Todeskampf die Zähne fletschten. Chee zählte drei Löwen, zwei Löwinnen, vier Tiger und eine ganze Reihe Panther, Leoparden, Pumas, Geparden und andere Raubkatzen, zusammen vierzig oder fünfzig, schätzte er. Das Licht brach sich in Hunderten gebleckter Zähne.
»Der Einbrecher ist durch das Fenster neben dem Kamin eingedrungen und direkt dahin gegangen, wo das Kästchen zu holen war. Das hat er genommen und sonst nichts angerührt. Er wusste genau, wo es war.« Rosemary Vines suchte Chees Blick. »Hätten Sie das auch gewusst?«
Chee sah sich den Raum an. Rosemary Vines hatte gesagt, ihr Mann sammle Erinnerungen. Das stimmte. Das Zimmer war vollgestopft damit. Die Westwand, die einzige ohne Vines’ Arrangement von Raubtiertrophäen, war eine Galerie aus Fotografien und gerahmten Zertifikaten. Vines neben einem toten Tiger. Vines am Steuer eines Schnellboots. Vines mit einer Trophäe in Händen. Vines zwergenhaft neben dem Rad eines riesigen Erztransporters auf der Red Deuce Mine. Vines’ breites, graubärtiges Gesicht strahlend unter einem Tropenhelm. Sein schmaleres, jüngeres, noch schwarzbärtiges Gesicht, aus dem Cockpit eines Flugzeugs spähend. Chees Blick wanderte weiter. Zwei Glasvitrinen, eine mit Trophäen und Pokalen, die andere voller holzgeschnitzter oder in Stein gehauener Gegenstände. Regale, ein Tisch, jede Fläche musste für die Dinge herhalten, die Vines brauchte, um in die Vergangenheit zu schauen.
Mrs Vines sah Chee belustigt an. »All diese objets d’art sind für ihn eine Art Gesamtkunstwerk«, sagte sie und deutete auf die Galerie der Fotografien. »Und wie Sie sehen, hat mein Mann ein Problem mit seinem Ego.«
»Befand sich das Kästchen im Schreibtisch?«, wollte Chee wissen.
»Falsch geraten.« Mrs Vines ging zur Kaminwand und hängte den Kopf des kleinsten Tigers ab. Dahinter war eine Metallplatte mit aufgebogener Ecke eingelassen und öffnete sich von selbst.
»Die haben gewusst, wo sie suchen mussten. Und auch, dass sie etwas brauchten, um die Tür aufzuhebeln. Was sie auch getan haben«, sagte Mrs Vines. »Anschließend haben sie sich nicht mal die Mühe gemacht, die Tür wieder zu schließen und den Tigerkopf aufzuhängen.«
Chee sah sich die Platte an. Sie hing in schweren Angeln und war mit einem teuer aussehenden Schloss gesichert. Wer immer sich hier zu schaffen gemacht hatte, musste eine Art Brecheisen zwischen Platte und Rahmen gekeilt und so lange gedrückt haben, bis das Schloss nachgab. Die Platte war dick und hing erstaunlich schwer in den Scharnieren, war aber nicht stark genug gewesen, dem Druck standzuhalten. Chee war ein wenig verblüfft. Dem Aussehen nach hätte die Tür mehr Widerstand leisten müssen.
»Wie groß war das Kästchen?«, fragte er.
»Es hat genau in den Safe gepasst«, sagte Mrs Vines. »B. J. hat es eigens dafür anfertigen lassen. Vorn besaß es ein Kombinationsschloss mit Drehknopf. Ich will, dass Sie diese Leute finden und ihnen sagen: Wenn sie das Kästchen nicht zurückgeben – und zwar mit allem, was drin war –, sorge ich erbarmungslos dafür, dass sie eingelocht werden.« Sie ging zur Tür und winkte Chee an sich vorbei. »Sie können ihnen außerdem sagen, dass B. J. sie mit einem Fluch belegt, wenn er nach Hause kommt und feststellt, dass das Kästchen weg ist.«
»Was?«, fragte Chee.
Mrs Vines lachte. »Die Navajo hier in der Gegend halten ihn für einen Hexer.«
»Ich dachte, dass er gut mit den Diné auskam.«
»Das ist lange her. Als Dillon Charley starb, war auch das gute Verhältnis zu den Navajo vorbei. Innerhalb von ein, zwei Jahren haben alle, die hier arbeiteten, gekündigt. Wir haben seit Jahren keinen mehr aus Ihrem Volk auf unserer Gehaltsliste. Maria ist Acoma. Die meisten unserer Hausangestellten sind Laguna oder Acoma.«
»Was ist denn passiert?«
»Das weiß ich wirklich nicht«, sagte Mrs Vines. »Ich bin sicher, dass B. J. etwas getan hat, habe aber keine Ahnung, was. Ich habe Maria gefragt, und sie hat gesagt, die Navajo glauben, B. J. bringe Unglück.«
»Und Sie haben den Einbruch nicht dem Sheriff gemeldet?«
»Gordo Sena würde nicht den kleinen Finger für uns rühren«, sagte sie. »B. J. hat vor vielen Jahren mal dafür gesorgt, dass er bei der Wiederwahl nicht durchkam. Später hat er mehrfach versucht, ihm die Tour zu vermasseln. Sena ist kein ehrlicher Mann, und ich möchte nicht, dass er irgendwie mit dieser Sache zu tun bekommt.«
»Ich werde ihm den Fall melden müssen«, sagte Chee. »Ich muss mit ihm auskommen. Schließlich ziehen wir am selben Strang.«
»Tun Sie das«, sagte Mrs Vines. »Wenn er jemanden schickt, werde ich sagen, dass wir keine Strafanzeige erstatten und alles nur ein Missverständnis war.«
Chee nahm seinen Hut vom Sofa. Er war feucht.
»Der Mann, den Sie finden müssen, ist der Sohn vom alten Dillon Charley. Er hat die Leitung der Kirchengemeinde übernommen, heißt Emerson Charley und lebt in der Gegend von Grants. Nach dem Tod seines Vaters war er mehrfach hier, und jedes Mal gab es Auseinandersetzungen mit B. J.«
»Worüber?«
»Ich glaube, er wollte haben, was in dem Kästchen war. Ich habe ihn sagen hören, ihr Glück sei darin eingeschlossen. Oder so. Ich erinnere mich, dass schon der alte Dillon so was geäußert hat. Allerdings lachend. Aber Emerson hat nicht gelacht.«
Chee ließ den Hut in den Händen kreisen. Er sah nachdenklich aus.
»Noch zwei Fragen«, sagte er. »Woher konnte Emerson Charley von dem Safe wissen?«
»Ganz einfach. Dillon hat es gewusst, er war oft mit B. J. hier. Wie gesagt, ich bin sicher, Dillon hat seinem Sohn davon erzählt. Schließlich war Emerson dazu ausersehen, Dillons verrückten Kult weiterzuführen. Und Ihre zweite Frage?«
»Woran ist Dillon Charley gestorben?«
»Wie?« Mrs Vines sah ihn verwirrt an. Dann lachte sie. »Oh, ich verstehe, was Sie denken. Nichts Mysteriöses. Er starb an Krebs.« Sie lachte wieder. »Darum die seltsame Inschrift auf dem Grabstein. Das mit dem guten Indianer. Er war krank, und eines Tages kam er aus Albuquerque zurück und erzählte B. J., der Doktor habe ihm gesagt, seine Krankheit sei unheilbar. Der Doktor habe das so formuliert, dass er in ein paar Monaten ein guter Indianer sein werde.« Rosemary Vines zog eine Grimasse. »Über den eigenen Tod zu lachen – diese Art von Verrücktheit hat immer Eindruck auf B. J. gemacht. Er ließ es in den Grabstein meißeln.« Sie drückte Chee einen Umschlag in die Hand.
»Ich muss das mit meinen Vorgesetzten besprechen«, sagte Chee. »Und selber darüber nachdenken. Ich sage Ihnen in ein paar Tagen Bescheid. Vielleicht gebe ich das hier zurück.«
»Ihre Vorgesetzten werden nichts dagegen haben. Ich habe das schon geklärt.«
»Ich rufe Sie an«, sagte Chee.
Die alte Acomafrau öffnete die Haustür für Chee und hielt sie gegen den böigen Wind fest. Er nickte ihr zu und trat in die Dunkelheit.
»Tenga cuidado«, sagte sie.
Als er den kalten Motor startete, ging Chee durch den Kopf, dass sie zwar kein Navajo sprach und er ihr Keresan nicht verstand, dass es aber logischer gewesen wäre, wenn sie »Seien Sie vorsichtig« auf Englisch statt auf Spanisch gesagt hätte, denn sie musste damit rechnen, dass er kein Spanisch verstand.
Dann aber wurde ihm klar, dass Mrs Vines wahrscheinlich kein Spanisch sprach. Und dass die Acoma bei ihrer Warnung vielleicht nicht an das schlechte Wetter gedacht hatte.
3
Als Chee nach vorsichtiger Fahrt von den Bergen herunter in Grants ankam, war der Sturm nach Osten weitergezogen. Nun war es windstill, trocken und kalt, etwa elf Grad unter null. Eine fingerdicke, federleichte Schneedecke lag auf dem Land.
Chee fuhr einen Umweg am Valencia County Office vorbei, vielleicht machten sie ja in der Polizeistation wegen der schwierigen Straßenverhältnisse Überstunden. Tatsächlich brannte Licht. Er bog auf den Parkplatz ein.
Nur im Osten verdunkelten noch Wolken das Firmament. Sonst sah der Himmel wie gefegt aus, Sternenlicht funkelte. Chee blieb kurz stehen und betrachtete den Himmel voller Freude. Er entdeckte die typischen Sternbilder des Herbstes, die im Süden emporsteigen, wenn die Erde sich am Ende des Sommers neigt und die »Zeit-wenn-der-Donner-schläft« beginnt.
Die Namen, die die Römer und Griechen ihnen gegeben hatten, waren Chee nicht so vertraut, wohl aber, wie sein Großvater sie genannt hatte. Tief am südlichen Horizont erkannte er Spider Woman (bei den Römern »Aquarius«, also Wassermann) und – knapp über dem Dunkel der Sturmwolken am nordöstlichen Himmel – die unheilvollen Blue Flint Boys, die die Griechen »Plejaden« genannt hatten. Fast direkt über ihm funkelte Born of Water, der Weise der Hero Twins. Über seiner rechten Schulter, umgeben von Sternen geringerer Größe und Bedeutung, strahlte Blue Heron. Nach dem Ursprungsmythos, wie man ihn in Chees Stamm erzählte, war dieser Reiher von First Man in die überflutete Unterwelt zurückgeschickt worden, um das vergessene Bündel der Zauberrituale zu retten und so das Böse auf die Erde zu bringen.
Chee spürte, wie die Kälte durch Jackenkragen und Hosenbeine drang, und begab sich eilig in die Wärme des Bürogebäudes. An der dritten Tür, ein Stück den Flur entlang, stand: LAWrence Sena, Sheriff, Valencia County. Bitte eintreten. Jemand hatte Chee erzählt, dass Sena mit dem groß geschriebenen LAW vergeblich versucht hatte, seinen kränkenden Spitznamen »Gordo« loszuwerden.
Chee drückte die Klinke und hoffte, ein Deputy würde Sena während der Überstunden vertreten. Den Sheriff hatte er erst einmal getroffen, nach der Versetzung nach Crownpoint, als er seinen Antrittsbesuch machte. Sena hatte ihn beeindruckt. Er schien ein harter, kluger, barscher Mann zu sein, der es – wie Mrs Vines – offenbar nicht nötig fand, taktvoll mit seinen Mitmenschen umzugehen, da er ein Mann mit Macht und Einfluss war. Vielleicht liegt das daran, dachte Chee, dass die beiden einfach zu viel Geld haben.
Und zwar wegen des Urans. Vines hatte es gefunden, seine Konzession für Unsummen verkauft und sich obendrein Anteile an der riesigen Red Deuce Mine gesichert, auf der das Uranerz im Tagebau gewonnen wurde. Und Familie Sena verdankte ihr Vermögen dem Umstand, dass etwa sechs Meter unter den Kaktuswurzeln ihrer heruntergekommenen Ranch, auf der sie ein kümmerliches Dasein gefristet hatte, große Vorkommen an radioaktivem Erz gefunden worden waren. Ganz klar, dachte Chee, ein so reicher Mann ist in einer Nacht wie dieser zu Hause, nicht im Büro.
Sheriff Sena stand in der Glaskabine, die die Funkerin der Polizeistation von der Außenwelt isolierte, und hörte den Funkverkehr mit. Eine Frau in mittleren Jahren mit Kopfhörern stritt mit jemandem über den Einsatz eines Abschleppwagens. Es verging einige Zeit, bis der Sheriff Chee bemerkte.
»Hallo, Sergeant, was kann ich für Sie tun?«
»Ich möchte einen Einbruch melden«, sagte Chee.
Sheriff Sena reagierte nicht überrascht und hob seine buschigen schwarzen Brauen um kaum einen Millimeter. Die dunklen Augen gelangweilt und ausdruckslos auf Chee gerichtet, wartete er auf Einzelheiten.
»Jemand ist bei B. J. Vines eingedrungen und hat ein Kästchen gestohlen«, sagte Chee. »Nichts weiter Wertvolles. Nur Andenken.«
Senas Augen waren plötzlich hellwach. »Na«, sagte er nach einer Weile, »das ist interessant.« Er zwängte sich an Chee vorbei aus der Kabine. »Kommen Sie mit, ich muss mir das notieren.«
Das Büro des Sheriffs war noch kleiner als die Funkstation, gerade groß genug für den Schreibtisch, einen Drehstuhl auf der einen und einen Küchenstuhl auf der anderen Seite.
Sena ließ seinen massigen Körper in den Drehstuhl fallen und sah zu Chee hoch. »Vermutlich ist Vines’ Telefon kaputt. Oder warum hat er den Einbruch nicht selbst gemeldet?«
»Vines ist nicht zu Hause. Seine Frau sagte, sie habe keine offizielle Meldung gemacht, weil die Polizei ihrer Meinung nach den Fall sowieso nicht lösen kann.«
Sena zog die oberste Lade seines Schreibtisches auf und nahm Bleistift und Schreibblock heraus. »Können wir nicht, nein? Hat sie auch gesagt, warum nicht?«
»Weil es keine Anhaltspunkte gebe.«
»Setzen Sie sich.« Sena deutete auf den Küchenstuhl. Die Jahre und das Wetter hatten unzählige Falten in sein rundes Gesicht gegraben, in dem jetzt nur Skepsis stand. »Hat sie nicht erwähnt, dass der alte B. J. und ich nicht sonderlich gut miteinander auskommen?«
Chee lächelte. »Sie hat anklingen lassen, dass Sie keine Freunde sind. An den genauen Wortlaut erinnere ich mich nicht mehr.«
»Und warum hat sie Ihnen von dem Einbruch erzählt? Sind Sie ein Freund der Familie?«
»Sie will mich engagieren. Ich soll ihr das Kästchen wiederbeschaffen.«
»Aha.« Senas gerunzelte Brauen ersetzten stumm die Frage: Warum?
»Sie glaubt, es war ein Indianer. Ein Navajo. Sie meint, es habe etwas mit religiösen Dingen zu tun. Oder mit Hexerei. So was in der Art.«
Sena dachte darüber nach. »Es geht nur um dieses Kästchen? Sonst wird nichts vermisst?«
»Das hat sie jedenfalls gesagt.«
»Sehr wahrscheinlich dachte jemand, B. J. hat sein Geld darin versteckt.«
»Vermutlich«, sagte Chee.
»Aber sie glaubt nicht, dass die Sache so einfach ist.« Das war eine Feststellung, keine Frage, und Chee schwieg dazu.
Eine Fotografie an der Wand hinter dem Sheriff fiel ihm auf, anscheinend bei einem Unglück aufgenommen. Verbogene Reste von Stahlträgern im Vordergrund, daneben ein ausgebrannter Lastwagen, zwei Männer in Kakiuniform, den Blick starr auf ein Objekt außerhalb des Fotos gerichtet, hinter ihnen ein Polizei- und ein Krankenwagen, beide etwa Baujahr 1950. Offensichtlich der Schauplatz einer Explosion. Ein kleines weißes Kärtchen steckte in einer Ecke des Rahmens. Mit sechs getippten Namen, alle anscheinend Navajonamen. Vielleicht die der Opfer. Es war ein grobkörniges Schwarz-Weiß-Foto, Staub lag auf Glas und Rahmen.
Sena schob den Radiergummi seines Bleistifts zwischen die Zähne, lehnte sich im Drehstuhl zurück und musterte Chee. Sein Unterkiefer mahlte, sein Bleistift wippte auf und ab, eine Antenne auf der Suche nach einer logischen Erklärung. Sena nahm den Bleistift aus dem Mund. »Was hat sie noch gesagt?«