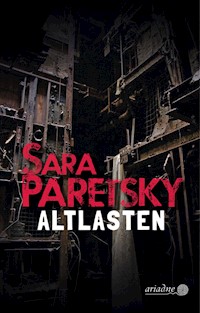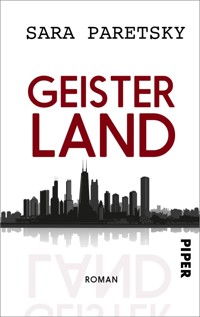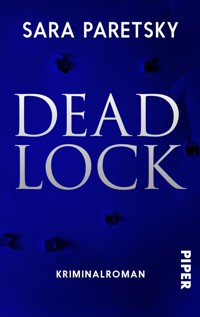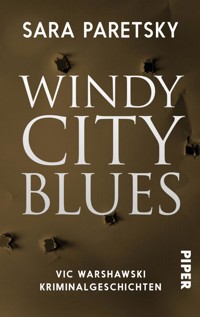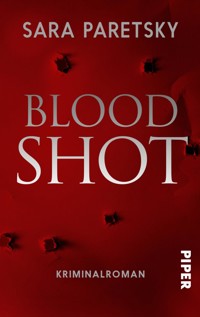
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Schauplatz Chicago: Vic Warshawski in ihrem fünften Fall bei der Arbeit, ihr Markenzeichen: Allein gegen den Rest der Welt mit einer scharfen Zunge. Die Privatdetektivin Vic Warshawski ermittelt in einem privaten Routinefall. Die Nachbarstochter Caroline bittet sie um Nachforschungen. Sie will endlich wissen, wer ihr Vater ist. Doch Vic stößt auf undurchdringliches Schweigen. Gleichzeitig wird eine Freundin tot im Sumpf aufgefunden. Als auch Vic im Sumpf landet und sich retten kann, muss sie feststellen, dass hinter dem Rätsel dieser Vaterschaft eine ganz andere, wesentlich brisantere Affäre steckt. »Ein Spitzenkrimi: Mit scharfem Schritt, immer einen flotten Spruch auf den Lippen, geht Vic ran an die Sache und riskiert dabei Kopf und Kragen« Brigitte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Annette Grube
ISBN: 978-3-492-98375-4
© dieser Ausgabe Piper Verlag GmbH, 2018
© 1988 Sara Paretsky
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Blood Shot«
© Delacorte Press, New York 1988
Published by arrangement with Sara and Two C-Dogs Inc.
© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1990, 1996
Covergestaltung: Favoritbüro München
Covermotiv: Freedom Master/shutterstock
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Wiedersehen mit Highway 41
Das Kind wird erzogen
Schwesternpflichten
Zu Gast bei alten Leuten
Die einfachen Freuden der Kindheit
Die Fabrik am Calumet
Die Jungs im Hinterzimmer
Ein guter Arzt
Die oberen Zehntausend
Wie geheuert so gefeuert
Carolines Geschichte
Gesunder Menschenverstand
Dead Stick Pond
Sumpf
Chemieunterricht
Hausbesuch
Trauerfeier
Im Schatten seines Vaters
Rauswurf
Der weiße Elefant
Mamas Liebling
Des Doktors Ausweg
Endspurt
In bitterster Not
Besuchszeit
Wieder zu Hause
Das Spiel geht los
Die goldenen Notizbücher
Gesindel
Wiedergutmachung
Krieg und Frieden
Scham und Schande
Eine Familienangelegenheit
Bankgeheimnis
Wortwechsel am Buckingham-Brunnen
Schlechtes Blut
Der Hai greift an
In der Giftküche
Aufräumarbeiten
Schüttelfrost
Ein kluges Kind
Humboldts Vermächtnis
Schwesternliebe
Dank
Widmung
Für Dominick
Wiedersehen mit Highway 41
Der Geruch. Ich hatte den Geruch vergessen. Obwohl die South Works bestreikt wurden und Wisconsin Steel geschlossen war und vor sich hin rostete, strömte ein beißender Chemikaliengeruch in das Innere des Chevy. Ich schaltete die Heizung ab, aber der Gestank – Luft konnte man das nicht nennen – drang durch alle Ritzen und brannte mir in Augen und Nase.
Ich fuhr auf dem Highway 41 in Richtung Süden. Ein paar Meilen weiter nördlich, wo linker Hand der Michigansee gegen die Felsen anbrandet und auf der rechten Seite kostspielige Wolkenkratzer hochmütig auf einen herabsehen, heißt er Lake Shore Drive. In Höhe der Neunundsiebzigsten Straße verschwindet der See plötzlich. Zwischen Straße und Wasser erstreckt sich das Gelände der riesigen USX South Works ungefähr eine Meile nach Osten. In der Ferne ragten Stahlmasten, Kräne und Schornsteine in die rauchverhangene Februarluft. Dies hier war nicht mehr das Land der Wolkenkratzer und Strände, sondern das der Müllhalden und heruntergekommenen Fabriken.
Den South Works gegenüber auf der rechten Straßenseite standen kleine, verfallende Häuser. Bei manchen fehlten Teile der Verschalung, andere wandten schamvoll Fassaden, deren Verputz abblätterte, oder gesprungene und abgesackte Vordertreppen aus Beton der Straße zu. Aber nirgendwo war eine kaputte Scheibe in den fest verschlossenen Fenstern oder Abfall im Garten zu sehen. Die Armut mochte in dieser Gegend Einzug gehalten haben, aber meine alten Nachbarn weigerten sich tapfer, vor ihr zu kapitulieren.
Ich konnte mich noch an die Zeit erinnern, als tagtäglich achtzehntausend Männer aus diesen Häuschen in die South Works strömten, zu Wisconsin Steel, an die Fließbänder von Ford oder in die Xerxes-Fabrik. Ich konnte mich noch an die Zeit erinnern, als hier jedes zweite Frühjahr frisch gestrichen wurde und neue Buicks oder Oldsmobiles herbstliche Selbstverständlichkeiten waren. Aber das war in einem anderen Leben gewesen, von dem ich ebensoweit entfernt war wie South Chicago.
An der Neunundachtzigsten Straße bog ich nach Westen ab und klappte die Sonnenblende herunter, um meine Augen vor der bleichen Wintersonne zu schützen. Jenseits des Durcheinanders von toten Bäumen, rostigen Autos und Hausruinen zu meiner Linken lag der Calumet River. Meine Freundinnen und ich setzten uns als Kinder regelmäßig über das Verbot unserer Eltern hinweg und badeten darin; bei dem Gedanken, heutzutage auch nur den großen Zeh in dieses Dreckwasser zu stecken, drehte sich mir der Magen um.
Die High-School stand auf der anderen Seite des Flusses. Es war ein riesiger dunkelroter Ziegelbau, der anheimelnd wirkte wie ein Mädchenpensionat aus dem neunzehnten Jahrhundert. Die von der Sonne angestrahlten Fenster und die vielen jungen Leute, die durch die breite Flügeltür des Westeingangs gingen, verstärkten den malerischen Eindruck. Ich parkte den Wagen, griff nach meiner Tasche und mischte mich unter die Menge.
Die hohen, gewölbten Räume waren erbaut worden, als das Heizen noch billig war und das Erziehungswesen den Menschen noch so sehr achtete, daß es ihm Schulhäuser errichtete, die Kathedralen glichen. Von Decken, Wänden und Metallspinden in den geräumigen Korridoren hallten Gelächter und Geschrei wider. Ich fragte mich, warum mir als Schülerin der Krach nie aufgefallen war.
Es wird behauptet, man würde nie vergessen, was man als Kind gelernt hat. Vor zwanzig Jahren war ich das letzte Mal hier gewesen, aber am Eingang zur Turnhalle wandte ich mich, ohne nachzudenken, nach links und ging den Flur entlang zum Umkleideraum der Mädchen. Caroline Djiak stand an der Tür, Klemmbrett in der Hand.
»Vic! Ich hab' schon geglaubt, du würdest kneifen. Alle anderen sind seit einer halben Stunde hier und haben sich schon umgezogen – zumindest die, die noch in ihr Trikot passen. Hast du deins dabei? Joan Lacey vom Herald-Star ist auch da. Sie will mit dir sprechen. Schließlich und endlich warst du unsere beste Turnierspielerin, oder etwa nicht?«
Caroline hatte sich nicht verändert. Der einzige Unterschied zu früher schien die Frisur zu sein, keine Zöpfe mehr, sondern ein kupferroter Heiligenschein, der ihr sommersprossiges Gesicht umrahmte. Sie war noch immer klein, ein Energiebündel und taktlos. Ich folgte ihr in den Umkleideraum, in dem der Geräuschpegel durchaus mit dem Lärm im Korridor konkurrieren konnte. Zehn junge, mehr oder weniger angezogene Frauen riefen durcheinander – wer hat eine Nagelfeile, ein Tampon, mein verdammtes Deospray? In BH und Slip sahen sie muskulös und fit aus, wesentlich besser in Form als meine Freundinnen und ich in ihrem Alter. Und mit Sicherheit fitter, als wir es jetzt waren.
Sieben der zehn Lady Tigers, mit denen ich vor zwanzig Jahren die Meisterschaft in der A-Liga des Staates Illinois gewonnen hatte, standen in einer Ecke und machten kaum weniger Lärm. Fünf von ihnen hatten bereits das schwarzgoldene Trikot an. Bei einigen spannte das T-Shirt über den Brüsten, und die Shorts sahen aus, als würden bei einer heftigen Bewegung die Nähte platzen. Die dort, die ihr Trikot nahezu sprengte, konnte Lily Goldring sein, unsere Freiwurfspezialistin, aber wegen des dauergewellten Haars und des Doppelkinns war ich mir nicht sicher. Die Schwarze, die das Fassungsvermögen ihres Trikots weit überschritt und deren breite Schultern qualvoll in das enge Oberteil gezwängt waren, war möglicherweise Alma Lowell. Nur Diane Logan und Nancy Cleghorn erkannte ich mit Bestimmtheit. Dianes Beine waren noch immer wohlgeformt und schlank genug für ein Vogue-Titelbild. Sie war Starstürmerin, zweiter Mannschaftskapitän und Klassenbeste gewesen. Caroline hatte mir erzählt, daß Diane jetzt eine PR-Agentur auf dem Loop leitete, mit Firmen von Schwarzen als Hauptkunden.
Mit Nancy Cleghorn hatte ich auch noch während der Collegezeit Kontakt gehalten; aber selbst wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte ich ihr unverändert ausdrucksstarkes, eckiges Gesicht und das blonde Kraushaar sofort wiedererkannt. Sie hatte mich dazu überredet, heute abend hierherzukommen. Nancy war verantwortlich für die Umweltabteilung von SCRAP – des South-Chicago-Reaktivierungs-Projekts, dessen stellvertretende Direktorin Caroline Djiak war. Als die beiden erfuhren, daß die Lady Tigers zum erstenmal seit zwanzig Jahren wieder bei den Regionalmeisterschaften mitmischten, beschlossen sie, die alte Mannschaft für einen Auftritt vor dem eigentlichen Spiel zusammenzutrommeln. Publicity für die Gegend, Publicity für SCRAP, Unterstützung für die Mannschaft – alle profitierten davon.
Als Nancy mich sah, grinste sie. »He, Warshawski, mach mal 'n bißchen Tempo. In zehn Minuten sind wir dran.«
»Hallo, Nancy. Ich könnt' mich in den Hintern beißen, daß ich mich von dir habe hierher locken lassen. Ist dir immer noch nicht klar, daß du keinen Treffer mehr landen wirst?« Ich fand ein paar Quadratzentimeter leere Bank, auf die ich meine Tasche stellte, zog mich schnell aus, stopfte die Jeans in die Tasche und streifte das ausgebleichte Trikot über. Dann zog ich Socken und Schuhe an.
Diane legte einen Arm um meine Schulter. »Siehst gut aus, Weiße, als ob du dich noch bewegen könntest, wenn's unbedingt sein muß.« Wir sahen in den Spiegel. Einige der derzeitigen Tigerinnen maßen sicher ein Meter achtzig; vor zwanzig Jahren war ich mit ein Meter siebzig die größte in unserer Mannschaft gewesen. Dianes Afro-Frisur reichte mir bis zur Nase. Wir beide, die eine schwarz, die andere weiß, wollten damals Basketball spielen, obwohl Rassenkonflikte auch in der Halle und im Umkleideraum ausgetragen wurden. Wir hatten uns nicht besonders gemocht, aber im vorletzten Schuljahr zwangen wir dem Rest der Mannschaft einen Waffenstillstand auf, und im nächsten Jahr nahmen wir an der Landesmeisterschaft der Mädchen teil.
An ihrem Grinsen merkte ich, daß sie dasselbe dachte. »Der ganze Schrott, durch den wir damals durch sind, kommt mir heute ziemlich belanglos vor, Warshawski. Komm mit zu der Frau von der Zeitung. Sag irgendwas Nettes über die Gegend.«
Joan Lacey vom Herald-Star war die einzige Sportreporterin in der ganzen Stadt. Als ich ihr erzählte, daß ich ihre Artikel regelmäßig las, strahlte sie vor Freude. »Sagen Sie das meinem Chef, oder besser noch, schreiben Sie einen Brief. Und wie fühlen Sie sich nach so vielen Jahren wieder in Ihrem Trikot?«
»Saublöd. Ich hab' keinen Basketball mehr in der Hand gehabt, seit ich aus dem College bin.« Dank eines Stipendiums für besonders sportliche Mädchen, das die Universität von Chicago anbot, lang bevor der Rest des Landes wußte, daß auch Frauen Sport treiben konnten, hatte ich damals studieren können.
Wir unterhielten uns eine Zeitlang, sprachen über die Vergangenheit, über alternde Sportler, über die fünfzig Prozent Arbeitslosen in der Gegend, über die Aussichten der derzeitigen Mannschaft. »Wir machen Stimmung für sie, klar«, sagte ich. »Ich bin sehr gespannt auf die Mädchen. Im Umkleideraum hatte ich den Eindruck, daß sie die Sache ernster nehmen als wir vor zwanzig Jahren.«
»Ja, sie hoffen, daß die Damen-Profiliga wieder ins Leben gerufen wird. Es gibt ein paar Superspielerinnen in der High-School und im College, die nicht wissen, wohin.«
Joan steckte ihren Notizblock weg und winkte einem Fotografen, damit er ein paar Bilder von uns machte. Wir acht Veteraninnen zottelten auf das Spielfeld, Caroline hüpfte um uns herum wie ein wildgewordener Terrier. Diane hob den Ball auf, dribbelte damit herum und warf ihn mir zu. Ich drehte mich um und zielte auf den Korb. Der Ball prallte ab, ich rannte, um ihn zu erwischen, und traf in den Korb. Meine alten Mannschaftskameradinnen drückten mir flüchtig die Hand. Der Fotograf machte ein paar Fotos von uns allen zusammen und dann von Diane und mir mit dem Ball unter dem Korb. Die Zuschauer klatschten zwar, aber ihr eigentliches Interesse galt der jungen Mannschaft. Als die Lady Tigers in Trainingsanzügen das Spielfeld betraten, um sich aufzuwärmen, wurden sie jubelnd empfangen. Wir spielten ein bißchen mit ihnen, überließen ihnen aber das Spielfeld so schnell wie möglich: Es war ihr großer Auftritt.
Als die Gastmannschaft St. Sophia in rot-weißen Trikots aufs Feld kam, schlich ich mich zurück in den Umkleideraum und zog mich wieder um. Caroline kam herein, als ich mir gerade den Schal um den Hals drapierte. »Vic! Wohin willst du? Du hast versprochen, nach dem Spiel mit zu meiner Mutter zu kommen!«
»Ich habe gesagt, ich würde mitkommen, wenn ich Zeit hätte.«
»Sie rechnet mit dir. Sie kann kaum mehr aufstehen, so schlecht geht es ihr. Es wäre eine riesige Enttäuschung für sie.«
Im Spiegel sah ich, daß sie rot wurde und sich ihre blauen Augen verdunkelten, und sie warf mir den gleichen gekränkten Blick zu, wie sie es als Fünfjährige getan hatte, wenn ich sie nicht hatte mitspielen lassen. Ich spürte, daß in mir der gleiche Ärger hochstieg wie vor zwanzig Jahren. »Hast du dir diese Basketball-Farce ausgedacht, damit ich Louisa besuche? Oder ist dir das erst später eingefallen?«
Sie wurde noch röter. »Was soll das heißen, Farce. Ich versuche, etwas für diese Gegend hier zu tun. Ich bin nicht irgendein feiner Pinkel, der in den Norden gezogen ist und die Leute hier ihrem Schicksal überläßt!«
»Meinst du vielleicht, wenn ich hier geblieben wäre, hätte ich Wisconsin Steel retten können? Oder die Idioten von USX davon abhalten können, den letzten noch funktionierenden Betrieb zu bestreiken?« Ich griff nach meinem Wolljackett auf der Bank und zog es wütend an.
»Vic! Wohin gehst du?«
»Nach Hause. Ich bin zum Abendessen verabredet und muß mich noch umziehen.«
»Das kannst du nicht tun. Ich brauche dich«, jammerte sie lauthals. Ihre großen Augen schwammen jetzt in Tränen – früher sah so das Vorspiel zu einem Protestgeheul vor ihrer oder meiner Mutter aus, wenn ich angeblich gemein zu ihr gewesen war. Mir fiel ein, wie Gabriella immer gesagt hatte: »Was macht es für einen Unterschied, Victoria? Laß die Kleine doch mitspielen.« Und ich zwang mich jedesmal dazu, Caroline nicht auf den großen, zitternden Mund zu schlagen.
»Wozu brauchst du mich? Um ein Versprechen zu halten, daß du gegeben hast, ohne mich vorher zu fragen?«
»Ma wird nicht mehr lang leben«, rief sie. »Ist das nicht wichtiger als irgendeine Scheißverabredung?«
»Selbstverständlich. Wenn es sich um irgendeine Verabredung handeln würde, würde ich anrufen und sagen, Entschuldigung, aber das kleine, ungezogene Mädchen von nebenan hat mich in was reingezogen, da kann ich nicht mehr raus. Aber es geht um ein Abendessen mit einem Klienten. Er ist sehr leicht beleidigt, zahlt aber pünktlich, und ich will ihn nicht vergraulen.«
Jetzt liefen Tränen über die Sommersprossen. »Vic, du hast mich noch nie ernst genommen. Als wir über heute abend geredet haben, habe ich dir gesagt, wie wichtig es für Ma ist, daß du sie besuchst. Und du hast es einfach vergessen. Du glaubst noch immer, ich bin fünf Jahre alt und nichts, was mich betrifft, ist von Bedeutung.«
Dagegen war nichts zu sagen, sie hatte recht. Und wenn Louisa wirklich so krank war, sollte ich sie besuchen. »In Ordnung. Ich sag' ab und ändere dir zuliebe meine Pläne. Zum letzten Mal.«
Augenblicklich versiegten die Tränen. »Danke, Vic. Ich werd's dir nicht vergessen. Ich wußte, auf dich ist Verlaß.«
»Du meinst, du warst dir sicher, daß du mich rumkriegen würdest.«
Sie lachte. »Ich zeig' dir, wo die Telefone sind.«
»Ich bin noch nicht verkalkt, ich weiß noch, wo sie sind. Und keine Angst, ich verdrück' mich nicht, wenn du wegschaust«, fügte ich hinzu, als ich ihren unsicheren Blick bemerkte.
Sie grinste. »Und Gott ist dein Zeuge?«
Das war ein alter Spruch, den sie von einem ständig betrunkenen Onkel ihrer Mutter – Onkel Stan – aufgeschnappt hatte; er hatte ihn benutzt, um zu beweisen, daß er nüchtern war.
»Und Gott ist mein Zeuge«, stimmte ich feierlich zu. »Ich hoffe nur, Graham wird nicht allzu sauer sein. Er soll seine Rechnung zahlen.«
Am Haupteingang fand ich die Telefone und verschwendete einiges Geld, bis ich ihn endlich im Forty-Nine-Club an der Strippe hatte. Er war nicht sehr erfreut – er hatte in einem teuren Restaurant einen Tisch reserviert –, aber ich brachte das Gespräch ohne größere Verärgerung seinerseits über die Bühne. Dann schwang ich mir meine Tasche über die Schulter und kehrte zurück zur Turnhalle.
Das Kind wird erzogen
St. Sophia machte es den Lady Tigers nicht leicht. Letztere gerieten während der zweiten Halbzeit meistens ins Hintertreffen. Es wurde viel schneller gespielt als zu meiner Zeit. Ich sah gespannt zu. Zwei Stürmerinnen der Lady Tigers mußten sieben Minuten vor Spielende wegen Foulspiels vom Feld, und es sah mies aus. Drei Minuten vor Schluß wurde die beste Verteidigerin von St. Sophia des Feldes verwiesen. Die Starstürmerin der Tigers, die das ganze Spiel über nicht zum Zug gekommen war, nutzte die Chance und traf achtmal in den Korb. So gewann die Heimmannschaft 54:51.
Ich jubelte ebenso wie alle anderen und verspürte sogar so etwas wie nostalgische Sympathie für die Mannschaft meiner früheren High-School – zu meiner eigenen Überraschung, denn die Erinnerung an meine Jugend wird beherrscht von der Krankheit und dem Tod meiner Mutter, und ich war immer der Meinung gewesen, ich hätte alles Leichte und Gute jener Zeiten ganz vergessen.
Nancy Cleghorn war sofort nach dem Spiel gegangen, aber Diane Logan und ich gesellten uns zum Rest der alten Mannschaft im Umkleideraum, um unseren Nachfolgerinnen zu gratulieren und ihnen für die Halbfinalspiele viel Glück zu wünschen. Wir blieben nicht lange: Die Mädchen waren unmißverständlich der Ansicht, daß wir viel zu alt waren, um etwas von Basketball zu verstehen; sie schienen es uns kaum abzunehmen, daß wir jemals wirklich gespielt hatten.
Diane verabschiedete sich von mir. »Um nichts in der Welt möchte ich noch mal jung sein«, sagte sie und drückte ihre Wange an meine. »Ich fahr' zurück an die Goldküste. Und von dort werden mich keine zehn Pferde mehr wegbringen. Mach's gut, Warshawski.« Weg war sie, in einer Wolke aus Silberfuchs und Opium.
Caroline stand vor der Tür. Sie war sichtlich besorgt, daß ich mich ohne sie aus dem Staub machen könnte und wirkte so angespannt, daß ich mich zu fragen begann, was mich bei ihr zu Hause erwarten würde. Genauso hatte sie sich verhalten, als sie mich in unserer Collegezeit an einem Wochenende dazu gebracht hatte, mit zu ihr nach Hause zu fahren, angeblich weil Louisa einen steifen Rücken hatte und Hilfe beim Einsetzen eines neuen Fensters brauchte. Dort allerdings stellte es sich heraus, daß ich Louisa erklären sollte, warum sie, Caroline, Louisas Perlenring dem St.-Wenzeslaus-Fastenorden gespendet hatte.
»Ist Louisa wirklich krank?« wollte ich wissen, als wir endlich gingen.
Sie sah mich ernst an. »Sehr krank, Vic. Es wird dir keine Freude machen, sie zu sehen.«
»Was hast du sonst noch vor?«
Prompt wurde sie rot. »Ich weiß nicht, wovon du redest.«
Am Schuleingang stürzte sie davon. Ich folgte ihr langsam und beobachtete, wie sie in ein zerbeultes Auto stieg, dessen Vorderteil weit in die Straße ragte. Als ich vorbeiging, kurbelte sie das Fenster herunter, rief mir zu, daß wir uns zu Hause sehen würden, und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Ich war in ziemlich düsterer Stimmung, als ich in die Houston Street einbog. Zuletzt war ich 1976 hier gewesen, als mein Vater starb und ich das Haus verkaufte. Damals war ich Louisa und der vierzehnjährigen Caroline begegnet, die zielstrebig in meine Fußstapfen trat; sie spielte sogar Basketball, aber mit ihren Einsfünfzig schaffte sie es trotz ihrer unermüdlichen Energie nicht in die erste Mannschaft.
Damals hatte ich mich auch mit den anderen Nachbarn, die meine Eltern gekannt hatten, zum letzten Mal unterhalten. Sie trauerten wirklich um meinen sanftmütigen, stets gutgelaunten Vater; Gabriella, meiner Mutter, die damals schon zehn Jahre tot war, zollten sie widerwillig Respekt. Schließlich hatte sie wie alle Frauen der Nachbarschaft jeden Pfennig sparen und zweimal umdrehen müssen; es war nicht leicht gewesen, jeden Tag etwas zum Essen auf den Tisch zu bringen. Als sie tot war, beschönigten sie ihr exzentrisches Verhalten, über das sie immer den Kopf geschüttelt hatten – daß sie mit mir in die Oper gegangen war, statt mir für die zehn Dollar einen neuen Wintermantel zu kaufen. Daß sie mich nicht hatte taufen lassen und mich nicht zu den Schwestern von St. Wenzeslaus in die Schule gab. Letzteres beunruhigte sie so sehr, daß eines Tages die Schwester Oberin, Mutter Joseph Irgendwas, bei uns hereinschneite. Es kam zu einer denkwürdigen Auseinandersetzung.
Die größte Narrheit bestand in ihren Augen vermutlich darin, daß sie darauf bestand, mich aufs College zu schicken, und es mußte auch noch die Universität von Chicago sein. Nur das Beste war gut genug für Gabriella, und als ich zwei war, hatte sie beschlossen, daß eben die Universität von Chicago das Beste war. Nach ihren Maßstäben vielleicht nicht ganz so gut wie die Universität von Pisa, ebensowenig wie die Schuhe, die sie bei Callabrano in der Morgan Street kaufte, sich mit Schuhen aus Mailand vergleichen ließen. Aber man tat, was man konnte. Also ging ich zwei Jahre nach ihrem Tod auf die – wie sie meine Nachbarn nannten – Rote Universität, halb ängstlich, halb neugierig, um mich den bösen Geistern dort zu stellen. Seitdem war ich nie mehr wirklich nach Hause zurückgekehrt.
Louisa Djiak war die einzige Frau in der Nachbarschaft gewesen, die zu Gabriella – ob tot oder lebendig – gestanden hatte. Aber sie hatte Gabriella für sich vereinnahmt. Und mich auch, dachte ich mit einer Spur Bitterkeit, die mich selbst wunderte. Mir wurde klar, daß ich mich noch immer über die vielen verlorenen Sommertage ärgerte, an denen ich Babysitter spielen mußte; zu oft hatte ich meine Hausaufgaben zum Gebrüll von Caroline machen müssen.
Das Baby war zwar mittlerweile erwachsen, aber es plärrte mir noch immer unerbittlich die Ohren voll. Ich kam hinter Carolines Capri zum Stehen und schaltete den Motor aus. Das Haus war kleiner und vor allem schäbiger, als ich es in Erinnerung hatte. Louisa war zu krank, um zweimal im Jahr die Vorhänge zu waschen und zu stärken, und Caroline gehörte einer Generation an, die solche Arbeiten tunlichst vermied. Ich mußte es wissen, gehörte ich doch auch zu dieser Generation.
Sie wartete an der Haustür auf mich. Noch immer nervös, lächelte sie kurz und angespannt. »Ma ist schon ganz aufgeregt. Sie hat bis jetzt auf ihren Kaffee verzichtet, weil sie ihn unbedingt mit dir trinken will.«
Sie führte mich durch das kleine, vollgestopfte Eßzimmer in die Küche und sagte dabei über die Schulter: »Eigentlich sollte sie überhaupt keinen Kaffee mehr trinken. Aber das wäre bei all dem, was sie sonst nicht mehr darf, zuviel verlangt, und wir haben uns auf eine Tasse pro Tag geeinigt.«
Sie machte sich mit energiegeladener Ineffizienz am Herd zu schaffen, und obwohl sie Wasser und Kaffeepulver verschüttete, gelang es ihr, Tasse, Stoffserviette und eine einzelne Geranie liebevoll auf einem Tablett zu arrangieren. Als letztes stellte sie noch ein Schüsselchen Eis mit einem Geranienblatt garniert dazu. Als sie das Tablett aufnahm, folgte ich ihr in Louisas Schlafzimmer. Der Geruch nach Medikamenten und Krankheit, der Gabriella in ihrem letzten Lebensjahr immer umgeben hatte, schlug mir wie eine Faust ins Gesicht. Ich riß mich zusammen und zwang mich, weiter in das Zimmer hineinzugehen.
Trotz Carolines Warnungen war ich schockiert. Louisa saß an Kissen gelehnt im Bett, ihr ausgezehrtes Gesicht war seltsam grüngrau verfärbt, das Haar dünn und strähnig. Die steifen Hände ragten aus den weiten Ärmeln einer abgetragenen rosa Strickjacke. Aber als sie sie mir lächelnd entgegenstreckte, konnte man noch etwas von der Schönheit der jungen Frau ahnen, die das Nachbarhaus gemietet hatte, als sie mit Caroline schwanger war.
»Ich freu' mich, dich zu sehen, Victoria. Ich wußte, du würdest kommen. In der Beziehung bist du wie deine Mutter. Du siehst ihr sogar ähnlich, obwohl du die grauen Augen deines Vaters hast.«
Ich kniete mich neben das Bett und umarmte sie. Die Knochen in der Strickjacke fühlten sich dünn und zerbrechlich an. Ein quälender Hustenanfall erschütterte ihren ganzen Körper. »Entschuldige. Zu viele verdammte Zigaretten geraucht. Das Fräulein hier versteckt sie vor mir, als ob sie mir jetzt noch schaden würden.«
Caroline biß sich auf die Lippen und kam ans Bett. »Ich hab' dir deinen Kaffee gebracht, Ma. Vielleicht lenkt er dich von den Zigaretten ab.«
»Ja, die eine Tasse. Verdammte Ärzte. Zuerst pumpen sie einen voller Scheiße, daß man nicht mehr weiß, ob man leben oder sterben will, und wenn sie einen zur Strecke gebracht haben, verbieten sie alles, was die Zeit schneller vergehen läßt. Ich sag' dir, Kleine, laß es nie soweit kommen.«
Ich nahm Caroline die große Tasse ab und reichte sie Louisa. Ihre Hände zitterten, und sie preßte die Tasse gegen die Brust, um sie ruhig zu halten. Ich stand auf und setzte mich auf einen Stuhl neben dem Bett.
»Möchtest du mit Vic ein bißchen allein sein, Ma?« fragte Caroline.
»Ja, geh nur, Kind. Ich weiß, daß du noch Arbeit zu erledigen hast.«
Nachdem Caroline draußen war, sagte ich: »Es tut mir wirklich leid, daß es dir so schlecht geht.«
Sie machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ach, was soll's. Ich will nicht mehr darüber nachdenken, und drüber reden muß ich oft genug mit den verdammten Ärzten. Über dich möcht' ich was hören. Ich lese alles, was über deine Fälle in den Zeitungen steht. Deine Mutter wäre wirklich stolz auf dich.«
Ich mußte lachen. »Da bin ich mir nicht so sicher. Sie hat immer gehofft, ich würde Opernsängerin werden. Oder Staranwältin. Ich kann mir ihr Gesicht gut vorstellen, wenn sie sehen würde, wie ich lebe.«
Louisa legte eine knochige Hand auf meinen Arm. »Das darfst du nicht denken, Victoria. Wirklich nicht. Du hast doch Gabriella gekannt – sie hätte einem Bettler ihr letztes Hemd gegeben. Erinnere dich dran, wie sie zu mir gehalten hat, als die Leute mir Eier und Scheiße an die Fenster geworfen haben. Vielleicht wollte sie, daß du besser lebst. So geht's mir zumindest mit Caroline. Mit ihrem Verstand, ihrer Ausbildung und so weiter hätte sie es besser erwischen können, als hier in diesem feuchten Loch rumzuhängen. Aber ich bin stolz auf sie. Sie ist ehrlich und arbeitet hart und setzt sich ein für das, woran sie glaubt. Und du bist genauso. Nein. Wenn Gabriella dich jetzt sehen würde, wäre sie stolz auf dich.«
»Als sie krank war, hätten wir es ohne deine Hilfe nicht geschafft«, sagte ich und fühlte mich unbehaglich.
»Ach, Scheiße, Kind. War meine einzige Möglichkeit, mich für all das zu revanchieren, was sie für mich getan hat. Ich seh' sie noch vor mir, als die rechtschaffenen Damen von St. Wenzeslaus bei mir anrückten. Gabriella kam dahergeschossen wie eine Furie, sie hätte sie beinahe in den verdammten Calumet geworfen.« Sie lachte heiser und wurde dann von einem erneuten Hustenanfall geschüttelt, der sie atemlos und hochrot im Gesicht zurückließ. »Kaum mehr vorstellbar, daß sich die Leute wegen einem schwangeren, unverheirateten Teenager so aufgeregt haben«, sagte sie, nachdem sie endlich wieder zu Atem gekommen war. »Hier in der Gegend ist die Hälfte der Leute arbeitslos – so ist das Leben, und der Tod. Damals hat so was das Ende bedeutet. Sogar für meine Eltern, die mich rausgeschmissen haben.« In ihrem Gesicht arbeitete es eine Weile. »Als ob es ausschließlich meine Schuld gewesen wäre. Deine Mutter war die einzige, die zu mir gehalten hat. Und obwohl meine Leute irgendwann zugaben, daß Caroline immerhin ein menschliches Wesen ist, haben sie ihr nie verziehen, daß sie geboren wurde, und mir, daß ich sie auf die Welt gebracht habe.«
Gabriella machte nie halbe Sachen. Und ich half ihr mit dem Baby, damit Louisa nachts bei Xerxes arbeiten konnte. Am schlimmsten waren die Tage, an denen ich Caroline zu ihren Großeltern brachte. Zwanghaft und humorlos wie sie waren, ließen sie mich nur ins Haus, wenn ich die Schuhe auszog. Ein paarmal badeten sie Caroline sogar vor dem Haus, bevor sie sie in ihre heiligen Hallen ließen. Louisas Eltern waren erst in den Sechzigern – in dem Alter, in dem Gabriella und Tony jetzt wären, wenn sie noch lebten. Weil Louisa ein Kind hatte und allein lebte, rechnete ich sie immer zur Generation meiner Eltern, aber tatsächlich war sie nur fünf oder sechs Jahre älter als ich.
»Wann hast du aufgehört zu arbeiten?« fragte ich sie. South Chicago war mir immer wieder in den Sinn gekommen, aber auf beunruhigende Weise – ich hatte es eigentlich aus meinem Leben verbannen wollen. Nur dann, wenn mein schlechtes Gewissen Gabriellas Bild heraufbeschwor, rief ich Louisa an, aber das letzte Mal war vor über zwei Jahren gewesen. Damals hatte sie mit keinem Wort erwähnt, daß sie sich schlecht fühlte.
»Ach, ich konnte einfach nicht mehr. Muß jetzt ungefähr ein Jahr her sein. Sie haben mich für erwerbsunfähig erklärt. Aber erst seit dem letzten halben Jahr geht es mir wirklich schlecht.« Sie zog die Decke von ihren Beinen. Sie sahen aus wie Zweige, dünne Knochen, auf denen Vögel hätten sitzen können, grüngrau gesprenkelt wie ihr Gesicht. Aschgraue Flecken auf Füßen und Knöcheln zeigten die Stellen, die nicht mehr durchblutet wurden. »Es sind die Nieren«, sagte sie. »Die verfluchten Dinger lassen mich nicht mehr richtig pissen. Caroline fährt mich jede Woche zwei-, dreimal ins Krankenhaus, und dort hängen sie mich an diese blöde Maschine, die mein Blut säubern soll, aber, ehrlich gesagt, mit wär's fast lieber, ich könnte in Frieden sterben.« Sie hob eine dürre Hand. »Erzähl Caroline nichts davon. Sie tut alles für mich. Und die Firma bezahlt, also brauch' ich nicht das Gefühl haben, daß sie ihr Erspartes für mich opfert. Ich will nicht, daß sie mich für undankbar hält.«
»Nein, nein, ich erzähl' ihr nichts«, beruhigte ich sie und deckte ihre Beine wieder zu.
Sie kam auf die alten Zeiten zu sprechen, als ihre Beine noch schlank und muskulös gewesen waren und sie um Mitternacht, nach der Arbeit, noch zum Tanzen ging. Auf Steve Ferraro, der sie heiraten wollte, auf Joey Pankowski, der sie nicht heiraten wollte, und darauf, daß sie alles genauso wieder machen würde, wenn man sie vor die Wahl stellte, denn sie hatte ja Caroline. Aber Caroline wünschte sie ein anderes, besseres Leben, sie sollte sich nicht in South Chicago zu Tode arbeiten.
Schließlich nahm ich ihre knochige Hand und drückte sie sanft. »Ich muß gehen, Louisa, es sind zwanzig Meilen bis zu meiner Wohnung. Aber ich komm' wieder.«
»Es war wirklich schön, dich zu sehen.« Sie legte den Kopf auf die Seite und lächelte hinterhältig. »Du hast wahrscheinlich keine Zigaretten dabei, oder?«
Ich mußte lachen. »Das Zeug rühr' ich nicht mal mit der Feuerzange an, Louisa, da mußt du dich schon mit Caroline einigen.«
Ich schüttelte ihre Kissen auf und schaltete den Fernseher ein, dann ging ich, um Caroline zu suchen. Louisa hatte nie etwas für Küsse und Umarmungen übrig gehabt, aber ein paar Sekunden lang drückte sie fest meine Hand.
Schwesternpflichten
Caroline saß am Eßzimmertisch, aß Brathuhn und machte sich auf einem farbigen Schaubild Notizen. Chaotische Papierhaufen – Berichte, Zeitschriften, Flugblätter – bedeckten den ganzen Tisch. Neben ihrem linken Ellbogen schwankte ein großer Stapel über dem Abgrund. Als sie mich eintreten hörte, legte sie den Bleistift aus der Hand, »Während du bei Ma warst, hab' ich was zu essen geholt. Möchtest du? Was meinst du – ziemlicher Schock, was?«
Ich schüttelte bestürzt den Kopf. »Sie sieht schrecklich aus. Wie erträgst du das?«
Sie verzog das Gesicht. »Es war alles nicht so schlimm, solange ihre Beine sie noch trugen. Hat sie sie dir gezeigt? Dachte ich mir. Was sie wirklich fertigmacht, ist, daß sie nicht mehr gehen kann. Für mich war am härtesten, daß sie schon so lange krank war, ohne daß ich etwas gemerkt habe. Du kennst sie – sie klagt nie, und schon gar nicht über so was Intimes wie ihre Nieren.« Sie fuhr mit einer fettigen Hand durch ihre widerspenstigen Locken. »Vor drei Jahren fiel mir plötzlich auf, wie dünn sie geworden war, und da wußte ich, daß irgendwas nicht stimmte. Und dann kam allmählich raus, daß sie sich schon ziemlich lange komisch fühlte – schwindlig und benommen, taube Beine –, aber sie wollte nicht, daß jemand davon erfuhr, um ihren Arbeitsplatz nicht zu gefährden.«
Die Geschichte hörte sich auf deprimierende Weise bekannt an. Die Leute im schicken Norden gingen zum Arzt, wenn sie sich den kleinen Zeh verstauchten, aber im Süden Chicagos wurde erwartet, daß man hart im Nehmen war. Unter Schwindelgefühlen und Gewichtsverlust litten viele Leute, das war etwas, worüber sich erwachsene Menschen ausschwiegen.
»Hat sie gute Ärzte?«
Caroline legte das abgenagte Hühnerbein zur Seite und leckte ihre Finger ab. »Sie sind in Ordnung. Wir gehen ins katholische Krankenhaus, da sind die Vertrauensärzte von Xerxes, und sie tun wirklich, was in ihrer Macht steht. Die Nieren arbeiten nicht mehr – man nennt das akutes Nierenversagen –, und es sieht so aus, als wäre auch das Knochenmark nicht mehr in Ordnung, und sie hat Emphyseme. Diese Scheißzigaretten sind unser wirkliches Problem. Die haben wahrscheinlich ihren Teil dazu beigetragen, daß sie jetzt in der Patsche sitzt.«
»Wenn es ihr sowieso schon so schlecht geht, werden ihr die Zigaretten auch nicht weiter schaden«, sagte ich, obwohl es mir peinlich war, davon anzufangen.
»Vic! Das hast du hoffentlich nicht zu ihr gesagt! Ich streite jeden Tag mindestens zehnmal mit ihr deswegen. Wenn sie jetzt glaubt, daß du ihr den Rücken stärkst, kann ich auf der Stelle aufgeben.« In ihrer Erregung schlug sie mit der Hand auf den Tisch; der schwankende Stapel fiel auf den Boden. »Von dir hätte ich, was das betrifft, am allermeisten Unterstützung erwartet.«
»Du weißt, wie ich über das Rauchen denke«, sagte ich verärgert. »Ich glaube, daß Tony noch leben würde, hätte er nicht tagtäglich zwei Schachteln gequalmt. In meinen Alpträumen höre ich ihn noch immer husten und keuchen. Aber wieviel Zeit gewinnt Louisa jetzt noch, wenn sie nicht mehr raucht? Sie ist allein, nur die Glotze leistet ihr Gesellschaft. Alles, was ich sage, ist, daß es ihr psychisch besser ginge, wenn sie rauchen könnte, und physisch würde es sie nicht weiter schädigen.«
Carolines Mund wurde zu einer kompromißlosen Linie. »Nein. Ich will nicht mehr darüber reden.«
Ich seufzte und half ihr, die am Boden verstreuten Papiere aufzusammeln. Als wir damit fertig waren, sah ich, daß sie wieder angespannt und wie abwesend war.
»Ich glaube, es wird Zeit, daß ich mich auf die Socken mache. Hoffentlich schaffen's die Lady Tigers.«
»Ich – Vic. Ich muß mit dir sprechen. Ich brauche deine Hilfe.«
»Caroline, ich bin deinetwegen hergekommen und in diesem lächerlichen Basketball-Trikot rumgehüpft. Ich hab' mit Louisa geredet. Nicht, daß es mir um die Zeit mit ihr leid tut, aber wie viele Punkte stehen noch auf deiner Tagesordnung?«
»Ich möchte dich engagieren. Dich als Profi. Ich brauche deine Hilfe als Detektiv«, sagte sie herausfordernd.
»Wozu? Hast du SCRAPs Geld dem Fastenorden gespendet und willst jetzt, daß ich es wiederbeschaffe?«
»Verdammt noch mal, Vic! Kannst du nicht endlich aufhören, mich wie eine Fünfjährige zu behandeln und mich statt dessen mal ernst nehmen?«
»Wenn du mich engagieren willst, warum hast du dann am Telefon nichts davon gesagt? Dein komischer zögerlicher Annäherungsversuch ist nicht gerade geeignet, dich in ein seriöses Licht zu rücken.«
»Ich wollte, daß du zuerst Ma siehst, bevor ich mit dir rede«, brummelte sie, die Augen auf das Schaubild gerichtet. »Ich dachte, wenn du siehst, wie schlecht es ihr geht, würdest du der Sache vielleicht mehr Bedeutung beimessen.«
Ich setzte mich an den Tisch. »Caroline, schieß los. Ich verspreche dir, ich werde dir so ernsthaft zuhören, wie jedem anderen potentiellen Klienten auch. Aber erzähl mir die ganze Geschichte, Anfang, Mitte, Schluß. Dann können wir entscheiden, ob du wirklich einen Detektiv brauchst, ob ich dafür geeignet bin und so weiter.«
Sie holte tief Luft und sagte schnell: »Ich will, daß du meinen Vater für mich findest.«
Ich schwieg.
»Ist das nicht ein Auftrag für einen Detektiv?« wollte sie wissen.
»Weißt du, wer es ist?« fragte ich sanft.
»Nein, das sollst du ja für mich rausfinden. Du hast gesehen, wie es um Ma steht. Sie wird bald sterben.« Sie versuchte, so sachlich wie möglich zu sprechen, aber ihre Stimme zitterte ein bißchen. »Ihre Familie hat mich immer – ich weiß nicht – jedenfalls nicht so behandelt, wie sie meine Cousins und Cousinen behandelt. Zweitklassig irgendwie. Wenn sie tot ist, möchte ich eine Familie haben. Vielleicht wird sich rausstellen, daß mein Vater ein altes Arschloch ist, jemand, der ein schwangeres Mädchen das durchmachen läßt, was Ma durchmachen mußte. Aber vielleicht mögen mich seine Leute. Und wenn nicht, dann weiß ich es wenigstens.«
»Was sagt Louisa dazu? Hast du sie nach ihm gefragt?«
»Sie hätte mich beinahe umgebracht. Und sich auch. Sie hat sich so aufgeregt, daß sie fast erstickt wäre. Hat mich angeschrien, daß ich undankbar bin, daß sie sich für mich zu Tode gearbeitet hat, daß es mir nie an irgend etwas gefehlt hat, und warum ich jetzt meine Nase in Dinge stecke, die mich einen Dreck angehen. Danach war mir klar, daß es keinen Sinn hat, sie nach ihm zu fragen. Aber ich muß es wissen. Und du kannst es für mich herausfinden.«
»Caroline, vielleicht-wäre es besser, wenn du es nicht wüßtest. Selbst wenn es mir gelingen sollte – mit vermißten Personen hab' ich nicht sehr viel Erfahrung –, ihn zu finden, wäre es um Louisas willen vielleicht besser, ihn nicht zu finden.«
»Du weißt, wer es ist, nicht wahr!« rief sie.
Ich schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung, Ehrenwort. Warum hast du das angenommen?«
Sie senkte den Kopf. »Ich bin sicher, daß sie es Gabriella erzählt hat. Und ich dachte vielleicht, daß Gabriella es dir gesagt hat.«
Ich stand auf und setzte mich neben sie. »Möglicherweise hat es Louisa meiner Mutter erzählt, aber wenn dem so war, dann gehörte es zu den Dingen, die ich Gabriellas Meinung nach nicht zu wissen brauchte. Gott ist mein Zeuge, ich weiß es nicht.«
Sie lächelte kurz. »Also wirst du ihn für mich suchen?«
Wenn ich sie nicht schon mein ganzes Leben lang gekannt hätte, wäre es leichter gewesen, nein zu sagen. Ich hatte mich auf Wirtschaftskriminalität spezialisiert; um vermißte Personen aufzuspüren, bedurfte es einer bestimmten Art von Geschicklichkeit und bestimmter Kontakte, die ich mir nie die Mühe gegeben hatte zu pflegen. Und außerdem war dieser Typ seit über einem Vierteljahrhundert verschwunden.
Aber abgesehen von der heulenden und hartnäckigen Anhänglichkeit, die Caroline dann zeigte, wenn ich sie nicht dabei haben wollte, hatte sie mich immer angehimmelt. Kam ich am Wochenende vom College nach Hause, rannte sie – die kupferroten Zöpfe flogen um ihren Kopf – mit ihren plumpen, schweren Beinen so schnell sie konnte zum Bahnhof, um mich abzuholen. Und nur weil ich Basketball spielte, tat sie es auch. Mit vier Jahren ertrank sie fast, als sie mir in den Michigansee nachlief. Und so weiter und so fort. Ihre blauen Augen blickten noch immer mit absolutem Vertrauen auf mich. Obwohl ich nicht wollte, konnte ich nicht umhin, sie zu fragen: »Hast du irgendeine Idee, wo man mit der Suche anfangen könnte?«
»Es muß jemand sein, der in East Side lebte. Sie war niemals woanders. Selbst im Loop ist sie erst gewesen, als uns deine Mutter mitgenommen hat, um uns die Weihnachtsbäume und die Schaufenster zu zeigen. Und damals war ich schon drei.«
East Side war eine ausschließlich von Weißen bewohnte Gegend östlich von South Chicago. Von der Stadt durch den Calumet abgeschnitten, führten die Menschen dort ein beschränktes, ewig gleiches Leben. Louisa war in East Side aufgewachsen, und ihre Eltern wohnten noch immer dort.
»Das bringt uns einen großen Schritt weiter«, sagte ich aufmunternd. »Was meinst du, wie viele Leute dort 1960 gelebt haben? Zwanzigtausend? Und nur die Hälfte davon waren Männer. Und viele noch Kinder. Irgendeine andere Idee?«
»Nein«, antwortete sie trotzig. »Deswegen brauche ich ja einen Detektiv.«
Bevor ich etwas erwidern konnte, klingelte es. Caroline blickte auf ihre Armbanduhr. »Das ist bestimmt Tante Connie. Manchmal kommt sie noch so spät. Bin gleich zurück.«
Sie ging hinaus, und während ihrer Abwesenheit blätterte ich in einer Zeitschrift, die sich der Entsorgung von festem Müll widmete – ein ganzer Industriezweig mittlerweile –, und fragte mich, ob ich wirklich so verrückt wäre, Carolines Vater zu suchen. Ich starrte geistesabwesend auf das Bild einer riesigen Verbrennungsanlage, als sie zurückkam. Nancy Cleghorn war bei ihr, meine alte Mannschaftskameradin, die jetzt für SCRAP arbeitete.
»Hallo, Vic, tut mir leid, so reinzuplatzen, aber ich wollte Caroline schnell was Wichtiges berichten.«
Caroline sah mich entschuldigend an und bat mich, ein paar Minuten Geduld zu haben.
»Macht nichts«, sagte ich höflich und fragte mich, ob ich dazu verdammt sei, die ganze Nacht hier zu verbringen. »Soll ich euch alleinlassen?«
Nancy schüttelte den Kopf. »Nichts Privates, nur was Ärgerliches.«
Sie setzte sich und knöpfte ihren Mantel auf, unter dem sie jetzt ein braunes Kleid mit rotem Schal trug, und obwohl sie sich geschminkt hatte, sah sie wie immer zerzaust aus. »Ich kam an, bevor die Versammlung anfing. Ron wartete schon auf mich – Ron Kappelman, unser Anwalt«, fügte sie zu mir gewandt hinzu, »und dann stellten wir fest, daß wir nicht auf der Tagesordnung standen. Also ging Ron zu diesem fetten Trottel Martin O'Gara und verklickerte ihm, daß wir unser Material rechtzeitig eingereicht und heute morgen mit der Sekretärin gesprochen hatten, um sicherzustellen, daß wir auch drankommen. O'Gara zieht eine Riesenshow ab à la Was-zum-Teufel-ist-hier-los und ruft den Sitzungssekretär an und verschwindet. Dann kommt er zurück und sagt, daß es mit unserer Vorlage 'ne Menge juristischer Probleme gibt und daß sie deswegen beschlossen haben, sie heute abend nicht zu behandeln.«
»Wir wollen hier eine Lösungsmittel-Recyclinganlage bauen«, erklärte Caroline zu mir gewandt. »Wir haben Geldgeber, das geeignete Gelände, unsere technischen Vorschriften halten allen nur erdenklichen Umweltprüfungen stand, und wir haben sogar schon Kunden – Xerxes und Glow-Rite. Wir könnten hier gut hundert Arbeitsplätze schaffen und verhindern, daß die Scheiße weiter in den Boden sickert.« Sie drehte sich wieder zu Nancy um. »Was sind die Probleme? Was hat Ron gesagt?«
»Ich hab' mich so wahnsinnig geärgert, daß ich kein Wort rausbrachte. Und er war so wütend, daß ich schon Angst hatte, er würde O'Gara den Hals umdrehen – falls er ihn unter den Speckschwarten gefunden hätte. Ron hat Dan Zimring angerufen, den Anwalt von der Umweltbehörde. Dan sagte, wir sollen bei ihm vorbeikommen. Das haben wir dann auch getan, und er hat unsere Vorlage genau durchgesehen und gesagt, daran wär' überhaupt nichts auszusetzen.« Nancy fuhr sich durch das Kraushaar, so daß es nach allen Seiten abstand. Geistesabwesend griff sie nach einem Stück Huhn.
»Ich sag' dir, was das Problem ist«, zischte Caroline mit roten Backen. »Wahrscheinlich haben sie die Vorlage Art Jurshak gezeigt – du weißt schon, weil sie ihm immer alles zeigen oder aus irgendeinem anderen beschissenen Grund. Und der blockiert.«
»Art Jurshak«, entfuhr es mir. »Ist der noch immer Stadtrat? Der muß doch inzwischen hundertfünfzig sein.«
»Nein, nein«, sagte Caroline ungeduldig. »Er ist erst Anfang Sechzig. Was meinst du, Nancy?«
»Ich glaub', er ist zweiundsechzig«, antwortete sie mit dem Mund voller Brathuhn.
»Ich habe nicht sein Alter gemeint«, fuhr Caroline noch immer ungeduldig fort. »Sondern daß Jurshak versucht, die Anlage zu verhindern.«
Nancy leckte an ihren Fingern. Sie sah sich nach einem Platz für den Knochen um und legte ihn schließlich auf den Teller zu den restlichen Hühnerteilen. »Wie kommst du darauf, Caroline? Eine Menge Leute könnte Interesse daran haben, hier eine Recyclinganlage zu verhindern.«
Caroline musterte sie aus zusammengekniffenen Augen. »Was hat O'Gara gesagt? Er muß doch irgendeinen Grund angeführt haben, warum sie uns nicht anhören wollten.«
Nancy runzelte die Stirn. »Er sagte, wir sollten nicht versuchen, solche Vorschläge einzubringen ohne Rückendeckung der Gemeinde. Ich erklärte ihm, daß die Gemeinde hundertprozentig hinter uns steht, und wollte ihm Kopien von Eingaben und so Zeug zeigen, als er fröhlich loslachte und sagte, nicht hundertprozentig. Er hätte von Leuten gehört, die strikt dagegen sind.«
»Aber warum Jurshak?« fragte ich, plötzlich entgegen meinem Vorsatz interessiert. »Warum nicht Xerxes oder die Mafia oder irgendein Konkurrent im Lösungsmittel-Recyclinggeschäft?«
»Wegen der politischen Verflechtungen«, erwiderte Caroline. »O'Gara ist der Vorsitzende der für diesen Stadtbezirk zuständigen Baukommission, weil er ein guter Freund der ganzen alten, abgewrackten Demokraten hier ist.«
»Aber, Caroline, Art hat keinen Grund, gegen uns zu sein. Auf unserem letzten Treffen machte er sogar den Eindruck, als wollte er uns unterstützen.«
»Er hat es aber nie ausdrücklich gesagt«, entgegnete Caroline erbittert. »Und alles, was nötig ist, damit er seine Meinung ändert, ist, daß jemand mit einer entsprechend hohen Wahlkampfspende vor seiner Nase rumwedelt.«
»Vermutlich«, stimmte Nancy widerwillig zu. »Aber daran will ich gar nicht denken.«
»Warum bist du auf einmal so für Jurshak eingenommen?« wollte Caroline wissen.
Jetzt wurde Nancy rot. »Bin ich nicht. Aber wenn er wirklich gegen uns ist, dann wird es so gut wie unmöglich sein, O'Gara dazu zu bringen, einer Anhörung zuzustimmen. Außer, wir legen eine Bestechungssumme auf Jurshaks Tisch, die groß genug ist, daß er sich auf unsere Seite schlägt. Wie finde ich heraus, wer gegen die Anlage ist, Vic? Arbeitest du nicht als Detektiv oder so was?«
Ich runzelte die Stirn und sagte schnell: »Oder so was. Das Problem ist, daß es in einem politischen Saustall wie diesem zu viele Möglichkeiten gibt. Die Mafia zum Beispiel. Die hat in Chicago ihre Finger in einer Menge von Müllbeseitigungsprojekten. Vielleicht denken sie, daß ihr euch ein Stück von ihrem Kuchen abschneiden wollt. Oder zurück nach Eden. Soviel ich weiß, sind sie angeblich hundertprozentige Umweltschützer, aber in letzter Zeit haben sie 'ne Menge Geld gemacht bei Sammlungen nach ihren Aktionen hier in South Chicago. Vielleicht wollen sie nicht, daß ihnen ein anderes Projekt das zahlende Publikum stiehlt. Oder die Leute von der Müllabfuhr, die sich vielleicht schmieren lassen und wegschauen, wenn's um Umweltverschmutzung geht, damit sie ihre Einkünfte nicht verlieren. Oder Xerxes will nicht –«
»Jetzt reicht's!« protestierte sie. »Du hast natürlich recht. Es könnte jeder oder alle von ihnen sein. Aber an meiner Stelle, wo würdest du zuerst nachforschen?«
»Ich weiß nicht«, sagte ich nachdenklich. »Wahrscheinlich bei Jurshak. Überprüfen, ob der Druck tatsächlich von ihm ausgegangen ist. Und wenn ja, warum. In dem Fall könntest du dir die Mühe sparen, alle anderen Möglichkeiten nachzuprüfen. Außerdem blieben dir Scherereien mit Leuten erspart, die dir allein schon wegen der Fragerei Zementschuhe verpassen wollen.«
»Du kennst ein paar von den Leuten, die für Art arbeiten, oder?« fragte Caroline Nancy.
»Ja.« Sie machte sich an einem weiteren Hühnerteil zu schaffen. »Ich wollte bloß nicht … Na gut. Alles für die gute Sache.« Sie nahm ihren Mantel und ging zur Tür, drehte sich noch einmal zu uns um, biß dann die Zähne zusammen und ging.
»Vielleicht möchtest du ihr gern helfen herauszufinden, wer gegen die Anlage ist«, sagte Caroline.
»Das hättest du gern, Süße. Und obwohl es bestimmt Spaß machen würde, verkraftet meine finanzielle Lage nicht mehr als einen mittellosen Klienten.«
»Heißt das, daß du mir helfen willst? Daß du meinen Vater suchen wirst?« Die blauen Augen verdunkelten sich in der Erregung. »Ich kann bezahlen, Vic. Wirklich. Ich will nicht, daß du umsonst für mich arbeitest. Ich habe tausend Dollar gespart.«
Mein üblicher Satz sind zweihundertfünfzig Dollar pro Tag plus Spesen. Selbst bei einem zwanzigprozentigen Familienrabatt würde ihr das Geld schneller ausgehen als mir die Arbeit.
Aber niemand hatte mich gezwungen, den Auftrag zu übernehmen. Ich war ein freier Mensch, beherrscht lediglich von meinen eigenen Launen und Schuldgefühlen. »Ich schick' dir morgen einen Vertrag«, sagte ich. »Und ruf mich ja nicht jede halbe Stunde an, weil du Ergebnisse sehen willst. Es wird eine Zeitlang dauern.«
»Nein, Vic, werd' ich nicht tun.« Sie lächelte ängstlich. »Ich kann dir gar nicht sagen, was mir deine Hilfe bedeutet.«
Zu Gast bei alten Leuten
In jener Nacht träumte ich von dem Baby Caroline, dessen Gesicht gerötet und fleckig war vom vielen Brüllen. Meine Mutter stand hinter mir und ermahnte mich, auf das Kind aufzupassen. Als ich um neun aufwachte, benebelte der Traum meinen Kopf und hüllte mich in Lethargie. Der Auftrag, den ich angenommen hatte, erfüllte mich mit Abscheu.
Für tausend Dollar sollte ich Carolines Vater finden. Entgegen dem lauthals geäußerten Widerstand Louisas. Wenn er sie nach so langer Zeit noch zu solchen Gefühlsausbrüchen hinreißen konnte, war es wahrscheinlich besser, er bliebe verschollen. Vorausgesetzt, er lebte noch, vorausgesetzt, er lebte in Chicago und war nicht irgendein Handelsreisender, der sich kurz einmal in der Stadt amüsiert hatte.
Schließlich streckte ich einen bleischweren Fuß unter der Bettdecke hervor. Im Zimmer war es eiskalt. Der Winter war bislang sehr mild gewesen, deshalb hatte ich die Heizung abgestellt, damit die Luft im Zimmer nicht stickig wurde, aber über Nacht war die Temperatur offenbar gefallen. Ich zog den Fuß wieder zurück; die Bewegung rettete mich aus meiner trägen Starre. Ich schlug die Decke zurück, stand auf, griff nach einem Sweatshirt, das ich im Kleiderhaufen auf dem Stuhl fand, und trottete in die Küche, um Kaffee zu kochen. Vielleicht war es zu kalt, um zu joggen. Ich schob den Vorhang beiseite und sah aus dem Fenster, das auf den Hinterhof hinausging. Der Himmel war grau verhangen, und der Ostwind wehte Abfall gegen den Zaun. Ich wollte den Vorhang gerade fallen lassen, als eine schwarze Nase und zwei schwarze Pfoten vor der Fensterscheibe auftauchten und ein lautes Bellen einsetzte. Es war Peppy, der Retriever, der mir gemeinsam mit dem Nachbarn aus dem Erdgeschoß gehörte. Ich hielt ihr die Tür auf, aber sie wollte nicht hereinkommen, statt dessen tänzelte sie auf der kleinen Veranda herum und gab mir damit zu verstehen, daß wir perfektes Laufwetter hatten und ich mich doch bitte endlich in Bewegung setzen sollte.
»Na gut«, brummte ich, schaltete den Herd aus und ging ins Wohnzimmer, um meine Dehnübungen zu machen. Peppy verstand nicht, warum ich mich lockern mußte und nicht sofort nach dem Aufstehen startbereit war. Alle paar Minuten hörte ich ihr drohendes Bellen in meinem Rücken. Als ich schließlich in Trainingsanzug und Joggingschuhen auftauchte, raste sie die Treppe hinunter, blieb auf jedem Absatz stehen, um sich zu vergewissern, daß ich es mir nicht anders überlegt hatte. Und als ich das Tor zu dem kleinen Weg hinter dem Haus öffnete, japste sie ekstatisch, obwohl wir diesen Ausflug drei-, viermal pro Woche machten.
Wie immer lief ich ungefähr fünf Meilen. Da das zuviel für Peppy war, blieb sie, sobald wir den See erreichten, bei einem Brackwasserteich zurück und spürte Enten und Bisamratten auf, rollte sich im Schlamm oder in verfaulenden Fischen, wenn sie welche fand, und sprang mir mit weit heraushängender Zunge und selbstzufrieden grinsend entgegen, sobald ich zurückkam. Die letzte Meile nach Hause liefen wir immer langsam, und dann übergab ich sie meinem Nachbarn. Mr. Contreras schüttelte regelmäßig den Kopf, schimpfte uns aus, wenn sie mal wieder völlig verdreckt war, und verbrachte die nächste vergnügliche halbe Stunde damit, ihr glänzendes rotgoldenes Fell zu waschen.
Auch an diesem Morgen erwartete er uns. »Habt ihr beide euch gut amüsiert beim Laufen? Hoffentlich haben Sie den Hund nicht ins Wasser gelassen? Bei dieser Kälte sollte sie besser nicht naß werden, wissen Sie.«
Er stand in der Tür, bereit stundenlange Gespräche zu führen. Mr. Contreras war früher Maschinenschlosser gewesen, heute unterhält er sich, so gut es geht, mit dem Hund, seinen Kochkünsten und mir. Ich verabschiedete mich so schnell wie möglich, aber es war schon fast elf, als ich endlich geduscht hatte. Während ich mich im Schlafzimmer anzog, frühstückte ich nebenbei, wohl wissend, daß ich eine Entschuldigung nach der anderen finden würde, um nicht wieder aufstehen zu müssen, wenn ich mich mit einer Tasse Kaffee und der Zeitung hinsetzte. Das Geschirr stellte ich auf der Wäschekommode ab, dann wickelte ich mir einen Wollschal um den Hals, sammelte Tasche und Mantel im Flur auf, wo ich sie letzte Nacht hatte liegen lassen, und brach auf in Richtung Süden.
Der Wind peitschte den See; drei Meter hohe Wellen schlugen gegen das felsige Ufer, und Gischt spritzte bis auf die Straße. Angesichts dieses Schauspiels wütender, verachtungsvoller Natur fühlte ich mich klein und mickrig. Auf dem Weg nach Süden sprang mir jede Einzelheit des Verfalls ins Auge. Die Tore des alten South Shore Country Clubs, einst ein Symbol für Reichtum und Exklusivität dieser Gegend, schlossen nicht mehr, und die weiße Farbe blätterte ab. Als Kind hatte ich immer davon geträumt, als große Lady auf einem Pferd über die Privatwege des Clubs zu reiten. Jetzt war mir die Erinnerung an diese Phantasien etwas peinlich – der jugendliche Kastendünkel wog schwer auf meinen erwachsenen Schultern. Aber dem Club hätte ich ein besseres Los gewünscht, als langsam in den Händen der Bezirksstadträte, seinen gleichgültigen Besitzern, zu verrotten.
South Chicago sah aus, als wäre es dem Tode geweiht; hier schien die Zeit irgendwann in den Vierzigern stehengeblieben zu sein. Als ich durch das Geschäftsviertel fuhr, bemerkte ich, daß die meisten Läden jetzt spanische Namen trugen, obwohl sie noch genauso aussahen wie in meiner Kindheit. Rußiger Beton umrahmte noch immer Schaufenster, in denen geschmacklose weiße Kommunionkleider aus Nylon, Kunstlederschuhe und Plastikmöbel ausgestellt waren. Frauen in fadenscheinigen Wollmänteln trugen noch immer Kopftücher und stemmten sich gegen den Wind. An den Straßenecken, in der Nähe der allgegenwärtigen Stehausschänke standen schäbig gekleidete Männer und starrten ins Leere. Sie waren schon immer dagewesen, aber die hohe Arbeitslosenquote hatte ihre Zahl in die Höhe getrieben.
Der alte Schleichweg nach East Side war mir nicht mehr geläufig, und ich mußte umkehren und zur Fünfundneunzigsten Straße zurückfahren, wo eine altmodische Zugbrücke über den Calumet führt. Wenn in South Chicago die Zeit 1945 stehengeblieben ist, dann liegt die East Side seit Woodrow Wilson unter einer Formaldehydschicht begraben. Lediglich fünf Brücken verbinden diese Gegend mit dem Rest der Stadt. Die Menschen dort leben in beschränkter Zurückgezogenheit, als wären sie aus den Dörfern ihrer osteuropäischen Großeltern nie herausgekommen. Sie mögen die Leute von der anderen Seite des Flusses nicht, und jemand, der nördlich der Einundsiebzigsten Straße lebt, wird hier nicht besser empfangen als ein russischer Panzer. Unter den mächtigen Betonpfeilern des Interstate Highway fuhr ich bis zur Hundertsechsten Straße. Die Ewing Avenue, in der Louisas Eltern wohnten, lag südlich davon. Ich rechnete damit, daß ihre Mutter zu Hause war, und hoffte von ihrem Vater das Gegenteil. Vor einigen Jahren hatte er die kleine Druckerei aufgegeben, aber er war nach wie vor aktives Mitglied bei den Knights of Columbus, einer wohltätigen Gesellschaft römisch-katholischer Männer, sowie bei einem Veteranenverein, und es war gut möglich, daß er mit seinen alten Kameraden beim Mittagessen war.
Entlang der Straße stand ein gepflegtes Häuschen neben dem anderen auf zwanghaft ordentlichen Grundstücken. Kein Fetzchen Papier lag auf der Straße. Art Jurshak kümmerte sich höchst liebevoll um diesen Teil seines Bezirks. Regelmäßig wurden die Straßen gereinigt und ausgebessert. Hier gab es nicht wie sonst überall in South Chicago Schlaglöcher an den Stellen, wo der Asphalt geplatzt war. Als ich aus dem Auto stieg, hatte ich das Gefühl, daß es besser gewesen wäre, wenn ich mich vor meinem Aufbruch einer gründlichen Reinigung unterzogen hätte.
In den Fenstern auf der Vorderseite des Djiak-Hauses leuchteten die Vorhänge in der matten Sonne, und die kleine Veranda vor dem Haus glänzte vom vielen Schrubben. Ich klingelte und sammelte Energie für die Unterhaltung mit Louisas Eltern.
Martha Djiak kam an die Tür, die gerunzelte Stirn in dem breiten, faltigen Gesicht hätte jeden Hausierer in die Flucht geschlagen. Nach einem Augenblick erkannte sie mich, und das Stirnrunzeln verlor etwas von seiner Strenge. Sie öffnete die innere Tür, und ich sah, daß sie eine Schürze über dem gestärkten Kleid trug. Zu Hause hatte ich sie nie ohne Schürze gesehen.
»Hallo, Victoria. Ist lange her, daß du mit der kleinen Caroline hier warst, nicht wahr?«
»Allerdings«, stimmte ich ohne jede Begeisterung zu.
Louisa hatte Caroline nie allein zu ihren Großeltern gehen lassen. Wenn sie selbst oder Gabriella zu beschäftigt gewesen waren, hatte sie mir einen halben Dollar für den Bus und den strikten Befehl gegeben, Caroline keinen Moment aus den Augen zu lassen. Ich habe nie verstanden, warum Mrs. Djiak nicht selbst kommen und Caroline abholen konnte. Vielleicht hatte Louisa befürchtet, ihre Mutter würde das Kind nicht mehr hergeben, damit es nicht mit einer alleinstehenden Mutter aufwachsen mußte.
»Wenn du schon einmal da bist, möchtest du vielleicht eine Tasse Kaffee.« Das klang nicht gerade überschwenglich, aber ein warmherziger Mensch war sie noch nie gewesen.
Ich nahm die Einladung mit soviel guter Laune an, wie ich aufbieten konnte. Sie öffnete mir die äußere Tür, darauf bedacht, daß sie die Glasscheibe nicht mit der Hand berührte. Ich schlüpfte so unauffällig wie möglich hinein und dachte daran, in dem kleinen Flur die Schuhe auszuziehen, bevor ich ihr in die Küche folgte. Wie ich gehofft hatte, war sie allein. Vor dem Herd war das Bügelbrett aufgestellt, ein Hemd lag darauf. Sie faltete es ordentlich und behend, legte es in den Wäschekorb und klappte das Bügelbrett zusammen. Nachdem alles in der kleinen Kammer hinter dem Kühlschrank verstaut war, stellte sie Wasser auf.
»Ich habe heute morgen mit Louisa gesprochen. Sie sagte, daß du gestern bei ihr gewesen bist.«
»Ja«, gab ich zu. »Es ist hart, jemanden, der so voller Leben war, krank im Bett zu sehen.«
Mrs. Djiak löffelte Kaffee in die Kanne. »Viele Leute haben aus geringerem Anlaß mehr zu leiden.«
»Und viele Leute führen sich auf wie Attila der Hunne und kriegen nicht mal 'nen Kratzer ab. Geschenkt, oder?«
Sie nahm zwei Tassen von einem Regal und stellte sie steif auf den Tisch. »Wie ich gehört habe, arbeitest du jetzt als Detektiv. Nicht gerade Frauenarbeit, oder? Wie Caroline. Die arbeitet in der Gemeindeentwicklung oder wie immer das heißt. Ich versteh' nicht, warum ihr zwei Mädchen nicht geheiratet und eine Familie gegründet habt.«
»Vermutlich warten wir darauf, daß uns Männer wie Mr. Djiak über den Weg laufen.«
Sie sah mir ernst ins Gesicht. »Da liegt der Hase begraben. Ihr Mädchen denkt, das Leben ist romantisch wie im Film. Ein guter, zuverlässiger Mann, der jeden Freitag seine Lohntüte heimbringt, ist mehr wert als irgendwelche tollen Partys und Blumen.«
»War das auch Louisas Problem?« fragte ich leise.
Sie kniff die Lippen zusammen und wandte sich wieder dem Kaffee zu. »Louisa hatte andere Probleme«, sagte sie kurz angebunden.
»Was für welche?«
Vorsichtig nahm sie eine Zuckerdose aus dem Hängeschrank über dem Herd und stellte sie zusammen mit einem Milchkännchen in die Mitte des Tisches. Erst als sie Kaffee eingeschenkt hatte, sprach sie wieder. »Louisas Probleme sind längst vergessen. Abgesehen davon, gehen sie dich überhaupt nichts an.«
»Und was ist mit Caroline? Gehen sie sie auch nichts an?« Ich nippte an dem köstlichen Kaffee, den Mrs. Djiak immer noch auf alte europäische Weise aufbrühte.
»Sie gehen sie nichts an. Es wäre besser für sie, wenn sie endlich lernen würde, ihre Nase nicht immer in die Angelegenheiten anderer Leute zu stecken.«
»Louisas Vergangenheit ist für Caroline sehr wichtig. Louisa stirbt, und Caroline fühlt sich einsam. Sie möchte wissen, wer ihr Vater ist.«
»Und deswegen bist du hierher gekommen? Um ihr zu helfen, die alten Leichen noch mal auszugraben? Sie sollte sich dafür schämen, keinen Vater zu haben, statt mit aller Welt darüber zu reden.«
»Was soll sie denn tun?« fragte ich ungeduldig. »Sich umbringen, nur weil Louisa nie den Mann geheiratet hat, der sie schwängerte? Sie tun so, als wäre es einzig Louisas und Carolines Schuld. Louisa war damals sechzehn – fünfzehn, als sie schwanger wurde. Glauben Sie nicht, daß auch der Mann dafür verantwortlich war?«
Sie umklammerte die Kaffeetasse so fest, daß ich fürchtete, sie würde zerbrechen. »Männer – können sich manchmal nicht kontrollieren. Wir alle wissen das«, sagte sie langsam. »Louisa muß ihn verführt haben. Obwohl sie das niemals zugeben würde.«
»Ich möchte nur seinen Namen wissen«, sagte ich so gelassen wie möglich. »Meiner Meinung nach hat Caroline das Recht, zu erfahren, wer es war. Und das Recht, selbst festzustellen, ob die Familie ihres Vaters sie aufnehmen will.«
»Rechte!« sagte sie erbittert. »Carolines Rechte! Louisas Rechte! Was ist mit meinem Recht auf ein anständiges und friedliches Leben? Du bist genauso schlecht wie deine Mutter.«
»Sehr gut«, sagte ich. »Ein schöneres Kompliment konnten Sie mir gar nicht machen.«
In meinem Rücken drehte sich ein Schlüssel im Schloß der Hintertür. Martha wurde blaß und setzte ihre Kaffeetasse ab. »Sprich nicht davon in seiner Gegenwart«, sagte sie eindringlich. »Sag ihm, du hättest Louisa besucht und anschließend hier vorbeigeschaut. Versprich's mir, Victoria.«
Ich verzog das Gesicht. »Von mir aus, in Ordnung.«