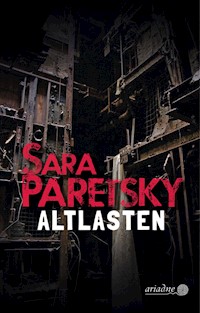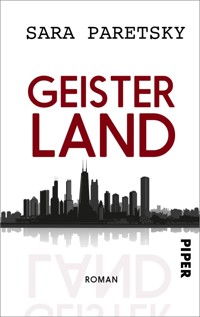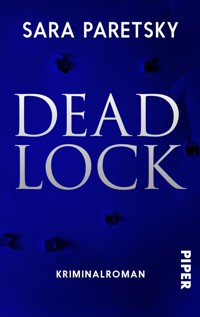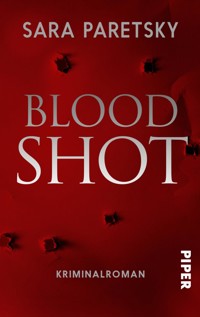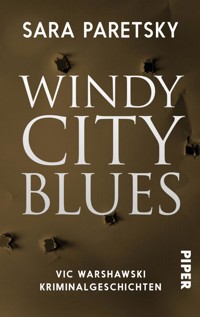19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Die Suche nach einer obdachlosen Musikerin führt Warshawski erneut nach Kansas – und zurück nach Chicago, wo man gut beraten ist, aalglatten Stadtentwicklern nicht in die Quere zu kommen. Denn wo das große Geld im Spiel ist, sinkt der Wert von Demokratie und Menschenleben …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 686
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Impressum
E-Book-Ausgabe: © Argument Verlag 2021
Glashüttenstraße 28, 20357 Hamburg
Telefon 040/4018000 – Fax 040/40180020
www.argument.de
Alle Rechte vorbehalten
Titel der amerikanischen Originalausgabe
Dead Land
© 2020 by Sara Paretsky
Printausgabe: © Argument Verlag 2021
Lektorat: Iris Konopik
Umschlag: Martin Grundmann
Umschlagmotiv: © Alex Powell, pexels.com
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: April 2021
ISBN 978-3-95988-183-8
Über das Buch
Wem gehört die Stadt?
Das Klimpern eines Plastikpianos in einer Unterführung lässt Privatdetektivin V. I. Warshawski nicht mehr los. Auf den Spuren der obdachlosen Musikerin durchstreift sie die Ufermeile am Lake Michigan, wo ein neues Bauprojekt geplant ist. Doch nach einem Eklat bei der Stadtteilversammlung gibt es plötzlich Tote. Wer betreibt hier Stadtentwicklung mit dem Holzhammer? Warshawski bohrt tiefer und stößt auf Intrigen, die sich über Generationen und Kontinente erstrecken. Chicago ist der Ort, wo alles zusammenläuft. Und das alte Credo der Stadt ›Wer blecht, hat Recht‹ erweist sich als mörderisch gegenwärtig.
Chicago, Moloch am Lake Michigan, Hochburg der Wirtschaftswissenschaften: Hier ist Warshawski aufgewachsen, in einem Stadtteil mit Sozialwohnblocks und kleinen Einfamilienhäusern, Industrie- und Gewerbezonen, hoher Kriminalitätsrate, neuerdings gentrifiziert. Die Gemüter sind erhitzt, denn ein Landgewinnungsprojekt am Seeufer soll zügig durchgewunken werden, doch in den Augen mancher Anwohner stinkt die Sache nach dicken Investoren und gekauften Politikern. Als Wirtschaftsermittlerin kennt Warshawski ihr Chicago: Geld wandert von Hand zu Hand, und schon am nächsten Tag sind Gebäude und Parks dem neusten Milliardenprojekt gewichen. Aber was hat die verwirrte Obdachlose damit zu tun, die ihrem Plastikpiano so grandiose Melodien entlockt? Und warum ist sie plötzlich verschwunden, als man im Park eine Leiche findet?
Über die Autorin
Sara Paretsky, eine der renommiertesten Krimiautorinnen weltweit, studierte Politikwissenschaft, war in Chicagos Elendsvierteln als Sozialarbeiterin tätig, promovierte in Ökonomie und Geschichte, arbeitete eine Dekade im Marketing und begann Anfang der 1980er Jahre, den Detektivroman mit starken Frauen zu bevölkern. In der Geschichte der feministischen Genre-Eroberung, die den Hardboiled-Krimi aus dem Macho-Terrain herausholte und zur Erzählung über die ganze Welt machte, gehört Paretsky zu den wichtigsten Vorreiterinnen: Ihre Krimis um Privatdetektivin Vic Warshawski wurden Weltbestseller, mit zahllosen Preisen geehrt und in 30 Ländern verlegt. Sara Paretsky gehört zu den Gründerinnen des internationalen Netzwerks Sisters in Crime, engagiert sich gegen Sexismus und Rassismus und bloggt kritisch zur lokalen und US-Politik.
Sara Paretsky
Landnahme
Kriminalroman
Deutsch von Else Laudan
Inhaltsverzeichnis
Für Martha und Vince Baggetto und Marzena Madej, die mir durch die finsterste Nacht meines Lebens halfen. Wenn es bessere Worte
Vorbemerkung von Else Laudan
V. I. Warshawskis zwanzigster Romanauftritt beginnt mit einer fröhlich entgleisenden Stadtteilversammlung. Es geht in Landnahme um Musik und Politik, um die Metropole und ihre Geschichte, um Prärie und Ackerbau, um das Spannungsfeld Wirtschaft und Demokratie: Wem gehört das Land? Wem gehört die Stadt?
Meisterin Sara Paretsky erzählt in dieser mit schillernden Gestalten bevölkerten Krimi-Oper auch von Verbrechen, die dem rechtsstaatlichen Radar entgehen. Eine Stadt wie Chicago (oder Berlin, oder sonst eine Stadt) ist ein hyperkomplexes Gebilde aus Menschen, Bauten, Infrastruktur, Politik und Zivilgesellschaft, durchsetzt/zersetzt von Gier und Hybris elitärer Eminenzen, die sich am urbanen Lebensraum bereichern und ihn ausbluten, so wie auch das Land, so wie alle Ressourcen des Planeten, rechenschaftsfrei, ohne sanktioniert zu werden – von wem auch? Wer blickt durch, ohne mit drinzuhängen?
Ich lese Landnahme als Ode an die Aufklärung, bin erinnert an das Geschichtswerkstätten-Motto »Grabe, wo du stehst«, ab den 1980ern weltweit Methode gesellschaftspolitischer Geschichtsaufarbeitung. Das Ziel: demokratische Selbstermächtigung durch Zutagefördern der Geschichte der eigenen Lebensbedingungen, um die Deutungsmacht nicht herrschenden Eliten zu überlassen, um sich kollektiv als historische Akteur*innen zu begreifen, um Gegenwart und Zukunft mitzugestalten. Erforscht werden von der dominanten Erzählung marginalisierte Themen und Lebenswelten: Werktätige, Frauen, Randgruppen, Nichtweiße, Geschichten von Unterdrückung und Widerstand. Die Menschen eignen sich das Geschehen in der Gesellschaft an.
Für mich verkörpert V. I. Warshawski diese Maxime so konsequent und zeitgemäß wie kaum eine Gestalt in der Kriminalliteratur. Ihr vehement engagiertes Interesse an den diversen Realitäten treibt sie an. Unabhängig und unermüdlich gräbt sie, wo sie geht und steht, buddelt verdrängte und verschwiegene Wahrheiten aus, kassiert Belehrungen und Blessuren, ohne klein beizugeben, auch wenn sie nicht siegen kann. Möge ihr rechtschaffen forschender Geist einige von uns anstecken. Unsere Welt braucht dringend viele Warshawskis. .
Else Laudan
Hunde des August
14. August
Das anhaltende Klingeln an meiner Wohnungstür weckte mich, dann hörte ich die Hunde. Ich stieg in Jeans und taumelte zur Tür, wo Donna Lutas den Klingelknopf dauerdrückte und schrie: »Kommen Sie endlich aus Ihrem Scheißbett und regeln das hier?«
Ich ignorierte sie, schlüpfte in die Laufschuhe, die ich vor der Tür gelassen hatte, und eilte die Treppen runter, vorbei an einem Spalier erzürnter Nachbarn – einschließlich Mr. Contreras in einem prächtigen magentarosa Pyjama.
Peppy und Mitch, die Hunde, die ich mir mit ihm teile, warfen sich in wilder Aufregung gegen die Eingangstür im Treppenhausflur. Eine kluge Detektivin öffnet um vier Uhr früh nicht die Haustür, wenn eine unbekannte Gefahr auf der anderen Seite die Hunde aufgestört hat, aber Donna Lutas keifte Drohungen, das Baby der Sungs brüllte wie am Spieß, und alle brabbelten wild ihre Ängste durcheinander – sollte man die Polizei rufen? Sollte man die Hunde erschießen?
Ich öffnete die Tür gerade weit genug, um hindurchzuschlüpfen. Ein großer brauner Hund mit vierschrötigem Gesicht und tief besorgter Miene war vorm Eingang an einem Laternenmast angeleint, neben sich auf dem Gehweg eine Papiertragetasche. Um sein Halsband war ein weißer Zettel gewickelt. Ich entrollte ihn und hielt ihn ins Licht der Laterne.
Warshawski –
Sie scheinen mit Hunden umgehen zu können, auch wenn Sie mit Menschen grauenhaft sind. Kümmern Sie sich um Bär, bis ich ihn holen komme.
Coop
Ich joggte die Straße runter, stolperte über meine Schnürsenkel, hoffte zu sehen, in welche Richtung Coop verschwunden war. Sinnlose Aktion: Er hatte seinen Hund an den Laternenpfahl gebunden und sich im Dunkeln verdrückt, noch ehe Mitch und Peppy zu bellen anfingen.
Ich machte kehrt. Bär winselte und leckte sich aufgeregt die Lefzen, als ich zu ihm kam. Ich band die Leine los.
»Na, Junge, was läuft hier?«, sagte ich leise.
Der Hund winselte wieder und strebte den Gehweg entlang. Ich stellte mich kurz auf seine Leine, um mir die Schnürsenkel zuzubinden, dann überließ ich ihm die Führung. Wir waren etwa fünf Blocks weit gelaufen, ehe mir klar wurde, dass er zur South Side wollte, vermutlich zu Coops gewohnter Meile, statt einer frischen Spur zu folgen. Aber als ich versuchte, mit Bär kehrtzumachen, legte er sich auf den Bürgersteig und streikte. Ich bin kräftig, aber nicht stark genug, um einen großen Hund eine halbe Meile zu schleppen.
Ich hockte mich neben ihn. Trotz der warmen Nacht fühlte ich mich nackt in Schlafshirt und Jeans, keine Unterwäsche, keine Socken, kein Telefon, kein Hausschlüssel.
»Wenn Coop dich bei mir lässt, ist er auf sicher nicht zu Hause, Junge. Komm lieber mit mir mit. Wir schlafen ein bisschen und sehen morgen weiter. Machen wir das Beste aus einer Situation, die wir uns beide nicht ausgesucht haben.«
Waren es meine Worte, mein Ton oder die traurige Erkenntnis seines hoffnungslosen Schicksals, jedenfalls stand er auf und trottete neben mir die Straße lang.
»Wie ist ein friedlicher Kerl wie du bloß an so ein explosives Gerät wie ihn geraten?«, fragte ich den Hund.
Ich kannte Coop eigentlich kaum – ich wusste nicht mal, ob das sein Vor- oder Nachname oder bloß ein Spitzname war. Ich hatte keine Ahnung, wo er wohnte, wo er herkam oder wo er vielleicht hinwollte, falls er aus Chicago abgehauen war.
Wir waren uns nur einige Male über den Weg gelaufen, und dabei hatte er sich jedes Mal in weniger als einer Minute von grimmig zu Vulkanausbruch hochgeschaukelt. Vielleicht hatte er ja wirklich Leo Prinz umgebracht und dachte sich, dass ihm die Cops schon im Nacken saßen.
»Nur hätte er dich ganz sicher mitgenommen, wenn er untergetaucht wäre, stimmt’s?«, sagte ich zu dem Hund. »Und wieso gerade ich? Er hat doch klargestellt, dass er mich nicht ausstehen kann. Nicht bös gemeint, aber was soll ich bloß mit dir anfangen?«
Wir erreichten mein Haus. Ich nahm die Tüte mit rein, die Coop dagelassen hatte.
»Noch ein Hund?«, schrie Donna Lutas. Sie stand in ihrer offenen Wohnungstür. »Sie können hier nicht noch einen Hund anschleppen.«
»Ja, Vic«, sagte Mr. Sung. »Es wird zu viel, immer dieses Gebell, und dann wissen wir nie, ob jemand einbricht und Sie erschießen will, aber versehentlich einen von uns trifft.«
Mr. Contreras ist für gewöhnlich auf meiner Seite, aber heute Nacht nicht. Mr. Sung sang nur dasselbe Lied, das auch er oft anstimmte, wiewohl einfühlsamer: Warum warf ich mich kopfüber in gefährliche Situationen? Waren mir denn die Leute, die mich gern hatten, völlig egal?
Peppy und Mitch machten die Sache nicht besser. Als sie sahen, dass ich Bär in den dritten Stock mitnahm, gab es prompt neues Gebell und Gezerre: Keinesfalls sollte irgendein Dahergelaufener die Aufmerksamkeit abgreifen, die ihnen zustand.
»Scheiße, jetzt reicht’s endgültig!«, giftete Lutas. »Morgen früh geh ich zur Hausverwaltung und verlange Ihre Zwangsräumung. Drei Hunde? Wo einer erlaubt ist?« Lutas vertrat unsere Hausgemeinschaft bei der Verwaltung, die das Gebäude betreute. Sie war Junior-Anwältin bei einer der großen Rechtsanwaltskanzleien in der Innenstadt. Sie schuftete neunzig Stunden die Woche wie alle Junior-Anwältinnen. Ich wusste, dass sie unter Schlafmangel litt. Ich wusste auch, dass ich keine ideale Nachbarin war: Erst kürzlich war bei einem Scharmützel mit einem Angreifer ein Treppengeländer zu Bruch gegangen. Trotz alledem brachte ich wenig Verständnis für sie auf – sie war fast geplatzt vor Schadenfreude, als sie mir den Bescheid überbrachte, dass ich allein für die Erneuerung aufzukommen hatte.
Bestimmt würde sie versuchen, mich zwangsräumen zu lassen, und vielleicht schaffte sie das sogar, zumal bei den erbosten Blicken, die mir die anderen Bewohner jetzt zuwarfen.
Aus Coops Tüte zog ich eine Decke, Bärs Futternäpfe und etwas Hundespielzeug. Ich machte ihm einen Platz in der Küche und ging zurück ins Bett, aber ich fühlte mich wie ein zu heftig gestärktes Hemd, steif und unnachgiebig, lauschte, wie Bärs Zehennägel auf den Böden schrammten, als er die Wohnung erkundete. Zuletzt kam er in mein Zimmer und beschnüffelte mich ein paar Minuten, dann seufzte er schwer und ließ sich vor meinem Bett zu Boden fallen.
»Hätte ich doch« ist ein sinnloses Spiel. Aber ich konnte nicht umhin zu denken, ach wäre ich doch meinem spontanen Wunsch gefolgt, meinen Geburtstag mit Peter Sansen und den Hunden auf dem Land mit Wandern zu verbringen – dann wäre das alles gar nicht passiert.
1 South Side Sisters
27. Juli, V. I. Warshawskis Geburtstag
Die Mädchen reihten sich an der Wand auf, ihre Gesichter glänzten vor Schweiß, sie atmeten immer noch schwer.
»Wir hätten gewinnen können, wenn Lureen mal ihren fetten Arsch bewegt und verhindert hätte –«, fing eine von ihnen an, doch Bernie brachte sie zum Schweigen.
»Keine in meinem Team beschimpft eine andere Spielerin. Und bei einem Turnier gibt es nur eine Art, wirklich zu verlieren. Nämlich welche?«
Das Mädchen, das geschimpft hatte, drehte den Kopf weg, aber die anderen sieben riefen im Chor: »Unehrlichkeit.«
»Genau!«, sagte Bernie. »Wenn ihr nicht euer Bestes gebt, ist das unehrlich euch selbst und eurem Team gegenüber. Wenn ihr euer Bestes gebt, habt ihr gewonnen, selbst wenn die andere Mannschaft mehr Punkte gemacht hat. Aus Fehlern lernen wir, n’est-ce pas? Ein Spiel verlieren ist nur dann eine Niederlage, wenn ihr dabei nichts lernt und nicht daran wachst.«
»Ja, Coach.«
»Lauter. Ihr glaubt doch daran!«
»Ja, Coach!«, donnerten sie.
Die South Side Sisters hatten das Spiel gegen die Lincoln Park Lions verloren. Bernie – Bernadine Fouchard – hatte sie für das Spiel trainiert, mit der Inbrunst, mit der sie alles tat. Die Mädchen liebten sie. Sie gewöhnten sich an, in Gesprächen französische Bröckchen einzuflechten, sie ahmten ihre Manierismen nach: wie sie dastand, die Hände in die Hüften gestemmt, wie sie sich mit der Hand an die Stirn schlug und Mon dieu stöhnte.
Bernies Sport war eigentlich Eishockey – wie bei ihrem Vater Pierre und ihrem Taufpaten, meinem Cousin Boom-Boom, beide einst Stars bei den Chicago Blackhawks. Anders als die beiden hatte sie selbst als begnadete Spielerin keine Chance, davon zu leben, also tat sie das Nächstbeste und studierte Sportmanagement an der Nordwestern University, wo sie auch im Eishockeyteam Big Ten spielte.
Diesen Sommer machte sie Praktikum, als Fußballtrainerin in einem Jugendcamp der Chicagoer Parkverwaltung. Als Kind hatte sie genug Fußball gespielt, um die Grundlagen zu kennen. Sie stürzte sich mit derselben Energie in den Sport, mit der sie alles in ihrem Leben anging. Obwohl ihre Kids weder private Trainingscamps noch die anderen Vorteile hatten, die Mädchen in betuchteren Gegenden zugutekamen, inspirierte Bernie sie zu einer Spielweise, die ihrer eigenen Tolldreistigkeit nahekam.
Ich war zur Forty-seventh Street gekommen, um die elfjährigen Sisters beim Endspiel in einem Rundenturnier zu sehen. Ein Stadtteilgremium zur Quartiersaufwertung – der South Lakefront Improvement Council, kurz SLICK – hatte den Sisters Sponsoren besorgt und wünschte, dass sie nach dem Spiel ihren Kotau machen kamen. SLICK hielt hier seine monatliche Versammlung ab; die Mädchen sollten auf dem Flur warten, bis sie reingeholt wurden.
Eine Frau mit rostbraun gefärbten Kringellocken öffnete die Saaltür und steckte den Kopf heraus. »Könntet ihr Mädels mal leiser – ach! Sind das unsere kleinen Fußballerinnen?«
»Ja«, sagte Bernie. »Wir sind ein tolles Team, aber im Warten auf dem Flur sind wir nicht so toll. Wann kommen wir dran?«
»Sehr bald.« Die Frau kicherte, als hätte Bernie einen milde erheiternden Scherz gemacht. Als sie die Tür schloss, hörten wir drinnen eine Männerstimme losbrüllen.
»Du verdammter scheiß Lügner! Wo hast du denn diesen gequirlten Scheißdreck her? Von der Lügen-Uni? In einem seriösen Studium der Umweltwissenschaften hast du das nämlich garantiert nicht so gelernt.«
Die Mädchen hielten sich den Mund zu, um ihr erschrockenes Auflachen zu dämpfen.
Ich ging zur Tür, machte sie auf und spähte hinein. Früher, als das Bankgebäude der Prairie Savings and Loan noch Wahrzeichen von Bronzeville war, hatte dieser Tagungsraum als Gemeindesaal gedient. Es gab eine niedrige Bühne und rund hundertfünfzig Klappstühle, heute zum konzentrischen Halbkreis angeordnet. Die Sitze waren voll belegt, nicht, weil viele Anwohner scharf darauf waren, an einem Sommernachmittag einer Stadtteilversammlung beizuwohnen, sondern weil reichlich Familienmitglieder die Sisters angefeuert hatten und dabei sein wollten, wenn sie ihre Meriten erhielten.
Zwei Männer und eine Frau, alle in gesetzterem Alter, versuchten die Versammlung zu leiten, doch der Schreihals aus dem Publikum hatte sie wohl unvorbereitet erwischt. Einer der Männer hatte einen Richterhammer, mit dem er dauernd auf einen Holzblock einschlug, dabei rief er »Ruhe, Ruhe!«. Die Frau – dünn, drahtig, in einem blauen T-Shirt mit SLICK-Logo – zappelte auf ihrem Stuhl herum und versuchte den Störenfried im Publikum niederzuschreien. Der zweite Mann sah gar nicht auf, er schrieb mit der Hand langsam etwas auf einen weißen Block.
Der Zwischenrufer war ein Weißer um die vierzig, die Haut braun wie altes Leder, in Khakishorts und einem T-Shirt mit einer verblichenen Sonnenblume. Womöglich sogar recht gutaussehend, aber Wut verzerrte seine Züge.
Sein Zorn richtete sich offenbar gegen einen sehr jungen Mann auf der Bühne, der unbeholfen einen Computer auf einem Notenständer balancierte: Wie so vieles an der South Side bot der Saal, wo SLICK Versammlungen abhielt, wenig Ausstattung, es gab kein Podium. Er hatte anscheinend eine Präsentation vorgestellt, bei der es um Landgewinnung an Teilen des Seeufers um die Forty-seventh Street ging, denn an die Wand hinter der Bühne war eine Skizze projiziert: ein Sandstrand, Spielplätze, eine Bar, ein Restaurant.
»Aber, Sir, das ist quasi Teil des ursprünglichen Burnham-Plans, oder jedenfalls ist es das, was Burnham –«
»Scheiße nein, nie im Leben ist das der Burnham-Plan.« Obwohl der junge Mann ein Mikro hatte, übertönte der Zwischenrufer ihn ohne Mühe.
Jetzt stürmte er auf die Bühne los. Der junge Mann erschrak und ließ seine Maus fallen. Als er sich bückte, um sie aufzuheben, krachte sein Computer zu Boden. Das Bild an der Wand verschwand.
Noch ehe der Störer die Stufen erreichte, traten mehrere Leute aus dem Publikum dazwischen und versperrten ihm den Weg. Er rangelte mit ihnen und spie wüste Beschimpfungen sowohl gegen den Redner als auch gegen das Trio, das die Versammlung leitete.
Aus irgendeinem Winkel tauchten zwei Cops auf. Sie drückten dem Mann die Arme auf den Rücken und führten ihn zwischen den Sitzreihen hindurch zur Tür, wo sie mich beiseitestießen. Ein ganzer Wald von Handys stieg auf, um die Szene festzuhalten.
Ein Großteil des Publikums hatte den Cops applaudiert, aber vereinzelt erhoben sich Rufe zugunsten des Störers. »Lasst ihn doch sprechen!« »Lasst ihm etwas Luft!« »Hey, die ganze Welt schaut zu!«
Der Mann mit dem Richterhammer hieb weiter auf den Holzblock ein. Im Flur hinter mir sahen die Mädchen offenen Mundes zu, wie die Cops den Unruhestifter aus dem Gebäude schleiften. Als sie außer Sicht waren, brach unter den Fußballerinnen erregtes Geschnatter aus, das Bernie nicht zu dämpfen versuchte.
»Das ist Leo, den er da attackiert hat«, sagte sie zu mir. »Gut, dass die Polizei ihn festgenommen hat!«
»Leo?«, echote ich.
»Er arbeitet diesen Sommer für SLICK. Er hat mir die Zeremonie für mein Team organisieren geholfen. Diese Attacke braucht er jetzt echt nicht.«
Sie schob ihre Spielerinnen in den Saal, wo sie sich hinter der letzten Sitzreihe drängten.
Die Frau vorn marschierte jetzt auf der kurzen Bühne auf und ab und schlug sich mit einem hölzernen Zeigestab in die offene Handfläche, als wäre es der Offiziersstab eines Feldmarschalls. »Unser Gremium hat sich dem Schutz des Sees und des Seeufers verschrieben«, rief sie. »Alles, was mit dem Lake Michigan zu tun hat, prüfen wir besonders sorgfältig. Ich lebe an der South Side, seit ich neunzehn bin, ich habe hier drei Kinder großgezogen. Ich habe diesem Stadtteil und dem Seeufer mein Leben geweiht. Ich hasse diese Berufsprotestler, die hierherkommen und alles umschmeißen wollen.«
»Jawohl!«, rief der Hammermann. »Berufsprotestler raus.«
Der zweite Mann auf der Bühne sah immer noch nicht von seinen Papieren auf.
»Wir brauchen eine Abstimmung, um den Planungsstand so abzusegnen, wie Leo ihn vorgestellt hat.« Die Frau schlug mit ihrem Zeigestab so hart auf den Tisch, dass der Notizenmann seinen Stift fallen ließ.
»Aber ich bin noch gar nicht fertig«, wandte Leo ein.
»Schon gut, Söhnchen«, dröhnte der Hammermann. »Wer Einzelheiten wissen will, findet sie ja auf der Internetseite von SLICK.«
Eine weißhaarige Frau vorne im Saal stand auf. »Ich bin keine Berufsprotestlerin, Mona. Ich lebe schon länger an der South Side als du, ich hab hier Kinder großgezogen, wobei ich nicht weiß, was das mit dem Schutz der Ufermeile zu tun haben soll. Egal, ich weiß auch ein bisschen was über demokratische Strukturen. Wir können hier nicht über ein Vorhaben abstimmen, von dem wir nicht mal die Einzelheiten kennen.«
»Sie haben gar nicht das Wort, das Podium hat Ihnen nicht das Wort erteilt«, röhrte der Hammermann, die Backen gebläht vor Empörung.
Neben mir runzelte Bernie die Stirn, irritiert darüber, wie die Versammlung sich entwickelte. »Das ist nicht korrekt. Wieso lassen sie Leo nicht weiterreden?«
Ich versuchte nicht, das zu beantworten. »Jetzt wär ein guter Zeitpunkt dafür, dass deine Mädchen ihre Ehrung bekommen. Sonst wird die Versammlung vollends zur Posse, und deine Kids sind vergessen.«
Idee und Durchführung gehen bei Bernie Hand in Hand. Sie blies einen gellenden Pfiff auf ihrer Trillerpfeife. Im Saal wurde es still. Sie nickte ihrem Team zu, und singend marschierten sie zur Bühne.
»Die South Side Sisters treten an zum Spiel
Und wo wir am Start sind, komm’ wir auch zum Ziel.
Wir ha’m gespielt mit voller Kraft
Diese Prüfung ist geschafft
Wir sind die Champs!
Also vergesst
den ganzen Rest.«
Die Mädchen stellten sich vor dem Tisch auf. Sie stampften, wirbelten und vollführten eine pfiffige Choreografie mit den Armen. Das Publikum brach in spontanen Beifall aus, alle waren erleichtert, das Hickhack über die Pläne für die Ufermeile auszusetzen.
Mona trat an das Mikro, wo Leo gesprochen hatte, sagte zu den Mädchen, sie seien eine Ehre für die South Side, erging sich über den Wert harter Arbeit und Zielstrebigkeit und bedachte jede Einzelne mit einem Zertifikat und einer roten Rosette. Ein anderer Sponsor, eine ansässige Pizzeria, teilte Gratis-Coupons für Pizza aus, dann marschierten die Mädchen von der Bühne und sangen wieder ihr Lied, lauter als zuvor. Die Familien folgten ihnen nach draußen. Binnen weniger Minuten war nur noch gut ein Dutzend Leute im Saal. Ich blieb stehen, um die weißhaarige Frau zu fragen, worum es hier eigentlich ging.
Sie schüttelte den Kopf. »Das wüsste ich selber gern. Alle wollen bei dem Wirtschaftsboom mitverdienen, der angeblich auf die South Side zukommt, sobald das Obama Center aufmacht, aber dieser Landgewinnungsentwurf kam doch sehr plötzlich auf den Tisch. Mona und ihre Bande verkaufen ihn uns als edelmütige Geste zum Wohle des Stadtteils, samt nagelneuem Strand wie dem, den sie an der Thirty-first Street angelegt haben. Aber selbst wenn, sollten sie so was nicht ohne öffentliche Anhörung durchziehen, und wir hören heute zum ersten Mal davon.«
Sie brach ab und musterte mich scharf. »Welches Interesse verfolgen Sie dabei?«
»Bin bloß neugierig. Ich bin an der South Side aufgewachsen und erinnere mich noch dunkel an SLICK aus der Zeit, als die South Works-Stahlfabrik dichtgemacht wurde. SLICK hatte damals einen Umnutzungsplan für das Gelände, aber ich glaube, für die Finanzierung wurden dann keine Mittel bewilligt.«
Die Frau schnitt eine Grimasse. »Immer dasselbe Lied, wenn’s darum geht, dass die Stadt an der South Side investieren soll. Große Pläne, aber nichts kommt je dabei raus. Das Gleiche könnte auch diesem kleinen Strandprojekt blühen. Nur Coop – der Kerl, der eben abgeführt wurde – glaubt anscheinend, dass da noch mehr dahintersteckt. Oder vielleicht stemmt er sich einfach gegen jede Veränderung an der Ufermeile. Das geht ja einigen so.«
»Wer ist denn Coop?«
»Man könnte ihn schon einen Berufsprotestler nennen, nur würde das unterstellen, dass ihn jemand dafür bezahlt. Aber in Wahrheit weiß niemand genau, wer er ist. Er ist vor einem Jahr oder so mit einem großen Hund aufgetaucht. Wie es aussieht, bringt er sein Leben damit zu, mit ihm die Ufermeile auf und ab zu wandern. Ansonsten sitzt er viel in der Bibliothek und studiert die Geschichte der Lakefront-Parks – über den Burnham-Biotopkorridor weiß er mehr als ich. Und wesentlich mehr als Mona und ihre Kumpel, nebenbei bemerkt.«
»Die Versammlung wirkte etwas chaotisch«, sagte ich. »Ist Leo zuständig für die Planung bei SLICK? Hat er deshalb die Präsentation gehalten?«
Sie verzog das Gesicht. »Oh, nein. Bei SLICK herrscht eigentlich immer so ein Chaos. Sie haben irgendwelche Fördermittel dafür gekriegt, ihre Karten und Unterlagen zu digitalisieren, und das macht Leo für sie. Mona hat erst versucht, die Präsentation selber zu machen, aber sie kommt überhaupt nicht mit Power Point zurande und hat’s auch nicht geschafft, ihre Anmerkungen mit den Folien zu koordinieren. Es wäre komisch gewesen, wenn es nicht so erbärmlich wär, aber sie mussten den Jungen bitten, das zu übernehmen.«
Jetzt war ich froh, dass ich bei dem Teil der Versammlung nicht dabei gewesen war. Ich fragte mich, welche Rolle die Frau vor mir spielte – offenbar kannte sie sich mit den Plänen der Parkbehörde ganz gut aus.
»Ich bin bloß Anwohnerin. Und es stinkt mir, dass SLICK sich hier zum Sprachrohr der Parkbehörde macht, ohne die Wünsche der Stadtteilbewohner einzubeziehen. Diese Landgewinnung mag ja ’ne ganz gute Idee sein, aber es ist wie bei allem in dieser Stadt – null Transparenz. Entscheidungen fallen bei privaten Treffen, wo Geld von Hand zu Hand geht. Ich lebe seit dreiundfünfzig Jahren hier. Ich hab es satt.«
Sie buchstabierte mir ihren Namen, Nashita Lyndes. Ich reichte ihr eine meiner Visitenkarten, die mich als Detektivin auswies.
»Detektivin?« Ihre Miene erhellte sich. »Sind Sie hier, um etwas über die Pläne der Stadtverwaltung auszugraben?«
»Tut mir leid, Ms. Lyndes: Ich bin bloß wegen der Fußballerinnen hier. Aber um was über die Pläne der Stadtverwaltung auszugraben, bräuchte es mindestens einen atomgetriebenen Schaufelbagger. Eine normale Dampfmaschine kann da gar nichts ausrichten.«
2 Barbaren
Bernie war in den Saal zurückgekommen, nicht auf der Suche nach mir, sondern um mit Leo zu sprechen. Sie schien ihn von irgendwas überzeugen zu wollen; er betrachtete die SLICK-Führungsriege und schüttelte bedauernd den Kopf.
»Manche Leute haben einfach kein Rückgrat«, knurrte sie, als sie hinten im Saal zu mir stieß.
»Und du fühlst dich wohl zuständig, ein paar Knochenzellen zu injizieren, um das Wachstum zu stimulieren?«, fragte ich sardonisch.
»Wenn das bloß gehen würde!«
Bernie rannte los, um ihr Team einzuholen, das auf dem Weg zum Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Forty-seventh Street war. Ich folgte ihr langsamer. Sie musste noch sicherstellen, dass ihre Mädchen nur mit befugten Erwachsenen abzogen.
Als sie damit durch war, ließ sie Mundwinkel und Schultern hängen. »Diese Mädchen, neun Wochen lang waren sie mein ganzes Leben, und jetzt? Puff! Aus und vorbei, weg sind sie, als wäre nie was gewesen.«
»Du fängst doch nächste Woche ein neues Programm an, oder?«, fragte ich.
»Ja, an der West Side. Ich hab gebettelt und gefleht, um bei diesen Mädchen zu bleiben, aber von der Parkbehörde gibt’s kein Geld mehr für solche Maßnahmen.«
Ich teilte ihre Empörung. Die Stadt hatte genug Mittel für Landaufschüttungen und einen neuen Strand, aber für ein Team aus afroamerikanischen und Latina-Mädchen war nichts übrig.
»Und gehen sie nicht noch Pizza essen? Geh doch mit – sie beten dich an, bestimmt hätten sie dich gern dabei.«
»Das ist nicht organisiert. Manche gehen heut Abend mit ihren Familien hin, andere heben sich die Gutscheine für später auf.«
»Peter spendiert mir vor dem Essen noch einen Geburtstagsdrink bei Sal. Lust, mitzukommen?«
Peter Sansen war der Archäologe, mit dem ich seit ein paar Wochen ausging. Und meiner alten Freundin Sal gehörte die Bar Golden Glow.
»Dein Geburtstag! Ma foi – je suis un crétin! Ich hab’s vergessen. Natürlich komm ich mit.« Sie grinste schurkisch. »Und danach bin ich taktvoll und lasse euch beide alleine Essen gehen. Außerdem wollen Angela und ich nachher noch mit den anderen zum Inlineskaten.«
Angela Creedy, Basketballerin an der Northwestern-Uni, teilte sich mit Bernie und zwei anderen Sportstudentinnen eine Wohnung in einem wackligen alten viktorianischen Haus.
Auf dem Weg zum Auto unterhielt mich Bernie mit einer Replik ihrer ausgefuchsten Strategien bei dem heutigen Spiel.
Einst hatte die Forty-seventh Street gewimmelt von Bars und winzigen Läden, die das Einzugsgebiet Bronzeville versorgten, als die Banken im Loop Afroamerikaner nur abzockten und die Innenstadtgeschäfte ihnen den Zutritt verwehrten – außer natürlich als Putzkräfte. Jetzt prangten hier neue Wohnblöcke, riesige unpersönliche Kettenfilialen, Fitnessstudios und ein gigantischer Spirituosenmarkt, der das Sterben der alten Bars noch beschleunigt hatte.
Häuser und Läden endeten an den Bahnschienen der Illinois Central Railroad, der östlichen Grenze des Stadtteils, doch die Straße führte unter den Schienen hindurch noch ein Stück ostwärts und mündete in einer Auffahrt zum Lakeshore Drive. Zwischen dem Drive und dem Gleisbett lag ein schmaler Streifen Land, der allmählich wieder zu Prärie wurde; dort gab es auch einen Parkplatz, wo ich meinen Wagen abgestellt hatte.
Als wir in die Unterführung eintauchten, vernahmen wir eine Art hohles Klimpern wie von einem Xylofon, willkürlich dissonant, verstörend.
Um diese Zeit, sechs Uhr, war hier alles voll mit joggenden, radfahrenden, picknickenden Leuten, denn der Tunnel führte zu einer Fußgängerbrücke, die den Drive überquerte. Eine Person mit Kopfhörern, die einen Sportbuggy mit Baby vor sich herstieß, rannte in mich hinein und beschimpfte mich lautstark. Ich trat dichter an einen der Pfeiler heran und sah schließlich auch, wo die Musik herkam: Eine vermummte, in Grau gehüllte Gestalt beugte sich über ein kleines rotes Plastikpiano wie das von Schroeder bei den Peanuts. Und genau wie Schroeder holte die Gestalt ein erstaunliches Klangspektrum aus diesem Spielzeug heraus.
Als ich am früheren Nachmittag hier langgekommen war, hatte ich sie nicht gehört, aber es war erkennbar, dass sie hier ständig hauste. Vielleicht hatte sie vorhin noch geschlafen, ihre grauen Lumpen mochten mit dem grauen Hintergrund verschmolzen sein.
Ich versuchte Bernie weiterzuziehen, aber sie lauschte mit großen Augen gebannt dem unheilvollen Rhythmus, den die Pianistin auf der tiefsten Oktave ihres Instruments hämmerte.
»Hör mal hin«, forderte sie. »Das ist doch ›Savage‹.«
Ich schüttelte verständnislos den Kopf.
»Wie kannst du das nicht kennen? Das ist der größte Song der letzten zehn Jahre, es geht um diese indianische Häuptlingsfrau. Sie hieß Anacaona, und die Spanier haben sie ermordet, als sie nicht ihre Hure sein wollte. Meine gesamte Highschool hat das am First Nations Day gesungen, aber es geht um viel mehr als nur das. Es geht um Frauen, und wenn wir eine Demo machen, gegen Vergewaltigung oder gegen die schrecklichen Incel-Frauenhasser, dann trommeln wir und singen diesen Song. Wer kommt darauf, jetzt und hier dieses Lied zu spielen? Gibt es eine Demo? Sollen wir mitmarschieren?«
Bernie versuchte mitzusingen, aber sie traf weder Ton noch Rhythmus. Alles, was ich ihrem atonalen Singsang entnehmen konnte, waren die Wörter ›Barbaren‹ und ›brutal‹.
Unvermittelt fuhr die Pianistin das Tempo runter. Die Musik glitt nahtlos aus einem Afro-Pop-Beat in einen getragenen Drei-Halbe-Takt. Nach ein paar Takten meinte ich etwas zu erkennen, das nach dem Lamento aus Purcells Dido und Aeneas klang. Ich fing an zu singen: »Remember me, remember me, but ah! forget my fate –«
Bernie unterbrach mich. »Nein, nein, so geht das nicht. Es heißt: ›Remember me and don’t forget my fate.‹ Wir sollen sie ja eben nicht vergessen!«
»Tut mir leid«, sagte ich kleinlaut. »Ich hab Purcells Fassung gesungen. Wer hat die Fassung geschrieben, die du kennst?«
»Lydia Zamir. Erst war sie bloß irgendeine Musikerin, aber dann fing sie an, Songs über Frauen zu schreiben, weißt du, für #MeToo und so. Sie war in diesen Mann verliebt, und sie reisten zusammen zu allen möglichen Kundgebungen, und dann wurden sie bei einem von diesen grässlichen Massenmorden erschossen. Irgend so ein crétin mit zu vielen Waffen hat sie einfach abgeknallt.«
Bernie funkelte mich an, als wollte sie, dass ich auf der Stelle das Problem der Kretins mit zu vielen Waffen löste.
Als ich nichts sagte, fügte sie hinzu: »Es ist echt schräg, Zamirs Musik so zu hören, in einer Unterführung mitten in Chicago.«
Ich trat langsam auf die vermummte Gestalt zu – ich ging davon aus, dass es eine Frau war, weil der Körper so schmächtig wirkte, aber genau sagen konnte ich es nicht. Ich kam dicht genug heran, um zu erkennen, dass es sich um einen Mini-Flügel handelte, die winzige Klaviatur nur ein paar Handbreit über dem Boden. Der rote Plastikkorpus war bestoßen und gesprungen. Als ich mich hinhockte, um nach der Musik zu fragen, krabbelte die Gestalt hastig rückwärts weiter in den Tunnel und umklammerte ihr Piano.
Bernie legte unwillkürlich die Finger an den Mund. »O nein – sie hat Angst. Ich wollte sie doch fragen, woher sie diese Musik kennt. Vielleicht war sie eine Freundin von Zamir – das wäre das reinste Wunder!«
Sie schob sich vorsichtig näher, als pirschte sie sich an ein Eichhörnchen im Wald heran, aber die Frau heulte auf und drehte uns den Rücken zu.
Eine Radfahrerin hielt neben uns an. »Das ist doch hier kein Zoo, wo Sie die Tiere anstarren können. Das ist eine Frau, die ein Recht auf ihre Privatsphäre hat.«
»Aber sie spielt hier in der Öffentlichkeit«, wandte Bernie ein. »Ich will sie gar nicht wie ein Museumsstück behandeln, aber sie kennt einen wichtigen Song. Warum soll ich sie nicht fragen, wo sie den herhat?«
»Weil sie nicht mit Ihnen reden will. Ihre Körpersprache macht das doch wohl deutlich.« Die Radlerin baute sich zwischen der Frau und Bernie und mir auf.
»Kennen Sie sie?«, fragte ich. »Sie wirkt hier sehr angreifbar. Wär’s nicht besser, ihr Hilfe zu besorgen – medizinische Versorgung, einen Schlafplatz?«
Die Radfahrerin verzog verächtlich den Mund. »Sind Sie eine mobile Sozialarbeiterin? Sie will nicht in eine Einrichtung.«
»Sind Sie eine mobile Hellseherin?«, fragte ich. »Sie empfangen die Gedanken und Wünsche dieser Person und tun sie der Welt kund?«
Ihre Nasenflügel blähten sich. »Sie halten sich vielleicht für witzig, aber Sie haben keine Ahnung. Wer sie kennt, lässt sie in Ruhe. Dass Sie sie behelligen wollen, heißt, dass Sie sie nicht kennen.«
»Was ist hier los, Judith?« Von der Seeseite der Unterführung war ein Mann aufgetaucht, ein Hund trottete hinter ihm her. Der Mann trug Khakishorts und ein T-Shirt mit dem Umriss einer verblassten Sonnenblume darauf. Als er stehen blieb, um mit der Radfahrerin zu sprechen, setzte der Hund sich hin und starrte mit großen traurigen Augen zu mir hoch.
»Das sind bloß zwei Möchtegerns.« Judith nickte in Bernies und meine Richtung. »Meinen es vielleicht sogar gut, aber kein Respekt.«
»Wir sind keine Möchtegerns«, rief Bernie. »Und wir respektieren die Klavierspielerin. Aber diese Judith hier, die bildet sich ein, es ist ihr Job, zu verhindern, dass die Welt von dieser Musik erfährt. Und was Sie angeht, Sie kenne ich doch von der Versammlung eben, da haben Sie Leo attackiert. Vielleicht sollten Sie sich mal um Ihren eigenen Kram kümmern!«
»Ja«, sagte ich. »Hat die Polizei Sie nicht erst vor einer Stunde aus der SLICK-Versammlung abgeführt?«
Er rammte sich die Faust in die Handfläche. Der Hund beobachtete ihn, die Nackenhaare aufgestellt. »Sagen Sie nicht, Sie gehören zu Mona Borsas Handlangern. Was hat sie vor, sollen Sie mich jetzt beschatten –«
»Sie sind nicht wichtig genug, als dass ich Sie beschatten würde. Sie sind kaum wichtig genug, um mit Ihnen zu reden«, blaffte ich. »Hier hockt eine begabte Musikerin, lebt im Elend, und Ihre Freundin Judith hat sich zu ihrem Sprachrohr ernannt. Ich will wissen, ob sie ärztliche Versorgung braucht –«
»Und ich, ich will unbedingt wissen, woher sie den Song ›Savage‹ kennt«, unterbrach mich Bernie.
»Und keine von euch hat das Recht, sie zu nerven. Wir kümmern uns schon um sie!«, rief Coop erbost.
»Na, das machen Sie aber lausig«, sagte ich. »Zunächst mal braucht sie Essen, Kleidung, ein Bad und ein richtiges Bett. Außerdem gebührt ihr ein richtiges Klavier. Nur eine wahre Künstlerin holt aus einem miesen Plastikdingsbums solche Töne raus.«
»Und was bitte geht Sie das an? Sind Sie vielleicht Talentscout?«, höhnte Coop.
Judith sagte: »Die Stadt wimmelt offenbar von Sozialarbeitern, die genau wissen, was das Beste für Leute ist, ohne sie je zu fragen. Wann immer jemand diese Frau ins Asyl oder ins Krankenhaus steckt, haut sie ab.«
»Hat sie einen Namen?«, fragte ich.
»Kann sein, aber das geht Sie nichts an. Sie brauchen nur zu wissen, dass sie auf die meisten Menschen allergisch reagiert, ganz besonders auf Fremde. Sie lässt sich von Coop Essen bringen, sie vertraut Bär. Manchmal traut sie auch mir. Sie können sich also beruhigen und Leuten helfen gehen, die Ihre Hilfe wollen.«
Bär war vermutlich der Hund.
»Wir sind keine Sozialarbeiter«, protestierte Bernie verärgert. »Ich bin Eishockeyspielerin und Fußballtrainerin, und Vic hier ist Detektivin. Wenn die Polizei –«
»Detektivin?«, brüllte Coop. »Dann hat Mona Borsa endgültig den Bogen überspannt. Sie hat gewusst, die Polizei kann mich nicht festnehmen, nur weil ich auf der Versammlung widerspreche, also hat sie Sie als bezahlte Provokateurin –«
»Schluss jetzt!«, rief ich. »Sie können mich jederzeit fragen, wer ich bin und was ich hier tue, aber mir gehen Sie nicht ohne Fakten an die Gurgel. Ich bin nicht der unerfahrene Junge, den Sie bei der SLICK-Versammlung zerlegt haben, also machen Sie halblang.«
Bär, der Hund, blickte von Coop zu mir, unsicher, ob er eingreifen musste. Er stand auf und stellte sich zwischen uns. Ich trat ein paar Schritte zurück.
»Sie wurden gar nicht festgenommen?«, sagte Bernie zu Coop. »Warum nicht?«
»Erster Zusatzartikel«, sagte ich knapp. »Meinungsfreiheit. Auch wenn er gebrüllt hat, er hat niemanden angefasst.«
»Wenigstens sind Sie ’ne Schnüfflerin, die das Gesetz kennt, aber was verdammt hatten Sie bei der Versammlung zu suchen, wenn Mona Borsa Sie nicht auf mich angesetzt hat?«
»Wissen Sie was? Meine Welt dreht sich nicht um Sie. Aber Ihr Gewüte verstört genau die Person, die Sie angeblich beschützen.«
Auch wenn einige Passanten einen Bogen um uns machten, hatten wir Gaffer angelockt. Ob es am Gezänk zwischen Coop und mir lag oder am Starren der Leute, jedenfalls presste sich die Pianistin so dicht wie möglich an die Mauer, umklammerte ihr Piano und wimmerte.
»Dabei will ich doch nur mit ihr über Musik reden«, sagte Bernie.
»Lass es.« Die Frau namens Judith hatte geschwiegen, als Coop und ich stritten, jetzt wandte sie sich an Bernie. »Sie ist schlimm verletzt worden, und sie spürt keinen Unterschied zwischen Fremden, die es gut meinen, und Fremden, die ihr wehtun wollen.«
Ihr Tonfall war immer noch überheblich, aber was sie sagte, ergab Sinn. Ich legte Bernie den Arm um die Schultern. »Da ist was dran, piccola. Hier sind zu viele Leute, und wir geraten nur alle aneinander. Komm, wir gehen ins Glow.«
Bernie ließ sich von mir weiterschieben, aber nur widerstrebend. Am Ende der Unterführung blieb sie stehen und blickte zurück. Coop und Bär hockten dicht neben der Pianistin, die langsam wieder in ihr Nest aus Decken und Kartons kroch.
Judith wartete etwas abseits, während die Frau die Beine ihres Plastikpianos justierte, bis es stabil stand. Als sie wieder zu spielen anfing, radelte Judith weiter; die Menge löste sich vollends auf. Bernie lauschte konzentriert.
»Den Song kenne ich auch!«, sagte sie schließlich. »Glaube ich jedenfalls.«
Sie fing auf ihre atonale Art an zu singen:
»Die Kunst des Liebens
ist die des Todes
das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, nicht Hass
das Gegenteil von Liebe ist einsam
ein einsamer Schwan.«
»Das Lied ist wunderschön, aber so – so mélancolique, oder, Vic?«
»Sehr«, stimmte ich zu, aber ich lauschte gebannt dem Piano: In den krachenden Beat auf der tiefen Oktave webte die Pianistin die Melodie von Griegs ›Schwan‹: ein Lied, das meine Mutter früher gern gesungen hatte.
3 Traders Traum
Bernie verließ mich vor dem Glow. Sie hatte die ganze Fahrt über den Vorfall geschmollt, weniger wegen der obdachlosen Musikerin, mehr wegen Judiths und Coops selbstgerechtem Auftreten.
»Und du – wieso hast du mir nicht geholfen, an ihm vorbeizukommen, um mit ihr zu reden? Sie ist doch nicht sein Eigentum, enfin. Wirst du auf deine alten Tage zu zaghaft, um dich für das Richtige gerade zu machen?«
»Kann schon sein. Alt und voller Zipperlein, vielleicht auch Moder in den Knochen, deshalb knirschen meine Gelenke, die Schnelligkeit lässt nach. Aber vergiss bitte nicht, dass ich mir einen Nachmittag freigenommen habe, um deine South Side Sisters anzufeuern. Du könntest dich bedanken, statt mich anzupöbeln, nur weil ich eine Frau in Ruhe lasse, die vor Schmerz geheult hat, als ich mich zu nähern versuchte.«
»Ja, danke, Vic«, sagte Bernie in hölzernem Ton. »Meine Mädchen haben sich gut geschlagen, sie waren das Anfeuern wert. Trotzdem bin ich nicht in Stimmung für Geselligkeit mit dir und deinen Freunden. Die werden alle deiner Meinung sein, und dann werde ich erst recht sauer und es gibt dick Streit, was an deinem Geburtstag nicht sein soll.«
»Wir Alten haben gar nicht genug Energie, um uns mit dir zu streiten, Bernie, aber geh ruhig nach Hause. Grüß Angela.«
Bernie küsste mich kurz auf die Wange zum Zeichen, dass sie nichts nachtrug, und lief zur Bahn.
Im Glow stand Peter Sansen an der Bar und sprach mit der Eigentümerin Sal Barthele. Sein Gesicht hellte sich auf, als er mich sah, was meinen Missmut prompt verfliegen ließ.
»Herzlichen Glückwunsch, du Schöne. Sal hat extra für dich einen Cocktail erfunden.«
Sal warf ihrer Tresenchefin Erica einen Blick zu, drehte sich zu einer bereitstehenden Flaschensammlung um, schüttete und mixte. Erica ging inzwischen zur Anlage. Genau als Sal mir ein Glas kredenzte, erklang Piafs kehlige Stimme: »Je ne regrette rien.«
»Ist doch ein guter Einstieg in ein neues Lebensjahr, Warshawski: Bereue nichts.«
Ich lehnte mich über den Mahagonitresen, um sie zu küssen, und sah, dass sie mit Bourbon hantiert hatte. Den mag ich sonst nicht, aber der Cocktail war eine perfekte Balance aus Süß, Sauer und Bitter.
»Lass dir den schleunigst patentieren«, sagte ich. »Der ist bewusstseinsverändernd. Nicht, dass einer von deinen findigen Börsianern das Rezept klaut und sich die Lizenz sichert.«
Das Golden Glow liegt bloß zwei Querstraßen entfernt von der Chicagoer Börse, und nach der Schlussglocke ist es gewöhnlich ein, zwei Stunden voller Broker, die ihre Gewinne feiern oder ihre Sorgen ertränken. Wir befanden uns jetzt zwischen dieser Welle und der etwas kleineren, die kam, wenn die Theater- und Kinovorstellungen aus waren. Peter trank einen anderen von Sals berühmten Cocktails, ›Traders Traum‹, der hatte schon so manche törichte Investitionsentscheidung auf dem Gewissen.
»Hat Bernie sich gut gemacht als Coach?«, fragte Sal.
»Beachtlich«, sagte ich. »Inbrunst und Schneid – unschlagbare Kombi. Der stressige Teil kam erst später.«
Während ich von der turbulenten Stadtteilversammlung erzählte, kam Murray Ryerson rein. Sal hat extra seinetwegen Dark Lord-Bier da, und als er den Tresen erreichte, hatte sie ihm eine Flasche geöffnet.
»Was war denn bei der SLICK-Versammlung los?«, fragte Murray. »Sollte der junge Reporter davon wissen?«
»Ich glaub kaum, dass es auf dem Global-Radar anschlägt.«
Murray hatte mal zur Spitzenliga des investigativen Journalismus im Mittleren Westen gehört. Er schrieb für den Herald-Star, bis der Konzern Global Entertainment den Star schluckte. In gewisser Weise berichtet er zwar immer noch über Politik, solange die Herausgeber nicht befürchten, dass sein Beitrag ihren Kumpels an der Macht schaden könnte, aber hauptsächlich verzapft er Chicago-Larifari für den lokalen Kabelsender von Global.
»Die Parkbehörde will an der Forty-seventh ein Stückchen vom See aufschütten, um einen Strand zu schaffen«, erläuterte ich. »Ein hochgradig wutentbrannter Typ namens Coop hat dann etwas Würze in die übliche Langeweile gebracht. Aber was mir wirklich nachgeht, ist diese Klavierspielerin, über die Bernie und ich danach gestolpert sind. Sie hat auf ein Spielzeugpiano à la Schroeder eingehämmert, als wär’s eine Trommel, aber dabei echt Musik rausgeholt. Das Ungewöhnlichste war die Art, wie sie bekannte Melodien aus dem Klassik-Repertoire mit einem Rhythm and Blues-Sound verwoben hat. Purcell und Grieg hab ich jedenfalls erkannt.«
»Ach, komm«, meinte Murray abfällig. »So was soll sie auf einem Peanuts-Klavier gebracht haben? Ihr wart zur Stoßzeit in einer belebten Unterführung. Du hast bloß gehört, was Bernie dir suggeriert hat, nicht was eine Obdachlose auf einem Stück Plastik raushaut.«
Ich fuhr auf. »Mach nicht vor anderen Leuten den Klugscheißer, Murray. Yo-Yo Ma könnte auf dem Börsenparkett auf einem Teekistenbass Bach spielen, und jeder würde es sofort erkennen. Aber Bernie kannte bei einem Song den Text, da geht’s um eine Frau, die im fünfzehnten Jahrhundert von den Spaniern ermordet wurde. Sie war wohl Anführerin eines Volks, auf das die Spanier bei ihrer Ankunft stießen. Ich gestehe, ich hab noch nie von ihr gehört, aber ihr Name klang ein bisschen wie Ancona.«
»Anacaona«, sagte Sal prompt. »Aus Hispaniola. Wo sie vor dem Eintreffen der Europäer so primitiv waren, dass Frauen regieren konnten. Meine Schwester und ich sind mit der Geschichte aufgewachsen. Die Spanier wollten ihr Gold und ihr Land. Als sie sich zur Wehr setzte und verlor, ließen sie ihr die Wahl zwischen Prostitution und Tod. Sie wählte den Tod.«
Sal und ihre Schwestern waren in Chicago geboren, aber ihre Eltern waren haitianische Emigranten.
»Wenn du heute hinfährst, siehst du kaum noch eine Spur von den ursprünglichen Einwohnern«, fügte sie hinzu. »Es fällt auch schwer, sie sich vorzustellen, denn alle Leute da sind entweder wie ich Nachfahren von Afrikanern, die es dort 1492 noch nicht gab, oder von Europäern. Es ist verstörend, als ob du ständig einem Geist auf die Füße trittst.«
Murray scrollte indessen auf seinem Handy herum. »Scheint, als wär der Song, den Bernie da erkannt hat, ›Savage‹ von Lydia Zamir.«
Er reichte sein Telefon an Sal weiter, die es zu ihrer Anlage hinter der Bar trug. Noch lief ›The Albatross Song‹ von Patricia Barbers Album Higher. Am Ende des Stücks stöpselte Sal Murrays Handy ein und drehte die Lautstärke hoch. Der Klang eines Konzertflügels erfüllte die Bar, ominöse Akkorde rumpelten in den Tiefen des Bassregisters. Aus den Höhen schossen einzelne Töne herab, wie ein Kolibri in Blüten taucht und wieder zurückschnellt. Und dann stimmte ein tiefer Alt den Song an, den Bernie nicht hatte singen können:
Anacaona, queen and chief (Anacaona, Königin)
You were a savage (Du warst Barbarin)
Yes, a savage. (Ja, Barbarin.)
You couldn’t comprehend (Du konntest nicht glauben)
Why the Spanish took your land (Dass die Spanier euer Land rauben)
You were too savage Warst (einfach zu barbarisch)
For European law and rule. (Für europäisches Recht und Tribunal.)
To a savage we seem cruel (Euch Barbaren erscheinen wir brutal)
We landed on your shore (Wir eroberten all eure Plätze)
Cried: ›Choose death or be our whore!‹ (›Wähle: Stirb oder sei unsre Metze!)‹
We killed because (Wir töteten, denn)
We are so savage. (Wir sind barbarisch.)
Am Ende des Refrains glitt der Flügel wie bei der Frau in der Unterführung mit ihrem Plastikpiano in den düster getragenen Rhythmus von Purcell. Der Gesang brachte für ein paar Takte die Zeile »Remember me, but announce my fate«, dann, während das Klavier bei Didos Klage blieb, heulte die Sängerin das Wort »Savage«, wieder und wieder.
Die Lautstärke und Intensität der Musik hatte alle Gespräche zum Schweigen gebracht. An mehreren Tischen winkte man nach der Rechnung. Eine Frau stakste auf ihren Stilettos zur Tür und sagte: »Ich geh in eine Bar, weil ich was trinken will, nicht um mich politisch indoktrinieren zu lassen. Ich komme nicht wieder.«
Sal runzelte die Stirn und nickte kurz ihrer Tresenfrau zu. Erica ging mit einem Tablett voller Probegläschen mit ›Traders Traum‹ von Tisch zu Tisch. Binnen Minuten wurde wieder geplaudert und gelacht.
An der Bar las Peter über meine Schulter mit, als ich mich durch die Eckdaten von Lydia Zamirs Leben scrollte. Bernies Zusammenfassung hatte einige Fakten ausgelassen. Zamir war in Kansas aufgewachsen, wo ihr Talent als Pianistin früh entdeckt wurde. Nachdem sie am New England Conservatory of Music studiert hatte, spielte sie bei ein paar regionalen Symphonieorchestern und auf Sommerfestivals. Bei einem Festival in Santa Fe lernte sie einen chilenisch-amerikanischen Schriftsteller namens Hector Palurdo kennen und verliebte sich.
Im Laufe der folgenden Jahre entwickelte Zamir sich vom klassischen Repertoire weg. Sie brachte sich Gitarre bei – »Im Grunde ein Klavier mit sechs Saiten statt achtundachtzig«, sagte sie in einem Interview – und fing an, Palurdos Lyrik zu vertonen, dazu die der chilenischen Dichter Gabriela Mistral und Pablo Neruda.
Dann, vor vier Jahren, traten Zamir und Palurdo bei einem Open-Air-Solidaritätsfestival in Kansas auf, und da kam es zu einer Massentragödie. Ein Amokläufer schoss von einem Berghang aus wahllos in die Menge. Siebzehn Menschen wurden getötet, darunter Palurdo. Zweiundfünfzig schwer verletzt. Zamir hatte anscheinend überlebt. Sie gab ein Gedenkkonzert für Hector, wobei der Erlös an die Familien der Toten ging, und dann hörte sie mit der Musik auf.
»Sie ist in Kansas aufgewachsen, und er wurde dort erschossen. Eifersüchtiger Liebhaber?« Murray, der von Sal sein Handy zurückbekommen hatte, rief die gleichen Infos ab. »Sie stammt aus einem Landkartenpünktchen namens Eudora, und dieser Amoklauf war in der Nähe von Salina, einem etwas dickeren Klecks auf der Landkarte … zirka drei Stunden von ihrem Heimatort – keine große Entfernung für einen erbosten Verehrer.«
Er scrollte weiter, las leise murmelnd mit. »Palurdo kam aus Chicago, aber sein Vater war Immigrant aus Chile. In den Siebzigern hergezogen, arbeitete als Schweißer, starb, rund achtzehn Monate bevor sein Sohn erschossen wurde. Hector verfasste Gedichte und Storys, die auf volkstümlichen Geschichten indigener Völker basierten, aber in erster Linie war er Essayist, der über Menschenrechte in beiden Amerikas schrieb. Nord und Süd.«
Murray trank seine Flasche aus. »Da bist du ja über ein echtes Mysterium gestolpert, Warshawski.« Er verstellte die Stimme und sprach wie ein Radio-Ansager aus alten Zeiten. »Wer ist die geheimnisvolle Obdachlose, und wie kommt es, dass sie Zamirs Musik spielt?«
Ich zog eine Grimasse. »Und jetzt soll ich sagen, dass sie Lydia Zamir ist?«
Murray grinste wölfisch. »Fette Story, wenn sie’s wäre.«
»Möglich wäre es wohl, aber – wie ist sie ausgerechnet hier gelandet?«
»Ihr Liebster war in Chicago zu Hause«, warf Peter ein.
»Denkbar wär’s«, gab ich zu. »Die Musik ist schon dermaßen eigenwillig, kein Material, das eine beliebige Obdachlose so – so locker draufhaben würde wie diese Frau in der Unterführung. Aber kann eine anerkannte Musikerin so wenig Beistand haben, dass sie als Pennerin an der Forty-seventh Street endet?«
»Hey, Vic, du weißt doch, wie es läuft«, sagte Sal. »Niemand ist immun.«
Sal und ich sind im Vorstand eines Asyls für Fälle häuslicher Gewalt – und sie hatte recht: Absturz und Verelendung gibt es auf allen Bildungs- und Einkommensstufen.
Murray drehte die leere Dark Lord-Flasche in den Fingern. »Der Fall aus großer Höhe gibt immer eine gute Story her. Grammy für ›Savage‹, Auftritte mit Beyoncé, Liebe zu einem südamerikanischen Revolutionär unter einem schlechten Stern, Endstation auf Chicagos Straßen.«
»War Palurdo denn ein Revolutionär?«, fragte Peter, der auf seinem eigenen Smartphone herumwischte. »Es klingt eher, als ob er thematisch ähnliches Gelände beackert hat wie Luis Urrea und Isabel Allende.«
»Südamerikanische Schriftsteller sind doch immer Revolutionäre, jedenfalls im Sinne Hollywoods. Ich rieche hier eine erfolgverheißende Serie: Wie unsere Überflieger abstürzen – vom höchsten Gipfel ins Tal des Todes.« Murray skizzierte in der Luft, wie etwas einen Berg hinabtrudelte.
»Ja genau«, ich schnaubte entrüstet. »Abgewrackte Basketball-Stars liefern UPS-Pakete aus, und einstige Pulitzerpreisträger geben sich für Kabelkanalgeschwätz her.«
Diesen Seitenhieb bereute ich, sobald er mir aus dem Mund geschlüpft war. Entschuldigend legte ich Murray eine Hand auf den Arm. »Das war unter der Gürtellinie: Verzeih mir.«
Er nickte flüchtig, ging aber kurz darauf, ohne noch etwas zu sagen.
»Er hat einen Pulitzer?« Sansens sandblonde Brauen hoben sich erstaunt.
»Und ob. Das war eine sensationelle Story, und er hat großartige Arbeit geleistet, es ging um eine Clique von Stadträten im Besitz einer Strohfirma, die ein Schulgelände an der West Side als Sondermülldeponie nutzte. Die Story machte genug Wirbel, um das Rathaus für ein paar Monate ins Visier der Bundesbehörden zu bringen; aber dann hat Global die Zeitung aufgekauft, und es war klar, dass das Global-Management mit den Tätern am Kungeln war. Die Folgeberichterstattung wurde einfach gekippt.«
»Das lief mit harten Bandagen«, bestätigte Sal, »trotzdem hätte Murray den Wisch nicht unterschreiben müssen, dank dem sie die Story begraben konnten. Er hätte damit auch zu einer unabhängigen Zeitung gehen und auf sein schickes Mercedes Kabrio verzichten können.«
Das Gespräch wandte sich anderem zu. Sansen und ich brachen bald auf, um im Colibri tanzen zu gehen, einem heißen neuen Laden an der Lake Street. Als wir später in meine Wohnung zurückkehrten, suchte ich online nach ›Savage‹, dem Hit von Zamirs Album Continental Requiem.
Auf YouTube gab es eine Aufnahme von Zamir und Palurdo, wie sie ›Savage‹ sangen, kein Video, sondern einer dieser Clips, wo eine Abfolge von Fotos der Künstler eingeblendet wird: Zamir über ihre Gitarre gebeugt, kräftige Finger auf den Saiten. Zamir, wie sie Palurdo ansah, Liebe und Verwegenheit im Blick, weiß schimmernde Zähne, das dunkle Haar wellig auf ihren Schultern. Hector Palurdos Zähne waren schief und tabakfleckig. Auf dem nächsten Bild hielt er ein Schild hoch: Ich kann nicht singen, und auf Zamirs Schild stand: Er sagt, er kann schreiben.
Ich fühlte, wie sich mein Zwerchfell zusammenzog. Sie sprühten vor Leben, vor Verliebtheit. Ich glaube nicht, dass ich diese überschäumende Freude je empfunden habe, nicht in jungen Jahren, wo solche Gefühle so heftig sind, dass sie durch und durch gehen. Und dann – Mord. Massaker. Den Liebsten sterben sehen, zusammen mit all den anderen Toten und Verletzten. Es wäre kein Wunder, wenn der posttraumatische Schock sie in ein Leben unter den Gleisen getrieben hätte, mit nichts als einem Spielzeugklavier.
Sansen ergriff meine Hand und hielt sie sanft fest. »Glaubst du, die Frau, die du heute gesehen hast, ist Lydia Zamir?«
»Von den Bildern her lässt sich das nicht sagen, aber diese Musik, dieses Verzahnen von Grieg mit eigenen Rhythmen bei ›Swan Song‹. Genauso hier bei ›Savage‹, wo sie Purcell mit diesem haitianischen kompa-Beat verwoben hat. Es hätte spannend werden können, zu erleben, was sie musikalisch als Nächstes anstellt, aber ich schätze, das Massaker hat ihre Stimme zum Schweigen gebracht.«
Sansen nickte. »Ich hatte im Irak und in Afghanistan mit Leuten zu tun, die Massenmord miterlebt haben. Davon erholt man sich nicht so schnell, oder vielleicht überhaupt nie – es ist wie ein Stück Schrapnell im Herzen, das nicht entfernt werden kann. Ich weiß, die beiden, mit denen du bei ihrem Unterschlupf zusammengerasselt bist, haben dich gegen den Strich gebürstet, aber sie könnten durchaus recht haben damit, dass sie zu allergisch auf Leute reagiert, um es in einer Einrichtung auszuhalten, wo es Hilfe für sie gäbe.«
»Die Musik bedeutet mir auch viel«, sagte ich.
»Natürlich. Ich vergaß …« Sansen zog mich an sich.
Meine Mutter war Musikerin gewesen, eine Sängerin mit großer Stimme, aber der Krieg, Armut, familiäre Verpflichtungen – und ich, das einzig überlebende Kind nach einer Reihe von Fehlgeburten – brachten ihre Karriere zum Stillstand. Sie hatte mich gewollt, jedenfalls wollte sie ihr Kind, aber ihre Musik, die blieb dann auf der Strecke.
4 Jailhouse Blues
Ich hatte in dieser Nacht meinen alten Albtraum, wo meine Mutter in einem Dickicht aus Schläuchen eingeschlossen war. Um sie zu erreichen, kappte ich die Schläuche, aber bei jedem Schnitt schoss ein neuer Wald davon hervor. Sowohl Sansen als auch ich wachten davon auf, dass ich ihren Namen schrie.
Ich lag in der Dunkelheit, umklammerte Peters Hand und beruhigte meinen Herzschlag, da klingelte mein Telefon.
»Ms. Warshawski? Ich meine, Vic? Ich … hier ist Angela. Angela Creedy. Ich wecke Sie ungern, aber Bernie ist in Schwierigkeiten.«
Ich setzte mich auf, versuchte mein Bewusstsein auf die Gegenwart zu richten. »Ist sie verletzt?«
»Ich glaube nicht, Ma’am. Vic. Aber wir sind auf der Polizeiwache. Sie wollte nicht, dass ich Ihnen Bescheid sage, aber ehrlich, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll.«
Mein Hirn produzierte dieses taumelige Gefühl, das von nur zwei Stunden Schlaf kommt. Oder von der Nachricht, dass die Patentochter verhaftet wurde. Über einer Stuhllehne fand ich eine Jeans und begann mich anzuziehen, während Angela mir sagte, wo man Bernie festhielt – im Revier Second District, Fifty-first Street direkt am Ryan Expressway. Keine zwei Meilen entfernt von der obdachlosen Klavierspielerin.
Peter blinzelte mich an, als ich in meiner Brieftasche nach der Plastikkarte wühlte, die mich als zugelassenes Mitglied der Anwaltskammer von Illinois ausweist. »Was ist los?«
»Bernie hat Ärger.«
»Soll ich mitkommen?« Er begann aufzustehen.
Ich beugte mich runter und küsste ihn. »Du müsstest einen Mord mitansehen, das würde dir nicht gefallen.«
»Kommt drauf an, wen du umbringst.«
»Bernie. Sie sitzt auf einem Polizeirevier in der Nähe dieser klavierspielenden Obdachlosen.«
»Willst du da wirklich allein hin?«
»Einer von uns muss morgen wach sein. Beziehungsweise heute. Du triffst Sponsoren, ich hab bis zum späten Vormittag keinen Termin.«
Ich zog meine weichen Lederstiefel an und begab mich in die Nacht hinaus. Auf den Seitenstraßen war nichts los, und ich kam gut durch bis zum Expressway, aber auf dem Ryan war der Verkehr dicht und schnell, verlangte Konzentration, die aufzubringen mir schwerfiel. Zu meiner Erleichterung erreichte ich die Ausfahrt Fifty-first Street, ohne mit irgendwas zusammengestoßen zu sein.
Angela saß auf einer Bank neben dem Eingang, und als sie mich sah, sprang sie auf. Bei ihren eins achtundachtzig Gardemaß fühlte ich mich mit meinen eins sechsundsiebzig klein, als sie mich umarmte.
»Ach, Ma’am, danke, dass Sie so schnell gekommen sind! Die lassen mich nicht zu ihr, und ich weiß nicht, was sie mit ihr machen.« Angela kam aus Louisiana und besaß die Manieren, die wir Nordlichter für den Süden typisch finden. Es fiel ihr immer noch schwer, mich zu duzen.
Wir waren nicht die Einzigen, die mitten in der Nacht auf dem Revier waren. Wentworth ist ein turbulenter Bezirk, jede Menge schwere Körperverletzung und Überfälle, reichlich Brandstiftung und Autodiebstahl, gelegentlich auch Mord.
Ein Pärchen in meinem Alter, das so müde aussah, wie ich mich fühlte, kämpfte um die Aufmerksamkeit des Diensthabenden am Tresen in Konkurrenz mit zwei Streifenpolizisten, die einen Mann reingebracht hatten, der zu besoffen war, um ohne Hilfe stehen zu können. Neben uns diskutierte eine Frau an ihrem Handy sehr laut mit jemandem, der keine Verantwortung für etwas übernehmen wollte, was Damian angestellt hatte.
Ich zog Angela zur anderen Seite des Raums. »Was ist passiert? Ist Bernie etwa zu der Unterführung an der Forty-seventh Street gegangen?«
Angela nickte kläglich. »Wir waren mit unseren Mitbewohnerinnen Inlineskaten. Alle hatten Spaß, eigentlich auch Bernie, nur hat sie immer wieder von dieser Frau angefangen, der Klavierspielerin, die alle Songs von Lydia Zamir kennt, obwohl sie obdachlos ist, aber Sie wären zu feige gewesen, um ihr zu helfen. Sie fand, dieser Kerl hätte Sie eingeschüchtert.«
Sie biss sich auf die Lippen und sah mich an. »Ich hab ihr gesagt, sie redet Stuss – keiner kann Sie so einschüchtern, dass Sie nicht tun, was Sie für richtig halten. Aber Bernie – nee, egal.«>
»Bernie hat gesagt, ich werde alt und will es nicht zugeben«, sagte ich.
Angelas dunkles Gesicht wurde noch eine Schattierung dunkler vor Verlegenheit.
»So in der Art. Natürlich kennen alle Kids in meinem Alter Lydia Zamir, vor allem ›Savage‹ – das singt unsere Mannschaft manchmal in der Umkleide, um vor dem Spiel den Teamgeist anzuheizen. Bernie hat gesagt, Lydia Zamir sei tot, aber Latisha meinte, nein, sie ist nicht erschossen worden. Tja, da hat Bernie beschlossen, dass diese Frau Lydia Zamir sein muss, denn wer sonst sollte ihre Musik spielen?
Und dann, so gegen Mitternacht, als die anderen zwei nach Haus wollten, sagte Bernie, sie fährt mit der L hin und guckt nach, ob das wirklich Lydia ist und ob sie Hilfe braucht. Sie meinte, um die Zeit wär’s ideal, weil dieser Kerl nicht da wäre. Ich hab versucht, es ihr auszureden, ehrlich, Ma’am, aber …«
»Mach dir nichts draus«, sagte ich. »Wir wissen alle, wie Bernie ist, wenn sie denkt, sie kann den Puck ins Netz bringen.«
Angela lächelte schwach. »Also steigt sie in die L, und ich – das ist keine ganz harmlose Strecke, wissen Sie, nicht nachts, also bin ich mit, obwohl ich es falsch fand. Es dauerte ewig – es war fast zwei, als wir endlich zu der Unterführung kamen. Wir sind von der L aus gelaufen, wir hatten keine Ahnung, dass das zwei Meilen sind! Jedenfalls schlief die Lady in diesem Haufen müffelnder alter Decken. Bernie ist sofort zu ihr hin. Ich hab sie bekniet, es zu lassen, aber sie rief ›Lydia‹, und die Lady wachte auf.
Anfangs schien es halbwegs glattzugehen. Bernie hatte sich eine Lydia Zamir-Playlist runtergeladen. Sie ließ ›Savage‹ laufen, und die Lady wickelte ihr Klavier aus und spielte ein paar Töne mit. Aber dann hat Bernie ›Swan Song‹ angemacht, da geht’s darum, dass Schwäne sich fürs Leben binden, und da fing die Lady an zu schreien und auf ihre Tasten einzuhämmern.