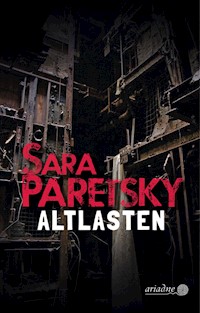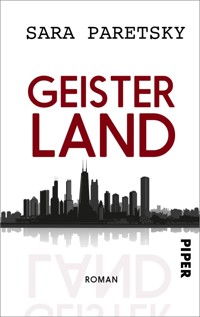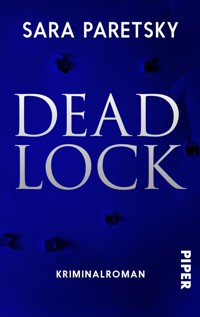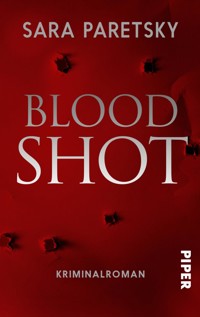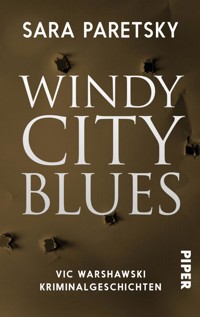19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der Sommer geht zur Neige. Im ländlichen Illinois stehen schwere Missernten bevor, in der Großstadt Chicago geht die soziale Schere immer weiter auseinander. Die panische Nachricht einer haltlosen Frau auf Dr. Herschels Anrufbeantworter führt Privatdetektivin Vic Warshawski nach Palfry County. Doch statt der erwarteten Landkommune findet sie dort nur noch eine verlassene Methküche vor und einen toten Hund. Zurück in Chicago ist Warshawski zwar auf vertrautem Terrain, aber ihre Vermisstensuche weitet sich aus zu einer Odyssee durch Zeit und Raum, und die Gegenseite hat fast unbegrenzte Ressourcen. Großmeisterin Sara Paretsky demonstriert die gewaltige Erzählkraft der Kriminalliteratur in diesem elegant geplotteten Hardboiled-Roman mit Privatdetektivin Vic Warshawski, die hier einmal mehr an ihre Grenzen gerät. »Beide, Warshawski und Paretsky, sind bei Kritische Masse in absoluter Höchstform. Mit dem Scharfblick einer guten Reporterin und der visionären Kraft einer Künstlerin setzt Sara Paretsky Orte ins Bild und leuchtet Strukturen aus.« Washington Post »Paretsky erzählt hier mit dieser schwindelerregenden, diamantharten Klarheit, die einem von Seite zu Seite unverhofft das Herz brechen kann.« Chicago Tribune
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 713
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Impressum
eBook-Ausgabe: © Argument Verlag 2018
Glashüttenstraße 28, 20357 Hamburg
Telefon 040/4018000 – Fax 040/40180020
www.argument.de
Alle Rechte vorbehalten
Titel der englischen Originalausgabe
Critical Mass
© 2015 by Sara Paretsky
Published by Arrangement with SARA AND TWO C-DOGS INC.
Printausgabe: © Argument Verlag 2018
Lektorat & Satz: Iris Konopik
Umschlag: Martin Grundmann
Umschlagmotiv: Dark City Alley © Bruno Passigatti, fotolia.com
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: November 2018
ISBN 978-3-95988-127-2
Über das Buch
Der Sommer geht zur Neige. Im ländlichen Illinois stehen schwere Missernten bevor, in der Großstadt Chicago geht die soziale Schere immer weiter auseinander. Die panische Nachricht einer haltlosen Frau auf Dr. Herschels Anrufbeantworter führt Privatdetektivin Vic Warshawski nach Palfry County. Doch statt der erwarteten Landkommune findet sie dort nur noch eine verlassene Methküche vor und einen toten Hund. Zurück in Chicago ist Warshawski zwar auf vertrautem Terrain, aber ihre Vermisstensuche weitet sich aus zu einer Odyssee durch Zeit und Raum, und die Gegenseite hat fast unbegrenzte Ressourcen.
Großmeisterin Sara Paretsky demonstriert die gewaltige Erzählkraft der Kriminalliteratur in diesem elegant geplotteten Hardboiled-Roman mit Privatdetektivin Vic Warshawski, die hier einmal mehr an ihre Grenzen gerät.
»Beide, Warshawski und Paretsky, sind bei Kritische Masse in absoluter Höchstform. Mit dem Scharfblick einer guten Reporterin und der visionären Kraft einer Künstlerin setzt Sara Paretsky Orte ins Bild und leuchtet Strukturen aus.« Washington Post
»Paretsky erzählt hier mit dieser schwindelerregenden, diamantharten Klarheit, die einem von Seite zu Seite unverhofft das Herz brechen kann.« Chicago Tribune
Über die Autorin
Sara Paretsky
Kritische Masse
Kriminalroman
Vorbemerkung von Else Laudan
Beziehungsreich, professionell, impulsgesteuert: Privatdetektivin V. I. Warshawski, die hier im Zuge einer Ermittlung folgenschwere Kapitel der Geschichte streift und ins Visier mächtiger Drahtzieher gerät, ist selbst ein Stück Literaturgeschichte. Ich war blutjung und schwer verliebt in die Hardboiled-Helden – Marlowe, Archer und Konsorten eroberten mein Herz mit ihrem coolen, schmutzig-realistischen Nonkonformismus –, als der feministische Aufbruch erstmals das Genre erreichte und kühne Frauen endlich auf die mean streets vorstießen: In schnell äußerst populären Romanen bevölkerte sich die Große Erzählung um Verbrechen und Gewalt mit aktiven weiblichen Figuren. Einige Namen strahlten besonders hell, allen voran Liza Cody (GB) und Sara Paretsky (USA), denen das politische Potenzial des Genres bewusst war und die sich ihm mit Talent, Erfindungsreichtum und Hingabe verschrieben, um im urbanen Dickicht aus Sozialspannung und Korruption auch die Geschichten der nicht männlichen Weltbevölkerung anzusiedeln. So wurde V. I. Warshawski meine Heldin, noch bevor ich selbst dazu kam, das zu übersetzen und zu verlegen, was wir triumphierend-rebellisch ›Frauenkrimi‹ nannten (damals ein Kampfbegriff, der später in den Händen von Marketingabteilungen zur affirmativen bis reaktionären Konsumkategorie mutierte und heute nach süßlichem Mist klingt).
Aber stellt euch mein Entzücken vor, als ich entdeckte, dass diese Quelle nie versiegt ist! Als souverän weiterentwickelte Protagonistin folgt Warshawski bis heute konsequent ihrem ausgeprägten Gewissen, dient ihrer Schöpferin als unbefangene Seismographin für die Risse in der amerikanischen Gesellschaft und ihren zahlreichen Leserinnen als unverwüstliche Streiterin für die Art Gerechtigkeit, die nicht blind der herrschenden Norm vertraut. Kritische Masse ist ihr 16. Fall und ein leuchtendes Beispiel dafür, wie ungeheuer viel Welt zwischen die Buchdeckel eines guten Krimis passt, ohne dass Paretsky es nötig hätte, sich zu wiederholen oder mit Versatzstücken zu arbeiten: Jeder Warshawski-Fall hat die Standalone-Qualität eines starken Gegenwartsromans.
Dieser hier schenkt uns neben bezaubernden und entlarvenden Episoden aus der aktuellen Wirklichkeit auch geschmeidig verknüpfte Zeitreisen: von der Nazizeit über die Nachkriegspolitik zur Duck and Cover-Phase, als die US-Regierung im Namen von ›Zivilschutz‹ ähnlich infantile Indoktrination verbreitete wie heute über Twitter. Doch das alles verdichtet nur nebenbei die akkurat in der Tradition des klassischen Detektivromans gewebte, vorwärtsdrängende Handlung. Kritische Masse ist pures Genre, ist Spannung, Unterhaltung und Bildung zugleich, eine Lupe in die Vergangenheit und ein Spiegel der Gegenwart, erzählt mit Herz und Verstand von einer großen Kriminalschriftstellerin unserer Zeit. Danke, Sara Paretsky.
Else Laudan
Wien 1913 Und es ward Licht
»Oh.« Die Silbe ist ein leiser Jauchzer des Entzückens. Noch nie hat sie solche Farben gesehen wie da auf dem Fußboden, Rot fließt in Orange, in Gelb, in Grün. Das Violett ist so üppig wie Traubensaft, sie möchte hineinspringen. Als sie hinläuft, um zu gucken, verschwinden die Farben. Ihr Mund wird rund vor Verblüffung, sie hat gedacht, Frau Herschel hat den Regenbogen auf den Fußboden gemalt. Dann entdeckt sie ihn wieder, er erscheint an ihrem Arm. Auf dem gestärkten Weiß ihres Matrosenhemds sieht sie das Violett, das der Holzboden verschluckt hat. Sie streichelt es und sieht zu, wie die Farben über ihre Hand rinnen.
»Martina!« Ein harsches Flüstern von ihrer Mutter. »Benimm dich.«
Widerstrebend dreht sie sich um und knickst vor Frau Herschel. Die schwarzen Stiefel umschließen ihre Knöchel so fest, dass sie sich kaum bewegen kann und beinahe hinfällt. Ihre Mutter runzelt die Stirn, es ist ihr so wichtig, dass ihr täppisches Kind einen guten Eindruck auf ihre Dienstherrin macht.
Birgit, das Kindermädchen, gibt sich keine Mühe, ihr Grinsen zu verbergen. Die kleine Sophie Herschel lacht nicht, sie dreht eine Pirouette in ihren weichen weißen Tanzschuhen und sinkt vor Martinas Mutter in einen tiefen Knicks.
»Ich glaube, das Kind hat das Schaukelpferd nicht einmal bemerkt«, sagt Frau Herschel, ein Auflachen bemäntelt kaum ihre Verärgerung. »Na, Sophie wird ihr schon helfen. Sie dürfen sie hier in der Kinderstube lassen, Frau Saginor. Sie können schon hinunter ins Nähzimmer gehen und mit dem Weißzeug anfangen. Birgit soll Martina mitversorgen, wenn sie Sophie ihr Mittagessen bringt.«
Die Sechsjährigen werden sich selbst überlassen und starren einander an. Sophies Haar hat die Farbe von Flachs, eine Rosettenschleife hält ihr die hübsch arrangierten Korkenzieherlöckchen aus dem Gesicht. Martinas Haar ist in strenge Zöpfe geflochten, so fest, dass man hinter den Ohren weiße Halbmonde von Haut sieht. Sophie trägt ein Kleid, wunderschön bestickt und gesmokt von Martinas Mutter, doch Martina selbst steckt in Matrosenhemd und dunklem Rock. Selbst wenn sie daheim Geld hätten für so feines Garn und edlen Stoff wie Sophies Kleider, würde es sich für Frau Saginors Tochter nicht geziemen, derart elegant herumzulaufen.
Später verbringen die Mädchen so viel Zeit miteinander, dass sie sich an diese erste Begegnung nicht mehr erinnern, nicht daran, wie gemein Sophie ein teures Spielzeug nach dem anderen zur Schau stellt, nicht daran, wie das Kindermädchen Martina ein Stück Brot mit Gänseschmalz zu Mittag gibt, während Sophie eine cremige Suppe und eine Apfelsine bekommt, und auch nicht daran, wie Martina Sophie bei Signor Caperelli aussticht, dem Italiener, der vielen Wiener Bürgerkindern Musikunterricht gibt.
»Und die da? Spielt sie auch?«, fragt Signor Caperelli Birgit, nachdem er eine halbe Stunde über Sophies planlose Darbietungen gegähnt hat.
»Sie ist bloß das Kind der Näherin, die hat sie mitgebracht, um Fräulein Sophie zu unterhalten.« Birgit rümpft die Nase.
»Aber zu Hause spiele ich auf Tantes Flöte«, sagt Martina. Die offensichtliche Enttäuschung des Fremden über Sophie macht sie kühn, und sie nutzt ihre Chance, der anderen ihre Überheblichkeit heimzuzahlen.
Signor Caperelli holt eine kleine Blockflöte aus der Reisetasche, in der er seine Musik aufbewahrt. Martina bläst hinein, um sie anzuwärmen, wie Tante es ihr beigebracht hat. Sie schließt die Augen und sieht wieder den Regenbogen auf dem Kinderzimmerfußboden vor sich. Jede Farbe hat einen Ton, und sie spielt den Regenbogen oder versucht es. Sie möchte weinen, denn sie hat den Klang der Farben nicht richtig getroffen. Sie gibt die Flöte zurück, rot vor Scham.
Signor Caperelli lacht. »Deine Tante, sie liebt wohl den Lärm von Herrn Schönberg? In meinen Ohren ist das keine Musik!«
Als Martina nicht antwortet, nur weiter zu Boden starrt, wühlt Caperelli erneut in seiner Tasche und entnimmt ihr ein Notenblatt mit einfacher Musik. »Du kannst Noten lesen, ja? Zeig das deiner Tante. Klein, wie du bist, liebst du schon die Töne, aber jetzt lernst du mal ein Lied spielen, nicht das Katzengeschrei, das Herr Schönberg sich ausdenkt, si?«
1 Teufels Küche
Die Sonne versengte meinen Rücken durch mein dünnes Shirt hindurch. Es war schon September, aber hier draußen in der Prärie hielt sich die Hitze noch mit hochsommerlichem Ungestüm.
Ich versuchte es an dem Tor im Stacheldrahtzaun, doch es war mit einem schweren Vorhängeschloss versperrt; als ich kräftig dagegendrückte, um zu sehen, ob ich durch den Spalt schlüpfen konnte, verbrannte das Metall mir die Finger. Oben auf dem Torpfosten waren eine Kamera und ein Mikrofon montiert, aber beides war zerschossen.
Ich trat ein Stück zurück und blickte mich in der leeren Landschaft um. Mein Wagen war weit und breit das einzige Auto gewesen, seit ich vom Abzweig in Palfry auf einer Schotterstraße hierher geholpert war. Bis auf die Krähen, die Kreise zogen und immer wieder auf das gegenüberliegende bräunliche Maisfeld hinabstießen, war ich völlig allein. Ich fühlte mich winzig und verwundbar unter der blauen Himmelsschüssel. Sie spannte sich in alle Richtungen über der Erde, schien die Luft auszusperren, ließ nichts durch als Licht und Hitze.
Trotz Sonnenbrille und Schirmmütze pochten meine Augen von dem grellen Hell. Als ich rund ums Haus nach einem Loch im Zaun suchte, waberten purpurrote Rauchkringel vor meinem Sichtfeld.
Das Haus selbst war alt und baufällig. Die meisten Fensterscheiben waren gesprungen oder herausgebrochen. Jemand hatte Sperrholzplatten davorgenagelt, sich aber keine große Mühe gegeben: An etlichen Stellen hingen die Platten lose, nur von ein oder zwei Nägeln gehalten. Hinter dem Sperrholz hatte irgendwer Pappe oder schmuddeligen Stoff in die geborstenen Rahmen gestopft.
Über dem Stahlzaun war Natodraht gespannt, um Eindringlinge wie mich zu entmutigen. Schilder warnten vor Wachhunden, aber ich hörte kein Gebell oder Schnüffeln, als ich das Gelände umrundete.
Vorne stand das Haus dicht am Zaun und an der Straße, aber nach hinten fasste die Umzäunung einen Streifen Land ein. In einer Ecke war ein alter Schuppen in sich zusammengefallen. Daneben hatte jemand eine riesige Grube ausgehoben, die mit Unrat gefüllt war und nach Chemikalien stank. Allerlei Behälter, Sprühdosen mit Lösungsmittel und weiteres Zubehör einer Methküche rangen mit Kaffeesatz und Hähnchenknochen um die Geruchsdominanz.
Und hinter dem Schuppen fand ich auch die Öffnung, die ich brauchte. Jemand mit einem großen Bolzenschneider war vor mir da gewesen und hatte ein Stück Zaun entfernt, breit genug, um mit einem Auto hindurchzufahren. Die Schnitte sahen frisch aus, der Stahl an den Drahtenden blinkte noch im Gegensatz zu dem sonstigen stumpfen Grau. Als ich durch die Öffnung trat, kribbelte es in meinem Nacken, und nicht nur wegen der Hitze. Ich wünschte mir, ich hätte meine Kanone dabei, aber als ich Chicago verließ, hatte ich noch nicht geahnt, dass ich auf dem Weg zu einer Drogenküche war.
Wer immer den Zaun zerschnitten hatte, war ähnlich ökonomisch mit der Hintertür umgegangen, indem er sie so eintrat, dass sie nur noch an einer Angel hing. Der Geruch, der aus der Türöffnung drang – metallisch, wie eine Mischung aus Eisen und verwesendem Fleisch –, war nur allzu leicht einzuordnen. Ich zog mir mein Shirt über die Nase und spähte vorsichtig hinein. Ein Hund lag gleich hinter der Schwelle, die Brust aufgeplatzt. Etwas Großkalibriges hatte ihn niedergestreckt, als er versuchte, das Gesocks zu verteidigen, bei dem er lebte.
»Du armer alter Rottweiler, wenn deine Mama wüsste, dass du eine Drogenhöhle bewachen musstest«, flüsterte ich. »Nicht dein Fehler, Junge, falscher Ort, falsche Zeit, falsche Leute.«
Fliegen arbeiteten geschäftig an seinen Wunden, die Enden seiner Rippen lagen schon frei, weiße Flecken zwischen dem Schwarz aus geronnenem Blut und Muskeln. Seine Augen hatten die Insekten gegessen. Ich spürte, wie mir das Mittagessen hochkam, und eilte die Stufen hinunter, um neben die Grube beim Schuppen zu kotzen.
Auf wackligen Beinen ging ich zu meinem Wagen und ließ mich in den Fahrersitz fallen. Ich trank etwas Wasser aus der Flasche, die ich dabeihatte. Es war so warm wie die Luft und schmeckte nach Plastik, aber es besänftigte meinen Magen. Ein paar Minuten blieb ich sitzen und sah zu, wie in der Ferne ein Farmer auf einem Acker auf und ab fuhr, wobei er um sich herum eine Staubwolke aufwirbelte. Er war zu weit weg, um etwas zu hören. Die einzigen Geräusche kamen vom Wind im Maisfeld und den Krähen, die darüber kreisten.
Als meine Beine und mein Magen sich halbwegs erholt hatten, nahm ich das große Strandtuch vom Rücksitz, das ich für meine Hunde benutze. Im Kofferraum fand ich ein altes T-Shirt und schlitzte es auf, so dass ich es mir über Nase und Mund binden konnte. Mit dieser selbstgebastelten Maske bewehrt kehrte ich zum Haus zurück. Ich wedelte mit dem Strandtuch, bis die meisten Fliegen vertrieben waren, dann deckte ich es über den Hund.
Ich stieg über seine Leiche und trat in des Teufels Höllenküche. Ein zerschrammter, ehemals weißer Geschirrschrank stand voller Dosen mit Starthilfespray, Abflussreiniger, halbvollen Marmeladengläsern mit übel aussehenden Flüssigkeiten, Pipetten, Inhalatoren sowie Kanistern mit der Aufschrift Salzsäure. Eine behelfsmäßige Abzugshaube mit einem Lüftungsrohr war über dem Geschirrschrank angebracht. Halb begraben unter dem ganzen Mist lagen ein paar Industrie-Atemschutzmasken.
Wer immer die Tür eingetreten hatte, hatte auch das Linoleum vom Boden gerissen und einige der modrigen Dielen darunter aufgehebelt. Ich ging in die Hocke und richtete meine Taschenlampe in eine Lücke zwischen den freigelegten Balken. Auf dem nackten Erdboden unter mir stand ein Boiler, eine Heizungsanlage, aber keine Leichen in meinem Sichtfeld. Kühle Luft stieg aus dem Keller auf, dazu ein Geruch modernden Laubs, der verglichen mit den Chemikalien ringsum urgesund wirkte.
Ich richtete mich auf und schwenkte mein Licht im Raum umher. Es war schwer zu sagen, welchen Teil des Chaos die Hundemörder angerichtet hatten und was von den Bewohnern stammte.
Ich stieg über achtlos zu Boden geworfene Kanister, umrundete ein paar Heizlüfter und drang in die hinteren Räume vor.
Es war ein altes Farmhaus mit einem Vorderzimmer, das einst ein repräsentativer Salon gewesen war, schloss man von den Scherben der Zierfliesen rund um den unbenutzten Kamin. Sie waren aus dem Sims herausgebrochen und zerschmettert worden. Den alten Sekretär hatte jemand als Zielscheibe benutzt. Eine wütende Hand hatte die Schubladen zertrümmert und Papiere über den Boden verteilt.
Ich bückte mich, um sie mir anzusehen. Hauptsächlich Mahnungen von der Kreisverwaltung für Steuern und Müllabfuhr. Die Bibliothek von Palfry forderte die Vom Winde verweht-Ausgabe zurück, die Agnes Schlafly 1979 ausgeliehen hatte.
In Fetzen gerissene Fotos waren alles, was von einem wild misshandelten Fotoalbum noch übrig war. Als ich es zurück auf den Haufen fallen ließ, rutschte jedoch ein unbeschädigtes Bild heraus. Es war ein altes Foto, verblichen und leicht zerschrammt, und zeigte eine Gruppe Menschen vor einem großen Metall-Ei, das auf einem gigantischen Dreifuß befestigt war. Es sah aus wie die Comicversion einer eben gelandeten außerirdischen Raumkapsel, doch die Leute blickten mit feierlichem Stolz in die Kamera. Drei Frauen in den länglichen Kleidern und dickhackigen Schuhen der 1930er saßen in der Mitte, fünf Männer standen hinter ihnen, alle in Jackett und Krawatte.
Ich starrte es stirnrunzelnd an und fragte mich, was das Metall-Ei darstellen sollte. Röhren liefen hindurch, womöglich war es der Prototyp einer Maschine, die Milch direkt von der Kuh zum Kühlschrank beförderte. Weil es so bizarr aussah, steckte ich es ein.
Der angrenzende Raum enthielt ein paar Klapptische und Stühle mit abgebrochenen Rückenlehnen. Leere Pizzaschachteln, Hühnerknochen und eine Müslischale, in der Schimmel wuchs: ein Bosch-Stillleben.
Eine Treppe führte in den ersten Stock; darunter war eine verstopfte Toilette eingebaut. Eine bessere Detektivin als ich hätte vielleicht hineingesehen, doch der Geruch verriet mir schon mehr, als ich wissen wollte.
Am oberen Ende der Treppe lagen drei Schlafzimmer unter dem Dachstuhl. Zwei enthielten bloß Matratzen und Plastikkörbe. Die waren umgekippt und schmutzige Wäsche über den Boden verteilt. Die Matratzen waren aufgeschlitzt, Fetzen der Füllung bedeckten die Dreckwäsche. Im dritten Schlafzimmer hatten ein richtiges Bett und eine Kommode gestanden, aber auch sie waren jetzt Kleinholz. Ein Porträtfoto von einer jungen Frau mit Baby im Arm war aus dem Rahmen gerupft, der entzweigebrochen auf dem zerfetzten Bettzeug lag. Ich hob das Foto auf, vorsichtig, berührte es nur an den Rändern. Die Farben waren stark verblasst, so dass ich das Gesicht der Frau nicht richtig erkennen konnte, bloß einen Heiligenschein aus dunklen Locken. Ich schob das Bild in meine Schultertasche zu dem von der Milchkapsel.
Ein großes Poster von Judy Garland mit der Titelzeile Somewhere Over The Rainbow hing nur noch an einer Ecke über der Bettstatt, das Klebeband an den anderen Seiten war abgerissen. Sollte das der Witz eines Drogenkonsumenten sein? Way up high? Es fällt schwer, sich Methsüchtige als Meister der Ironie vorzustellen – aber es ist wiederum leicht, Vorurteile gegen Leute zu hegen, die man nie kennengelernt hat.
Die wenigen Sachen im Schrank – ein goldenes Abendkleid, ein Samtjackett, einst kastanienbraun, und eine Designerjeans – waren ebenfalls zerschlitzt. »Du hast wohl irgendwen stinksauer gemacht, was?«, murmelte ich der unbekannten Person zu, die diese Kleidung getragen hatte. Meine Stimme klang eigenartig in dem zerlegten Zimmer.
Falls in diesem verwüsteten Haus etwas zu finden gewesen war, hatten es jetzt die Hundemörder. In meiner Zeit als Pflichtverteidigerin war ich deprimierend häufig mit dieser Art von Zerstörung konfrontiert gewesen.
Höchstwahrscheinlich hatten die Eindringlinge nach Drogen gestöbert. Oder sie fanden, die Dealer hätten sie übers Ohr gehauen. Die Süchtigen, die ich kennengelernt habe, hätten für einen Kick den Ehering ihrer Mutter verscherbelt und wären später wiedergekommen, um den Laden in Stücke zu schießen und sich ihren Schmuck zurückzuholen. Ich hatte mal eine Frau vertreten, die ihren Sohn umbrachte, als er den Ring nicht wiederbeschaffen konnte, den er für ein Steinchen Crack verkauft hatte.
Ich stieg die steile Treppe wieder runter und fand die Tür zum Keller. Auf halbem Weg die Stufen hinab huschte eine Spinne durch meinen Lichtkegel, die größer war als meine Hand, und dämpfte meine Erkundungslust. Ich leuchtete mit der Taschenlampe umher, sah aber keine Spuren von Blut oder Kampf.
Um nicht noch mal durch die Küche waten zu müssen, verließ ich das Haus durch die Vordertür. Hier gab es eine ganze Reihe von Sperrriegeln, eine ebenso überflüssige Investition wie die Kamera überm Tor. Wer immer vor mir hier gewesen war, hatte sie kurzerhand weggeschossen.
Bevor ich mich durch die Lücke im Zaun verzog, suchte ich mir im Unkraut ein altes Brett und stocherte damit in der offenen Grube herum. Sie enthielt so viele leere Flaschen, dass ich nicht hineinklettern mochte, aber soweit ich feststellen konnte, war darunter niemand verborgen. Ich machte ein paar Aufnahmen mit der Handykamera und strebte dem Ausgang zu.
Eben wollte ich durch den Zaun schlüpfen, da hörte ich ein schwaches Winseln aus dem eingestürzten Schuppen. Ich kämpfte mich durch Unkraut und Schutt und drang durch die Reste der Seitenwand ein. Noch ein Rottweiler. Als er mich sah, wedelte er kraftlos mit dem Stummelschwanz. Ich bückte mich langsam. Er lag ganz still und unternahm keinerlei Versuch, mich anzugreifen, also tastete ich ihn vorsichtig ab. Eine Hündin, entsetzlich mager, aber soweit ich das beurteilen konnte unverletzt. Sie hing in einem Haufen aus alten Seilen und Stacheldrahtrollen fest. War wohl in den Schuppen geflüchtet, als ihr Partner erschossen wurde, und hatte sich dann in ihrer Panik völlig verheddert. Behutsam bog ich die Drähte nacheinander von ihrer Brust und ihren Beinen weg.
Als ich zurücktrat und mit ausgestreckter Hand in die Hocke ging, kam sie mühsam auf die Beine und wollte mir folgen, brach aber nach wenigen Schritten erneut zusammen. Ich lief zu meinem Wagen und holte die Wasserflasche und einen Strick. Ich goss ein wenig Wasser über ihren Kopf, gab ihr aus der hohlen Hand zu trinken und band ihr den Strick um den Hals. Als sie nicht mehr so ausgedörrt war, ließ sie sich von mir langsam am Zaun entlang zur Straße führen. Hier im Tageslicht sah ich die Stichwunden, wo der Draht sich in ihr Fleisch gebohrt hatte, aber auch tiefe Striemen in dem schmutzigen schwarzen Fell. Irgendein Widerling hatte sie geprügelt, und nicht nur einmal.
Als wir mein Auto erreichten, wollte sie nicht einsteigen. Ich versuchte sie hochzuheben, aber sie knurrte mich an, stemmte ihre schwachen Beine in das Unkraut am Straßenrand und zerrte am Strick, strebte auf die Straße. Ich ließ den Strick los und sah zu, wie sie quer über den Schotter humpelte. Am Maisfeld schnüffelte sie an den Stängeln, bis sie fand, wonach sie suchte. Sie drang in das Feld ein, war aber so geschwächt, dass sie immer wieder umfiel.
»Wie wär’s, wenn du hierbleibst und mir die Suche überlässt?«
Sie sah mich skeptisch an, glaubte wohl nicht, dass eine Frau aus der Stadt in einem Feld zurechtkam. Schließlich befahl ich ihr, sich hinzulegen. Ob sie nun gut erzogen war oder einfach bloß zu schwach zum Weitergehen, jedenfalls ließ sie sich fallen, wo sie stand, und schaute zu, wie ich weiter ins Feld ging.
Die Stängel waren höher als mein Kopf, aber sie waren braun und trocken und boten keinen Schutz vor der Sonne. Überall um mich schwirrten und stachen Insekten. Präriehunde und eine Schlange huschten bei meinem Auftauchen davon.
Die Pflanzen standen knapp einen Meter auseinander, die Reihen sahen gleich aus, in welche Richtung ich auch blickte. Ich hätte mich leicht verlaufen können, wäre ich nicht einer Spur umgeknickter Stängel zu der Stelle gefolgt, über der die Krähen kreisten.
Die Leiche lag ausgebreitet auf dem Mais wie ein Schneeengel. Krähen saßen dicht an dicht auf Schultern und Händen und griffen mich mit wilden Schreien an.
2 Hundemüde
»Deine Freundin war nicht dort, aber ich bin auf einen ihrer Mitkommunarden gestoßen. Oder Dealer, wie wir so was an der South Side nennen.« Ich saß in Lotty Herschels Wohnzimmer, lehnte mich in ihrem Barcelona-Sessel zurück und prüfte, wie die Farben durch den Brandy aussahen, den sie mir gereicht hatte.
»Ach, Vic, oh nein.« Lottys Gesicht knautschte sich vor Sorge. »Ich habe gehofft – ich dachte – ich wollte so gern glauben, dass sie ihr Leben in den Griff gekriegt hat.«
Es war neun Uhr vorbei, und Lotty war fast so müde wie ich, aber keine von uns mochte das Gespräch auf den nächsten Morgen verschieben.
Ich hatte die Krähen von dem Kadaver vertrieben, indem ich meine stoßfeste Taschenlampe und einen Schraubendreher nach ihnen warf. Sie flogen auf und bildeten einen großen schwarzen Kreis, gerade lange genug, dass ich mir die Leiche ansehen und feststellen konnte, dass es ein Mann gewesen war, keine Frau. Danach verzog ich mich so schnell es ging durch den toten Mais. Ich rief den Sheriff erst an, als ich den Straßenrand erreichte.
Die Hündin wollte ihren Wachposten am Feldrand nicht aufgeben, egal wie ich bat und befahl. Während wir auf das Gesetz warteten, goss ich ihr nochmals Wasser über den Kopf und ins Maul. Sie versuchte meinen Arm zu lecken, schlief aber stattdessen ein und hob dann mit einem Ruck den Kopf, als zwei Streifenwagen vorfuhren. Zwei Deputys, ein junger Mann und eine ältere Frau, folgten den geknickten Maisstängeln zur Leiche. Der dritte funkte das Hauptquartier an und holte sich Anweisungen: Ich sollte mit in die Stadt und mich beim Sheriff persönlich legitimieren.
»O nein, scheuch bloß die Krähen von ihm runter!« Das kam von den Deputys im Feld. Wir hörten sie auf die Pflanzen einschlagen, um die Krähen zu vertreiben, schließlich gaben sie ein paar Schüsse ab. Die Krähen stiegen wieder auf.
Ich bat den Deputy, mir den Hund in den Wagen heben zu helfen. »Auch wenn der Tote im Feld vielleicht für etliche ihrer Verletzungen verantwortlich ist, will sie nicht weg, solange er da liegt«, sagte ich.
Als er näher trat, zog die Hündin die Lefzen hoch und knurrte ihn an.
Der Deputy wich zurück. »Die sollten Sie einfach erschießen, so geschwächt und heimtückisch, wie sie ist.«
Ich war hundert Meilen von zu Hause weg, das Gesetz hier war ein Gesetz für sich und konnte mir leicht das Leben zur Hölle machen. Ich musste mich zügeln. »Vielleicht haben Sie recht. Aber bis zum Beweis des Gegenteils gilt sie erst mal als unschuldig. Wenn Sie die Hinterbeine nehmen, packe ich sie um den Nacken, dann kann sie Sie nicht beißen.«
Die Hündin widersetzte sich, aber nur schwach. Bis wir sie hinten in meinen Mustang verfrachtet hatten, kamen die beiden anderen Deputys in wackligem Eiltempo aus dem Feld getaumelt. Beide sonnenverbrannten Gesichter waren grünlich grau.
»Wir brauchen hier schleunigst einen Leichenwagen, solange noch was zum Obduzieren übrig ist«, sagte die Frau mit belegter Stimme. »Glenn, du forderst ihn an. Ich werde …« Sie drehte sich von uns weg und übergab sich in den Straßengraben. Ihr Partner schaffte es bis zum Streifenwagen, bevor er kotzte.
Mein Deputy rief die Zentrale. »Hier Davilats. Wir haben einen 0110 … Keine Ahnung, wer. Ich hab den langen Strohhalm gezogen und musste mir die Leiche nicht ansehen, aber Jenny meint, die Krähen haben sich schon ein üppiges Abendbrot geholt.«
Die Stimme am anderen Ende befahl, dass Jenny den Eingang zum Feld bewachte, mich sollte Officer Davilats zum Sheriff bringen. Zu meiner Überraschung und dankenswerterweise hielt Sheriff Kossel mich nicht allzu lange fest. Er ließ mich warten, während Davilats ihn zum Maisfeld rausfuhr. Als er zurück war, verlangte Kossel meine Papiere zu sehen. »Warshawski? Sind Sie mit diesen Auto-Ersatzteilhändlern verwandt?«, fragte er.
»Nein«, sagte ich zum fünfzigtausendsten Mal in meinem Berufsleben. »Die schreiben sich mit y. Ich bin mit dem jiddischen Schriftsteller I. V. Warshawski verwandt.« Keine Ahnung, warum ich das behauptete, da es nicht stimmte.
Kossel grunzte und fragte, was ich in der Gegend zu suchen hatte. Ich nannte ihm ein paar Namen von der Chicagoer Polizei als Referenzen.
»Ich bin auf der Suche nach einer gewissen Judy Binder«, erklärte ich, nachdem der Sheriff die Meinung Chicagos über mich eingeholt hatte. (»Rechtschaffen, aber eine Nervensäge«, hörte ich einen meiner Beleumunder poltern.) »Ich wusste nicht, dass die Adresse eine Drogenküche ist, aber ich hab die Bude durchsucht und keine Spur von ihr gefunden. Hat der Tote da allein gewohnt?«
Kossel knurrte. »Die Truppe wechselt, wir kennen nicht alle Namen. War bei jedem Zugriff eine andere Mannschaft. Das Haus stand leer, nachdem das alte Ehepaar, das das Land bewirtschaftet hat, gestorben war, dann tauchte einer der Enkel auf und machte auf Kommune mit seinen Kumpels und ihren Mädchen. Wir haben ihnen den Laden dreimal dichtgemacht, aber Sie wissen ja, es ist kein Problem, die Zutaten zu kaufen und von vorn anzufangen. Das Mädel, Judy sagen Sie? Die haben wir nie aufgegriffen. Es gab da kein Telefon, Festnetz mein ich. Falls sie einen Notruf abgesetzt hat, dann von einer Telefonzelle aus oder per Handy. Für mich sieht’s aus, als hätten die Gauner sich zerstritten, und sie ist gerade noch mit heiler Haut davongekommen.«
»Das Haus war buchstäblich zerlegt«, sagte ich.
»Kann sein, die haben das selbst besorgt, als sie drauf waren. Die nächsten Nachbarn wohnen eine Viertelmeile südlich, und die haben immer mal wieder Schüsse gehört. Einmal haben diese Trottel ihre Ätherdämpfe abzusaugen vergessen, da sind ein paar Fenster zu Bruch gegangen. Haben die Explosion bis hier nach Palfry gehört, aber als wir hin sind, um nachzusehen, haben sie uns nicht reingelassen. Bei all den Drogen, Knarren und Hunden hat hier jeder lieber Abstand gehalten. Wir haben sie nur festgenommen, wenn sie anfingen, ihren Dreck an der Highschool zu verkaufen. Wie war das, warum suchen Sie noch mal nach diesem Mädel, dieser Judy?«
Das war das dritte Mal, dass er fragte: ein Test, ob die plötzlich und ohne Zusammenhang gestellte Frage ihm eine abweichende Antwort einbrachte.
»Sie hat auf einem Anrufbeantworter die Nachricht hinterlassen, dass jemand sie umbringen will. Ich bekam telefonisch den Auftrag, sie zu suchen. Die Adresse hier draußen war die einzige, die ich auftreiben konnte.«
Das war genau das, was ich die ersten beiden Male gesagt hatte, aber ich wiederholte es geduldig: Fremde, die in Methküchen aufkreuzen, müssen Fragen beantworten, ganz gleich, wie viele Chicagoer Cops für sie bürgen.
»Gehört dieser Anrufbeantworter irgendwem?«
»Ich krieg das raus und melde mich«, versprach ich.
»Sie sind ganz schön weit gefahren für jemanden, den Sie nicht kennen, auf der Suche nach jemandem, den Sie angeblich noch nie im Leben gesehen haben.« Kossel musterte mich eingehend. Ich bemühte mich um ein offenes Gesicht, vertrauenswürdig, naiv. »Aber ich hab ja Ihren Namen und Ihre Adresse, und die passen zu dem, was im Internet steht, also fahren Sie mal zurück in die große Stadt. Ich ruf Sie an, wenn ich was brauche. Und wenn Sie über weiteren Maisfeldern Krähen kreisen sehen, fahren Sie einfach weiter, verstanden?«
Ich fasste das als Verabschiedung auf und erhob mich. »Darauf können Sie Ihre Pension verwetten, Sheriff.«
Mir war leicht schwummerig von Anspannung und Flüssigkeitsverlust. Ich füllte am Trinkbrunnen des Reviers meine Flasche auf, ließ mir in der Frauentoilette Leitungswasser über den Kopf laufen und brach mit meinem verwaisten Hund auf nach Chicago.
Palfry lag hundert Meilen südlich der Stadt. Alles in allem hatten die Rettung des Hundes, das Auffinden der Leiche und das Gespräch mit dem Sheriff dazu geführt, dass ich den Dan Ryan Expressway auf dem Höhepunkt des Feierabendverkehrs erreichte, doch das war mir schnurz. Es fühlte sich gut an, von Tausenden Autos und Millionen Leuten umgeben zu sein. Selbst die verseuchte Luft kam mir nach dem grässlichen ländlichen Mief viel klarer vor.
Ich fuhr direkt zur Notaufnahme der Tierklinik an der North Side. Die Rottweilerin hatte während der Fahrt so still dagelegen, dass ich schon fürchtete, sie wäre mir weggestorben, doch als ich sie an der Klinik aus dem Wagen hob, fühlte ich ihren unregelmäßigen Herzschlag. Ich wollte sie auf dem Gehweg absetzen, aber sie war so schwach, dass ich sie tragen musste. Mit trockener Zunge leckte sie einmal über meine Hand, als ich sie auf den Tresen wuchtete. Ich berichtete an der Aufnahme, wie ich sie gefunden hatte, gab an, dass ich keine Ahnung hatte, wie alt oder ob sie sterilisiert war, aber ja, ich würde alle Rechnungen bezahlen, sofern sie im Rahmen blieben. Nach einer geschätzten halben Stunde kam eine junge Frau im weißen Kittel aus dem Untersuchungsraum, um mit mir zu reden.
»Im Augenblick ist das Hauptproblem, zumindest nach äußerem Anschein, die Unterernährung, aber sie ist schlimm geprügelt worden und könnte noch innere Verletzungen haben«, sagte die Tierärztin. »Außerdem wird ein Wachhund für eine Drogenküche vermutlich scharf sein, wenn sie also erst ihre Kräfte wiedererlangt, ist sie möglicherweise zu aggressiv, um sie zu behalten. Wir untersuchen sie noch mal gründlicher, sobald sie genug Infusionen und Futter bekommen hat, um das durchzustehen. Falls sie zu retten ist, gehört sie sterilisiert.«
»Ja, natürlich.«
Die Veterinärin fügte hinzu: »Wir kriegen dauernd solche Fälle rein. Hunde, die zu Brei geprügelt werden, weil sie nicht hart genug kämpfen, oder weil sie verloren haben, oder einfach so aus Jux. Wir tun unser Bestes für Ihre Kleine. Sie sollen aber wissen, dass nicht jeder gerettete Hund gerettet werden kann.«
Ich trat noch mal zu der Hündin und küsste sie auf die Nase. Doch als ich mich zum Gehen wandte, sagte die Ärztin, ich solle unbedingt duschen, Haare waschen und meine gesamte Kleidung direkt in die Maschine tun, ohne sie in einen Wäschekorb zu werfen, weil an meiner Schutzbefohlenen eine Unmenge Zecken und Flöhe hafteten.
Niemand, der mich kennt, hat mir je unterstellt, Angst vor Bazillen zu haben, aber Zecken und Flöhe machen sogar aus einer schlampigen Person eine Lady Macbeth mit Waschzwang. Ich hielt an der nächsten Autowaschanlage und warf sämtliche herumliegenden Handtücher und T-Shirts weg, während das Wageninnere chemisch gereinigt wurde. Zu Hause jagte ich meine Klamotten mit Bleiche durch den Heißwaschgang und schrubbte mich unter der Dusche, bis meine sonnenverbrannten Arme um Gnade winselten.
Lotty hatte mehrfach angerufen, als ich auf dem Heimweg war. Bei der Autowäsche hatte ich mich kurz gemeldet und gesagt, ich käme so bald wie möglich zu ihr. Sie wartete schon auf mich, als ich aus dem Fahrstuhl trat. Obwohl ihr Gesicht sorgenzerfurcht war, bestand sie darauf, dass ich zuerst eine Schale Linsensuppe aß, um wieder zu Kräften zu kommen.
Sobald ich die Suppenschale von mir schob, sagte Lotty: »Rhonda Coltrain hat mir berichtet, weshalb sie dich alarmiert hat, aber natürlich kamen wir erst nach meinem Dienst in der Chirurgie zum Reden.«
Rhonda Coltrain ist Geschäftsführerin in Lottys Tagesklinik. Als sie früh um halb acht hinkam, hörte sie eine angsterfüllte Nachricht von einer Frau ab, die sich nur als ›Judy‹ gemeldet hatte. So begann auch mein Tag: Ms. Coltrain weckte mich und flehte mich an, sofort in die Klinik zu kommen. Lotty war im staatlichen Krankenhaus und steckte mitten in der komplizierten Operation eines Gebärmuttervorfalls, die keine Unterbrechung gestattete.
In Lottys Tagesklinik an der Damen Avenue spielte ich das panische Gestammel mehrmals ab, bis ich die verschliffenen Worte verstand. »Dr. Lotty, ich bin’s, Judy, die sind hinter mir her, die wollen mich umbringen, du musst mir helfen! Oh, wo bist du, wo bist du?«
Ich kannte keine Judys, die noch vor dem Morgengrauen bei Lotty anrufen könnten, aber Ms. Coltrain schon. Sie ist normalerweise absolut verschwiegen, aber diesmal fauchte sie: »Das überrascht mich kaum. Sie meldet sich nur bei Dr. Herschel, wenn sie zusammengeschlagen wurde oder eine Geschlechtskrankheit hat. Und warum die Frau Doktor ihr immer noch zu helfen versucht, ist mir ein Rätsel, auch wenn sie anscheinend eine gemeinsame Vorgeschichte haben. Ich bitte Sie nur ungern darum, aber Sie müssen versuchen, sie aufzuspüren.«
Sie fand die Adresse auf dem Land in Lottys privaten Unterlagen. Keine meiner Recherchedatenbanken spuckte eine Telefonnummer oder auch nur ein Foto aus. Mangels anderer Optionen war ich nach Palfry County gefahren.
Nachdem ich Lotty von der unbeschreiblichen Verwüstung in Judys sogenannter Kommune berichtet hatte, sagte ich: »Der Sheriff von Palfry will deinen Namen, und er will wissen, was du mit dieser Judy Binder zu schaffen hast. Ich hab dich heute noch rausgehalten, aber auf lange Sicht kann ich das nicht. Es wäre hilfreich, wenn ich wüsste, wer sie ist und warum dir so viel an ihr liegt.«
»Ich habe dich nicht aufgefordert, nach Palfry zu fahren. Wenn ich in der Klinik gewesen wäre, hätte ich dich gar nicht behelligt.«
»Lotty, jetzt komm mir nicht so. Wenn du in der Klinik gewesen wärst, und das weißt du ganz genau, dann hättest du als Erstes bei mir angerufen und mich gebeten, den Anruf zurückzuverfolgen, wozu mir nebenbei bemerkt jede behördliche Legitimation fehlt – du kannst ja Ms. Coltrain morgen früh auf die Telefongesellschaft ansetzen, wenn du wissen willst, von wo aus Judy angerufen hat. Und als Nächstes hättest du gesagt: Victoria, ich weiß, es ist viel verlangt, aber könntest du vielleicht mal nach ihr sehen?«
Lotty schnitt eine Grimasse. »Ach, mag sein. Genau wie du jedes Mal ankommst, wenn wieder jemand eine Kugel in dir versenkt hat, und sagst: Ich weiß, es ist viel verlangt, aber meine Versicherung deckt das leider nicht ab.«
Ich setzte mich in dem Barcelona-Sessel auf und starrte sie an. »Du versuchst doch nur, Streit mit mir anzufangen, damit ich nicht weiter nach Judy Binder frage. Ich bin zu müde für Spielchen. Ich gehe nicht weg, bis du mir erzählst, wer sie ist. Rhonda Coltrain glaubt, du fühlst dich für sie verantwortlich. Hier sitz ich nun, kenne dich seit dreißig Jahren und hab dich noch nie ihren Namen erwähnen hören.«
»Ich kenne jede Menge Leute, von denen du noch nie gehört hast«, sagte Lotty, dann lächelte sie schief, als sie einsah, wie bockig das klang. Sie setzte ihre Kaffeetasse ab und ging hinüber zu der Fensterwand mit Blick auf Lake Michigan. Lange starrte sie aufs dunkle Wasser, bevor sie wieder sprach.
»Ihre Mutter und ich sind in Wien zusammen aufgewachsen, das ist das Problem.« Sie drehte sich nicht um, ich musste angestrengt lauschen, um sie zu verstehen. »Ich meine, das ist der Hintergrund. Käthe, das war damals der Name ihrer Mutter, Käthe Saginor. Und als Käthes Tochter Judy immer mehr Aufmerksamkeit brauchte, als sie dann mit fünfzehn von zu Hause weglief, als sie sich mit einem gewalttätigen Kerl nach dem anderen einließ, dann mit sechzehn ihre erste Abtreibung brauchte – sie kam noch ein zweites Mal deswegen zu mir, als sie zweiundzwanzig war –, da hatte ich das Gefühl … ich kann dir gar nicht sagen, was ich eigentlich fühlte. Ich habe Judy als Kind gar nicht oft gesehen, also warum sollte ich mich verantwortlich fühlen oder gar Liebe empfinden? Aber ich empfand etwas von beidem, und dazu noch einen Hauch Schadenfreude über Käthes völliges Versagen als Mutter. Ich weiß nur, wider besseres Wissen habe ich immer wieder versucht, Judy zu retten.«
Sie wandte sich um und sah mich an. »In meiner Innenstadtpraxis erlebe ich ständig Leute, die sich in der einen oder anderen Abhängigkeit verfangen und zu Sklaven ihrer Sucht werden. Ich weiß, um gerettet zu werden, müssen sie die Rettung selbst wollen, wovon ich, wenn ich ehrlich bin, bei Judy nie eine Spur gesehen habe. Ich weiß nicht, warum ich mir eingebildet habe, meine Willenskraft könnte diesen Wunsch in ihr entfachen.«
»Sie war die Tochter einer Freundin aus deiner Kindheit.« Ich glaubte zu verstehen. »Das kann –«
»Ich mag ihre Mutter nicht«, fiel mir Lotty scharf ins Wort. »Käthe Saginor war immer ein quengeliges, ängstliches Gör. Es war mir verhasst, dass meine Oma fand, ich sollte mit ihr spielen. Ich war nie sonderlich nett zu ihr, wenn Käthes Großmutter – ich meine Kitty, sie hat in England ihren Namen geändert – also Kittys Großmutter brachte sie mit in unsere Wohnung in der Renngasse. Nach dem Anschluss mussten wir aus der Wohnung raus, und da wurde es noch schlimmer, weil wir Tür an Tür im überfüllten Ghetto in der Leopoldstadt hockten. Käthe erzählte ihrer Großmutter immer … ach, was soll’s!« Lotty warf eine Hand hoch, als müsse sie sich eine Spinnwebe aus den Haaren wischen. »Weshalb suhle ich mich in diesen bedeutungslosen alten Kränkungen und Wunden? Jedenfalls, als mein Opa in jenem Frühling, bevor der Krieg losging, Käthe mit Hugo und mir in den Zug nach London setzte, hatte ich furchtbare Angst, Käthe würde alles vermasseln. Ich fürchtete, sie würde so lange heulen und nörgeln, bis die deutschen Wachen uns aus dem Zug warfen, oder sie würde den Engländern so auf die Nerven gehen, dass sie Hugo und mich gleich mit zurück nach Wien verfrachteten. Es war eine unglaubliche Erleichterung, als wir London erreichten und sie weiter nach Birmingham geschickt wurde.
Im Aufruhr der Kriegsjahre habe ich sie völlig vergessen. Dann tauchte sie ohne Vorwarnung in Chicago auf, etwa zu der Zeit, als ich am Northwestern State Hospital mein Geburtshilfepraktikum machte. Sie war zu Kitty geworden – ich weiß nicht, warum ich mir das nicht merken kann. Schließlich habe auch ich die Schreibweise meines Namens anglisiert.«
»Ist sie auf der Suche nach dir nach Chicago gekommen?«, fragte ich.
»Nein – sie hatte ihre eigene verworrene Geschichte, die ich nach einer Weile nicht mehr hören mochte. Sie war inzwischen verheiratet, sie war nach dem Krieg zurück nach Österreich gegangen, um für die britische Armee zu übersetzen, und hatte dort einen amerikanischen GI geheiratet. Sie kamen nach Chicago, weil Kä– Kitty glaubte, ihre Mutter wäre hier, so lautete zumindest ihre Geschichte. Ich konnte es nicht ertragen, ständig von all den Leuten zu hören, die sie schlecht behandelten oder die sie angelogen hatten, und wie sie ihre Mutter gefunden hatte, aber sie hatte ihre Mutter gar nicht gefunden, ihre Mutter hatte Chicago verlassen, ohne sie zu treffen, ihre Mutter war tot. Wir hatten alle unsere Toten zu beklagen, mussten uns ein Leben aufbauen, niemand hielt deswegen mit mir Händchen, und ich wollte ganz sicher nicht ihrs halten.«
Ich saß ganz still: Wenn ich jetzt zu ihr ging, würde sie auch mich wie eine Spinnwebe fortwischen.
Schließlich schritt sie zurück zu ihrem Sessel. »Ich mochte Len – Leonard Binder, er war Kittys Ehemann. Judy ist ihr einziges Kind. Len ist vor ungefähr achtzehn Monaten gestorben, und das war das letzte Mal, dass ich Judy gesehen habe, auf seiner Beerdigung. Sie erzählte mir, dass sie sich einer Landkommune angeschlossen hat, dass sie ihr Leben ändert, und ich wollte ihr gern glauben, auch wenn ich ziemlich sicher war, dass sie in dem Moment high war.«
Jetzt ging ich zu ihr, kniete mich neben ihren Sessel und legte die Arme um sie. Lottys Atmung normalisierte sich allmählich. Dann setzte sie sich abrupt auf und sagte: »Hast du nicht gesagt, der Sheriff da unten hat Judy nie gesehen? Was, wenn sie bei dieser Drogenküche gar nicht mitgemacht hat?«
Ich ging rüber zur Couch, wo meine Umhängetasche lag, und zog die beiden Fotos heraus, die ich in den Trümmern gefunden hatte. Ich reichte Lotty das von der jungen Mutter mit dem Baby.
Lotty warf einen kurzen Blick darauf. »Oh, ja. Judy mit dem einzigen Kind, das sie ausgetragen hat. Das arme Ding, sie hat ihn Len und Käthe überlassen, als er ungefähr ein Jahr alt war.«
Ich sah mir das verblichene Foto noch einmal an. Judy Binders Ausdruck war schwer zu deuten, aber sie wirkte erstaunt, wie eine Träumerin, die nicht verstand, wo sie aufgewacht war. Sie hatte das Baby ihren Eltern überlassen, aber das Foto behalten, das musste doch etwas bedeuten.
Ich zeigte Lotty das ältere Bild mit dem Metall-Ei auf Stelzen. »Weißt du, was das ist?«
»Es sieht aus wie die Kinderzeichnung eines Raumschiffs. Aber die Leute …«, stirnrunzelnd starrte sie auf das Foto. »Es kommt mir vor, als müsste ich sie erkennen, aber … ich weiß nicht, es liegt wohl an den Kleidern. Die erinnern mich so an meine Kindheit.«
Die Kaminuhr schlug elf und erschreckte Lotty und mich gleichermaßen. Es war ein langer Tag gewesen. Ich war mehr als reif fürs Bett. Während sie mich zum Fahrstuhl brachte, bedankte sich Lotty förmlich für die Mühen, die ich auf mich genommen hatte.
Als das Taxi vorfuhr, ergriff sie meinen Arm und sagte mit ihrem selbstironischen Lächeln: »Victoria, ich weiß, es ist viel verlangt, aber könntest du noch Käthe aufsuchen – ich meine Kitty – und prüfen, ob sie irgendetwas weiß?«
3 Familienporträts
Kitty Binder wohnte in Stokie am Nordwestrand von Chicago in einem hellbraunen Backsteinhaus. Die meisten ihrer Nachbarn hatten kleine Vorgärten mit Ringelblumen und Rosensträuchern, die saubere Rechtecke makellosen Rasens säumten. Auf dem Binder’schen Grundstück lieferten sich Flecken ungemähten Grases mit Löwenzahn auf trockenem Boden einen Stellungskrieg. Der Lack blätterte von den Fensterrahmen, Eichhörnchen hatten unter der Dachtraufe Löcher genagt. Wirtschaftskrise, Alter, Geldmangel oder auch alles zusammen. Ich atmete tief durch, um mich zu wappnen, und drückte auf die Klingel.
Zwei Finger teilten vorsichtig die Jalousien hinter dem Fenster. Nach einem Augenblick hörte ich, wie scheppernd mehrere Riegel zurückgezogen wurden. Die Vordertür öffnete sich bis zur Länge einer kräftigen Sperrkette. Durch den Spalt konnte ich mit Mühe ein verschattetes Gesicht erkennen.
»Ms. Binder? Ich bin V. I. Warshawski. Wir haben heute Morgen telefoniert.«
Es war ein schwieriges Gespräch gewesen. Zuerst hatte Kitty Binder gesagt, sie habe kein Interesse an ihrer Tochter, sie habe keine Ahnung, wo Judy sei, und im Übrigen auch keinerlei Verständnis dafür, dass ich Charlotte Herschel ermutigte, sich in Dinge einzumischen, die sie nichts angingen.
Als ich ihr Judys verängstigte Nachricht auf Lottys Anrufbeantworter schilderte, wurde Ms. Binder noch abweisender. Sie wünschte, sie hätte für jeden von Judys dramatischen Anrufen im Laufe der Jahre einen Nickel bekommen. Judy spiele mit Lottys Mitgefühl wie Isaac Stern auf einer Stradivari. Judy wisse genau, dass sie, Kitty, diesen Unfug nicht mitmachte, also hielte sie sich stattdessen an Lotty.
»Nicht dass Charlotte leichtgläubig wäre. Sie sieht ja in ihrer komischen Klinik jede Menge Drogensüchtige. Sie weiß genau, was los ist. Sie will nur, dass ich vor meiner Tochter schlecht dastehe, darum führt sie sich auf wie eine Heilige.«
Ich wand mich am Telefon. Lotty und Kitty waren entschieden keine Freundinnen. Ich wollte mir von keiner sämtliche Kränkungen der letzten Jahrzehnte anhören, also fiel ich Kitty energisch ins Wort. »Ich war gestern in Palfry, in dem Haus, in dem Ihre Tochter gewohnt hat. Ich habe Judy nicht angetroffen, aber das Haus ist übel verwüstet worden, und ich muss Ihnen leider sagen, dass ich auf die Leiche eines ermordeten Mannes gestoßen bin, der dort ansässig war. Ich fürchte, diesmal könnte Ihre Tochter –«
»Ein ermordeter Mann?«, unterbrach mich Kitty ihrerseits, ihre Stimme laut und ängstlich. »Wer war das?«
»Ich weiß es nicht, ich habe keine Papiere bei ihm gefunden.« Ich mochte nicht sagen, dass ich wegen der auf mich herabstoßenden Krähen, deren Krächzen und Krallen mich von ihrem Festmahl wegscheuchten, gar nicht danach gesucht hatte.
»Kommen Sie heute Mittag.« Damit legte sie auf.
Und jetzt war es so weit, Mittag, was ich nur geschafft hatte, indem ich mehrere Kliententermine verschob. Ms. Binder aber ließ mich nicht herein, sondern verlangte einen Nachweis, dass ich V. I. Warshawski war. Ich diskutierte nicht mit ihr, zeigte einfach meine diversen Lizenzen: Autofahren, Schusswaffen führen, Verbrechen untersuchen.
Schließlich löste sie die Kette. Sobald ich drinnen war, schob sie alle Riegel wieder vor. Das Haus roch nach nicht geöffneten Fenstern. Das einzige Licht im Flur kam durch ein dreckverkrustetes Oberlicht über der Eingangstür. Ich hatte Mühe, Ms. Binder zu erkennen, immerhin konnte ich feststellen, dass sie klein war, mit kurzgeschorenem weißem Haar, und trotz des heißen Tages eine dicke Strickjacke anhatte.
Statt mich vollends hereinzubitten, verblüffte sie mich, indem sie streng zu wissen verlangte, ob mir jemand gefolgt sei.
»Nicht dass ich wüsste. Mit wem rechnen Sie denn?«
»Wenn Sie wirklich eine Detektivin wären, hätten Sie ja wohl auf Verfolger geachtet.«
»Wenn Sie wirklich Kitty Binder wären, würden Sie ja wohl wissen wollen, was mit Ihrer Tochter ist, statt mich über die Feinheiten der Detektivarbeit zu belehren.«
»Natürlich bin ich Kitty Binder!« Ihre Miene war schwer zu erkennen, aber ihre Stimme klang empört. »Sie dringen in meine Privatsphäre ein, kommen zu mir nach Hause, stellen mir impertinente Fragen. Es ist mein gutes Recht, von Ihnen Professionalität zu erwarten.«
US-Bürger ziehen sich heutzutage viel zu viele schlechte Fernsehkrimis rein. Als Folge davon erwarten Geschworene bei Routinefällen teuren Forensikaufwand und Klienten erwarten Maßnahmen, als wären sie für die CIA tätig. Wobei Kitty Binder bisher gar keine Klientin war.
»Fürchten Sie sich vor der Drogenbehörde?«, fragte ich. »Wenn die DEA hinter Ihrer Tochter her ist, haben die Sie längst verwanzt, die müssen nicht jemandem wie mir hinterherdackeln.«
Ich hatte den Eindruck, dass Ms. Binder erschrocken die Augen aufriss. »Sie meinen, mein Telefon ist angezapft?«
»Nein, Ma’am.« Mich beschlich das Gefühl, mich in einem Gesprächsdickicht von der Größe des gestrigen Maisfeldes verlaufen zu haben. »Ich meine nur, wir sollten über den ermordeten Mann sprechen, den ich gestern gefunden habe. Wer, glauben Sie, war das?«
»Sie haben ihn doch gefunden«, sagte sie. »Sagen Sie es mir.«
»Entweder hat er mit Ihrer Tochter in dem Haus gewohnt, oder er gehörte zu den Eindringlingen. Aber Sie wissen, oder glauben zu wissen, wer es sein könnte, denn erst als ich ihn erwähnte, haben Sie eingewilligt, mit mir zu reden.«
»Charlotte hat Sie geschickt, um mich zu bespitzeln, nicht wahr?« Ihre Stimme zitterte leicht, als versuchte sie sich in einen Zorn hineinzusteigern, um ihre Angst vor irgendetwas zu kaschieren.
»Ma’am, wollen wir uns nicht setzen? Wenn jemand Sie belästigt oder beschattet oder bedroht, kann ich helfen.«
»Da Sie mit Charlotte Herschel befreundet sind, werden Sie ihr doch bloß alles brühwarm erzählen, damit ihr zwei euch auf meine Kosten totlachen könnt.«
»Nein, Ma’am, ich kann Ihnen versprechen, was Sie mir im Vertrauen erzählen, wird von mir auch vertraulich behandelt.«
Lottys Worte kamen mir in den Sinn: das Kind, das Judy ausgetragen hatte, sie hatte ihn Len und Kitty überlassen. War das womöglich der Mann im Maisfeld? Ich fragte mich, wie alt dieser Enkel jetzt sein mochte.
Kitty nagte an ihrer Lippe und rang mit sich: Sollte sie mit mir reden? Ich schob mich an ihr vorbei und blieb an einer Tür stehen, die in ein Wohnzimmer führte. Dank der fest verschlossenen Jalousien erkannte ich nur geisterhafte Schemen von Sesseln und einer Couch sowie das Flimmern eines Fernsehbildschirms. Ich roch Staub.
»Wo sitzen Sie am liebsten, Ms. Binder? Hier drin? Oder sollen wir in die Küche gehen?«
Ms. Binder drängte sich an mir vorbei ins Wohnzimmer. Schade eigentlich, in der Küche wäre sie vielleicht schneller aufgetaut. Sie knipste eine Tischlampe an und deutete auf einen Sessel, über dessen Arm- und Rückenlehnen Spitzendeckchen drapiert waren. Spitzen bedeckten auch die meisten anderen Möbel, einschließlich eines Beistelltischs mit Fotos, einige eher gestellt, formell und gerahmt, die Mehrzahl aber alte Schnappschüsse. Das Zimmer war aufgeräumt, wenn auch überladen, doch eine dicke Staubschicht zog sich über Tisch und Fernseher.
»Haben Sie die selbst gemacht?« Ich berührte die Spitze auf der Armlehne meines Sessels.
»Oh, ja, sicher. Ich war ja nicht so ein behütetes Hätschelkind wie Charlotte Herschel. Bei uns zu Hause wurde gearbeitet. Meine Großmutter hat dafür gesorgt, dass ich stricken und klöppeln konnte, noch ehe ich fünf wurde. So etwas verlernt man nicht, schon gar nicht, wenn man von klein auf ausgebildet wird. Sogar meine Mutter –« Kitty Binder biss das Ende des Satzes ab, als wäre es ein Faden zwischen ihren Zähnen.
Ich wartete, hoffte, sie würde noch etwas hinzufügen. Schließlich fragte ich: »Wann haben Sie Ihre Tochter zuletzt gesehen?«
Ihre Lippen wurden schmal. »Sie kam zum Begräbnis ihres Vaters. Ganz in Schwarz, mit großem Hut und in Tränen aufgelöst, als hätte sie Len Tag und Nacht gepflegt. Natürlich, er war immer lieb zu ihr, so lieb, man sollte meinen, sie wäre öfter mal vorbeigekommen, als sie erfuhr, dass er krank war. Oder vielleicht ist sie das sogar, sie hat ihn wahrscheinlich häufiger im Laden besucht, als er mich wissen ließ. Er wusste, ich war dagegen, dass er ihr Geld gab. Ich nehme an, wenn ich mal tot bin, bleiben ihre Augen trocken.«
Und wenn sie tot ist, werden deine Augen trocken bleiben?, ging mir durch den Kopf.
»Kann ich mit Ihrem Enkel sprechen? Vielleicht hat er –«
»Sie lassen Martin in Ruhe«, sagte sie in drohendem Ton.
»Wie alt ist er?«, fragte ich, als hätte sie nichts gesagt.
»Alt genug, um zu wissen, dass seine Mutter durch und durch Gift ist.«
Ich stand auf und sah mir die gerahmten Fotos an. Eine junge Kitty mit Blumenbouquet in einem New Look-Kostüm starrte streng in die Kamera. Der Mann neben ihr, in Uniform mit U. S. Army-Verdienstmedaille auf der Brust, das schwarze Haar nach hinten gegelt, glühte vor Stolz. Lotty zufolge waren sie sich im Nachkriegsösterreich begegnet. Aus der Uniform schloss ich, dass sie dort auch geheiratet hatten. Damals trugen viele Frauen ihr bestes Kleid zur Hochzeit, Brautkleider waren nicht drin. Meine Mutter hatte in einem ähnlichen Kostüm geheiratet, aber mein Vater hatte ihre Arme mit Rosen gefüllt.
Auf einem anderen Foto stand derselbe Mann, deutlich älter, aber immer noch stolz lächelnd, mit einem mageren ernsten Jungen vor einer Bima. Die Bar-Mizwa des Enkels. Die beiden standen auch zusammen hinter einer komplizierten Konstruktion aus Glasröhren und Drahtspulen mit einer Erster Platz-Banderole, die am Tisch befestigt war. Dasselbe stolze Lächeln bei Großpapa, derselbe ernste Blick bei dem Jungen. Das letzte Foto war ein verblichener Schnappschuss, drei Mädchen im Teenageralter und ein molliges Paar. Sie alle trugen altertümliche Badeanzüge und grinsten in die Kamera. Kitty stand in der Mitte, auch sie strahlte.
»Sind das Ihre Schwestern?«, fragte ich auf gut Glück.
Ihr Gesicht verfinsterte sich noch mehr, aber sie nickte andeutungsweise.
»Ist es denkbar, dass Ihre Tochter bei einer von –«
»Oh!« Ihr Ausruf war beinahe ein Schmerzensschrei. »Wie können Sie nur? Wie können Sie so grausam sein?«
Mein Magen zog sich zusammen. Ich hätte es wissen sollen, jüdische Flüchtlinge aus Wien: Ihre Familie war vermutlich ermordet worden wie die von Lotty.
»Verzeihen Sie.« Ich schob einen spitzenbedeckten Fußschemel neben ihren Sessel, so dass ich tiefer saß als sie. »Ich wusste das nicht. Ich habe nicht nachgedacht. Bitte erzählen Sie mir von Ihrer Tochter und Ihrem Enkel. Er ist es, um den Sie sich Sorgen machen, oder? Wenn Sie ihn mir beschreiben können, bin ich vielleicht imstande, Ihnen zu sagen, ob er die Person ist, deren Leiche ich gestern gefunden habe.«
»Sie haben ihn sich doch gerade angesehen.« Ihre Finger verknoteten sich in ihrem Schoß, bis ihre Knöchel weiß wurden.
»Wie alt ist er jetzt?«
»Er ist im Mai zwanzig geworden.«
»Der Mann, den ich gefunden habe, war bestimmt zehn, fünfzehn Jahre älter«, sagte ich, »auch wenn seine Leiche so schlimm zugerichtet war, dass ich nicht hundertprozentig sicher sein kann. Wann haben Sie Martin denn zuletzt gesehen?«
Sie runzelte die Stirn, antwortete aber nicht. Sie wirkte verlegen. Vielleicht war Martin wie seine Mutter geflüchtet, um diesem muffigen Haus mit seinen geschlossenen Jalousien und versiegelten Fenstern zu entkommen.
»Arbeitet er? Studiert er?«, fragte ich.
»Er besucht Abendseminare auf dem Circle Campus, aber er arbeitet für seinen Lebensunterhalt, wie meine Familie das immer getan hat.«
»Ms. Binder, wo liegt das Problem? Macht er etwas, das ihn in Schwierigkeiten bringen könnte?«
Sie fuhr auf. »Natürlich nicht. Er ist kein bisschen wie seine Mutter. Der beste Beleg, dass das ganze Geschwafel vom prägenden Umfeld völliger Quatsch ist. Wenn er hier aufwachsen und ein anständiger, hart arbeitender Junge werden konnte, hätte seine Mutter das auch schaffen können, wenn sie nicht so einen schwachen Charakter besäße.«
»Was macht Ihnen dann Sorgen?«, fragte ich.
Sie verflocht ihre Finger zu so festen Knoten, dass mir unklar war, wie sie den Schmerz ertrug. »Er ist vor zehn Tagen verschwunden«, flüsterte sie. »Niemand weiß, wo er steckt.«
4 Martins Höhle
Stück für Stück zog ich Kitty die Geschichte aus der Nase, es war wie Goldfädchen aus einem Felsen kratzen. Martin arbeitete bei einer Firma in Northbrook, er war so eine Art Computertechniker. Er ging zu Abendseminaren auf dem Chicago Circle Campus der Universität Illinois, aber er verdiente gutes Geld an seinem Arbeitsplatz, und Kitty fand, er brauchte kein Studium.
Martin hatte nie viel von der Arbeit erzählt, aber er schien sie zu mögen, er machte oft Überstunden, obwohl sie ihm nicht bezahlt wurden. »Ich habe ihm immer gesagt, dass die ihn einfach nur ausbeuten, aber er sagt, er lernt so viel dabei, dass er mit Gewinn rauskommt. Hat er jedenfalls früher gesagt.«
Dann, vor etwa sechs Wochen, hatte ihn etwas erschüttert. Er hatte schon immer viel Zeit allein in seinem Zimmer verbracht, aber jetzt hockte er entweder nur noch dort, oder er verschwand nach der Arbeit und blieb stundenlang weg. Er machte keine Überstunden mehr, er fing an, den Job wie einen Job zu erledigen. Kitty fand, so sollte es sein, oder vielmehr, das hätte sie gefunden, wenn er dabei nicht so düster geworden wäre.
»Hat er erzählt, was ihn bedrückt?«
»Er ist nicht gerade gesprächig. Ich auch nicht.« Kitty lächelte freudlos. »Ich schätze, wir waren ziemlich auf Len als Gesprächsführer angewiesen. Jedenfalls ging das so weiter, er brütete vor sich hin, ich musste ihn daran erinnern, etwas zu essen, und dann, vor zehn Tagen, ist er eines Morgens aufgebrochen wie immer. Nur kam er nach ein paar Stunden wieder nach Hause. Er blieb ein Weilchen in seinem Zimmer, dann, so gegen drei, ging er wieder weg.«
Das war das letzte Mal, dass seine Großmutter ihn gesehen oder von ihm gehört hatte.
»Wo wollte er hin?«
»Er hat es mir nicht gesagt. Er meinte nur, er hätte da etwas entdeckt, was nicht aufgeht, dann ist er los. Ich fing noch an zu putzen …«
Sie brach ab, als ich mich unwillkürlich in dem eingestaubten Wohnzimmer umsah.
»Ja, meine Großmutter hätte mir schön den Marsch geblasen, dass ich das Zimmer so verkommen lasse, aber seit Martin verschwunden ist, frage ich mich, wozu? Warum noch saubermachen, wenn eh alle weggehen?«
»Ihre Großmutter würde mich täglich ohrfeigen, wenn sie meine Wohnung sehen könnte«, versicherte ich ihr. »Etwas, was ›nicht aufgeht‹. Eine Rechnung? Ein Geldbetrag? Ist er vielleicht zur Bank gegangen?«
Sie schüttelte den Kopf, ihr Gesicht ganz verkniffen vor Unglück. »Ich weiß es nicht. Er sagte bloß, er müsste etwas prüfen, oder nachprüfen? Ich habe nicht richtig darauf geachtet. Ich dachte, es wäre nicht weiter wichtig, bis er dann nicht nach Hause kam.«
»Wann haben Sie angefangen, sich Sorgen zu machen?«
»Am Abend. Na ja, eigentlich am nächsten Tag. Ich dachte, wer weiß, vielleicht hat er ein Mädchen gefunden, mit der er die Nacht verbringt. Dann dachte ich, vielleicht ist er campen gegangen. Er hat manchmal einfach ein kleines Zelt eingepackt und ist für ein paar Tage runter nach Starved Rock oder rauf nach Wisconsin gefahren. Er hat ja keinen richtigen Urlaub mehr gemacht, seit er vor zwei Jahren diesen Job gekriegt hat – er hat da gleich nach der Highschool angefangen.«
»Würde er denn campen gehen, ohne es Ihnen zu sagen?«
»Schon möglich. Seit Len tot ist, erzählt mir Martin nicht mehr so gern von seinen Vorhaben. Aber als er dann immer noch nicht zurückkam, dachte ich, er hat sich vielleicht eine Wohnung gesucht. Wir hatten früher mal Diskussionen darüber. Aber er kann doch so viel Geld sparen, wenn er daheim lebt, und er hat ja seine eigene kleine Wohnung unten im Keller. Ich dachte, vielleicht ist er ausgezogen und hat nicht den Mut gehabt, es mir ins Gesicht zu sagen. Nur – er reagiert nicht auf Anrufe oder E-Mails oder sonst was.«
»Man kann doch einfach mal bei seinem Arbeitgeber nachfragen«, sagte ich.
Sie fing an, sich die dicken Kordeln ihrer Strickjacke um die Finger zu wickeln, und ihre Stimme senkte sich zum Flüstern. »Letzte Woche hat sein Chef angerufen: Martin war seit dem Tag vor seinem Verschwinden nicht mehr bei der Arbeit. Er reagiert auch auf deren Anrufe und E-Mails nicht.«
»Das klingt gar nicht gut«, sagte ich unverblümt. »Was meint die Polizei dazu?«
»Ich habe es nicht gemeldet. Was hätte das für einen Sinn?«
Ich wollte sie packen und schütteln. »Ihr Enkel ist seit zehn Tagen weg. Keine Anrufe, richtig? Keine Postkarten oder E-Mails? Nein? Höchste Zeit, dass die Polizei nach ihm sucht.«
»Nein!«, schrie sie auf. »Lassen Sie ihn bloß in Ruhe. Und gehen Sie ja nicht zur Polizei. Die Polizei ist noch schlimmer als – egal jetzt. Aber wenn Sie mit meinen Angelegenheiten zur Polizei gehen, dann – dann verklage ich Sie!«
Irritiert starrte ich sie an. Es war schwer vorstellbar, dass eine ältliche weiße Frau hier und heute Opfer polizeilicher Übergriffe geworden war. Vielleicht war es ein Überbleibsel aus Österreich unterm Naziregime, als die Polizei die Jagd auf Juden eröffnet hatte, aber ihre Heftigkeit ließ mich annehmen, dass sie sich von einer aktuelleren Gefahr bedroht sah. »Ms. Binder, wovor haben Sie denn Angst? Hat jemand aus den Kreisen Ihrer Tochter Ihnen gedroht?«
»Nein! Ich will mit der Polizei nichts zu tun haben. Was, wenn die –« Sie brach mitten im Satz ab.
»Wenn die was?«, hakte ich scharf nach.
»Leute wie Sie denken, die Polizei wär Freund und Helfer, aber ich weiß es besser, das ist alles. In meiner Familie lösen wir unsere Probleme selber. Ich brauch keine Polizei. Ich brauche Charlotte Herschels Herablassung nicht, und ich brauche Sie nicht!«
Von dieser Einstellung konnte ich sie keinen Millimeter abbringen, obwohl ich in Bezug auf die Gefahr, in der ihr Enkel schweben könnte, kein Blatt vor den Mund nahm.
»Womit ist er denn unterwegs? Hat er einen Wagen?«, fragte ich schließlich. Mit einem Autokennzeichen könnte ich die State Police bitten, nach ihm Ausschau zu halten.
»Len hat ihm einen gebrauchten Subaru gekauft, als ich – als wir beschlossen – als Martin auch fand, dass ein College bloß Zeit- und Geldverschwendung wäre. Aber damit ist er nicht gefahren, er steht noch vor der Tür.«
Sie hatte keine Ahnung, wie er weggekommen war, sie meinte, ein Taxi hätte sie hören müssen. Vielleicht war er einfach zur Bushaltestelle gegangen.
»Was hat er bei sich?«, fragte ich.
»Ich weiß es nicht. Ich sagte Ihnen doch schon, ich habe nicht groß darauf geachtet.«