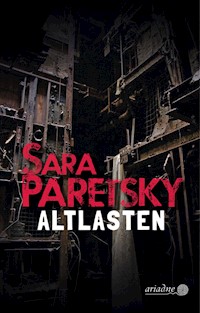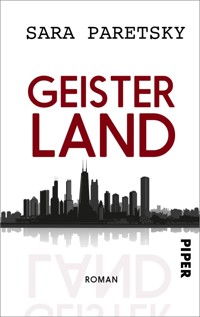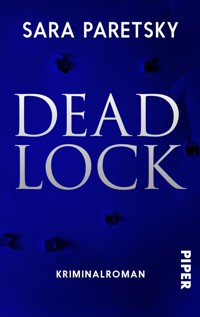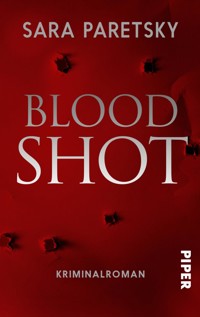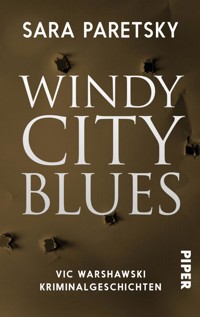6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der zwölfte Fall für Kultheldin Vic Warshawski! Eine ungewöhnliche Aufgabe wartet auf Privatdetektivin Vic Warshawski: Sie soll die Mädchen-Basketballmannschaft ihrer ehemaligen High School betreuen, was sich angesichts der problematischen Trainingsbedingungen als echte Herausforderung entpuppt. Vergeblich bemüht sich Vic, die Ladenkette BySmart als Sponsor zu gewinnen. Als sie das florierende Unternehmen etwas genauer unter die Lupe nimmt, stößt sie auf eine infame Intrige mit tödlichen Folgen – und schon bald ist auch ihr eigenes Leben in Gefahr …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Sybille Schmidt
ISBN: 978-3-98382-2
© dieser Ausgabe Piper Verlag GmbH, 2018
© 2005 Sara Paretsky
Titel der amerikanischen Originalausgabe »Fire Sale«
© Putnam Adult, a member of Penguin Group (USA) New York 2005
© der deutschsprachigen Ausgabe: Wilhelm Goldmann Verlag, Münche, in der Verlagsgruppe Randomhouse GmbH 2007
Published by Arrangement with Sara and two C-Dogs Inc
Covergestaltung: Favoritbüro, München
Covermotiv: Freedom Master/shutterstock
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Prolog
Reminiszenzen
Homie
Auftritt Romeo
Warenberge
Direkter Draht zur Hoheit
Mädchen bleibt Mädchen
Dicht an dicht
Innenleben einer Fabrik
Vernebelt
Gewerkschaften?Das möge der Himmel verhüten!
Wie im trauten Heim
Firmenpolitik
Auftrag für Schnüfflerin
Rückzug von Schnüfflerin
Herzschocker
Commander in Aktion
Frosch in der Jeans
Besuchszeit
Der gastfreundliche Mr. Contreras
Stippvisite
Freilaufender Büffel in Kirche
Mahlstrom der Armut
Unsternbedrohte Liebende
Noch ein verschwundenes Kind
Gutenachtgeschichten
Annie, Get Your Gun
Tod im Sumpf
Es ist ein Vogel, es ist ein Flugzeug, nein, es ist…
Abgetaucht – mal wieder
Waffenbrüder
Freigang für Versehrte
Den Pastor ans Kreuz nageln
Glückliche Familien sind alle gleich, unglückliche Familien…
Und die Reichen sind auch nicht glücklich
Freddy, na so eine Überraschung!
Schon wieder vor die Tür gesetzt
Wo die wilden Büffel hausen
Primitive Kunst
Schmerzhaftes Rausbohren
Ein Hauch von Säure
Chavo in der Klemme
Das Versteck
Die Flüchtenden
Der Aufnahmeengel oder -teufel?
Wie der letzte Dreck
Siehe da – der entwendete Füller
Büroparty
Tanzendes Rhinozeros
Danke
Widmung
Für Rachel, Phoebe, Eva, Samantha und Maia – meine eigenen Hoffnungen für eine bessere Welt
Prolog
Als der orangerote Blitz aufflammte, befand ich mich auf halber Höhe der Böschung. Ich ließ mich zu Boden fallen und schützte den Kopf mit den Armen. Der Schmerz, der mir in die Schulter fuhr, war so schlimm, dass mir die Luft wegblieb.
Da lag ich nun mit dem Gesicht in Adlerfarn und irgendwelchem Müll und hechelte mit glasigen Augen wie ein Hund, bis der Schmerz so weit nachließ, dass ich mich rühren konnte. Auf allen vieren kroch ich von den Flammen weg, dann richtete ich mich halb auf und saß eine Weile ganz still. Atmete tief und langsam, um den Schmerz wegzudrängen. Schließlich berührte ich behutsam die linke Schulter. Etwas Längliches, ein Stück Metall oder Glas vom Fenster, das herausgeschossen war wie ein Pfeil. Ich versuchte, daran zu ziehen, worauf mich eine heftige Schmerzwelle erfasste und mir fast schwarz vor Augen wurde. Ich beugte mich vor und legte den Kopf auf die Knie.
Als die Welle nachließ, schaute ich zu der Fabrik hinüber. Aus dem explodierten Fenster an der Rückseite loderte ein Feuer, eine blaurote Wand, so massiv, dass ich keine einzelnen Flammen unterscheiden konnte, nur glühende Farben. Dort waren Stoffballen gelagert, die natürlich gut brannten.
Frank Zamar. Der fiel mir nun schlagartig ein. Wo hatte er sich während der Explosion aufgehalten? Ich rappelte mich mühsam auf und stolperte los.
An der Tür zerrte ich meine Dietriche raus und versuchte, das Schloss aufzukriegen, während mir vor Schmerz die Tränen übers Gesicht liefen. Erst beim dritten vergeblichen Versuch fiel mir mein Handy ein. Ich holte es aus der Tasche und rief die Feuerwehr an.
Dann mühte ich mich weiter mit dem Schloss ab, wobei ich die dünnen Metallstäbe kaum handhaben konnte. Ich versuchte, die linke Hand wenigstens zum Stützen zu benutzen, aber es gelang mir nicht, die Dinger ruhig zu halten.
Mit diesem Brand hatte ich nicht gerechnet – ich hatte mit gar nichts gerechnet, als ich hierherkam. Eigentlich war ich auf dem Heimweg nur bei Fly the Flag vorbeigefahren, weil mir irgendwas keine Ruhe ließ. Ich war schon auf der Route 41, als ich spontan beschloss, der Fabrik noch einen Besuch abzustatten. Ich wendete, fuhr auf die Escanaba und fädelte mich durch das Gewirr kleiner Straßen zur South Chicago Avenue durch. Als ich bei Fly the Flag vorbeikam, war es sechs Uhr und schon dunkel, doch auf dem Parkplatz standen noch ein paar Autos. Leute sah ich keine, aber in dieser Gegend geht selten einer zu Fuß; nur ein paar Wagen waren unterwegs, Einheimische, die in den wenigen hier verbliebenen Fabriken arbeiteten und zur nächsten Bar oder sogar nach Hause fuhren.
Ich parkte den Mustang in einer Seitenstraße und hoffte, dass ihn keiner aus Lust und Laune zerdeppern würde. Handy und Brieftasche verstaute ich in meinen Manteltaschen, dann holte ich die Dietriche aus dem Handschuhfach und schloss meine Tasche im Kofferraum ein.
Es war ein kalter, düsterer Novemberabend, was mir zugute kam, als ich die steile Böschung hinter der Fabrik hochkraxelte. Auf dieser Anhöhe verläuft die Mautstraße, oberhalb meines alten Wohnviertels. Das Dröhnen der Autos auf dem Skyway übertönte sämtliche Geräusche, die ich verursachte – inklusive dem unterdrückten Aufschrei, als ich mit einem Fuß in einem Autoreifen hängen blieb und unsanft zu Boden ging.
Von meinem Aussichtspunkt unter der Brücke konnte ich nur die Rückfront und den seitlichen Hof der Fabrik sehen. Als um sieben die Schicht zu Ende war, sichtete ich schattenhafte Gestalten, die zur Bushaltestelle tappten, und ein paar Autos, die über die unebene Zufahrt zur Straße holperten.
Die Lichter an der Nordseite waren noch an, und auch aus einem der Kellerfenster auf meiner Seite drang ein fahler Lichtschein. Wenn Frank Zamar sich noch auf dem Gelände aufhielt, konnte er mit allem Möglichen beschäftigt sein, von Lagerbestände checken bis tote Ratten in der Lüftung deponieren. Ich beschloss, den Müll an der Böschung nach einer Kiste zu durchforsten, auf die ich vielleicht steigen konnte, um durch das Fenster an der Rückseite zu spähen. Auf halber Höhe des Abhangs stöberte ich in dem Schutt herum, als besagtes Fenster kurz dunkel wurde und dann grellrot aufloderte.
Als ich jetzt die Sirenen auf der South Chicago Avenue hörte, fummelte ich immer noch an dem Schloss herum. Zwei Spritzenwagen, ein Kommandowagen und eine ganze Phalanx von Streifenwagen kamen auf den Parkplatz gerast.
Schlagartig war ich umgeben von Männern in schwarzen Regenmänteln. Vorsicht hier, Miss, treten Sie beiseite, wir haben’s im Griff, das Krachen, als Äxte durch Metall brachen, mein Gott – schau dir mal das Ding in ihrer Schulter an, ruf einen Krankenwagen, eine riesige Handschuhhand, die mich so mühelos hochhob, als wäre ich ein Kind und nicht eine 64 Kilo schwere Privatdetektivin, und dann, als ich mit den Füßen nach draußen auf dem Beifahrersitz des Kommandowagens hockte, wieder hechelnd vor Schmerz, eine vertraute Stimme:
»Ms. W., um Himmels willen, was machst du hier?«
Ich blickte verblüfft auf und war unsagbar erleichtert. »Conrad! Wo kommst du denn her? Woher wusstest du, dass ich hier bin?«
»Wusste ich nicht, aber ich hätte mir denken können, dass du irgendwo in der Nähe bist, wenn in meinem Revier Häuser in die Luft fliegen. Was ist passiert?«
»Ich weiß nicht.« Die Schmerzwelle überrollte mich wieder, zog mir den Boden unter den Füßen weg. »Zamar. Wo ist er?«
»Wer ist Zamar? Dein jüngstes Opfer?«
»Der Fabrikbesitzer, Commander«, sagte ein Mann, den ich nicht sehen konnte. »Sitzt da drin fest.«
Ein Funkgerät quäkte, Handys klingelten, Männer redeten durcheinander, Maschinen dröhnten, Feuerwehrleute mit rußschwarzen Gesichtern trugen einen verkohlten Körper vorbei. Ich machte die Augen zu und erlaubte der Welle, mich davonzutragen.
Ich kam kurz zu mir, als der Krankenwagen eintraf. Es gelang mir noch, mich selbstständig zur Tür zu schleppen, aber dann musste der Sanitäter mich reinheben. Als sie mich in einer unbequemen Position, auf der Seite liegend, festgeschnallt hatten und der Wagen losruckelte, zog sich alles in mir zusammen vor Schmerz. Wenn ich die Augen zumachte, wurde mir übel, aber öffnen konnte ich sie auch nicht, weil mir dann das Licht durch Mark und Bein ging.
Als der Wagen auf den Hof des Krankenhauses einbog, sah ich kurz das Schild mit dem Namen, aber ich war vor allem damit beschäftigt, die Fragen der Triageschwester zu beantworten. Ich schaffte es irgendwie, meine Versicherungskarte aus meiner Brieftasche zu nesteln, Formulare auszufüllen, Lotty Herschel als meine Hausärztin anzugeben und zu sagen, dass sie Mr. Contreras benachrichtigen sollten, falls mir etwas zustieße. Ich wollte auch Morrell anrufen, aber ich durfte mein Handy nicht benutzen und war überdies auf eine Trage verfrachtet worden. Irgendein Jemand stach mir eine Nadel in den Handrücken, andere Jemands verkündeten, dass sie meine Kleider aufschneiden müssten.
Ich wollte protestieren, weil ich unter meiner marineblauen Seemannsjacke einen guten Hosenanzug trug, aber da wirkte die Droge bereits, und ich gab irgendein sinnloses Kauderwelsch von mir. Ich war nicht vollständig narkotisiert, aber sie mussten mir eine Gedächtnisdroge gegeben haben, denn ich konnte mich später weder daran erinnern, wie mir die Kleider vom Leib geschnitten wurden, noch daran, wie man mir den Teil des Fensterrahmens aus der Schulter entfernte.
Als ich zu einem Bett gerollt wurde, war ich bei Bewusstsein. Die Teilnarkose und ein Pochen in der Schulter rissen mich immer wieder aus dem Schlaf, wenn ich einzudösen drohte. Als die Ärztin um sechs Uhr morgens ins Zimmer kam, war ich wach, aber so grauenvoll müde, dass ich die Welt wie durch eine Watteschicht wahrnahm.
Die Ärztin hatte selbst die ganze Nacht kein Auge zugetan, sondern Notfälle wie mich operiert. Sie sah völlig übernächtigt aus, war aber so jung, dass sie es noch schaffte, mit heller, fast munterer Stimme zu sprechen, als sie sich auf einem Stuhl an meinem Bett niederließ.
»Als das Fenster explodiert ist, hat sich ein Stück vom Rahmen in Ihre Schulter gebohrt. Sie können von Glück sagen, dass es gestern Abend kalt war, denn Ihr Mantel hat den Splitter abgebremst.« Sie hielt ein fünfzig Zentimeter langes verbogenes Metallstück hoch – ein Souvenir, falls ich Wert darauf legte.
»Wir werden Sie jetzt nach Hause schicken«, verkündete sie, nachdem sie mein Herz, den Kopf und die Reflexe meiner linken Hand untersucht hatte. »So funktioniert die Medizin heute, wissen Sie. Raus aus dem Operationssaal und ab ins Taxi. Ihre Wunde wird schön verheilen. Der Verband darf allerdings eine Woche lang nicht nass werden, also keine Dusche, bitte. Kommen Sie nächsten Freitag in die Ambulanz, dann wechseln wir den Verband und schauen, wie es Ihnen geht. Was arbeiten Sie?«
»Ich bin Ermittlerin. Privatdetektivin.«
»Würden Sie dann bitte ein bis zwei Tage aufs Ermitteln verzichten? Ruhen Sie sich aus, warten Sie ab, bis Ihr Körper die Narkose verarbeitet hat, dann geht’s Ihnen wieder gut. Können Sie jemanden anrufen, der Sie abholt, oder sollen wir Sie in ein Taxi setzen?«
»Ich habe gestern Abend darum gebeten, dass man einen Freund von mir unterrichtet«, sagte ich. »Aber ich weiß nicht, ob sich jemand drum gekümmert hat.« Außerdem wusste ich nicht, ob Morrell die Fahrt hierher schaffen würde. Er war im Sommer in Afghanistan angeschossen worden und befand sich noch in der Rekonvaleszenzzeit; ich wusste nicht, ob er es sich zutraute, fünfzig Kilometer mit dem Auto zu fahren.
»Ich bring sie nach Hause.« Conrad Rawlings war in der Tür aufgetaucht.
Ich fühlte mich zu matschig, um erstaunt, erfreut oder gar geschmeichelt zu sein ob seiner Anwesenheit. »Sergeant – oder nein, du bist befördert worden, stimmt’s? Muss ich jetzt Lieutenant sagen? Stattest du allen Opfern vom Abend vorher einen Besuch ab?«
»Nur denen, die nicht weiter als achtzig Kilometer vom Tatort entfernt waren und Alarm geschlagen haben.« Sein kantiges, kupferfarbenes Gesicht war ziemlich ausdruckslos, keine Spur von Sorge oder vom Zorn des einstigen Liebsten, der seinerzeit sehr wütend gewesen war, als er mich verließ. »Und, ja, ich bin befördert worden, bin jetzt Watch Commander im Revier an der 103rd, Ecke Oglesby. Du findest mich im Eingangsbereich, wenn die Frau Doktor hier dich für fit genug befindet, die South Side in die Luft zu jagen.«
Die Ärztin unterzeichnete meine Entlassungspapiere, schrieb mir ein Rezept für Schmerzmittel und reichte mich an die Schwestern weiter. Eine Schwesternschülerin händigte mir die Überreste meiner Kleidung aus. Die Hose konnte ich noch anziehen, obwohl sie nach Rauch stank und mit Bestandteilen der Böschung durchsetzt war, aber mein Mantel, mein Sakko und die rosa Seidenbluse waren an den Schultern aufgeschlitzt worden. Sogar den BH-Träger hatten sie durchgeschnitten. Beim Anblick der Seidenbluse und des Sakkos hätte ich am liebsten losgeheult. Beides gehörte zu einem Lieblingsoutfit von mir, das ich gestern Morgen zu einer Präsentation bei einem Klienten in der City getragen hatte, bevor ich in die South Side fuhr.
Die Schwesternschülerin nahm wenig Anteil an meiner Trauer, fand aber auch, dass ich schlecht halb nackt draußen rumlaufen konnte. Sie begab sich zur Stationsschwester, die irgendwo ein altes Sweatshirt für mich organisierte. Bis das alles geklärt war und wir einen Krankenpfleger aufgetrieben hatten, der mich im Rollstuhl in die Eingangshalle beförderte, war es fast neun.
Conrad hatte es sich erlaubt, mit seinem Dienstwagen direkt vor dem Eingang zu parken, und war dann dort eingeschlafen, aber er wurde wach, als ich die Beifahrertür öffnete.
»Uff. War ‘ne lange Nacht, Ms. W.« Er rieb sich die Augen und startete den Wagen. »Wohnst du noch in der alten Bude oben an der Wrigley? Ich hab gehört, wie du einen Freund erwähnt hast bei der Ärztin.«
»Ja.« Zu meinem Ärger klang ich ziemlich krächzend, und mein Mund fühlte sich trocken an.
»Nicht dieser Ryerson, hoffe ich doch.«
»Nein, nicht dieser Ryerson. Morrell. Schriftsteller. Ist im Sommer bei Recherchen in Afghanistan ziemlich zusammengeschossen worden.«
Conrad gab eine Art Grunzen von sich, dem zu entnehmen war, dass zusammengeschossene Schreiberlinge ihn wenig beeindruckten; er war in Vietnam von einem Maschinengewehr unter Beschuss genommen worden.
»Ich hab übrigens von deiner Schwester gehört, dass du auch nicht grade einen mönchischen Eid abgelegt hast.« Conrads Schwester Camilla und ich gehören beide dem Vorstand desselben Frauenhauses an.
»Flotte Sprüche waren ja schon immer dein Ding, Ms. W. Einen mönchischen Eid. Nein, hab ich in der Tat keinen abgelegt.«
Wir verfielen beide in Schweigen. Conrad steuerte seinen Dienstwagen, einen Buick, nach Jackson Park, wo wir uns in den dichten Verkehr einfädelten, den letzten Rest der Früh-Rushhour, und durch die Baustellen Richtung Lake Shore Drive vorarbeiteten. Die matte Herbstsonne versuchte, durch die Wolkendecke zu brechen, und verbreitete ein fahles Licht, das mir in den Augen wehtat.
»Du sagtest Tatort«, äußerte ich schließlich, um das Schweigen zu brechen. »War es Brandstiftung? War das Frank Zamar, den die Feuerwehrleute rausgetragen haben?«
Conrad gab ein weiteres Grunzen von sich. »Das wissen wir erst, wenn der Gerichtsmediziner sich meldet, aber man kann wohl davon ausgehen – ich hab mit dem Vorarbeiter gesprochen, und der meinte, als die Schicht aus war, hielt sich nur noch Zamar im Gebäude auf. Und ob es Brandstiftung war, kann ich auch erst sagen, wenn die Sondereinheit sich alles angesehen hat, aber der Typ ist jedenfalls nicht an Unterernährung gestorben.«
Er wechselte das Thema und erkundigte sich nach meiner alten Freundin Lotty Herschel, gab seinem Erstaunen Ausdruck, dass er sie nicht im Krankenhaus gesehen hätte, wo sie doch Ärztin und meine große Beschützerin sei.
Ich erklärte ihm, dass ich keine Zeit gehabt hatte, um Anrufe zu machen. Dennoch sann ich über Morrell nach, aber das wollte ich Conrad nicht auf die Nase binden. Vermutlich hatte ihn niemand vom Krankenhaus angerufen, denn sonst hätte er sich auf jeden Fall gemeldet, auch wenn er nicht kommen konnte. Ich bemühte mich, nicht an Marcena Love zu denken, die derzeit in Morrells Gästezimmer wohnte. Aber sie war dieser Tage ohnehin anderweitig beschäftigt. Oder eher dieser Nächte. Unvermittelt fragte ich Conrad, wie es ihm gefiel, so weit entfernt vom Mittelpunkt des Geschehens zu arbeiten.
»Wenn du bei der Polizei bist, dann ist South Chicago der Mittelpunkt des Geschehens«, antwortete er. »Mord, Gangs, Drogen – hier haben wir das ganze Programm. Und Brandstiftung, massenhaft, wenn diese alten Fabrikgebäude und sonst was an die Versicherungsfirmen verkauft werden.«
Er hielt vor meinem Haus. »Dieser alte Knabe, Contreras, wohnt der immer noch im Parterre? Müssen wir erst wieder ‘ne Stunde mit dem quasseln, bevor wir hochgehen können?«
»Vermutlich. Und ›wir‹ gibt’s nicht, Conrad: Ich komme alleine die Treppe hoch.«
»Ich weiß, dass du dafür stark genug bist, Ms. W., aber du glaubst doch wohl nicht, dass ich aus nostalgischer Sehnsucht nach deinen schönen grauen Augen heute früh im Krankenhaus aufgetaucht bin, oder? Wir werden uns ein bisschen unterhalten, wir beide, und du wirst mir haarklein berichten, was du gestern Abend bei Fly the Flag zu suchen hattest. Woher wusstest du, dass der Laden in die Luft fliegen würde?«
»Das wusste ich überhaupt nicht«, knurrte ich. Ich war todmüde, die Wunde schmerzte, die Narkose steckte mir noch in den Knochen.
»Ja, und ich bin der Ayatollah von Detroit. Wo immer du dich aufhältst, werden Leute angeschossen, massakriert oder umgebracht, also wusstest du entweder, dass das passieren würde, oder du warst selbst dafür verantwortlich. Was interessiert dich so an dieser Fabrik?«
Seine Stimme klang bitter, aber diese Anschuldigung machte mich so wütend, dass ich schlagartig munter war. »Vor vier Jahren bist du angeschossen worden, weil du nicht geglaubt hast, dass ich was wusste. Jetzt willst du mir nicht glauben, dass ich nichts weiß. Ich hab es satt, dass du mir nie was glaubst.«
Er verzog die Lippen zu einem niederträchtigen Copgrinsen. Sein goldener Schneidezahn glitzerte in der fahlen Sonne. »Dann werde ich deinen Wunsch jetzt erhören. Ich werde jedes einzelne Wort von dir glauben. Wenn wir das Spießrutenlaufen hinter uns gebracht haben.«
Den letzten Satz murmelte er nur noch, da Mr. Contreras und die beiden Hunde, die meinem Nachbarn und mir gemeinsam gehören, bereits nach mir Ausschau gehalten hatten und zu dritt die Treppe heruntergestürmt kamen, als ich aus dem Wagen stieg. Mr. Contreras allerdings zögerte, als er Conrad erblickte. Er war ohnehin nie dafür gewesen, dass ich ein Verhältnis mit einem schwarzen Mann hatte, hatte mich aber gehätschelt, als Conrad mich verließ, und war nun völlig verdattert, uns zusammen zu sehen. Die Hunde dagegen hatten keinerlei Vorbehalte. Ob sie sich an Conrad erinnerten oder nicht – Peppy, eine Golden-Retriever-Hündin, und ihr Sohn Mitch, der zur Hälfte Labradorblut hat, begrüßen jeden gleich stürmisch, den Parkuhrenableser wie den Sensenmann.
Mr. Contreras folgte ihnen in gemäßigtem Tempo. Als er meine Verletzung bemerkte, war er besorgt und verärgert, weil ich mich nicht gemeldet hatte. »Ich hätte Sie doch abgeholt, Herzchen, wenn Sie’s mir gesagt hätten, wär doch keine Polizei-Eskorte nötig gewesen.«
»Es ist spätabends passiert, und sie haben mich gleich heute früh rausgelassen«, erklärte ich geduldig. »Conrad ist jetzt übrigens Commander im Fourth District. Diese Fabrik, in der es gestern Abend gebrannt hat, liegt in seinem Revier, und jetzt möchte er gerne erfahren, was ich darüber weiß – er will mir nämlich nicht glauben, dass ich keinen blassen Schimmer habe.«
Schließlich begaben wir uns alle zusammen in meine Wohnung – die Hunde, der alte Mann, Conrad. Mein Nachbar kramte in meiner Küche herum und servierte mir dann eine Schale Yoghurt mit Apfelschnitzen und braunem Zucker. Es gelang ihm sogar, meinem betagten Espressokocher eine große Tasse abzuringen.
Ich machte mich auf der Couch lang, die Hunde auf dem Boden daneben. Mr. Contreras ließ sich im Sessel nieder, und Conrad rückte sich den Klavierstuhl so zurecht, dass er mein Gesicht beobachten konnte, während ich redete. Er förderte einen Kassettenrekorder zutage und gab Datum und Ort ein.
»Okay, Ms. W., das ist jetzt offiziell. Erzähl mir, was du in South Chicago zu suchen hattest, und zwar die ganze Geschichte.«
»Das ist meine Heimat«, antwortete ich. »Ich gehöre da mehr hin als du.«
»Vergiss es. Du lebst seit über fünfundzwanzig Jahren nicht mehr dort.«
»Spielt keine Rolle. Du weißt so gut wie ich, dass du das Viertel, in dem du groß geworden bist, dein Leben lang nicht mehr loswirst.«
Reminiszenzen
Die Rückkehr nach South Chicago ist für mich immer eine Rückkehr zum Tod. Die Menschen, die ich am meisten geliebt habe, die mir in meiner Kindheit am wichtigsten waren, starben alle in diesem verwaisten Viertel am südöstlichen Rand der Stadt. Der Leib meiner Mutter, die Asche meines Vaters sind zwar nicht in South Chicago bestattet, aber während ihrer schlimmen Krankheit habe ich beide dort gepflegt. Mein Cousin Boom-Boom, der mir näher war als ein Bruder, wurde vor fünfzehn Jahren dort ermordet. In meinen Albträumen werde ich vom dichten, gelben Rauch der Stahlwerke bedrängt, doch die gewaltigen Schornsteine, die in meiner Kindheit hier aufragten, sind heute selbst nur noch Geister.
Nach Boom-Booms Begräbnis hatte ich mir geschworen, mich nie wieder in die South Side zu begeben, doch solche Gelübde sind albern und bombastisch, weil man sie nicht einhalten kann. Dennoch versuche ich immer noch, daran festzuhalten. Als meine einstige Basketball-Trainerin bei mir anrief, um mich zu bitten – oder vielmehr zu beauftragen –, sie wegen ihrer Krebsoperation zu vertreten, sagte ich erst mal automatisch: »Nein.«
»Victoria, du hast es durch den Basketball geschafft, aus der Gegend rauszukommen. Du bist den Mädchen, die jetzt in derselben Lage sind wie du damals, etwas schuldig. Sie sollen die Chance auch haben.«
Ich erwiderte, nicht Basketball, sondern die Entschlossenheit meiner Mutter, die mir um jeden Preis ein Studium ermöglichen wollte, hätten mich aus South Chicago rausgebracht. Und meine Abschlussnoten, die verdammt gut waren. Mary Ann McFarlane versetzte darauf, das Sportstipendium für die University of Chicago habe wahrlich auch nicht geschadet.
»Weshalb kümmert sich denn die Schule nicht um eine Ersatztrainerin?«, wandte ich bockig ein.
»Glaubst du, ich bekomme Geld von der Schule?« Mary Ann klang aufgebracht. »Es handelt sich hier um die Bertha Palmer High, Victoria. Um South Chicago. Die haben kein Geld, und jetzt sind sie auch noch von der Schulbehörde schlecht eingestuft worden, das heißt, jeder Cent wird für die Vorbereitung auf Standardtests ausgegeben. Sie erhalten das Training für die Mädchen nur aufrecht, weil ich umsonst arbeite, und wir hängen ohnehin schon am Tropf. Ich muss ständig irgendwo schnorren, damit wir Trikots und Ausrüstung bekommen.«
Mary Ann McFarlane hatte an der Bertha Palmer auch Latein unterrichtet und sich für Mathematik ausbilden lassen, als die Schule nur noch Spanisch und Englisch anbot. Und in den ganzen Jahren hatte sie dort Basketballmannschaften trainiert. Das alles wurde mir erst bewusst, als sie mich anrief.
»Es sind nur zwei Stunden zwei Nachmittage die Woche«, fügte sie hinzu.
»Plus eine Stunde Fahrzeit pro Strecke«, sagte ich. »Ich schaffe das nicht, ich habe eine Detektei, arbeite derzeit ohne Assistentin, muss mich um meinen Partner kümmern, der in Afghanistan zusammengeschossen wurde. Und meine Wohnung und zwei Hunde habe ich auch am Bein.«
Coach McFarlane zeigte sich davon wenig beeindruckt; das waren für sie nur Ausflüchte. »Quotidie damnatur qui semper timet«, sagte sie erbost.
Ich musste mir den Satz mehrmals stumm wiederholen, bevor ich ihn übersetzen konnte: Wer sich immer fürchtet, ist Tag für Tag verdammt. »Ja, mag sein, aber ich habe seit zwanzig Jahren keinen Wettkampf-Basketball mehr gespielt. Die jungen Frauen, die samstags immer zu unseren Streetball-Spielen ins YMCA kommen, spielen viel schneller und härter als wir damals. Vielleicht kann eine von diesen Zwanzigjährigen zwei Nachmittage pro Woche erübrigen – ich werd mich gleich dieses Wochenende drum kümmern.«
»Du kriegst doch keines von diesen jungen Dingern hier zur 90th, Ecke Houston«, gab Mary Ann scharf zurück. »Das ist deine Gegend hier, hier sind deine Nachbarn, nicht in diesem aufgemotzten Lakeview, wo du dich gerne verkriechen möchtest.«
Diese Bemerkung ärgerte mich so, dass ich am liebsten aufgelegt hätte, aber dann sagte Mary Ann: »Nur bis die Schule jemanden findet, Victoria. Vielleicht geschieht ja auch ein Wunder, und ich komme wieder.«
Da wurde mir klar, dass sie sterben würde. Und mir wurde klar, dass ich ein weiteres Mal nach South Chicago zurückkehren und mich dem Schmerz aussetzen musste.
Homie
Der Lärm war ohrenbetäubend. Die Bälle knallten auf den abgenutzten gelben Linoleumboden, prallten von den Backboards und der Zuschauertribüne am Spielfeld ab. Das rhythmische Trommeln war so donnernd laut wie ein Orkan. Die Mädchen trainierten Korbleger und Freiwürfe, Rebounds, Dribbling zwischen den Beinen und hinter dem Rücken. Nicht alle hatten einen eigenen Ball, dafür reichte das Schulbudget nicht, aber mit zehn Bällen kann man auch schon einen Höllenkrach machen.
Die Halle selbst sah aus, als sei sie seit meiner Schulzeit nicht geputzt, geschweige denn gestrichen worden. Es roch nach altem Schweiß, und zwei der Deckenstrahler waren kaputt, sodass es hier drin permanent Februar zu sein schien. Der Boden war zerkratzt und teilweise aufgequollen, und wenn man an der Freiwurflinie oder der linken Ecke – den beiden schlimmsten Stellen – nicht aufpasste, machte man eine Bauchlandung. Letzte Woche hatte eine unserer beiden talentierten Aufbauspielerinnen sich auf diese Weise den Knöchel verstaucht.
Ich hatte mir vorgenommen, mich von der bedrückenden Atmosphäre nicht runterziehen zu lassen. Immerhin gab es an der Bertha Palmer sechzehn Mädchen, die spielen wollten, und einige von denen waren mit Leib und Seele bei der Sache. Ich war verpflichtet, ihnen zu helfen, bis die Schule eine neue Trainerin gefunden hatte. Musste ihnen den Rücken stärken, wenn die Saison anfing und sie gegen Mannschaften antreten sollten, die unter viel besseren Umständen trainieren konnten – und mit besseren Coaches.
Die Mädchen, die unter den Körben herumlungerten, sollten sich eigentlich warmlaufen oder stretchen. Stattdessen versuchten sie, den anderen die Bälle wegzugrapschen, oder schrien herum, dass April Czernin und Celine Jackman sich zu viel Zeit ließen beim Abwerfen.
»Deine Mam hat nicht die Beine breit gemacht, um für den Ball zu blechen – her damit!«, wurde gerne gegrölt. Ich musste die Streitereien im Auge behalten, damit sie nicht eskalierten, aber zugleich die sportlichen Fehler korrigieren. Bei all dem tat ich gut daran, mich nicht vom Geheul des Babys und des Kleinkinds auf der Zuschauertribüne ablenken zu lassen. Sie gehörten zu meiner Center-Spielerin, Sancia, einer schlaksigen Sechzehnjährigen, die selbst noch ein Babygesicht hatte, obwohl sie fast eins neunzig war. Ihr Freund sollte auf die Kinder aufpassen, doch der hockte mit dem Discman auf den Ohren stumpfsinnig neben ihnen und starrte vor sich hin.
Und ich durfte mich nicht von Marcena Love nervös machen lassen, obwohl deren Anwesenheit sowohl den Trainingseinsatz als auch den Ausstoß an Beleidigungen beflügelte. Marcena war weder Talentscout noch Trainerin, sie verstand nicht mal sonderlich viel vom Spiel, aber die Mädchen reagierten heftig auf ihr Dasein.
Als Marcena – unsäglich aufgedonnert mit schwarzem Prada-Spandex-Kleid und wuchtiger Ledertasche – mit mir anrückte, stellte ich sie kurz vor: Sie war eine Journalistin aus England, die sich Notizen machen und in den Pausen mit der Mannschaft reden wollte.
Die Mädchen hätten sie so oder so bewundert, aber als sich auch noch herausstellte, dass Marcena vom Usher-Konzert im Wembley-Stadion berichtet hatte, kreischten sie aufgeregt los.
»Reden Sie mit mir, Miss, mit mir!«
»Hör’n Sie nicht auf die, ‘ne größere Lügnerin gibt’s in der ganzen South Side nicht.«
»Wollen Sie mich nicht fotografieren, wenn ich einen Sprungwurf mache? Ich werd dieses Jahr Auswahlspielerin.«
Ich hätte sie nur mit dem Brecheisen von Love weggebracht. Sie schielten sogar noch zu ihr rüber, während sie sich um den Ball und die Würfe zankten.
Ich schüttelte den Kopf: Ich ließ mich selbst viel zu sehr von Love ablenken. Ich nahm April Czernin, auch eine gute Aufbauspielerin, den Ball ab und versuchte, ihr zu zeigen, wie sie rückwärts zur Freiwurflinie dribbeln, sich dann im letzten Moment umdrehen und diesen Sprungwurf machen konnte, mit dem Michael Jordan berühmt wurde. Wenigstens landete der Ball im Korb, sehr von Vorteil, wenn man grade was vorführen möchte. April machte den Spielzug ein paar Mal, worauf schon wieder eine Stimme laut wurde: »Wieso darf die den Ball behalten, und ich komm nicht dran, Coach?«
Mir war immer noch unbehaglich zumute, wenn sie mich »Coach« nannten. Ich wollte mich an den Job hier nicht gewöhnen, er sollte ein Gastspiel bleiben. Für diesen Nachmittag hatte ich mir vorgenommen, eine Sponsorfirma aufzutreiben, die bereit war, einen Profi oder wenigstens Halbprofi zu bezahlen, der die Mannschaft unter die Fittiche nehmen konnte.
Als ich mit der Trillerpfeife das Ende des Aufwärmtrainings ankündigte, tauchte Theresa Diaz vor mir auf.
»Ich hab meine Periode, Coach.«
»Prima«, sagte ich. »Du bist nicht schwanger.«
Sie wurde rot und blickte finster; obwohl ständig etwa fünfzehn Prozent der Klasse schwanger waren, fanden die Mädchen das Thema Körper peinlich und sprachen nicht gerne darüber. »Ich muss mal aufs Klo, Coach.«
»Immer nur eine, du kennst die Regeln. Wenn Celine zurückkommt, kannst du gehen.«
»Aber, Coach, meine Shorts, Sie wissen schon.«
»Du kannst auf der Bank warten, bis Celine wieder da ist«, gab ich zurück. »Und die anderen: Bildet zwei Reihen, wir üben Korbleger und Rebounds.«
Theresa seufzte gequält und schlenderte betont langsam zur Bank.
»Bringt diese Form von Machtdemonstration hier was? Spielt das Mädchen besser, wenn sie gedemütigt wird?« Marcena Loves Stimme war so hell und klar, dass die beiden Mädchen in ihrer Nähe das Gezanke um den Ball schlagartig aufgaben, um zu lauschen.
Josie Dorrado und April Czernin blickten von Love zu mir und warteten gespannt ab. Ich konnte – durfte – jetzt nicht aus der Haut fahren. Vielleicht bildete ich mir ja auch nur ein, dass Love beabsichtigte, mich zur Raserei zu treiben.
»Wenn ich sie demütigen wollte, würde ich sie zum Klo verfolgen und nachsehen, ob sie wirklich ihre Periode hat.« Ich sprach laut, damit alle mithören konnten. »Ich gebe vor, ihr zu glauben, weil es ja wirklich stimmen könnte.«
»Glaubst du, sie will nur eine rauchen?«
Jetzt sprach ich leiser. »Celine, das Mädchen, das vor fünf Minuten auf die Toilette verschwunden ist, legt sich mit mir an. Sie ist Anführerin einer der Mädchen-Gangs in der South Side, den sogenannten Pentas, und Theresa ist eine ihrer Gefolgsfrauen. Wenn Celine es schafft, während des Trainings auf dem Klo ein kleines Gangtreffen abzuhalten, hat sie die Mannschaft im Griff.«
Ich schnipste mit den Fingern. »Aber du könntest natürlich Notizen von den Wünschen und Träumen der beiden Mädels machen. Da wären sie endlos begeistert. Und du könntest in deiner Reportage einen Vergleich zwischen den Schulklos in der South Side von Chicago und denen in Bagdad und Brixton anstellen.«
Love bekam große Augen und lächelte dann entwaffnend. »Entschuldige. Du kennst deine Mannschaft. Aber ich dachte, der Sport soll die Mädchen aus den Gangs raushalten.«
»Josie! April! Zwei Reihen, eine wirft, eine macht Rebounds, ihr wisst, wie’s läuft.« Ich wartete ab, bis alle sich aufgestellt hatten und mit den Würfen begannen.
»Soll sie auch davon abhalten, schwanger zu werden.« Ich wies Richtung Zuschauertribüne. »Sechzehn Mädchen sind in der Mannschaft, und nur eine ist Mutter. Und das an einer Schule, an der fast die Hälfte der Mädchen Babys haben, bevor sie in die Oberstufe kommen. Es funktioniert also durchaus. Und nur drei – soweit ich weiß – gehören einer Gang an. Die South Side ist die soziale Müllhalde der Stadt. Deshalb ist die Halle in diesem miesen Zustand, die Hälfte der Mädchen hat kein Trikot, und wir müssen rumbetteln, damit wir genug Bälle haben, um halbwegs anständig trainieren zu können. Aber mit Basketball alleine kann man diese Kids nicht von Drogen und Schwangerschaften fernhalten und sie zum Lernen anspornen.«
Ich ließ Love stehen und wies die Mädchen an, hintereinander zum Korb zu laufen und zu werfen; die Nachfolgende sollte jeweils die Rebounds fangen. Wir übten von der Freiwurflinie und von der Drei-Punkte-Linie aus Hakenwürfe, Sprungwürfe, Korbleger. Irgendwann kam Celine anspaziert. Ich fragte sie nicht, was sie in den zehn Minuten draußen getrieben hatte, sondern bedeutete ihr, sich einzureihen.
»Jetzt kannst du gehen, Theresa!«, rief ich.
Theresa steuerte Richtung Tür und brummte dann: »Ich glaub, ich halt durch bis zum Ende, Coach.«
»Das Risiko würd ich nicht eingehen«, sagte ich. »Lieber fünf Minuten Training versäumen, als dass es schiefläuft.«
Sie lief wieder rot an und behauptete, es sei alles in Ordnung. Ich platzierte sie getrennt von Celine und warf einen Blick auf Marcena Love. Die betrachtete eingehend das Geschehen unter dem Korb, der ihr am nächsten war.
Ich grinste in mich hinein: Der Punkt ging an die Straßenkämpferin aus der South Side. Wiewohl Straßenkampf im Einsatz gegen Marcena Love nicht die Methode der Wahl sein konnte – die Frau hatte allerhand im Arsenal, was mich außer Gefecht setzen konnte. Wie diesen knochigen – also von mir aus schlanken – Körper, den das schwarze Prada-Teil bestens zur Geltung brachte. Oder die Tatsache, dass sie meinen Liebsten schon kannte, als er noch beim Peace Corps war. Und dass sie sich im letzten Winter mit ihm in Afghanistan aufgehalten hatte. Und dass sie vor drei Tagen, während ich Mary Ann McFarlane in South Shore besuchte, in seiner Eigentumswohnung in Evanston aufgekreuzt war.
Als ich abends in die Wohnung gekommen war, saß Marcena an Morrells Bett, den löwengelben Schopf über Fotos gebeugt, die sich die beiden ansahen. Morrell musste wegen seiner Schussverletzungen immer noch hauptsächlich liegen; es war also nicht weiter verwunderlich, dass er sich im Bett aufhielt. Aber der Anblick einer fremden und überaus ansehnlichen Frau, die sich – um zehn Uhr abends – über ihn beugte, sorgte doch dafür, dass sich mir das Nackenfell sträubte.
Morrell streckte die Hand aus, um mich an sich zu ziehen und zu küssen, bevor er uns vorstellte: Marcena, alte Journalistenfreundin, war in der Stadt, um eine Serie für den Guardian zu schreiben, hatte vom Flughafen aus angerufen, würde eine Woche oder so im Gästezimmer wohnen. Victoria, Privatdetektivin, Basketballtrainerin auf Zeit, geborene Chicagoerin, die ihr die Stadt zeigen konnte. Ich bemühte mich um das freundlichste Lächeln, das mir gelingen wollte, und versuchte in den folgenden drei Tagen angestrengt, nicht darüber nachzudenken, was die beiden wohl trieben, während ich in der Stadt auf Achse war.
Ich war natürlich nicht eifersüchtig auf Marcena. Keinesfalls. Schließlich war ich eine moderne Frau und überdies Feministin, ich konkurrierte nicht mit anderen Frauen um die Zuwendung eines Mannes. Aber Morrell und Love merkte man die Vertrautheit ihrer langen Freundschaft an. Als sie redeten und gemeinsam lachten, fühlte ich mich ausgeschlossen. Und war, na gut, okay, eifersüchtig.
Ein Gerangel unter einem der Körbe brachte mich wieder in die Gegenwart. Wie üblich hatten sich April Czernin und Celine Jackman, meine Gangbraut und Flügelspielerin, in der Wolle. Die beiden waren die besten Spielerinnen in der Mannschaft, aber eine Strategie zu entwickeln, wie man diese beiden zu Teamwork anhalten konnte, gehörte zu den wenig aussichtsreichen Herausforderungen dieser Arbeit. In solchen Momenten war mir meine Straßenkampferfahrung durchaus nützlich. Ich trennte die beiden und teilte die Mannschaft in Gruppen auf zum Scrimmage, zum Übungsspiel.
Um halb vier machten wir eine Pause; alle waren inzwischen schweißgebadet, auch ich. Dank einer Spende von einem meiner Firmenkunden konnte ich den Mädels Gatorade offerieren. Während die anderen mit ihrem Getränk beschäftigt waren, kletterte Sancia Valdéz, meine Center-Spielerin, auf die Tribüne, sorgte dafür, dass ihr Baby seine Flasche bekam, und eröffnete eine Art Gespräch mit dem Vater des Kinds, den ich allerdings nur irgendwas vor sich hinmurmeln hörte.
Marcena suchte beliebig – oder vielleicht nach Hautfarbe – eine Blondine, eine Latina, eine Afroamerikanerin aus und begann, diese Mädchen zu interviewen. Die anderen lungerten neidisch um sie herum.
Ich sah, dass Marcena das Gespräch mit einem schnuckligen roten Gerät aufzeichnete, das an einen Füllhalter erinnerte. Eindrucksvolles Teilchen, natürlich digital, in dem man acht Stunden Interview speichern konnte. Und sofern Marcena den Leuten nicht sagte, dass sie die Unterhaltung aufzeichnete, merkten sie nichts davon. Den Mädchen hatte sie es verschwiegen, aber ich beschloss, kein Aufhebens davon zu machen – sie wären ohnehin wohl eher geschmeichelt als empört gewesen.
Ich ließ ihnen eine Viertelstunde Zeit, dann holte ich meine Trainertafel heraus und zeichnete Spielzüge auf. Marcena war fair – als sie merkte, dass die Mädchen lieber mit ihr reden als mir zuhören wollten, legte sie ihre Sachen weg und sagte, sie wolle nach dem Training weitermachen.
Ich schickte die Mädchen wieder ins Übungsspiel. Marcena schaute ein paar Minuten zu, dann kraxelte sie die klapprige Tribüne hoch und ließ sich neben Sandras Freund nieder, der sich ruckartig aufsetzte und weitaus lebhafter wirkte als zuvor. Was wiederum Sandra so ablenkte, dass sie einen Routinepass vermasselte und dem anderen Team Punkte schenkte.
»Aufs Spiel achten, Sandra«, bellte ich in bestem Coach-McFarlane-Stil, war aber doch erleichtert, als ich sah, dass die Reporterin von der Tribüne kletterte und hinausschlenderte; das war der Konzentration förderlich.
Als Marcena am Abend vorher beim Essen vorschlug, mich zum Training zu begleiten, versuchte ich, ihr die Idee auszureden. Man hat eine lange Anfahrt nach South Chicago, und ich sagte ihr, dass ich sie nicht ins Zentrum chauffieren könne, falls ihr langweilig würde.
Love lachte. »Ich langweile mich nicht so schnell. Ich mache eine Serie für den Guardian über das Amerika, das Europäer nicht zu sehen bekommen. Irgendwo muss ich anfangen, und wer könnte unsichtbarer sein als die Mädchen, die du da unterrichtest? Deinen Aussagen zufolge werden die weder Olympiasieger noch Nobelpreisträger werden, sie kommen aus sozial schwachen Familien, sind minderjährige Mütter…«
»Kurz gesagt, wie die Mädchen in South London«, warf Morrell ein. »Ich glaube nicht, dass du da eine weltbewegende Story hast, Love.«
»Aber es könnte eine dabei herausspringen«, erwiderte sie. »Vielleicht das Porträt einer amerikanischen Detektivin, die zu ihren Wurzeln zurückkehrt. Detektivgeschichten kommen immer gut an.«
»Du könntest die Geschichte der Mannschaft verfolgen«, pflichtete ich ihr mit geheuchelter Begeisterung bei. »Könnte eines dieser Rührstücke werden, bei denen diese Mädchen, die zu wenig Bälle und Trikots haben, unter meiner inspirierenden Führung Landesmeisterinnen werden. Aber, weißt du, das Training dauert zwei Stunden, und ich hab direkt danach eine Verabredung mit einem Firmenchef in der Gegend. Wir sitzen dann in der runtergekommensten Ecke der Stadt – da gibt’s nicht viel zu tun für dich, falls du es öde findest.«
»Ich kann doch jederzeit gehen«, meinte Love.
»Raus auf die Straßen mit der höchsten Mordrate Chicagos.«
Love lachte wieder. »Ich komme gerade aus Bagdad. Ich habe aus Sarajewo, Ruanda und Ramallah berichtet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Chicago schlimmer zugeht als an einem dieser Orte.«
Ich hatte ihr natürlich beigepflichtet; blieb mir ja nichts anderes übrig. Ich hatte Love nur nicht mitnehmen wollen, weil sie mir nicht in den Kram passte – und das lag wiederum daran, dass ich eifersüchtig, verunsichert oder einfach bloß eine Straßenkämpferin aus der South Side mit Komplexen war. Wenn die Mannschaft ein Presseecho bekam – und sei es im Ausland –, würde mir das die Suche nach einem Sponsor womöglich erleichtern.
Trotz ihrer vollmundigen Beteuerungen, dass sie in Kabul und der West Bank auf sich selbst aufgepasst hätte, zog Love ein bisschen den Kopf ein, als wir bei der Schule eintrafen. Die ganze Gegend ist schon zum Heulen – jedenfalls empfinde ich das so. Als ich zwei Wochen vorher an dem Haus vorbeifuhr, in dem ich aufgewachsen bin, brach ich tatsächlich in Tränen aus. Die Fenster waren zugenagelt, und der Garten, in dem meine Mutter liebevoll bocca di leone gigante und eine japanische Kamelie gezogen hatte, war mit Unkraut zugewachsen.
Das Schulgebäude ist mit Graffiti besprüht, die Fensterscheiben sind eingeworfen, überall liegt Müll herum, und sämtliche Eingänge bis auf einen sind mit fünf Zentimeter dicken Stahlketten versperrt. Dieser Anblick zieht jeden runter. Selbst wenn man die Ketten und den Dreck nicht mehr richtig wahrnimmt, wird man doch davon beeinflusst. Schüler und Lehrer, die sich in so einer Umgebung aufhalten müssen, sind zwangsläufig irgendwann deprimiert und reizbar.
Marcena war auffallend schweigsam, als wir dem Wachmann unseren Ausweis vorzeigten. Sie murmelte nur, dass sie diese Zustände aus dem Irak und von der West Bank kenne, aber nicht gewusst habe, dass auch Amerikaner eine Besatzungsmacht in ihrer Mitte hätten.
»Die Polizei ist keine Besatzungsmacht«, fuhr ich sie an. »Diese Rolle übernimmt hier die brutale Armut.«
»Polizisten sind immer machtversessen, egal wer ihnen ihre Position auch zuweist«, versetzte sie, blieb aber weiterhin ziemlich wortkarg, bis wir auf die Mädchen trafen.
Als Love aus der Sporthalle verschwunden war, legte ich einen Zahn zu mit dem Training, obwohl ein paar Spielerinnen bockten und jammerten, dass sie erschöpft seien und sie so was bei Coach McFarlane nicht hätten machen müssen.
»Das könnt ihr vergessen«, bellte ich. »Ich hab selbst bei ihr trainiert, daher hab ich ja diese Methoden.«
Ich ließ sie Pässe und Rebounds üben, ihre größten Schwachpunkte. Die Drückebergerinnen beorderte ich unter die Körbe und ließ sie Bälle ans Brett schmettern und fangen, weil sie ständig zu lahm waren zuzupacken. Celine, die Gangbraut, rammte eine der Trödeltanten so, dass die zu Boden ging. Das hätte ich heimlich zwar selbst gerne gemacht, aber mir blieb nichts anderes übrig, als Celine auf die Bank zu schicken und ihr mit Ausschluss zu drohen, falls sie noch mal eine Keilerei anfing. Was ich äußerst ungern tat, weil Celine, April und Josie Dorrado unsere einzige Hoffnung für eine Mannschaft waren, die vielleicht ein paar Spiele gewinnen konnte. Falls sie sich verbesserten. Falls die anderen sich mehr anstrengten. Falls sie alle weiterhin antraten, nicht schwanger oder erschossen wurden, die richtigen Schuhe und die Ausstattung fürs Krafttraining bekamen, die sie brauchten. Und falls Celine und April sich nicht gegenseitig fertigmachten, bevor die Saison überhaupt begonnen hatte.
Alle legten sich plötzlich ins Zeug, und ich wusste auch ohne Blick auf die Uhr, dass wir noch eine Viertelstunde hatten. In dieser Zeit tauchten Freunde und Familienmitglieder auf. Obwohl die meisten Mädchen alleine nach Hause gingen, spielten alle besser mit Publikum.
April Czernin strengte sich heute zu meiner Verwunderung besonders an – ihre Rebounds waren so flott wie die von Theresa Witherspoon. Ich schaute zur Tür, um zu sehen, für wen sie sich solche Mühe gab. Marcena Love war zurückgekehrt, in Begleitung eines Mannes, der etwa in meinem Alter war, einem dunklen Typ, der ein bisschen verwittert wirkte, aber immer noch einen zweiten Blick lohnte. Die beiden lachten zusammen, und seine rechte Hand befand sich etwa einen Millimeter von ihrer linken Hüfte entfernt. Als April merkte, dass er nur auf Marcena achtete, schmetterte sie ihren Ball mit solcher Wucht gegen das Brett, dass er beim Abprall Sandra an den Kopf knallte.
Auftritt Romeo
(Bühne links)
Mit einem lockeren Lächeln auf den Lippen trat der Mann auf mich zu. »Du bist es also wirklich, Tori. Dachte ich’s mir doch, als April uns deinen Namen gesagt hat.«
Seit dem Tod meines Cousins Boom-Boom hatte mich niemand mehr mit diesem Spitznamen angesprochen. Es war sein Kosename für mich gewesen – meine Mutter verabscheute amerikanische Spitznamen, und mein Vater nannte mich immer Pepperpot, Pfefferstreuer –, und es passte mir überhaupt nicht, dass dieser Fremde ihn in den Mund nahm.
»Warst schon so lang nicht mehr hier, dass du deine alten Kumpel nicht mehr kennst, was, Warshawski?«
»Romeo Czernin!«, rief ich verblüfft, als die Erinnerung zurückkehrte. Romeo – sein Spitzname – war in Boom-Booms Klasse gewesen, eine über mir, und die Mädchen in meiner Clique hatten ihn immer kichernd beäugt, wenn er eine unserer Klassenkameradinnen anbaggerte.
Jetzt waren es Celine und ihre Kumpaninnen, die laut grölten, um April anzustacheln. Was funktionierte, denn April schmetterte einen Ball in Celines Richtung. Ich sprang dazwischen und fing ihn auf, wobei ich mich erfolglos an Romeos bürgerlichen Namen zu erinnern versuchte.
Czernin grinste selbstgefällig, weil ihm sein Jugendspitzname schmeichelte oder aber weil es ihm vor Marcenas Augen gelungen war, die Aufmerksamkeit sämtlicher Mädchen im Raum auf sich zu lenken. »Genau der.« Er legte den Arm um mich und beugte mich nach hinten, offenbar mit der Absicht, mich zu küssen, aber ich drehte mich in seinem Arm und hakte den linken Fuß um seinen Knöchel, worauf er ins Schwanken geriet und ich entkam. Ich legte keinen Wert darauf, dass die Mannschaft sich diesen Kniff merkte, aber natürlich schauten alle aufmerksam zu, und ich hatte die üble Vorahnung, dass Celine die Nummer im nächsten Spiel zum Einsatz bringen würde. Marcena Love beobachtete das Geschehen mit einem amüsierten Lächeln, und ich kam mir nicht minder pubertär vor als meine Gangbräute.
Romeo wischte sich den Staub von der Kleidung. »Du bist so überheblich wie eh und je, was, Tori? Warst du nicht damals eine von McFarlanes Lieblingen? Als ich gehört hab, dass sie immer noch Basketball unterrichtet, wollt ich mal vorbeischaun und ein Wörtchen mit ihr reden – hab mir gedacht, dass sie meiner Kleinen jetzt denselben Müll erzählt wie uns damals. Und nun muss ich wohl deutlicher dafür sorgen, dass du April anständig behandelst.«
»Irrtum«, erwiderte ich. »April zu unterrichten macht Spaß. Sie ist dabei, sich zu einer ernsthaften Spielerin zu entwickeln.«
»Wenn ich mitkrieg, dass du Lieblinge hast oder eine von diesen dreckigen Mexikanerinnen sie fertigmacht, kriegst du’s mit mir zu tun, vergiss das nicht.«
April fand das so peinlich, dass sie rot anlief, weshalb ich nur lächelte und sagte, ich würde es mir merken. »Komm nächstes Mal früher und schau ihr beim Scrimmage zu. Wirst beeindruckt sein.«
Er nickte mir zu, als wolle er seine Machtposition noch mal bekräftigen, dann stellte er für Marcena wieder das Lächeln an. »Würd ich ja machen, wenn ich könnte, aber da muss ich arbeiten. Heut hab ich früher frei und dachte, ich führ meine Kleine zum Pizza-Essen aus – was hältst du davon, Schätzchen?«
April, die sich mit Josie Dorrado nach hinten verzogen hatte, blickte so mürrisch, wie Teenager gerne gucken, wenn sie ihre Begeisterung nicht zeigen wollen.
»Und diese englische Lady hier, die was über deine Mannschaft und die South Side schreibt, möchte auch gern mit. Hat mich auf dem Parkplatz angesprochen, als ich mit dem Truck angekommen bin. Was meinst du? Gehen wir zu Zambrano’s und zeigen ihr mal, was hier so los ist?«
April zog eine Schulter hoch. »Von mir aus. Wenn Josie auch mitkommen kann. Und Laetisha.«
Romeo willigte ein und schlug seiner Tochter kräftig auf die Schulter; dann sagte er, sie solle sich ranhalten, er habe nach dem Essen noch Touren.
Zambrano’s ist so ziemlich das einzige Restaurant in der Gegend, das noch übrig ist von damals. Fast alle anderen sind zugenagelt. Sogar Sonny’s, wo es für einen Dollar ein Bier und einen Whiskey gab – unter dem lebensgroßen Porträt von Ex-Bürgermeister Richard Daley –, hat aufgegeben.
Ich schickte die Mädchen in die Duschen, die sich in einem derart düsteren und muffigen Umkleideraum befanden, dass ich meine verschwitzten Sachen lieber anbehielt, bis ich bei Morrell war. Marcena heftete sich an die Fersen des Teams und verkündete, sie wolle sich einen Eindruck von allem verschaffen, und außerdem müsse sie pinkeln. Worauf die Mädchen entsetzt keuchten, weil sie dieses Wort in Anwesenheit eines Mannes benutzte, und sich noch eifriger um sie scharten.
Ich schaute zur Tribüne hinüber, um zu sehen, ob sich jemand um Sancias Kinder kümmerte, während sie duschte, und entdeckte Sancias Schwester; die Mutter und sie wechselten sich offenbar ab mit den Kleinen. Sancias Freund lungerte mit ein paar Typen, die auch Freundin oder Schwester in der Mannschaft hatten, im Flur herum. Bei meinem ersten Training hatten die Jungs Grenzen getestet, indem sie mit den Bällen rumknallten, bis ich ihnen auftrug, in Zukunft draußen zu warten.
Romeo nahm sich einen Ball und warf ihn ans Backboard. Er trug Arbeitsstiefel, aber ich beschloss, auf eine Ermahnung wegen falschen Schuhwerks zu verzichten; der Boden war ohnehin in üblem Zustand und die Stimmung zwischen uns angespannt genug.
Mein Cousin Boom-Boom, der schon an der Schule ein Basketball-Star war und mit siebzehn von den Black Hawks geholt wurde, machte sich damals gerne lustig über Romeo, weil er um die Sportskanonen herumlungerte. Ich hatte am selben Strang gezogen, weil ich meinen Cousin und seine coolen Freunde beeindrucken wollte, aber jetzt musste ich zugeben, dass Czernin sogar mit Arbeitsstiefeln eine ziemlich gute Leistung brachte. Er löffelte fünf Bälle in Folge von der Freiwurflinie aus in den Korb; dann versuchte er andere schwerere Würfe aus weiterer Entfernung, allerdings mit weniger Erfolg.
Er merkte, dass ich ihm zusah, und warf mir ein selbstgefälliges Lächeln zu: Alles war verziehen, wenn ich ihn bewunderte.
»Und was hast du so getrieben, Tori? Stimmt das, was die Leute sagen, dass du bei der Polizei bist, wie dein alter Herr?«
»Nicht ganz. Ich bin Privatdetektivin. Ich kümmere mich um die Sachen, für die sich die Polizei nicht interessiert. Und du fährst einen Truck, wie dein Vater?«
»Nicht ganz«, machte er mich nach. »Er war selbstständig, ich arbeite für By-Smart. So ziemlich die einzige Firma hier, die heutzutage noch Leute einstellt.«
»Und da brauchen sie einen Sattelschlepper?«
»Ja, von dem großen Lagerhaus zu den Läden, nicht nur dem an der 95th, in meiner Gegend gibt’s elf von denen – South Side, Northwest Indiana.«
Wenn ich auf der Autobahn Richtung Süden fuhr, kam ich immer an dem riesigen Billigladen an der 95th, Ecke Commercial vorbei. Er war so groß wie die Ford-Fabrik weiter im Süden. Der Laden mit Parkplatz nahm fast einen Quadratkilometer vom einstigen Sumpfgelände ein.
»Ich muss heute Nachmittag selbst ins Lagerhaus«, sagte ich. »Kennst du Patrick Grobian?«
Auf Romeos Gesicht trat wieder dieses wissende Grinsen, das mir an den Nerven riss. »Na klar. Ich mach viel mit Grobian. Er organisiert immer noch gerne die Touren, obwohl er Geschäftsführer vom Lagerhaus ist.«
»Und du zeigst Marcena also die Läden an der Indiana, nachdem du mit den Mädchen bei Zambrano’s warst?«
»Ganz genau. Auf den ersten Blick kommt sie so eingebildet daher wie du, aber das liegt nur an dem Akzent und der Aufmachung; sie ist ‘n echter Mensch und interessiert sich für meine Arbeit.«
»Sie ist mit mir hergekommen. Kannst du sie nach eurer Tour zum Loop bringen? Sie sollte hier spätabends nicht mit der Bahn fahren.«
Er grinste anzüglich. »Ich werd schon dafür sorgen, dass sie auf ihre Kosten kommt, da zerbrich dir mal nicht dein verblasenes Hirn drüber.«
Ich widerstand der Versuchung, ihm eine zu kleben, sammelte stattdessen die anderen Bälle ein und brachte sie in den Geräteraum. Wenn ich sie nicht sofort wegschloss, lösten sie sich in Luft auf, wie ich nach meinem ersten Training feststellen musste: Als die Besucher verschwunden waren, fehlten zwei Bälle. Ich hatte vier neue von Freunden erbettelt, die Mitglieder von teuren Sportclubs in der City sind, und schloss jetzt regelmäßig alle zehn Bälle in einem Schrank mit Vorhängeschloss ein, wobei ich dem Trainer der Jungenmannschaft und den Sportlehrern auch Schlüssel geben musste.
Während die Mädchen in der Umkleide waren, füllte ich an einem schmalen Tisch im Geräteraum für die imaginäre zukünftige Trainerin unsere Anwesenheitsliste aus und schrieb einen Kurzbericht über unsere Fortschritte. Als ein Schatten in der Tür erschien, blickte ich auf. Josie Dorrado, Aprils spezielle Freundin im Team, stand da, wickelte ihren langen Zopf um den Finger und trat von einem Bein aufs andere. Sie war ein schlaksiges, stilles und fleißiges Mädchen, eine der stärksten Spielerinnen der Mannschaft. Ich lächelte und hoffte insgeheim, dass es sich nicht um ein zeitraubendes Problem handelte, denn ich wollte bei meinem Termin mit dem Lagerhausleiter von By-Smart nicht unpünktlich sein.
»Coach, ähm, ich hab gehört, ähm, stimmt es, dass Sie bei der Polizei sind?«
»Ich bin Privatdetektivin, Josie. Ich arbeite für mich selbst, nicht für die Stadt. Brauchst du jemanden von der Polizei?« Dieses Gespräch hatte schon mehrfach stattgefunden beim Training, obwohl ich allen meinen Beruf erklärt hatte.
Sie schüttelte den Kopf und blickte etwas erschrocken bei der Vorstellung, dass sie die Polizei benötigen könne. »Ma, meine Ma, die hat gesagt, ich soll Sie fragen.«
Ich erahnte einen gewalttätigen Ehemann, einstweilige Verfügungen, eine langwierige Anhörung vor Gericht, und bemühte mich, nicht hörbar zu seufzen. »Was für ein Problem hat sie denn?«
»Irgendwas wegen ihrer Arbeit. Nur, ihr Boss, der will nicht, dass sie drüber redet.«
»Weshalb – belästigt er sie?«
»Können Sie nicht mal ‘ne Minute mit ihr reden? Ma kann’s Ihnen erklären, ich weiß nicht recht, worum es geht, sie hat nur gesagt, ich soll Sie fragen, weil sie gehört hat, wie jemand in der Wäscherei meinte, Sie seien hier aufgewachsen und jetzt bei der Polizei.«
Romeo tauchte hinter Josie auf und ließ den Ball im Stil der Harlem Globetrotters auf der Fingerspitze kreisen. »Wofür braucht denn deine Ma ‘nen Cop, Josie?«, fragte er.
Josie schüttelte den Kopf. »Gar nicht, Mr. Czernin, sie möchte nur mal mit der Trainerin über irgendein Problem reden, das sie mit Mr. Zamar hat.«
»Was für ein Problem mag das sein, wenn sie ihm ‘nen Schnüffler auf den Hals hetzen will? Oder ist es umgekehrt?« Er lachte herzhaft.
Josie sah ihn verwirrt an. »Sie meinen, ob sie ihn verfolgen lassen will? Glaub ich nicht, aber ich weiß es eben nicht genau. Bitte, Coach, es dauert nicht lang, und sie nervt jeden Tag mit ›Hast du schon die Trainerin gefragt? Hast du die Trainerin gefragt?‹, und jetzt kann ich ihr sagen, dass ich Sie gefragt hab.«
Ich warf einen Blick auf meine Uhr. Zehn vor fünf. Ich musste um Viertel nach fünf am Lagerhaus sein und bei Mary Ann McFarlane vorbeischauen, bevor ich zu Morrell fuhr. Wenn ich Josies Mutter noch dazwischenquetschte, würde ich wieder erst um zehn zu Hause sein.
Ich blickte in Josies ängstliche schokobraune Augen. »Hat es nicht Zeit bis Montag? Da könnte ich nach dem Training mit ihr reden.«
»Okay.« Sie entspannte die Schultern, und nur daran merkte ich, wie erleichtert sie war, dass ich eingewilligt hatte.
Warenberge
Ich steuerte zwischen den Trucks vor dem Lagerhaus hindurch und hielt Ausschau nach dem Parkplatz. Sattelschlepper hielten vor Ladezonen, kleinere Laster waren auf einer Rampe zum Kellergeschoss unterwegs, Müllwagen nahmen sich der Container an, und überall liefen Männer mit Bierbauch und Schutzhelm herum und schrien den anderen zu, dass sie verflucht noch mal aufpassen sollten, wo sie hinfuhren.
Die schweren Lastwagen hatten tiefe Furchen in den Weg gegraben, und mein Mustang wurde durchgeschüttelt und mit Schlamm bespritzt. Es hatte tagsüber immer wieder geregnet, und der Himmel war bleigrau. Seit einem Jahrhundert wird die Sumpflandschaft hier im Süden von Chicago als Abladeplatz für alles von Zyanid bis Zigarettenpapierchen benutzt und hat sich in eine Art trostloses Niemandsland verwandelt. Vor diesem düsteren Hintergrund wirkte das Lagergebäude von By-Smart unheimlich und bedrohlich, wie die Behausung eines gefräßigen Ungeheuers.
Es war ein monströs riesiges Gebäude, so groß wie zwei Wohnblocks, ein Ziegelbau, der früher vermutlich mal rot gewesen war, sich im Laufe der Jahre aber grauschwarz verfärbt hatte. Das gesamte Gelände war von einem hohen Drahtzaun umgeben, und wer hineinwollte, musste ein Wachhaus passieren. Als ich von der 103rd Street abbog, wollte irgendein Knabe in Uniform meinen Ausweis sehen. Ich teilte ihm mit, ich hätte einen Termin bei Patrick Grobian, worauf der Mann in der Behausung des Unholds anrief und mir bestätigte, dass ich erwartet wurde. Der Parkplatz sei gleich geradeaus, ich könne ihn nicht verfehlen.
Der Mann hatte offenbar ein anderes Richtungsverständnis als ich; nachdem ich um zwei Ecken gefahren war, sichtete ich schließlich die Parkzone, die aussah wie der Abstellplatz eines Gebrauchtwagenhändlers – zwischen den Schlaglöchern waren kreuz und quer irgendwelche alte Schüsseln geparkt. Ich suchte mir ein Plätzchen am Rand, in der Hoffnung, dass dort keiner meinem Mustang in die Seite fahren würde.
Als ich die Tür aufmachte, blickte ich bestürzt auf den Boden. Der Eingang zum Lagerhaus war ein paar hundert Meter entfernt, und nun sollte ich mit meinen guten Pumps durch Matsch und Pfützen stöckeln. Ich kniete mich auf den Sitz, wühlte in dem Tohuwabohu aus Papieren und Handtüchern auf der Rückbank und förderte schließlich ein Paar Flip-Flops zutage, die ich letzten Sommer am Strand getragen hatte. Ich schaffte es auch mit Strümpfen, sie mir an die Füße zu klemmen, und machte mich peinlich watschelnd Richtung Eingang auf. Als ich dort eintraf, waren jedenfalls nur meine Strümpfe und Hosenaufschläge voller Schlamm. Ich zog die Pumps wieder an und steckte die schmutzigen Flip-Flops in eine Plastiktüte, die ich in meinem Aktenkoffer verstaute.
Durch hohe Türen gelangte ich in eine Art Konsumentenalbtraum. Regale, so weit das Auge reichte, vollgestopft mit allen nur erdenklichen Waren. Direkt vor mir baumelten Besen, Hunderte von Besen, Strohbesen, Besen mit Plastikstiel, Besen mit Holzstiel, Drehbesen. Daneben warteten Tausende von Schaufeln darauf, im nächsten Winter zum Schneeschippen benutzt zu werden. Rechter Hand Kartons mit der Aufschrift »Enteiser« in Regalen, die fast bis zu der vier Meter hohen Decke reichten.
Ich setzte mich in Bewegung und wich wieder zurück, als ein Gabelstapler auf mich zuraste, der Kartons mit Enteiser geladen hatte. Gegenüber der Schaufeln kam er zum Halten. Eine Frau in Overall und leuchtend roter Weste begann, die Kartons aufzuschlitzen, noch bevor sie richtig abgeladen waren, entnahm ihnen kleinere Kartons und fügte sie dem Enteiserberg hinzu.
Ein zweiter Gabelstapler kam angesaust und wurde von einem Mann, der die identische rote Weste trug wie die Frau und immer wieder auf einen Computerausdruck blickte, mit Besen beladen.
Als ich einen erneuten Ansatz machen wollte, mich fortzubewegen, kam jemand von der Wachmannschaft angelaufen. Es handelte sich um eine massige schwarze Frau, an deren Weste Reflektoren glitzerten. Sie trug einen Schutzhelm mit der Aufschrift »Sei smart, kauf bei By-Smart« und einen Gürtel, an dem sämtliche Utensilien eines Ordnungshüters baumelten, inklusive einer Betäubungspistole. Sie musste ziemlich schreien, um den Krach der Förderbänder und Laster zu übertönen, und erkundigte sich, was ich hier wohl zu suchen hätte.
Ich gab wieder meine Erklärung zum Besten. Sie pflückte ein Handy von ihrem Gürtel und ließ sich meine Info bestätigen. Danach versah sie mich mit einem Anstecker und Anweisungen zu Patrick Grobians Büro: Gang 116S entlanggehen, bei 267W links abbiegen, durchgehen bis zum Ende, dort würde ich Büros, Toiletten, Kantine und so fort finden.
Erst jetzt fielen mir die riesigen roten Zahlen auf, die über dem Eingang zu jedem Gang standen; sie waren so groß, dass ich sie übersehen hatte. Auch die Förderbänder über den Gängen registrierte ich erst jetzt; von dort oben wurden die Waren über Rutschen zu den Ladestationen hinuntergeschafft. An Wänden und Regalen verkündeten Schilder »Rauchen strengstens verboten« und »Achten Sie auf Sicherheit am Arbeitsplatz«.
Da ich auf Gang 122S blickte, bog ich bei den Schaufeln links ab und ging sechs Gänge weiter, wobei ich an einem Gebirge aus Mikrowellen und einem Wald aus künstlichen Weihnachtsbäumen vorbeikam. Im Gang 116S wanderte ich zwischen Weihnachtsdeko hindurch: Lawinen von Glocken, Lichterketten, Servietten, Plastikengeln, Madonnen mit rosa Gesichtern und käseweißen Jesuskindern im Arm.
Mir wurde zusehends schwindlig zwischen diesen endlosen Warenbergen, den rasselnden Förderbändern über meinem Kopf, den wild umhersausenden Gabelstaplern. Es gab Menschen hier in diesem Lagerhaus, aber auch sie wirkten wie eine Art Maschinen. Ich hielt mich an einem Regal fest, damit mir nicht schwarz vor Augen wurde. Bei Patrick Grobian konnte ich nicht schwankend antreten; ich wollte ihm schließlich Geld für die Basketballmannschaft der Bertha Palmer Highschool entlocken und sollte lieber einen dynamischen, professionellen Eindruck machen.
Als ich drei Wochen vorher die stellvertretende Direktorin der Schule kennengelernt hatte, die für die Projekte zuständig war, wurde mir klar, dass ich selbst einen Ersatz für Mary Ann suchen musste, wenn ich nicht bis an mein Lebensende als Trainerin antreten wollte. Natalie Gault war Mitte vierzig, klein, untersetzt und sich ihrer Autorität höchst bewusst. Sie saß zwischen Bergen von Arbeitspapier. Mädchen-Basketball war für sie etwa so bedeutsam wie die Anschaffung einer neuen Kaffeemaschine fürs Lehrerzimmer.
»Ich kann nur bis Jahresende für Mary Ann einspringen«, verkündete ich, als sie mir für meinen schnellen Einsatz dankte. »Wenn im Januar die Saison anfängt, kann ich nicht mehr hier runterkommen. Bis dahin will ich dafür sorgen, dass die Mädchen in Form bleiben, aber sie brauchen eine ausgebildete Trainerin, und das bin ich nicht.«
»Sie brauchen in erster Linie Erwachsene, die Interesse an ihnen bekunden, Ms. Sharaski.« Gault lächelte mich unverbindlich an. »Niemand erwartet von ihnen, dass sie tatsächlich Spiele gewinnen.«
»Warshawski. Und die Mädchen wollen durchaus gewinnen – sie spielen nicht, um ihre Fairness unter Beweis zu stellen. Die haben sie ohnehin nicht drauf. Mit dem richtigen Training könnten aus drei oder vier von ihnen erstklassige Basketballerinnen werden – sie verdienen mehr Einsatz und Qualifikation, als sie von mir kriegen können. Was unternimmt die Schule, um eine neue Trainerin zu finden?«