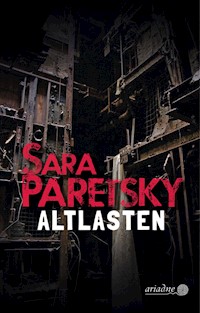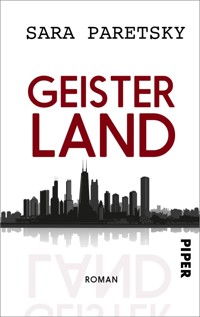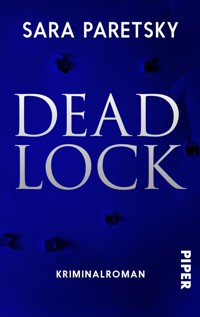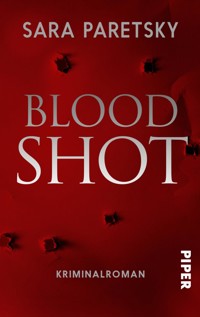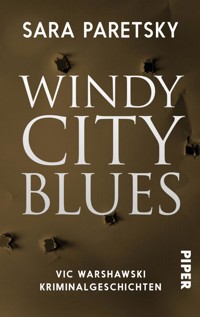19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: CulturBooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Wirtschaftsermittlerin V. I. Warshawski rackert sich ab, um sowohl ihrer frisch aufgetauchten und gleich wieder verschollenen Nichte als auch dem Großneffen ihrer Freundin zu helfen. Was ihr wenig Dank und kein Honorar einbringt, dafür gleich zwei kräftezehrende Fälle: Einer führt nach Syrien, der andere beschert ihr mächtige Widersacher im heutigen Chicago. Und schon fliegen ihr Kugeln um die Ohren. Ihr schlipstragender Ex ist auch keine Hilfe – hat er gar Dreck am Stecken? In der neuen Paretsky geht es um Aktienhandel und Schuldenfallen, um den Chauvinismus der Mächtigen und um archäologische Schätze. Die Detektivin ohne Furcht und Tadel im Kampf gegen Korruption und Vorurteil: V. I. Warshawski in Bestform.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
E-Book-Ausgabe: © Argument Verlag 2021
Glashüttenstraße 28, 20357 Hamburg
Telefon 040/4018000 – Fax 040/40180020
www.argument.de
Alle Rechte vorbehalten
Titel der amerikanischen Originalausgabe
Shell Game
© 2018 by Sara Paretsky
Printausgabe: © Argument Verlag 2022
Lektorat: Iris Konopik
Umschlag: Martin Grundmann
Umschlagmotiv: © Bob Ward, pexels.com
eBook-Herstellung: CulturBooks
Erscheinungsdatum: Oktober 2022
ISBN 978-3-95988-229-3
Über das Buch
Wirtschaftsermittlerin V. I. Warshawski rackert sich ab, um sowohl ihrer frisch aufgetauchten und gleich wieder verschollenen Nichte als auch dem Großneffen ihrer Freundin zu helfen. Was ihr wenig Dank und kein Honorar einbringt, dafür gleich zwei kräftezehrende Fälle: Einer führt nach Syrien, der andere beschert ihr mächtige Widersacher im heutigen Chicago. Und schon fliegen ihr Kugeln um die Ohren. Ihr schlipstragender Ex ist auch keine Hilfe – hat er gar Dreck am Stecken?
In der neuen Paretsky geht es um Aktienhandel und Schuldenfallen, um den Chauvinismus der Mächtigen und um archäologische Schätze.
Die Detektivin ohne Furcht und Tadel im Kampf gegen Korruption und Vorurteil: V. I. Warshawski in Bestform.
Über die Autorin
Sara Paretsky, eine der renommiertesten Krimiautorinnen weltweit, studierte Politikwissenschaft, war in Chicagos Elendsvierteln als Sozialarbeiterin tätig, promovierte in Ökonomie und Geschichte, arbeitete eine Dekade im Marketing und begann Anfang der 1980er Jahre, den Detektivroman mit starken Frauen zu bevölkern. In der Geschichte der feministischen Genre-Eroberung, die den Hardboiled-Krimi aus dem Macho-Terrain herausholte und zur Erzählung über die ganze Welt machte, gehört Paretsky zu den wichtigsten Vorreiterinnen: Ihre Krimis um Privatdetektivin Vic Warshawski wurden Weltbestseller, mit zahllosen Preisen geehrt und in 30 Ländern verlegt. Sara Paretsky gehört zu den Gründerinnen des internationalen Netzwerks Sisters in Crime
Sara Paretsky
Schiebung
Kriminalroman
Deutsch von Else Laudan
Vorbemerkung von Else Laudan
Sara Paretskys Warshawski-Reihe – ich liebe diesen fiktionalen Kosmos, der so sehr der aktuellen Wirklichkeit verpflichtet ist und doch so idealistisch an ihrem Zustand Kritik übt. Ein Trick dabei ist das Spannungsfeld aus heroischer Ermittlerin und total realistischen Schauplätzen und Verflechtungen.
Sie stehen in inniger Beziehung, Warshawski und Chicago, die Protagonistin und der Hauptschauplatz der Reihe. Warshawski mit ihrem starken inneren Kompass und ihrer sozialen Vernetztheit steht für ein utopisches und doch stets gegenwärtiges Konzept von Respekt und Toleranz, ihre Arbeit ist das Aufdecken des Vertuschten und Verschwiegenen. Die Stadt Chicago mit all ihren Widersprüchen, ihren so unterschiedlichen Quartieren, ihrem Gitternetz aus Straßen und Häusern und ihren Waldreservaten, ihren Museen, Unis und Bürotürmen zeigt die Vielfalt der Alltage, aber auch die durchgebackenen Strukturen von Unrecht, Willkür, Korruption, Ausbeutung und Betrug.
Paretskys Romane sind immer hoch aktuell, jeder ihrer komplexen Fälle lässt wie ein Stück aufgeschnittene Torte viele Schichten dessen sichtbar werden, was im heutigen urbanen American Way of Life lebt, stirbt, brodelt, treibt, bremst, killt und strampelt, und fördert zutage, wo überall Missbrauch im Gange ist. Warshawskis sture Unverdrossenheit führt vor, dass inmitten all der Konflikte und Probleme ethisches Handeln möglich ist – und dass seriös weder humorlos noch konservativ heißen muss und mit widerständig gut kombinierbar ist.
Schiebung – geschrieben vor Landnahme – nimmt einmal mehr strukturelles Unrecht aufs Korn und schafft es, mich für gängige Finanzverbrechen ebenso zu interessieren wie fürs Altertum in Syrien. Das macht Paretsky für mich zur Meisterin: Elegant zeigt sie, wie vielfältig diese geschundene Welt ist und wie sehr sie unser Interesse braucht, damit das Unrecht mal weniger wird.
Else Laudan
Am Ende des Buchs finden sich einige Begriffserklärungen.
1 Schweigen im Walde
Der Deputy schlug sich vorwarnungslos ins wuchernde Dickicht. Felix und ich stolperten hinter ihm her, folgten dem tanzenden Licht seiner Taschenlampe, so gut es ging, Zweige von Sträuchern und Bäumen schnappten zurück, peitschten uns ins Gesicht. Als ich ihm zurief, er solle langsam machen, lief er nur noch schneller.
Das mickrige Licht meines Handys brachte wenig, ich rutschte auf einem Haufen feuchter Blätter aus und landete in einem dornigen Gebüsch. Schlamm quoll über den Rand meiner Schuhe und lief runter in die Socken. Felix versuchte mich zu befreien, aber dabei verfing sich sein Schal in den Brombeeren.
Der Deputy war uns ein gutes Stück voraus, als wir uns freigestrampelt hatten, aber wir sahen noch sein Licht durch die Bäume huschen und dahinter, endlich, den kalten Schein von Bogenlampen. Ich kämpfte mich durchs Unterholz darauf zu.
Der Deputy stand bei einer der Lampen. Er sah sich gereizt um, als wir ankamen, und sagte: »Wird auch Zeit«, dann rief er jemandem hinter der Lampe zu: »Hab den Jungen hier, Boss. Er hat noch jemand dabei. Behauptet, sie ist Anwältin.«
»Ja, weil ich Anwältin bin«, sagte ich in munterem Ton – ich will bloß helfen und niemanden behindern.
»Bring sie her.« Der Boss hatte eine rasselnde Stimme, rau.
Nach den zwanzig Minuten im dunklen Gehölz blendete das wattstarke Licht. Ich blinzelte, sah zur Seite und versuchte dann Einzelheiten der Szenerie auszumachen. Tatortabsperrband markierte ein Gebiet mit Bäumen und Gestrüpp. Eine beachtliche Anzahl Officer durchsuchte die Gegend außerhalb dieses Bereichs, während Spurensicherer ihre Entdeckungen entgegennahmen – Zigarettenkippen, Kondome, Bier- und Cognacflaschen –, sie eintüteten und die Fundorte mit gelben Fähnchen markierten.
Felix versenkte die Hände tief in den Hosentaschen und schlurfte hinter mir her auf die Lichtung. Er stolperte über einen Ast und fiel beinahe hin, stieß aber meinen Arm weg, als ich ihn stützen wollte.
Felix war normalerweise ein lebhafter junger Mann, der mit meiner Generation so ungezwungen umging wie mit seinen Altersgenossen, aber er hatte kaum ein Wort herausgebracht, seit ich ihn vor einer Stunde eingesammelt hatte. Nerven: verständlich, aber als ich nachzufragen versuchte – Warum glaubte die Polizei, Felix könne eine Leiche identifizieren? Wurde jemand, den er kannte, vermisst? –, blaffte er mich an, ich solle Ruhe geben.
Der Deputy schob uns zu einem Mann um die fünfzig mit Hängebacken, kräftig Gewicht um die Körpermitte, aber sonst nicht fett. Lieutenantstreifen auf den Schulterklappen seiner Uniformjacke.
»Felix Herschel?«, raunzte der Lieutenant, und an mich ge-wandt: »Sie sind die Anwältin?«
»V. I. Warshawski«, sagte ich.
Der Lieutenant ignorierte meine ausgestreckte Hand. »Wozu braucht der Junge einen Rechtsverdreher? Haben Sie was zu verbergen, Söhnchen? Unschuldige brauchen keine Anwälte.«
»Unschuldige brauchen Anwälte viel dringender als die Schuldigen, Lieutenant –«, ich schielte auf sein Namenschild, »McGivney. Weil sie nichts von Strafrecht verstehen und ruppige Vernehmende sie leicht einschüchtern und zu falschen Geständnissen verleiten können. Also, kommen wir zu der Frage, was Mr. Herschel hier für Sie tun kann.«
McGivney musterte mich, beschloss, sich auf diese Schlacht nicht einzulassen, und nickte zur Mitte der Bogenlampen hin. »Bringen Sie Ihren Mandanten mit, Warshawski. Achten Sie beide darauf, in meinen Spuren zu gehen: Wir wollen die Verunreinigung des Tatorts möglichst gering halten.«
Ich musste meine Oberschenkelmuskeln strapazieren, um mit ihm Schritt zu halten. Dann standen wir vor einem Baumstumpf, auf den die Bogenlampen ausgerichtet waren. Felix hielt hinter mir an, aber ein Deputy schubste ihn vorwärts.
Der Stumpf war über einen Meter hoch, Überbleibsel einer großen alten Eiche oder Esche, die im Wald umgestürzt war. Die Rinde war rostbraun verrottet. Eine schwarze Plane bedeckte den Stumpf und ein Stück dahinter.
McGivney nickte einer Kriminaltechnikerin zu. Sie zog die Plane weg und enthüllte den zerschundenen und aufgequollenen Körper eines Mannes. Er war kopfüber ins hohle Innere des Stumpfs gestopft. Die ursprüngliche Lage der Leiche war mit weißen Linien angezeichnet – man hatte wohl nur die Füße und Teile der Beine gesehen, aber die Deputys hatten ihn herausgezogen.
Er hatte Jeans an und einen dreckverkrusteten Hoodie, der Reißverschluss stand offen und zeigte einen schlimm zugerichteten Torso. Er war so grausam geprügelt worden, dass sein Kopf nur noch ein unförmiger Fleischklumpen war. Das Haar mochte braun gewesen sein, war aber zu sehr mit Matsch und Blut verkrustet, um sicher zu sein.
Meine Muskeln spannten sich an. Gewaltsamer Tod, abstoßender Tod. Neben mir stieß Felix einen gurgelnden Laut aus. Sein Gesicht war bleich, der Blick glasig, er taumelte. Ich legte ihm eine Hand ins Kreuz und zog mit der anderen seinen Kopf grob nach unten, presste sein Gesicht so nah an seine Knie, wie es ging.
»Haben Sie Wasser, Lieutenant?«, fragte ich.
»Nein, und Riechsalz hab ich auch keins dabei.« McGivney grinste ein Haifischlächeln. »Erkennen Sie das Opfer – die Leiche, den Ermordeten –, Söhnchen?«
»Wie kommen Sie darauf, dass Mr. Herschel ihn kennt?«, fragte ich, bevor Felix etwas sagen konnte. Ich hatte ihn im Auto vorgewarnt, sich mit mir abzusprechen, bevor er Fragen beantwortete, aber unter Schock angesichts des Todes würde er daran nicht denken.
McGivneys Mund zog sich verärgert zusammen. »Wir haben einen guten Grund dafür.«
»Das mag ja sein, aber abgesehen davon, dass es sich ziemlich sicher um einen Mann handelt, wüsste ich nicht, wie ihn irgendwer identifizieren soll, außer durch DNS oder Zahnbefunde. Und da Sie ihn gerade erst gefunden haben, dürften solche Daten noch nicht vorliegen.«
»Erkennen Sie ihn, Mr. Herschel?« McGivney beherrschte sich, nur seine verkrampften Kiefermuskeln verrieten seinen Grimm.
Felix sah weg von der Lichtung, weg von der Leiche. Seine Gesichtsfarbe war etwas besser, aber sein Blick immer noch glasig.
McGivney packte ihn an der Schulter. »Kennen Sie diesen Mann?«
Felix blinzelte. »Wer ist es?«
»Deshalb haben wir Sie herkommen lassen. Wir nahmen an, dass Sie ihn kennen.«
Felix schüttelte langsam den Kopf. »Ich kenne ihn nicht. Woher stammt er?«
»Was spielt das für eine Rolle?« McGivney stürzte sich auf die seltsame Frage. »Wissen Sie von einer vermissten Person?«
Ich entfernte die Hand des Sheriffs von Felix’ Arm. »Er sagt, er kennt den Toten nicht, und das heißt, dass wir hier fertig sind, Lieutenant.«
»Wir sind fertig, wenn ich sage, dass wir fertig sind«, blaffte McGivney.
»Oh, bitte. Sie haben uns keinerlei Gründe dafür genannt, Mr. Herschel um zwei Uhr morgens hier rauszubeordern. Wir haben einen ermordeten Mann betrachtet und das Grauen seines Todes empfunden, was zweifellos in Ihrer Absicht lag. Keiner von uns hat ihn je zuvor gesehen. Wir können Ihnen nicht helfen. Gute Nacht, Lieutenant.«
Ich nahm Felix am Arm, drehte ihn um und wies ihn an, in die Fußabdrücke zu treten, denen wir hergefolgt waren.
»Warum hatte der Kerl Herschels Namen und Telefonnummer in der Hosentasche?«, rief McGivney scharf.
Felix sah mich an, die dunklen Augen weit vor Angst.
Ich raunte ihm zu: »Sag kein Wort«, bevor ich McGivney über die Schulter zurief: »Ich bin kein Medium, folglich kann ich leider keine Fragen nach Handlungen und Motiven dieses armen Toten beantworten.«
»Sie sind hier am Schauplatz eines Mordes und nicht bei Saturday Night Live«, blaffte McGivney. »Ihr Mandant muss seine Verbindung zu dem Toten offenlegen, Warshawski.«
Ich drehte mich um. »Mein Mandant sagte Ihnen doch schon, er hat keine Verbindung. Wenn beim Durchsuchen der Leiche ein Telefon mit Mr. Herschels Kontaktdaten aufgetaucht ist, können Sie seine Identität auch ohne unsere Hilfe ermitteln.«
»Es ist ein Stück Papier«, sagte McGivney.
»Wenn wir uns das ansehen können, sind wir vielleicht imstande, Ihnen zu helfen«, sagte ich im besänftigenden Ton einer Kindergärtnerin.
McGivney runzelte die Stirn, aber er war ein vernünftiger Cop, nur dass ich ihm mehr zusetzte, als ihm lieb war. Er gab jemandem von der Spurensicherung ein Zeichen und erhielt eine Beweismitteltüte mit Etikett: Linke vordere Jeanstasche, entnommen 01:17 h. Darin war ein Zettelchen mit Felix’ Mobilnummer, handgeschrieben, und zwar so sorgsam, dass die Zahlen wie ein Kunstwerk aussahen.
»Was wissen Sie darüber, Herschel?«, verlangte McGivney zu wissen.
Felix sah mich an, die Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben. Ich war sicher, dass er die Handschrift kannte.
»Das ist von einem größeren Stück Papier abgerissen worden«, sagte ich rasch, bevor er sich verriet. »Gute Qualität. Kein Zettelblock, keine Notizbuchseite.«
»Sie sind wohl Sherlock Holmes«, knurrte McGivney.
»Keine Abhandlungen über Papierherstellung, Lieutenant, bloß Hinsehen und Erfahrung.«
»Und wie erklärt sich mit Hinsehen und Erfahrung, warum die Nummer Ihres Mandanten in der Tasche des Opfers steckte?«
»Hab immer noch keine Kristallkugel, Lieutenant.« Ich entfernte mich vom Tatort, die Hand fest um Felix’ Unterarm geschlossen.
McGivney folgte uns. Er gab telefonisch Befehle an Untergebene aus, hörte aber damit auf, als wir den Rand des Dickichts erreichten, durch das wir uns auf dem Hinweg gekämpft hatten.
»Eine letzte Frage, Söhnchen«, sagte er zu Felix. »Mit wem haben Sie dahinten gerechnet?«
»Ich – mit niemandem«, stammelte Felix.
»Sie haben gefragt, woher er stammt«, sagte McGivney. »Was dachten Sie denn, woher?«
»Ich weiß es nicht.« Bedrückt trat Felix von einem Fuß auf den anderen.
Ehe McGivney weiter in ihn dringen konnte, fragte ich: »Wer hat den Leichnam entdeckt? Er hat in dem Stumpf gesteckt, oder? Und es gibt keinen Weg oder Pfad zu dieser Lichtung.«
McGivney seufzte. »Highschool-Kids, kleiner Trip ins Grüne zum Kiffen und Zechen. Gras, Bier, Wodka, Zigaretten. Das machen die nicht so bald wieder.«
»Sie schließen aus, dass die ihn selbst umgebracht haben? So eine aus dem Ruder gelaufene Herr der Fliegen-Nummer?«
»Was, und dann zurückkommen, um am Tatort stoned zu werden und den Mord zu feiern?« McGivney schürzte wegwerfend die Lippen. »Die hatten die Hosen voll vor Panik.«
»Wer immer ihn ermordet hat, wollte nicht, dass er entdeckt wird«, sagte ich.
»Ach, meinen Sie?« McGivneys Mund verzog sich spöttisch. »Sagen Sie mir Bescheid, wenn Ihnen noch mehr erhellende Einsichten kommen, Sherlock.«
2 L-Haltestelle
Auf dem Weg zurück in die Stadt hielt ich an einer Tankstelle, um Felix eine Flasche Wasser zu kaufen. »Man soll kein Wasser in Flaschen kaufen«, murmelte er.
»Ganz deiner Meinung, aber du brauchst jetzt Flüssigkeit. Du wirst dich davon gleich besser fühlen.«
»Ich bin doch kein Baby«, sagte er, trank aber einen Gutteil der Flasche.
Dann fing er an zu zittern, dass seine Zähne klapperten, und schlang die Arme um sich, um warm zu werden. Ich drehte die Heizung auf, und als wir wieder auf dem Expressway waren, beruhigte er sich allmählich und trank den Rest Wasser aus.
»Danke, dass du mich hingefahren hast, Vic«, murmelte er und starrte aus dem Fenster. »Es war – echt grauenhaft.«
»Ja, die Leiche – das Gesicht – war ein schlimmer Anblick«, bestätigte ich. »Kennst du ihn wirklich nicht?«
»Denkst du, ich lüge?« Er fuhr herum, starrte mich an.
»Ich denke gar nichts. Ich bin hier, um dir auf jede erdenkliche Weise zu helfen, aber ich brauche Tatsachen, damit ich weitermachen kann.«
»Ich weiß nicht, wie irgendwer den noch erkennen soll.« Seinem Ton nach war Felix den Tränen nahe. »Ich hab ihn noch nie gesehen. Aber als es hieß, er hätte meine Telefonnummer in der Tasche, hab ich es mit der Angst gekriegt. Ich hatte das Gefühl, dieser Lieutenant will mich irgendwie festnageln, und ich hab mich wohl nicht gerade klug angestellt.«
»Was dachtest du denn, wo der Mann herkommt?«, fragte ich. »Wird jemand aus deiner IFW-Gruppe vermisst?«
»Ich kann jetzt keine Fragen mehr vertragen, Vic, bitte!«
IFW – Ingenieure für eine freie Welt – war eine Aktivistengruppe, zu der Felix seit dem letzten Winter gehörte. Unmittelbar vor Weihnachten gerieten er und rund ein Dutzend andere ausländische Studierende bei einer Razzia ins Netz der Einwanderungs- und Zollbehörde. Man sperrte ihn in einen fensterlosen Raum in einem Gebäude, von dem er nie erfuhr, wo es lag. Man gewährte ihm weder Wasser noch Toilettenzugang und auch keinen Anruf.
Felix war Kanadier; er war nach Chicago gekommen, um am Illinois Institute of Technology seinen Master in Ingenieurswissenschaft zu machen. Sein Großvater war Lotty Herschels Bruder Hugo, der zusammen mit ihr zehn Tage vor Beginn des Zweiten Weltkriegs aus Wien nach London geflüchtet war. Nach dem Krieg, als Lotty in Chicago ihr Klinikpraktikum in Frauenheilkunde und Geburtshilfe absolvierte, zog Hugo nach Montreal, wo er heiratete und eine Familie gründete. Hugo und Lotty blieben in engem Kontakt mit allsommerlichen Familienbesuchen in Chicago. Für Felix schien es daher ganz naheliegend, sich für sein Studium eine Chicagoer Uni auszusuchen.
Das war vor seiner Inhaftierung. Danach erzählte uns Felix, dass die ICE-Behörden zwar behaupteten, den Status aller ausländischen Studierenden gleichermaßen zu überprüfen, aber festgenommen und durchgecheckt wurden tatsächlich die aus Nahost und Lateinamerika. Sowie Felix, der mit seiner walnussfarbenen Haut und den dunklen Locken wie Omar Sharifs Enkel aussah.
»Sie haben mich fünf Stunden festgehalten. Ab und zu kam jemand rein und stellte mir genau dieselben Fragen wie sein Vorgänger, als wollten sie mich austricksen. Als ich rauskam, hab ich erfahren ich, dass die Studis aus Europa und Asien – und die weiß aussehenden aus Kanada – bloß ihre Pässe zeigen mussten, keine weiteren Fragen.
Und selbst als sie mich endlich in ihr System eingegeben und festgestellt hatten, dass ich wirklich Kanadier bin, forderten sie immer noch mein Visum. Anscheinend wussten sie nicht mal, dass Kanadier keine Visa brauchen, um in den USA zu studieren. Üble Schikanierer und dumm noch dazu.«
Zwei seiner Mitstudierenden, ein Mann aus Paraguay und eine im Sudan geborene Frau, wurden in Untersuchungshaft genommen, ihnen drohte Abschiebung. Sie waren DACA-Fälle, auch Dreamer genannt: als Minderjährige ohne Aufenthaltsgenehmigung in die USA gekommene Personen, die durch die DACA-Maßnahme für jeweils zwei Jahre vor Abschiebung geschützt sein und Zugang zu einer Arbeitserlaubnis erhalten sollten. Wie viele andere Träumer hatten sie Mühe, die fünfhundert Dollar für den Verlängerungsantrag zusammenzukriegen.
Die Abschiebung der Frau brachte Felix noch mehr in Rage. Ich fragte mich, ob sie etwas miteinander gehabt hatten, aber er sagte, sie seien nur Laborpartner. »Im Sudan ist Kitokos Leben in Gefahr. Ihr Bruder wurde ermordet, ihre Mutter vergewaltigt. Sie ist in den USA aufgewachsen, alles, was sie kennt, ist hier. Aber das zählt gar nichts!«
Er war zum Kanadischen Konsulat gegangen und hatte darum ersucht, Kitoko Asyl zu gewähren, aber bis der Konsul endlich antwortete, hatten die USA sie abgeschoben.
Felix hatte davon gesprochen, nach den Weihnachtsferien ganz in Montreal zu bleiben. Außerdem hatte er über ein paar alarmierend radikale Aktivitäten gesprochen. Um Neujahr herum hatten einige seiner Mitstudierenden am IIT die Gruppe Ingenieure für eine freie Welt gegründet. Als Felix davon erfuhr, kam er zurück nach Chicago und trat der Gruppe bei. Er setzte sein Studium fort, aber parallel dazu ging er regelmäßig zu Treffen von Studierenden aus Lateinamerika und dem Orient.
Vorher war er praktisch jeden Sonntag zum Essen bei Lotty gewesen, jetzt nahm die Projektarbeit mit Gleichgesinnten seine gesamte Freizeit in Anspruch. »Friedensinitiativen. Wir orientieren uns am Beispiel von Ingenieure ohne Grenzen«, sagte er, als Lotty fragte, warum er nur noch unregelmäßig zu ihr kam.
Lotty war das Ganze nicht geheuer. »Ja, es ist prima, dass er für das Richtige eintritt, aber ich will nicht, dass er vor lauter Empörung etwas tut, was sich nicht rückgängig machen lässt.«
Als Felix mich heute um zwei Uhr früh anrief, in heller Panik, weil des Sheriffs Deputys an seine Wohnungstür hämmerten, bekam ich Angst, dass er diese Grenze überschritten hatte.
Ich war nach einem langen Tag im Tiefschlaf gewesen, doch als er »Cops an meiner Tür« sagte, fuhr ich hoch und war hellwach.
»Was wollen sie?«
Ich zog Jeans, Sweater und Schuhe über, während ich ihm einschärfte, er solle der Polizei mitteilen, dass seine Anwältin auf dem Weg war und er mit ihnen reden würde, sobald ich ankam, aber bis dahin würde er die Tür nicht öffnen.
Ich bin wirklich Anwältin, zumindest auf dem Papier: Ich erhalte meine Mitgliedschaft in der Anwaltskammer aufrecht, schon damit ich mich auf meine Privilegien berufen kann, wenn ich über meine Klienten befragt werde. Oder auch um einen provisorischen Schutzwall zwischen ihnen und etwaiger Strafverfolgung zu errichten, bis ich ihnen eine mächtigere juristische Faust besorgt habe.
Auf dem Weg zu Felix rief ich Lotty an. Ich scheuchte sie nur sehr ungern auf, aber sie würde es mir nie verzeihen, wenn Felix verhaftet wurde und sie erst im Nachhinein davon erfuhr. Wir einigten uns, dass ich die Sache am besten selbst zu regeln versuchte, aber sofort anrufen würde, falls er den kanadischen Konsul brauchte oder meinen Strafrechts-Anwalt.
Es gab ein ziemliches Gehedder, als ich bei Felix eintraf, aber ich konnte die Deputys des Sheriffs überreden, mir ihre Mission zu offenbaren: Felix war nicht tatverdächtig – sie wollten wissen, ob er eine Leiche identifizieren konnte. Weiter wussten sie nichts, oder sie sagten nichts weiter, außer dass sie sich mit mir anlegten, als ich Felix selbst hinfahren wollte, statt ihnen zu erlauben, ihn ins Heck eines Streifenwagens zu stopfen. Sie zogen auch bei dieser Debatte den Kürzeren, was vermutlich erklärte, wieso der Deputy uns ohne Hilfestellung durchs Dickicht strampeln ließ.
Die Leiche war im Cap Sauers-Naturschutzgebiet deponiert worden, Teil einer Kette von Wäldern, Sümpfen und kleineren Seen, die zu den Waldreservaten im Südwesten der Stadt gehören. Die Vororte und Gated Communities sind gewachsen und greifen immer mehr auf die Wälder über, aber Cap Sauers kommt einer echten Wildnis so nahe, wie es im Ballungsraum einer Großstadt nur irgend möglich ist. Es ist eine nur geringfügig manikürte Erinnerung an die Gletscher, die vor fünfundzwanzigtausend Jahren die ganze Gegend bedeckt haben, und die wenigen Trampelpfade stellen sogar bei Tageslicht eine Herausforderung dar.
Während Felix und ich stadteinwärts fuhren, dachte ich über die Kids nach, die die Leiche entdeckt hatten. Ich hätte sie nicht so schnell abgeschrieben wie der Sheriff. Höchstwahrscheinlich Weiße, womöglich aus einflussreichen Familien, wenn ich nach dem Wohlstand der unmittelbaren Umgebung ging. McGivney würde sie mit Samthandschuhen anfassen, aber meiner Einschätzung nach konnten die Jugendlichen noch mehr Heimlichkeiten im Sinn haben, als sich zuzudröhnen, wenn sie durch den Wald strolchten.
Als ich vom Expressway abfuhr und in die schmalen Einbahnstraßen um den Campus der Technischen Universität kam, fing Felix an, Textnachrichten auszutauschen. Anspannung strahlte von seinen Schultern aus – er war sich meiner Gegenwart bewusst, behandelte mich aber als Außenseiterin.
»Ich sage Lotty Bescheid, was passiert ist«, sagte ich. »Willst du heute Nacht bei ihr bleiben oder bei mir?«
»Nein, bring mich einfach zu mir nach Hause.«
Er sagte nichts mehr, blieb über sein Handy gebeugt, das hartnäckig weiter pingte. Vielleicht, dachte ich, ging er die Mitglieder seiner Ingenieure für eine freie Welte-Gruppe durch, allesamt mitten in der Nacht wach, von denen niemand etwas über einen Toten wusste, die aber trotzdem in Alarmbereitschaft waren.
Ich brach das Schweigen, als ich vor seinem Haus hielt. »Die Leute des Sheriffs kommen wahrscheinlich mit einem Durchsuchungsbeschluss für deinen Computer. Du hast doch nichts auf dem Server, was nach Gewalt gegen die Regierung klingt, oder?«
»Wir bauen keine Bomben! Wie oft muss ich es dir und Tante Lotty noch erklären, IFW entwickelt Projekte für das Leben, nicht den Tod.« Seine Stimme brach weg. »Bitte, heute Abend keine Fragen mehr. Okay?«
»Schon gut.« Ich hob die Hände als Signal für einen Waffenstillstand. »Ich hab im Revier des Sheriffs keine Beziehungen wie bei der Polizei von Chicago, also komme ich nicht an Informationen über ihr Vorgehen heran. In meinen Augen macht das die Situation noch besorgniserregender, deshalb will ich sicherstellen, dass wir keine unnötigen Risiken eingehen.«
Das Revier des Sheriffs, die Kreispolizei, war zuständig für Todesfälle in den Waldreservaten. Dieser Teil der Polizei galt lange Zeit als Inbegriff aller Arten von Korruption, bis hin zu Arbeit für das organisierte Verbrechen. Zwar sind sie mittlerweile erneuert und eine professionelle Polizeieinheit geworden, aber ganz wohl war mir dabei nicht, mir fehlte ein Insider, mit dem ich über McGivney reden konnte oder darüber, wie seine Ermittlung voranging.
»Ich red mal mit meinem Anwalt«, sagte ich zu Felix. »Freeman Carter hat in seiner Kanzlei neuerdings eine Einwanderungsexpertin, eine Frau namens Martha Simone. Sieh mal zu, ob deine Mutter oder dein Großvater ihre Rechnungen übernehmen kann, denn das wird nicht billig, aber du brauchst jemanden mit ihrem Können auf deiner Seite. Einstweilen schließ bitte mich und Lotty nicht aus. Wir mögen in deinen Augen engstirnige Reaktionäre sein, aber dein Wohlergehen ist Lotty sehr wichtig, und ihr Wohl ist für mich entscheidend, klar?«
Er nickte stumm, drückte krampfhaft meine Hand und stieg aus. Es war vier Uhr morgens, eine gute Zeit für Straßenräuber. Ich sah ihm nach, bis er in seinem Mietshaus verschwunden war, bevor ich wieder zurück zum Expressway fuhr. Jenseits des Dan Ryan Expressway ragte das White Sox-Stadion in die Höhe. Zwischen Felix’ Wohnung und dem Ryan standen die gealterten Träger der State Street-Hochbahn. Lotty rief genau in dem Moment an, als ein Zug über mir entlangratterte.
Ich fuhr rechts ran und wartete, bis der Zug vorbei war, damit ich sie hören konnte. »Wir sind gerade erst mit der Kreispolizei fertig – ich habe Felix vor fünf Minuten zu Hause abgesetzt. Das war ein seltsamer und ermüdender Ausflug, aber Felix konnte die Leiche nicht identifizieren.«
Ich erzählte ihr von dem Zettel mit seiner Telefonnummer, jedoch nichts von meiner Befürchtung, dass Felix damit gerechnet hatte, eine bestimmte Leiche zu sehen. Lotty ist meine engste Freundin, meine Mentorin, mein Gewissen; es fühlte sich falsch an, Geheimnisse vor ihr zu haben, aber ich wollte sie nicht beunruhigen, solange ich nur ein ungreifbares Gefühl und keinerlei Beweise hatte.
»Du bist also sicher, dass Felix nichts mit dem Tod dieses Fremden zu tun hat?« Sie konnte nicht verbergen, dass ihre Stimme leicht zitterte.
»Ganz sicher«, sagte ich standhaft.
Sicher war ich mir, dass Felix diese Schläge nicht ausgeteilt haben konnte. In anderer Hinsicht war ich weniger überzeugt – das betraf nicht nur die Frage, ob jemand aus seinem Team vermisst wurde, sondern auch, was für Einlassungen seine E-Mails enthalten mochten. Ich wusste auch nicht, ob ich seinen Beteuerungen trauen konnte, dass sie keinerlei Waffen entwickelten. Ich wusste nicht, wie er und seine Freunde womöglich über die USA herzogen und dabei vergaßen, dass es heutzutage klug ist, gewisse Meinungen aus dem digitalen Äther herauszuhalten.
»Ich operiere nachher«, sagte Lotty. »In einer halben Stunde muss ich zum Schrubben und Umziehen. Kannst du nicht heute Abend zum Essen kommen?«
Ich kniff die Augen zu. Mein Arbeitstag begann in wenigen Stunden, lauter Termine, die ich nicht verschieben konnte.
»Ich ruf dich an«, sagte ich. »Ich glaub nicht, dass ich es schaffe, aber mal sehen, wie es heute Nachmittag läuft.«
Als ich den Gang einlegte, sah ich einen Mann die Treppe zum Bahnsteig der L hochgehen. Felix’ üppige Locken und der lange Schal, den er gern baumeln ließ wie Tom Baker als Dr. Who, waren unverkennbar.
Tagsüber, wenn der Verkehr so dicht ist, dass die L alle Autos hinter sich lässt, hätte ich ihm nicht folgen können, aber um diese Uhrzeit war das leicht. Ich fuhr unter dem Zug her, wartete an jeder Station und hielt in der Handvoll Aussteigender nach Felix Ausschau.
Der heikle Teil kam auf dem Stück, wo die Gleise unterirdisch verlaufen. Ich musste an jeder Haltestelle beide Seiten der Straße im Blick behalten, bis endlich ein oder zwei säumige Fahrgäste auftauchten. Ich fuhr weiter nordwärts, folgte dem Zug, von dem ich hoffte, dass Felix noch darin war. Und an der Station Granville, acht Meilen nördlich vom Loop, kam er die Stufen herunter.
Ich blieb an ihm dran bis zu einem Mietshaus nahe der Western Avenue, wo eine junge Frau ihm die Haustür öffnete. An ihrem Umriss konnte ich lediglich erkennen, dass sie schlank war und ein langer Zopf aus dem Schal hervorlugte, den sie lose um ihr Gesicht gewickelt trug.
Sie umarmte Felix. Er hielt sie fest, streichelte ihren Kopf. Die Tür schloss sich hinter ihnen und entzog sie meiner Sicht, aber ich starrte noch eine ganze Weile hin. Ganz bestimmt war das nicht die Person, von der Felix befürchtet hatte, sie tot im Wald vorzufinden.
3 Sister Act
Ich verschlief, was bedeutete, dass ich den Tag über hektisch durch ein Programm hetzen musste, mit dem selbst Trägerinnen Olympischer Medaillen überfordert wären: im Dauerlauf mit den Hunden um den Block, unter die Dusche und wieder raus, beim Anziehen Dateien zusammenstellen und Nachrichten checken, essen während der Autofahrt zum Büro, dann rasch noch Haare kämmen und schminken in der Bahn, während die L mich zum Loop rüttelte.
Ich kam trotzdem fünf Minuten zu spät zu meinem ersten Termin, was nicht so gut war, denn es war eine Konferenz bei meinem allerwichtigsten Klienten. Darraugh Graham ist Geschäftsführer eines Unternehmens, das im Transportgeschäft angefangen hat und mittlerweile so viele Kapitalbeteiligungen in so vielen Industriezweigen hat, dass es nur schwer zu kategorisieren ist. Es gibt Tage, da denke ich, eine moralisch gefestigte Person würde nicht für CALLIE Enterprises arbeiten, denn es lässt sich nie genau sagen, was für Schäden ihre diversen Tochtergesellschaften anrichten. Es gibt andere Tage, da betrachte ich die offenen Posten in meiner Buchhaltung und meinen Kreditrahmen und denke, wie glücklich ich mich schätzen kann, dass Darraugh mir vertraut und einen Teil seiner Angelegenheiten in meine Obhut gibt. Heute war so ein dankbarer Tag.
Während einer Konferenzpause ging ich auf den Flur und rief den stellvertretenden Leiter der Gerichtsmedizin an, um zu erfahren, ob die Leiche im Wald schon identifiziert war. Nick Vishnikov beantwortet alle meine Fragen, nicht wegen unserer Beziehung – die in der Grauzone zwischen Freundschaft und gelegentlicher Zusammenarbeit angesiedelt ist –, sondern weil ihn der chronische Betrug und die Misswirtschaft im Verwaltungsbezirk Cook County so erbost, dass er seine eigenen Regeln macht.
»Weiß, männlich, um die dreißig, bei halbwegs guter Gesundheit, scheint sich anständig ernährt zu haben, wenn man vom Zustand seiner Arterien und der Leber und so weiter ausgeht, aber er war Raucher. Eins kann ich dir schon sagen, er ist nicht da gestorben, wo er gefunden wurde.«
»Sollte die Knüppelei irgendwas kaschieren?«
»Nein. Jemand mit einem Hang zu Sadismus hat ihn in den Kopf getreten, bis er am Schädeltrauma starb. Davor ist er hart in den Bauch geschlagen worden und dadurch zu Boden gegangen, soweit ich das rekonstruieren kann. Als er unten war, ging das mit dem Treten los. Nicht unbedingt in der Absicht, ihn zu töten – unmöglich zu sagen.«
Ein brutaler, blindwütiger Mörder. Ich schauderte.
»Hat er Tätowierungen oder Muttermale oder irgendwas, was einer befreundeten Person ermöglichen könnte, ihn zu identifizieren?«, fragte ich.
»Nichts Ungewöhnliches. Wir rekonstruieren jetzt sein Gesicht – wenn wir es schaffen, dass er aussieht, als ob eine Freundin oder ein Freund ihn erkennen könnte, geben wir sein Bild an die Medien. Wahrscheinlich zu den Abendnachrichten. Fällt dir was dazu ein?«
»Nichts. Als der Junge, mit dem ich draußen war, um die Leiche zu sichten, ihn sah, ist ihm rausgerutscht: Woher stammt er? Weist irgendwas darauf hin, dass er kein Amerikaner ist?«
»Gab es eine neue Verordnung, während ich frühstücken war? Dass wir nur noch gebürtige Amerikaner untersuchen dürfen?«, konterte Vishnikov.
»Ich bin erstaunt, dass du das Memo nicht gelesen hast«, sagte ich. »Umso dringender müssen wir wissen, wo der geheimnisvolle Mann geboren ist.«
»Kann ich dir nicht sagen. Sollte er Spuren von Cholera oder Denguefieber aufweisen, dann heißt das, dass er vor kurzem in einem von dreißig bis vierzig Ländern war, aber nicht, dass er da geboren ist.«
»Gibt es denn Spuren von Cholera oder Denguefieber?«, fragte ich.
»Ich untersuche das Blut auf Pathogene. Machen wir normalerweise nicht, aber – nur für den Fall. Wenn du nachfragst, gibt es fast immer einen Grund.«
Er legte auf, bevor mir eine geistreiche Erwiderung einfiel. Auf dem Rückweg zu der Besprechung schlug ich Denguefieber nach. Es schien mir ein guter Grund, nicht in die Tropen zu fahren.
Von Darraugh aus ging ich zur nächsten Brotverdienst-Klientin, einer kleinen Gemeinschaftskanzlei, die ab und an Verwendung für mich hat. Am Ende des Nachmittags, aufgebläht von all den Besprechungen, holte ich mein Auto und fuhr zu dem Mietshaus, das Felix heute früh aufgesucht hatte. Ich hatte ihn in der Mittagspause anzurufen versucht, um zu hören, ob er noch mal Besuch von der Kreispolizei bekommen hatte, aber er schickte meinen Anruf auf die Voicemail.
Das Mietshaus lag in einem Stadtteil, in dem immer viel los ist, sowohl Fußgänger als auch Straßenverkehr. Pakistanische und indische Einwandererfamilien haben sich hier zusammengetan, und Devon ist ein Knotenpunkt für südasiatische Lokale und Läden. An diesem Nachmittag wirkte die Gegend eher ruhig – fast zu ruhig, als hielten sich Einwanderer von jedem Ort fern, wo ICE-Agenten lauern könnten.
Es war ein Viertel mit Bungalows und ordentlichen Gärtchen, dazwischen vereinzelte Wohnblocks. Die meisten davon waren eher klein, sechs bis zehn Wohnungen pro Gebäude, aber Felix’ Freundin lebte in einem der wenigen größeren Blocks mit etwa sechzig oder siebzig Wohneinheiten. Ich saß ein Weilchen da, sah Erwachsene von der Arbeit oder vom Einkaufen heimkommen, Kinder von der Schule, manche in Fußballkluft, andere mit jüngeren Geschwistern auf dem Rücken oder der Hüfte. Es wurde voller. Ich sah Männer, die Takken trugen, Gebetskappen, oder Sikh-Turbane, Frauen mit Hijabs, barhäuptige Frauen mit langen Zöpfen oder kurzen Locken, dünne Frauen, schwergewichtige Frauen. Als einige bemerkten, dass ich das Haus beobachtete, verdrückten sie sich rasch: Nur Leute von der Einwanderungsbehörde würden so penetrant starren.
Schamgefühl packte mich. Scham, weil ich Menschen musterte, als wären sie Laborproben, Scham, weil meine Regierung Leuten solche Angst machte. Ich fuhr weg. Selbst wenn ich mir Mühe gäbe, eine unauffälligere Beobachtung durchzuführen, könnte ich Felix’ Freundin in diesem Trubel gar nicht erkennen.
Es geht dich sowieso nichts an, knurrte ich mir auf dem Heimweg grimmig zu. Ich brauchte fast vierzig Minuten für die vier Meilen bis zu meiner Wohnung in Racine: eine gerechte Strafe für die Zeitverschwendung mit blindem Voyeurismus. Nur blieb da die nagende Sorge, dass Felix irgendwie damit gerechnet hatte, in dem Baumstumpf einen Ausländer zu sehen.
Rund die Hälfte der Studierenden am IIT war international. Seit Felix bei Ingenieure für eine freie Welt war, gab er sich größte Mühe, Anschluss an die aus Afrika und dem Orient zu finden. Ich war mir sicher, dass er sich um einen vermissten Freund sorgte, aber solange er mich nicht freiwillig einweihte, gab es wenig, was ich tun konnte.
Ich zog Jeans an und fuhr die Hunde zum Seeufer. Ein bitterer Winter hatte sich noch bis in den späten März gehalten, aber heute war es unerwartet warm. Während die Hunde schwammen, rollte ich die Hosenbeine hoch und watete ins Wasser, sprang aber gleich wieder raus – die Kälte drang mir fast augenblicklich bis in die Knochen.
Der Tag war zu lang gewesen. Ich simste an Lotty, dass ich es nicht zum Abendessen schaffte, wir würden uns morgen auf den Stand bringen.
Mr. Contreras, der Nachbar im Erdgeschoss, mit dem ich mir die Hunde teile, kam heraus, um sie in Empfang zu nehmen. Als er anfing, etwas von Besuch zu erzählen, winkte ich ab. »Bitte später.«
»Nichts mit später, Cookie, sie wartet da drin auf dich.« Er ruckte den Kopf in Richtung seines Wohnzimmers. »Sagt, sie ist deine Nichte. Ich wusste gar nicht, dass du Nichten hast, aber sie sieht mir nicht nach einer Schwindlerin aus.«
»Ich habe keine Nichten«, sagte ich. Wenn die Frau jung und hübsch war, konnte sie meinen Nachbarn mühelos um ihren kleinen Finger wickeln.
»Tante Vic?«
Eine Frau, jung, mit Haar von der Textur und Farbe seidiger Maisgrannen, tauchte hinter Mr. Contreras aus. Sie blickte mich unsicher an: Würde ich eine Waise verstoßen und ins brüllende Unwetter hinausschicken? Es war eine gute Darbietung – Mitch trottete sofort zu ihr und rieb seinen Kopf an ihrem Bein, während Mr. Contreras ihr die Schulter klopfte. Peppy blieb dicht bei mir stehen – wir beide unnahbar, misstrauisch.
»Tante Vic, ich – ich weiß, es ist ewig her, dass wir uns gesehen haben, aber Onkel Dick –«
»Reno?« Ich starrte sie ungläubig an.
»Ich bin Harmony, Tante Vic. Reno ist verschwunden.«
»Tut mir leid, das zu hören«, sagte ich höflich.
»Also, Cookie, das ist doch keine Art. Miss Harmony braucht deine Hilfe bei der Suche nach ihrer Schwester.« Mr. Contreras funkelte mich an, die Arme in die Hüften gestemmt. Sogar Peppy sah bekümmert zu mir hoch.
»Können wir das morgen bereden? Ich war die ganze Nacht auf, ich musste mir am Stadtrand ein Mordopfer ansehen.«
»Aber, Tante Vic …« Tränen glitzerten an den Spitzen von Harmonys Wimpern. »Es ist wirklich ernst. Ich bin aus Portland hergeflogen, weil ich wusste, dass Reno in Schwierigkeiten steckt, aber als ich zu ihrer Wohnung kam, war sie weg.«
Alles, was ich wollte, war mein Bett zwei Treppen über mir, so weit entfernt wie der Gipfel des Everest. Mein Hirn hatte die Denkkraft einer Schüssel alter Hafergrütze.
»Du lebst in Portland?«
Harmony nickte.
»Und Reno ist hier in Chicago? Zu Besuch?«
»Cookie, du hörst nicht zu«, sagte Mr. Contreras. »Sie hat dir gerade erzählt, dass Reno hier eine Wohnung hat.«
»Wenn sie hier lebt, wie kommt es, dass ich nichts von ihr gehört habe? Meine letzte Info war, dass Becky – das ist die Mom der beiden«, schob ich für Mr. Contreras ein, »mit ihnen nach Westen in eine Kommune gezogen ist. War es in Wyoming?«
»Montana. Wir sind da nur sechs Monate geblieben, haben auf einen Kerl gewartet, der mutmaßlich unser Vater ist, aber er ist nie aufgetaucht. Dann sind wir weiter nach Westen und haben uns in Oakland niedergelassen. Reno ist allein hergezogen, vor über einem Jahr.«
»Warum hat sie sich nicht gemeldet?«, fragte ich.
»Sie wusste gar nicht, dass du und Onkel Dick geschieden seid, bis sie bei ihm anrief und seine zweite Frau dran war. Reno sprach sie mit ›Tante Vic‹ an, und die Dame hat sie angepöbelt, als ob wir gefälligst wissen müssten, dass ihr euch getrennt habt, Onkel Dick und du. Und dann, also deinen Namen hat sie erst später rausgekriegt. Wir wussten ja nicht, wie Opa Tony mit Nachnamen hieß. Jedenfalls hat Onkel Dick Reno gewissermaßen eine Art Job vermittelt, aber dazugesagt, das war’s, sie sollte ihn ja nicht wieder belästigen.«
Becky Seale war die kleine Schwester des Mannes, mit dem ich mal verheiratet gewesen war. Als Richard Yarborough und ich uns scheiden ließen, waren ihre Mädchen fünf und sechs. Linda Yarborough, die Mutter von Dick und Becky, konnte ihr Entzücken über die Scheidung nicht verhehlen. Beide ihrer Kinder waren katastrophale Ehen eingegangen: Becky mit Fulton Seale, einem heroinsüchtigen Herumtreiber, und ihr geliebter Richard war (ihrer Ansicht nach) von der Tochter eines Chicago-Cops und einer italienischen Flüchtlingsfrau verführt worden.
Und dann ereignete sich ein Wunder, wenigstens für meine Schwiegermutter: Dick verließ mich wegen eines grazilen fraulichen Weibchens mit reichem Vater. Teri wollte keine Karriere – sie war völlig glücklich damit, zwei Tage pro Woche im Wohlfahrtsladen des Krankenhauses auszuhelfen und den Rest der Zeit mit Freundinnen shoppen zu gehen oder Golf zu spielen.
Ich war ebenfalls glücklich: Der Kleinkrieg zwischen Becky und ihrer Mutter hatte mir schon zwei Thanksgiving und ein Weihnachten verdorben. Beim zweiten Weihnachten mit Dick konnte ich keine weitere Yarborough-Familienschreierei ertragen und nahm Reno und Harmony mit nach South Chicago, um Weihnachten mit meinem Vater zu feiern. Zum Entzücken seiner Mutter blieb Dick in Lake Forrest an ihrer Seite.
Die Mädchen und ich spielten Verstecken im Bessemer Park, wir gingen zu einem Blackhawks-Spiel – mein Cousin Boom Boom lebte damals noch und führte die Torschützenliste der NHL an –, wir rösteten Marshmallows auf der Ofenplatte in der winzigen Küche im Haus meiner Kindheit. Über Nacht packte ich sie auf die Ausziehcouch im Wohnzimmer und summte ihnen die italienischen Schlaflieder vor, die meine Mutter früher für mich gesungen hatte.
Als ich sie zu ihrer Großmutter nach North Shore zurückbrachte, besiegelten sie deren Abneigung gegen mich, indem sie darum bettelten, zurück zu Opa Tony zu dürfen. Und dann hatte ich sie vergessen.
»Na jedenfalls, Reno kam ganz gut klar«, sagte Harmony. »In dem Finanzunternehmen, wo Onkel Dick ihr den Job vermittelt hatte, fand man sie gut, sie wurde befördert, und die haben sie zu so einer Art Mardi-Gras-Party in die Karibik geschickt. Aber als sie zurück nach Chicago kam, war sie ziemlich aufgebracht wegen dem, was in dem Ferienparadies ablief. Gesagt hat sie nur, dass sie es hätte besser wissen müssen, aber dann wirkte sie zunehmend, ich weiß nicht, aufgewühlt vielleicht. Deprimiert. Irgendwann hab ich beschlossen herzufliegen, um sie zu sehen. Wir waren füreinander immer die beste Freundin, wir haben so viel zusammen durchgemacht, wovon sonst niemand weiß. Es ist eigentlich das erste Mal im Leben, dass wir länger als einen Tag getrennt sind.
Mein Chef, also der war auch dafür: ›Lass deine Schwester nicht allein damit‹, hat er gesagt. ›Wir kommen hier ein paar Tage ohne dich zurecht.‹ Erst als ich herkam – der Hausmeister, also der hat mich in ihre Wohnung gelassen, und sie war nicht da. Ich hab ihr eine SMS geschickt: Auf dich wartet eine Überraschung, wenn du heimkommst!, aber keine Antwort bekommen. Ich konnte nicht schlafen. Ich hab die ganze Zeit darauf gewartet, dass sie nach Hause kommt.«
»Unterwegs im Auftrag der Firma?«, schlug ich vor. »Über Nacht bei ihrem Freund geblieben?«
»Sie hat keinen Freund, und sie hätte es mir gesagt, wenn sie die Stadt verlässt. Wir erzählen uns immer alles.«
Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz schon gehört habe, meist von einer Person, deren Gefährte oder Gefährtin sie hintergangen hat. Von Geschwistern allerdings hörte ich es wohl zum ersten Mal.
»Hast du in ihrem Büro angerufen?«
»Schon, aber, also die haben mich endlos im Kreis geschickt. Sie haben eine Unmenge Niederlassungen in Chicago, und keiner wollte mir sagen, in welcher sie arbeitet.«
Ich setzte mich auf. »Für wen ist sie denn tätig?«
»›Rundum sorglos‹, die gehören zu –«
»Ich kenne ›Rundum sorglos‹«, sagte ich.
Es handelte sich um ein Unternehmen, das Zahltagskredite vergab, einer der dickeren Fische in einem trüben Teich. Ein Zahltagskredit ist eigentlich als Überbrückung bis zum nächsten Gehaltsscheck gedacht, aber die Zinsen dafür betragen in Illinois bis zu 400 Prozent im Jahr. Da würde sogar die Mafia erröten – geh zu Don Pasquale, einem der wenigen Paten, die nicht in einem Bundesgefängnis sitzen, der hilft dir für 300 aus der Patsche.
»Bist du sicher?«, fragte ich Harmony. »Du hast den Namen nicht missverstanden? Es gibt Matratzenfirmen, die so ähnlich heißen.«
Harmony fuhr auf. »Bist du etwa auch wie alle anderen? Denkst du, ich bin blond, also bin ich blöd? Reno hat gesagt, sie jobbt im Finanzwesen. Sie hat gesagt, sie arbeitet bei ›Rundum sorglos‹. Klingt das für dich nach Matratze?«
»Nein«, bestätigte ich friedlich. »Es klingt nach einem Job bei ›Rundum sorglos‹. Hast du sie vermisst gemeldet?«
»Bei der Polizei? Nein, ich kann nicht zur Polizei!«
»Die haben aber ganz andere Möglichkeiten als das bisschen, was ich tun kann«, sagte ich.
»Glaubst du, die scheren sich einen Furz um Leute wie Reno und mich?«, rief Harmony mit feuchten Augen. »Die haben immer nur eins im Sinn, wenn sie uns sehen.«
»Opa Tony war auch ein Cop«, sagte ich. »Wenn er noch am Leben wäre –«
»Ist er aber nicht, und ich rede mit keinem Bullen, selbst wenn er Opa Tonys Zwillingsbruder wäre!«
Ich sagte, wir könnten doch darauf bestehen, mit einer Frau zu sprechen, aber Harmony war nicht umzustimmen. Keine Polizei, jetzt nicht und niemals.
»Ich weiß, dass du Detektivin bist, ich hab online nachgesehen. Du hast große Fälle gelöst.«
Mein Mund verzog sich. »Manchmal ist es einfacher, einen großen Betrug aufzudecken als eine vermisste Person zu finden.«
»Aber trotzdem, ach bitte, kannst du nicht wenigstens versuchen, sie zu finden?«
»Ich kann morgen früh eine ernsthafte Nachforschung einleiten, aber im Moment bin ich zu müde, um noch geradeaus zu denken.«
Mr. Contreras schaltete sich diesmal zu meinen Gunsten ein. »Ganz recht, Harmony. Ich brate dir ein schönes Steak, dann schauen wir beide uns das Rennen an, und dann kannst du im Zimmer meines Enkels übernachten. Und deine Tante hier, die lassen wir in Frieden ausschlafen.«
Es war ein freundliches Angebot an uns beide, aber Harmony hatte Einwände.
»Ich muss zurück in Renos Wohnung. Was, wenn sie heute Nacht nach Hause kommt? Dann muss ich für sie da sein!«
Wir konnten sie nicht umstimmen. Ich versprach, sie noch zur Wohnung ihrer Schwester zu fahren. Nachdem ich ein Bad genommen hatte. Nach dem Abendessen.
4 Königinnen in Seide
Während ich in der Badewanne lag, meldete ich mich bei Lotty. Sie hatte den ganzen Tag nichts von Felix gehört, und er hatte auch nicht auf ihre Anrufe reagiert. Ich berichtete ihr, wie ich ihm am frühen Morgen nach Edgewater gefolgt war, und von meinen Spekulationen über die junge Frau, aber Lotty wusste auch nicht mehr als ich darüber, was er dort suchte.
Ich wollte ihr eigentlich von Harmony Seales unerwarteter Ankunft erzählen, aber dann fehlte mir die Kraft, meine Neuigkeiten zu teilen. Stattdessen versprach ich, mich wieder zu melden, und döste ein.
Harmony weckte mich eine halbe Stunde später, rieb sacht meine Schulter: Mr. Contreras hatte sie hochgeschickt, um mich zum Essen zu holen. Sie stand in meinem kleinen Flur herum, während ich mich im Schlafzimmer anzog.
Ein postergroßes Foto meiner Mutter hängt dort, Gabriella auf der Schwelle zu ihrem Comeback als Konzertsängerin, kurz bevor der Gebärmutterkrebs sie auffraß. Auf dem Foto sieht sie umwerfend aus, im Konzertkleid mit seinem Mieder aus Samtbrokat und dem fließenden Seidenrock wirkt sie glamouröser als die Callas.
Harmony stellte ein paar höfliche Fragen nach ihr. »Du hast so ein Glück, eine Mutter zu haben, auf die du stolz sein kannst«, bemerkte sie. »Wobei Reno und ich mit unserer Pflegemutter Clarisse letztlich auch Glück hatten, bloß hat sie jetzt Alzheimer und weiß nicht mehr, wer ich bin.«
»Das ist mächtig hart«, murmelte ich.
Im Vorbeigehen strich ich über das Glas vor dem Gesicht meiner Mutter. Es war dreißig Jahre her, und doch durchfuhr mich bei Harmonys Bemerkung immer noch Trauer. Verlust lässt sich nicht gegeneinander aufrechnen: meine zu jung gestorbene Mutter, Clarisses Verschwinden aus der Gegenwart – noch da, aber nicht mehr da. All diese Verluste sind Zugänge zu einem Abgrund. Wenn wir uns erst mal hineinfallen lassen, ist es schwer, da wieder rauszuklettern.
Nach dem Abendessen drängte Mr. Contreras Harmony erneut, die Nacht in seinem Gästezimmer zu verbringen. »Vic sollte so spät nicht mehr fahren müssen«, mahnte er.
»Ich kann mir einen Wagen rufen«, sagte Harmony.
Ich fuhr sie, teilweise um eine Beziehung aufzubauen – ich war verlässlich, ich ließ sie in einer fremden Stadt nicht allein. Außerdem wollte ich die Wohnung ihrer Schwester sehen: Fairfield Ecke North Avenue, die gentrifizierte Gegend nordöstlich vom Humboldt Park. Wir nahmen Mitch mit – ein schwarzer, hundert Pfund schwerer Hund flößt Respekt ein, wo er geht und steht.
Unterwegs fragte ich Harmony, was ihre Schwester zurück nach Chicago getrieben hatte.
Sie zuckte die Achseln. »Mom ist nach Oakland, als unser sogenannter Vater sie sitzenließ. Sie hat sich eine Art Job gesucht, aber dann ist alles entgleist, wie es bei ihr halt immer lief. Mom hat auf der Straße gebettelt, und alles, was sie bekam, ging für Drogen drauf. Sie wollte Großmutter Yarborough dazu bringen, uns zu nehmen, oder Onkel Dick, aber beide haben abgelehnt.
Wir haben unter Brücken gepennt oder manchmal im Keller von Kirchen. Wir haben aus Mülltonnen gegessen. Reno und ich – Reno war so hübsch, Mom hat – sie hat sie benutzt, um Männer dazu zu bringen, dass sie vorbeikommen und ihr Stoff bringen. Und mich ebenso, auch wenn ich nicht so hübsch war, sie haben –«
Sie presste die Lippen aufeinander. Meine Bauchmuskeln verkrampften sich vor Empörung, ich war wütend auf Becky Seale, die ihre Töchter dem ausgesetzt hatte, auf Dick und seine Mutter, die ihnen die kalte Schulter gezeigt hatten, auf mich, die sie komplett ignoriert hatte. Ich sagte nichts – an diesem Punkt von Harmonys Leben war nachträgliche Empörung einfach zu billig.
»Als ich zehn war und Reno elf, beschlossen wir abzuhauen, wir wollten zurück nach Chicago trampen und sehen, ob uns irgendwer aus der Familie aufnimmt. Wir dachten, vielleicht würde Opa Tony … aber wir sind gar nicht erst aus Oakland rausgekommen: Gleich an der Autobahnauffahrt hat uns eine Frau aufgelesen.
Man hat uns in dieses staatliche Heim für Ausreißer und schwer Erziehbare gesteckt. Wir arbeiteten noch an einem Fluchtplan, da sind Clarisse und Henry aufgetaucht. Clarisse und Henry Yu. Sie waren ein multiethnisches Paar, weißt du, und sie konnten keine eigenen Kinder kriegen, da dachten die Behörden wohl, man könnte ihnen doch zwei völlig verkorkste weiße Mädchen aufdrücken. Wir waren Straßenkinder. Wir waren nicht süchtig, aber über Drogen konnte uns keiner was erzählen. Und wir kannten uns – nach Strich und Faden – mit Sex aus.«
Harmonys Hände wanderten unwillkürlich über ihren Bauch. Ich riskierte es, sie sacht an der Schulter zu berühren. Sie stieß mich nicht weg, saß aber starr da: Sie war wohl zu oft ohne Einwilligung berührt worden.
Wir erreichten Renos Adresse. Ich beschäftigte mich mit Einparken, beide Hände am Lenkrad.
»Hört sich an, als ob ihr doch noch gut untergekommen wärt«, tastete ich mich vor.
»Oh ja, das sind wir. Es hat lange gedauert, bis wir ihnen ganz vertrauen konnten, aber am Ende hat alles zusammengepasst. Clarisse war streng mit uns. Nicht auf die fiese Art, aber wir waren keine Regeln gewöhnt – jeden Tag zur Schule gehen, nach der Schule heimkommen, Hausaufgaben machen und aufräumen, bevor es zum Sport ging oder zum Chor oder was auch immer, und keine Ausflüchte.«
Harmony lächelte vor sich hin, in irgendeine Erinnerung versunken.
»Henry war da lockerer – wenn wir eine Zwei oder Drei bekamen, sagte er zu Clarisse, sie soll sich entspannen, niemand erwartet, dass wir Marie Curie werden. Sein richtiger Name war eigentlich Heng, Yu Heng, aber in Amerika nannte er sich Henry. Clarisse und Henry, also die sprachen Chinesisch miteinander, wenn sie unter sich waren, da haben wir es natürlich auch ein bisschen gelernt, jedenfalls genug, um zu verstehen, worum es ging. Reno war darin immer besser als ich – ich konnte ›guten Morgen‹ sagen oder ›was macht deine Arthritis‹, aber sie hat es hingekriegt, richtig flüssig Chinesisch zu sprechen.
Clarisse und Henry hatten einen Blumenladen in Oakland, aber Henry zog auch Früchte und Gemüse für die Familie. Das war meine Lieblingsbeschäftigung, mit Henry in der Erde buddeln. Reno mochte das nicht so, aber sie liebte es, im Laden mitzuarbeiten, besonders wenn Clarisse sie Blumenbouquets stecken ließ. Renos Spezialität waren Beerdigungsblumen.«
Eine makabere Vorliebe, aber vielleicht hatte Reno sich da ihr eigenes emotionales Geduldsspiel ausgeknobelt, bei dem sie indirekt mit anderer Leute Kummer hantierte.
»Wir gingen aufs staatliche College in Oakland, und Clarisse und Henry waren so hin und weg, als wir unseren Abschluss machten, also man hätte denken können, wir wären die besten in Stanford.«
»Das klingt ganz so, als würde Reno Clarisse und Henry erzählen, was sie bedrückt, wenn sie es dir nicht erzählt hat«, sagte ich.
Harmonys Lippen zitterten. »Henry hatte einen Herzinfarkt, er ist vor fünf Jahren gestorben. Deshalb sind wir nach Portland umgezogen. Es gab kein Geld mehr, oder jedenfalls nicht viel nach seiner Beerdigung, und wir konnten uns Portland eher leisten. Clarisse kam mit uns, aber da ging das mit dem Alzheimer schon los. Wir haben versucht, uns selbst um sie zu kümmern, wir verdanken ihr und Henry alles, aber – sie braucht so viel Pflege, wir haben es nicht gestemmt.« Sie rieb sich mit dem Taschentuch die Nase. »Wir mussten sie ins Heim geben. Das hat dazu geführt, dass Reno in den Osten ging – es hat sie wütend gemacht und – sie fühlte sich so versehrt, jeder Mensch in unserem Leben verlässt uns. Erst Fulton – unser Vater, vorausgesetzt, das war er, wie konnten wir bei Mom da sicher sein? Dann Mom und die ganzen Yarboroughs, dann Henry und nun Clarisse – sie erkennt mich nicht mal mehr, wenn ich sie besuche. Reno wollte eigentlich an einen Ort, wo sie das alles vergessen konnte, aber sie hat sich Chicago ausgesucht. Ich schätze mal, sie dachte, Onkel Dick oder sogar unsere steifärschige Großmutter wollen sie jetzt, wo wir erwachsen sind, vielleicht mal sehen. Aber denkste.«
»Du hast gesagt, Reno und du, ihr wusstet meinen Namen nicht. Wie hast du mich denn gefunden?«
»Ich hab Onkel Dicks Büro angerufen. So eine schnöselige Sekretärin war dran, also die wollte mich partout nicht zu ihm durchstellen, aber sie hat mir gesagt, du bist eine Detektivin, die Streuner mag. Ich wusste nicht, was das soll, aber sie hat mir deine Adresse gegeben.«
»Wie überaus freundlich von ihr, uns beiden gegenüber«, sagte ich.
Wir stiegen aus und gingen die North Avenue entlang. Gleich westlich von uns lag der Park, wo Autos sich den Weg frei hupten. Trotz der Kälte staksten Mädchen in Miniröcken und hochhackigen Stiefeln die Straße entlang, Arm in Arm miteinander oder mit schmalhüftigen Jungs. Skateboarder fuhren Schlenker um uns herum und johlten dem »blonden Hühnchen« zu, als ich Harmony zum Hauseingang folgte. Als Mitch einen anknurrte, der uns zu nahe kam, ging der Rest auf Abstand.
»Wie bist du an den Schlüssel gekommen?«, fragte ich, als Harmony die Haustür aufschloss.
»Der Hausmeister, also der hat mich reingelassen. Ich hab hier draußen gewartet« – sie zeigte auf den Gehweg – » als er Feierabend machte. Ich sehe Reno sehr ähnlich, auch wenn ich nicht so hübsch bin, da hat er gleich erraten, dass ich ihre Schwester bin, und mich reingelassen.«
»Er hat dir Schlüssel gegeben?«
»Nein. Reno hat ihre gar nicht mitgenommen, was mich noch mehr beunruhigt. Wie kann sie weggehen und ihre Schlüssel nicht mitnehmen? Aber die lagen da, wo wir sie immer hintun, in der Schüssel neben der Tür. Wenn du ein System hast, verschwendest du keine Zeit mit Suchen.«
Vermisste Person, mögliche Entführung. Hausmeister mit Schlüsseln. Ich machte den Mund auf und wieder zu. Mir war nicht nach einer weiteren Schlacht mit Harmony in Sachen Polizei: Morgen würde ich auf eigene Faust Meldung machen.
Mitch und ich folgten Harmony die Treppe hoch in den zweiten Stock. Gleich neben dem Eingang stand ein Tischchen mit einer blauen Steingutschüssel. Harmony legte den Schlüsselbund hinein, obenauf ein paar Briefe.
Ich drehte eine schnelle Runde durch das Apartment, prüfte, ob etwas auf Eindringen hindeutete und wie die Sicherheitsvorkehrungen waren. Die Wohnung zu durchsuchen dürfte leicht sein, denn alles war akkurat bis regelrecht kahl. In den Schubladen des Schreibtischs im Wohnzimmer fand sich nur das Notwendigste – die wenigen Rechnungen, die noch per Post kamen statt online, eine Einladung zu einer Benefizveranstaltung, ein paar alte Briefe, einer davon trug chinesische Schriftzeichen. Im Wohnzimmer hingen auch zwei chinesische Drucke an den Wänden.
In Renos Schlafzimmer war ihre spärliche Garderobe ordentlich auf Bügeln und in Körben verstaut. Es gab drei Handtaschen, alle leer. Kein Computer, kein Telefon.
Auf dem Nachttisch und an der Wand neben dem Bett hatte sie gerahmte Familienfotos. Auf den meisten waren eine Afroamerikanerin und ein Chinese: Clarisse und Henry. Ein formelles Foto von ihnen mit den zwei Schwestern stand auf dem Nachttisch.
Das Bild, das Harmony lebendig werden ließ, zeigte sie strahlend mit Henry, beide in dreckverkrusteten Overalls, sie hielten einen Korb mit Gemüse so in die Kamera, dass sie die makellosen Auberginen einfing, umringt von Tomaten und Zucchini.
Auf einem Profilbild stand die ältere Frau im Blumenladen, steckte eine Rose in einen Kranz. Ein Hauch von Lächeln auf ihren Lippen – sie wusste, dass sie fotografiert wurde, und amüsierte sich über die Vorspiegelung, dass sie das nicht tat. Es gab mehrere Bilder von den Mädchen bei ihren verschiedenen Abschlüssen, die beiden Erwachsenen hinter ihnen, alle vier breit grinsend vor Stolz.
Auf einem präsentierten sie zwei identische goldene Ketten mit altmodischen herzförmigen Medaillons. »Die haben uns Clarisse und Henry zum Highschoolabschluss geschenkt. Wir nehmen sie nie ab. Also ich jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, wie Reno das inzwischen hält.« Sie zog die Kette unter ihrem Sweater hervor. Sie war massiv Gold, nicht bloß vergoldet, eine Reihe kunstvoll ineinandergeschlungener Glieder mit einem goldenen Medaillon dran. Harmony klappte es auf und zeigte mir die Gesichter von Clarisse und Henry auf der einen Seite und das ihrer Schwester auf der anderen.
Als ich die Handwerkskunst der Kette bewunderte, sagte Harmony: »Man nennt das eine Singapurkette. Henry hatte eine Tante in Shanghai, die hat ihm oft was für uns geschickt, Schmuck oder feine Seide. Einmal hat er Clarisse und mir und Reno zu Weihnachten seidene Bademäntel geschenkt. Wir saßen oft darin auf der hinteren Veranda und spielten, dass wir Königinnen sind und in unseren Seidengewändern frühstücken.«
Ich sah mir alle Fenster an, überzeugte mich, dass die Verriegelung funktionierte, überprüfte die Hintertür, die nicht nach draußen führte, sondern zu einer Wartungstreppe und einem Lastenfahrstuhl.
»Schließ alle Türen ab, wenn du hier bist«, sagte ich.
»Ich bin in Oakland aufgewachsen«, sagte Harmony verächtlich. »Ich hab keine Angst vor dieser Gegend.«
»Deiner Schwester ist irgendwas zugestoßen«, sagte ich. »Sie geht nicht ans Telefon, sie hat ihre Schlüssel hiergelassen. Wenn jemand einmal hier reingekommen ist, kann es wieder passieren. Falls du mit zu mir kommen willst, nehme ich dich gern auf, aber wenn du hierbleibst, stell dich klug an, okay?«
»Yeah, okay. Genau das würde Clarisse auch sagen: Stell dich klug an. Glaubst du, du findest Reno?« Beim letzten Satz brach ihr die Stimme.
»Das weiß ich nicht, Schatz. Ich werd’s versuchen, aber es ist ein weites Feld. Ich gehe morgen mal zu ›Rundum sorglos‹ und berichte dir dann, was sie gesagt haben. Hat sie je Kollegen erwähnt oder Vorgesetzte, mit denen sie gut klarkam?«
»Ihre neue Chefin, nach ihrer Beförderung, Reno schien sie zu mögen. Ihr Name klang ungefähr wie ›Lukas‹. Oder so ähnlich.«
»Okay. Ich suche diese Ms. Lukas. Du hast meine Nummer, du hast die von Mr. Contreras, ruf an, wenn du uns brauchst.«
5 Teamgeist
Mitch und ich fuhren mit dem Lastenfahrstuhl bis ins Untergeschoss. Ich folgte dem Klang von Waschmaschinen zum Wäschekeller. Eine Frau mittleren Alters war beim Wäschefalten und stieß einen leisen Schrei aus, als sie den Hund sah.
Ich hielt Mitchs Leine in die Höhe, um zu zeigen, dass er unter Kontrolle war. »Ich suche den Raum des Hausmeisters.«
»Vern wohnt nicht hier – er ist nur tagsüber da.«
»Kein Problem. Ich suche trotzdem seinen Raum. Jemand hat ihm etwas gegeben, was mir gehört, er sollte es für mich vor der Tür lassen.«
Sie musterte mich und den Hund einen Moment, dann zuckte sie die Achseln – möglich, dass wir Einbrecher waren, aber sie würde sich da raushalten. »Den Gang runter, gegenüber vom Heizungskeller.«
Ich knipste die Lichter im Flur an, tief hängende nackte Glühbirnen baumelten an ihren Kabeln. Die Hausmeistertür war abgeschlossen, aber das Schloss war nichts Dolles. Ich spähte den Gang entlang; die Frau mit der Wäsche interessierte sich nicht für uns. Ich nahm meine Privatermittlerinnenlizenz, starkes Laminat, schob sie zwischen Schlossfalle und Türzarge, drehte am Knauf, und wir waren drin.
Vern hatte einen gepolsterten Lehnsessel, wo er sich ausruhte, wenn seine Arbeitspflichten zu beschwerlich wurden. Das Kissen hatte einen tiefen Abdruck – die Pflichten mussten oft überwältigend sein.
Ein 24-Zoll-Flachbildschirmfernseher stand dem Sessel gegenüber. Auf dem Boden neben dem Sessel ein Stapel Zeitschriften, teils zum Thema Wassersport und Angeln, teils handelsübliche Pornosammlung. Ein kleiner Kühlschrank mit einer Salami und sieben Flaschen Pabst. Eine Spüle mit einem senfverkrusteten Teller. Er könnte mal bei Reno einen Putzkurs machen.
Weiter hinten stand seine Werkbank. Sein Werkzeug immerhin behandelte er pfleglich. Feilen, Schraubendreher, Elektroutensilien, alles in Schubladen, beschriftet in der runden unbeholfenen Schrift eines Menschen, der nicht oft schreibt. Klempnerwerkzeug für Notfälle in Regalen an der gegenüberliegenden Wand. Sägen.
Ich fasste nichts an, hielt aber scharf Ausschau nach möglichen Spuren von Blut oder Haaren. Ich spähte hinter alle Kisten und Regale. Ich nahm Mitch mit in den Heizungsraum gegenüber. Wir sahen keine Anzeichen dafür, dass eine Frau hier runtergebracht und angegriffen worden wäre. Immerhin etwas.
Jenseits des Heizungskellers gab es noch ein Labyrinth kleiner Räume und merkwürdiger Behälter, aber sie alle zu durchsuchen würde die ganze Nacht dauern. Es war bereits nach Mitternacht, und ich war schon gestern erst um fünf ins Bett gekommen.
Mr. Contreras war extra noch aufgeblieben und wartete auf mich, was rührend war, aber auch anstrengend, denn wir mussten Harmonys Geschichte nochmals durchkauen. Ich versicherte ihm, dass ich ihr helfen würde, auch wenn ich mir allmählich vorkam, als hätte ich eine Leuchtreklame auf der Stirn: Schickt mir Verwandte in Not, mühselige Beinarbeit. Honorarfrei.
Als ich es endlich hoch in meine eigene Wohnung geschafft hatte, checkte ich die Nachrichten, um zu sehen, ob es Neuigkeiten zu Felix’ Leiche gab. Der Gerichtsmedizin war es wohl noch nicht gelungen, das Gesicht medientauglich aufzuhübschen. Bevor ich ins Bett ging, versuchte ich es bei Felix, hatte aber auch nicht mehr Glück als Lotty.
Ich hinterließ eine Textnachricht, er solle sich bei seiner Tante melden, damit sie sich nicht sorgte, schaltete mein Telefon aus und wurde ausnahmsweise mit dem Schlaf der Gerechten beschenkt. Am Morgen hatte ich Zeit für mein Training, eine Gelegenheit, mit den Hunden zu laufen, und ein richtiges Frühstück an meinem eigenen Tisch. Dann fuhr ich nach Downtown und kam pünktlich zu meinem ersten Termin.