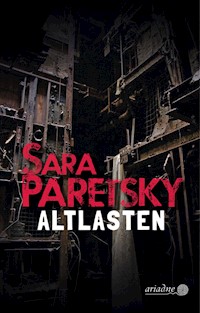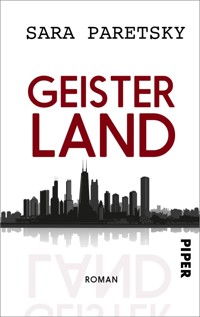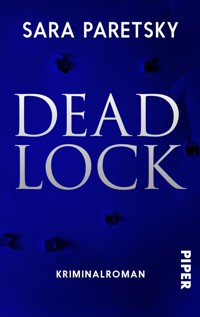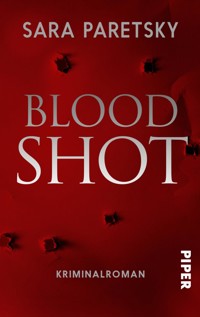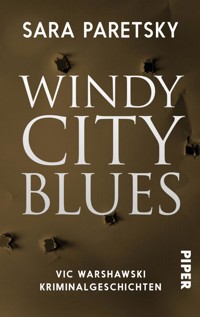6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Der sechste Fall für Vic Warshawski - allein gegen die Immobilien-Mafia. Frauenpower im Dschungel von Chicago! Chicago im Bauboom: V.I. Warshawski, die Privatdetektivin mit den harten Sprüchen und dem starken Gerechtigkeitssinn, muss sich notgedrungen mit der Baumafia der Stadt anlegen. Seit Tantchen Elenas Altenheim abgebrannt ist, campiert die Schnapsdrossel bei ihrer Nichte. Genervt macht sich Vic an die Arbeit ... »Gnadenlos zerrt Ms Warshawski den Leser durch das Schattenland der Abbruchhäuser der Stadt: kein weiblicher Robin Hood, sondern eine gewiefte Detektivin mit einem ätzend großen Mundwerk« manager magazin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Dietlind Kaiser
ISBN: 978-3-492-98376-1
© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2018
© 1990 Sara Paretsky
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Burn Marks«
© Delacorte Press, New York 1990
© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1992, 1995
Covergestaltung: Favoritbüro München
Covermotiv: Freedom Master/shutterstock
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Weckruf
Nachtasyl
Kein heiliger Petrus
Tantchen reißt aus
Prachtzimmer
Picknick auf dem Land
In Zungen reden
Eine fürsorgliche Mutter
Die Dame ist indisponiert
A Little Help from My Friends
Oma mit Rauchvergiftung
Feuer im Dezernat für Brandstiftung
Waschtag
In flagranti ertappt
In der Rue Morgue
Schwachstelle
Ein Rauswurf von Tantchen
Kein Donald Trump
Herrenbesuch
Ernste Warnung
Wieder Ärger mit Tantchen
Aufgemischter Bautrupp
Eingemauert
Schlafplatz im Keller
Die Dame ist nicht fürs Feuer
Ärztliche Anordnung
Wir dienen und schützen
Ein paar nette Worte von einer Freundin
Schwere Blumen
Anlauf zum Hochsprung
Hausbesuch
Ein Sprung im Dunkeln
Arbeitskleidung
Dampf von oben
Töchter in Trauer
Schatzsuche
Kaninchenjagd
Wahlkampfvorbereitungen
Todesröcheln
Von Haus und Hof vertrieben
Feuerwerkskörper
Trauer muß Elektra tragen
Das Auge des Hurrikans
Ein alter Freund meldet sich
Spaziergang am Abgrund
Auf Justitias Waage
In Lottys Nest
Die Geburtstagsparty
Dank
Widmung
Für Patti Shepherd, Jayanne Angellund Bill Mullins, die vor mir an meinSchreiben glaubten.
Weckruf
Wir saßen in der Falle, meine Mutter und ich, in ihrem Schlafzimmer, dem winzigen Raum im oberen Stock unseres alten Hauses an der Houston Avenue. Unten bellten und kläfften die Hunde, die uns nachstellten. Gabriella war vor den Faschisten aus ihrer italienischen Heimat geflohen, aber sie verfolgten sie bis nach Südchicago. Das Hundegebell steigerte sich zu ohrenzerfetzendem Geheul, das die Schreie meiner Mutter noch übertönte.
Ich setzte mich auf. Es war drei Uhr morgens, und jemand lehnte sich gegen die Klingel. Vom aufdringlichen Realismus des Traums war ich naßgeschwitzt, und ich zitterte.
Das hartnäckige Klingeln rief die Zeit meiner Kindheit wieder herauf: wie oft hatten Telefon oder Türglocke meinen Vater geweckt und zu einem dringenden Polizeieinsatz gerufen. Meine Mutter und ich sind immer aufgeblieben und warteten auf seine Rückkehr. Obwohl mich die Furcht aus ihren glühenden dunklen Augen anstarrte, wollte sie sich ihre Angst nicht anmerken lassen; jedesmal machte sie mir in der Küche süßen Kinderkaffee – einen Eßlöffel Kaffee mit Milch und Kakao – und erzählte mir abenteuerliche italienische Volksmärchen, von denen ich Herzrasen bekam.
Ich zog Sweatshirt und Shorts über und fummelte an meinen Türschlössern herum. Das Klingeln hallte hinter mir her, als ich die drei Treppen zum Hauseingang hinunterstolperte.
Meine Tante Elena stand auf der anderen Seite der Glastür und drückte den Finger entschlossen auf den Klingelknopf. Um die Schultern trug sie als wenig kleidsames Cape eine verblichene Steppdecke. An der Mauer lehnte ein Matchsack aus Vinyl; ein violettes Nachthemd quoll oben heraus. Ich glaube nicht an Vorahnungen oder Psi, aber ich wurde das Gefühl nicht los, der Traum – ein vertrauter Alptraum aus meiner Kindheit – sei von düsteren Vibrationen ausgelöst worden, die Elena in mein Schlafzimmer schickte.
Elena, die kleine Schwester meines Vaters, war von jeher der Problemfall der Familie gewesen. »Sie trinkt ein bißchen, wißt ihr«, hatte meine Großmutter in besorgtem Flüsterton mitgeteilt, als Elena bei einem Thanksgiving-Essen weggesackt war. Mehr als einmal weckte ein verlegener Streifenpolizist meinen Vater um zwei Uhr morgens, um ihm mitzuteilen, Elena sei eingebuchtet worden, weil sie auf der Clark Street auf Freierfang gegangen war. In solchen Nächten gab es keine Märchen in der Küche. Meine Mutter schickte mich mit einem leisen Kopfschütteln wieder ins Bett, während sie sagte: »Das liegt in ihrem Wesen, cara, wir dürfen sie nicht verurteilen.«
Als meine Großmutter vor sieben Jahren gestorben war, hatte Peter, der überlebende Bruder meines Vaters, Elena seinen Anteil am Bungalow in Norwood Park geschenkt, unter der Bedingung, daß sie ihn nie wieder um etwas bitten sollte. Wohlgemut unterschrieb sie die Papiere, aber vier Jahre später war sie den Bungalow wieder los: Ohne mit mir oder Peter zu sprechen, hatte sie ihn als Sicherheit in ein abenteuerliches Bauprojekt eingebracht. Als sich die windige Firma verflüchtigt hatte, war Elena der einzige Geschäftspartner, den das Gericht auftreiben konnte – also wurde ihr Haus konfisziert und verkauft, um die Schulden zu bezahlen.
Meiner Tante blieben dreitausend. Davon und von ihrer Rente hatte sie in einer Pension an der Kreuzung zwischen Cermak Road und Indiana Avenue gelebt, hin und wieder ein bißchen Siebzehn und Vier gespielt und es, wenn die Rentenschecks kamen, immer mal wieder mit der alten Masche probiert. Die jahrelange Trinkerei hatte ihr schmale Furchen in Kinn und Stirn gegraben, aber ihre Beine waren bemerkenswert schön geblieben.
Sie sah mich durch die Glastür und nahm den Finger vom Klingelknopf. Als ich die Tür öffnete, legte sie die Arme um mich und küßte mich begeistert.
»Victoria, Herzchen, du siehst großartig aus!«
Der bittere, hefige Gestank von abgestandenem Bier umhüllte mich. »Elena – was zum Teufel machst du hier?«
Der üppige Mund schmollte. »Baby, ich brauche einen Schlafplatz. Ich bin verzweifelt. Die Bullen wollten mich in ein Asyl bringen, aber natürlich habe ich an dich gedacht, und also haben sie mich hierhergefahren. Ein wirklich netter junger Mann mit einem absolut hinreißenden Lächeln. Ich habe ihm alles über deinen Paps erzählt, aber damals war er noch ein kleiner Junge, natürlich hat er ihn nie kennengelernt.«
Ich knirschte mit den Zähnen. »Was ist mit deiner Pension passiert? Haben sie dich rausgeschmissen, weil du die alten Rentner gevögelt hast?«
»Vicki, Baby – Victoria«, verbesserte sie sich hastig. »Red nicht so vulgär – das paßt nicht zu einem Mädchen wie dir.«
»Elena, laß den Scheiß.« Als sie zum zweiten Tadel ansetzte, rief ich mich schnell zur Ordnung. »Ich meine, hör auf, solchen Unsinn zu reden, und sag mir, warum du um drei Uhr morgens auf der Straße stehst.«
Sie schmollte noch mehr. »Ich versuch ja, dir das zu erzählen, Baby, aber du unterbrichst mich dauernd. Es hat einen Brand gegeben. Unser reizendes kleines Heim ist abgebrannt. Runtergebrannt zu Schutt und Asche.«
In den trüb gewordenen blauen Augen stiegen Tränen auf und liefen durch tiefe Furchen zum Kinn. »Ich hatte noch nicht geschlafen und gerade noch Zeit, meine Sachen in die Tasche zu stopfen und die Feuertreppe hinunterzusteigen. Manche haben nicht einmal das geschafft. Der arme Marty Holman mußte sein künstliches Gebiß zurücklassen.« Die Tränen versiegten so plötzlich, wie sie gekommen waren, und sie verfiel statt dessen in schrilles Gekicher. »Du hättest ihn sehen sollen, Vicki, lieber Himmel, du hättest sehen sollen, wie der alte Knacker ausgesehen hat, mit den eingefallenen Wangen und den Glubschaugen, wie er mümmelnd herumgejammert hat: Meine Zähne, ich hab meine Zähne verloren.«
»Muß urkomisch gewesen sein«, sagte ich trocken. »Du kannst nicht bei mir wohnen, Elena. Das würde mich in achtundvierzig Stunden zum Selbstmord treiben. Vielleicht noch früher.«
Ihre Unterlippe zitterte wieder, und sie sagte in einer schrecklichen Imitation von Kindergebrabbel: »Sei nicht gemein zu mir, Vicki, sei nicht gemein zur armen alten Elena, die mitten in der Nacht abgebrannt ist. Gottverflucht noch mal, du bist mein Fleisch und Blut, die Kleine meines Lieblingsbruders. Du kannst die arme alte Elena doch nicht auf die Straße hinauswerfen wie eine durchgelegene Matratze.«
Hinter uns flog krachend eine Tür zu. Der Bankangestellte, der vor kurzem in die nach Norden gelegene Erdgeschoß Wohnung gezogen war, trat ins Treppenhaus, die Hände in den Hüften, das Kinn herausfordernd vorgereckt. Er trug einen Baumwollschlafanzug mit marineblauen Streifen; so verschlafen er aussah, sein Haar war tadellos gekämmt.
»Was zum Teufel ist denn hier los? Vielleicht müssen Sie Ihr Brot nicht mit Arbeit verdienen, Gott allein weiß, was Sie da oben den ganzen Tag lang treiben, aber ich muß arbeiten. Wenn Sie Ihrem Geschäft schon mitten in der Nacht nachgehen müssen, dann nehmen Sie wenigstens etwas Rücksicht auf Ihre Nachbarn und tun es nicht im Hausflur. Wenn Sie nicht sofort Ruhe geben und wie der Blitz von hier verschwinden, ruf ich die Bullen.«
Ich schaute ihn kalt an. »Ich fabriziere da oben Crack. Das ist meine Lieferantin. Sie können als Komplize festgenommen werden, wenn die Polizei Sie mit uns erwischt.«
Elena kicherte, sagte aber: »Sei doch nicht so unhöflich zu ihm, Victoria – man weiß nie, wann man mal einen Jungen mit so wunderschönen Augen braucht.« Dem Bankmenschen zugewandt, setzte sie hinzu: »Keine Bange, Herzchen, ich komme jetzt rein. Wir gönnen Ihnen den Schönheitsschlaf.«
Hinter der geschlossenen Tür der südlichen Erdgeschoßwohnung begann ein Hund zu bellen. Ich knirschte noch etwas heftiger mit den Zähnen und zog Elena ins Haus, nahm ihr den Matchsack ab, als sie unter seinem Gewicht wankte.
Der Bankangestellte beobachtete uns mit zusammengekniffenen Augen. Als Elena auf ihn zutorkelte, verzog er das Gesicht in blankem Entsetzen, retirierte hastig zu seiner Wohnungstür und fummelte am Schloß herum. Ich versuchte, Elena nach oben zu zerren, aber sie wollte stehenbleiben und über den Bankmenschen reden, von mir hören, warum ich ihn nicht gebeten hatte, ihre Tasche zu tragen.
»Das wäre der ideale Weg gewesen, daß ihr euch kennenlernt und die Wogen ein bißchen glättet.«
Ich war nahe daran, vor Verzweiflung zu schreien, als die Tür zur südlichen Erdgeschoßwohnung aufging. Mr. Contreras kam heraus, ein umwerfender Anblick in einem purpurroten Morgenmantel. Die Golden-Retriever-Hündin, die ich mir mit ihm teilte, zerrte am Halsband, aber als das Tier mich sah, ging das kehlige Knurren in aufgeregtes Jaulen über.
»Ach, Sie sind’s, Engelchen«, sagte der alte Mann erleichtert. »Die Prinzessin hat mich geweckt, und dann hab ich den ganzen Lärm gehört und mir gedacht: Ach du lieber Gott, das Schlimmste ist passiert, mitten in der Nacht bricht einer hier ein. Sie sollten ein bißchen rücksichtsvoller sein, Engelchen – für Leute, die zur Arbeit müssen, ist es gar nicht schön, wenn die mitten in der Nacht aus dem Bett geholt werden.«
»Stimmt.« Ich strahlte ihn an. »Und ganz gleich, was hier öffentliche Meinung ist, ich gehöre auch zur arbeitenden Bevölkerung. Und glauben Sie mir, ich hab nicht mehr Lust, um drei Uhr morgens aus dem Bett zu steigen als Sie.«
Elena legte ihr herzlichstes Lächeln auf und hielt Mr. Contreras die Hand hin wie Prinzessin Diana, die einen Soldaten begrüßt. »Elena Warshawski«, sagte sie. »Hocherfreut, Sie kennenzulernen. Die Kleine ist meine Nichte, und sie ist die hübscheste und liebste Nichte, die eine Frau sich wünschen kann.«
Mr. Contreras schüttelte ihr die Hand und blinzelte sie an wie eine Eule, der man mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchtet. »Nett, Sie kennenzulernen«, sagte er mechanisch, wenn auch nicht sonderlich begeistert. »Hören Sie, Engelchen, Sie sollten die Dame – Ihre Tante, sagen Sie? –, Sie sollten sie zu Bett bringen. Sie ist nicht ganz in Hochform.«
Der bittere Hefegestank war auch ihm in die Nase gestiegen. »Ja, genau das mach ich jetzt. Komm schon, Elena. Gehen wir nach oben. Der Bettzipfel ruft.«
Mr. Contreras wandte sich seiner Wohnung zu. Der Hund war verärgert – wenn wir alle hier schon ein Fest feierten, wollte er auch dabeisein.
»Das war gar nicht höflich von ihm«, schnaubte Elena, als Mr. Contreras’ Tür hinter uns zuging. »Er hat mir nicht mal seinen Namen gesagt, wo ich mich dazu überwunden und mich vorgestellt habe.«
Sie maulte auf dem ganzen Weg die Treppe hinauf. Ich sagte gar nichts, legte ihr nur die Hand auf den Rücken, um sie in die richtige Richtung zu steuern, und schob sie weiter, als sie auf dem Treppenabsatz im ersten Stock eine Atempause einlegte.
In meiner Wohnung hatte sie nichts Besseres zu tun, als all mein Zeug mit Ohs und Ahs zu bestaunen. Ich kümmerte mich nicht darum, stellte den kleinen Tisch beiseite, damit ich die Couch ausziehen konnte. Ich machte das Bett und zeigte ihr das Bad.
»Jetzt hör mir zu, Elena. Du bleibst nicht länger hier als eine Nacht. Bilde dir ja nicht ein, daß ich es mir anders überlege.«
»Aber ja doch, Baby, ja. Was ist denn aus dem Flügel deiner Ma geworden? Hast du ihn etwa verkauft, damit du dir dieses reizende kleine Klavier leisten konntest?«
»Nein«, sagte ich kurz angebunden. Der Flügel war dem Brand zum Opfer gefallen, der in meiner Wohnung vor drei Jahren gewütet hatte. »Und glaub ja nicht, daß ich wegen deiner Schwärmerei über das Klavier vergesse, was ich gesagt habe. Ich gehe wieder zu Bett. Ob du schläfst oder nicht, ist deine Sache, aber morgen früh gehst du woandershin.«
»Ach, mach doch kein so häßliches Gesicht, Vicki, Victoria, meine ich. Wenn du so die Stirn runzelst, ruinierst du deinen Teint. Und an wen soll ich mich denn wenden mitten in der Nacht, wenn nicht ans eigene Fleisch und Blut?«
»Laß den Quatsch«, sagte ich schläfrig. »Dazu bin ich zu müde.«
Ich schloß die Tür zum Flur, ohne gute Nacht zu sagen. Ich verkniff es mir, sie davor zu warnen, daß sie nach meinem Schnaps herumstöberte – falls sie ihn wirklich nötig hatte, fand sie ihn bestimmt und würde sich am nächsten Tag hundertmal bei mir dafür entschuldigen, daß sie ihr Versprechen gebrochen hatte, nicht zu trinken.
Ich lag im Bett und konnte nicht schlafen, weil ich Elenas Anwesenheit im Nebenzimmer körperlich spürte. Ich hörte sie eine Weile herumgeistern, dann wurde der dröhnende Fernseher rücksichtsvoll heruntergedreht. Ich verfluchte meinen Onkel Peter dafür, daß er nach Kansas City gezogen war, und wünschte mir, ich wäre so schlau gewesen, nach Quebec oder Seattle oder an einen ähnlich weit entfernten Ort abzuhauen. Gegen fünf, als die Vögel mit ihrem Gezwitscher die Dämmerung ankündigten, fiel ich schließlich in unruhigen Schlaf.
Nachtasyl
Um acht riß mich die Klingel abermals aus dem Schlaf. Ich zog Sweatshirt und Shorts über und wankte zur Tür. Niemand antwortete, als ich mich über die Sprechanlage meldete. Als ich aus dem Wohnzimmerfenster auf die Straße hinunterschaute, sah ich den Bankmenschen, der zur Diversey Avenue hinüberging, mit eitel federnden Schultern. Ich schnippte mit dem Daumen hinter ihm her.
Elena hatte den Zwischenfall verschlafen, auch meine lauten Rufe in die Sprechanlage. Einen Augenblick packte auch mich der wütende Impuls des Bankmenschen – fast hätte ich sie geweckt, sie sollte sich genauso miserabel fühlen wie ich.
Ich schaute angewidert auf sie hinunter. Sie lag auf dem Rücken, mit offenem Mund, und ließ beim Ausatmen abgehackte Schnarchlaute hören, beim Einatmen verschliffene Seufzer. Ihr Gesicht war rot angelaufen. Deutlich traten die geplatzten Äderchen auf ihrer Nase hervor. Im Morgenlicht konnte ich sehen, daß das violette Nachthemd eine Wäsche dringend nötig hatte. Der Anblick war abstoßend. Aber auch unerträglich jämmerlich. Niemand sollte im Schlaf den Blicken eines Außenstehenden ausgesetzt sein, schon gar niemand, der so wehrlos ist wie meine Tante.
Mit einem Schaudern zog ich mich hastig in den hinteren Teil der Wohnung zurück. Leider vertrieb ihr Jammerbild meine Wut darüber nicht, daß sie bei mir war. Ihr hatte ich es zu verdanken, daß sich mein Kopf anfühlte, als ob jemand eine Ladung Kies daraufgekippt hätte. Noch schlimmer war, daß ich mich morgen einem potentiellen Auftraggeber vorstellen sollte. Ich wollte meine Schaubilder vervollständigen und Dias davon anfertigen lassen. Statt dessen sah es so aus, als müßte ich den Tag mit der Suche nach einer Unterkunft verbringen. Wenn das nur lang genug dauerte, mußte ich am Schluß vierfachen Überstundenzuschlag für die Dias bezahlen.
Ich setzte mich auf den Eßzimmerboden und machte Atemübungen, ich wollte den verkrampften Magen lockern. Es gelang mir schließlich, mich soweit zu entspannen, daß ich mit den Dehnübungen für das Laufen beginnen konnte.
Weil ich Elenas gerötetes Gesicht nicht noch einmal sehen wollte, stieg ich die Hintertreppe hinunter und holte Peppy vor Mr. Contreras’ Küchentür ab. Der alte Mann steckte den Kopf heraus und rief mir etwas zu, als ich das Tor schloß; ich tat, als hätte ich ihn nicht gehört. Es gelang mir nicht, mich ebenso taub zu stellen, als ich zurückkam – er wartete auf mich, saß mit der Sun-Times auf der Hintertreppe und suchte sich seine Favoriten für das heutige Pferderennen in Hawthorne aus. Ich versuchte, den Hund einfach stehenzulassen und die Treppe hinauf zu entkommen, aber er packte mich an der Hand.
»Moment mal, Engelchen. Wer war die Dame, die Sie gestern nacht reingelassen haben?« Mr. Contreras ist Maschinenschlosser, pensioniert, ein Witwer mit einer verheirateten Tochter, die er nicht besonders gut leiden kann. In den drei Jahren, in denen wir im selben Haus wohnen, hat er sich an mein Leben gehängt wie ein Adoptivonkel – oder eher wie eine Klette.
Ich riß mich los. »Meine Tante. Die jüngere Schwester meines Vaters. Sie hat ein Faible für alte Männer mit guter Rente, also passen Sie auf, daß Sie vollständig angezogen sind, falls sie heute nachmittag auf einen Plausch vorbeikommt.«
Solche Bemerkungen nimmt er immer krumm. Ich bin mir sicher, er hat in seiner Zeit als Maschinenschlosser in der Fabrik viel Schlimmeres gehört – und gesagt, aber von mir verträgt er nicht einmal versteckte Anspielungen auf Sex. Er läuft rot an und wird so wütend, wie das jemandem mit seinem erbarmungslosen Hang zur guten Laune nur möglich ist.
»Kein Grund, schmutzige Reden zu führen«, fuhr er mich an. »Ich mache mir bloß Sorgen. Und eins muß ich Ihnen sagen, Süße, Sie sollten nicht rund um die Uhr Besuche empfangen. Und wenn schon, dann sollten Sie im Hausflur nicht so laut reden, daß das ganze Haus aufwacht.«
Am liebsten hätte ich eine lose Sprosse aus dem Treppengeländer gerissen und ihn damit geschlagen. »Ich hab sie nicht eingeladen«, kreischte ich. »Ich hab nicht gewußt, daß sie kommt. Ich will sie nicht hier haben. Ich wollte nicht um drei Uhr morgens aufwachen.«
»Kein Grund zu brüllen«, sagte er streng. »Und selbst wenn Sie Ihre Tante nicht erwartet haben, Sie hätten oben in Ihrer Wohnung mit ihr reden können.«
Ich klappte den Mund mehrmals auf und zu, kam aber auf keine sinnvolle Antwort. Das war richtig, ich hatte Elena im Flur festgehalten, weil ich hoffte, das werde sie so verletzen, daß sie ihren Matchsack schnappen und verschwinden würde. Aber schon gestern nacht war mir im Innersten klar gewesen, daß ich sie um diese Tageszeit nicht wegschicken konnte. Der alte Mann hatte also recht. Es stimmte mich kein bißchen fröhlicher, daß ich seiner Meinung war.
»Okay, okay«, gab ich zurück. »Soll nicht wieder vorkommen. Jetzt lassen Sie mich in Frieden – ich habe heute viel zu tun.« Ich stapfte die Treppe zu meiner Küche hinauf.
Durch die geschlossene Tür zum Wohnzimmer drangen immer noch gedämpfte Schnarchlaute. Ich kochte eine Kanne Kaffee und nahm eine Tasse mit ins Bad. Weil ich entschlossen war, die Wohnung so schnell wie möglich zu verlassen, zog ich Jeans und eine weiße Bluse an und ging in die Küche, um etwas zum Frühstück zu finden.
Elena saß bereits am Tisch. Sie hatte einen gesteppten, schmuddeligen Morgenmantel über das violette Nachthemd gezogen. Ihre Hände zitterten leicht; sie nahm beide, um die Kaffeetasse zum Mund zu führen.
Sie ließ ein beflissenes Lächeln sehen. »Du kochst wunderbaren Kaffee, Baby. Genauso gut wie deine Mutter.«
»Danke, Elena.« Ich öffnete die Kühlschranktür und bilanzierte den mageren Inhalt. »Tut mir leid, daß ich nicht auf einen Schwatz bleiben kann, aber ich will versuchen, was aufzutreiben, wo du heute nacht schlafen kannst.«
»Ach, Vicki – Victoria, meine ich. Renn doch nicht so herum. Das ist gar nicht gut fürs Herz. Laß mich hierbleiben, wenigstens ein paar Tage lang. Damit ich über den Schock wegkomme. Daß ich dieses Inferno von gestern nacht erleben mußte. Ich versprech dir, ich falle dir nicht zur Last. Ich könnte in der Wohnung ein bißchen saubermachen, während du bei der Arbeit bist.«
Ich schüttelte unnachgiebig den Kopf. »Ausgeschlossen, Elena. Ich will nicht, daß du hier wohnst. Nicht eine Nacht mehr.«
Ihr Gesicht zuckte. »Warum haßt du mich, Baby? Ich bin die Schwester deines Vaters. Die Familie muß zusammenhalten.«
»Ich hasse dich nicht. Ich will mit keinem Menschen zusammenleben, und dein Leben und meines passen besonders schlecht zueinander. Du weißt so gut wie ich, Tony hätte dasselbe gesagt, wenn er noch da wäre.«
Es war zu einem schmerzlichen Zwischenfall gekommen, als Elena ihre Unabhängigkeit von meiner Großmutter erklärt hatte und in eine eigene Wohnung gezogen war. Als sie nämlich feststellte, daß die Einsamkeit nicht nach ihrem Geschmack war, kam sie an einem Wochenende in unser Haus nach Südchicago. Drei Tage blieb sie. Es war nicht meine temperamentvolle Mutter, die sie hinauswarf – Gabriella gelang es, in ihre Liebe zu armen Teufeln auch Elena einzubeziehen. Aber als mein immer gelassener Vater nach der Nachtschicht zum Montag nach Hause gekommen war und Elena sinnlos betrunken am Küchentisch gefunden hatte, ließ er sie in die Ausnüchterungszelle im Countygefängnis stecken und weigerte sich ein halbes Jahr lang, mit ihr zu reden, nachdem sie wieder draußen war.
Auch Elena erinnerte sich offenbar an diesen Vorfall. Das zuckende Schmollen wich aus ihrem Gesicht. Sie sah tieftraurig aus und irgendwie klarer.
Ich drückte ihr sanft die Schulter und bot ihr an, Eier zu braten. Sie schüttelte wortlos den Kopf und beobachtete mich schweigend, während ich Sardellenpaste auf eine Toastscheibe strich. Ich aß schnell und ging, bevor das Mitleid mein Urteilsvermögen lahmlegen konnte.
Jetzt war es schon weit nach neun. Der Morgenstau löste sich auf, und ich kam rasch über die Belmont Avenue auf die Schnellstraße. Als ich mich dem Loop näherte, drängte sich der Verkehr jedoch durch ein Labyrinth von Baustellen. Die sechseinhalb Kilometer auf dem Ryan Expressway zwischen Eisenhower Expressway und Thirty-first Street, vermutlich die verkehrsreichsten acht Spuren im bekannten Universum, waren schließlich doch unter der Last der Sattelschlepper zusammengebrochen. Die Fahrspuren Richtung Süden waren gesperrt, solange die Bundesbehörden die Brücke wiederaufbauen ließen.
Mein kleiner Chevy, eingeklemmt zwischen einigen Fünf- undfünfzigtonnern, schlängelte sich mit dem langsamen Verkehrsstrom um die Absperrungen herum. Rechts von mir sah man durch die abgetragene Fahrbahn hindurch das Netzwerk der Stützpfeiler, wie zugeknäulte Vipernnester wirkten sie, hier und da hob sich ein rostiger Kopf, zum Zubeißen bereit.
Die Ausfahrt zum Lake Shore Drive war so geschickt getarnt, daß ich sie erst sah, als ich schon neben der Tonne war, die die gesuchte Abbiegespur versperrte. Mit meinem Weggefährten, dem Fünfundfünfzigtonner, an der Stoßstange, konnte ich schlecht die Bremse durchtreten und um das Blechding herumfahren. Ich biß die Zähne zusammen und fuhr bis zur Thirty-fifth Street, dann über Nebenstraßen zurück zur Cermak Road.
Elenas Pension hatte sich immer ein paar Häuser nördlich von der Kreuzung mit der Indiana Avenue befunden. Als ich gegenüber anhielt, verschwand spurlos der Zweifel, den ich nicht loswerden konnte, seit ich ihre Geschichte gehört hatte. Das Indiana Arms Hotel – Durchreisende willkommen, Zahlungen täglich oder monatlich – hatte es den anderen Prachtschuppen dieser Straße gleichgetan und den Betrieb eingestellt, endgültig. Ich ließ den Wagen stehen und überquerte die Straße, um das Gerippe näher zu betrachten.
Als ich um das Gebäude herum auf die Nordseite ging, entdeckte ich einen Mann mit Sportjackett und Helm, der im Schutt herumstocherte. Hin und wieder holte er mit einer Zange etwas zwischen den Trümmern hervor und verwahrte es in einem Plastikbeutel. Ehe er seine Untersuchung fortsetzte, markierte er den Beutel und brummte etwas in ein Taschendiktafon. Er sah mich, als er sich nach Osten wandte, um in einem vielversprechenden Haufen herumzustochern. Er hob noch etwas auf und beschriftete den Beutel, bevor er zu mir herüberkam.
»Sie haben hier etwas verloren?« Der Ton war freundlich, aber die braunen Augen blickten mißtrauisch.
»Nur Schlaf. Eine Bekannte hat bis gestern nacht hier gewohnt – sie ist am frühen Morgen in meine Wohnung gekommen.«
Er schürzte die Lippen und dachte über meine Geschichte nach. »Und dann, was wollen Sie jetzt hier?«
Ich hob die Schulter. »Ich nehme an, ich wollte es mit eigenen Augen sehen. Ob die Pension wirklich abgebrannt ist. Bevor ich mich abrackere und ihr eine neue Unterkunft suche.
Und wenn wir schon dabei sind: Was tun Sie hier? Ein argwöhnischer Mensch könnte glauben, Sie reißen sich Wertsachen unter den Nagel.«
Er lachte, und ein Teil des Mißtrauens wich aus seinem Gesicht. »So jemand hätte recht – in gewisser Hinsicht tue ich genau das.«
»Sind Sie von der Feuerwehr?«
Er schüttelte den Kopf. »Versicherungsgesellschaft.«
»War es Brandstiftung?« Ich hatte mich in den Familienbanden so verfangen, daß ich mich nicht einmal gefragt hatte, wie der Brand entstanden war.
Er war wieder auf der Hut. »Ich sammle nur ein paar Sachen ein. Die Diagnose bekomme ich vom Labor.«
Ich lächelte. »Es ist richtig, daß Sie vorsichtig sind – man weiß nie, wer sich nach so einem Brand hier herumtreiben könnte. Ich heiße V. I. Warshawski. Wenn ich nicht nach einer Notunterkunft suche, bin ich Privatermittlerin. Und ich arbeite von Zeit zu Zeit für die Ajax-Versicherung.« Ich zog eine Karte aus der Handtasche und gab sie ihm.
Er wischte sich die rußige Hand an einem Kleenex ab und schüttelte die meine. »Robin Bessinger. Ich gehöre zur Abteilung für Brandstiftung und Versicherungsbetrug bei der Ajax. Es überrascht mich, daß ich Ihren Namen noch nie gehört habe.«
Mich überraschte das nicht. Ajax beschäftigte rund um den Erdball sechzigtausend Menschen – niemand konnte den Überblick über sie alle behalten. Ich erklärte, ich hätte für Ajax Fälle von Schadenersatz und Weiterversicherung bearbeitet, und nannte ein paar Namen, die er eigentlich kennen mußte. Er taute noch mehr auf und ließ mich wissen, daß alles auf Brandstiftung hindeute.
»Ich könnte Ihnen die Stellen zeigen, an denen Brandbeschleuniger verschüttet worden sind, aber ich möchte nicht, daß Sie ohne Helm hineingehen. Dauernd fallen Putzbrocken herunter.«
Ich zeigte angemessenes Bedauern darüber, daß mir dieses Vergnügen versagt wurde. »Der Besitzer hat in letzter Zeit wohl hohe Zusatzversicherungen abgeschlossen?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich weiß es nicht – ich habe die Policen nicht gesehen. Ich habe bloß den Auftrag bekommen, mich an die Arbeit zu machen, ehe Plünderer zu viele Beweise verderben. Ich hoffe, Ihre Freundin hat ihre Sachen retten können – der Brand hat nicht viel übriggelassen.«
Ich hatte vergessen, Elena zu fragen, ob jemand schwer verletzt worden war. Robin sagte, falls jemand gestorben wäre, hätte die Mordkommission die Beamten von der Feuerpolizei verstärkt.
»Dann hätten Sie ohne triftigen Grund gar nicht in der Nähe des Gebäudes parken dürfen – die Lebenserfahrung sagt, daß Brandstifter gern zurückkommen, um zu sehen, ob sie ganze Arbeit geleistet haben. Niemand ist umgekommen, aber ein gutes halbes Dutzend ist mit Verbrennungen und Rauchvergiftung ins Michael Reese gebracht worden. Im allgemeinen achten Brandstifter darauf, ob ein Gebäude geräumt werden kann – sie können sich vorstellen, daß es bei einer Ermittlung in einer alten Bruchbude wie der hier nicht besonders gründlich zugeht, wenn kein Mordverdacht dazukommt, der die Bullen scharfmacht.« Er schaute auf seine Uhr. »Ich muß mich wieder an die Arbeit machen. Ich hoffe, daß Ihre Freundin was Neues findet.«
Dem konnte ich nur zustimmen, und ich fuhr los, um mich mit einem Optimismus, der nur meiner Unerfahrenheit zu verdanken war, auf Wohnungssuche zu machen. Ich begann im Wohnungsamt auf der südlichen Michigan Avenue, wo ich mich in eine lange Schlange einreihte. Frauen mit Kindern aller Altersstufen waren da, alte Männer, die murmelnd mit sich selbst sprachen, wild die Augen rollten, Frauen, die ängstlich Koffer oder kleine Einrichtungsstücke umklammerten – ein offenbar endloser Strom von Menschen, die irgendeine dramatische Wendung ihres Lebens auf die Straße geschleudert hatte.
Die hohen Schaltertresen und die kahlen Wände vermittelten uns ein Gefühl, als seien wir Bittsteller vor den Toren eines sowjetischen Arbeitslagers. Es gab nicht einen Stuhl; ich zog eine Nummer und lehnte mich an die Wand, um zu warten, bis die Nummer aufgerufen wurde.
Neben mir rackerte sich eine hochschwangere junge Frau, die einen größeren Säugling auf dem Arm hatte, mit einem Kleinkind ab. Ich bot an, das Baby zu halten oder den Zweijährigen abzulenken.
»Ist schon gut«, sagte sie mit leiser langsamer Stimme. »Todd ist bloß müde, weil er die ganze Nacht auf war. Wir konnten nicht ins Asyl, weil dorthin, wo sie uns geschickt haben, keine Babys dürfen. Ich hab kein Geld mehr für den Bus gehabt, noch mal herzukommen und denen hier zu sagen, daß sie uns etwas anderes besorgen müssen.«
»Und was haben Sie dann gemacht?« Ich wußte nicht, was entsetzlicher war – ihre Notlage oder die sanfte Resignation, mit der sie darüber sprach.
»Ach, wir haben eine Parkbank an der Edgewater Avenue gefunden, in der Nähe vom Asyl. Das Baby hat geschlafen, aber für Todd war’s einfach zu unbequem.«
»Haben Sie keine Freunde oder Verwandten, die Ihnen helfen können? Was ist mit dem Vater des Babys?«
»Ach, der würde schon versuchen, was für uns zu finden«, sagte sie teilnahmslos. »Aber er kriegt keine Arbeit. Und meine Mutter, bei der haben wir gewohnt, aber sie hat ins Krankenhaus gemußt, und jetzt sieht es so aus, als ob sie lange krank ist, und sie kann sich die Miete nicht mehr leisten.«
Ich schaute im Raum umher. Dutzende von Menschen warteten vor mir. Die meisten sahen so ausgebrannt aus wie meine Nachbarin, Menschen, die zuviel Scham gebrochen hatte. Und wer nicht so aussah, war aggressiv, wartete darauf, sich mit einem System anzulegen, gegen das man keine Chance hatte. Da war kein Zweifel, Elenas Bedürfnisse – meine Bedürfnisse – rangierten weit hinter ihrem Anspruch auf eine Notunterkunft. Ehe ich ging, fragte ich die Frau, ob Todd und sie etwas zum Frühstück mochten – ich wollte hinüber zu Burger King gehen und etwas besorgen.
»Hier lassen sie einen nichts essen, aber vielleicht können Sie Todd mitnehmen, damit er etwas bekommt.«
Todd war absolut dagegen, sich von seiner Mutter zu trennen, auch wenn es um Essen ging. Schließlich ließ ich ihn jammernd neben ihr zurück, ging zu Burger King, kaufte ein Dutzend Frühstücksbrötchen mit Eiern und wickelte alles in eine Plastiktüte, damit niemand sah, daß es sich um Essen handelte. Die Tüte gab ich der Frau und verschwand so schnell wie möglich. Schauer liefen noch immer über meine Haut.
Kein heiliger Petrus
Unterkünfte, die Elena sich hätte leisten können, hatten wohl kein Geld für Inserate. Die Pensionen, die im Branchentelefonbuch aufgeführt waren, kosteten hundert Dollar pro Woche und mehr. Für ihr kleines Zimmer im Indiana Arms hatte Elena fünfundsiebzig im Monat bezahlt.
Ich verbrachte vier Stunden mit vergeblichem Pflastertreten. Ich durchkämmte Near South Side, klapperte die Cermak Road ab zwischen Indiana Avenue und Halsted Street. Vor hundert Jahren gab es hier viele Hotels mit wohlklingenden Namen. Als sie an das Nordufer umgezogen waren, kam die Gegend schnell herunter. Heute sieht man hier nur leere Grundstücke, Autohändler, Kneipen und kaum noch eine Pension. Vor ein paar Jahren hat jemand beschlossen, eine Häuserzeile im ursprünglichen Stil renovieren zu lassen. Die Häuser bilden nun eine makabre Geisterstadt, leere luxuriöse Hülsen inmitten des Verfalls, der sich im Viertel breitmacht.
Über mir die Stützpfeiler der Dan-Ryan-Hochbahn, kam ich mir winzig und unnütz vor, wie ich so von Tür zu Tür ging und betrunkene oder gleichgültige Portiers nach einem Zimmer für meine Tante fragte. Ich erinnerte mich vage daran, daß ich etwas darüber gelesen hatte, wie viele Pensionen den Presidential Towers hatten weichen müssen, aber ich hatte mir bis jetzt nicht klargemacht, wie sich das auf das Viertel auswirken mußte. Für Menschen mit Elenas beschränkten Mitteln gab es einfach keine Unterkunft mehr. Die Pensionen, die ich fand, waren alle besetzt – Opfer des Brandes der letzten Nacht, schlauer als ich, waren schon im Morgengrauen hiergewesen und hatten die wenigen verfügbaren Zimmer ergattert. Viermal mußte ein schmuddeliger Geschäftsführer sagen: »Tut mir leid, wenn Sie gleich heute morgen gekommen wären, als wir noch was hatten…«, bis ich das begriffen hatte.
Um drei brach ich die Suche ab. Entsetzt von der Aussicht, Elena für unbestimmte Zeit beherbergen zu müssen, fuhr ich in mein Büro im Loop, um Onkel Peter anzurufen. Das war eine Entscheidung, zu der ich mich nur durchringen konnte, weil mich Panik packte.
Peter war das erste Mitglied meiner Familie, das es zu etwas gebracht hatte; vielleicht neben meinem Vetter Bum-Bum der einzige. Peter war neun Jahre jünger als Elena und hatte nach seiner Rückkehr aus Korea in den Schlachthöfen gearbeitet. Er begriff schnell, wenn jemand in der Fleischindustrie reich wurde, dann nicht die Polen, die den Kühen den Hammer auf den Kopf schlagen. Er kratzte bei Freunden und Verwandten einige Dollars zusammen und machte eine eigene Wurstfabrik auf. Der Rest war die klassische Geschichte des amerikanischen Traums.
Er folgte den Schlachthöfen nach Kansas City, als sie in den siebziger Jahren dorthin umzogen. Jetzt wohnte er in einem riesigen Haus im protzigen Stadtteil Mission Hills, schickte seine Frau zum Einkauf ihrer Frühjahrsgarderobe nach Paris, meine Vettern auf teure Privatschulen und in Sommerlager und fuhr immer den neuesten Nissan. Ein Bilderbuchamerikaner. Peter hielt sich auch so fern wie irgend möglich von den armen Schluckern der restlichen Familie.
Das Pulteney-Building, in dem sich mein Büro befindet, ist alles andere alls eine erstklassige Adresse. In den letzten Jahren hat der Loop sich nach Westen erweitert. Das Pulteney liegt am südöstlichen Zipfel, wo Peepshows und Pfandleiher die Mieten drücken. Die Wabash-Hochbahn bringt die Fenster im dritten Stock zum Klirren und wirbelt Tauben und Dreck auf, die sich normalerweise dort festsetzen.
Meine Möbel sind zusammengewürfelte Fundstücke aus Polizeiauktionen und Gebrauchtwarenläden. Früher hing über dem Aktenschrank eine Radierung aus den Uffizien, aber letztes Jahr wurde mir endgültig klar, daß die sorgfältig ausgeführte schwarze Strichelei zusammen mit dem olivgrünen Mobiliar nur trist wirken kann. Ich habe also ein paar farbenfrohe Drucke von Gemälden von Nell Blaine und Georgia O’Keeffe an die Wand gepinnt. Das brachte etwas Farbe in den Raum, aber niemand wäre eingefallen, dieses Büro für die Zentrale weltweiter Operationen zu halten.
Peter war einmal hier gewesen, als er vor mehreren Jahren mit seinen drei Kindern eine Städtereise nach Chicago unternahm. Ich hatte beobachtet, wie ihm sichtlich die Brust schwoll, als er die Differenz zwischen unseren gegenwärtigen Nettowerten abschätzte.
Ihn an diesem Nachmittag ans Telefon zu bekommen, erforderte meine ganze Überredungskraft, und ein wenig Dreistigkeit. Meine erste Sorge, er könne außer Landes sein oder auf irgendeinem Golfplatz unerreichbar, erwies sich als unbegründet. Aber er beschäftigte eine ganze Heerschar von Assistenten, die davon überzeugt waren, es sei besser, wenn sie sich selbst um mein Anliegen kümmerten und den großen Mann nicht störten. Zum aufreibendsten Scharmützel kam es, als ich schließlich seine Privatsekretärin an der Strippe hatte.
»Ich bedaure, Miss Warshawski, aber Mr. Warshawski hat mir eine Liste von Familienmitgliedern gegeben, die ihn jederzeit stören können. Ihr Name steht nicht darauf.« Der näselnde Tonfall von Kansas war höflich, aber unerbittlich.
Ich beobachtete, wie sich die Tauben nach Läusen absuchten. »Könnten Sie ihm etwas ausrichten? Während ich in der Leitung bleibe? Daß seine Schwester Elena mit dem Sechs-Uhr-Flug in Kansas City ankommt und mit dem Taxi vor seinem Haus vorfährt?«
»Weiß er, daß sie kommt?«
»Eben nicht. Deshalb versuche ich ja, ihn zu erreichen. Damit er es erfährt.«
Fünf Minuten später – während ich für das Warten Tagesgebühren bezahlte – dröhnte mir Peters tiefe Stimme ins Ohr. Was zum Teufel das heißen solle, daß ich ihm Elena unangemeldet ins Haus schickte. Er denke nicht daran, seine Kinder einer solchen Schlampe auszusetzen, er habe kein Gästezimmer, er habe schon vor Jahren deutlich gemacht, daß er niemals – »Ja, ja.« Ich brachte den Wortschwall schließlich zum Versiegen. »Ich weiß. Eine Frau wie Elena paßt einfach nicht nach Mission Hills. Die dortigen Säufer werden jede Woche manikürt. Ich verstehe.«
Nicht die allerbeste Eröffnung für eine Bitte um Finanzhilfe. Nachdem er sich ausgetobt hatte, erklärte ich ihm das Problem. Die Nachricht, daß Elena noch in Chicago war, sorgte, anders als ich gehofft hatte, nicht dafür, daß er ihr aus der Klemme half.
»Auf keinen Fall. Das habe ich ihr das letzte Mal unmißverständlich klargemacht, damals, als sie Mutters Haus bei diesem bescheuerten Investmentprojekt durchgebracht hat. Vielleicht erinnerst du dich daran, daß ich ihr einen Anwalt beschafft habe, der dafür gesorgt hat, daß sie beim Verkauf noch etwas übrigbehielt. Das war’s. Das letzte Mal, daß ich mich um ihre Angelegenheiten gekümmert habe. Es wird Zeit, daß du dieselbe Lektion lernst, Vic. Ein Alki wie Elena zapft dich an, bis du trocken bist. Je früher du das begreifst, desto leichter wird dein Leben.«
Das Echo meiner finstersten Gedanken von seinen arroganten Lippen zu hören, brachte mich dazu, daß ich auf dem Stuhl herumrutschte. »Wenn ich mich richtig erinnere, Peter, hat sie den Anwalt selbst bezahlt. Sie hat dich nie um Geld gebeten, oder? Wie auch immer, ich habe nur eine Dreizimmerwohnung. Es geht nicht, daß sie bei mir wohnt. Ich will nur soviel Geld, daß sie einen Monat lang die Miete für eine anständige Wohnung bezahlen kann, während ich ihr bei der Suche nach einer Unterkunft helfe, die ihren Möglichkeiten entspricht.«
Sein Lachen war unangenehm. »Genau das hat deine Mutter gesagt, als Elena damals in eurem Haus in Südchicago aufgetaucht ist. Weißt du noch? Nicht mal Tony hat es ertragen, daß sie dort war. Tony! Der Nachsicht hatte für alles und jedes.«
»Im Gegensatz zu dir«, kommentierte ich trocken.
»Ich weiß, daß du mich damit beleidigen willst. Aber ich fasse es als Kompliment auf. Was hat dir Tony hinterlassen, als er gestorben ist? Das schäbige Häuschen in der Houston Street und seine Pension.«
»Und einen Namen, auf den ich stolz bin«, fuhr ich ihn an, gründlich verärgert. »Und wenn wir schon dabei sind, ohne seine Hilfe wäre nie etwas aus deiner Hackfleischfabrik geworden. Tu also zum Ausgleich etwas für Elena. Ich bin mir sicher, wo immer Tony jetzt ist, er würde das für einen gerechten Tausch halten.«
»Ich habe Tony den letzten Cent zurückgezahlt.« Peter war eingeschnappt. »Und ich schulde weder ihm noch dir einen Furz. Und du weißt verflucht genau, daß es Würstchen sind, kein Hackfleisch.«
»Ja, du hast ihm den letzten Cent zurückgezahlt. Aber ein kleiner Gewinnanteil oder auch nur Zinsen hätten dich nicht umgebracht, oder?«
»Probier diesen sentimentalen Scheißdreck nicht an mir aus, Vic. Da fall ich nicht drauf rein, dazu hab ich schon zu viele Kilometer auf dem Buckel.«
»Genau wie ein Gebrauchtwagen«, sagte ich bitter.
Die Leitung war tot. Das Vergnügen, daß ich das letzte Wort gehabt hatte, entschädigte nicht für den verlorenen Kampf. Warum zum Teufel hatten aus der Familie meines Vaters Elena und Peter überlebt? Warum hatte nicht Peter sterben und Tony weiterleben können? Freilich nicht in dem Zustand, in dem er in seinen letzten Jahren gewesen war. Ich schluckte Galle und versuchte, das Bild meines Vaters in seinem letzten Lebensjahr zu verdrängen, dieses aufgeschwemmte Gesicht, diese unkontrollierbaren Hustenanfälle, die seinen Körper erschütterten.
Ich preßte die Lippen zusammen und sc haute auf meinen Schreibtisch, auf den Stapel unbeantworteter Post und nicht abgelegter Akten. Vielleicht wäre es an der Zeit, daß ich mich im zwanzigsten Jahrhundert einfand, ehe es in zehn Jahren zu Ende gehen würde. Zeit, daß ich mit meiner Arbeit soviel Erfolg hatte, mir wenigstens eine Sekretärin leisten zu können, die mir den Papierkram abnahm. Einen Assistenten, der einen Teil der Lauferei erledigte.
Ich wühlte ungeduldig in den Papieren, bis ich schließlich die Seiten fand, die ich für meine bevorstehende Präsentation brauchte. Ich rief bei Visible Treasures an, um zu hören, bis wann ich meine Vorlagen bringen konnte, damit die Dias noch über Nacht entwickelt würden. Sie sagten mir, wenn ich sie bis acht brächte, müßten sie für Satz und Dias das Doppelte des normalen Preises verlangen. Nach dieser Auskunft war mir wohler, es würde nicht ganz so schlimm kommen, wie ich befürchtet hatte.
Ich tippte die Vorlagen auf der alten Olivetti meiner Mutter. Wenn ich mir schon keinen Assistenten leisten konnte, sollte ich wenigstens ein paar Tausender für ein Textverarbeitungssystem springen lassen. Aber hielt nicht die Kraft, die ich brauchte, um die Tasten der Olivetti anzuschlagen, meine Handgelenke stark?
Kurz nach sechs war ich mit dem Tippen fertig. Ich durchsuchte meine Schubladen nach einem Aktendeckel für die Diagramme. Als ich keinen neuen fand, kippte ich einen Berg von Versicherungspapieren auf die Schreibtischplatte und schob die Unterlagen in den freigewordenen Ordner. Jetzt sah der Schreibtisch aus wie der Schuttabladeplatz der Stadt, wenn die Lastwagen ihre Ladung abgekippt haben. Ich sah es lebhaft vor mir, wie Peter auf die Platte starren würde und in seinem Gesicht die Fältchen mühsam unterdrückter Blasiertheit auftauchten. Vielleicht mußte man nicht unbedingt in einem Saustall arbeiten, wenn man sich der Wahrheit, der Gerechtigkeit und dem American Way verpflichtet fühlte.
Ich steckte die Versicherungsunterlagen in den Aktendeckel zurück und trug sie hinüber zu den Aktenschränken, wo ich eine Mappe mit Geschäftsausgaben fand, zu denen sie halbwegs paßten. Mit der Befriedigung einer guten Tat steckte ich »Versicherung« zwischen »Unkosten« und »Werbungskosten«. Nachdem ich das vollbracht hatte, nahm ich mir die Post der letzten zwei Wochen vor, die auf meinem Schreibtisch lagerte, schrieb ein paar Schecks aus, legte Korrespondenz ab und warf Werbebriefe in den Papierkorb. Ziemlich weit unten im Stapel stieß ich auf einen dicken weißen Brief von der Größe einer Hochzeitseinladung, oben links prangte in Prägedruck »Frauen von Cook County für eine offene Regierung«.
Ich wollte den Umschlag schon wegwerfen, als ich plötzlich begriff, um was es sich handelte – in einem Anfall von Schwachsinn hatte ich mich bereit erklärt, für einen Wahlkampf zu spenden. Marissa Duncan und ich hatten vor einer Ewigkeit zusammengearbeitet, als ich noch Pflichtverteidigerin für das County gewesen war. Sie gehörte zu den Menschen, die für die Politik leben und sterben, ganz gleich ob im Büro oder auf der Straße, und sie suchte sich ihre Themen sorgfältig aus. Zum Beispiel hatte sie aktiv an unserer Kampagne mitgearbeitet, die Behörde gewerkschaftlich zu organisieren, aber aus der Abtreibungsdebatte hatte sie sich völlig herausgehalten – sie wollte vermeiden, daß ihr irgend etwas Nachteile brächte, falls sie sich um ein öffentliches Amt bewarb.
Aus dem Büro der amtlichen Pflichtverteidigung war sie vor etlichen Jahren ausgeschieden, um am katastrophalen zweiten Wahlkampf von Jane Byrne für das Amt des Bürgermeisters mitzuarbeiten. Jetzt hatte sie einen einträglichen Posten bei einer großen PR-Agentur, die sich auf den Verkauf von Kandidaten spezialisierte. Sie ruft mich nur an, wenn sie gerade eine große Kampagne organisiert. Kurz vor ihrem Anruf vor vier Wochen hatte ich einen schwierigen Auftrag für einen Kugellagerfabrikanten aus Kankakee abgewickelt. Sie erwischte mich, als ich in der Hochstimmung schwebte, die immer dann aufkommt, wenn man Kompetenz gezeigt und einen dicken Scheck erhalten hat.
»Tolle Neuigkeiten«, sagte sie begeistert und setzte sich über meine lauwarme Begrüßung hinweg. »Boots Meagher sponsert eine Wahlspendenparty für Rosalyn Fuentes.«
»Ich weiß es zu schätzen, daß du mich ins Bild setzt«, sagte ich höflich. »Da brauch ich mir schon morgen früh den Star nicht mehr zu kaufen.«
»Du hattest schon immer einen ganz besonderen Sinn für Humor, Vic.« Politiker müssen vermeiden, jemandem direkt zu sagen, daß sie ihn für eine Nervensäge halten. »Aber das ist wirklich ungeheuer aufregend. Boots hat sich noch nie öffentlich für eine Frau ins Zeug gelegt. Er gibt eine Party in seinem Haus in Streamwood. Eine hervorragende Gelegenheit, die Kandidatin kennenzulernen und ein paar von den Leuten im County Board. Alle Welt kommt dorthin. Vielleicht sogar Rostenkowski und Dixon.«
»Beim bloßen Gedanken daran hüpft mir das Herz. Für wieviel verkaufst du die Eintrittskarten?«
»Fünfhundert pro Sponsor.«
»Zu happig für mich. Außerdem hast du doch gesagt, daß Meagher sie sponsert«, sagte ich aus purer Lust am Widerspruch.
Jetzt schwang doch eine Spur Ungeduld in ihrer Stimme mit. »Vic, du weißt doch, wie so etwas läuft. Fünfhundert, wenn man als Sponsor im Wahlprogramm stehen will. Für zweihundertfünfzig wird man als Sympathisant genannt. Für hundert gibt es eine Einladung.«
»Tut mir leid, Marissa. Das ist nicht meine Gewichtsklasse. Und ich bin sowieso kein großer Fan von Boots.« Er hieß eigentlich Donnel – den Spitznamen Boots hat er 1972 erworben, als die Reformer glaubten, sie könnten Daleys Leute verdrängen. Sie hatten eine arme ernsthafte Null aufgestellt, an deren Namen ich mich schon nicht mehr erinnere. Der Wahlslogan war: »Give Meagher the Boot. Einen Tritt für Meagher.« Als Daleys Einfluß dafür sorgte, daß Chicagos großer Mann mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt wurde, hatten seine Wahlhelfer, als er bei der Siegesparty in Bismarck auftrat, »Boots, Boots, Boots« gebrüllt, und seither wurde er nicht anders genannt.
Marissa sagte ernsthaft: »Vic, wir brauchen mehr Frauen bei der Kampagne. Sonst sieht es so aus, als hätte sich Roz von Boots kaufen lassen, und wir verlieren eine Menge von unserer Basis. Auch wenn du keine Pflichtverteidigerin mehr bist, bei den Frauen hier zählt dein Name immer noch.«
Um eine lange Geschichte kurz zu machen, sie schmeichelte mir, warb mit Roz Fuentes’ Eintreten für die freie Entscheidung der Frau und weckte zuletzt mein schlechtes Gewissen darüber, daß ich mich so lange aus politischen Aktivitäten herausgehalten hatte. So schaffte sie es, mich als Sympathisantin anzuheuern. Und schließlich strahlte mir ja von meinem Schreibtisch ein Scheck über zweitausend Dollar entgegen.
Der dicke weiße Umschlag enthielt die Einladung, ein Exemplar des Wahlprogramms und einen Rückumschlag für meine zweihundertfünfzig Dollar. Auf das Programm hatte Marissa in ihrer riesigen Schulmädchenschrift gekritzelt: »Freue mich wirklich darauf, Dich wiederzusehen.«
Ich blätterte in der Broschüre, schaute die Liste der Sponsoren und Sympathisanten durch. Nachdem er sich bereit erklärt hatte, die Spendenparty zu geben, hatte Boots alle rechtschaffenen Demokraten aufgeboten. Vielleicht war auch das Marissas Werk. Seitenlang tummelten sich Richter, Abgeordnete, Senatoren und Direktoren großer Firmen. Irgendwo am Ende der Sympathisantenliste stand mein Name. Aus irgendeinem alten Jahrbuch, wenn nicht aus einer Abschrift meiner Geburtsurkunde mußte Marissa meinen zweiten Vornamen ausgegraben haben. Als ich tatsächlich »Iphigenia« las, war ich versucht, sie anzurufen und meine Unterstützung zurückzuziehen – schließlich habe ich viel Mühe darauf verwandt, die hirnrissige Anwandlung meiner Mutter, als sie mich taufen ließ, als Familiengeheimnis zu wahren.
Das Spektakel sollte am Sonntag steigen. Ich schaute auf die Uhr – Viertel nach sieben. Ich konnte Marissa anrufen und es trotzdem noch rechtzeitig zu Visible Treasures schaffen.
Trotz der späten Stunde war sie noch im Büro. Sie gab sich Mühe, erfreut zu klingen, es gelang ihr aber nicht ganz – Marissa kann mich besser leiden, wenn ich ihr einen Gefallen tun soll.
»Klappt es am Sonntag, Vic?«
»Da kannst du drauf wetten«, sagte ich mit Schwung. »Was ziehen wir denn an? Jeans oder Abendkleider?«
Sie entspannte sich. »Ach, es ist ganz zwanglos – ein Barbecue, weißt du. Ich ziehe vermutlich ein Kleid an, aber Jeans sind in Ordnung.«
»Kommt Rosty? Du hast gesagt, das wäre möglich.«
»Nein. Aber die Leiterin seines Büros in Chicago kommt. Cindy Mathiessen.«
»Toll.« Ich bemühte mich, wie ein Cheerleader zu klingen. »Ich möchte mit ihr über die Presidential Towers sprechen.«
Marissas Stimme klang sofort wieder vorsichtig, als sie sich erkundigte, was mir ausgerechnet an diesem Thema liege.
»Es geht um die kleinen Pensionen«, sagte ich ernst. »Als sie die Häuser abgerissen haben, um die Towers hinzustellen, sind etwa achttausend vermietete Zimmer verlorengegangen. Weißt du, ich habe eine Tante…«. Und ich erklärte ihr die Geschichte mit Elena und dem Brand. »Ich bin nicht besonders gut zu sprechen auf Boots, Rosty oder die anderen Demokraten, weil ich kein Zimmer für sie finden kann. Aber ich bin mir sicher, wenn ich mit – wie heißt sie gleich noch? Cindy? – wenn ich mit Cindy spreche, kann sie mir sicher helfen.«
Mir kam es so vor, als halle das Telefon vom Wirbel der Rädchen wider, die in Marissas Kopf rotierten. Schließlich sagte sie: »Was kann sich deine Tante leisten?«
»Sie hat im Indiana Arms fünfundsiebzig bezahlt. Im Monat, meine ich.« Die Sonne war jetzt untergegangen, und jenseits des Lichtkegels meiner Schreibtischlampe war das Büro dunkel. Ich ging mit dem Telefon zur Wand hinüber und schaltete das Deckenlicht ein.
»Wenn ich ihr ein Zimmer besorgen kann, versprichst du mir dann, am Sonntag nicht über die Presidential Towers zu sprechen? Mit niemandem? Es ist ein etwas heikles Thema.«
Für die Demokraten, meinte sie. Nachdem der Vorsitzende des Repräsentantenhauses schon wegen moralischer Probleme im Scheinwerferlicht stand, wollten sie nicht, daß noch einer seiner Kumpel in Verlegenheit gebracht wurde.
Ich gab mich widerstrebend. »Kannst du das bis morgen abend erledigen?«
»Wenn nötig, erledige ich es bis morgen abend, Vic.« Sie gab sich keine Mühe, ihren grimmigen Ton zu unterdrücken.
Es waren noch genau zwanzig Minuten, in denen ich Visible Treasures erreicht haben mußte, damit mir nicht das Vierfache berechnet würde, aber ich nahm mir noch die Zeit, einen Scheck an »Frauen von Cook County für eine offene Regierung« auszuschreiben. Als ich die Bürotür hinter mir abschloß, begann ich zum ersten Mal an jenem Tag zu pfeifen. Wer behauptet, Erpressung mache keinen Spaß?
Tantchen reißt aus
Es war fast neun, als ich vom Kennedy Expressway abbog und auf die Racine Avenue zufuhr. Ich hatte nichts mehr gegessen seit jenem Würstchen, das ich mir um zwei an einem Imbißstand in der Canal Street gekauft hatte. Ich wünschte mir Ruhe und Frieden, ein heißes Bad, einen Drink und ein angenehmes Abendessen – im Gefrierfach lag ein Kalbskotelett, das ich genau für einen solchen Abend aufgehoben hatte. Aber ich mußte mich ja auf eine Nacht mit Elena gefaßt machen.
Als ich am gegenüberliegenden Bordstein parkte und zum zweiten Stock hinaufschaute, waren die Fenster dunkel. Während ich die Treppe hinaufschlich, stellte ich mir vor, wie meine Tante völlig hinüber am Küchentisch hing. Oder hingestreckt auf der ungemachten Bettcouch. Vielleicht verführte sie im Erdgeschoß gerade Mr. Contreras.
Ich hatte Elena weder Schlüssel noch Instruktionen für die beiden Sperrriegel gegeben. Ich mußte nur das oberste Schloß aufschließen – dasjenige, das automatisch einrastet, wenn man die Tür zuschlägt – und konnte das Licht im kleinen Flur einschalten. Es warf einen Lichtstreifen ins Wohnzimmer. Ich sah, daß die Couch wieder zugeklappt war.
Ich ging durch das Eßzimmer in die Küche und machte dort Licht. Die Küche blitzte. Das Geschirr von drei Tagen, das sich in der Spüle angesammelt hatte, war abgewaschen und weggestellt. Die Zeitungen waren verschwunden. Der Boden war gewischt. Die Tischplatte war sauber und abgeräumt. Mitten darauf lag ein Zettel von meinem gelben Abreißblock, beschrieben mit Elenas riesiger unsicherer Handschrift. Sie hatte »Vicki« geschrieben, das Wort durchgestrichen und durch »Victoria, Baby« ersetzt.
Danke, daß Du mir gestern nacht ein Bett abgetreten hast, als ich eins brauchte. Ich wußte, daß ich in einem Notfall auf Dich zählen kann, Du warst immer ein liebes Mädchen, aber ich will nicht herumhängen und Dir zur Last fallen, was ich bestimmt täte, deshalb alles Gute, Kleine, und wir sehen uns wieder, wenn aller Harm verrauscht ist, wie es heißt.
Sie hatte acht große X gemalt und mit ihrem Namen unterschrieben.
Seit drei Uhr morgens hatte ich meine Tante dafür verflucht, daß sie zu mir gekommen war, und mir nichts anderes gewünscht, als beim Nachhausekommen festzustellen, daß ich den Auftritt in der Nacht nur geträumt hatte. Der Wunsch war in Erfüllung gegangen. Aber anstatt in Hochstimmung zu geraten, wurde mir ziemlich flau im Magen. Trotz ihrer so offenherzigen Art hatte Elena keine Freunde. Natürlich wimmelte es auf den Straßen und Gassen von Chicago von ihren ehemaligen Liebhabern, aber ich glaubte nicht, daß sich auch nur einer von ihnen an Elena erinnerte, wenn sie bei ihm vor der Tür stand. Wenn ich es mir recht überlegte, war ich auch nicht sicher, ob Elena sich an einen von ihnen so deutlich erinnerte, daß ihr auch einfiel, an welche Tür sie zu klopfen hätte.
Den zweiten unerfreulichen Gedanken, der mir im Kopf herumspukte, löste Elenas Schlußsatz aus. In einer Bühnenfassung von Tom Sawyer hatten wir in der High School gesungen: »Wo aller Harm verrauscht«. Das Lied galt als typisches Beispiel für spätviktorianische Choräle. Wenn ich mich recht erinnerte, war der verrauschte Harm ein zuckersüßer Euphemismus für das Leben nach dem Tod. So gut kannte ich Elena nicht, um entscheiden zu können, ob das nur eine Lieblingswendung von ihr war oder ob sie sich nun von der Wacker-Drive-Brücke stürzen würde.
Ich durchsuchte die Wohnung gründlich nach Indizien für Elenas Absichten. Der Matchsack war fort, das violette Nachthemd auch. Als ich im Barschrank nachschaute, fehlten genau zwölf Zentimeter aus der angebrochenen Flasche Black Label. Aber so, wie Elena heute morgen geschlafen hatte, mußte sie das, da war ich einigermaßen sicher, vor dem Zubettgehen getrunken haben.
Es wäre mir fast lieber gewesen, wenn sie die Flasche mitgenommen hätte – das hätte mich davon überzeugen können, daß sie sich nicht sofort umbringen wollte.
Aber konnte eine Frau wirklich ihr ganzes Leben damit verbringen, zu saufen und mit Männern herumzuziehen, und dann plötzlich im Alter von Sechsundsechzig Jahren von einer so starken Reue gepackt werden, daß sie es nicht mehr ertrug? Das schien nicht allzu wahrscheinlich. Der Schlafmangel und mein Tag in den ausgebrannten Gebäuden der Near South Side trieben mich in morbide Vorstellungen.
Ich überlegte, ob ich Lotty Herschel anrufen sollte, um die Angelegenheit mit ihr zu besprechen. Sie ist Ärztin. In ihrer Praxis an der Damen Avenue bekommt sie jede Menge Säufer zu sehen. Aber ihr Tag beginnt mit den Klinikvisiten um sieben. Es war ein bißchen spät für einen Anruf, dessen Hauptfunktion darin bestand, mein schlechtes Gewissen zu beschwichtigen.
Ich stellte den Black Label in den Schrank zurück, ohne mir etwas einzugießen. Der alkoholische Teil meines Abendprogramms hatte an Reiz verloren, als ich mir vorstellte, wie Elena zwölf Zentimeter geschluckt hatte und dann rotgesichtig in Stupor verfallen war. Ich ging in die Küche, nahm das Kalbskotelett aus dem Gefrierfach und legte es zum Auftauen auf meinen kleinen Backautomaten, während ich ein Bad nahm. Wenn ich nicht die Polizei alarmieren wollte, konnte ich heute abend wegen meiner Tante nichts mehr unternehmen.
Das Eintauchen in die Wanne entspannte mich nicht so wie sonst. Das Bild von Elena, wie sie, das tapfere Lächeln leicht schief, mit der Familie, die ich beim Wohnungsamt getroffen hatte, auf einer Parkbank saß, verhinderte das. Ich stieg aus der Wanne, schaltete den Backautomaten aus und zog mich wieder an.
Das Wohnzimmerlicht von Mr. Contreras hatte gebrannt, als ich nach Hause gekommen war. Ich stieg die Vordertreppe hinunter und klopfte an seiner Tür. Der Hund jaulte ungeduldig, während Mr. Contreras an den Schlössern fingerte. Als er sie schließlich offen hatte, sprang der Hund hoch und leckte mir das Gesicht. Ich fragte den alten Mann, ob er gesehen habe, wie Elena gegangen war.
Natürlich hatte er es gesehen – wenn er nicht im Garten wirtschaftete oder mit den Pferderennen beschäftigt war, hatte er das Haus scharf im Auge. War er zu Hause, brauchten wir eigentlich keinen Wachhund. Elena war gegen halb drei gegangen. Nein, er konnte mir nicht sagen, was sie angehabt, ob sie Make-up aufgelegt hatte. Wofür ich ihn denn hielte, für einen Schnüffler, der Leute anstarrte und in ihrem Privatleben herumstocherte? Er konnte mir jedoch sagen, daß sie in der Diversey Avenue in einen Bus gestiegen sei. Er sei nämlich um die Ecke gegangen, um Milch zu holen. Richtung Osten, das stimmte.
»Sie haben nicht erwartet, daß sie die Wohnung verläßt?«
Ich hob ungeduldig die Schultern. »Sie hat keine Bleibe. Soweit ich weiß.«
Er schnalzte mitfühlend mit der Zunge und unterzog mich einem eingehenden Verhör. Mein schmaler Vorrat an Geduld neigte sich dem Ende zu, als der Bankangestellte seine Wohnungstür aufmachte. Er trug hautenge Jeans, Marke Ralph Lauren, und ein Polohemd.
»Herr und Heiland! Hätte ich gewußt, daß Sie rund um die Uhr im Treppenhaus herumschreien, hätte ich diese Wohnung nie gekauft.« Das runde Gesicht verzog sich zu einer finsteren Miene.
»Und wenn ich gewußt hätte, daß Sie eine so verklemmte Heulsuse sind, hätte ich verhindert, daß Sie die Wohnung kriegen«, gab ich mißgelaunt zurück.
Die Hündin ließ ein kehliges Knurren hören.
»Gehen Sie nur nach oben, Engelchen«, drängte Mr. Contreras hastig. »Wenn mir noch was einfällt, rufe ich Sie an.« Er zerrte die Hündin hinter sich her in die Wohnung und schloß die Tür. Ich hörte, wie Peppy dahinter jaulte und schniefte. Sie hätte gegen ein kleines Gerangel nichts gehabt.
»Was tun Sie eigentlich?« wollte der Bankangestellte wissen.
Ich lächelte. »Nichts, was in einem Wohngebiet verboten ist. Sie brauchen sich also nicht das Gehirn darüber zu zermartern.«
»Wenn Sie nicht damit aufhören, Ihrem Geschäft im Treppenhaus nachzugehen, rufe ich wirklich die Bullen.« Er knallte die Tür zu.
Ich stapfte wieder nach oben. Jetzt hatte er seiner Freundin, seiner Mutter oder wen immer er abends anrief, etwas zu erzählen. Ich bin anderen gern gefällig.
In meiner Wohnung schaltete ich den kleinen Backofen wieder an und garte Pilze und Zwiebeln in etwas Rotwein. Nachdem ich erfahren hatte, daß Elena mit dem Bus an der Diversey Avenue weggefahren war, fühlte ich mich etwas besser. Das klang, als hätte sie ein bestimmtes Ziel gehabt. Am Morgen würde ich, um mein Gewissen zu beruhigen, mit einem meiner Freunde bei der Polizei telefonieren. Vielleicht hatten sie gerade nichts Besseres zu tun, als den Busfahrer ausfindig zu machen, der sich natürlich an Elena erinnern würde und daran, welche Richtung sie nach dem Aussteigen genommen hatte. Vielleicht würde ich die erste Frau sein, die auf dem Mond landete – es sollen schon seltsamere Dinge vorgekommen sein.
Es war schon nach zehn, als ich mich endlich zum Essen setzte. Das Kotelett war genau richtig, innen noch rosa, und die glasierten Pilze ergänzten es ausgezeichnet. Ich hatte etwa die Hälfte gegessen, als das Telefon klingelte. Ich hätte es klingeln lassen, aber dann dachte ich an Elena. Falls sie versucht hatte, auf der Clark Street anzuschaffen, konnten das die Bullen sein, die wollten, daß ich Kaution für sie stellte.
Am Telefon war ein Polizist, aber er kannte Elena nicht und rief aus rein privaten Gründen an. Mindestens zum Teil aus privaten Gründen. Ich hatte Michael Furey kennengelernt, als ich am letzten Neujahrstag bei den Mallorys zum Essen gewesen war. Sein Vater und Bobby waren gemeinsam in Norwood Park aufgewachsen. Als Michael gleich nach dem Junior College zur Polizei ging, verfolgte Bobby wie ein Onkel seinen Weg. In Chicago sieht jeder, wo er bleibt, aber Bobby ist ein fast skrupulös ehrpusseliger Bulle – er hätte niemals persönlichen Einfluß geltend gemacht, um die Karriere des Sohns von einem Freund zu fördern. Der Junge kam jedoch auch allein zurecht; nach fünfzehn Jahren begrüßte Bobby ihn freudig als neues Mitglied der Mordkommission im Zentralrevier.
Nach der Versetzung lud Eileen uns beide eine Zeitlang regelmäßig zum Essen ein. Sie hatte es weniger auf eine zweite Ehe für mich abgesehen als auf Kinder – sie ließ nicht ab, mir die intelligentesten und tüchtigsten Polizisten Chicagos vorzustellen, immer in der Hoffnung, einer davon habe in meinen Augen das Zeug zu einem guten Vater.
Eileen gehörte zu der Generation, die glaubte, ein Typ mit einem ordentlichen fahrbaren Untersatz sei reizvoller als einer, der sich nur einen Honda leisten kann. Furey hatte etwas Geld – die Lebensversicherung seines Vaters, sagte er, die er gut habe anlegen können –, und er fuhr eine silberne Corvette. Er war attraktiv und hatte Witz, und ich fuhr gern Corvette, aber ansonsten gab es nur die Mallorys und die Liebe zum Sport, die wir gemeinsam hatten. Unsere Beziehung beschränkte sich schließlich darauf, daß wir hin und wieder ins Stadion gingen oder uns zu einem Ballspiel verabredeten. Eileen verbarg ihre Enttäuschung, aber es kamen keine Einladungen zum Essen mehr.
»Vic! Bin heilfroh, daß ich dich antreffe«, dröhnte Michael fröhlich in mein Ohr.
Ich kaute zu Ende. »Abend, Michael. Was gibt’s?«
»Hatte eben Schichtschluß. Hab mir gedacht, ich melde mich mal und hör, wie’s dir geht.«
»Na, so was, Michael«, sagte ich mit spöttischer Aufrichtigkeit, »wie aufmerksam von dir. Wie lange ist es her – einen Monat oder so? –, und du meldest dich um zehn Uhr abends bei mir?«
Er lachte etwas befangen. »Ach, was soll’s, Vic. Du weißt ja, wie es ist. Ich muß dich was fragen und will nicht, daß du es in den falschen Hals kriegst.«
»Versuch’s mal.«
»Es geht – äh, na ja, ich hab gar nicht gewußt, daß du dich für die Politik im County interessierst.«
»Die interessiert mich auch nicht besonders.« Ich war überrascht.
»Ernie hat mir erzählt, du stehst auf der Liste als Sponsor der Wahlparty für die Fuentes, die am Sonntag auf Boots’ Farm steigt.«