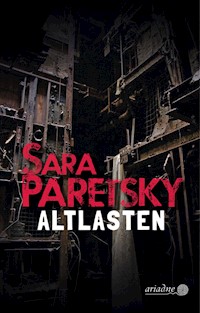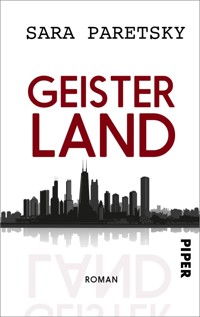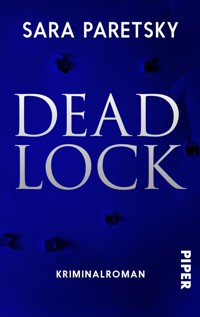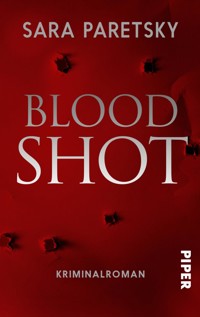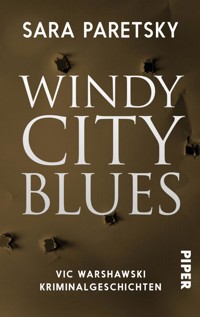
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Neunmal Vic Warshawski in Hochform! Neun Kriminalgeschichten aus Chicago: eine Stadtbesichtigung der eher mörderischen Art an der Seite von Vic Warshawski, die mit den Haien schwimmt, nichts mehr liebt als die Gerechtigkeit und die sich gnadenlos der Wahrheit opfert. »Zuallererst und vor allem bin ich eine Geschichtenerzählerin. Bücher, die ihren Gegenstand erst erklären müssen, sind langweilig und reizlos.« Sara Paretsky
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Übersetzung aus dem Amerikanischen von Vera Mansfeldt, Takamoku Joseki, Renate Kunze, alle anderen Erzählungen Sonja Hauser
ISBN: 978-3-492-98384-6
© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2018
© 1995 Sara Paretsky
Titel der amerikanischen Originalausgabe:»Windy City Blues«: Delacorte Press, New York 1995
© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1997
Covergestaltung: Favoritbüro, München
Covermotiv: Freedom Master/shutterstock
Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Cover & Impressum
Vorwort
Einleitung
A Walk on the Wild Side Mit Vic Warshawski durch Chicago
Noten
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
Die Andromache von Pietro
I
II
III
IV
Ausgebrannt
I
II
III
IV
V
VI
Stille Wasser…
I
II
III
IV
V
VI
Die Malteserkatze
I
II
III
IV
V
VI
VII
QUITT
I
II
III
IV
V
Der Schein trügt
I
II
III
IV
Drei-Punkt Po
Takamoku Joseki
Vorwort
Die vorliegenden Geschichten entstanden in einem Zeitraum von dreizehn Jahren, als erste »Takamoku Joseki« (1982), als letzte »Noten« (1995), die ich eigens für diesen Band geschrieben habe. Aus diesem Grund erscheinen manche Einzelheiten in V. I.s Leben widersprüchlich – manchmal zum Beispiel fährt sie einen Omega, dann wieder ihren Trans Am. Den Trans Am hat sie 1990 gekauft, am Ende des Romans Brandstifter. Ihr Hund Peppy trat 1988 in ihr Leben, im Verlauf des Romans Tödliche Therapie. Die Geschichte »Die Malteserkatze« entstand 1990, während der Amtszeit von Bush und Quayle.
Der Kurzgeschichtenform wende ich mich manchmal zu, wenn ich mich mit einer Frage auseinandersetze, die keinen ganzen Roman wert zu sein scheint. Das war beispielsweise bei »Quitt« der Fall, wo ich mich mit dem Problem der persönlichen Verantwortung beschäftige. Andere Geschichten fallen mir durch ungewöhnliche Schauplätze ein: Einmal habe ich bei einem Betriebsschwimmfest mitgemacht (ich war so langsam, daß die anderen schon beim Mittagessen waren, als ich immer noch herumpaddelte); die Startpistole und die Tatsache, daß sich bei dem Wettbewerb sofort die Spreu vom Weizen trennte, gingen in die Story »Stille Wasser…« ein. Mit »Die Malteserkatze« schließlich wollte ich dem großen Meister der »hard-boiled school« meine Ehrerbietung erweisen.
Sara ParetskyChicago, Juni 1995
Einleitung
A Walk on the Wild Side Mit Vic Warshawski durch Chicago
Ein einsamer Reiher breitet die Schwingen aus und erhebt sich über das Marschland. Er zieht einige Kreise, dann macht er sich auf den Weg nach Süden, verschwindet im dichten Nebel. Ein paar rothalsige Enten knabbern weiter an den Köstlichkeiten des übelriechenden Wassers. Sie unterbrechen ihre Reise von Kanada zum Amazonas schon seit Jahrtausenden hier in der Gegend, die wir Neuankömmlinge die South Side von Chicago nennen.
Das Stück Sumpf, auf dem sie sich niederlassen, ist klein, nicht einmal einen Quadratkilometer groß. Dieser Fleck ist der letzte Überrest der Feuchtgebiete, die früher von Whiting, Indiana, mehr als dreißig Kilometer weit nördlich bis nach McCormick Place, dem monströsen Kongreßzentrum gleich beim Lake Michigan, reichten. Noch vor fünfzig Jahren lag ein großer Teil dieses Gebiets unter Wasser, darunter auch der achtspurige Highway, der die South Side mit dem Loop verbindet. Das Marschland hat man mit allen möglichen Stoffen, von Blausäure bis Schlacke, aufgefüllt, und damit alles Halt bekam, noch mit einer Menge Abfall.
Die Einheimischen nennen dieses letzte Stück Sumpf nach dem verrottenden Holz darin »Dead Stick Pond«, was so viel heißt wie »Teich der toten Zweige«. Der Name steht auf keinem Stadtplan. Nicht einmal die Chicagoer Polizisten, die gerade mal zehn Häuserblocks entfernt am Port of Chicago ihr Revier haben, kennen ihn. Dasselbe gilt für die Beamten des dortigen Chicago Park District. Um den Ort zu finden, muß man einen Einheimischen kennen.
Ich selbst komme nicht aus dieser Gegend, ja nicht einmal aus dieser Stadt: Ich habe Chicago im Juni 1966 um zwei Uhr früh das erstemal gesehen. Damals kam ich gerade aus einer kleinen Stadt im östlichen Kansas, um den Sommer über ehrenamtlich für die Presbyterianer in Chicago zu arbeiten – in einer Zeit großer Hoffnungen und großer Aufregung, in einer Zeit, in der wir dachten, Veränderungen seien möglich, in einer Zeit, in der wir glaubten, wenn wir nur genug Energie und genug guten Willen aufbrächten, könnten wir die schrecklichen Probleme unseres Landes für immer lösen.
Die Ausdehnung der nächtlichen Stadt war überwältigend. Rote Punkte schimmerten vor einem gelben Himmel, und danach folgten Kilometer um Kilometer von Lichtern: Straßenlaternen, Neonschilder, Ampeln, Blaulichter – Lichter, die nicht erhellten, sondern Schatten warfen und aus der Stadt ein Monster machten, bereit, die Unachtsamen zu verschlingen.
Mein Blick auf Chicago ist immer auch ein wenig distanziert und verzweifelt, denn für mich ist diese Stadt ein gefährlicher Ort, an dem beide Gefühle unter der Oberfläche brodeln. Wenn ich mich nachts mit dem Flugzeug dem Lichtermeer nähere, habe ich wieder das Gefühl, winzig, einsam, unbekannt zu sein. Erst wenn ich die Wahrzeichen der South Side entdecke, weiß ich wieder, daß mich hier ein Zuhause, Freunde, ein geliebter Mensch, Wärme erwarten.
Die Bewohner von Chicago finden diese Wärme wie alle anderen Städter in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft. In meiner Stadt gibt es siebenundsiebzig Viertel, jedes davon mit einer anderen ethnischen und rassischen Zusammensetzung, jedes mit eigenem Einkaufszentrum, eigener Bücherei, einem Polizeirevier und Schulen. Die Erwachsenen identifizieren sich auch, wenn sie in die Vororte gezogen sind, mit den Vierteln, in denen sie aufgewachsen sind: Eine meiner Sekretärinnen von der South Shore, selbst irischer Abstammung, spuckte immer verächtlich aus, wenn sie über irische Kollegen von den Vierteln der West Side redete. Sie nahm nicht einmal Nachrichten von ihnen entgegen.
Die Leute aus dem Norden gehen nicht nach Süden, und die Leute aus dem Süden wagen sich häufig nicht einmal bis zum Loop, es sei denn, sie müssen beruflich hin. Deshalb gibt es in Chicago auch zwei Baseballteams. Die Cubs spielen in Wrigley Field, knapp acht Kilometer nördlich des Loop; die White Sox sind im Comiskey Park daheim, der ungefähr genausoweit südlich des Loop liegt. (Der Name »Loop« kommt von der Hochbahn, die um den Finanzbezirk von Chicago herumfährt.)
Als Bewohnerin der South Side werde ich oft heftig kritisiert, weil ich ein Fan der Cubs bin. Dann muß ich erklären, daß meine Vorliebe auf den Sommer 1966 zurückgeht, in dem ich bei einem städtischen Programm für Kinder mitmachte. Die Cubs, die heutzutage sogar vor vollem Haus spielen, wenn sie verlieren, brauchten damals so dringend Zuschauer, daß sie unseren Kindern donnerstags Freikarten gaben. Das machten die Sox nicht, also wurde ich ein Fan der Cubs. Und das verstehen alle Leute aus Chicago – Loyalität, besonders Loyalität gegenüber jemandem, der einen bestochen hat. Schon ziemlich lange definiert man den ehrlichen Chicagoer Politiker als jemanden, der sich immer wieder kaufen läßt – also dürfte meine Erklärung genügen.
Es war gar nicht so leicht, die Kinder in den Zug nach Norden zu bekommen. Obwohl sie nur vier Häuserblocks von der el – der Hochbahn – entfernt wohnten, waren die meisten von ihnen noch nie damit gefahren, die meisten waren noch nie im Stadtzentrum gewesen, nicht einmal, um die berühmten Weihnachtsschaufenster von Marshall Field anzusehen (früher war das ein Wahrzeichen Chicagos, heute handelt es sich dabei um eine Außenstelle eines Konzerns in Minneapolis), und keins von ihnen war jemals im Norden gewesen. Als sie dann merkten, daß man sie auf dem Weg von und nach Wrigley Field nicht massakrieren würde, begannen sie, sich auf die Spiele zu freuen.
Von allen Chicagoer Vierteln finde ich die an der südöstlichen Seite, wo der Dead Stick Pond unter den verrottenden Schuppen der alten Stahlwerke ums Überleben kämpft, am interessantesten. Dort kann man die ganze Geschichte der Stadt in vier kleinen Vierteln nachverfolgen – South Chicago, South Deering, Pullman und die East Side.
Um die wahre South Side zu erleben, sollten Sie auf der I-94, dem Dan Ryan Expressway, nach Süden fahren, weg von der Gold Coast mit den teueren Restaurants und Läden. Die Straße führt zuerst an der Jackson Street vorbei, wo Besucher des griechischen Viertels von Chicago ihre Restaurants betreiben, dann an der Cermak Road, die nach Chinatown geht, und dann an der 59th Street, in der sich die weltberühmte University of Chicago befindet – das ist übrigens mein Viertel – und schließlich am anderen Ende wieder aus der Stadt heraus.
An der 95th Street, wo sich die Schnellstraße teilt und dem Fahrer die Wahl zwischen Memphis und Indiana bietet, sollten Sie auf der I-94 in östlicher Richtung nach Indiana fahren. An der 103rd Street wird die Luft beißend. Selbst wenn man die Fenster zumacht und die Klimaanlage ausschaltet, brennen einem Nase und Augen. Obwohl die Stahlwerke stillgelegt wurden und ein Drittel der South-Side-Bewohner arbeitslos ist, gibt es dort noch immer genug Schwerindustrie, um einen ziemlichen Gestank zu produzieren.
Auf einem Hügel zur Linken, der sich ungefähr eineinhalb Kilometer weit zwischen 103rd und 110th Street erstreckt, wird Methan abgefackelt. Dies hier ist der Müllplatz von Chicago. Er ist beinahe voll, und die Frage, wo man in Zukunft den Müll abladen soll, ist nur eines der Probleme, die Dead Stick Pond bedrohen. Die Bakterien, die unseren Müll auffressen, produzieren Methan, und dieses Methan wird abgefackelt, damit der ganze Müll nicht in die Luft fliegt. (Wenn solche Müllhalden sich unter einer Straße befinden wie hier, kann explodierendes Methan große Highway-Abschnitte zerstören.)
Hinter dem Müllberg erheben sich Getreideförderbänder und überraschenderweise auch die Schornsteine von großen Frachtschiffen. Die Müllhalde und die Fabriken verbergen ein Netzwerk von Wasserwegen vor den Betrachtern auf der Straße.
An der 130th Street, ungefähr dreißig Kilometer südöstlich des Water Tower, einem beliebten Einkaufsviertel für Einheimische und Touristen, verlassen Sie schließlich die Schnellstraße und machen sich auf den Weg nach Osten, mitten ins Herz des Industriegebiets. An Wochentagen könnte Ihr Wagen gut und gern der einzige Pkw unter all den Sattelschleppern sein, die zusammen mit Schleppkähnen und Zügen die Fabriken versorgen und die fertigen Produkte weiterbefördern.
Die 130th Street führt vorbei an Metron, einem der letzten Stahlwerke von Chicago, an Medusa Cement und an der Scrap Corporation of Chicago – davor türmt sich ein Berg von Schrott. An der Torrence Avenue kommt das gigantische Ford-Werk in Sicht, das größte der Welt. Dort fahren Sie wieder nach Norden und überqueren den Calumet River an einer alten Flaschenzugbrücke. Gleich auf der anderen Seite liegt die 122nd Street, eine schmale, schlecht asphaltierte Durchgangsstraße. Dann fahren Sie unter dem Reklameschild der Welded Tube Company nach links und folgen den Sattelschleppern nach Westen.
Dort ist der Himmel vom Smog purpurpinkfarben, und Sumpfgras und Schilf wachsen höher als die Dächer der vorbeifahrenden Wagen. Obwohl seit gut einem Jahrhundert Müll hierher gekippt wird und das Grundwasser mehr karzinogene Substanzen beinhaltet, als die Umweltschutzbehörde überhaupt benennen kann, gedeiht das Gras dort wunderbar. Wenn Sie sich für Vögel interessieren und ein wenig Geduld mitbringen, finden Sie hier Feldlerchen und andere Bewohner der Prärie.
Nach ungefähr eineinhalb Kilometern kreuzt die 122nd Street einen Schotterweg, Stoney Island. Nach rechts führt er hinauf zur CID-Müllhalde. Links verläuft er parallel zum Dead Stick Pond, und beide enden am Lake Calumet in einer Sackgasse. Medusa Cement buddelt am südlichen Ende des Sumpfes; am westlichen erheben sich die Gebäude der Feralloy Corporation, und im Osten wird gerade neu gebaut.
Schilder an den Bäumen erklären das Gebiet einerseits zum Wasserschutzgebiet und warnen andererseits die Leute vor gefährlichen Abfällen. Wenn Sie diese Schilder mißachten und ein bißchen Glück haben, können Sie im Dead Stick Pond vom Bettgestell bis zu alten Stiefeln alles finden.
Seitdem in den siebziger Jahren ein Gesetz zum Schutz des Wassers erlassen wurde, siedeln sich allmählich wieder Fische im Calumet River und seinen Nebenflüssen an, aber diejenigen, die es bis in den Teich schaffen, haben meist riesige Tumore und mißgebildete Flossen. Die Phosphate im Wasser verringern die Sauerstoffmenge, die durch die Oberfläche dringen kann. Trotzdem lassen sich wilde Vögel auf ihrem Flug nach Süden hier nieder. Und Bewohner von Chicago, die so arm sind, daß sie in Baracken ohne fließendes Wasser leben müssen, fangen die Fische fürs Mittagessen im Marschland. Ihre Hütten befinden sich entlang unmarkierter Wege durch die Sümpfe. Die Sterblichkeitsrate ihrer Bewohner ist besonders hoch, weil sie als Folge der Giftstoffe aus dem Trinkwasser häufig an Speiseröhren- oder Magenkrebs leiden. Die halbwilden Hunde, die um ihre Baracken streichen, machen es den Sozialarbeitern schwer, sich ein klares Bild von ihren Lebensumständen zu verschaffen.
An diesem Punkt Ihrer Fahrt sind Sie entweder müde und frieren, oder Sie sind durstig und es ist Ihnen heiß. Also liegt es nahe, bei einem Schnaps und einem Bier eine Pause zu machen. Das können Sie am besten in Sonny’s Inn ein paar Kilometer weiter nördlich.
Fahren Sie auf der gleichen Strecke, auf der Sie gekommen sind, bis zur Torrence Avenue zurück und dann nach links beziehungsweise Norden. Von der 117th bis zur 103rd Street, ungefähr drei Kilometer lang, können Sie die Überreste von Wisconsin Steel sehen. Früher war dieses Unternehmen einer der größten Stahlproduzenten der Welt, doch vor mittlerweile fast fünf Jahren ging es bankrott.
An der 97th Street wird die Torrence Avenue zur Colfax Avenue. Folgen Sie ihr bis zur 95th Street, wo Sie rechts abbiegen und drei Blocks weit bis zur Commercial Avenue fahren, der Hauptrennstrecke in South Chicago. Zwei Blocks nördlich der 91st Street finden Sie Sonny’s Inn gleich auf der anderen Seite der Eisenbahngleise.
Die kleinen Bungalows entlang dieser Strecke sind zum größten Teil in gutem Zustand, ein paar jedoch sehen ziemlich hoffnungslos aus. Obwohl fast fünfzig Prozent der Bewohner arbeitslos sind, pflegen sie ihre Häuser und Gärten. Und die Steel-City- und South-Chicago-Bank, bei denen die meisten ihre Hypotheken haben, lassen ihnen hin und wieder ein bißchen Geld zukommen. Diese Banken stellen selbst eine beachtliche Touristenattraktion dar: Welche andere große Stadt der Welt könnte von sich behaupten, daß ihre Banken so viel Gemeinsinn besitzen, daß sie ihren Kunden über lange Durststrecken hinweghelfen?
Die Tapferkeit dieses alten Viertels hat mich dazu veranlaßt, meine Detektivin V.I. Warshawski hier anzusiedeln – die Tapferkeit auf der einen Seite und die Mischung verschiedenster Rassen und ethnischer Gruppen, die es in eine ziemlich brisante Gegend verwandelt haben. South Chicago ist schon immer die erste Zuflucht für Einwanderer in Chicago gewesen. Die Fabriken mit ihren drei Schichten pro Tag boten Ungelernten und Analphabeten Arbeit. Das Viertel wurde die Heimat von Iren, Polen, Böhmen, Jugoslawen, Afrikanern und in letzter Zeit auch Hispanos. Die Alteingesessenen, die sich gerade erst einen kleinen Happen vom amerikanischen Traum allgemeinen Wohlstands gesichert hatten, wehrten sich gegen jede neue Welle von Einwanderern. In den öffentlichen Schulen kam es immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Mädchen, die in South Chicago aufwuchsen, schafften sich entweder Freunde an, die sie beschützten, oder sie lernten die Grundlagen des Straßenkampfs, um sich selbst zu beschützen. Obwohl V.I. unter dem wachsamen Auge ihrer Mutter groß wurde, wollte ihr Vater, daß sie sich selbst ihrer Haut wehren konnte: Als Polizeibeamter wußte er besser als die meisten anderen Väter, welchen Gefahren eine junge Frau ausgesetzt ist, die sich nicht wehren kann.
V.I. wuchs also im Schatten der Stahlwerke auf, und am Wochenende machte sie Ausflüge zum Dead Stick Pond, um den Reihern beim Fressen zuzusehen. Und sie kennt Sonny’s Bar, die alle ethnischen und rassischen Veränderungen überdauert hat und an die Tage des großen Bürgermeisters Daley erinnert. Sein Bild hängt an den Wänden und steht auf den Regalen – signierte Fotos von ihm mit Sonny, dem Gründer der Bar, signierte Fotos von ihm mit Präsident Kennedy, Wahlkampfsticker, vergilbte Zeitungsartikel. Ein Geweih über dem Tresen verdeckt den Blick auf einige dieser Erinnerungsstücke.
Wenn Sie unter der Woche zum Mittagessen vorbeischauen, werden Sie sich dort ein gutes Bild von den South-Side-Bewohnern machen können – von jeder Rasse und ethnischen Gruppe der Stadt sowie den meisten Berufen des Viertels. Sie bekommen ein Sandwich und einen Drink für weniger als fünf Dollar. Und wenn Sie »a shot and a beer« wirklich probieren wollen – das ist Roggenwhisky und Faßbier. Sie würden nur auffallen, wenn Sie einen Markenwhisky bestellen.
South Chicago steht nicht an erster Stelle der Viertel, denen eigentlich Mittel für Straßen- und Gehsteigreparaturen zustünden. Hin und wieder finden Sie Orte, wo der Bodenbelag eingebrochen ist. Wenn Sie in diese Löcher schauen, können Sie in ungefähr eineinhalb Meter Tiefe Kopfsteinpflaster sehen. Weil die Müllhalde, die vor einhundert Jahren angelegt wurde, die darunterliegenden Sümpfe nicht zurückhalten konnte, kippte die Stadt kurzerhand noch eine Schicht darüber. South Chicago ist einer der wenigen Orte, an denen die ursprüngliche untere Schicht noch zu erkennen ist.
Vielleicht haben Sie Ihr Quartier ja in der Stadtmitte im Palmer House aufgeschlagen. Dann dürfte es Sie interessieren, daß dies das einzige Gebäude ist, das noch von der unteren Stadt übrig geblieben ist. Da Mr. Palmer nicht wollte, daß sein ganzer Stolz abgerissen wird, ließ er das Gebäude auf Stelzen stellen, damit die neue, höhere State Street angelegt werden konnte.
Mit dem »shot and a beer« sowie einer Polnischen im Bauch haben Sie nun sicher noch Lust, ein paar andere Dinge anzuschauen. Wenn Sie ungefähr drei Kilometer weit nach Westen zu Stony Island und vier Blocks südlich zur 95th Street fahren, befinden Sie sich im Pullman Historie Landmark District. George Pullman, der sein Vermögen durch die Erfindung und Herstellung des Pullman-Wagens machte, ließ 1880 fast zweitausend Häuser als Musterdorf errichten. Das Gebiet sollte als Vorzeigeareal für Arbeiter dienen, unter anderem um die Agitation der Gewerkschaften zu dämpfen. Die Häuser wurden im Federal Style aus Lehmziegeln erbaut, die man aus dem nahegelegenen Lake Calumet holte. Die Pullman Company kontrollierte alle Geschäfte des Ortes sowie alle Dienstleistungen.
Leider wurden diese Häuser schon schnell zu teuer für die Arbeiter. Die Unzufriedenheit mit der Pullman Company spitzte sich deshalb in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts zu, als viele Arbeiter ihre Jobs verloren. Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen verlor Pullman ein Gerichtsverfahren, in dem es darum ging, wer den Ort in Zukunft besitzen und verwalten solle. Als die Pullman Company sich zurückzog, erlebte das Viertel zahlreiche wirtschaftliche und ethnische Umwälzungen. 1970 wurde es unter Denkmalschutz gestellt. Seither sind viele dieser schönen alten Häuser renoviert worden.
Aus dem Lehm des Calumet ließen sich bessere Ziegel als heutzutage brennen. Deshalb müssen die Bewohner des Pullman-Viertels sich gegen den Verlust ihrer Ziegelgaragen schützen – oft müssen sie nach dem Urlaub feststellen, daß ihre Garagen Ziegel für Ziegel abgetragen und zu einem anderen Bau in einem völlig anderen Gebiet gebracht worden sind.
Statt die Schnellstraße nach Norden zu nehmen, sollten Sie sich sozusagen durch die Hintertür aus der South Side schleichen, nach Osten bis zur Buffalo Street, vorbei am National Shrine to St. Jude, dem katholischen Schutzheiligen für alle hoffnungslosen oder schwierigen Fälle. Wenn Sie auf der Buffalo Street nach Norden fahren, werden Sie plötzlich feststellen, daß sie sich in den Highway 41 verwandelt hat. Die nächsten drei Kilometer gehen nicht immer geradeaus, aber die Schilder für den Highway 41 sind immer leicht zu sehen.
An der 79th Street sehen Sie zu Ihrer Rechten die letzten USX-Fabriken, und plötzlich verlassen Sie das Industriegebiet und sind wieder in einem ruhigen Wohnviertel. Ecke 71st Street/South Shore Drive befindet sich der alte South Shore Country Club. In ihm trafen sich früher die Reichen und Mächtigen der Gegend. Eine Tochter des verstorbenen Bürgermeisters Daley feierte hier Hochzeit. Der Privatstrand und Golfplatz wurden mittlerweile vom Chicago Park District übernommen, in den Ställen stehen Polizeipferde, und die Anwohner schwingen ihren Schläger auf dem Green. Das Clubhouse ist heute ein Gemeindezentrum, ein schöner Ort, der eine kleine Pause lohnt.
Auf der anderen Seite des Country Club ist der Lake Michigan zu sehen. Vielleicht klettern Sie ungefähr einen Kilometer weiter beim La-Rabida-Kinderkrankenhaus die Felsen hinauf und genießen den Blick auf den See. Von hier aus können Sie im Süden den industrialisierten Sumpf erkennen, aus dem Sie gerade gekommen sind. Im Norden zeichnet sich die Skyline, die Skidmore, Edward Durrel Stone, Bud Goldberg und ihre Freunde so berühmt gemacht hat, vom Himmel ab.
Wenn Sie wieder im Wagen sitzen, sollten Sie auf den Highway 41 zurückkehren. Schon bald wird daraus ein achtspuriger Highway, der Sie ziemlich schnell zum Loop bringt. Auf dem Rest Ihrer Fahrt wird Sie der Lake Michigan begleiten, der Gischt wird gegen die Felsen spritzen – eine Barriere, die von Menschen errichtet wurde, in der Hoffnung, das Wasser zu zähmen. Aber dieser See ist alles andere als zahm. Unter dem Asphalt liegt der Sumpf, seit fünfundzwanzigtausend Jahren Heimat der Reiher. Es könnte gut sein, daß der See eines Tages sein Recht zurückfordert.
Noten
I
Gabriella Sestieri aus Pitigliano.
Bitte setzen Sie sich mit dem Büro von Malcolm Ranier in Verbindung, wenn Sie etwas über ihren gegenwärtigen Aufenthaltsort wissen.
Ich las beim Frühstück den Herald-Star, als mir die Anzeige ins Auge sprang. Ganz vorsichtig stellte ich meinen Kaffee auf den Tisch, langsam wie in einem Traum. Ich machte die Zeitung zu, ebenfalls ganz langsam, dann schlug ich sie wieder auf. Die Anzeige war immer noch da. Ich buchstabierte die Überschrift für den Fall, daß ich unbewußt einen anderen Namen gelesen hatte, aber der Text blieb derselbe. Mehr als eine Gabriella Sestieri aus Pitigliano konnte es nicht geben – meine Mutter, die im Alter von sechsundvierzig Jahren 1968 an Krebs gestorben war.
»Wer könnte sie nach all den Jahren noch suchen?« dachte ich laut.
Peppy, die Golden-Retriever-Hündin, die ich mir mit meinem unteren Nachbarn teilte, hob mitfühlend eine Augenbraue. Wir waren an jenem trüben Novembermorgen gerade vom Joggen zurückgekommen, und Peppy wartete auf ihr Fressen.
»Ihr Vater kann’s nicht sein.« Er hatte nach sechs Monaten in einem deutschen Konzentrationslager den Verstand verloren und weigerte sich zu glauben, daß Gabriella tatsächlich gestorben war, als mein Vater ihm dies schriftlich mitteilte. Ich hatte den Brief übersetzen müssen, in dem es hieß, er selbst sei zu alt zum Wegfahren, wünsche aber Gabriella alles Gute für ihre Konzertreise. Wenn er noch lebte, war er mittlerweile fast schon hundert.
Vielleicht suchte Gabriellas Bruder Italo nach ihr; er war in den Kriegswirren verschwunden, aber Gabriella hatte immer gehofft, daß er überlebt hatte. Oder ihre erste Gesangslehrerin Francesca Salvini, die Gabriella so gern wiedergesehen hätte, um ihr zu erklären, warum sie nie das geworden war, was diese sich von ihr erhofft hatte. Als Gabriella mit allen möglichen Kanülen an ihrem ausgezehrten Körper im Jackson Park Hospital lag, hatte sie nur noch eine letzte Botschaft für mich und Francesca Salvini. Heute morgen wurde mir zum erstenmal klar, wie sehr das meinen Vater verletzt haben mußte. Er liebte meine Mutter abgöttisch, doch sie hatte ihn nur gern wie einen alten Freund.
Jetzt merkte ich, daß meine Hände schweißnaß waren und daß die Zeitung feucht an meinen Handflächen klebte. Mit einem verlegenen Lächeln legte ich das Blatt weg und wusch mir die Druckerschwärze an der Küchenspüle von den Fingern. Wie lächerlich, Mutmaßungen anzustellen, wenn ich bloß Malcolm Ranier anzurufen brauchte. Ich ging ins Wohnzimmer und suchte unter den Papieren auf dem Klavier nach dem Telefonbuch. Offenbar war Ranier Anwalt und hatte seine Kanzlei in der La Salle Street, am nördlichen Ende, wo sich die teueren neuen Gebäude befanden.
Anscheinend hatte er keine Partner. Die Frau, die sich am Telefon meldete, erklärte mir, sie sei die Assistentin von Mr. Ranier und mit all seinen Akten vertraut. Mr. Ranier könne im Augenblick nicht selbst mit mir reden, weil er in einer Besprechung sei. Oder vor Gericht. Oder auf dem Klo.
»Ich rufe wegen der Anzeige in der heutigen Zeitung an. Sie wollen wissen, wo Gabriella Sestieri sich im Moment aufhält.«
»Würden Sie mir bitte sagen, wie Sie heißen und in welchem Verhältnis Sie zu Mrs. Sestieri stehen?«
»Das sage ich Ihnen gern, wenn Sie mir sagen, wieso Sie sie suchen.«
»Es tut mir leid, aber ich darf telefonisch keine Auskunft geben. Wenn Sie mir mitteilen, wie Sie heißen und was Sie über Mrs. Sestieri wissen, melden wir uns jedoch wieder bei Ihnen, nachdem wir die Angelegenheit mit unserem Mandanten besprochen haben.«
Dieses Gespräch hätte gut und gerne den ganzen Tag so weitergehen können. »Möglicherweise ist die Person, nach der Sie suchen, nicht mit der identisch, die ich kenne, und ich möchte den Privatbereich ihrer Familie nicht verletzen. Ich habe heute morgen einen Termin in der La Salle Street; ich könnte bei Ihnen vorbeikommen und die Sache mit Mr. Ranier besprechen.«
Schließlich erklärte mir die Frau, Mr. Ranier habe um halb eins zehn Minuten Zeit. Ich gab ihr meinen Namen und legte auf. Danach hämmerte ich auf mein Klavier ein, als könnten die Töne meine aufgewühlten Gefühle besänftigen. Ich konnte nicht genau sagen, ob ich gewußt hatte, wie krank meine Mutter in den letzten sechs Monaten ihres Lebens gewesen war. Hatte sie es mir gesagt, und ich konnte – oder wollte – es nicht verstehen? Oder hatte sie beschlossen, mich vor diesem Wissen zu schützen? Normalerweise enthielt mir Gabriella schlechte Neuigkeiten nicht vor, aber vielleicht hatte sie mir die schlimmste aller Nachrichten, die von unserer baldigen Trennung, doch verschwiegen.
Warum hatte ich das Singen nie geübt? Zumindest das hätte ich für sie tun können. Ich hatte eine ganz brauchbare Altstimme – nach Gabriellas hohen Maßstäben nichts Besonderes –, und meine Mutter bestand natürlich darauf, daß ich mir musikalische Kenntnisse aneignete. Ich erhob mich und begann mit ein paar Stimmübungen, dann plötzlich verspürte ich den heftigen Wunsch, die Noten meiner Mutter zu finden, die alten Hefte, aus denen ich immer hatte üben müssen.
Ich suchte im Flurschrank nach dem Schrankkoffer, im dem sich ihre Bücher und Hefte befanden. Endlich entdeckte ich ihn im hintersten Winkel unter einem Karton mit alten Aktenordnern, einem Baseballschläger und einer Schachtel mit Kleidungsstücken, die ich nicht mehr anzog, aber auch noch nicht weggeben wollte… Ich setzte mich traurig auf den Boden, mit einem Gefühl, als hätte ich Gabriella so tief begraben, daß ich sie nicht mehr wiederfinden konnte.
Peppys Jammern holte mich in die Gegenwart zurück. Sie war mir zum Flurschrank gefolgt und stupste mich mit der Nase am Arm. Ich streichelte ihre Ohren.
Irgendwann wurde mir klar, daß ich die Beziehung zu meiner Mutter mit Dokumenten belegen mußte, wenn jemand tatsächlich nach ihr suchte. Ich stand vom Boden auf und zerrte den Schrankkoffer in den Flur. Ganz obenauf lag das schwarze Abendkleid aus Seide, das sie immer zu ihren Auftritten getragen hatte: Ich hatte vergessen, es in Seidenpapier einzuwickeln und ordentlich zu lagern. Schließlich fand ich die Heiratsurkunde meiner Eltern und Gabriellas Sterbeurkunde in der Partitur von Don Giovanni.
Als ich die Partitur wieder in den Schrankkoffer zurücklegte, flatterte ein weiteres altes Kuvert heraus. Ich nahm es in die Hand und erkannte Mr. Fortieris steile Handschrift. Carlo Fortieri reparierte Musikinstrumente und hatte früher Noten verkauft. Wenn Gabriella italienisch reden, sich über Musik unterhalten oder Rat einholen wollte, ging sie zu ihm. Aus Zuneigung zu ihr stimmte er noch immer manchmal mein Klavier.
Als Gabriella ihn kennenlernte, war er schon seit Jahren Witwer und hatte genau wie sie eine Tochter. Gabriella meinte, ich solle mit ihr spielen, während sie selbst sang oder sich mit Mr. Fortieri über Musik unterhielt, aber Barbara war mindestens zehn Jahre älter als ich, und wir hatten uns nie viel zu sagen.
Ich holte das vergilbte Papier aus dem Umschlag. Die Worte darauf waren italienisch, und es fiel mir schwer, sie zu entziffern, aber offenbar stammte der Brief von 1965.
Mr. Fortieri redete meine Mutter als »Cara signora Warshawski« an und sprach sein Bedauern darüber aus, daß sie ihr Konzert vom 14. Mai absagen mußte. »Natürlich werde ich Ihre Wünsche respektieren und niemandem den wahren Grund Ihrer Indisposition verraten. Und, cara signora, Sie sollten mittlerweile wissen, daß ich vertrauliche Mitteilungen von Ihnen als heilig erachte: Sie brauchen keine Angst vor einer Indiskretion meinerseits zu haben.« Er hatte mit seinem vollen Namen unterschrieben.
Ich machte mir Gedanken darüber, ob er der Liebhaber meiner Mutter gewesen war. Mein Magen verkrampfte sich bei dem Gedanken daran, daß sie die Grenzen ihrer Mutterrolle überschritten haben könnte, und ich steckte den Brief wieder ins Kuvert, nachdem ich ihn gefaltet hatte. Wahrscheinlich hatte mich vor fünfzehn Jahren dasselbe Gefühl dazu veranlaßt, die Notiz in die Partitur von Don Giovanni zu stecken. Da mir nichts Besseres einfiel, legte ich sie zurück in die Partitur und räumte alles wieder in den Schrankkoffer. Meine eigene Geburtsurkunde fand ich in einem anderen Karton. Inzwischen war es zu spät, um mich noch weiter meinen nostalgischen Gefühlen hinzugeben.
II
Malcolm Raniers Büro ging auf den Chicago River und die neuen Glas- und Marmorgebäude an seinem Ufer. Es war ein spektakulärer Blick – vorausgesetzt, man ignorierte den verbrannten Müll der Chicagoer West Side, die dahinter lag. Ich kam um Punkt halb eins an, bekleidet mit meinem guten schwarzen Kostüm und der weißen Crêpe-de-Chine-Bluse. Ich sah feminin, aber auch streng aus. Jedenfalls hatte ich das vor.
Raniers Assistentin/Empfangsdame war in Danielle Steel vertieft. Als ich ihr meine Visitenkarte reichte, merkte sie ohne allzugroße Eile ihr Buch ein und brachte meine Karte ins Büro ihres Chefs. Nach ungefähr zehn Minuten, die mir zeigen sollten, wie wichtig er war, kam Ranier höchstpersönlich heraus, um mich zu begrüßen. Er war rundlich und schwabbelig, vielleicht sechzig, und hatte graue Augen, die wie Kiesel über seinem angestrengt leutseligen Lächeln lagen.
»Ms. Warshawski. Wie schön, daß Sie hergekommen sind. Sie wollen uns also bei unserer Suche nach Mrs. Sestieri helfen.« Er sprach den Namen meiner Mutter italienisch aus, aber seine Stimme war genauso hart wie sein Blick.
»Ich möchte nicht gestört werden, Cindy«, sagte er und legte mir die Hand in den Nacken, um mich in sein Büro zu dirigieren.
Wir hatten noch nicht mal die Tür geschlossen, als Cindy sich bereits wieder auf Danielle stürzte. Ich entwand mich seiner Hand – schließlich wollte ich keinen Fettfleck auf meinem Fünfhundert-Dollar-Blazer – und bewunderte eine Bronzenymphe auf einem Regal beim Fenster.
»Hübsch, nicht wahr?« Ranier hätte genausogut vom Wetter sprechen können. »Einer meiner Mandanten hat sie aus Frankreich mitgebracht.«
»Sie sieht aus, als gehörte sie in ein Museum.«
Durch einen Anruf bei der Anwaltsvereinigung hatte ich vor meinem Besuch bei ihm erfahren, daß er Import-Export-Anwalt war. Offenbar waren etliche der Importe auf ihrem Weg ins Land an ihm kleben geblieben. Der Raum wurde von einem Block aus Rosenmarmor beherrscht, der vermutlich als Arbeitstisch diente, und die alten Stühle im Raum waren auch nicht zu verachten. An einer der Wände stand eine alte Anrichte mit Einlegearbeiten. Ich hielt es für durchaus wahrscheinlich, daß der Modigliani darüber echt war.
»Kaffee, Ms.« – er warf einen Blick auf meine Visitenkarte – »Warshawski?«
»Nein, danke. Ich weiß, daß Sie viel zu tun haben, und mir geht’s genauso. Unterhalten wir uns lieber über Gabriella Sestieri.«
»D’accordo.« Er dirigierte mich zu einem der alten spindeligen Stühle bei dem Marmorblock. »Sie wissen also, wo sie ist?«
Der Stuhl sah nicht so aus, als würde er meine siebzig Kilo aushalten, aber als Ranier sich auf einen ganz ähnlichen setzte, wagte ich es, Platz zu nehmen, allerdings mit dem Gefühl, daß er seine Gäste mit diesen Stühlen bewußt verunsichern wollte. Ich lehnte mich zurück und schlug die Beine übereinander, ganz die selbstsichere Frau.
»Ich möchte sichergehen, daß wir uns über ein und dieselbe Frau unterhalten. Und außerdem möchte ich erfahren, warum Sie sie finden wollen.«
Ein Lächeln spielte um seine vollen Lippen, breitete sich jedoch wieder nicht bis zu seinen Augen aus. »Wir könnten den ganzen Tag spiegelfechten, Ms. Warshawski, aber wie Sie selbst sagen, ist die Zeit für uns beide wertvoll. Die Gabriella Sestieri, die ich suche, wurde am 30. Oktober 1921 in Pitigliano geboren. Sie hat Italien Anfang 1941 verlassen; niemand weiß ganz genau, wann. Zum letztenmal hat man im Februar desselben Jahres in Siena von ihr gehört. Es gibt Mutmaßungen, daß sie danach nach Chicago kam. Und was den Grund meiner Bemühungen anbelangt: Ein Verwandter von ihr, der jetzt in Florenz lebt, möchte sie aufspüren. Ich habe mich auf Import und Export, besonders von und nach Italien, spezialisiert: Ich habe nicht viel Ahnung von der Suche nach vermißten Personen, aber ich habe den Fall übernommen, um einem Mandanten einen Gefallen zu tun. Der Verwandte von Mrs. Sestieri hat berufliche Verbindungen zu meinem Mandanten. Und nun sind Sie dran, Ms. Warshawski.«
»Ms. Sestieri ist im März 1968 gestorben.« Mein Puls raste; es freute mich, daß ich trotzdem sprach, ohne zu zittern. »Sie hat im April 1942 einen Polizeibeamten geheiratet. Sie hatten ein Kind. Mich.«
»Und Ihr Vater, Officer Warshawski?«
»Er ist 1979 gestorben. Könnte ich jetzt den Namen des Verwandten haben? Ich kenne lediglich eine Verwandte von Gabriella, die Schwester meiner Großmutter. Sie lebt hier in Chicago. Ich würde gerne noch andere kennenlernen.« Wenn die anderen Anverwandten auch nur die geringste Ähnlichkeit mit meiner verbitterten Tante Rosa hatten, hatte ich kein allzugroßes Interesse daran, dem restlichen Verazi-Clan zu begegnen.
»Sie waren vorsichtig, Ms. Warshawski, also vergeben Sie mir auch meine Vorsicht: Können Sie Ihre Identität beweisen?«
»Das klingt fast so, als warte ein Schatz auf den vermißten Erben, Mr. Ranier«, sagte ich und reichte ihm die Kopien meiner Dokumente. »Wer oder was sucht nach meiner Mutter?«
Ranier ignorierte meine Frage. Er warf einen kurzen Blick auf die Dokumente und legte sie dann auf den Marmorblock, während er mir sein Bedauern über den Verlust meiner Eltern aussprach. Seine Stimme klang genauso flach wie bei seiner Bemerkung über die Nymphe.
»Sie haben doch sicher den Kontakt zur Schwester Ihrer Großmutter aufrecht erhalten? Wenn Sie diejenige ist, die Ihre Mutter nach Chicago geholt hat, könnte es mir nützen, ihren Namen und ihre Adresse zu erfahren.«
»Meine Tante ist ziemlich schwierig, aber ich kann sie fragen, ob es ihr etwas ausmacht, wenn ich Ihnen ihren Namen und ihre Adresse gebe.«
»Und die restliche Familie Ihrer Mutter?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Die kenne ich nicht. Ich weiß nicht mal, wie viele Verwandte es noch gibt. Wer ist dieser mysteriöse Verwandte? Was will er – oder sie?«
Er sah die Unterlagen in seinen Händen an. »Das weiß ich wirklich nicht. Ich habe die Anzeige nur aufgegeben, um meinem Mandanten einen Gefallen zu tun. Aber ich werde Ihren Namen und Ihre Adresse weiterleiten, Ms. Warshawski, und wenn er sich mit der betreffenden Person in Verbindung gesetzt hat, werden Sie sicher etwas von ihm hören.«
Allmählich regte es mich auf, daß er die ganze Zeit um den heißen Brei herumredete. »Sie sind ein verdammter Pokerspieler, Mr. Ranier. Aber Sie wissen genausogut wie ich, daß Sie lügen wie gedruckt.«
Ich sagte das ganz locker, während ich aufstand, zur Tür ging und dabei meine Dokumente von dem Marmorblock nahm. Zum erstenmal war an seinem Blick abzulesen, was er fühlte: Während ich auf den Aufzug wartete, fragte ich mich, ob die Beantwortung dieser Anzeige nicht ein großer Fehler gewesen war.
Beim Abendessen erzählte ich Dr. Lotty Herschel von meinem Gespräch mit Ranier und versuchte dabei, meine wirren Gedanken zu sortieren. Außerdem überlegte ich, wer aus Gabriellas Familie sie suchen könnte – immer vorausgesetzt, die Suchanzeige war echt.
»Die wissen doch sicher, daß sie tot ist«, sagte Lotty.
»Das hatte ich anfangs auch gedacht, aber so einfach ist die Sache nicht. Meine Großmutter ist zum Judentum übergetreten, als sie Nonno Mattia geheiratet hat – Gabriellas Vater, Opa Matthias; sie hat ihn immer mit seinem italienischen Namen angeredet. Jedenfalls ist meine Großmutter in Auschwitz gestorben, als 1944 die italienischen Juden zusammengetrieben wurden. Mein Großvater ist nach seiner Befreiung nicht nach Pitigliano zurück, das ist die kleine Stadt, aus der die beiden stammten – die jüdische Gemeinde war ziemlich dezimiert worden, und er hatte keine Familie mehr dort. Also hat man ihn in ein von Juden geleitetes Sanatorium in Turin geschickt, aber das hat Gabriella erst nach Jahren herausgefunden, nachdem sie unzählige Briefe an jüdische Hilfsorganisationen geschrieben hatte.«
Ich starrte in mein Weinglas, als könnte der rote Bordeaux die Geheimnisse meiner Familie lüften. »Es gab eine Kusine im christlichen Zweig der Familie, der sie sehr nahe stand. Sie hieß Frederica. Frederica bekam ein Jahr, bevor Gabriella nach Chicago kam, ein uneheliches Kind und wurde verstoßen. Nach dem Krieg hat Gabriella versucht sie wiederzufinden, aber Fredericas Familie hat sich geweigert, ihre Briefe weiterzuleiten – die wollten keinerlei Kontakt mehr zu ihr. Vielleicht hätte Gabriella genug Geld sparen können, um selbst nach Italien zurückzufahren und nach ihr zu suchen, aber dann wurde sie krank. Sie hatte im Sommer ‘65 einen Abgang und hat enorm viel Blut verloren. Tony und ich haben damals gedacht, sie verblutet.«
Ich dachte an jenen heißen, unglücklichen Sommer, jenen Sommer, in dem die Stadt in Krawallen versank und meine Mutter blutend im stickigen vorderen Schlafzimmer lag. Sie und Tony stritten sich – das war ziemlich selten bei ihnen. Ich hatte gerade die Zeitungen ausgetragen, und sie hörten nicht, wie ich hereinkam. Er wollte, daß sie etwas verkaufte, von dem sie sagte, sie könne nicht darüber verfügen.
»Und dein Leben?« schrie mein Vater. »Das kannst du einfach verschenken? Selbst wenn sie noch leben würde…« Dann sah er mich und schwieg, und sie sprachen nicht mehr über die Angelegenheit, jedenfalls nicht, solange ich dabei war.
Lotty drückte meine Hand. »Was ist mit deiner Tante, ich meine, mit deiner Großtante, in Melrose Park? Sie könnte ihren Geschwistern etwas gesagt haben, meinst du nicht auch? Hatte sie ein enges Verhältnis zu ihnen?«
Ich verzog das Gesicht. »Ich kann mir nicht vorstellen, daß Rosa ein enges Verhältnis zu irgend jemandem haben könnte. Sie war das letzte Kind, und Gabriellas Großmutter ist bei ihrer Geburt gestorben. Sie wurde von Kusins adoptiert, und als die in den zwanziger Jahren emigrierten, ist Rosa mit ihnen nach Chicago gekommen. Sie hat sich nie als Mitglied der Verazi-Familie gefühlt. Ich weiß, das klingt merkwürdig, aber der Krieg hat zu so vielen Entwurzelungen geführt, daß der größte Teil von Gabriellas Familie mütterlicherseits tatsächlich nicht wußte, was aus ihr geworden war.«
Lotty nickte; auch ein Großteil ihrer Familie war in den Konzentrationslagern umgekommen. »Ist es nicht zur Spaltung innerhalb der Familie gekommen, als deine Großmutter konvertiert ist?«
Ich zuckte mit den Achseln. »Keine Ahnung. Schon frustrierend, wie wenig ich über diese Leute weiß. Gabriella sagt – hat gesagt –, daß die Verazis nicht gerade entzückt darüber waren, und sie haben sich auch kaum getroffen, außer mal zu Hochzeiten oder Beerdigungen. Die eine Kusine war die einzige Ausnahme. Aber Pitigliano war vor dem Krieg ein kulturelles Zentrum der Juden, und Nonno galt allgemein als gute Partie. Wahrscheinlich war er ziemlich reich, bevor die Faschisten seinen Besitz konfiszierten.« Gedanken an Entschädigungszahlungen schossen mir durch den Kopf.
»Klingt eher unwahrscheinlich«, sagte Lotty. »Meinst du, nach sechzig Jahren hat plötzlich jemand Schuldgefühle und will dir ein paar Grundstücke schenken?«
Ich wurde rot. »Eigentlich dachte ich eher an Fabriken: Die Sestieris waren Sattler, die sich in den zwanziger Jahren auf die Herstellung von Innenausstattungen für Automobile verlegten. Vermutlich gehört die Fabrik, vorausgesetzt, sie existiert noch, jetzt zu Fiat oder Mercedes. Weißt du, ich wälze schon den ganzen Tag die wildesten Phantasien – über Nonnos Fabrik oder Gabriellas Bruder –, aber dann kriege ich plötzlich Angst und frage mich, ob das alles nicht nur eine scheußliche Falle ist. Allerdings wüßte ich nicht, wer mich in eine Falle locken wollte und warum. Ich weiß, daß dieser Malcolm Ranier Bescheid weiß. Es wäre so einfach…«
»Nein! Du wirst nicht in das Büro dieses Mannes einbrechen, auch nicht, um dir Gewißheit zu verschaffen oder um dir zu beweisen, daß du das Sicherheitssystem in einem modernen Wolkenkratzer austricksen kannst.«
»Na schön.« Ich gab mir größte Mühe, nicht wie ein schmollendes Kind zu klingen.
»Versprichst du mir das, Victoria?« fragte Lotty mich mit grimmigem Blick.
Ich hielt die rechte Hand hoch. »Ehrenwort, ich verspreche dir, nicht in sein Büro einzubrechen.«
III
Sechs Tage später bekam ich einen Anruf in meinem Büro. Ein junger Mann mit so starkem italienischem Akzent, daß ich sein Englisch kaum verstehen konnte, fragte mich mit fröhlicher Stimme, ob ich seine »Kusine Vittoria« sei.
»Parliamo italiano«, sagte ich, und seine Stimme wurde noch fröhlicher, als er dankbar in seine Muttersprache wechselte.
Er sei mein Kusin Ludovico, Ururenkel unserer gemeinsamen Verazi-Vorfahren, erst am Vorabend von Mailand nach Chicago gekommen, ganz aufgeregt darüber, eine Verwandte mütterlicherseits gefunden zu haben und begeistert, daß ich italienisch konnte. Mein Akzent sei wirklich ganz, ganz schwach, er könne nur einen Hauch vom Amerikanischen wahrnehmen, und könnten wir uns treffen, egal, wo. Er würde schon hinfinden, wenn ich ihm eine Zeit nannte – je früher, desto besser.
Ich mußte lachen, als er mich mit seinem Wortschwall überschüttete, und ihn bitten, alles etwas langsamer noch einmal zu wiederholen. Es war lange her, daß ich italienisch gesprochen hatte, und ich brauchte Zeit, bis ich mich einhörte. Ludovico war im Garibaldi, einem kleinen Hotel an der Gold Coast, untergekommen, und würde sich sehr freuen, wenn ich mich dort um sechs auf einen Drink mit ihm treffen könnte. Ach ja, sein Familienname – er lautete Verazi, genau wie der unseres Urgroßvaters.
Ich erledigte, was zu tun war, effektiver als sonst, so daß ich noch Zeit hatte, die Hunde spazieren zu führen und mich umzuziehen, bevor ich mich mit ihm traf. Ich mußte über mich selbst lachen, weil ich mich mit so viel Sorgfalt kleidete. Ich wählte einen Hosenanzug aus lavendelfarbigem Knittersamt, in dem ich auch zum Tanzen gehen konnte, falls der Abend auf diese Weise enden sollte. Doch meine Selbstironie konnte meine Aufregung nicht kaschieren. Ich war ein Einzelkind gewesen und hatte, abgesehen von jeweils einem Kusin mütterlicher- und väterlicherseits, keine Verwandten gehabt. Mein Kusin Boom-Boom, den ich verehrt hatte, war bereits seit mehr als zehn Jahren tot, und Rosas Sohn Albert litt unter so vielen Angstneurosen, daß ich ihm lieber aus dem Weg ging. Jetzt würde ich also eine völlig neue Familie kennenlernen.
In meiner Aufregung führte ich einen kleinen Steptanz rund um Peppy auf. Die Hündin forderte mich mit einem gequälten Blick auf, sie wieder zu meinem unteren Nachbarn zurückzubringen. Ihr Sohn Mitch war bereits dort geblieben, als wir vom Joggen zurückgekommen waren.
»Sie schauen schick aus, Süße«, sagte Mr. Contreras, hin und her gerissen zwischen Bewunderung und Eifersucht. »Haben Sie ‘nen neuen Freund?«
»Einen neuen Kusin.« Ich führte meinen Steptanz vor seiner Tür auf dem Flur fort. »Tja. Endlich taucht der mysteriöse Verwandte auf. Ludovico Verazi.«
»Passen Sie auf, Süße«, sagte der alte Mann mit strenger Stimme. »Es gibt ‘ne Menge Schwindler da draußen, wissen Sie, die erzählen Ihnen, sie sind Ihr Kusin, und dann…«
»Bei mir gibt’s nicht viel zu holen. Höchstens meine Schmutzwäsche.« Ich gab ihm einen Kuß auf die Nase und tänzelte den Gehsteig entlang zu meinem Wagen.
Im kleinen Foyer des Garibaldi warteten drei Männer, doch ich wußte sofort, welcher mein Kusin war. Seine Haare waren bernsteinblond, nicht schwarz, doch das Gesicht sah aus wie das meiner Mutter, von der hohen, runden Stirn bis zu seinem breiten, sinnlichen Mund. Er sprang auf, als er mich entdeckte, ergriff meine Hände und gab mir ein Küßchen auf beide Wangen.