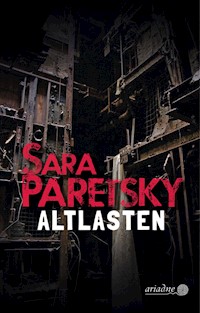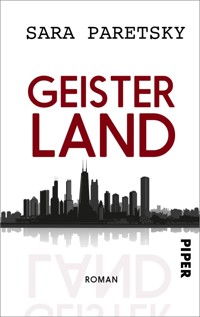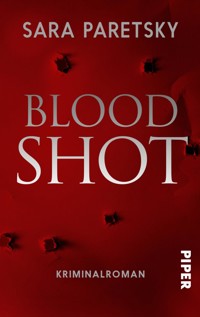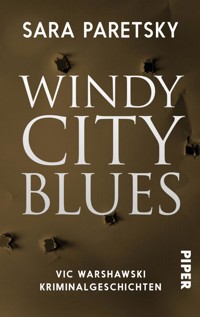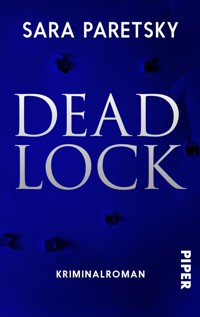
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Vic Warshawski, Chicagoer Privatdetektivin und Spezialistin für Wirtschaftskriminalität ermittelt in ihrem zweiten Fall! Champ, ehemaliger Eishockey-Star und der Lieblingsvetter von Privatdetektivin Vic Warshawski, gerät im Hafen von Chicago in die Schiffsschraube eines Getreidefrachters. »Ein bedauerlicher Unfall« meint sein Arbeitgeber, eine angesehene Reederei. Doch Vic ist misstrauisch: Je weiter sie ihre Nase in die Frachtschwindeleien steckt, desto tiefer gerät sie zwischen die Fronten der großen Reeder... »Vic ist die coole, starke Frau, von der wir alle ein bisschen träumen« Brigitte
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Katja Münch
ISBN 978-3-492-98372-3
© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2018
© 1984 Sara Paretsky
Published by arrangement with Sara and Two C-Dogs Inc.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Deadlock«
© The Dial Press,New York 1984
© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1988, 1998
Covergestaltung: Favoritbüro München
Covermotiv: Freedom Master/shutterstock
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Tod eines Helden
Verlorene Liebesmüh
Gedankenspiele
Hafenmilieu
Glück und Glas
Ein imposantes Schiff
Wächter, künd uns von der Nacht
Zunftgeheimnisse
Ein ganz gewöhnlicher Mord
Unter Deck
Außer Gefecht
Bettgespräche
Sherry in heiligen Hallen
Besser als gar nichts
Im kühlen Norden
Blinder Passagier
Deadlock
Der lange Heimweg
Pavane für einen toten Hockeyspieler
Entladung
Fischzug
Nächtliche Gaunerei
Ein Trauerhaus
Eine Frage der Taktik
Frauen unter sich
Versumpft
In der Höhle des Löwen
Wotans Abschied
Der lange Abschied
Dank
Widmung
Für die »Lucella Wieser«, eine seetüchtige und couragierte alte Dame, die länger als hundertsechs Jahre auf den Großen Seen ihren Dienst versah
Tod eines Helden
Mehr als tausend Leute waren auf Champs Beerdigung, darunter viele Kinder, seine Fans aus den Vororten und den vornehmeren Vierteln. Einige stammten aber auch aus der schäbigen South Side von Chicago, dorther, wo Champ Schlittschuh laufen und sich zu behaupten gelernt hatte. Er war Rechtsaußen bei den Black Hawks, bis er sich vor drei jahren beim Drachenfliegen den linken Knöchel brach. Und bevor Wayne Gretzky ihm den Rang streitig machte, galt er als der größte Champion seit Bobby Hull.
Er ließ sich drei Mal am Knöchel operieren, weil er einfach nicht glauben wollte, dass er nicht mehr aufs Eis konnte. Die Ärzte waren bereits bei der dritten Operation skeptisch gewesen, doch Champ fand sich erst mit den Tatsachen ab, als er niemanden mehr auftrieb, der bereit war, einen vierten Versuch zu riskieren. Danach nahm er wahllos eine Reihe von Jobs an. Etliche Leute waren willens, ihn dafür zu bezahlen, dass er seinen Namen zu Werbezwecken hergab, aber er war ein Mensch, der sich gern in eine Aufgabe hineinkniete – ganz gleich, in welche.
Schließlich landete er bei der Eudora-Getreideverschiffungsgesellschaft, bei der sein Vater in den dreißiger und vierziger Jahren als Schauermann gearbeitet hatte. Der Bezirksdirektor dieser Gesellschaft, Clayton Phillips, fand am vergangenen Dienstag Champs Leiche in der Nähe der Ladekais im Wasser treibend. Phillips versuchte mich telefonisch zu erreichen, da ich in Champs Personalunterlagen als seine nächste Verwandte aufgeführt war. Ich hatte jedoch während der letzten drei Wochen beruflich in Peoria zu tun. Noch bevor die Polizei mich ausfindig machte, hatte eine der zahlreichen Schwestern von Champs Mutter die Leiche identifiziert und war bereits dabei, ein pompöses polnisches Begräbnis zu inszenieren.
Champs Vater und meiner waren Brüder; zusammen wuchsen wir im Süden Chicagos auf. Wir waren beide Einzelkinder, standen uns aber näher als manche Geschwister. Meine Tante Marie, Polin und gute Katholikin, hatte unaufhörlich Kinder in die Welt gesetzt und war beim zwölften Versuch gestorben. Champ war das vierte und das einzige, das länger als drei Tage am Leben blieb.
Er spielte Eishockey von früher Kindheit an. Ich weiß nicht, woher er diesen Fimmel hatte – und auch die Begabung. Jedenfalls verbrachte er damals den größten Teil seiner Zeit damit, Mittel und Wege zu ersinnen, wie er trotz des Gejammers seiner Mutter, die überall Gefahren witterte, spielen konnte, ohne dass sie davon erfuhr. Häufig diente ein Besuch bei mir als Alibi – ich wohnte sechs Straßen weiter. In jenen Tagen schwärmten alle hockeybesessenen Jugendlichen für Champ Geoffrion. Mein Vetter bemühte sich, Geoffrions knallharten Schlag genau zu imitieren, sodass ihn die anderen Jungen, um ihm eine Freude zu machen, ebenfalls »Champ« nannten. Dieser Spitzname blieb ihm.
Als die Polizei von Chicago mich schließlich in meinem Hotel in Peoria erreichte und wissen wollte, ob ich Bernard Warshawskis Cousine sei, brauchte ich erst eine Weile, bis mir klar wurde, wen sie meinten.
Nun saß ich zusammen mit Champs schniefenden Tanten und Cousinen, von denen eine wie die andere aussah, in der vordersten Bankreihe von St. Wenzel. Sie waren alle in Schwarz und sichtlich pikiert, weil ich ein marineblaues Wollkostüm trug. Ich hielt den Blick fest auf die imitierten Tiffany-Fenster gerichtet, die in grellen Farben die Höhepunkte im Leben des heiligen Wenzel zeigten, und hoffte, dadurch einen hinreichend frommen Eindruck zu machen.
Ich komme aus keiner religiösen Familie. Meine italienische Mutter war Halbjüdin, mein Vater Pole, beide Nachkommen einer langen Reihe atheistischer Vorfahren. Sie hatten beschlossen, mir keinen Glauben aufzuzwingen. Die leidenschaftliche Religiosität von Champs Mutter und die billigen Gipsheiligen in ihrem Hause hatten mir als Kind immer Furcht eingeflößt.
Ich hätte eine schlichte Aussegnungsfeier in einer nicht konfessionsgebundenen Kapelle vorgezogen, in der Champs ehemalige Mannschaftskameraden Gelegenheit gehabt hätten, eine kleine Gedenkrede zu halten. Sie hatten die Tanten darum gebeten und eine Abfuhr erhalten. Ganz gewiss hätte ich nicht diese geschmacklose Kirche in unserer alten Wohngegend ausgewählt, deren Priester meinen Vetter überhaupt nicht gekannt hatte und der nun so scheinheilig und salbungsvoll von ihm sprach. Aber ich überließ die Begräbnisformalitäten seinen Tanten. Mein Vetter hatte mich zur Testamentsvollstreckerin bestellt – eine Aufgabe, die voraussichtlich mit großem Arbeitsaufwand verbunden war.
Nach der Begräbniszeremonie kämpfte sich Lieutenant Bob Mallory zu mir durch. Ich war auf dem Weg zu Champs Tante Helen, um dort den Nachmittag bei Piroschkis und Fleischklopsen zu verbringen. Fein, dass Bobby gekommen war: Er war ein alter Freund meines Vaters aus dessen Tagen bei der Chicagoer Polizei und der erste Mensch aus dem Viertel, über dessen Gegenwart ich mich wirklich freute.
»Die Sache mit Champ tut mir aufrichtig Leid, Vicki. Ich weiß, wie gern ihr euch hattet.«
Bobby ist der Einzige, dem ich gestatte, mich »Vicki« zu nennen. »Danke, Bobby. Es geht mir sehr nahe. Ich bin froh, dass du hier bist.«
Ein eisiger Aprilwind zerzauste mir das Haar und ließ mich in meinem Wollkostüm frösteln. Hätte ich doch einen Mantel angezogen! Mallory ging mit mir zu den Limousinen, die für den Transport der dreiundfünfzig Personen bereitstanden, die zur engsten Verwandtschaft gehörten. Die Beerdigungskosten würden vermutlich fünfzehntausend Dollar aus dem Nachlass verschlingen, aber das war mir gleichgültig.
»Gehst du auch zum Leichenschmaus? Kann ich mit dir fahren? Bei dem Haufen Leute passt sowieso keiner auf den anderen auf.«
Gutmütig wie er war, erklärte sich Bobby einverstanden. Er half mir auf den Rücksitz der Polizeilimousine und machte mich mit dem Fahrer bekannt: »Vicki, Officer Cuthbert gehörte zu Champs zahlreichen Fans.«
»Stimmt, Miss. Ich war richtig geknickt, als Cha-, Verzeihung, als Ihr Vetter plötzlich nicht mehr spielen konnte.«
»Nennen Sie ihn ruhig weiterhin Champ«, sagte ich. »Er mochte diesen Namen, und alle nannten ihn so … Bobby, ich hatte einen von der Verschiffungsgesellschaft an der Strippe, aber es ist mir nicht gelungen, aus dem Kerl irgendetwas herauszuholen. Wie ist Champ ums Leben gekommen?«
Er sah mich streng an. »Musst du das denn wirklich wissen, Vicki? Ich weiß, dass du dich für abgebrüht hältst, aber es wäre angenehmer für dich, Champ so in Erinnerung zu behalten, wie du ihn vom Eis her kennst.«
Ich presste die Lippen aufeinander; bei Champs Beerdigung wollte ich nicht aus der Rolle fallen. »Ich lechze nicht nach Blut, Bobby. Ich möchte nur gern wissen, was mit meinem Vetter passiert ist. Er war Sportler – ich kann mir schlecht vorstellen, dass er einfach ausgerutscht und hineingefallen ist.«
Bobbys Gesichtszüge entspannten sich. »Du meinst doch nicht etwa, er sei ins Wasser gegangen?«
Ich machte eine unbestimmte Handbewegung. »Er hat bei meinem telefonischen Auftragsdienst eine dringende Nachricht hinterlassen, während ich verreist war. Ich frage mich, ob er vielleicht über irgendetwas verzweifelt war.«
Bobby schüttelte den Kopf. »Dein Vetter war keiner von denen, die sich einfach vor den Bug eines Schiffes werfen. Das weißt du genauso gut wie ich.«
Ich war nicht scharf auf einen Vortrag über die Feigheit von Selbstmördern. »Ist das der Tatbestand?«
»Wenn dir die Getreideverschiffungsgesellschaft keine Auskunft geben wollte, so sicherlich nicht ohne Grund. Aber du kannst dich damit nicht abfinden, stimmt's?« Er seufzte. »Vermutlich wirst du deine Nase erst recht dort zur Tür hineinstecken, wenn ich es dir verschweige. Also, ein Schiff lag am Kai vor Anker, und Champ geriet in die Schraube, als es ablegte. Er wurde übel zugerichtet.«
»So war das also.« Ich schaute nach vorn auf den Eisenhower Expressway.
»Es war ein feuchter Tag, Vicki. Die Docks sind alt und aus Holz – sie werden bei Regen ganz schön glitschig. Ich habe den Bericht des Sachverständigen gelesen und denk' mir, dass Champ ausgerutscht ist. Dass er hineingesprungen ist, glaube ich nicht.«
Ich nickte und tätschelte seine Hand. Eishockey war Champs Lebensinhalt gewesen, und er hatte sich nur schwer mit seinem erzwungenen Ruhestand abgefunden. Ich teilte Bobbys Meinung, dass mein Vetter nicht zu denen gehörte, die einfach aufgaben. Doch während des letzten Jahres war eine gewisse Resignation bei ihm unübersehbar gewesen. Ob das ausgereicht hatte, um sich vor eine Schiffsschraube zu stürzen?
Ich versuchte, nicht mehr daran zu denken, als wir an dem gepflegten einstöckigen Ziegelhäuschen von Tante Helen vorfuhren. Tante Helen war einer Schar Polen aus dem Süden von Chicago nach Elmwood Park gefolgt. Ich glaube, es gab auch einen Ehemann, einen pensionierten Metallarbeiter, der sich aber – wie alle männlichen Wojciks – stets im Hintergrund hielt.
Cuthbert ließ uns vor dem Haus aussteigen und parkte die Limousine hinter einer langen Reihe von Cadillacs. Bobby begleitete mich zum Eingang, aber ich verlor ihn in der Menge bald aus den Augen.
Die nächsten beiden Stunden strapazierten mein Nervenkostüm über Gebühr. Einige Verwandte vertraten die Ansicht, es sei ein Jammer, dass Bernard trotz des Widerstandes der armen Marie darauf bestanden habe, Eishockey zu spielen. Andere sagten, es sei ein Jammer, dass ich mich von Dick hätte scheiden lassen und mir eine Familie fehlte, die mich auf Trab hielt – man brauche sich doch nur die Kleinen von Cheryl, Martha und Betty anzusehen. Das Haus quoll förmlich über vor Kindern; die Fruchtbarkeit der Wojciks war beängstigend. Ein Jammer auch, dass Champs Ehe nur drei Wochen gedauert hatte – aber er hätte ja nicht unbedingt Eishockey spielen müssen. Weshalb arbeitete er eigentlich bei der Eudora-Getreideverschiffungsgesellschaft? War nicht schon sein Vater daran gestorben, dass er sein Leben lang Getreidestaub eingeatmet hatte? Dabei waren diese Warshawskis sowieso nicht besonders robust.
Das kleine Haus war bald von Zigarettenrauch, dem schweren Essensgeruch polnischer Spezialitäten und dem Geplärr der Kinder erfüllt. Ich schob mich an einer Tante vorbei, die fand, man könne von mir wenigstens Hilfe beim Geschirrspülen erwarten, wenn ich mich schon nicht um die Beerdigung gekümmert hätte. Ich hatte mir zwar geschworen, beim Leichenschmaus nichts weiter von mir zu geben als »Ja« und »Nein« und »Ich weiß nicht«, aber allmählich fiel mir das immer schwerer. Zu guter Letzt packte Oma Wojcik, zweiundachtzigjährig, korpulent und in glänzendes Schwarz gehüllt, meinen Arm und hielt mich mit eisernem Griff fest. Sie sah mich aus wässrigen blauen Augen an, blies mir ihren Zwiebelatem ins Gesicht und sagte: »Die Mädels reden so allerlei über Bernard.« Die Mädels waren natürlich die Tanten. »Sie sagen, er habe dort unten bei den Silos ganz schön in der Patsche gesessen und habe sich vor das Schiff gestürzt, damit er nicht verhaftet würde.«
»Wer erzählt dir denn so was?«, fragte ich.
»Helen. Und Sarah. Cheryl sagt, dass Pete sagt, er sei einfach ins Wasser gesprungen, als niemand hinsah. Kein Wojcik hat je Selbstmord begangen. Aber die Warshawskis … Juden eben. Ich habe Marie immer wieder gewarnt.«
Ich löste ihre Finger von meinem Arm. Rauch, Lärm und der Dunst sauren Kohls umnebelten mein Gehirn. Ich beugte mich zu ihr hinunter, um eine bissige Bemerkung zu machen, besann mich jedoch anders. Ich bahnte mir einen Weg durch den Qualm, stolperte über kleine Kinder und fand die Männer in einer Ecke um einen Tisch versammelt, der mit Würstchen und Sauerkraut beladen war.
»Weshalb erzählst du herum, dass Champ sich vom Kai gestürzt hat? Woher willst du das überhaupt wissen?«
Pete, Cheryls Mann, glotzte mich mit seinen blauen Augen dämlich an. »He, Vic, reg dich ab! Ich hab's unten am Hafen gehört.«
»Wieso hat er in der Patsche gesessen? Oma Wojcik sagt, du erzählst überall herum, dass er da unten Ärger hatte.«
Pete nahm sein Bierglas in die andere Hand. »Es ist nur Gerede, Vic. Er ist mit seinem Chef nicht zurechtgekommen. Irgendjemand meinte, er habe Unterlagen gestohlen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Champ hatte das nicht nötig.«
Vor meinen Augen verschwamm alles, und mein Kopf dröhnte. »Es ist eine Lüge, verdammt noch mal! Champ hat nie in seinem Leben etwas Anrüchiges getan, nicht einmal, als er noch arm war!«
Die anderen starrten mich verlegen an. »Nimm's nicht so tragisch, Vic«, sagte einer. »Wir haben Champ alle gemocht. Pete hat doch gesagt, dass er es nicht glaubt. Reg dich nicht so auf.«
Er hatte recht. Was war überhaupt in mich gefahren, bei der Beerdigung so ein Theater zu machen? Ich kämpfte mich zur Eingangstür durch und trat hinaus in die kalte Frühlingsluft. Nach Hause! Aber mein Wagen stand vor meiner Wohnung in der North Side von Chicago. Und wie ich befürchtet hatte, waren Cuthbert und Mallory längst verschwunden. Während ich überlegte, ob ich mir ein Taxi suchen oder mit meinen hochhackigen Schuhen zum Bahnhof laufen sollte, trat eine junge Frau neben mich – klein und adrett, mit honigfarbenen Augen und glattem, dunklem, kurz geschnittenem Haar. Sie trug ein hellgraues Kostüm aus Shantungseide mit weitem Rock und einem Bolero, der mit großen Perlmuttknöpfen geschlossen war. Die ganze Person wirkte elegant und perfekt und kam mir irgendwie bekannt vor.
»Wo Champ jetzt auch sein mag – ich bin sicher, dass er lieber dort ist als hier.« Sie machte eine Kopfbewegung zum Haus hin und lächelte – ein flüchtiges, spöttisches Lächeln.
»Das glaube ich auch.«
»Sie sind seine Cousine, nicht wahr? Ich bin Paige Carrington.«
»Ach natürlich! Ich wusste doch, dass ich Sie irgendwoher kenne. Ich habe Sie ein paarmal auf der Bühne gesehen.« Paige Carrington war Tänzerin und hatte eine komische Solonummer beim Windy City Ballet.
Nun schenkte sie mir ihr publikumswirksames Schmollmundlächeln. »Ich war in den letzten Monaten eng mit Ihrem Vetter befreundet. Aber wir passten auf, dass nichts an die Öffentlichkeit und in die Klatschspalten kam. Ihr Vetter war immer noch interessant, auch wenn er nicht mehr Eishockey spielte.«
Sie hatte recht. Ich fand Champs Namen ständig in der Zeitung. Es ist eine komische Sache, eine Berühmtheit gut zu kennen. Man bekommt eine Menge darüber zu lesen, aber der Mensch, über den berichtet wird, hat wenig zu tun mit dem, den man kennt.
»Ich glaube, Champ mochte Sie ganz besonders gern.« Stirnrunzelnd dachte sie über diese Bemerkung nach. Selbst das Stirnrunzeln war perfekt. Man hatte den Eindruck, als denke sie sehr genau über eine Sache nach. Dann lächelte sie etwas wehmütig. »Ich glaube, wir haben uns geliebt, aber ganz sicher weiß ich's nicht. Nun werde ich es nie mehr erfahren.«
Ich murmelte etwas Besänftigendes. »Champ hat viel von Ihnen erzählt. Schade, dass er uns nie miteinander bekannt gemacht hat.« »Ja. Ich hatte ihn monatelang nicht gesehen … Fahren Sie in die Stadt zurück? Könnten Sie mich vielleicht mitnehmen? Ich musste im Leichenzug mitgehen – mein Wagen steht in der North Side.«
Sie schob die weiße Seidenmanschette zurück und sah auf die Uhr. »In einer Stunde habe ich Probe. Ist es Ihnen recht, wenn ich Sie in der Innenstadt absetze?«
»Das wäre fantastisch. Ich komme mir hier draußen in der Vorstadt ganz verloren vor.«
Sie lachte. »Das kann ich mir gut vorstellen. Ich bin in Lake Bluff aufgewachsen. Aber wenn ich jetzt mal hinkomme, habe ich das Gefühl, ich kriege keine Luft mehr.«
Ich warf einen Blick auf das Haus und fragte mich, ob ich mich förmlich verabschieden sollte. Ich beschloss, es sei nicht erforderlich, zuckte die Achseln und folgte Paige Carrington.
Sie fuhr einen silbernen Audi 5000. Entweder zahlte das Windy City Ballet besser als die um ihre Existenz kämpfenden Durchschnittsbühnen, oder ihre Sippe in Lake Bluff finanzierte Shantungkostüme und Sportwagen ausländischer Herkunft. Paige chauffierte mit der gleichen präzisen Grazie, die auch ihrem Tanzstil eigen war. Da sich keiner von uns beiden in der Gegend auskannte, verfuhr sie sich einige Male in den gleichförmigen Häuserzeilen, bis sie eine Ausfahrt zum Eisenhower Expressway fand.
Auf dem Weg in die Stadt war sie sehr einsilbig. Auch ich war schweigsam und dachte an Champ – traurig und schuldbewusst. Mir wurde klar, dass ich deshalb diesen beschränkten Klötzen von Verwandten gegenüber die Beherrschung verloren hatte. Ich hatte mich nicht um Champ gekümmert, obwohl ich wusste, dass ihn etwas bedrückte. Wie hatte ich bloß verreisen können, ohne beim telefonischen Auftragsdienst meine Nummer zu hinterlassen? War er denn so sehr verzweifelt gewesen? Vielleicht hatte er darauf vertraut, dass die Liebe ihm helfen würde, und war bitter enttäuscht worden. Möglicherweise war auch das Gerede in den Docks daran schuld. Er hatte vielleicht geglaubt, sich mit meiner Hilfe zur Wehr setzen zu können, wie schon so oft. Doch ich war unerreichbar für ihn gewesen.
Mit seinem Tod hatte ich das letzte Mitglied meiner Familie verloren. Es gab zwar noch eine Tante meiner Mutter in Melrose Park, aber ich kannte sie kaum, und weder sie noch ihr schwabbeliger, eingebildeter Sohn kamen mir wie echte Verwandte vor. Champ und ich dagegen hatten miteinander gespielt und gerauft, und einer hatte den andern beschützt. Wenn wir auch in den letzten zehn Jahren nicht viel Zeit zusammen verbracht hatten, so konnten wir uns doch stets darauf verlassen, dass der andere im Notfall zur Verfügung stand. Ich hatte nicht zur Verfügung gestanden.
Als wir uns dem Schnellstraßenkreuz 1–90/94 näherten, klatschten Regentropfen gegen die Windschutzscheibe und störten mich auf aus meinen fruchtlosen Gedanken. Mir wurde bewusst, dass Paige mich forschend ansah. Mit hochgezogenen Augenbrauen wandte ich mich ihr zu.
»Sie sind Champs Testamentsvollstreckerin?«
Ich nickte. Sie trommelte mit den Fingern auf das Lenkrad. »Meine Beziehung zu Champ hatte noch nicht das Stadium erreicht, in dem man Wohnungsschlüssel austauscht.« Sie lächelte verlegen. »Ich würde gern ein paar persönliche Dinge aus seiner Wohnung holen.«
»Gern. Ich hatte vor, morgen Nachmittag seine Papiere durchzusehen. Wollen wir uns um zwei dort treffen?«
»Danke. Nett von Ihnen … Darf ich Sie Vic nennen? Champ hat so oft von Ihnen gesprochen, dass ich das Gefühl habe, Sie schon lange zu kennen.«
Wir fuhren gerade unter der Hauptpost durch, in deren Fundament man eine sechsspurige Autobahn eingeschnitten hatte. Paige nickte bekräftigend mit dem Kopf. »Und Sie müssen mich Paige nennen.« Sie wechselte die Spur, manövrierte den Audi um einen Wagen der Müllabfuhr und bog nach links in die Wabash Avenue ein. Sie setzte mich vor meinem Büro ab – am Pulteney-Gebäude an der Kreuzung Wabash Avenue/Monroe Street. Über uns donnerte die Hochbahn hinweg. »Wiedersehen!«, schrie ich durch das Getöse. »Bis morgen um zwei!«
Verlorene Liebesmüh
Als Eishockeyspieler hatte Champ bei den Hawks eine Menge Geld verdient. Einen beachtlichen Teil davon hatte er vor fünf Jahren in eine Eigentumswohnung in einem schicken Glaspalast am Lake Shore Drive nördlich der Chestnut Street investiert. Seither war ich einige Male dort gewesen, häufig mit einer Schar gutmütiger beschwipster Hockeyspieler.
Champs Anwalt, Gerald Simonds, übergab mir die Hausschlüssel sowie die Schlüssel für den Jaguar meines Vetters. Am Vormittag hatten wir uns mit seinem Testament befasst – einem Dokument, das höchstwahrscheinlich für weiteren Aufruhr unter den Tanten sorgen würde; denn Champ hatte den Löwenanteil seines Vermögens karitativen Einrichtungen und dem Pensionsfonds der Hockeyspieler-Witwen vermacht. Die Tanten wurden nicht einmal erwähnt. Mir selbst hinterließ er eine gewisse Summe mit der Aufforderung, nicht alles in Black Label anzulegen. Simonds legte seine Stirn missbilligend in Falten, als ich lachte. Er erklärte mir, dass er vergeblich versucht habe, Champ davon abzuhalten, diese Klausel einzufügen.
Gegen Mittag waren wir fertig. Für einen meiner Mandanten hatte ich zwar ein paar Kleinigkeiten im Bankenviertel zu erledigen, doch standen, abgesehen von einigen Gerichtsverhandlungen, im Augenblick keine interessanten Fälle an. Lediglich einen Mann musste ich noch aufspüren, der mit der Hälfte des Firmenvermögens einer Handelsgesellschaft verschwunden war, wozu auch eine Zwölf-Meter-Jacht gehörte. Nichts Eiliges also. Ich holte meinen Wagen – einen grünen Mercury Lynx – vom Parkplatz des Fort Dearborn Trust und fuhr los in Richtung Goldküste.
Wie in den meisten feudalen Wohnanlagen gab es auch in Champs Haus einen Portier, einen untersetzten Mann mittleren Alters, der bei meiner Ankunft gerade einer alten Dame aus ihrem Seville half und mir keine besondere Aufmerksamkeit schenkte. Ich musste ein bisschen mit den Schlüsseln herumprobieren, bis ich den richtigen für die Eingangstür fand.
Die Halle war nicht sehr groß. Einige Topfpflanzen und zwei cremefarbene Sofas standen herum, und über diesen hing ein Wandbehang. Ich studierte ihn eingehend, während ich auf den Lift wartete, und beglückwünschte mich dazu, dass ich in einem abgewohnten dreistöckigen Gebäude hauste, in dem es keine Miteigentümer gab, die über die Ausgestaltung der Halle zu befinden hatten.
Hinter mir glitt die Lifttür leise zurück. Eine Frau meines Alters im Jogginganzug trat heraus, gefolgt von zwei etwas älteren Damen, die sich darüber unterhielten, wo sie zu Mittag essen wollten. Ich sah auf die Uhr: Viertel vor eins. Wieso arbeiteten diese Leute eigentlich nicht an einem ganz gewöhnlichen Dienstag? Seltsam! Ich drückte auf die 22, und der Lift trug mich rasch und geräuschlos nach oben.
Auf jedem Stockwerk befanden sich vier Eigentumswohnungen. Champ hatte über eine Viertelmillion Dollar für seine Eckwohnung auf der Nordostseite ausgegeben. Sie war ungefähr hundertfünfzig Quadratmeter groß, mit drei Schlafzimmern und drei Bädern, eines davon – vom Hauptschlafraum zu erreichen – mit in den Boden eingelassener Wanne. Nach Norden wie nach Osten hatte man einen herrlichen Ausblick auf den Michigansee.
Ich schloss die Wohnungstür zu Nummer 22 C auf und ging direkt ins Wohnzimmer. Der hochflorige Teppiehboden verschluckte meine Schritte. Von der Glaswand der Ostseite waren die blaubedruckten Vorhänge zurückgezogen worden. Der Panoramablick verschlug mir den Atem – Wasser und Himmel verschmolzen zu einer riesenhaften graugrünen Kugel. Ich überließ mich dem überwältigenden Eindruck, bis ich ein Gefühl tiefen Friedens empfand. Plötzlich hatte ich das unbestimmte Empfinden, dass ich nicht allein in der Wohnung war. Schließlich nahm ich ein leichtes Geräusch wahr – das Rascheln von Papier.
Ich ging auf den Gang hinaus und stellte fest, dass das Geräusch von rechts kam. Zu meinem Termin mit Simonds hatte ich ein Kostüm angezogen und hochhackige Schuhe – völlig ungeeignete Kleidungsstücke, wenn man einen Einbrecher stellen wollte. Ich streifte die Schuhe ab, machte leise die Wohnungstür auf, um mir einen Fluchtweg offen zu halten, und stellte meine Handtasche im Gang neben einen Zeitungsständer. Dann sah ich mich im Wohnzimmer nach einer brauchbaren Waffe um. Ein Bronzepokal auf dem Kaminsims fiel mir ins Auge, eine Anerkennung für Champs besondere Verdienste beim Gewinn des Stanley Cup. Ich holte ihn lautlos herunter und schlich in Richtung Schlafzimmer.
Sämtliche Türen im Gang standen offen. Auf Zehenspitzen näherte ich mich dem ersten Raum, Champs Arbeitszimmer. Flach gegen die Wand gepresst, in der rechten Hand fest den schweren Pokal, so steckte ich meinen Kopf vorsichtig durch die Tür.
Mit dem Rücken zu mir saß Paige Carrington an Champs Schreibtisch und kramte in irgendwelchen Papieren. Ich kam mir albern vor, und gleichzeitig ärgerte ich mich. Lautlos zog ich mich zurück, stellte den Pokal auf einem Beistelltischchen ab und schlüpfte in meine Schuhe.
»Sie sind früh dran«, sagte ich, als ich das Arbeitszimmer betrat. »Wie sind Sie denn hereingekommen?«
Sie schreckte hoch, und einige Papiere glitten ihr aus der Hand. Röte überzog ihr Gesicht bis zum Haaransatz. »Oh! Ich habe Sie nicht vor zwei erwartet.«
»Ich Sie auch nicht. Ich dachte, Sie hätten keinen Schlüssel?« »Seien Sie mir nicht böse, Vic. Für zwei Uhr wurde eine zusätzliche Probe angesetzt, und ich wollte unbedingt meine Briefe finden. Deshalb habe ich Hinckley – das ist der Portier – überredet, mir die Wohnung aufzuschließen.« Einen Augenblick lang hatte ich den Eindruck, in ihren honigfarbenen Augen Tränen zu sehen, doch sie wischte mit dem Handrücken darüber und lächelte schuldbewusst. »Ich hatte gehofft, ich sei vor Ihrem Eintreffen wieder verschwunden. Die Briefe sind nämlich sehr persönlich. Ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass jemand sie liest – selbst wenn Sie es gewesen wären.« Sie streckte mir flehend die rechte Hand entgegen.
Ich sah sie mit zusammengezogenen Augenbrauen an. »Haben Sie etwas gefunden?«
Sie zuckte die Achseln. »Vielleicht hat er sie nicht aufbewahrt.« Sie bückte sich, um die Papiere aufzuheben. Ich kniete mich auf den Boden und wollte ihr helfen. Es schien sich um Geschäftsbriefe zu handeln, denn Myron Fackleys Name fiel mir mehrmals auf. Er war Champs Manager gewesen.
»Ich bin erst bei der zweiten Schublade, und es gibt noch sechs, die voller Papierkram sind. Ich glaube, er hat einfach alles aufgehoben – in einer Schublade ist nur Fanpost.«
Verflixt! Acht Schubladen voller Papiere! Einordnen und Sortieren hatten von jeher zu meinen schwachen Seiten gezählt.
Ich setzte mich auf die Schreibtischkante und legte Paige die Hand auf die Schulter. »Sehen Sie, ich muss ohnehin sämtliche Unterlagen sichten, die den Nachlass betreffen könnten. Überlassen Sie das Suchen doch einfach mir. Ich verspreche Ihnen, Ihre Privatbriefe an Champ nicht zu lesen, falls sie auftauchen sollten. Ich stecke sie in einen Umschlag.«
Sie lächelte unsicher. »Vielleicht ist es Eitelkeit – aber wenn er sogar bündelweise Briefe von Kindern aufbewahrt hat, die er gar nicht kannte, dachte ich mir, dass er meine Briefe auch aufgehoben hat.« Sie wandte sich ab.
Ich versuchte sie zu beruhigen. »Keine Sorge, Paige, Sie tauchen bestimmt noch auf.«
Sie schniefte dezent. »Ich glaube, ich bin nur deshalb so hinter ihnen her, weil ich dann nicht ständig daran denken muss, dass er wirklich … nicht mehr da ist.«
»Das versteh' ich. Und ich bin wütend auf ihn, weil er alles gesammelt hat wie ein Eichhörnchen.«
Sie lachte ein wenig. »Ich habe einen Koffer mitgebracht. Am besten, ich packe meine Kleider und Kosmetika, die noch hier sind, zusammen und verschwinde«, erklärte sie und ging hinüber ins Schlafzimmer.
Ich überlegte, wie ich an meine Arbeit herangehen sollte. Paige hatte recht: Champ hatte einfach alles aufgehoben. Jeder Quadratzentimeter Wandfläche war mit Fotos von seiner Eishockeykarriere bedeckt, angefangen bei der Schulmannschaft der zweiten Klasse. Mitten darunter entdeckte ich ein Foto von mir im kastanienbraunen Talar bei der Verleihung meines Juradiploms an der Universität von Chicago. Die Sonne schien, und ich grinste in die Kamera. Da mein Vetter nie ein College besucht hatte, war er über alle Maßen stolz auf meine akademische Ausbildung. Stirnrunzelnd betrachtete ich die jüngere, glückstrahlende V.I. Warshawski, bevor ich zu Paige ins Schlafzimmer ging, um ihr meine Hilfe anzubieten.
Der Koffer mit den sauber gefalteten Kleidungsstücken stand offen auf dem Bett. Als ich eintrat, zog sie gerade aus einer Kommodenschublade einen leuchtend roten Pullover hervor.
»Sehen Sie auch seine Kleidung und die übrigen Sachen durch? Geben Sie mir doch bitte Bescheid, falls ich etwas vergessen habe. Alles in Größe sechs gehört vermutlich mir.« Daraufhin nahm sie sich das Bad vor. Ich hörte, wie sie Schränkchen öffnete.
Dem Schlafzimmer sah man an, dass hier ein Mann gewohnt hatte, aber es war gemütlich. Ein riesiges Bett mit schwarz-weißem Bettüberwurf beherrschte die Zimmermitte, die schweren bodenlangen cremefarbenen Vorhänge waren zurückgezogen und gaben den Blick auf den See frei. Über der wuchtigen Kommode aus Walnussholz hing Champs Eishockeyschläger. Ein Gemälde in Lila- und Rottönen brachte Farbe ins Zimmer. Auf Spiegel, die nach Ansicht zahlreicher Junggesellen unbedingt in eine Wohnung gehören, hatte er verzichtet. Auf dem Nachttisch lagen ein paar Zeitschriften. Was wohl mein Vetter vor dem Einschlafen so gelesen hatte? Die »Sportillustrierte«, die »Hockey-Welt« sowie eine eng bedruckte Schrift mit dem Titel »Getreide-Nachrichten«. Das machte mich neugierig. Das Blatt erschien in Kansas City und enthielt eine Unmenge detaillierter Informationen über Ernteerträge, Notierungen an verschiedenen Getreidebörsen, Frachtkosten zu Lande und zu Wasser, Abschlüsse mit diversen Transportunternehmen. Äußerst informativ, falls man sich für Getreide interessierte.
»Ist das irgendetwas von Bedeutung?«
Ich war so in die Lektüre vertieft gewesen, dass ich gar nicht bemerkt hatte, wie Paige ins Zimmer gekommen war. Nach kurzem Zögern sagte ich: »Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, ob Champ sich womöglich absichtlich vor die Schiffsschraube gestürzt hat. Dieses Ding hier«, ich hielt ihr das Blatt hin, »dieses Ding enthält alles Wissenswerte über Getreide und Frachtverkehr. Es erscheint offenbar zwei Mal monatlich und während der Erntezeit wöchentlich. Wenn Champ sich bei der Eudora so stark engagiert hatte, dass er sogar eine Fachzeitschrift las, dann bin ich in gewisser Weise beruhigt.«
Paige sah mich aufmerksam an. Sie nahm mir die »Getreide-Nachrichten« aus der Hand und blätterte sie durch. Auf die Seiten starrend, bemerkte sie: »Es ging ihm sehr nahe, dass er nicht mehr spielen konnte – mir wäre bestimmt auch nicht anders zu Mute, wenn ich nicht mehr tanzen könnte, obwohl ich als Tänzerin lange nicht so gut bin wie er als Eishockeystar. Doch ich glaube, dass ihm seine Beziehung zu mir über die schlimmsten Depressionen hinweggeholfen hat. Hoffentlich sind Sie deswegen nicht gekränkt.«
»Ganz und gar nicht. Es würde mich freuen, wenn es so wäre.«
Ihre zart nachgezogenen Brauen hoben sich. »Wenn es so wäre? Was meinen Sie damit? Könnten Sie mir das bitte erklären?«
»Da gibt es nichts zu erklären, Paige. Ich hatte Champ seit Januar nicht gesehen. Damals kämpfte er noch gegen seine Zustände an. Sollte ihm Ihre Beziehung dabei geholfen haben, so wäre ich sehr froh … Bei der Beerdigung munkelte man, er sei bei seiner Firma in Schwierigkeiten geraten. Angeblich hat er irgendwelche Unterlagen gestohlen. Hat er Ihnen gegenüber etwas davon erwähnt?«
Die honigfarbenen Augen wurden groß und rund. »Nein. Kein Wort. Wenn es wirklich Gerüchte gab, dann hat er sich bestimmt nicht darüber aufgeregt, sonst hätte er wohl darüber gesprochen. Wir waren noch einen Tag vor seinem Tod zusammen essen. Außerdem hätte ich es sowieso nicht geglaubt.«
»Wissen Sie, worüber er mit mir reden wollte?«
Sie blickte überrascht auf. »Hat er versucht, Sie zu erreichen?« »Er hinterließ eine dringende Nachricht bei meinem telefonischen Auftragsdienst, sagte aber nicht, worum es ging. Ich habe mich schon gefragt, ob er vielleicht meine Hilfe als Detektivin gebraucht hätte – wegen dem Gerede auf den Ladekais.«
Sie schüttelte den Kopf und spielte nervös mit dem Reißverschluss ihrer Handtasche. »Keine Ahnung. Am Montagabend schien er völlig in Ordnung. Aber ich muss jetzt weg. Tut mir Leid, wenn ich Sie vorhin erschreckt habe.«
Ich begleitete sie zur Wohnungstür, ließ sie hinter ihr ins Schloss fallen und schob den Sicherheitsriegel vor. Wäre ja noch schöner, wenn der Portier ohne mein Wissen Besucher in die Wohnung ließe – noch dazu während meiner Anwesenheit.
Bevor ich mich der langweiligen Aufgabe widmete, Champs Papiere zu ordnen, sah ich mich kurz in der Wohnung um. Im Gegensatz zu mir war er von überwältigender Ordnungsliebe. Bei mir würde man in einer vergleichbaren Situation unangenehme Überraschungen im Ausguss finden, ganz zu schweigen von einer beachtlichen Staubschicht und einem Sammelsurium von Kleidungsstücken und Zeitungen im Schlafzimmer.
Champs Küche war makellos, der Kühlschrank innen so sauber wie außen. Ich inspizierte den Inhalt und sortierte verfaultes Gemüse aus. Acht Liter Milch landeten im Ausguss – anscheinend hatte er gewohnheitsmäßig Milch weitergetrunken, obwohl er nicht mehr trainierte. Herr Saubermann. So hatte ich Champ oft im Scherz genannt. Bei der Erinnerung an diese Worte bekam ich ein flaues Gefühl im Magen. Ja, so geht es einem, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Bei meinen Eltern hatte ich das Gleiche durchgemacht. Man besinnt sich immer wieder auf Kleinigkeiten, und es dauert seine Zeit, bis die Erinnerung nicht mehr schmerzt.
Ich kehrte ins Arbeitszimmer zurück und machte mich systematisch über die Schubladen her – von links nach rechts, von oben nach unten. Wenn schon, denn schon. Zum Glück war mein Vetter nicht nur eine Eichhörnchennatur, sondern auch ein Ordnungsfanatiker. In sämtlichen acht Schubladen befanden sich sauber beschriftete Ordner.
Die linke obere Schublade war voll gepfropft mit Fanpost. Da ich den Strom der Trauergäste erlebt hatte, überraschte mich die Menge nicht mehr. Noch immer erhielt er drei oder vier Briefe pro Woche, meist in mühsam gedrechselter Knabenschrift.
Quer über jedem einzelnen Brief war säuberlich Datum und Art der Antwort vermerkt, zum Beispiel: »26. März: Autogrammfoto übersandt« oder »Myron telefonisch gebeten, Vortragstermin zu vereinbaren«. Viele High Schools wünschten, dass er bei Abschlussfeiern oder festlichen Sportveranstaltungen eine kleine Rede hielt.
Die nächste Schublade enthielt Unterlagen über Champs Werbeverträge. Die musste ich mit Fackley und Simonds gemeinsam sichten. Mein Vetter hatte verschiedene Werbespots für die Amerikanische Molkereigenossenschaft gemacht. Das war möglicherweise die Erklärung für seine Milchvorräte – ein Getränk, für das man warb, musste man auch selbst trinken. Außerdem gab es noch den Warshawski-Hockeyschläger, eine Trainingsjacke mit seinem Namenszug sowie eine Werbung für Schlittschuhe.
Um fünf durchstöberte ich die Küche nach Kaffee, kochte mir eine Kanne und nahm sie mit ins Arbeitszimmer. Um halb neun entdeckte ich Champs Alkoholvorräte in einem geschnitzten chinesischen Schränkchen im Wohnzimmer und schenkte mir einen Chivas ein – nicht gerade meine Lieblingsmarke, aber ein zufriedenstellender Ersatz für Black Label.
Gegen zehn war ich rundum von Papierstößen umgeben. Ein Stoß für Fackley, seinen Manager. Einen für Simonds, seinen Anwalt. Mehrere Stöße für die Mülltonne. Einige Kleinigkeiten, die für mich Erinnerungswert hatten. Andere, die für Paige von Interesse sein konnten. Ein paar Andenken für die Hockey-Ruhmeshalle in Eveleth, Minnesota, und Verschiedenes für die Black Hawks.
Ich war müde. Meine olivfarbene Seidenbluse wurde von einem Ölfleck verunziert; meine Strümpfe bestanden nur noch aus Laufmaschen. Ich hatte Hunger. Vielleicht würde mich etwas zu essen wieder aufrichten. Paiges Briefe waren nicht aufgetaucht. Auf alle Fälle hatte ich mich durch sämtliche Schubladen gearbeitet, einschließlich der Schreibtischfächer. Was hatte ich denn bloß zu finden gehofft? Unvermittelt stand ich auf und zwängte mich an den Papierstößen vorbei zum Telefon. Ich wählte eine Nummer, die ich auswendig kannte.
»Doktor Herschel.«
»Lotty, ich bin's, Vic«, sagte ich, erleichtert darüber, dass sie zu Hause war. »Ich habe Champs Papiere durchgesehen und bin am Boden zerstört. Hast du schon gegessen?«
Sie hatte bereits vor mehreren Stunden zu Abend gegessen, verabredete sich jedoch mit mir auf einen Kaffee im Chesterton Hotel, wo ich eine Kleinigkeit zu mir nehmen konnte.
Bevor ich das Gebäude verließ, wollte ich noch mit Hinckley sprechen. Er hatte jedoch schon lange Feierabend. Ein müder alter Farbiger versah den Nachtdienst. Wie ein Wachmann saß er hinter einem Pult und beobachtete über Dutzende von Bildschirmen die Straße, die Garage und jedes der dreißig Stockwerke. Er blickte mich ausdruckslos an, als ich ihm auseinander setzte, wer ich war. Ich hielt ihm die von Simonds ausgestellte Vollmacht unter die Nase und erklärte, dass ich hier so lange aus und ein gehen würde, bis der Nachlass meines Vetters geordnet und die Wohnung verkauft war. Er zeigte sich völlig unbeeindruckt. Regungslos starrte er mich aus seinen braunen Augen mit den altersgelben Augäpfeln an.
Ich musste mich bemühen, nicht die Beherrschung zu verlieren. »Der diensthabende Pförtner hat heute Nachmittag jemanden in die Wohnung gelassen. Würden Sie bitte dafür sorgen, dass niemand mehr Zutritt bekommt, wenn ich nicht dabei bin?«
Er starrte mich immer noch an. Ich spürte, wie mir der Ärger die Röte ins Gesicht trieb. Brüsk wandte ich mich um und ließ ihn vor seinen Bildschirmen sitzen.
Gedankenspiele
»Wonach hast du denn gesucht?«, fragte Lotty, während sie ihren Kaffee schlürfte. Ihre wachen schwarzen Augen sahen mich prüfend, aber liebevoll an.
Ich aß einen Bissen von meinem Sandwich – hausgebackenes Roggenbrot mit Emmentaler. »Ich weiß selbst nicht. Vermutlich bin ich schon zu lange in meinem Beruf. Ständig erwarte ich, verborgene Geheimnisse in den Schreibtischen anderer Leute zu finden.«
Wir saßen im Dortmunder Restaurant im Souterrain des Chesterton Hotels. Aus den Weinregalen entlang der Wände hatte ich eine halbe Flasche Pomerol ausgewählt. Die Bedienung kennt dort keine Eile; man ist auf alte Damen eingestellt, die im Hotel wohnen und sich nachmittags die Zeit bei Kaffee und Kuchen vertreiben.
»Meine Liebe, ich will dich beileibe nicht drängen, wenn du nicht darüber reden möchtest. Aber du ordnest doch niemals Papiere. Selbst die deines Vetters würdest du dem Anwalt überlassen, wenn du nicht gehofft hättest, etwas zu finden. Demnach geht es um etwas Wichtiges, stimmt's?«
Lotty ist Österreicherin, hat aber ihre Jugend in London verbracht, und noch heute ist ihrem präzisen Englisch ein leichter Wiener Akzent anzuhören. Wir sind seit Langem befreundet.
Ich aß den letzten Bissen meines Sandwichs und trank einen Schluck Wein; dann hielt ich das Glas gegen das Licht und starrte gedankenverloren in das leuchtende Rot.
»Champ hinterließ eine dringende Nachricht bei meinem Auftragsdienst. Ich weiß nicht, ob er nur fürchterlich deprimiert war oder bei der Eudora Schwierigkeiten hatte. Jedenfalls war das gar nicht seine Art.« Ich starrte in mein Weinglas. »Lotty, ich habe nach einem Brief gesucht, in dem gestanden hätte: ›Liebe Vic, man hat mich beschuldigt, irgendwelche Papiere entwendet zu haben. Zu meinem kaputten Knöchel hat mir das gerade noch gefehlt. Das alles macht mich so fertig, dass ich nicht mehr weiterweiß.‹ Oder: ›Liebe Vic, ich bin in Paige Carrington verliebt. Das Leben ist wundervoll!‹ Paige behauptet das jedenfalls, und vielleicht stimmt's auch. Aber sie ist so – so … ich weiß nicht – irgendwie künstlich. Oder mindestens perfekt. Die Vorstellung, dass er in sie verliebt gewesen sein könnte, fällt mir äußerst schwer. Er fühlte sich eher zu natürlichen Frauen hingezogen.«
Lotty setzte ihre Tasse ab und legte ihre breite, kraftvolle Hand über meine. »Du bist doch nicht etwa eifersüchtig?«
»Doch, ein wenig. Allerdings nicht so, dass es mein Urteilsvermögen beeinträchtigen könnte. Vielleicht bin ich auch nur egozentrisch. Zwei Monate lang habe ich ihn nicht angerufen. Das geht mir nicht aus dem Kopf. Wir hatten zwar oft monatelang keinen Kontakt, doch ich werde das Gefühl nicht los, dass ich ihn im Stich gelassen habe.«
Der Druck auf meine Finger wurde stärker. »Champ wusste, dass er auf dich zählen konnte, Vic. Du weißt doch selbst, dass es so war. Er rief bei dir an. Und er wusste, dass du dich bei ihm melden würdest, selbst wenn er einige Tage warten musste.«
Ich entzog ihr meine Hand und fasste nach meinem Weinglas. Nachdem ich getrunken hatte, fühlte ich mich besser. Mein Blick ging zu Lotty hinüber. Sie lächelte mich verschmitzt an.
»Du bist Detektivin, Vic. Wenn du wirklich hundertprozentige Klarheit über Champs Tod haben möchtest, kannst du ja Ermittlungen anstellen.«
Hafenmilieu
Die Silos der Eudora-Getreideverschiffungsgesellschaft lagen inmitten des Labyrinths, aus dem der Hafen von Chicago besteht. Das Hafengelände folgt den Windungen des Calumet River zehn Kilometer weit nach Süden und Westen. Jeder Getreidesilo und jede Fabrik verfügt über eine eigene Zufahrtsstraße, doch keine davon ist deutlich gekennzeichnet.
Die fünfunddreißig Kilometer von meiner Wohnung in der North Side bis zur 130sten Straße brachte ich rasch hinter mich. Gegen acht Uhr bog ich ab, verfuhr mich jedoch, sodass es bereits halb zehn war, als ich endlich das Büro der Eudora erreichte.
Das Verwaltungsgebäude, ein moderner einstöckiger Kasten, lag am Fluss, und dahinter, im rechten Winkel dazu, ragte ein riesiger Silo auf, der aus fast zweihundert Rundbehältern von der Höhe zehnstöckiger Häuser bestand. Am Ufer befand sich ein Schlipp, wo Schiffe festmachen konnten. Rechts führten Eisenbahnschienen in einen Lagerschuppen. Ein paar Selbstentladewagen standen bereit, und eine kleine Gruppe von Männern mit Schutzhelmen machte einen an einem Lastenaufzug fest. Fasziniert beobachtete ich den Vorgang: Der Wagen entschwand nach oben und im Silo. Ganz links sah ich das Heck eines Schiffs hervorlugen. Offensichtlich wurde hier Getreide verladen.
Das Bürogebäude verfügte über eine modern eingerichtete Eingangshalle; aus den großen Fenstern sah man auf den Fluss. An den Wänden hingen zahlreiche Bilder zum Thema Getreideernte – Mähdrescher, kleinere Ausgaben der Mammutsilos hier im Hafen, Transportzüge, die den goldenen Schatz aufnahmen, Schiffsfracht, die gelöscht wurde. Hinter einem Marmortisch saß in der Mitte des Raumes die Empfangsdame. Sie war jung und eifrig bemüht, mir behilflich zu sein. Nach einer lebhaften Debatte mit seiner Sekretärin spürte sie den Bezirksdirektor Clayton Phillips auf. Er empfing mich im Foyer.
Phillips, schätzungsweise Anfang Vierzig, mit flachsblondem Haar und hellbraunen Augen, wirkte ziemlich steif. Er war mir von vornherein unsympathisch – möglicherweise deshalb, weil er mir zu Champs Tod nicht sein Beileid aussprach, obgleich ich mich ihm als nächste Verwandte vorgestellt hatte. Bei der Vorstellung, ich könne drüben am Silo Fragen stellen, geriet er beinahe aus der Fassung, andererseits brachte er es nicht fertig, Nein zu sagen. Eiskalt ließ ich ihn zappeln. Er hatte die irritierende Angewohnheit, die Augen unstet durch den Raum schweifen zu lassen, wenn ich ihm eine Frage stellte.
»Ich brauche Ihre Zeit nicht weiter in Anspruch zu nehmen, Mister Phillips«, meinte ich schließlich. »Ich finde mich schon zurecht bei den Silos, und Fragen kann ich auch allein stellen.«
»Ich begleite Sie natürlich, äh – äh –« Stirnrunzelnd sah er auf meine Visitenkarte.
»Miss Warshawski«, kam ich ihm zu Hilfe.
»Miss Warshawski. Der Lademeister ist bestimmt nicht begeistert, wenn Sie unangemeldet aufkreuzen.« Seine Stimme war tief, klang aber gepresst. Der ganze Mann wirkte verkrampft.
Pete Margolis, der die Oberaufsicht in den Silos hatte, schien nicht erbaut, als wir in seinem winzigen Büro auftauchten. Ich erkannte jedoch sehr rasch, dass sich sein Unmut mehr gegen Phillips richtete. Phillips stellte mich vor als »eine junge Dame, die sich für die Silos interessiert«. Als ich Margolis meinen Namen nannte und erwähnte, dass ich Champs Cousine sei, änderte sich sein Verhalten schlagartig. Er wischte seine schmutzige Pranke an seinem Overall ab, schüttelte mir die Hand und versicherte mir, wie sehr er den Unfall meines Vetters bedauere, der bei den Männern sehr beliebt gewesen sei und den die Firma schwer vermissen würde. Unter einem Stapel von Papieren zog er einen Schutzhelm für mich hervor.
Ohne von Phillips Notiz zu nehmen, machte er mit mir einen ausgedehnten Rundgang. Er zeigte mir, wo die Selbstentladewagen hereinkamen und wie die pneumatischen Getreideheber funktionierten, die das Getreide ins Innere des Silos beförderten. Phillips hatte sich angehängt und gab überflüssige Kommentare ab. Er besaß seinen eigenen Schutzhelm, fein säuberlich mit seinem Namen versehen; sein grauseidener Sommeranzug wirkte in der schmutzigen Anlage allerdings völlig deplatziert.
Margolis lotste uns eine lange, enge Treppe hinauf, die ins Innere des Silos führte. Oben öffnete er eine feuersichere Tür, und sofort schlug uns ein ohrenbetäubender Lärm entgegen. Überall war Staub. Er wirbelte durch die Luft, setzte sich in dicken Schichten auf den hohen Stahlträgern ab und bildete einen rutschigen Film auf dem Metallboden. Meine Joggingschuhe fanden keinen festen Halt mehr.
Von einer Laufplanke aus blickten wir hinunter auf den Betonboden des Silos. Nur ein hüfthohes Geländer schützte mich vor einem Sturz auf die Förderbänder dort in der Tiefe.
Pete Margolis packte mich am Arm und gestikulierte mit der freien Hand. Ich schüttelte den Kopf. Er beugte sich dicht an mein rechtes Ohr. »Hier kommt alles herein«, brüllte er. »Die Güterwagen werden hochgehievt und entleert. Dann treten die Förderbänder in Aktion.«
Ich nickte. Das Gerassel und Getöse kam zum Teil von den Förderbändern, doch auch der Lastenaufzug, der die Güterwagen wie Kinderspielzeug fast dreißig Meter nach oben beförderte, trug das Seine zu dem Krach bei. Die Bänder transportierten das Getreide aus den Rundbehältern zu Güterwagen, die ihre Fracht über Schütten in die Laderäume der draußen vertäuten Schiffe ergossen. Während des Transportvorgangs kam es zu erheblicher Staubentwicklung. Die meisten Männer dort unten waren mit Atemschutzmasken ausgestattet, doch die wenigsten schienen Ohrenschützer zu tragen.
»Weizen?«, schrie ich Margolis ins Ohr.
»Gerste. Etwa fünfunddreißig Bushel pro Bruttoregistertonne.«
Er rief Phillips etwas zu, und dann gingen wir weiter über die Laufplanke und hinaus auf ein schmales Mauersims an der Wasserseite. In tiefen Atemzügen sog ich die scharfe Aprilluft ein und gewöhnte meine Ohren an die plötzliche Stille.