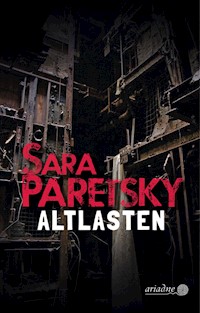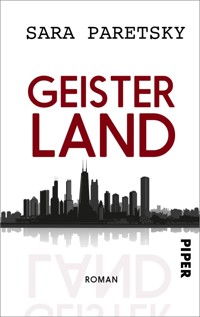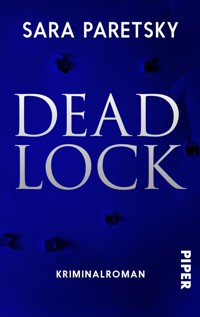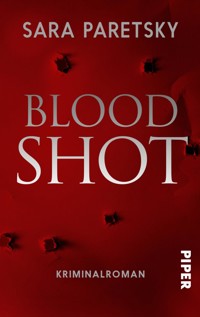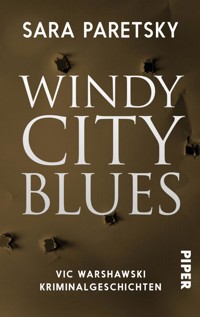12,23 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
In ihrem achten Vic Warshawski-Roman nimmt Sara Paretsky ein brandheißes Thema auf: Gewalt gegen Frauen und Kinder
Was zuviel ist, ist zuviel: Privatdetektivin Vic Warshawski findet zunächst im Keller eine verwahrloste Frau mit ihren drei Kindern, die vor ihrem gewalttätigen Ehemann geflohen ist. Sie versucht ihnen zu helfen, doch Vics Aktivitäten stoßen auf unerwarteten Widerstand. Aber die zähe, trotzige und unbestechliche Detektivin lässt sich weder von Kugeln noch Schlägertrupps abhalten, die Drahtzieher hinter Korruption, Geldwäsche, krummen Exportgeschäften und Mord zu suchen und zu überführen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
PIPER DIGITAL
die eBook-Labels von Piper
Unsere vier Digitallabels bieten Lesestoff für jede Lesestimmung!
Für Leserinnen und Leser, die wissen, was sie wollen.
Mehr unter www.piper.de/piper-digital
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Sonja Hauser
ISBN: 978-3-492-98378-5
© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2018
© 1994 Sara Paretsky
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Tunnel Vision«
© Delacorte Press, New York 1994
© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1995, 1997
Covergestaltung: Favoritbüro München
Covermotiv: Freedom Master/shutterstock
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Stromausfall
Einem geschenkten Gaul …
Der verlorene Sohn
Schwierige Verhandlungen
Wie gewonnen, so zerronnen
Kotz und Co.
Die Cocktailparty
Von Reichen, Säufern und Ratten
Ende der Festlichkeiten
Ein verängstigter Maulwurf
Alte Collegebande
Rückkehr der Gastgeberin
Kein schöner Anblick
Tabula rasa
Senatorenprivilegien
Ein hingebungsvoller Vater
Eine Familienangelegenheit
Unterredung mit der Polizei
Fuchs, du hast die Gans gestohlen
Ein Schlag ins Kontor
Was steckt in einem Gedicht?
Witterung
Ein Bulle geht aus
Spione
Die Spinne zieht ihre Fäden
Irrwisch
Überraschender Besuch
Ein bißchen tiefer
Verfolger
Komplexe Daten
Das Körnchen fällt nicht weit vom Kolben
Eine Nadel im Maisspeicher
Vor dem Eindringen klopfen
Für ein paar Dollar mehr
Leere Versprechungen
Sie kämpft und läuft weg – und kriegt trotzdem eins auf den Deckel
Raubvogel
In Sicherheit
Bus nach Rumänien
Nummer eins auf allen Beschwerdelisten
Eine Hand wäscht die andere
Dead Loop
Engel im Schacht
Für Dickschädel gibt’s keine Regeln
Die Maus zwischen zwei Katzen
Eine denkwürdige Nacht
Brainstorm
Die drei Musketiere
Alles hat seinen Preis
Nachtwache
Droit du Père
Freilaufende Maus
Die neununddreißig Stufen
Hinunter in den Schacht
Der nächste Schlag
Die Stimme der Toten
Ein Senator für alle
Lauter Freunde
Furioses Finale
Poeta emergit
Mal du Père
Märchenerzähler
Aus ist noch lang nicht vorbei
Dank
Widmung
Für Dorothy
»Es passiert nicht oft, daß jemand daherkommt, der ein guter Freund ist und ein guter Schriftsteller obendrein.«
E. B. White, Wilbur und Charlotte
Stromausfall
Als der Strom ausfiel, beendete ich gerade einen zehnseitigen Bericht. Es wurde dunkel in meinem Büro; der Computer gab ächzend seinen Geist auf. Hilflos mußte ich mit ansehen, wie aus meinem Text Schemen wurden, die noch kurz auf dem Bildschirm schimmerten, bevor sie verschwanden wie die Grinskatze aus Alice im Wunderland.
Ich verfluchte mich selbst und die Hauseigentümer. Wenn ich der alten Olivetti meiner Mutter die Treue gehalten hätte, statt mich zu computerisieren, hätte ich meine Arbeit bei Kerzenlicht fertigstellen und nach Hause gehen können. Und wenn die Brüder Culpepper das Pulteney-Gebäude nicht so hätten verkommen lassen, wäre der Strom nicht ausgefallen.
Ich hatte mein Büro seit zehn Jahren in dem Haus, also schon so lange, daß mir seine zahllosen Mängel nicht mehr auffielen. Jahrzehntealter Ruß verdeckte die Basreliefs auf den Messingtüren und füllte die ausgeschlagenen Ecken des Marmorbodens im Foyer; in den Friesen der oberen Stockwerke fehlten große Gipsstücke; drei Damentoiletten, die öfter verstopft waren als funktionierten, mußten für das ganze Gebäude genügen. Und die Innenverkleidung des Aufzugs konnte ich im Traum nachzeichnen, so oft war ich schon steckengeblieben.
Lediglich die niedrige Miete im Pulteney machte diese Zustände erträglich. Eigentlich hätte ich schon längst merken müssen, daß die Culpeppers nur warteten, bis die Loop-Sanierung auch unseren südlichen Stadtteil erfaßte, und das Gebäude kaputt mehr wert war als intakt. Unser allherbstliches Feilschen, aus dem ich triumphierend ohne Mieterhöhung hervorging und das die Brüder ohne die Verpflichtung, neue Rohre oder Leitungen zu verlegen, hinter sich brachten, hätte eine Detektivin wie mich, die sich auf Betrügereien, Brandstiftung und Wirtschaftsverbrechen spezialisiert hatte, hellhörig werden lassen müssen. Doch wie bei vielen meiner Klienten war auch für mich die Sorge darüber, daß Geld in die Kasse floß, größer als der Drang, die Zusammenhänge zu erforschen.
Das Gebäude stand bereits zu einem Drittel leer, als die Culpeppers zum neuen Jahr die Kündigung aussprachen. Sie versuchten uns restliche Mieter zuerst zu bestechen, dann mit Gewalt zum Verlassen des Hauses zu bewegen. Manche taten ihnen den Gefallen, aber Leute, die sich im Pulteney einmieteten, konnten sich nicht so ohne weiteres Räume anderswo leisten. Es waren harte Zeiten, und die, die sich früher gerade noch am Rand der Gesellschaft gehalten hatten, landeten jetzt schon auf der Straße. Als allein agierende Privatdetektivin machte mir die gegenwärtige Situation genauso zu schaffen wie allen anderen. Zusammen mit einem Hutmacher, einem Händler für orientalische Gesundheits- und Schönheitsmittelchen, einem Mann, der sein Geld wahrscheinlich als Buchmacher verdiente, einer Adressenhandelsfirma und noch ein paar anderen saß ich es bis zum bitteren Ende aus.
Ich nahm also meine Taschenlampe und bewegte mich ziemlich schnell, da geübt, durch den dunklen Flur zur Treppe. Der Bericht, an dem ich gerade gearbeitet hatte, mußte um acht Uhr am nächsten Morgen bei Darraugh Graham sein. Wenn ich das schadhafte Kabel oder die durchgebrannte Sicherung schnell genug fand, konnte ich die fehlenden Daten aus meinem Computer abfragen und so die wesentlichen Informationen rekonstruieren. Wenn nicht, mußte ich mit der Olivetti noch einmal von vorn anfangen.
Ich sperrte die Tür zum Treppenhaus auf, verschloß sie aber nicht wieder, damit ich problemlos zurückkonnte. Nachdem Tom Czarnik gekündigt hatte, hatte ich an den Türen Schlösser angebracht, die sich alle mit demselben Schlüssel öffnen ließen. Czarnik, der Hausmeister – der angebliche Hausmeister –, hatte in den letzten beiden Jahren nichts anderes getan, als die Mieter zu nerven, so daß sein Weggang kein großer Verlust war. Erst vor kurzem war mir aufgegangen, daß die Culpeppers ihn wahrscheinlich dafür bezahlt hatten, den Verfall des Pulteney Building zu beschleunigen. Die Brüder taten jedenfalls alles, um unser kleines Häuflein von Aufrechten noch vor dem Kündigungstermin loszuwerden. Sie gaben nicht einmal mehr vor, irgend etwas für die Wartung des Hauses zu tun. Als erstes hatten sie versucht, die Energieversorgung zu kappen; eine gerichtliche Verfügung sicherte uns wenigstens Elektrizität und Wasser. Jetzt standen ihre Nachlässigkeit und ihre Sabotageversuche unserer Gewitztheit gegenüber – oder besser gesagt, meiner. Zwar hatten die anderen Mieter den Eilantrag zum Wiederanschluß an das Stromnetz unterzeichnet, aber keiner von ihnen kam jemals mit mir nach unten, um sich mit Kabeln und Rohren zu beschäftigen.
An jenem Tag stellte ich mir durch meinen Übermut selbst ein Bein. Ich kannte die Kellertreppe so gut, daß ich die Stufen vor mir nicht mit der Taschenlampe ausleuchtete. Also stolperte ich über ein loses Stück Gips. Als ich mit den Armen ruderte, um das Gleichgewicht wiederzugewinnen, ließ ich die Taschenlampe fallen. Ich hörte das Glas splittern, als sie die Stufen hinunterpolterte.
Ich atmete tief durch. Lohnte es sich wirklich, sich jetzt noch Gedanken über Darraugh Grahams Zorn zu machen? War es nicht sinnvoller, nach Hause zu gehen und sich am nächsten Morgen mit einer neuen Taschenlampe den Drähten und Kabeln zu widmen? Außerdem wollte ich noch zu einer Sitzung des Frauenhausstiftungsbeirats, in dem ich Mitglied bin.
Das Problem war nur, daß Darraughs Honorar direkt in meine Kasse für ein neues Büro floß. Wenn ich nicht pünktlich ablieferte, hatte er keinerlei Grund, sich wieder an mich zu wenden – er arbeitete mit einer ganzen Anzahl von Detekteien zusammen, die meisten davon zwanzigmal so groß wie die meine.
Also bewegte ich mich wie ein Krebs nach unten. Ich hatte eine Arbeitslampe und einen Werkzeugkasten gleich neben dem Sicherungskasten am anderen Ende der Wand. Wenn ich den erreichte, ohne mir den Hals zu brechen, war alles in Ordnung. Doch meine eigentliche Angst galt den Ratten: Sie wußten, daß der Keller ihnen gehörte. Wenn ich sie mit der Lampe anleuchtete, verschwanden sie gemächlich aus dem Lichtkreis und wackelten dreist mit dem Schwanz, hörten aber deswegen noch lange nicht auf herumzuscharren, während ich arbeitete.
Ich tastete im Dunkeln herum und versuchte, nicht hinter jedem herunterhängenden Draht Schnurrhaare zu vermuten, als ich merkte, daß das Geräusch, das ich hörte, von einem Menschen stammte, nicht von einem Nager. Ich bekam eine Gänsehaut. Hatten die Culpeppers Schläger angeheuert, um mir einen Schreck einzujagen? Oder waren das Diebe, die glaubten, das Gebäude stehe leer, und die Kupferdrähte und andere halbwegs interessante Sachen von den Wänden entfernen wollten?
Ich kniete vorsichtig im Dunkeln nieder und bewegte mich langsam nach rechts, wo ich hinter einer Kiste mit Holzresten in Deckung gehen konnte. Ich spitzte die Ohren. Es befand sich mehr als nur ein Mensch im Keller. Einer davon klang, als stehe er kurz vor einem Asthmaanfall. Sie hatten genausoviel Angst wie ich. Aber das munterte mich auch nicht auf, denn ein verschreckter Einbrecher wird eher gewalttätig als einer, der glaubt, die Situation im Griff zu haben.
Ich bewegte mich noch weiter nach rechts, wo vielleicht ein paar alte Rohre lagen, die mir als Waffe dienen konnten. Einer der Eindringlinge wimmerte und wurde sofort zum Schweigen gebracht. Das Geräusch erschreckte mich so, daß ich gegen einen Stapel Rohre stieß; sie fielen klappernd herunter. Aber das war egal – das Wimmern stammte von einem kleinen Kind. Ich arbeitete mich zu meiner Lampe zurück, fand den Stecker und schaltete die Lampe an.
Auch nachdem sich meine Augen an das Licht gewöhnt hatten, dauerte es noch eine Weile, bis ich die Quelle des Geräuschs ortete. Ich stocherte vorsichtig zwischen Kisten und alten Büromöbeln herum. Ich schaute in den Aufzugschacht und unter die Treppe. Fast dachte ich schon, mir alles nur eingebildet zu haben, als ich das Wimmern wieder hörte.
Eine Frau kauerte hinter dem Boiler, neben ihr drei Kinder. Das kleinste davon zitterte stumm, das Gesicht gegen das Bein seiner Mutter gepreßt. Nur hin und wieder gab es ein quäkendes Geräusch von sich. Das größte, das mit Sicherheit nicht älter als neun oder zehn war, hustete asthmatisch, hemmungslos jetzt, wo sich ihre schlimmste Furcht bewahrheitet hatte: von jemandem entdeckt zu werden.
Wenn ich nicht das asthmatische Husten und das Wimmern gehört hätte, wäre ich in dem trüben Licht wahrscheinlich noch ein paarmal an ihnen vorbeigegangen, ohne sie zu bemerken.
Sie trugen mehrere Schichten von Pullovern und Jacken über ihren ausgemergelten Körpern, die sie wie Vogelscheuchen aussehen ließen.
»Die feuchte Luft hier unten ist sicher nicht gut für Ihren Sohn.« Die Bemerkung war ziemlich unpassend, das merkte ich selbst.
Die Frau starrte mich düster an. In dem trüben Licht konnte ich nicht beurteilen, was stärker war – Wut oder Furcht.
»Ist kein Junge«, sagte das mittlere Kind so leise, daß ich es kaum verstand. »Ist Jessie. Ist ein Mädchen. Ich bin der einzige Junge.«
»Tja, vielleicht sollten wir Jessie nach oben bringen, wo sie frische Luft kriegt. Wie heißt du denn, Kleiner?«
»Red nicht mit ihr. Hab’ ich euch nicht gesagt, ihr sollt mit niemandem reden, bevor ich euch das nicht ausdrücklich sage?« Die Frau packte den Jungen an den Schultern und schüttelte ihn. Er sank mit einem halbherzigen Jammern gegen ihren Körper.
Die Schatten des Boilers ließen ihr Gesicht und ihre Haare grau erscheinen. Sie war höchstens dreißig, aber wenn ich ihr auf der Straße ohne ihre Kinder begegnet wäre, hätte ich sie wahrscheinlich für siebzig gehalten.
»Wie lange leben Sie schon hier unten?«
Sie starrte mich an, antwortete aber nicht. Vielleicht hatte sie mich schon ein dutzendmal hier unten beobachtet; vermutlich wußte sie, daß ich allein war, daß ich keine Bedrohung für sie darstellte.
»Sie wollen das Haus in sechs Wochen abreißen«, sagte ich. »Wissen Sie das?«
Sie starrte mich weiter an, bewegte den Kopf aber nicht.
»Hören Sie zu. Es geht mich ja nichts an, wenn Sie hier unten bleiben wollen, aber Ihren Kindern tut das sicher nicht gut. Das ist schlecht für die Augen, für die Lunge, für die Moral. Wenn Sie Jessie wegen ihres Asthmas zum Arzt bringen wollen, kann ich Ihnen einen empfehlen, der nichts dafür verlangt.«
Ich wartete eine ganze Weile, bekam aber keine Antwort. »Ich muß mich jetzt um die Kabel hier kümmern, und dann gehe ich wieder rauf in mein Büro. Das hat die Nummer Vier-Null-Sieben. Wenn Sie sich die Geschichte mit dem Arzt überlegt haben, kommen Sie doch zu mir, und ich bringe Sie hin. Jederzeit.«
Ich wandte mich dem Sicherungskasten zu. Die Culpeppers kappten manchmal Drähte oder unterbrachen das Heißwassersystem, um uns schneller aus dem Haus zu vertreiben. So hatte ich mir in meiner Freizeit ein beträchtliches Wissen über Elektrik angeeignet. Doch heute war ich nicht gefordert: Ein Brett hatte sich von der Decke gelöst, einige Drähte mit sich gerissen und unbrauchbar gemacht. Ich holte einen Hammer aus meinem Gürtel, suchte zwischen den Kisten nach ein paar alten Nägeln und stieg auf eine Holzkiste, um das Brett wieder festzunageln. Die Drähte zu reparieren erforderte mehr Geduld als Know-how – man mußte die empfindlichen Kupferdrähte freilegen, die losen Enden miteinander verknüpfen und sie dann mit Klebeband verzwirbeln.
Es nervte mich ziemlich, mit den stummen Zuschauern im Rücken zu arbeiten. Jessies pfeifendes Atmen hatte sich ein wenig beruhigt, als sie merkte, daß ich der Familie nichts tun würde, und auch das kleine Baby hatte aufgehört zu jammern. Ich bekam eine Gänsehaut, weil sie mich beobachteten, aber ich versuchte trotzdem, mir Zeit zu lassen und den Schaden so gut zu reparieren, daß ich die nächsten sechs Wochen Ruhe hatte.
Während ich Drähte freilegte, klebte und nagelte, überlegte ich, was ich mit den Kindern machen sollte. Wenn ich jemanden vom Sozialamt anrief, kamen die mit Polizisten und Bürokraten an und steckten die Kinder in ein Heim. Aber wie sollten sie hier unten bei den Ratten überleben?
Als ich fertig war, ging ich wieder hinüber zum Boiler. Die vier schraken zusammen.
»Hören Sie zu. Oben gibt es jede Menge leere Räume und auch ein paar Toiletten. Ich kann Sie in ein leerstehendes Büro lassen. Wäre das nicht besser als das hier unten?«
Sie gab keine Antwort. Warum sollte sie mir vertrauen? Ich versuchte sie zu überzeugen, aber meine Worte klangen so drängend, daß sie zurückwich, als habe ich sie geschlagen. Ich hielt den Mund und dachte eine Weile nach. Schließlich nahm ich einen Zweitschlüssel von meinem Schlüsselring. Wieso sollte sie mir vertrauen, wenn ich ihr nicht vertraute?
»Damit können Sie alle Treppenhaustüren aufschließen, auch die zum Keller. Ich sperre die Kellertür zu, um mein Werkzeug zu schützen, wenn Sie also doch nach oben kommen sollten, schließen Sie bitte die Tür hinter sich ab. In der Zwischenzeit lasse ich meine Arbeitslampe an – das hilft Ihnen gegen die Ratten. Okay?«
Sie gab immer noch keine Antwort, streckte nicht einmal die Hand nach dem Schlüssel aus. Jessie flüsterte: »Na mach schon, Mama.« Der Junge nickte hoffnungsvoll, doch die Frau nahm den Schlüssel immer noch nicht. Ich legte ihn auf einen Sims beim Boiler und wandte mich zum Gehen.
Dann tastete ich mich zur Treppe zurück, hob meine Taschenlampe auf und ging die Stufen hinauf. Obwohl ich wußte, daß die Frau mit ihren Kindern mehr Angst vor mir hatte als ich vor ihr – und aus viel besserem Grund –, stand mir doch der kalte Schweiß auf der Stirn. Als die Frau plötzlich den Mund aufmachte, zuckte ich zusammen und hätte fast laut aufgeschrien.
»Meine Kinder verhungern nicht, Lady. Vielleicht ist das nicht viel in Ihren Augen, aber ich kann für sie sorgen. Ich kümmere mich schon um sie.«
Einem geschenkten Gaul …
Ich glitt atemlos auf einen Stuhl, als Sonja Malek gerade über die Einnahmen des Frühjahrs berichtete. Marilyn Lieberman, die Geschäftsführerin von Arcadia House, winkte mir zu, und Lotty Herschel hob fragend eine Augenbraue, aber niemand unterbrach die Rednerin. Arcadia House ist wie die meisten gemeinnützigen Unternehmen auf die geringen Subventionen und Spenden angewiesen, die von außen kommen; die Hauptaufgabe des Beirats ist es, Geld aufzutreiben.
Die meisten von uns arbeiten schon seit Jahren in den unterschiedlichsten Frauengruppen zusammen. Lotty kenne ich am längsten, seit meiner Studentenzeit, als sie den Frauen in einer Untergrundgruppe zeigte, wie man abtreibt.
»Die aufregendste Neuigkeit habe ich bis zum Schluß aufgehoben«, meinte Sonja, die feisten Backen rosafarben vor Freude. »Die Gateway Bank hat uns einen Scheck über fünfundzwanzigtausend Dollar geschickt.«
»Hey, toll!« schloß ich mich den erregten Ausrufen an. »Wie hast du denn das hingekriegt?«
»Ehre, wem Ehre gebührt.« Marilyn Lieberman klopfte der Frau zu ihrer Linken auf die Schulter. »Deirdre hat eben Connections.«
Deirdre Messenger zog ein wenig den Kopf ein. Ihre glatten blonden Haare fielen nach vorn und verbargen ihre roten Wangen.
»Hast wohl den Vorsitzenden von Gateway für einen guten Zweck gebumst, was?« fragte jemand.
Als die Frauen um sie herum zu lachen anfingen, stieß Deirdre selbst ein kurzes, bellendes Lachen aus, das wenig Begeisterung verriet. »Mir kommt’s fast so vor. Eigentlich hat Fabian das gedreht. Er hat ein paar juristische Fragen für sie geklärt …«
Ihre Stimme schweifte ab, so daß wir das Gefühl hatten, etwas Unanständiges gesagt zu haben. Anders als die meisten von uns hatte Deirdre keine besondere Fähigkeit, sondern nutzte die betuchten Kontakte ihres Mannes, um die Projekte zu unterstützen, bei denen sie im Beirat saß.
Sal Barthele, die Vorsitzende von Arcadias Stiftungsbeirat, kam wieder zur Tagesordnung zurück. »Vic, möchtest du jetzt über die Sicherheitsfragen reden? Oder brauchst du noch ein bißchen Zeit, um Atem zu holen?«
»Nein, nein, ist schon in Ordnung.« Arcadia House ist ein Frauenhaus, und viele Leute glauben, daß wir einen großen Teil unserer Energie darauf verwenden, die Männer der betroffenen Frauen abzuwehren. Aber um die Wahrheit zu sagen: Die meisten sind Feiglinge, die nicht wollen, daß jemand außerhalb der Familie erfährt, was sie daheim machen. In den sieben Jahren unseres Bestehens haben nur drei von ihnen versucht, das Frauenhaus zu stürmen.
Trotzdem wollen wir natürlich, daß Arcadia eine sichere Zuflucht für Frauen und ihre Kinder ist und bleibt. Vor zwei Wochen war es jemandem gelungen, über die Mauer zu klettern, mit einer Axt auf das Holzspielzeug im Hof einzuschlagen und sich aus dem Staub zu machen, bevor die Frau, die die Nachtschicht hatte, die Polizei rufen konnte. Daraufhin hatte Marilyn Lieberman vorübergehend einen Wachposten angeheuert, aber ich sollte Vorschläge für langfristige Lösungen machen. Keine davon war billig: Man konnte die Ziegelmauer abreißen und eine aus Stahl dafür hinstellen – aber möglicherweise kamen sich die Frauen dann vor, als säßen sie im Gefängnis; man konnte rund um das Frauenhaus Lichtsensoren installieren oder einen permanenten Sicherheitsdienst für die Nacht engagieren.
Ich hätte am liebsten die Mauer abgerissen. Obwohl die jetzige fast zwei Meter hoch war – mehr erlauben die Bauvorschriften in unserer Stadt nicht –, konnte man leicht drüberklettern. Und weil sie aus Backstein war, konnte man auch vom Haus aus nicht auf die Straße sehen. Zwar hatten wir eine Videokamera darauf installiert, aber es war ein Kinderspiel, sie auszutricksen. Kurzfristig gesehen war eine neue Mauer jedoch die teuerste Lösung. Die Diskussion wurde ziemlich leidenschaftlich fortgesetzt, bis Sonja Malek auf ihre Uhr sah, entsetzt etwas von ihrem Babysitter murmelte und ihre Unterlagen in ihrer Aktentasche verschwinden ließ. Auch alle anderen fingen an zusammenzupacken.
Sal klopfte auf den Tisch. »Mädels, seid ihr zur Abstimmung bereit? Nein? Na ja, kein Wunder. Wir streiten uns genauso leidenschaftlich darüber, welches Klopapier wir kaufen wollen, wie darüber, ob wir die Kinder zum Aidstest bringen sollen. Mädels, ihr solltet lernen, eure Kräfte einzuteilen, sonst habt ihr mit Fünfzig keine mehr. Wenn ihr nächsten Monat immer noch nicht wißt, was ihr wollt, nehmen Marilyn und ich euch die Entscheidung ab.«
»Yes, Ma’am!« grüßte jemand Sal zackig, als die Frauen sich in Richtung Tür drängten.
Deirdre Messenger kam zu mir herüber. »Wieso bist du denn erst um halb neun gekommen, Vic?«
Ihr scherzhafter Tonfall nervte mich, denn er deutete auf eine Nähe hin, die zwischen uns nicht existierte. Ich hatte sie in Collegezeiten flüchtig gekannt, weil ich zusammen mit ihrem Mann Jura studiert hatte – sie hatte immer im Tagesraum der juristischen Fakultät mit uns Mittag gegessen. Damals war sie hübsch gewesen, irgendwie verträumt, feenhaft. Zwanzig Jahre später war ihr maisblondes Haar nur einen Ton dunkler als damals, aber ihre Verträumtheit hatte sich in Anspannung und Verbitterung verwandelt.
Ich wurde also nicht ausfallend, denn solche Kränkungen verkraftete sie schlecht. »Ach, nur wieder die üblichen Problemchen mit dem Computer plus die Aufregungen um mein verfallendes Büro. Ich hab’ einen ganzen Bericht neu schreiben müssen, weil der Computer abgestürzt ist. Zum Glück hab’ ich meine Akten in letzter Zeit ordentlich geführt, also hab’ ich ziemlich schnell eine Rohfassung von dem neuen Schrieb hingekriegt.«
Marilyn Lieberman und Lotty waren stehengeblieben, um sich meine Leidensgeschichte anzuhören. Ihnen erzählte ich auch noch von meiner Begegnung mit der obdachlosen Frau und ihren Kindern.
»Vic! Du hast sie doch nicht dort unten gelassen, oder?« rief Marilyn aus.
Ich wurde rot. »Was hätte ich denn sonst machen sollen?«
»Bei den zuständigen Behörden anrufen zum Beispiel«, meinte Lotty knapp. »Für was hast du denn deine Freunde bei der Polizei?«
»Und was hätten die dann gemacht? Die hätten sie wegen Vernachlässigung ihrer Kinder festgenommen und die Kids in Pflege gegeben.«
Lotty zog ihre dichten Augenbrauen zusammen. »Das eine Kind hat Asthma, sagst du? Wer weiß, wie die Lunge von den anderen aussieht. Manchmal denkst du einfach nicht mit, Vic: In so einem Fall wäre Pflege vielleicht nicht das Schlechteste.« Ihr Wiener Akzent wurde stärker; das war das sicherste Zeichen dafür, daß sie wütend war.
Marilyn schüttelte zweifelnd den Kopf. »Das Problem sieht doch folgendermaßen aus: Es gibt natürlich Frauenhäuser, in denen auch Kinder unterkommen können. Aber die sind nicht immer sicher. Die meisten haben auch nur nachts geöffnet, und die Frauen müssen sehen, wie sie über den Tag kommen.«
»Eigentlich wollte ich vorschlagen, daß sie hierherkommt«, sagte ich, »aber ich weiß, daß ihr nicht …«
»Das geht nicht«, fiel Marilyn mir ins Wort. »Wir können keine Ausnahmen machen; wir brauchen alle Betten für Frauen, die von ihren Männern geschlagen werden.«
»Was willst du jetzt machen?« Deirdre war ein wenig abseits gestanden, während wir uns unterhalten hatten, als fühle sie sich nicht zu der Gruppe gehörig, wolle aber auch nicht gehen.
Ich atmete tief durch und sah die Frauen herausfordernd an. »Ich habe ihr gesagt, sie kann in eins von den freistehenden Büros oben ziehen. Schließlich wird der Kasten sowieso in ein paar Wochen abgerissen.«
Sal Barthele, die sich gerade mit der Leiterin unterhalten hatte, bekam das Ende unseres Gesprächs mit. »Du hast wohl deinen weißen Liberalenverstand verloren, Vic. Was sagt denn Conrad dazu?« Sal, selbst eine Schwarze, interessiert sich sehr für das Auf und Ab meiner Beziehung mit einem schwarzen Mann.
»Ich gehe mit dem Typ, aber ich bitte ihn nicht jedesmal, bevor ich mir die Nase putze, um Erlaubnis.«
»Mir geht’s ja auch gar nicht um seine männliche Psyche, Schätzchen. Viel wichtiger finde ich: Was sagt seine Bullenpsyche dazu?«
»Wenn ich ihm das erzähle, stimmt er wahrscheinlich Lotty zu. Aber dann mischen sich die Behörden ein, die Kinder kommen in drei unterschiedliche Heime, wo mindestens eins sexuell belästigt wird. Die Mutter verliert das bißchen Realitätssinn, das sie noch hat, und wird auch eine von den Frauen auf der Michigan Avenue, die ständig vor sich hin schimpfen und so ausschauen, als würden sie dem nächstbesten Passanten, der sie anspricht, an die Gurgel gehen.«
Ich klang bitterer als beabsichtigt; die anderen traten beklommen von einem Fuß auf den anderen. Ich schlang die Arme um meinen Körper, versuchte, meine Wut loszukriegen. Als Deirdre laut ächzte, als habe ihr jemand in den Bauch getreten, klang das weit, weit weg.
»Immer mit der Ruhe, Vic.« Marilyns Stimme – professionell, ruhig, an verzweifelten Frauen und in Personalfragen geschult –, holte mich wieder in die Realität zurück. »Nicht alle Pflegeheime sind so schrecklich. Findest du nicht, daß du dem System in so einem Fall eine Chance geben solltest? Das ist doch sicher besser, als die Kinder ohne Essen oder sanitäre Einrichtungen da unten zu lassen.«
»Vielleicht könnte ich mit ihr reden«, meinte Deirdre vorsichtig, als habe sie Angst, ich könne ihr das nicht zutrauen.
»Gute Idee.« Marilyn hörte sich an wie eine Beraterin, die die erfolgreiche Bewältigung von Problemen lobt. »Weißt du, Deirdre erledigt ziemlich viel für Home Free, die Leute vom Obdachlosenprogramm.«
Das hatte ich nicht gewußt. Den Namen »Home Free« kannte ich nicht, denn die ganze Energie, die mir noch für ehrenamtliche Tätigkeiten bleibt, stecke ich in Frauengruppen, deshalb weiß ich auch nicht so gut Bescheid über das, was sonst noch so in anderen ebenso wichtigen Bereichen läuft.
Deirdre musterte mich angriffslustig, als wolle sie mich herausfordern, obwohl sie Angst vor mir hatte. Ihr Gesichtsausdruck zwang mich dazu, den Rückzug anzutreten.
»Wenn du sie überreden kannst, sich helfen zu lassen, um so besser. Ich dachte, Lotty könnte sich das asthmatische Kind anschauen – das würdest du doch machen, oder …?«
»Klar, Vic. Aber laß dich mal nicht von deinem Idealismus übermannen. Weißt du, warum wir die TB vor fünfzehn Jahren, als wir die Gelegenheit dazu hatten, nicht ausrotten konnten? Weil die Leute ihre Medikamente nur nehmen, wenn wir sie persönlich dazu auffordern. Ich kann mir hundert kranke, verzweifelte Menschen im Monat anschauen – und das tue ich auch –, aber das macht sie noch lange nicht gesund.«
Ich brachte ein Grinsen zustande. »Lotty, wenn ich die Kleine dazu überreden kann, zu dir in die Klinik zu kommen, bleibe ich mit meiner Smith & Wesson so lange bei ihr, bis sie alle Medikamente genommen hat, die du ihr verschreibst.«
»Nicht schlecht«, meinte Marilyn. »Und du stellst dich dann hin wie Dirty Harry und sagst: ›Make my day: Nimm deine Antibiotika.‹«
Sogar Lotty mußte lachen. Sal rundete den Scherz mit einer kleinen Zote ab, und Marilyn lachte schallend.
Im Schutz des Gelächters flüsterte Deirdre mir zu: »Ich weiß, du traust mir das nicht zu, aber sag mir doch einfach, wo dein Büro ist.«
Meine Angst, sie zu verletzen, ließ mich schneller, als ich eigentlich wollte, auf ihr Angebot eingehen. »Klar. Versuchen wir’s einfach. Ich habe mein Büro im Pulteney-Building, an der Südwestecke Wabash/Monroe. Wie wär’s morgen so gegen drei?«
»Du kommst doch am Mittwochabend mit der ganzen Horde. Morgen stehe ich den ganzen Tag in der Küche.«
Ich zuckte zusammen bei der Gehässigkeit in ihrer Stimme. Sie und Fabian gaben eine Party für meinen Lieblingsprofessor in Jura. Ich war erstaunt, aber auch erfreut gewesen, eingeladen worden zu sein. Doch jetzt ärgerte ich mich, weil Deirdre mich so aus dem Gleichgewicht brachte und weil ich selbst versuchte, sie zu beschwichtigen. Jedenfalls fuchtelte ich wild mit den Händen herum, als ich ihr antwortete.
»Hoffentlich machst du dir nicht meinetwegen soviel Mühe; ich esse alles. Kalte Pizza, Sachen von McDonald’s, alles.«
Sie fletschte die Zähne bei dem Versuch zu lächeln. »Ich mach’ das nicht für dich, Vic: Die ganzen Schnösel aus der Stadt kommen, um zu sehen, wie Fabian Manfred Yeo um den Bart streicht, damit er die Stelle als Bundesrichter kriegt, auf die er’s abgesehen hat. Und ich schnipsel den lieben langen Tag Gemüse und fülle so viele verdammte Windbeutel wie möglich, damit die Leute auch merken, was für ein toller Gentleman Fabian ist.« Sie schloß mit der grimmigen Parodie eines englischen Akzents.
Ich zuckte zusammen. »Wenn das alles so schrecklich ist, komme ich lieber nicht – dann mußt du einen Windbeutel weniger füllen.«
»Bitte nicht, Vic – du wirst das einzige menschliche Wesen im Haus sein. Außerdem wollte Manfred, daß du kommst. Fabian hat ihn gefragt, ob er irgend jemanden von seinen früheren Studenten sehen wolle, da hat er dich genannt. Natürlich werden alle da sein, die’s zum Richter gebracht haben, aber an dich hätte Fabian sicher nicht gedacht, und das hat er gewußt.« Ihre Stimme und ihr Gesichtsausdruck wurden sanfter, sie sah jetzt beinahe zerbrechlich aus.
»Wie viele Leute kommen?«
»Fünfunddreißig. Der Sohn von Senator Gantner kommt auch. Wenn ich könnte, würde ich mich bei dir im Keller verstecken. Ich schaue am Freitagnachmittag bei dir vorbei.« Sie schlang den Mantel um ihre hochgezogenen Schultern, wartete, ob irgend jemand von den anderen sie begleiten würde, und ging dann allein hinaus.
»Irgendwas stimmt nicht mit der Frau«, meinte Sal, nachdem wir die Haustür hinter ihr ins Schloß hatten fallen hören. »Ich hab’ das Gefühl, daß sie sich in einem der Betten oben wohler fühlen würde als hier unten bei uns am Tisch.«
»Sie ist einfach schüchtern«, erwiderte Marilyn. »Sie bereitet sich immer auf die Beiratssitzungen hier vor, und ich weiß, daß sie wertvolle Arbeit für Home Free leistet. Ist gar nicht so leicht, so ganz ohne Beruf dazustehen, wenn alle anderen einen haben. Wieso hat sie sich denn gerade so aufgeregt, Vic? Wegen deiner obdachlosen Familie?«
»Nein. Sie und Fabian geben am Mittwoch eine große Party, aber Deirdre macht ein solches Trara darum, daß ich schon überlege, ob ich mir kurzfristig eine Grippe zulege. Sie bereitet das ganze Essen für fünfunddreißig Leute vor. Er verdient doch nicht schlecht – warum können sie keinen Partyservice beauftragen?«
»Was, du bist bei Fabian Messenger eingeladen?« Sal lachte. »Ist das nicht dieser aufgeblasene Republikaner-Berater? Was habt ihr zwei denn gemein?«
Jetzt lachte ich. »Bloß die Tatsache, daß wir damals, in der Blütezeit der Studentenrevolte, zusammen studiert haben. Er hat während des berühmten Sit-ins die Namen für die Verwaltung aufgenommen, und ich habe zur gleichen Zeit drinnen mitgeholfen, die erste Frauengewerkschaft zu organisieren. Dann hat er drei Jahre lang als Assistent beim Obersten Gerichtshof gearbeitet und ist mit Glanz und Gloria an seine Alma mater zurückgekehrt. Jetzt sitzt er rechts von den Rechten, während ich in einem Rattenloch in der Innenstadt residiere. Apropos: Sal, hast du ‘ne Ahnung, wie ich an ein neues Büro kommen könnte? Wenn ich nämlich nicht bald was finde, muß ich in dein Büro im Golden Glow ziehen.«
Sal legte mir den Arm um die Schulter. »Tja, das ist eine ernsthafte Drohung, meine Liebe. Aber ich hab’ dir ja von Anfang an gesagt, daß das Golden Glow ein Glückstreffer ist: Die meisten Sachen, die ich kaufe und verkaufe, sind Sanierungsobjekte in Wohngebieten, in denen du wahrscheinlich nicht arbeiten möchtest. Vielleicht könnte ich was Passendes finden, aber im Moment läuft das Geschäft nicht so gut. Verlaß dich lieber nicht darauf.«
Sal hatte auch den Kauf und den Wiederaufbau von Arcadia House initiiert, aber das war am Logan Square, zu weit weg vom Loop, der Chicagoer Innenstadt, wo der größte Teil meiner Kunden sitzt.
»Was ich brauche, Sal, ist ein ganzes Haus. Ich könnte oben wohnen und unten arbeiten.«
Meine Stimme klang sarkastisch, aber sie hob interessiert eine Augenbraue. »Keine schlechte Idee, Vic. Mach dich mal lieber nicht drüber lustig.«
Wir gingen miteinander hinaus. Marilyn und Lotty, die sich gerade über die problematische Schwangerschaft einer Bewohnerin des Frauenhauses unterhielten – jemand hatte ihr im sechsten Monat in den Unterleib getreten –, zockelten hinter uns her. Ich hielt mich in der Nähe von Lotty, bis Marilyn und Sal weg waren.
»Warum warst du wegen der Frau im Pulteney so wütend auf mich?« wollte ich wissen.
»Bin ich wütend? Vielleicht. Manchmal habe ich den Eindruck, daß du zu selbstherrlich über das Leben anderer Menschen entscheidest.«
»Wenn eine Ärztin jemand anders selbstherrlich nennt, ist was im Busch.« Ich versuchte, das Ganze witzig klingen zu lassen, aber der Witz ging in die Hose. »Ich will mich der Frau gegenüber nicht als Göttin aufspielen; ich weiß einfach nicht, wie ich ihr helfen soll.«
»Dann mach eben nichts. Oder mach was Cleveres: Überlaß es den zuständigen Behörden, sich den Kopf zu zerbrechen. Vic, ich mache mir immer Sorgen, wenn du anfängst, dich in das Leben anderer Leute einzumischen. Dann muß gewöhnlich jemand leiden. Oft bist du das, und es fällt mir schwer, das mit anzusehen, aber letztes Jahr war ich die Betroffene, und das war noch schlimmer. Willst du wirklich warten, bis es diesen Kindern so schlechtgeht, daß du sie mir zum Zusammenflicken bringen kannst?«
Im orangefarbenen Schimmer der Natriumlampen sah ich die harten Linien in ihrem ausdrucksstarken Gesicht. Vor einem Jahr hatten ein paar Schläger Lotty mit mir verwechselt und ihr den Arm gebrochen. Ihr Zorn und mein schlechtes Gewissen hatten einen Keil in unsere Freundschaft getrieben, den wir erst nach Monaten harter Arbeit ein Stück herausgezogen hatten. Hin und wieder bricht die Wunde wieder auf. An jenem Abend war ich nicht in der Verfassung, mir schuldbewußt gegen die Brust zu schlagen.
»Ich versuche, sie nicht zu verletzen und dich nicht in die Sache hineinzuziehen.« Dann schlug ich die Autotür hinter mir zu.
Der verlorene Sohn
Ich kleidete mich sorgfältig für mein Treffen mit Darraugh Graham: mit einem schwarzen Wollrock, einer weißen Seidenbluse und meinen roten Magli-Pumps. Wenn man näher hinschaut, sieht man, daß das Leder schon ziemlich brüchig ist, so alt sind die Schuhe schon. Ich pflege sie nach Kräften mit Schuhcreme und Imprägniermitteln, neuen Sohlen und Absätzen, denn sie durch neue zu ersetzen, würde mich fast eine Monatsmiete kosten. Sie bringen mir Glück, diese Magli-Pumps. Vielleicht würde auch ein bißchen davon auf die Obdachlose in meinem Keller abfärben, wenn ich die Schuhe auf dem Weg in ihr Versteck trug.
Bevor ich wegging, kramte ich noch ein paar alte Decken und Pullover aus dem Schrank. Mittags hatte ich sicher ein bißchen Zeit, um sie ihr vorbeizubringen.
Es war erst zwanzig nach sieben, als ich die drei Stockwerke hinunterklapperte, so zeitig, daß ich die drei Häuserblocks von der Garage zu Grahams Büro nicht rennen mußte. Ich konnte es mir nicht leisten, mit heraushängender Zunge und wirrem Haar bei ihm anzukommen.
Die beiden Hunde, um die mein Nachbar unter mir und ich mich gemeinsam kümmern, hörten meine Schritte und begannen zu bellen. Bis Mr. Contreras endlich an die Tür kam, war ich schon zum Haus hinaus. Ich rief noch schnell zurück, daß ich am Abend mit den Hunden Gassi gehen würde, dann sprang ich in meinen Wagen und fuhr los.
Treffen mit Darraugh verlaufen im allgemeinen so trocken, daß ich das Gefühl habe, Kreide im Mund zu haben. Effiziente Untergebene und disziplinierte leitende Angestellte wurden hereingerufen, wenn es ihrer Sachkenntnis bedurfte, und sie verlasen ihre Berichte mit einer Ruhe, die einem Rolls-Royce-Getriebe alle Ehre gemacht hätte.
Wenn man früh dran ist, bekommt man im Sitzungssaal Kaffee und Brötchen. Bei der Gelegenheit höre ich die Geschichten von den Kindern, die ins Basketballtraining gehen, oder die Probleme mit der Schneefräse. Um Punkt acht schneit dann Darraugh höchstpersönlich herein, und alles eitle Geplauder verstummt. Es hat schon Tage gegeben, an denen ich noch schnell hinter ihm auf meinen Platz schlüpfte, mir einen frostigen Blick einhandelte und die spitze Aufforderung, etwas zu sagen, wenn ich noch dabei war, meinen Mantel auszuziehen und meine Unterlagen auf dem Tisch abzulegen. Aber die Zeiten sind vorbei. Schließlich werde ich bald vierzig. Und außerdem kann ich es mir nicht leisten, gefeuert zu werden.
Als Darraugh heute hereinmarschierte, hatte er einen ungepflegten jungen Mann im Schlepptau. Ich blinzelte. Selbst bei IBM hätte man in der absoluten Blütezeit nie so viele gestärkte Kragen und Nadelstreifen auf einen Haufen gesehen wie in Darraughs Sitzungszimmer. Jemand, der es wagte, mit einem Dreitagebart, schulterlangen Haaren, einem schmutzigen Sportsakko und Jeans zur Arbeit zu kommen, wäre sofort wieder in dem schwarzen Loch verschwunden, aus dem er gerade geschlüpft war. Ob der Typ wohl ein fehlgeleiteter junger Manager war, dessen Vertreibung aus dem Paradies wir nun alle persönlich beiwohnen durften?
Darraugh stellte ihn nicht vor, aber ein paar Männer neben mir begrüßten den Jungen mit einem vorsichtigen: »Hallo, Ken, wie geht’s?« Während der ganzen Sitzung schenkte Darraugh Ken so viel Beachtung wie einem leeren Stuhl. Der junge Mann förderte diesen Eindruck noch, indem er mit runden Schultern seine Gürtelschnalle anstarrte.
Nachdem Darraugh uns über den Konsens der Gruppe informiert und seine Sekretärin versprochen hatte, daß wir die Protokolle bis zwei bekommen würden, hob Ken schließlich den Kopf und machte Anstalten, aufzustehen.
»Einen Augenblick«, bellte Darraugh. »MacKenzie, Vic, würdet ihr bitte noch dableiben? Ich komm’ dann später zu dir runter, Charlie, um den Fall Netherlands zu besprechen. Ach ja, Luke, wir sehen uns um drei, oder? Wir müssen noch über die Anlage in Bloomington reden.«
Alle anderen verdrückten sich artig. Ken ließ sich wieder auf seinen Stuhl sinken, die Hände tief in den Taschen seiner Jeans vergraben, und stieß einen Seufzer aus, den die Linguisten weltweit als Zeichen der Verachtung für die gesamte Erwachsenenwelt deuten.
Darraugh hob die Hand, um seinen Krawattenknoten zurechtzurücken. »Darf ich vorstellen? MacKenzie Graham, mein Sohn. – Victoria Warshawski.«
»Dein Vertreter«, murmelte Ken in Richtung seiner Brust.
Darraugh tat so, als habe er ihn nicht gehört. »MacKenzie hat gerade Pause am College. Nur vorübergehend, wie wir hoffen.«
»Kann ich nachvollziehen«, rutschte es mir heraus.
Mein Klient machte ein finsteres Gesicht, aber Ken hob, plötzlich interessiert, den Kopf.
»Er studiert in Harvard. Das ist in unserer Familie seit zweihundert Jahren Tradition«, preßte Darraugh hervor.
»Wenn ich mit der Tradition gebrochen hätte und nach Yale gegangen wäre, sähe es jetzt auch nicht anders aus«, meinte Ken.
»Soll ich jetzt so was wie ein Frage- und Antwortspiel mit euch spielen oder was? Hätt’s denn einen Unterschied gemacht, wenn er nach Berkeley gegangen wäre?«
»Na klar«, herrschte Darraugh mich an. »Wenn er nach Yale oder Berkeley gegangen wäre, hätte er keine Bewährung – dann müßte er jetzt selber sehen, wie er sich sein Geld verdient. Aber die in Harvard geben ihm ein Jahr frei. Nächstes Jahr im Januar kann er dann wieder zurück, wenn er sich ordentlich aufführt …«
»Soll heißen, wenn ich in Gedanken, Worten und Werken rein wie ein Lämmchen bleibe«, fiel sein Sohn ihm ins Wort. »Man hat mich beim Hacken erwischt. Das machen alle, aber bestraft werden nur die, die man erwischt.«
»Was du nicht sagst. Und die anderen tausend Sachen verschweigst du einfach, nach dem Motto: Unterschlagen tut doch jeder, nur Iwan Boeski hat sich erwischen lassen.«
Ken wurde rot und starrte wieder seine Gürtelschnalle an. »Es ist nämlich so«, meinte Darraugh, »daß der junge Mann auch beim Staat Bewährung hat. Er hat sich einige geheime Akten des Energieministeriums angeschaut. Wenn ich nicht ein paar Leute in Washington kennen würde, müßte er jetzt fünf bis zehn Jahre in Leavenworth absitzen.«
»Dann hat es sich wenigstens gelohnt, daß du Alec Gantner die ganzen Jahre über soviel Geld hast zukommen lassen. Eine deiner besten Investitionen«, murmelte Ken.
»Freut mich, daß alles so glimpflich verlaufen ist«, sagte ich, so höflich ich konnte. »Ich hoffe, daß Sie Ihren Abschluß schaffen. Sie studieren doch Informatik, oder?«
»Nein, russische Literatur. Computer sind bloß mein Hobby.«
»Ich erzähle Ihnen das alles nicht, damit Sie sich drüber lustig machen können, Warshawski. Ich brauche Ihre Hilfe. Ken muß zweihundert Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Ich möchte, daß Sie das arrangieren.«
Ich schluckte ein paarmal. »Aber Sie sitzen doch in den ganzen Ausschüssen, oder? Im Förderkreis für die Symphoniker und so. Sie kennen doch sicher Dutzende von gemeinnützigen Einrichtungen, die ihn nehmen.«
»Um solche Sachen hat sich immer meine Frau gekümmert«, meinte Darraugh steif, als gestehe er eine Schwäche ein. »Und das Art Institute akzeptieren sie nicht als gemeinnützige Einrichtung. Ich zahle Ihnen natürlich Ihr übliches Honorar.«
Darraugh war seit fast zehn Jahren Witwer. Nach dem Tod seiner Frau hatte er sich in die Arbeit gestürzt, und irgendwann war das zur Gewohnheit geworden, er konnte nicht mehr anders.
»Ich wollte Schulkindern zeigen, wie man Hacker sein kann, ohne sich erwischen zu lassen, aber mein Bewährungshelfer hält das nicht für eine gute Idee.« Ken schaute mich so vielsagend an, als habe er mich eben auf eine Probe gestellt, die ich ohnehin nicht bestehen könne.
»Wie einfallslos. Tja, Darraugh, ich kenne eine ganze Reihe von Einrichtungen, die jemanden mit Computerkenntnissen brauchen könnten, aber ein Typ mit einem so lockeren Mundwerk kommt nicht gut an.«
»Die Sache ist mir wirklich wichtig, Vic.« Darraugh betonte seine Worte gerade genug, daß sie nicht nach einer Drohung klangen. »Ich möchte, daß ihr zwei auf einen Kaffee nach unten geht, um euch ein bißchen kennenzulernen. Überlegt mal, was euch einfällt.«
»Aye, aye, Captain.« Ken stemmte sich aus seinem Stuhl. »Müssen wir den Kaffee schwarz trinken, oder kann ich zwei Stück Zucker haben?«
Darraugh starrte ihn düster an, besaß aber genug gesunden Menschenverstand, um ihm nicht zu antworten. »Die Leute von der Bewährungshilfe werden allmählich ungeduldig. Bis nächste Woche müssen wir was vorweisen.«
Am liebsten hätte ich Kens militärisch-zackigen Gruß nachgemacht, aber schließlich war Darraugh nicht mein Vater – er war nicht verpflichtet, mich weiterhin zu bezahlen. Wir verließen das Sitzungszimmer schweigend zu dritt. Dann wandte sich Darraugh nach rechts und verschwand in Richtung seines Büros, während Ken und ich zum Aufzug gingen, wo wir wie Zombies auf den Lift zum Untergeschoß warteten. Dort hatte eine der neuen Caféketten eine Filiale eingerichtet. Wenigstens bekam ich da als kleinen Lohn für meine künftigen Bemühungen einen Cappuccino.
»Tja, dann sollten wir mal anfangen, uns kennenzulernen«, meinte Ken und lümmelte sich in eine Ecke. »Wie lange kennen Sie meinen Alten schon? Sie haben ja kaum den Mund aufgemacht, wenn er was gesagt hat.«
»Wie versessen sind Sie darauf, wieder an die Uni zurückzugehen?« konterte ich. »Ich weiß, daß Sie keinen Abschluß brauchen, um sich Ihren Lebensunterhalt zu verdienen – Ihr Vater läßt Sie schon nicht verhungern.«
»Beantworten Sie zuerst meine Frage, dann gebe ich Ihnen auch eine Antwort: So läuft das normalerweise.«
Ich nahm einen Schluck Kaffee. »Sie könnten Gruppen helfen, die Frauen und Kinder unterstützen, das ist das einzige, was mir einfällt. Da geht’s um Gewalt in der Familie, Abtreibungssachen, Frauenhäuser. Aber ich werde Sie nicht empfehlen, wenn Sie von einer berufstätigen Frau sofort denken, daß sie mit Ihrem Vater schläft. Mit solch altmodischem Gedankengut wären Sie da einfach fehl am Platz.«
Bis etwa zur Hälfte dessen, was ich sagte, lächelte er süffisant, aber bei der Andeutung, daß er altmodisch sein könnte, riß er den Kopf erstaunt und auch ein bißchen verletzt zurück. Das konnte nicht wahr sein – er war nur halb so alt wie ich.
»Ich möchte nicht wie eine angeschlagene Tomate herumgereicht werden, die mein Alter unbedingt an die Hausfrau bringen möchte.«
»Das verstehe ich. Aber Sie haben sich strafbar gemacht. Machen wir uns doch nichts vor: Es ist nun mal passiert. Und wahrscheinlich wissen Sie genau, daß Sie längst im Knast säßen, wenn Sie arm oder schwarz wären. Ihre Strafe ist es nun mal, eine Tomate zu sein. Wenn Sie sich gut führen, versuche ich, Sie zu befördern – zur Avocado, vielleicht auch zur Aubergine.«
Plötzlich mußte er lächeln, und das ließ ihn jünger, verletzlicher wirken. Doch schon nach ein paar Sekunden runzelte er wieder die Stirn und starrte seine Hände an.
»Ich weiß nicht, ob ich wieder zurück nach Harvard will. Da wissen alle Bescheid. Außerdem kann ich den Abschluß nicht zusammen mit meinem Jahrgang machen.«
»Dann gehen Sie eben nicht zurück. Schließlich gibt’s noch tausend andere Colleges im Land.«
»Aber bloß eins davon hat eine Bibliothek, wo ein ganzer Flügel nach den Grahams benannt ist. Für Darraugh wär’s weniger peinlich, mich im Knast zu besuchen, als zu erleben, daß ich meinen Abschluß an einer staatlichen Uni mache.«
Tja, die Kümmernisse der Reichen und Berühmten unterscheiden sich halt doch von den Ihren und den meinen. »Machen wir einen Deal: Sie führen sich ordentlich auf, da, wo ich Sie hinvermittle, und ich überrede Ihren Dad, daß er Sie auf das College Ihrer Wahl läßt.«
Ich hob die Hand, um seine Einwände im Keim zu ersticken. »Ich mache ihm klar, daß das eine gute Idee ist. Schließlich hätten viele Schulen nichts dagegen, wenn sie ihrer Bibliothek einen Graham-Flügel hinzufügen könnten, oder? Abgemacht?«
»Tja, wenn Sie meinen.« Er trank seinen Kaffee aus. »Wir haben uns immer noch nicht kennengelernt. Aber wenigstens weiß ich, daß Sie keinen Zucker in den Kaffee tun. Gehören Sie vielleicht auch zu den Frauen, die ständig Diät machen?«
»Nee. Ich mag bloß keinen süßen Kaffee.« Ich stand auf. »Am besten geben Sie mir Ihre Telefonnummer, damit ich nicht immer Ihren Vater anrufen muß, wenn ich Sie erreichen will.«
»Eigentlich sollten Sie mich jetzt fragen, warum ich Zucker in den Kaffee nehme«, sagte er. »So lernen wir uns kennen. Ich wohne jetzt bei Darraugh.«
Ich lächelte. »Aber ich habe seine Privatnummer nicht. Jetzt wissen Sie also mit letzter Sicherheit, daß Ihr Papa und ich nichts miteinander haben. Beruhigt Sie das?«
Er kritzelte die Nummer auf eine Serviette und reichte sie mir. »Vielleicht verstellen Sie sich ja bloß.«
Ich lachte. »Aber tief in Ihrem Innersten wissen Sie, daß ich das nicht tue. Ich melde mich.«
Ich stapfte die Rolltreppe hinauf und spürte dabei das Metall durch die dünnen Sohlen meiner Pumps vibrieren. Im Foyer holte Ken mich ein. Mit gespielter Galanterie packte er meine linke Hand und drückte mir einen Kuß auf die Innenfläche. Dann flitzte er durch die Drehtür, bevor ich reagieren konnte.
Schwierige Verhandlungen
Inzwischen war es nach eins. Das hieß, daß ich noch zehn Minuten Zeit hatte, im Pulteney vorbeizuschauen, bevor ich mich am Nachmittag mit einer Frau traf, die sich als Risikofinancier betätigte. Hätte ich doch bloß einen Keks zu meinem Cappuccino gegessen: Jetzt schaffte ich es nicht mal mehr, ein Sandwich runterzuschlingen.
Ich rannte die drei Stockwerke in den Keller des Pulteney-Gebäudes hinunter, konnte aber keine Spur von der Frau und ihren Kindern entdecken. Keine Fußabdrücke, kein Fetzen Butterbrotpapier – es war, als hätten sie nie existiert. Ich stellte die Tüte mit den Decken hinter einen Boiler und steckte einen Umschlag mit dem ganzen Bargeld, das ich entbehren konnte, dazu, dann raste ich über den Loop zu Phoebe Quirks Büro.
Phoebe und ich kannten uns schon seit Jahren – seit unserer Studienzeit, wo wir zusammen in einer Gruppe gegen die Kriminalisierung der Abtreibung arbeiteten, aus der ich auch Lotty kannte. Ich konnte sie damals ganz gut leiden, aber eng befreundet waren wir nie: Sie stammte aus den wohlhabenden Vororten, wo die Kids abgerissene Jeans anzogen und sich subversiven Gruppen anschlössen, um es ihren Eltern zu zeigen. In den Winterferien, wenn ich mir als Kellnerin ein paar Dollar verdiente, schloß sie gerade lange genug Frieden mit ihren Eltern, um mit der ganzen Familie am Mont Blanc Ski zu fahren.
Aber ihr Idealismus war echt: Nach einer wechselhaften beruflichen Laufbahn, in der sie nicht nur beim Friedenskorps gewesen war, sondern sich auch als Lehrerin an der High-School versucht hatte, war sie Neurologin geworden. Fünf Jahre lang war sie immer wieder mit dem Kopf gegen die unnachgiebige Wand der organisierten Medizin gerannt, bis sie dann eines Tages auf den Parkplatz des Lake Point Hospital fuhr, den Strom von Ärzten und Schwestern betrachtete, die ihren Autos entstiegen, umdrehte und wieder nach Hause fuhr.
Ein paar Monate später hatte sie sich einer kleinen Venture-Capital-Gesellschaft angeschlossen, Capital Concerns. Die Leute dort brauchten Phoebes Kontakte in der Welt der Medizin sowie ihr Know-how für die biotechnischen Ingangsetzungen, auf die sie sich spezialisiert hatten; natürlich hatten sie auch nichts gegen das Treuhandvermögen ihrer Großeltern. Phoebe gefielen die Aufregungen, die so eine Venture-Capital-Gesellschaft mit sich brachte. Sie bewies Talent, und Capital Concerns entsprach auch deshalb ihren Vorstellungen, weil das Unternehmen soziale Programme unterstützte.
Auf Anregung von Phoebe hatte sich Capital wegen Nachforschungen über einige ihrer möglichen zukünftigen Partner mit mir in Verbindung gesetzt. Im vergangenen Jahr war das Unternehmen zu einem meiner wichtigsten Kunden aufgestiegen. Beim heutigen Treffen ging es mehr um Projekte als um Kapital: Phoebe hatte sich bereit erklärt, einer von Conrads vier Schwestern, Camilla, bei der Gründung eines Handwerkerinnenkollektivs zu helfen.
Als ich in Phoebes Büro ankam, war Camilla bereits dort. Sie und Phoebe saßen lachend auf dem Sofa. Camilla trug ein schickes, figurbetonendes schwarzes Jerseykleid und sah nicht so aus, als hielte sie je etwas Schwereres als eine Nagelfeile in der Hand. Da hätte man eher Phoebe, die ihre teuren Kostüme heute so trug wie damals ihre abgerissenen Jeans, mit Schutzhelmen und Gerüsten in Verbindung gebracht. Sie hatte ein marineblaues Kostüm von Donna Karan an, an dessen Rock ein Knopf fehlte. Außerdem waren Kaffeeflecken auf ihrer Bluse.
»Komm rein, Vic. Camilla erzählt mir gerade von ihren ersten Erfahrungen mit sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Wenn sie als einzige Frau in der Schicht arbeitete, haben die Männer Tampons an rostigen Eisenteilen gerieben und die Dinger ins Waschbecken im Klo gelegt. Was glaubst du wohl, warum alle erfolgreichen Frauen eine Toilettengeschichte erzählen können, die ihre Initiation begleitet hat?«
Ich wollte gerade sagen, das bewiese wohl, daß ich keine erfolgreiche Frau war, doch dann fielen mir die Toiletten im Pulteney-Gebäude ein, die ständig verstopft und in den zehn Jahren, die ich nun schon dort war, noch kein einziges Mal repariert worden waren. Zum erstenmal wurde mir bewußt, daß die Herrentoiletten, obwohl auch alles andere als hübsch, immer irgendwie funktioniert hatten. Außerdem gab es davon in jedem Stockwerk eine.
»Das stärkt den Charakter. Oder doch zumindest die Muskeln. Apropos Toilettengeschichten: Ich bin inzwischen so was wie ein Klempner – ich kann einen vollen Werkzeugkasten drei Stockwerke hochtragen, ohne mit der Wimper zu zucken. Wie geht’s, Camilla?«
»Kann mich nicht beklagen, Vic. Wie geht’s Conrad? Ich hab’ nicht mehr mit ihm geredet, seit er Nachtschicht schieben muß.«
Camilla war ein Jahr jünger als Conrad und stand ihm von seinen Familienangehörigen am nächsten. Sehr zum Kummer ihrer verwitweten Mutter hatte sie sich gegen eine Verwaltungstätigkeit entschieden, für die sie aufgrund ihrer High-School-Ausbildung prädestiniert gewesen wäre, und statt dessen als Schweißerlehrling in den alten South Works angefangen. Als es mit der Stahlindustrie bergab ging, hatte sie Bauschreinerin gelernt und bei einem kleinen Bauunternehmen angefangen.
»Jetzt muß ich was anderes probieren«, hatte sie mir im vergangenen Sommer mitgeteilt. »Ich hab’ für anständige Kerle und für Arschlöcher gearbeitet; im allgemeinen haben die Arschlöcher überwogen. Aber keiner will mehr Frauen einstellen als unbedingt nötig. Wir werden das ändern und ein eigenes Unternehmen nur mit Frauen gründen. Wir müssen bloß irgendwo das Geld dafür herkriegen.«
Mein erster Gedanke war Sal gewesen, die ziemlich viele Immobiliengeschäfte abschloß, aber die Rezession machte ihr doch sehr zu schaffen, so daß sie keine neuen Projekte finanzieren konnte. Daraufhin hatte ich sie mit Phoebe zusammengebracht, die Camilla und fünf anderen Frauen dabei half, ihr Unternehmen zu gründen, dem sie den Namen Lamia gaben, nach einer alten, griechisch-libyschen Göttin.
Auf Phoebes Anregung hin hatten sie sich auf ein Projekt geeinigt, das sie alle interessierte: billige Wohnungen für alleinerziehende Mütter. Sie hatten einen Architekten gefunden, der ihnen die Pläne zeichnete, damit sie sich um Finanzierung, Baugenehmigung und alles andere kümmern konnten, was man so braucht, wenn man im Bauwesen gute oder auch schlechte Werke tun möchte.
»Wir haben gedacht, an der Baugenehmigung ist nicht mehr zu rütteln, aber plötzlich sieht das anders aus«, erklärte Camilla. »Und nicht nur das: Die Century Bank, die eigentlich einen großen Teil der Finanzierung übernehmen wollte, hat einen Rückzieher gemacht.«
»Und jetzt brauchen wir dich, Vic.« Phoebe grinste mich zahnlückig an, ein bewährtes Mittel, wenn sie etwas erreichen wollte.
»Nein«, sagte ich kurz angebunden.
»Was meinst du mit ›nein‹?« erkundigte sich Camilla.
»Ich meine, daß ich nicht in dem Rattennest im Rathaus rumstochern werde, um rauszufinden, wer da wem den Käse wegfrißt, um eure Genehmigung abzuwürgen.«
»Aber Vic«, fing Camilla an, doch Phoebe fiel ihr ins Wort.
»Vic, das ist ein wichtiges Frauenprojekt. Wir müssen herausfinden, was die Opposition zu solchen Handlungen treibt – liegt es daran, daß Lamia allein Frauen gehört? Oder geht’s um die billigen Wohnungen? Denn, um ehrlich zu sein, wir können das Projekt entsprechend ändern.«
Als Camilla einwarf, das Projekt sei zu wichtig, um abgeändert zu werden, winkte Phoebe ab. »Ich weiß, daß alle bei Lamia unbedingt billige Wohnungen für Frauen bauen wollen. Aber zuerst müssen wir das Geld auftreiben und euch einen Ruf zurechtzimmern. Wenn ihr den erst mal habt, könnt ihr euch die Sachen auch aussuchen.«
»Phoebe, du kennst doch die Leute von der Century Bank. Die verlangen für ihre Beratung nichts. Warum willst du mir das Geld in den Rachen werfen?«
Phoebe beugte sich zu mir herüber. »Wenn Interessenkonflikte zwischen der Bank und leitenden Beamten im Rathaus bestehen, vielleicht sogar mit den Gewerkschaften, dann werden die nicht mit mir reden wollen. Aber das könntest du feststellen. Außerdem habe ich gedacht, daß du deine Arbeitszeit für das Lamia-Projekt kostenlos zur Verfügung stellst, genau wie ich. Natürlich ersetzen wir dir die Auslagen.«
»Laß dir das noch mal durch den Kopf gehen. Solche Nachforschungen können mehrere Wochen dauern. Das kann ich mir nicht leisten.«
»Ich erledige die Laufereien für dich«, bot Camilla an. »Ich kann schon ein paar Stunden am Tag für meine eigene Sache erübrigen.«
Ich zog Phoebes Schreibtischstuhl herüber und setzte mich vor die beiden. »Hört mal zu, ihr zwei. Ich habe sechs Wochen Zeit, um ein neues Büro zu finden. Wenn ich hundert Stunden einfach so übrig hätte, würde ich nicht so in der Tinte sitzen. Aber jeder einzelne Auftrag, den ich in den nächsten sechs Monaten übernehme, muß was einbringen – sonst bin ich die erste, die bei Camilla vor der Tür steht und sich um eine ihrer neu gebauten Wohnungen bewirbt.«
»Zuerst mußt du noch ein Baby kriegen«, widersprach Camilla. »Die Wohnungen sind für alleinerziehende Mütter, Vic, nicht für arbeitslose Schnüfflerinnen.«
»Capital zahlt dir einen anständigen Vorschuß.« Phoebe runzelte die Stirn, einen Augenblick lang verärgert über uns beide.
»Willst du meine Bücher überprüfen, selber nachschauen, wo mein Geld hingeht?«
Sie wurde rot, ein paar Sommersprossen kamen über ihren Wangenknochen zum Vorschein. »Ich möchte, daß du dich einer wichtigen Klientin gegenüber entgegenkommender verhältst.«
Ich merkte, wie ich unwillkürlich das Kinn vorreckte. »Phoebe, ich weiß, du opferst deine Zeit für dieses Projekt als Zeichen deines guten Willens und deiner makellosen politischen Gesinnung. Aber ich würde wetten: Wenn ich deine Bücher prüfe, stelle ich fest, daß dein guter Wille von der Lamia-Gruppe honoriert wird, wenn die erst mal im richtigen Fahrwasser ist. Aber ich habe kein persönliches Vermögen, das ich dafür aufs Spiel setzen könnte. Du kennst ja das alte Sprichwort: Angestellte spielen zum Spaß mit dem Feuer; Arbeiterinnen verbrennen sich daran.«
»Das habe ich noch nie gehört«, herrschte sie mich an. »Und wenn du glaubst, daß ich bei der Sache nichts riskiere …«
»Nun hört mal zu, Mädels«, meinte Camilla. »Ich will nicht, daß ihr zwei euch wegen der Sache in die Haare kriegt und eure Freundschaft aufs Spiel setzt. Vic, warum investierst du nicht einfach mal – na ja, vielleicht zehn Stunden in die Sache und siehst dir an, wieviel Arbeit tatsächlich nötig ist? Wenn es wirklich so aufwendig ist, kann Phoebe dich ja dafür bezahlen.«
»Und wie sieht dein Beitrag zu deiner eigenen Sache aus?« wollte Phoebe wissen.
»Wenn jemand versucht, Vic abzuschießen, hole ich Conrad, schneller als die Bullen anrücken können.«
»Wofür wir dir beide sehr dankbar wären.« Conrads Reaktion auf eine solche Situation würde vermutlich folgendermaßen aussehen: Wenn ich wieder so unvorsichtig wäre, jemandem vor die Pistole zu laufen, würde er diese wahrscheinlich selbst in die Hand nehmen, um die Arbeit meines Angreifers zu beenden. Schließlich hatten wir beide uns schon zur Genüge über »unnötige« Risiken für Privatpersonen unterhalten.
Phoebe verzog das Gesicht. Sie wollte keinesfalls klein beigeben, obwohl sie genau wußte, daß ein Kompromiß unumgänglich war. »Fünfzehn Stunden, Vic, dann sehen wir weiter.«
»Na schön, Phoebe, aber das möchte ich schriftlich.«
»Camilla ist Zeugin.«
Ich schüttelte den Kopf. »Die unbezahlten Aufträge fressen einen auf, und am schlimmsten sind die gemeinnützigen Sachen. Schriftlich, sonst läuft nichts. Ich berechne dir auch keine volle Stunde für zehn Minuten Arbeit wie deine Rechtsberater. Bei mir sind fünfzehn Stunden fünfzehn Stunden.«
»Verdammt noch mal, Vic, du bist schon immer ein stures Aas gewesen.« Phoebe wies ihre Sekretärin über die Gegensprechanlage an, die nötige Vereinbarung zu tippen.
Während ich darauf wartete, daß Gemma den Vertrag hereinbrachte, notierte ich mir die Namen von ein paar Kontakten, die Phoebe bei der Bank und Camilla bei der Bezirksverwaltung hatten.
Weder Phoebe noch ich waren sonderlich glücklich, als ich Anstalten machte zu gehen, aber Camilla lachte und meinte: »Das erinnert mich an eine Nutte, die in der gleichen Straße gewohnt hat wie wir. Sie hatte das horizontale Gewerbe aufgegeben und eine Arbeitsvermittlung aufgemacht, aber sie riet uns Mädchen aus der Nachbarschaft immer, aufzupassen, daß der Kunde auch zahlt. ›So‹, hat sie immer gesagt, ›habt ihr nicht das Gefühl, daß ihr ausgenutzt werdet, und er fühlt sich nicht verpflichtet.‹«
»V. I. als Nutte? Der Gedanke gefällt mir«, sagte Phoebe und stand auf. »Ich hab’ noch einen Termin. Ihr müßt mich entschuldigen.«
Camilla fuhr im Aufzug mit mir nach unten. »Gib meinem Bruder einen dicken Kuß, wenn du ihn das nächste Mal siehst.«
Ich grinste. »Worauf du dich verlassen kannst.«
»Ich wollte sagen, von mir. Bis dann, Vic.«
Auf meinem Weg zurück ins Pulteney kaufte ich mir schnell einen Bagel mit Schweizer Käse. Ich hatte eigentlich vorgehabt, Phoebe wegen einer Beschäftigungsmöglichkeit für Ken Graham zu fragen, aber meine Verärgerung über ihre Forderungen hatte mich das Problem völlig vergessen lassen. Ich schaute mit finsterem Gesicht in den Spiegel über der Theke in dem Sandwichladen. Ich hatte einfach den Verstand verloren. Noch vor zehn Jahren, vielleicht sogar vor fünf, hätte ich Darraugh und Phoebe gesagt, sie sollten sich zum Teufel scheren. Aber das drohende Mittelalter dämpfte meine Risikofreudigkeit. Dieser neue Zug an mir gefiel mir gar nicht.
Als ich wieder im Pulteney war, legte ich eine Akte für das Lamia-Projekt an und gab die Daten pflichtschuldig in den Arbeitsspeicher meines Computers ein. In den letzten zehn Jahren hatte ich Hunderte solcher Jobs erledigt. Ich konnte das fast im Schlaf, aber das bedeutete nicht, daß es deswegen schneller ging. Im Gegenteil: Die Tatsache, daß mich die Tätigkeit anödete, machte mich langsamer.
Ich betrachtete den Bildschirm ein paar Minuten mit gerunzelter Stirn, als erschiene dadurch ein vollendeter Bericht auf seiner glänzenden Oberfläche. Mit bekümmertem Seufzen rief ich Lexis auf, die allwissende juristische Datenbank, und bekam eine Liste der Direktoren und leitenden Angestellten der Century Bank. Während diese Liste ausgedruckt wurde, befragte ich den Dow Jones News Service wegen Informationen zu Century. Im Elektronikzeitalter wäre die Sekretärinenausbildung für einen Privatdetektiv viel nützlicher als mein Jurastudium und die Jahre bei der Pflichtverteidigung.
Century ist eine winzige Bank in Uptown, die nur selten in der Zeitung erwähnt wird. Sie feierte in diesem Jahr ihr hundertjähriges Bestehen: Sie war 1892 im Rahmen des »Century of Progress« – des Jahrhunderts des Fortschritts – gegründet worden und machte sich jetzt für ein zweites Jahrhundert bereit. In der Sun-Times fand ich ein Foto von den Feierlichkeiten – wenn ich bereit war, eine geringe Gebühr zu entrichten, konnte ich es mir ausdrucken lassen. Ich nahm das Angebot nicht an.
Berichten des Herald-Star zufolge bemühte sich Century um die Anliegen der Leute aus dem Uptown-Viertel. Ein Auszug aus der Liste ihrer Kunden war der Story beigefügt, unter ihnen Home Free, die Organisation der Obdachlosenanwälte, die Deirdre unterstützte. Dow Jones berichtete außerdem von einem Interesse der JAD Holdings Group, die Bank zu kaufen. Diese Informationen waren alles andere als weltbewegend, aber nichtsdestotrotz ließ ich sie mir ausdrucken, um etwas in der Hand zu haben.
Vielleicht war ja so etwas wie eine Verschwörung zwischen Rathaus und Bank im Gange, aber wahrscheinlich ging es dabei um so kleine Fische, daß die Zeitung es nicht für nötig hielt, darüber zu berichten. Vielleicht interessierte sich ein höherer Kommunalbeamter für den Grund, auf dem Lamia bauen wollte, und hatte seinen Kollegen veranlaßt, die Baugenehmigung für Lamia zurückzunehmen. Ende der Geschichte.
Weil der Drucker so laut war, hatte ich nicht gehört, wie die Tür aufgegangen war. Als eine Hand mich an der Schulter packte, sprang ich vor Schreck so hoch, daß ich mit dem Knie gegen das Bein meines Schreibtisches knallte. Das Gespenst aus dem Keller stand hinter mir.
»Jessie braucht einen Arzt«, sagte die Frau. Ihre Augen funkelten wild, und sie hatte das Kinn angriffslustig vorgereckt, aber ihre Hände, die sie gegen die dicken Pulloverschichten preßte, zitterten.
»Sofort? Ist es ein Notfall?«
»Sie kann kaum noch atmen. Sie keucht und schnappt nach Luft. Ich hab’ sie nach oben gebracht, wie Sie gesagt haben, aber das hat ihr auch nicht geholfen.«
»Wo ist sie jetzt?« Es überraschte mich, daß sie die Kinder allein gelassen hatte, nach ihrer strikten Weigerung vom Vorabend, sie loszulassen.
»Zeigen Sie mir, wie Sie mir helfen können, dann sage ich es Ihnen.«