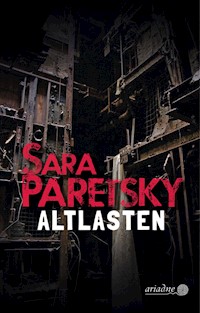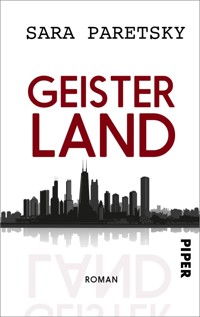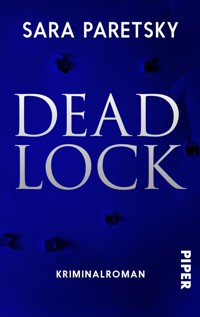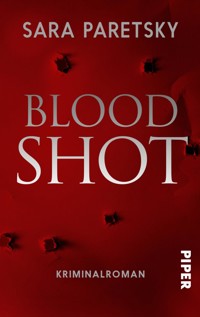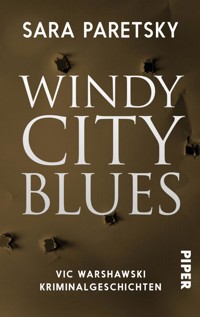12,23 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
»Vic ist die coole, starke Frau, von der wir alle ein bisschen träumen« Brigitte - Vic Warshawskis dritter Fall!
Die Privatdetektivin Vic Warshawski erhält einen überraschenden Anruf von ihrer Tante Rosa: Im Kloster St. Alban in Chicago sind Aktien im Wert von fünf Millionen Dollar als Fälschungen aufgedeckt worden. Die ungeliebte Tante, verantwortliche Buchhalterin, wird verdächtigt. Vic wittert einen größeren Skandal und hat Recht. Als Vics Freundin, eine Aktienexpertin, erschossen wird, steht für die Privatdetektivin fest, dass die Schuldigen nicht nur bei den Vertretern der Stadt zu suchen sind, sondern auch ganz oben in kirchlichen Kreisen.
»Mit Scharfsinn und hervorragenden Kenntnissen in der Wirtschaftskriminalität rollt Sara Paretsky den schmutzigen Chicagoer Aktienskandal auf« Der Spiegel
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher: www.piper.de
Übersetzt aus dem Amerikanischen von Katja Münch
ISBN 978-3-492-98372-3
© dieser Ausgabe, Piper Verlag GmbH, 2018
© 1984 Sara Paretsky
Published by arrangement with Sara and Two C-Dogs Inc.
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Deadlock«
© The Dial Press,New York 1984
© der deutschsprachigen Ausgabe: Piper Verlag GmbH, München 1988, 1998
Covergestaltung: Favoritbüro München
Covermotiv: Freedom Master/shutterstock
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
Inhalt
Cover & Impressum
Alte Wunden
Die Schatten der Vergangenheit
Der Predigerorden
Ein Wiedersehen
Frust
Onkel Stefans Beruf
Christliche Nächstenliebe
Der alte Fälscher
Schlußgeschäft
Mixed Grill
Säuretest
Trauerfeier
Nachtschicht
Frauen …!
Feueralarm
Das Glück ist launisch …
Der geschlagene Ritter
In der Mangel
Abendgesellschaft
Säuberungsarbeiten
Das Maß ist voll
Mönch auf Abwegen
Stelldichein in Lake Forest
Der Köder
Damengambit
Klar zum Gefecht
Abrechnung
Iphigenie
Dank
Alte Wunden
Mein Magen zog sich zusammen, als ich die Wagentür abschloß. Vor zehn Jahren war ich zuletzt in dem Haus in Melrose Park zu Besuch gewesen, doch ich hatte das Gefühl, es sei erst gestern gewesen. Auf dem schmalen gepflasterten Weg, der zum Seiteneingang führte, beschlich mich das gleiche Unbehagen, das ich schon als Kind empfunden hatte, und das Herz schlug mir bis zum Hals.
Der Januarwind wirbelte dürre Blätter um meine Füße. In diesem Winter war nur wenig Schnee gefallen, aber die Luft war schneidend kalt. Ich drückte auf den Klingelknopf, vergrub die Hände tief in den Taschen meines marineblauen Dufflecoats und versuchte mir einzureden, daß ich ja gar nicht nervös sei. Schließlich hatten sie mich angerufen, mich um Hilfe gebeten. Es nützte nichts. Als ich ihre Bitte erfüllte, hatte ich bereits die erste Schlacht verloren.
Ich stampfte auf den Boden, um meine in den leichten Slippers steifgefrorenen Zehen wieder beweglich zu machen. Endlich summte der Türöffner. Die blaugestrichene Tür führte in einen düsteren Vorraum. Hinter dem Fliegengitter erkannte ich meinen Vetter Albert. Er war in den letzten Jahren ziemlich dick geworden. Das Gitter und der dunkle Hintergrund sorgten jedoch dafür, daß man seinen Schmerbauch nicht so genau sah.
»Komm rein, Victoria. Mutter wartet schon.«
Ich verzichtete absichtlich auf eine Entschuldigung wegen meiner Verspätung und machte eine nichtssagende Bemerkung über das Wetter. Mit einiger Schadenfreude stellte ich fest, daß Albert schon fast eine Vollglatze hatte. Er nahm mir unbeholfen den Mantel ab und legte ihn über das Geländer der schmalen Holztreppe.
Eine tiefe Stimme fragte barsch: »Albert, ist es Victoria?«
»Ja, Mama«, brummte er.
Licht bekam die Diele nur durch ein winziges rundes Fenster gegenüber der Treppe, so daß sich das Tapetenmuster im Halbdunkel nicht erkennen ließ. Doch als ich Albert durch den Flur folgte, sah ich: es war noch das gleiche wie früher – weiße Kreise auf grauem Untergrund, häßlich und kalt. Als Kind hatte ich immer das Gefühl, von diesem Muster gehe etwas Böses aus. Auch diesmal, Alberts schwabbelnde Oberschenkel vor Augen, überfiel mich wieder diese Kälte, und ich fröstelte. Als ich noch klein war, hatte ich meine Mutter Gabriella oft genug angefleht, mich nicht mehr in dieses Haus mitzunehmen. Was sollten wir auch dort? Rosa haßte sie und mich, und nach der langen Heimfahrt mit der Hochbahn weinte meine Mutter jedesmal. Doch auf meine Bitten hatte sie stets nur verkrampft gelächelt und wiederholt: »Es ist meine Pflicht, cara. Ich muß sie manchmal besuchen.«
Albert führte mich ins Wohnzimmer. Die Polstersessel waren mir so vertraut wie meine eigenen vier Wände. In meinen Alpträumen sah ich mich gefangen in diesem Raum mit den klobigen Möbeln, den eisblauen Vorhängen, Onkel Carls trübseligem Bild über dem imitierten Kamin und mittendrin Rosa mit ihrer Habichtsnase, dürr, stirnrunzelnd und stocksteif auf einem dünnbeinigen Stuhl thronend.
Ihr schwarzes Haar war nun stahlgrau, doch hatte sie noch immer den strengen, mißbilligenden Blick. Einige tiefe Atemzüge sollten mir helfen, den Aufruhr in meinem Inneren zu bezähmen. Sie hat dich um den Besuch gebeten, rief ich mir ins Gedächtnis.
Sie begrüßte mich im Sitzen und verzog dabei keine Miene. Soweit ich mich entsinnen konnte, hatte ich sie noch niemals lächeln sehen. »Nett, daß du gekommen bist, Victoria.« Ihr Ton verriet, daß es besser gewesen wäre, pünktlich zu erscheinen. »Wenn man alt wird, fährt man nicht mehr so gern herum. Und in den letzten Tagen bin ich wirklich alt geworden.«
»Ach«, sagte ich unbestimmt. Ich setzte mich auf einen Stuhl, der etwas bequemer aussah als die übrigen. Rosa war ungefähr fünfundsiebzig. Bei der Autopsie stellte man eines Tages wahrscheinlich fest, daß ihre Knochen aus Gußeisen bestanden. Mir kam sie noch nicht alt vor, zumindest hatte sie noch keinen Rost angesetzt.
»Albert, gieße Victoria Kaffee ein.«
Rosas einzige Tugend war ihre Kochkunst. Den starken italienischen Kaffee nahm ich dankbar an, doch das Tablett mit den Leckereien, das Albert mir reichte, übersah ich – aus Angst, meinen schwarzen Wollrock mit Schlagsahne zu bekleckern und mir nicht nur verkrampft, sondern auch wie ein Trampel vorzukommen.
Albert saß mit einem Stück Königskuchen auf dem kleinen Sofa. Offensichtlich fühlte er sich nicht wohl in seiner Haut. Wenn er gekrümelt hatte, sah er verstohlen auf den Fußboden und schielte dann zu Rosa hinüber, um festzustellen, ob sie es bemerkt hatte.
»Dir geht's gut, Victoria? Bist du glücklich?«
»Ja«, erwiderte ich ruhig.
»Aber du hast nicht wieder geheiratet?«
Bei unserem letzten ungemütlichen Zusammentreffen hatte ich ihr den Mann vorgestellt, mit dem ich eine kurze Ehe geführt hatte. »Man kann auch ohne Ehepartner glücklich sein, wie Albert dir zweifellos bestätigen wird – und wie du ja auch selbst weißt.« Das war eine recht taktlose Bemerkung, denn Onkel Carl hatte sich kurz nach Alberts Geburt das Leben genommen. Nachdem ich meine Rachsucht befriedigt hatte, bekam ich Gewissensbisse. Schließlich war ich inzwischen alt genug, um nicht auf so schäbige Weise zurückschlagen zu müssen. Doch irgendwie brachte es Rosa immer fertig, mir das Gefühl zu vermitteln, ich sei erst acht Jahre alt.
Verächtlich hob Rosa die knochigen Schultern. »Du hast sicher recht. Allerdings bleibt mir die Freude versagt, Enkelkinder um mich zu haben.«
Albert wurde ein bißchen unruhig. Ganz offensichtlich bekam er diese Klage häufiger zu hören.
»Wie schade«, entgegnete ich. »Ich weiß, daß Enkel für dich die Krönung eines glücklichen und tugendsamen Lebens wären.«
Albert verschluckte sich beinahe, während Rosa ärgerlich die Brauen zusammenzog. »Gerade du solltest eigentlich wissen, weshalb ich kein glückliches Leben hatte.«
Der Zorn ging mit mir durch. »Rosa, du bist anscheinend der Meinung, daß Gabriella dein Glück zerstört hat. Ich kann mir nicht vorstellen, welches rätselhafte Leid dir ein achtzehnjähriges Mädchen zugefügt haben könnte. Du hast sie jedenfalls rausgeworfen und in der Großstadt sich selbst überlassen. Sie sprach kein Englisch – sie hätte umkommen können. Was sie dir auch getan haben mag: Es kann nicht so schlimm gewesen sein wie das, was du dir geleistet hast. Du weißt, daß ich nur gekommen bin, weil ich Gabriella versprechen mußte, dir im Notfall beizustehen. Das hat mir zwar niemals gepaßt, aber du siehst, ich bin hier. Lassen wir die Vergangenheit ruhen! Ich mache keine bösartigen Bemerkungen mehr, und du hörst auf, meine Mutter zu beleidigen. Sag mir lieber, wo dich der Schuh drückt.«
Rosa kniff die Lippen zusammen. »Noch nie ist mir etwas so schwergefallen, wie dich anzurufen. Ich hätte darauf verzichten sollen.« Ruckartig stand sie auf und verließ das Zimmer. Ihr wütender Schritt war auf dem blanken Dielenboden und auf der Treppe zu hören. Dann knallte eine Tür.
Ich setzte die Kaffeetasse ab und sah Albert an. Die Sache war ihm so peinlich, daß er knallrot anlief. Aber er wirkte nicht mehr so verschlafen wie in Rosas Gegenwart.
»Hat sie große Scherereien?«
Er wischte sich die Finger an der Serviette ab und faltete sie säuberlich. »Es reicht«, brummelte er. »Warum hast du sie auch so wütend gemacht?«
»Sie ärgert sich ja schon, wenn sie mich nur sieht. Am liebsten wär's ihr, ich läge auf dem Grund des Michigansees. Schon seit Gabriellas Tod ist sie so feindselig. Wenn ich ihr helfen soll, interessieren mich nur Fakten. Alles übrige soll sie sich für ihren Psychiater aufsparen. Der kriegt auch mehr dafür bezahlt.« Ich griff nach meiner Umhängetasche und stand auf. An der Tür drehte ich mich noch einmal um. »Denk bloß nicht, daß ich zur zweiten Runde wieder nach Melrose Park komme. Wenn du mir die Geschichte erzählen willst – gut. Aber wenn ich jetzt gehe, ist der Fall für mich erledigt. Rosa braucht in Zukunft auch die Familienbande nicht mehr zu bemühen. Und bevor ich's vergesse: Falls ihr mich engagieren wollt – ich arbeite nicht umsonst.«
Er starrte an die Decke, als erhoffe er sich eine Eingebung von oben – oder aus einem der hinteren Zimmer. Aber es blieb alles ruhig. Schließlich stand er verlegen auf. »Äh, hör mal. Am besten, ich erzähl's dir.«
»Gut. Können wir dazu in ein gemütlicheres Zimmer gehen?«
»Ja, sicher.« Zum ersten Mal an diesem Nachmittag lächelte er ein wenig. Ich folgte ihm über den Gang in ein winziges Zimmerchen auf der linken Seite. Es wurde fast ausschließlich von einer riesigen Stereoanlage und einer umfangreichen Platten- und Kassettensammlung eingenommen. Außer kaufmännischer Fachliteratur sah ich keine Bücher, dafür aber Erinnerungsstücke aus seiner High-School-Zeit und zwei oder drei Flaschen. Das Ganze war unschwer als sein eigenes Reich zu erkennen.
Er nahm in dem großen Schreibtischsessel aus Leder Platz und schob mir das danebenliegende marokkanische Sitzkissen zu. Hier in seinem Refugium wirkte er gelöster, sein Gesicht nahm einen beinahe entschlossenen Ausdruck an. Ich entsann mich, daß er Wirtschaftsprüfer war mit einem eigenen Büro. Wenn man ihn zusammen mit Rosa sah, konnte man sich kaum vorstellen, daß er ein paar Angestellte unter sich hatte, doch im Moment erschien das nicht mehr ganz so abwegig.
Er griff nach seiner Pfeife, und das übliche Ritual aller Pfeifenraucher begann. Wenn ich etwas Glück hatte, war ich schon weg, bevor sie endlich brannte. Rauchen macht mich krank, und bei leerem Magen – ich war zu aufgeregt gewesen, um zu Mittag zu essen – konnten die Folgen katastrophal sein.
»Wie lange bist du schon Detektivin, Victoria?«
»Ungefähr zehn Jahre.« Ich schluckte den Ärger wegen der Anrede »Victoria« hinunter. Natürlich heiße ich so. Nur: Wenn ich wollte, daß die Leute ihn benutzen, würde ich mich nicht überall mit meinen Initialen vorstellen.
»Und du kannst was?«
»Naja – das hängt davon ab, worum es geht. Möglicherweise bin ich die Beste, die du kriegen kannst … Ich habe eine Liste bei mir, falls du auf Referenzen Wert legst.«
»Ja, gut – nenne mir einen oder zwei Namen, bevor du gehst.« Er war immer noch mit seiner Pfeife beschäftigt. »Mutter ist in eine Sache mit gefälschten Wertpapieren hineingeschlittert.«
Tolle Phantasien schossen mir durch den Kopf: Rosa, das geheime Haupt der Unterwelt von Chicago! Ich sah bereits die riesigen Schlagzeilen im Herald-Star.
»Was heißt hier hineingeschlittert?«
»Man hat ein paar dieser Aktien im Safe des Sankt-Albert-Klosters gefunden.«
Ich seufzte innerlich. Albert legte es offensichtlich darauf an, die Sache in die Länge zu ziehen. »Und sie hat sie ihnen untergejubelt? Was macht sie überhaupt in diesem Kloster?«
Jetzt wurde es spannend. Albert strich ein Zündholz an und sog an der Pfeife, bis süßlicher blauer Dunst seinen Kopf einhüllte und zu mir herüberwehte. Mir wurde übel.
»Mutter führt dort seit über zwanzig Jahren die Bücher. Ich dachte, du wüßtest das.« Er machte eine kleine Kunstpause, um mir Gelegenheit zu geben, Schuldgefühle wegen mangelnden Familiensinns zu entwickeln. »Natürlich mußten sie sie beurlauben, als die Fälschungen entdeckt wurden.«
»Weiß sie etwas darüber?«
Er zuckte die Achseln. Seiner Meinung nach wußte sie von nichts. Ihm waren weder Art noch Anzahl der Papiere bekannt, noch konnte er sagen, wann sie zuletzt überprüft worden waren oder wer sonst noch Zugang zum Safe hatte. Der neue Prior wollte sie verkaufen, um mit dem Erlös das Kloster zu renovieren.
»Die Verdächtigungen haben ihr das Herz gebrochen.« Er bemerkte meinen zweifelnden Blick und fügte beinahe entschuldigend hinzu: »Du kannst dir natürlich nicht vorstellen, daß sie ein Herz hat, weil sie in deiner Gegenwart immer erregt ist und lospoltert. Sie ist fünfundsiebzig, und sie hing sehr an der Arbeit. Sie möchte, daß ihre Unschuld bewiesen wird, damit sie den Posten wieder übernehmen kann.«
»Ich nehme an, daß sich das FBI um die Sache kümmert.«
»Sicher. Aber die würden sie ihr liebend gern anhängen, wenn sie sich's damit leichter machen könnten. Wer stellt schon gern einen Geistlichen vor Gericht? Sie in ihrem Alter käme dagegen mit einer Bewährungsstrafe davon.«
Ich glaubte, nicht recht zu hören. »Aber Albert! Du bist da nicht ganz auf dem laufenden. So könnte man allenfalls mit einem armseligen Schwarzen von der West Side umgehen, aber nicht mit Rosa. Zunächst kämen die bei ihr an die falsche Adresse. Und dann wird das FBI der Sache natürlich auf den Grund gehen wollen. Kein Mensch dort würde glauben, daß eine alte Frau die Chefin einer Fälscherbande ist.« Immer vorausgesetzt, sie war es nicht wirklich. Aber Rosa war wohl boshaft, doch keine Betrügerin.
»Dem Kloster gehört aber ihre ganze Liebe«, brach es aus ihm heraus. Er lief rot an. »Und irgend jemand könnte meinen, daß sie eben doch mit der Sache zu tun hat. Du weißt doch, wie die Leute sind.«
Nach einigem Hin und Her zog ich meinen Standardvertrag in doppelter Ausfertigung aus der Tasche und bat Albert um seine Unterschrift. Ich gewährte ihm Familienrabatt – sechzehn Dollar pro Stunde statt der üblichen zwanzig.
Er sagte mir noch, daß der neue Prior Boniface Carroll meinen Anruf erwarte. Albert schrieb den Namen auf ein Blatt Papier, auf das er mir bereits den Weg zum Kloster skizziert hatte. Stirnrunzelnd steckte ich es ein. Sie waren sich meiner Hilfe ja recht sicher gewesen. Aber hatte ich nicht schon im voraus mein Einverständnis gegeben, als ich mich aufmachte nach Melrose Park?
Bevor ich in meinen Wagen stieg, massierte ich mir die Stirn. Die kalte, klare Luft würde hoffentlich den Pfeifenrauch aus meinem schmerzenden Kopf vertreiben. Ich warf einen Blick zurück zum Haus. Ein Vorhang bewegte sich an einem Fenster im ersten Stock. Die Vorstellung, von Rosa wie von einem kleinen Mädchen oder einem Dieb heimlich beobachtet zu werden, erheiterte mich und stärkte mein Selbstwertgefühl.
Die Schatten der Vergangenheit
Ich erwachte schweißgebadet. Es dauerte einen Augenblick, bis ich mich in der Wirklichkeit zurechtfand. Im Traum hatten mich Gabriellas Augen riesengroß aus dem bereits vom Tode gezeichneten, verhärmten Gesicht angestarrt. Auf Italienisch hatte sie mich um Hilfe angefleht.
Die Zeiger der Digitaluhr standen auf halb sechs. Ich biß fröstelnd die Zähne zusammen und zog mir die Steppdecke bis unters Kinn.
Mit fünfzehn verlor ich meine Mutter. Sie starb an Krebs. Als die Krankheit sich immer mehr in ihr schönes Gesicht fraß, nahm sie mir das Versprechen ab, daß ich mich um Tante Rosa kümmern würde, falls sie je Hilfe brauchte. Vergeblich versuchte ich, Gabriella umzustimmen, und zu guter Letzt versprach ich es ihr.
Mehr als einmal hatte mir mein Vater erzählt, wie er meine Mutter kennengelernt hatte. Er war Polizist gewesen. Rosa hatte Gabriella einfach auf die Straße gesetzt. Meine Mutter hatte schon von jeher mehr Mut als gesunden Menschenverstand besessen. Sie versuchte, sich mit Singen über Wasser zu halten, das war das einzige, was sie konnte. Leider wußte man in den Bars der Milwaukee Avenue, in denen sie vorsprach, mit Puccini oder Verdi wenig anzufangen, und mein Vater kam ihr zu Hilfe, als eine Horde Männer sie eines Tages zum Striptease zwingen wollte. Weder er noch ich hatten je verstanden, weshalb sie den Kontakt zu Rosa aufrechterhielt.
Mein Herz schlug wieder ruhiger, doch an Schlaf war nicht zu denken. Zähneklappernd tappte ich zum Fenster und schob die schweren Vorhänge beiseite. Der Wintermorgen war stockfinster. Wie dünner Nebel rieselte der Schnee herab. Obwohl ich vor Kälte zitterte, stand ich wie verzaubert, eingehüllt von der tröstenden Dunkelheit.
Erst nach einer ganzen Weile ließ ich den Vorhang wieder zufallen. Um zehn war ich mit dem Prior von Sankt Albert in Melrose Park verabredet. Weshalb also nicht gleich aufstehen?
Um in Form zu bleiben, jogge ich selbst im Winter täglich an die acht Kilometer. Auf meinem Spezialgebiet, der Wirtschaftskriminalität, kommt es zwar selten zu Gewalttätigkeiten, doch meines Erachtens ist Laufen das beste Mittel, um Gewichtsprobleme, die durch übermäßigen Pasta-Genuß entstehen könnten, in den Griff zu bekommen. Diät liegt mir nämlich noch weniger als Sport.
Im Winter trage ich beim Joggen ein leichtes Sweatshirt, bequeme Hosen und eine Daunenweste. Ich wärmte mich im Bett auf, zog mich dann an, spurtete durch den Gang und die drei Stockwerke hinunter. Draußen hätte ich mein Vorhaben wegen des scheußlichen feuchtkalten Wetters fast aufgegeben. Obwohl sich die Straßen bereits mit den ersten Pendlern füllten, war es für mich noch sehr früh. Sonst wachte ich erst Stunden später auf.
Bei meiner Rückkehr hatte sich der Himmel kaum aufgehellt. Vorsichtig stieg ich die Stufen zu meiner Wohnung hinauf. Sie sind sehr ausgetreten und bei Nässe schlüpfrig. Ich sah mich schon mit meinen durchnäßten Joggingschuhen ausrutschen und mir auf dem alten Marmor den Schädel einschlagen.
Meine Wohnung wird von einem langen Gang in zwei Hälften geteilt und wirkt dadurch größer. Eßzimmer und Küche liegen links, Schlafzimmer und Wohnzimmer rechts. Aus unerfindlichen Gründen hat die Küche eine Tür zum Bad. Ich ließ die Dusche laufen und machte mir nebenan Kaffee.
Meine Joggingsachen muffelten ein bißchen, würden es aber für eine Runde gerade noch tun. Ich warf sie über die Stuhllehne und genoß die heiße Dusche. Nach einigen Minuten wohliger Entspannung bemerkte ich plötzlich, daß ich leise eine traurige Melodie sang, die ich von Gabriella kannte. Offenbar stand ich völlig unter dem Eindruck meiner Begegnung mit Rosa; denn wie wäre ich sonst zu dem Alptraum gekommen, zu der Vorstellung, ich könnte mir den Schädel einschlagen, zu der tristen Melodie? Sollte Rosa endgültig die Oberhand gewinnen? Energisch massierte ich Shampoo in mein Haar und wechselte zu Brahms über, obwohl mir seine Lieder mit wenigen Ausnahmen nicht gefallen. »Meine Liebe ist grün wie der Fliederbusch« ist jedoch von einer Heiterkeit, die beinahe weh tut.
Nach der Dusche suchte ich meine Garderobe aus. Gereift und würdevoll wollte ich aussehen, und das hoffte ich mit meinem marineblauen Kostüm – dreiviertellange, doppelreihig geknöpfte Jacke und schicker Faltenrock – zu erreichen. Ergänzt wurde der Aufzug durch einen Seidenpulli in hellem Gold, fast im selben Ton wie meine Haut, und einen langen hellrot und marineblau gemusterten Seidenschal, abgesetzt mit dem Goldton des Pullovers. Farblich passendes Make-up und zehenfreie italienische Pumps gaben dem Ganzen den letzten Schliff.
Das Frühstücksgeschirr wanderte zu dem anderen schmutzigen Geschirr in den Ausguß. Aber das Bett blieb ungemacht, und die Kleider lagen kunterbunt umher. Vielleicht sollte ich mein Geld lieber für eine Haushälterin ausgeben statt für italienische Mode? Oder, noch besser, für eine Hypnosebehandlung, um mein gestörtes Verhältnis zu Ordnung und Sauberkeit wieder ins Lot zu bringen? Ich frage mich nur, wozu.
Der Predigerorden
Die Eisenhower-Schnellstraße ist die wichtigste Ausfallstraße, die in die westlichen Vororte Chicagos führt. Selbst an warmen, sonnigen Tagen wirkt sie wie ein Gefängnishof mit den heruntergekommenen Häusern und den gesichtslosen Bauten links und rechts neben den achtspurigen Fahrbahnen, die tief unten wie Canyons zwischen Lärmschutzwällen liegen. Auch um drei Uhr morgens ist dort noch allerhand los. Aber um neun an einem Wochentag, noch dazu bei Matschwetter, herrscht hier das absolute Chaos.
Ich spürte die nervöse Spannung in meinen Nackenmuskeln, als ich im Schneckentempo dahinschlich. Mich mit einem wildfremden Menschen über die Schwierigkeiten zu unterhalten, in die meine verhaßte Tante geraten war, hatte ich nicht die geringste Lust. Aber nun saß ich deswegen noch stundenlang im Verkehr fest und erfror mir in meinen offenen Pumps die Zehen, weil die Heizung in meinem kleinen Omega nicht funktionierte.
Der Verkehrsfluß normalisierte sich in Höhe der First Avenue; viele Büroangestellte hatten dort ihr Ziel erreicht. Ich nahm die nördliche Ausfahrt zur Mannheim Road und folgte im Zickzackkurs Alberts flüchtig skizziertem Plan. Fünf nach zehn stand ich endlich vor dem Klostereingang. Meine Laune wurde durch die Verspätung nicht gerade besser.
Zum Kloster St. Albertus Magnus gehörte ein großer neugotischer Bau am Rande eines herrlichen Parks. Offenbar hatte der Architekt geglaubt, dieses Gebäude müsse einen Gegensatz zur Schönheit der Natur bilden; drohend und düster lag das graue Gemäuer hinter dem Schneeschleier. Ein kleines Schild mit der Aufschrift Kolleg wies auf den nächstliegenden Betonblock. Als ich vorbeifuhr, huschten einige Männer in langen weißen Kutten hinein. Mit den tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen sahen sie wie mittelalterliche Mönche aus. Sie nahmen keine Notiz von mir.
Ich parkte in der kreisförmigen Auffahrt und hastete zum nächsten Eingang. Ein Schild verkündete schlicht: Sankt-Albert-Kloster.
In dem Gebäude herrschte die ein wenig unheimliche und zugleich beschauliche Atmosphäre wie häufig in kirchlichen Institutionen. Man ahnt, daß die Menschen dort viel beten, sich aber vielleicht auch oft langweilen und gedrückter Stimmung sind. Über der Eingangshalle verlor sich eine Betonkuppel im Dämmerlicht. Marmorfliesen verbreiteten zusätzliche Kälte. Von der Halle führte ein Korridor im rechten Winkel in den Klosterbereich. Meine Absätze klapperten laut. Hinter einem schäbigen Holzschreibtisch in einer Nische vor dem Treppenaufgang saß ein magerer junger Mann in Straßenkleidung und las in Charles Williams' Greater Trumps. Widerwillig legte er das Buch aus der Hand, nachdem ich ihn ein paarmal angesprochen hatte. Sein Gesicht war ungewöhnlich hager. Er schien sich in fanatischer Askese zu verzehren – doch möglicherweise litt er auch nur an einer Überfunktion der Schilddrüse. Immerhin beschrieb er mir in gehetztem Flüsterton den Weg zum Büro des Priors und vertiefte sich danach gleich wieder in seine Lektüre.
Zu meiner Erleichterung befand ich mich wenigstens im richtigen Gebäude, denn inzwischen hatte ich schon eine Viertelstunde Verspätung. Ich begegnete einem Grüppchen von Männern im weißen Habit, die leise, aber heftig miteinander diskutierten. Am Ende des Korridors wandte ich mich nach rechts. Auf der einen Seite lag die Kapelle und auf der anderen das Büro des Priors, wie der magere junge Mann beschrieben hatte.
Reverend Boniface Carroll telefonierte gerade. Er lächelte mir zu und deutete auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch, setzte jedoch sein Gespräch fort. Carroll war ein zerbrechlich wirkender Mann um die Fünfzig. Seine weiße Kutte war mit den Jahren gelblich geworden. Er sah sehr müde aus; immer wieder rieb er sich die Augen, während er dem Anrufer zuhörte. Das Büro war sehr spartanisch eingerichtet. Einziger Wandschmuck war ein Kruzifix. Auf dem Boden lag ein abgetretener Teppich.
»Sie ist zufällig hier, Mr. Hatfield … Nein, nein. Ich glaube, ich sollte mit ihr reden.«
Ich zog die Brauen hoch. Der einzige Hatfield, den ich kannte, arbeitete beim Betrugsdezernat des FBI – ein tüchtiger junger Mann, dem aber leider jeder Sinn für Humor fehlte. Wenn sich unsere Wege kreuzten, brachten wir uns in der Regel gegenseitig zur Weißglut, weil er mein respektloses Gerede stets mit Hinweisen auf die Allmacht des FBI konterte.
Carroll beendete das Gespräch und wandte sich mir zu. »Miss Warshawski, nicht wahr?« Seine Stimme war angenehm klar, mit einem leichten Oststaatenakzent.
»Ja.« Ich reichte ihm meine Karte. »War das eben Derek Hatfield?«
»Vom FBI – ja. Er ist in Begleitung von Ted Dartmouth von der Finanzaufsichtsbehörde hiergewesen. Ich weiß zwar nicht, wie er von unserem Termin erfahren hat, doch er bat mich, nicht mit Ihnen zu reden.«
»Sagte er auch, warum?«
»Seiner Meinung nach sind in diesem Fall das FBI und die Finanzaufsichtsbehörde zuständig. Er meinte, daß Sie als Amateurin die Untersuchung unter Umständen erschweren könnten.«
Gedankenverloren strich ich mir über die Oberlippe. An den Lippenstift dachte ich erst, als ich seine Spuren auf meinem Zeigefinger entdeckte. Ruhe bewahren, Vic. Die logische Konsequenz wäre, sich mit einem höflichen Lächeln von Pater Carroll zu verabschieden; schließlich hatte ich ihn, Rosa und meinen Auftrag auf dem ganzen Weg hierher verflucht. Wenn ich allerdings ein bißchen Opposition spüre – besonders, wenn sie von Leuten wie Derek Hatfield kommt –, dann kann ich meine Meinung sehr rasch ändern.
»So etwas Ähnliches habe ich gestern zu meiner Tante gesagt. Das FBI und die Finanzaufsicht haben Routine in der Aufklärung derartiger Fälle. Aber die alte Dame ist eben aufgescheucht und hätte gern jemanden aus der Familie an ihrer Seite. Ich arbeite seit zehn Jahren als Privatdetektivin, häufig auf dem Gebiet der Wirtschaftskriminalität. Ich habe einen guten Ruf. Sie können gern bei einigen Leuten in der Stadt Referenzen einholen, falls Ihnen mein Wort nicht genügt.«
Carroll lächelte. »Regen Sie sich nicht auf, Miss Warshawski. Sie müssen sich nicht anpreisen. Ich habe Ihrer Tante versprochen, mit Ihnen zu reden, und ich glaube, das ist das mindeste, was wir ihr schuldig sind. Sie hat dem Sankt-Albert-Kloster lange Jahre treu gedient, und es traf sie sehr hart, als wir sie baten, Urlaub zu nehmen. Obwohl es mir in der Seele zuwider war, habe ich jeden darum gebeten, der Zugang zum Safe hatte. Sie weiß, daß sie uns wieder herzlich willkommen ist, sobald die Angelegenheit geklärt ist. Sie ist sehr tüchtig.«
Ich nickte. Ganz sicher war Rosa eine tüchtige Finanzverwalterin. Mir schoß der Gedanke durch den Kopf, daß sie wahrscheinlich nicht so mürrisch wäre, wenn sie ihre Energie in eine berufliche Karriere hätte investieren können – zum Beispiel als Vermögensverwalterin einer Firma.
»Im Grunde weiß ich gar nicht, was eigentlich passiert ist«, sagte ich zu Carroll. »Erzählen Sie mir doch mal das Ganze: wo der Safe steht, wie Sie auf die Fälschungen gestoßen sind, um welche Beträge es sich handelt, wer an die Papiere herankonnte oder davon wußte. Ich frage dann schon, wenn mir etwas unklar ist.«
Wieder bedachte er mich mit seinem zurückhaltenden, liebenswürdigen Lächeln, dann stand er auf, um mir den Safe zu zeigen, der sich in einem Lagerraum hinter dem Büro befand – einen uralten Geldschrank aus Gußeisen mit Kombinationsschloß. Er stand in einer Ecke mitten zwischen Papierstapeln, einem antiquierten Vervielfältigungsapparat und Stößen von Gebetbüchern.
Ich kniete mich hin, um ihn genauer anzusehen. Natürlich war jahrelang die gleiche Kombination verwendet worden, und das bedeutete, daß jeder sie herausbringen konnte, der eine Zeitlang dort gearbeitet hatte. Weder das FBI noch die Polizei von Melrose Park hatten Spuren von Gewaltanwendung gefunden.
»Wie viele Leute gehen hier im Kloster ein und aus?«
»Wir haben einundzwanzig Studenten im Kolleg und elf Geistliche, die unterrichten. Außerdem kommen tagsüber etliche Leute zur Arbeit. So wie Ihre Tante zum Beispiel oder das Küchenpersonal. Die Brüder bedienen bei Tisch und waschen das Geschirr ab, aber wir haben drei Frauen, die für uns kochen, und zwei Leute für die Pforte – den jungen Mann, der Ihnen vermutlich den Weg zu mir gezeigt hat, und eine Frau für die Nachmittagsschicht. Und natürlich noch eine Menge Leute aus der Nachbarschaft, die in der Kapelle am Gottesdienst teilnehmen.« Wieder lächelte er. »Wir Dominikaner lehren und predigen. Im allgemeinen betreuen wir keine Kirchengemeinde, aber die Nachbarn betrachten das hier als ihre Kirche.«
Kopfschüttelnd bemerkte ich, daß es schwierig sei, eine solche Anzahl von Leuten zu überprüfen. »Wer hatte denn offiziell Zugang zum Safe?«
»Mrs. Vignelli natürlich« – das war Rosa – »und ich, ferner der Finanzbevollmächtigte und der Kollegvorstand. Bei der jährlichen Buchprüfung werden die Wertpapiere von unseren Revisoren stets mit kontrolliert. Aber ich glaube kaum, daß ihnen die Zahlenkombination bekannt ist.«
»Weshalb verwahrten Sie die Sachen nicht in einem Bankschließfach?«
Er zuckte die Achseln. »Das habe ich mich auch gefragt. Aber ich wurde erst letzten Mai ernannt.« Das Lächeln stahl sich in seine Augen. »Ich habe mich nicht um den Posten bemüht. Aber weil ich zu keiner Clique hier gehöre, war ich anscheinend der bequemste Kandidat. Nun, auf jeden Fall ist das meine erste Erfahrung in der Klosterverwaltung. Alles war neu für mich, und ich wußte auch nicht, daß wir hier Papiere im Wert von fünf Millionen Dollar liegen hatten.«
Mir lief es kalt über den Rücken. Fünf Millionen Dollar!
Und jeder, der vorbeikam, konnte sie sozusagen mitnehmen. Ein Wunder, daß man sie nicht schon vor Jahren beiseite geschafft hatte.
Ruhig und sachlich erzählte mir Pater Carroll Einzelheiten über die Aktien. Es handelte sich samt und sonders um erstklassige Wertpapiere, die dem Kloster vor zehn Jahren von einem wohlhabenden Mann aus Melrose Park vermacht worden waren.
Das Kloster war vor fast achtzig Jahren erbaut worden. Es war ziemlich renovierungsbedürftig. Er deutete auf einige Risse im Verputz und auf einen großen braunen Fleck an der Decke.
»Am dringendsten sind die Reparaturen am Dach und an der Heizungsanlage. Ich hielt es für sinnvoll, einen Teil der Papiere zu verkaufen und das Geld für die Renovierung zu verwenden. Die Gebäude sind unser Hauptkapital. Wenn sie auch häßlich und ungemütlich sind, ein Neubau kommt im Augenblick nicht in Frage. Deshalb legte ich die Angelegenheit dem Orden zur Entscheidung vor. Am Montag darauf hatte ich in der Stadt einen Termin bei einem Makler. Wir beschlossen, Papiere im Wert von achtzigtausend Dollar zu verkaufen. Er hat sie bei uns abgeholt.«
Eine Woche lang geschah nichts. Dann hatte der Makler telefonisch mitgeteilt, daß der Fort Dearborn Trust, der das Wertpapiergeschäft abwickeln sollte, die Aktien überprüft und entdeckt hatte, daß es sich um Fälschungen handelte.
»Könnte nicht der Makler oder der Bankier hier einen kleinen Tausch vorgenommen haben?«
Er schüttelte bedauernd den Kopf. »Daran hatten wir als erstes gedacht. Aber alle übrigen Papiere sind ebenfalls gefälscht.«
Stumm saßen wir uns gegenüber. Die Aussichten waren äußerst trübe.
»Wissen Sie, wann die Papiere zum letzten Mal auf ihre Echtheit überprüft wurden?«
»Keine Ahnung. Ich habe mich mit den Buchprüfern in Verbindung gesetzt. Aber die stellen nur fest, ob die Papiere vorhanden sind. Der FBI-Mann hielt die Fälschungen für fast perfekt. Sie wurden nur entdeckt, weil die Firmen, die die Aktien ausgegeben haben, andere Seriennummern verwendeten.«
Ich seufzte. Wahrscheinlich mußte ich noch mit dem ehemaligen Prior, dem Kollegvorstand und dem Finanzbevollmächtigten reden. Carrolls Vorgänger befand sich für ein Jahr in Pakistan, wo er eine Schule der Dominikaner leitete, aber der Kollegvorstand und der Finanzbevollmächtigte waren im Haus und würden beim Mittagessen anwesend sein.
»Sie sind uns als Gast herzlich willkommen.« Als ich ihn irritiert ansah, erklärte er mir, daß im allgemeinen nur Ordensbrüder Zutritt zum Refektorium hätten; hier habe man allerdings die Bestimmungen etwas gelockert. »Das Essen ist nicht berühmt, aber Pelly und Jablonski sind dort leichter zu erreichen.« Er schob den Ärmel zurück, um auf seine Uhr mit dem breiten Lederband zu sehen. »Fast zwölf. Die Leute dürften jetzt schon vor dem Refektorium versammelt sein.«
Auf meiner Uhr war es zwanzig vor zwölf. Mein Beruf hatte mir schon Schlimmeres beschert als ein mittelprächtiges Essen. Ich nahm die Einladung an. Sorgfältig verschloß der Prior die Tür des Lagerraums. »Eigentlich ist das grotesk«, meinte er. »Bevor die Fälschungen entdeckt wurden, sind wir ohne Schloß ausgekommen.«
Wir folgten den Männern im weißen Habit, die an Carrolls Büro vorbeistrebten. Die meisten grüßten ihn; mir warfen sie verstohlene Blicke zu. Am Ende des Ganges befanden sich zwei Schwingtüren. Durch die Glasscheiben im oberen Teil konnte ich ins Refektorium blicken. Es sah aus wie ein Gymnastiksaal, den man in eine Mensa verwandelt hatte: lange Eßtische, Klappstühle aus Metall, keine Tischdecken, grüngestrichene Wände. Carroll nahm meinen Arm und führte mich durch das Gedränge zu einem untersetzten Mann mittleren Alters mit einer grauen Ponyfrisur. »Stephen, darf ich Sie mit Miss Warshawski bekannt machen? Sie ist Privatdetektivin und eine Nichte von Rosa Vignelli.« Und zu mir gewandt: »Das ist Pater Jablonski. Seit sieben Jahren ist er bei uns Kollegvorstand … Stephen, schauen Sie doch mal, ob Sie Augustin irgendwo entdecken. Miss Warshawski möchte auch mit ihm sprechen.«
Ich konnte nicht einmal mehr irgendeine Höflichkeitsfloskel von mir geben, denn Carroll wandte sich bereits in lateinischer Sprache an die Versammelten. Nachdem sie im Chor geantwortet hatten, rasselte er etwas herunter, was sich nach einem Tischgebet anhörte. Alle schlugen das Kreuz.
Das Essen war miserabel – Tomatensuppe aus der Dose und Käse auf Toast. Jablonski stellte mich dem Finanzbevollmächtigten Augustin Pelly und etlichen anderen am Tisch vor. Sie wurden »Brüder«, nicht »Pater« genannt; ihre Namen vergaß ich sofort wieder, weil sie in ihren weißen Gewändern alle gleich aussahen.
»Miss Warshawski will's dem FBI zeigen«, meinte Jablonski leutselig. Er übertönte mühelos das allgemeine Stimmengewirr.
Pelly musterte mich von Kopf bis Fuß. Er war beinahe so hager wie Pater Carroll und auffallend braungebrannt. Wie kam ein Mönch mitten im Winter zu dieser Bräune? Seine Augen wirkten kühn und wachsam. »So wie ich Stephen kenne, sollte das wohl ein Witz sein, Miss Warshawski – aber offensichtlich ist mir die Pointe entgangen.«
»Ich bin Privatdetektivin.«
Pellys Augenbrauen gingen in die Höhe. »Sie wollen herausfinden, was mit unseren verschwundenen Papieren passiert ist?«
»Nein. Da könnte ich mit dem FBI nicht konkurrieren. Ich bin Rosa Vignellis Nichte und soll ihr ein bißchen Schützenhilfe leisten. Falls ihr Derek Hatfield zu sehr auf den Pelz rückt, will ich ihn daran erinnern, daß im Lauf der Jahre eine Unzahl von Leuten Zugang zum Safe hatte.«
Lächelnd bemerkte Pelly, daß Rosa in seinen Augen nicht gerade zu den hilflosen Frauen zählte. Ich mußte grinsen. »Bestimmt nicht, Pater. Aber sie ist auch nicht mehr die Jüngste. Wie dem auch sei – sie befürchtet, daß sie möglicherweise nicht mehr hier arbeiten kann.« Ich biß in meinen Käsetoast.
Jablonski erwiderte: »Hoffentlich weiß sie, daß Augustin und ich bis zur endgültigen Klärung der Angelegenheit ebenfalls keinen Zugang zu den Büchern haben. Sie steht also nicht allein da.«
»Vielleicht könnten Sie mal bei ihr anrufen. Das gibt ihr sicher Auftrieb … Sie wissen bestimmt, daß sie keinen großen Freundeskreis hat. Unser Kloster war sozusagen der Mittelpunkt ihres Lebens.«
Pelly fand den Vorschlag vernünftig. »Ich wußte gar nicht, daß sie außer ihrem Sohn noch Familie hat. Von Ihnen oder irgendwelchen polnischen Verwandten hat sie nie gesprochen, Miss Warshawski.«
»Mit Verwandtschaftsverhältnissen werde ich mich nie auskennen. Hat sie tatsächlich polnische Verwandte, nur weil mein Vater Pole war? Oder glauben Sie etwa, daß ich mich als ihre Nichte ausgebe, um mich ins Kloster einzuschleichen?«
Jablonski lächelte spöttisch. »Jetzt, wo die Papiere weg sind, lohnt sich das gar nicht mehr. Es sei denn, Sie hätten insgeheim ein Faible für Mönche.«
Ich mußte lachen, doch Pelly blieb ernst. »Ich nehme doch an, Sie haben dem Prior Ihre Papiere gezeigt.«
»Dafür gab's keinen Grund. Er wollte mir ja keinen Auftrag erteilen. Natürlich habe ich meinen Detektivausweis bei mir, aber damit ist noch nicht bewiesen, daß ich Rosa Vignellis Nichte bin. Rufen Sie doch bei ihr an.«
Pelly hob beschwichtigend die Hand. »Mir geht's ja nur um das Kloster. Wir sind von der augenblicklichen Publicity alles andere als begeistert. Außerdem schadet sie unseren Studenten.« Mit einer Handbewegung wies er auf die eifrig lauschenden jungen Männer an unserem Tisch. »Selbst wenn Sie die Nichte des Papstes wären, hätte ich etwas dagegen, daß Sie hier noch mehr Aufruhr verursachen.«
»Das sehe ich ein. Aber ich verstehe auch Rosas Standpunkt. Sie machen sich's sehr einfach mit ihr. Soll sie doch sehen, wo sie bleibt. Sie hat keine mächtige Organisation mit politischem Einfluß hinter sich wie Sie.«
Pelly sah mich eisig an. »Ich möchte dazu nicht Stellung nehmen, Miss Warshawski. Aber Sie spielen vermutlich auf die weitverbreitete Legende von der politischen Macht der katholischen Kirche an – auf den direkten Draht vom Vatikan zur Regierung der Vereinigten Staaten. Dafür ist mir jedes Wort zu schade.«
»Ich bin da anderer Ansicht. Wir könnten sogar sehr angeregt diskutieren. Zum Beispiel darüber, wie die Gemeindepfarrer bei Wahlen auf Stimmenfang gehen.«
Jablonski wandte sich mir zu. »Ich finde, es gehört zu den moralischen Verpflichtungen der Geistlichen, den Gliedern ihrer Gemeinde die geeigneten Kandidaten zu empfehlen.«
Ich spürte, wie mir das Blut zu Kopfe stieg, doch ich lächelte verbindlich. »Nun, es gibt in den Steuergesetzen ganz eindeutige Bestimmungen hinsichtlich politischer Betätigung und Steuerfreiheit. Wenn Bischöfe und Priester für bestimmte Kandidaten Partei ergreifen, so begeben sie sich damit auf eine steuerliche Gratwanderung. Bis jetzt wollte sich nur noch kein Gericht mit der katholischen Kirche anlegen.«
Pelly wurde unter seiner Bräune rot vor Wut. »Ich habe den Eindruck, Sie wissen überhaupt nicht, wovon Sie reden. Vielleicht beschränken Sie Ihre Äußerungen lieber auf die Punkte, die Sie für den Prior klären sollen.«
»In Ordnung. Fangen wir gleich einmal mit dem Kloster an. Gibt es hier jemanden, der sich aus irgendeinem Grund fast fünf Millionen Dollar unter den Nagel reißen würde?«
»Nein«, erwiderte Pelly kurz. »Alle haben das Gelübde der Armut abgelegt.«
Geistesabwesend ließ ich mir von einem Bruder noch eine Tasse des kaum genießbaren dünnen Kaffees einschenken.
»Die Papiere sind vor zehn Jahren in Ihren Besitz gelangt. Jeder hätte sie an sich nehmen können, der hier ein und aus ging. Wechseln die Mönche hier häufig?«
»Eigentlich heißen sie Klosterbrüder«, fuhr Jablonski dazwischen. »Mönche sind seßhaft, Brüder ziehen von Kloster zu Kloster. Was meinen Sie mit ›wechseln‹? Jedes Jahr verlassen verschiedene Studenten das Kloster – aus unterschiedlichen Gründen. Auch unter den Ordensleuten gibt es Zu- und Abgänge. Manche Lehrer kommen aus anderen Dominikanerklöstern zu uns oder wandern dorthin ab. Pater Pelly ist zum Beispiel gerade von einem sechsmonatigen Aufenthalt in Ciudad Isabella zurückgekehrt. Er hat in Panama studiert, und es zieht ihn immer wieder hin.«
Daher also die Bräune. »Wir können vermutlich alle ausschließen, die in andere Klöster übergewechselt sind. Aber was ist mit den jungen Männern, die während der letzten zehn Jahre aus dem Orden ausgetreten sind? Könnten Sie herausfinden, ob einer von ihnen jemals eine Erbschaft erwähnt hat?«
Pelly zuckte verächtlich die Achseln. »Ich denke schon – obwohl mir das gegen den Strich ginge. Wenn junge Leute dem Orden den Rücken kehren, dann tun sie es im allgemeinen nicht, weil sie das Luxusleben vermissen. Wir suchen unsere Novizen sehr sorgfältig aus. Ein potentieller Dieb würde uns wahrscheinlich auffallen.«
In diesem Augenblick trat Pater Carroll an den Tisch. Das Refektorium leerte sich langsam. Die Männer standen auf dem Gang in Grüppchen zusammen. Ein paar starrten mich an. Zu denen, die noch an unserem Tisch verweilten, sagte der Pater: »Sind nächste Woche nicht Prüfungen? Sie haben bestimmt noch zu arbeiten.« Ein wenig verlegen verabschiedeten sie sich.
»Wie kommen Sie voran?« fragte mich Carroll und nahm Platz.
Pelly runzelte die Stirn. »Wir haben uns ein paar wüste Anschuldigungen gegen die Kirche anhören müssen, insbesondere einen heftigen Angriff gegen die jungen Männer, die im letzten Jahrzehnt ausgeschieden sind. Nicht unbedingt das, was man von einer guten Katholikin erwarten würde.«
Ich hob protestierend die Hand. »Pater Pelly, ich bin gar nicht katholisch … Ja, wir treten auf der Stelle. Ich muß mit Derek Hatfield reden. Mal sehen, ob er mir verrät, wo das FBI den Hebel ansetzt. Sie müßten feststellen, ob hier bei Ihnen jemand ein geheimes Konto hat. Einer von den Brüdern etwa, möglicherweise auch meine Tante. Wenn sie sich an den Papieren vergriffen hätte, dann sicher nicht, um sich zu bereichern. Sie lebt sehr sparsam. Aber vielleicht wollte sie mit dem Geld eine karitative Einrichtung unterstützen. Das wäre auch bei jedem von Ihnen denkbar.«
Rosa als heimliche Wohltäterin – das war eine Vorstellung, die mir gefiel, wenn auch nichts darauf hindeutete. Ich konnte mir kaum denken, daß sie sich überhaupt einer Sache mit so viel Selbstlosigkeit widmen konnte, um dafür zur Diebin zu werden.
»Pater Pelly, als Finanzbevollmächtigter wissen Sie vielleicht, ob die Papiere jemals auf ihre Echtheit überprüft worden sind. Falls das bei der Übergabe nicht geschehen ist, haben Sie sie unter Umständen bereits als Fälschungen übernommen.«
Pelly schüttelte den Kopf. »Das ist uns noch nie in den Sinn gekommen. Kann sein, daß wir zu weltfremd sind, um mit Aktien umzugehen, aber ich glaube, so etwas tut kein Mensch.«
Hier mußte ich ihm zustimmen. Ich stellte ihm und Jablonski noch einige Fragen, doch beide waren nicht besonders entgegenkommend. Pellys Antworten fielen sogar ausgesprochen frostig aus. Selbst Jablonski war das nicht entgangen.