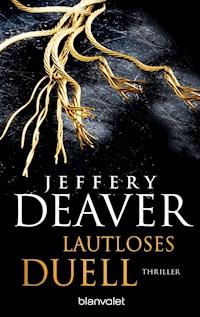7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Mit der Ruhe in New Lebanon, Indiana, ist es vorbei, als zwei Studentinnen ermordet werden. Bei seinen Ermittlungen stößt Detective Bill Corde zunächst auf die Finanzmisere des College-Direktors. Da kommt es in seinem eigenen Haus zu Ereignissen, die seine Familie in größte Angst versetzen. Bill befürchtet, dass der Täter ihn persönlich in das Verbrechen verwickeln will. Als er sein privates Umfeld genauer unter die Lupe nimmt, wird er auf einen jungen Professor aufmerksam, der seiner Tochter Nachhilfestunden erteilt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 775
Ähnliche
Jeffery Deaver
Blutiger Mond
Thriller
Deutsch von Marcel Bieger
Buch
Mit der Ruhe in New Lebanon, Indiana, ist es vorbei, als zwei Studentinnen ermordet werden. Bei seinen Ermittlungen stößt Detective Bill Corde zunächst auf die Finanzmisere des College-Direktors. Da kommt es in seinem eigenen Haus zu Ereignissen, die seine Familie in größte Angst versetzen. Bill befürchtet, dass der Täter ihn persönlich in das Verbrechen verwickeln will. Als er sein privates Umfeld genauer unter die Lupe nimmt, wird er auf einen jungen Professor aufmerksam, der seiner Tochter Nachhilfestunden erteilt …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat der von seinen Fans und den Kritikern gleichermaßen geliebte Jeffrey Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag
Die Originalausgabe erschien 1993 unter dem Titel »The Lesson of Her Death« bei Doubleday, New Yok
Die deutsche Erstausgabe erschien 1995 unter dem Titel »Tod im Hyazinthenbeet« beim Knaur Verlag.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
E-Book-Ausgabe 2016 Copyright der Originalausgabe © 1993 by Jeffery Deaver Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1995 by Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München Copyright dieser Ausgabe © 2016 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlaggestaltung: © www.buerosued.deUmschlagmotiv: © Arcangel Images/Malcolm Brice
ISBN 978-3-641-20167-8V002
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de
Für Carla Norton
Inhaltsverzeichnis
TEIL EINS
1
Mit jeder Meile, die sie hinter sich brachten, wurde ihr das Herz ein bisschen schwerer.
Das neunjährige Mädchen, das in sich zusammengesunken auf dem Beifahrersitz saß, rieb mit einem Finger über die abgewetzte beigefarbene Armlehne. Der Fahrtwind, der durch das geöffnete Seitenfenster hereindrang, blies der Kleinen eine blonde Strähne ins Gesicht. Sie strich sie sich aus der Stirn und sah den ernst dreinblickenden und grauhaarigen, fast vierzigjährigen Mann hinter dem Steuer an. Er fuhr vorsichtig und schaute stur auf die lange weiße Kühlerhaube des Wagens.
»Bitte«, sagte das Mädchen.
»Nein.«
Sie legte die Hände in den Schoß.
Wenn er an der nächsten Ampel anhalten musste, würde sie vielleicht aus dem Auto springen.
Wenn er die Geschwindigkeit nur ein kleines bisschen herabsetzte …
Ob es wohl sehr wehtun würde, fragte sie sich, wenn man sich aus einem Wagen in das hohe Gras am Straßenrand fallen ließ?
Sie stellte sich vor, wie sie über die grünen Halme rollte und die kühlen Tautropfen auf Gesicht und Händen spürte.
Aber was dann? Wohin sollte sie laufen?
Vor ihnen sprang eine Ampel auf Grün, und das Mädchen zuckte zusammen, als wäre neben ihm eine Kanonenkugel abgefeuert worden. Der Wagen bog ab und rumpelte durch die Einfahrt in Richtung eines niedrigen Ziegelsteingebäudes. Das Mädchen begriff, dass damit die letzte Chance zur Flucht vorbei war.
Das Auto kam zum Stehen, und die Bremsen quietschten leise. »Gib mir einen Kuss«, sagte der Mann, beugte sich über sie und öffnete ihren Sicherheitsgurt. Der Gurt schnellte hoch, aber sie hielt sich daran fest, als hinge ihr Leben davon ab. »Ich will nicht. Bitte!«
»Sarah!«
»Nur heute nicht, bitte!«
»Nein.«
»Lass mich nicht allein.«
»Raus mit dir!«
»Ich bin noch nicht so weit.«
»Tu dein Bestes.«
»Ich habe Angst.«
»Da ist nichts, wovor du …«
»Bitte, lass mich nicht allein!«
»Hör zu«, sagte er hart, »ich bin ganz in der Nähe. Drüben am Blackfoot Pond. Das ist nicht mal eine Meile entfernt.«
Ihr Vorrat an Einwänden war erschöpft. Sarah öffnete die Wagentür, blieb aber sitzen.
»Gib mir einen Kuss.«
Sie beugte sich zu ihm und küsste ihn rasch auf die Wange. Dann stieg sie aus dem Auto in die kühle Frühlingsluft, die unangenehm nach Busabgasen stank. Sarah machte drei Schritte auf das Gebäude zu und verfolgte dann, wie der Wagen aus der Einfahrt fuhr. Sie musste an die Garfield-Puppe denken, die an der Heckscheibe des Kombiwagens klebte. Ihr fiel wieder ein, wie sie sie selbst dort befestigt hatte. Zuerst hatte sie über die Saugnäpfe geleckt und dann das Kuscheltier an die Scheibe gedrückt. Aus irgendeinem Grund hätte sie bei dieser Erinnerung am liebsten laut losgeheult.
Vielleicht würde er einen Blick in den Rückspiegel werfen, sie in ihrer Not sehen, seine Meinung ändern und zurückkehren.
Der Wagen verschwand hinter einer Kuppe.
Sarah drehte sich um und betrat das Gebäude. Sie hielt ihre Frühstücksbox fest an die Brust gepresst, während sie durch die Flure schlich. Obwohl sie so groß war wie die anderen Kinder, die hier herumschwärmten, fühlte sie sich doch kleiner als sie. Und ihnen unterlegen. Schwächer.
Vor der Tür zu ihrem Klassenzimmer blieb sie stehen und warf einen Blick hinein. Ihre Nasenflügel blähten sich auf, und sie hatte solche Angst, dass sie eine Gänsehaut bekam. Nach einem Moment des Zögerns machte sie auf dem Absatz kehrt und marschierte fest entschlossen aus dem Gebäude. Sie erhielt manchen Stoß und Knuff, als sie sich gegen den Strom lärmender, lachender und rufender Kinder bewegte.
Kaum zehn Meter von der Stelle entfernt, an der man letzte Nacht die Leiche gefunden hatte, entdeckte er den Zettel.
Das Stück Papier, das an einen Rosendorn geheftet und von getrocknetem Blut rotbraun gefärbt war, flatterte in der feuchten Morgenbrise und schien seine Botschaft in das noch fahle Sonnenlicht hinauszumorsen.
Bill Corde kämpfte sich durch das Gewirr von Wacholdersträuchern, Ahornschößlingen und Forsythienranken zu dem Zettel vor.
Hatten die Beamten den Fetzen gestern Nacht übersehen? Kaum vorstellbar.
Er schlug sich an einer herausragenden Wurzel das Schienbein auf und fluchte leise, doch das brachte ihn nicht davon ab, weiter zu dem Papier vorzudringen.
Corde war einsfünfundachtzig groß und fast vierzig. Doch sein kurz geschnittenes Haar, das grau wie das einer Perserkatze war, ließ ihn älter erscheinen. Seine Haut war noch ziemlich blass für die Jahreszeit, aber er hatte in dieser Saison erst zweimal Gelegenheit gefunden, angeln zu gehen. Aus der Ferne wirkte er schlank, doch ihm war nur zu bewusst, dass der Bauch sich mehr über den Gürtel wölbte, als ihm lieb sein konnte. Corde trieb nicht viel Sport, und wenn, dann Softball. Am heutigen Morgen, wie an jedem anderen auch, war sein Diensthemd sauber und steif wie frisches Balsaholz, und die Bügelfalte an seiner beigefarbenen Uniformhose war rasiermesserscharf.
Corde tat im New Lebanon Sheriff’s Department als Detective Dienst und bekleidete den Rang eines Lieutenants.
Er erinnerte sich an diesen Ort, weil er vor kaum zwölf Stunden schon einmal hier gewesen war – vergangene Nacht, als das einzige Licht von den Taschenlampen der Deputies und dem fahlen Schein des Halbmonds gekommen war. Er hatte seinen Männern befohlen, das ganze Gebiet abzusuchen. Sie setzten sich aus zwei Gruppen zusammen. Die einen waren jung und nüchtern (die vom Militär gekommen waren) und die anderen jung und arrogant (die die Polizei-Akademie besucht hatten), aber alle waren mit Ernst bei der Sache. Obwohl sie wahre Virtuosen waren, wenn es darum ging, Drogenabhängige festzunehmen, auffällige Autofahrer anzuhalten oder bei Ehestreitigkeiten zu vermitteln, war ein Mord etwas Fremdes für sie. Alles, was sie darüber wussten, stammte aus Schundromanen oder Krimiserien im Fernsehen. Genauso wie sie ihre Waffenausbildung eher auf herbstlichen Stoppelfeldern als in der Schießanlage der Akademie erhalten hatten. Und letzte Nacht hatte man sie ausgeschickt, einen Tatort zu untersuchen, und das hatten sie dann auch mit Verbissenheit und Eifer getan. Aber keiner von ihnen hatte den Zettel entdeckt, zu dem Bill Corde sich gerade durchkämpfte.
Ach, du armes Mädchen …
… die liegt am Fuße eines drei Meter hohen Erddamms …
… die liegt in dieser kalten Nässe von Schlamm, niedrigem Gras und blauen Blumen …
… deren dunkles Haar gescheitelt, deren Gesicht lang und deren Hals dick ist. Ihre runden Lippen sind verzogen. Jedes Ohr trägt drei drahtdünne Goldringe. Ihre Zehen sind lang und schmal, die Zehennägel mit burgunderrotem Lack angemalt …
… die liegt auf dem Rücken, ihre Arme über der Brust gefaltet, so als hätte der Leichenwäscher sie schon zurechtgemacht. Die pinkfarbene Bluse ist bis zum Hals zugeknöpft. Ihr Rock bedeckt züchtig die Knie …
»Wir haben ihren Namen. Sie heißt Jennie Gebben und ist Studentin.«
Letzte Nacht hatte sich Bill Corde über die Leiche gebeugt – sein Knie hatte protestiert – bis sein Gesicht dem ihren ganz nahe war. Der perlweiße Halbmond hatte sich in ihren toten, aber noch nicht glasig gewordenen haselnussbraunen Augen widergespiegelt. Er hatte Gras, Methan, Ausscheidungen, Minze von ihren Lippen und Parfum von ihrer Haut gerochen. Düfte, die wie Dampf aus einer Pastete von ihr aufstiegen.
Er hatte sich wieder erhoben und war hinauf auf den Damm gestiegen, der das schmutzige Wasser des Blackfoot Pond festhielt, und hatte von oben auf sie hinabgeblickt. Das bleiche Licht des Mondes wirkte wie aus einer anderen Welt oder ein Special Effect in einem Film. In diesem Schein hatte man den Eindruck, als rührte sich Jennie Gebben. Keine lebendigen, normalen menschlichen Bewegungen, sondern mehr ein Zucken und ein Sich-Winden, so als verschmölze sie mit dem Schlamm. Corde hatte ihr, oder besser ihren Überresten, ein paar Worte zugeflüstert und dann den Beamten dabei geholfen, das Gelände abzusuchen.
Und jetzt, in der strahlenden Helligkeit des Morgens, schob er sich durch einen letzten Forsythienbusch und erreichte endlich den Rosenstrauch. Mit der Hand, die in einem dünnen Plastikhandschuh steckte, zog er den Zettel von den Dornen.
»Die ganze Scheißgegend?«, rief Jim Slocum.
Corde gab ihm keine Antwort. Die Jungs vom Sheriff’s Department hatten wohl gestern Nacht doch nicht so schlampig gearbeitet. Sie konnten das Papier nicht übersehen haben, weil es aus der heutigen Ausgabe des Registers stammte.
»Das ganze … äh … Terrain?«, fragte Slocum noch einmal.
Corde sah auf. »Ja, alles, von oben bis unten.«
Der Polizist murrte etwas vor sich hin und fuhr damit fort, das Gebiet rund um die Frauenleiche mit gelbem Plastikband zu umzäunen. Slocum war der dienstälteste Deputy der Polizeitruppe von New Lebanon und stand im Rang direkt hinter Corde. Er war ein muskulöser Mann mit einem runden Kopf und langen Ohren. 1974 hatte er sich das Haar auf Streichholzkopflänge schneiden lassen und diese Frisur bis zum heutigen Tag beibehalten. Außer zu Jagdausflügen oder Weihnachtsbesuchen bei den Schwiegereltern verließ er das County nur selten. Während er das Band abwickelte, pfiff er eine unidentifizierbare Melodie.
Ein kleiner Trupp Reporter hatte sich an der Straße zusammengefunden. Von Corde würden sie nichts erfahren, aber sie stammten alle aus der Gegend, und weil sie sich anständig verhielten, durften sie auch bleiben. Der heilige Reportereifer, eine gute Story zu ergattern, war ihnen allen anzumerken, doch sie störten die Beamten nicht bei der Arbeit und begnügten sich damit, ein paar Bilder zu schießen und den Tatort zu begutachten. Wahrscheinlich wollten sie, dachte Corde, Atmosphäre für ihre morgen erscheinenden Artikel und Berichte einfangen, die vermutlich wieder von Adjektiven und düsteren Menetekeln nur so strotzen würden.
Corde schob das Papier in eine Plastiktüte und sah sich um. Rechts stieg das Land vom Damm aus zu einem großen Wald an, welcher von der Route 302 durchschnitten wurde, einem Highway, der erst zu einem riesigen Einkaufszentrum, dann zu einem Dutzend Landstraßen, einem halben Dutzend State Highways und zwei Expressways und schließlich zu den neunundvierzig anderen Bundesstaaten und zwei benachbarten Ländern führte, wohin sich der flüchtige Mörder gewandt haben konnte, um dort unerkannt und sorglos bis ans Ende seiner Tage unterzutauchen.
Corde ging auf den Wald zu, presste die Lippen aufeinander und ließ den Blick über die Baumreihen wandern. Slocum und er waren vor fünf Minuten, genau um acht Uhr dreißig, hier eingetroffen. Der Register wurde ab sieben Uhr fünfzehn ausgetragen und in die Kioske gebracht. Wer immer das Stück Zeitung hier zurückgelassen hatte, musste das während der letzten halben Stunde getan haben.
Mit einem Ohr dem Summen des Windes lauschend, der über Stacheldraht blies, untersuchte er den Boden unter dem Rosenbusch. An zwei Stellen war er wie von Schuhsohlen eingedrückt, doch in dem matschigen Untergrund hätte das auch von wer weiß was sonst sein können. Er drehte mit der Fußspitze einen erst vor kurzem abgefallenen Ast um. Ein Schwarm von Insekten, die wie winzige Gürteltiere aussahen, schwirrte davon. Corde marschierte den Damm hinauf und stützte sich auf die grünen Metallrohre, die dort als Geländer in den Boden eingelassen waren.
Tiefe Falten bildeten sich auf seiner Stirn, als er im Licht des Morgens das vom Wind bewegte Wasser des Teichs betrachtete. Der Wald erstreckte sich vor ihm bis zum Horizont, Hektar um Hektar, eingeschlossen in den durchbohrenden Strahlen.
Hör! …
Er legte den Kopf schief und hielt das Ohr dem Lichtstrom entgegen.
Schritte!
Er blickte noch einmal ins Herz der Baumreihen und hob eine Hand, um die Augen vor dem grellen Licht abzuschirmen. Doch alles schien vor ihm zu tanzen, und die Strahlen stachen in seine Augen. Er konnte alles und doch nichts sehen.
Wo?
Seine Hand wanderte langsam nach unten, bis sie den Griff seines Dienstrevolvers erreicht hatte.
Den größten Teil des Weges rannte sie.
Die Entfernung zwischen der New Lebanon Grade School und dem Blackfoot Pond betrug drei Meilen entlang der 302 (auf der zu gehen ihr strikt untersagt war), aber nur eine halbe Stunde durch den Wald – und für diese Route entschied sie sich.
Sarah mied die Marschgebiete, doch nicht etwa wegen möglicher Gefahren – sie kannte jeden Weg und Pfad in allen Wäldern rings um New Lebanon – sondern weil sie befürchtete, die Schuhe schmutzig zu machen, die ihr Vater gestern Abend auf Hochglanz poliert hatte; ganz zu schweigen davon, sich die mit Rosen bedruckten Kniestrümpfe zu ruinieren, die Großmutter ihr zu Weihnachten geschenkt hatte. Deshalb verließ sie nicht den Weg, der sich zwischen Eichen, Wacholdersträuchern, Kiefern und Farnen hindurchwand. In der Ferne schrie ein Vogel ahhuuiii. Sarah blieb stehen und hielt nach ihm Ausschau. Ihr war ziemlich warm geworden, und so zog sie die Jacke aus, öffnete den Kragenknopf der Bluse und rollte die Ärmel hoch. Dann lief sie weiter.
Als sie sich dem Blackfoot Pond näherte, entdeckte sie ihren Vater, der mit Mr. Slocum auf der anderen Seite des Teiches mitten im dichtesten Teil des Waldes stand. Sie hielten die Köpfe gesenkt, und es sah so aus, als suchten sie auf dem Boden nach einem verlorenen Ball. Sarah lief auf die beiden Männer zu, blieb aber abrupt stehen, als sie aus dem Schatten des Ahornbaumes hervortrat. Ein ungeheuer heller Sonnenstrahl blendete sie. Der Schein war wie Magie: goldgelb und angefüllt mit Staubkörnern, Nebelresten und winzigen Insekten, die im Lichtstrom glühten. Doch die Sonne war nicht der Hauptgrund dafür, dass sie zögerte. Im dichten Unterholz am Wegesrand glaubte sie kurz – es war wirklich schwer feststellbar jemanden auszumachen, der in geduckter Haltung ihren Vater beobachtete.
Vielleicht hatten sich ihre Sinne nur von Blättern und Zweigen täuschen lassen.
Nein, jetzt bewegte sich dort etwas. Da versteckte sich tatsächlich jemand.
Ihre Neugier verwandelte sich in Angst. Sie drehte sich um, verließ den Pfad und lief den Hügel hinunter bis zum Teich, an dessen Ufer entlang sie zum Damm gehen konnte. Doch sie drehte sich immer wieder zu der Gestalt in den Sträuchern um, und plötzlich glitt ihr Fuß in dem glänzenden, schwarzen Schuh auf einer zusammengefalteten Zeitung aus, die unter einem Haufen alter Blätter lag.
Sarah stieß einen Schrei aus und griff in ihrer Panik um sich. Ihre kleinen Finger fanden nur lange Grashalme, die sich sofort aus dem Boden lösten und ihr wie Luftschlangen den Hang hinunter folgten.
»Hast du auch was gehört?«, rief Corde Slocum zu.
»Ja, kam mir so vor.« Slocum nahm kurz seinen Yogibär-Hut ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Ein Rascheln. Vielleicht Schritte.«
»Aber jetzt ist es weg, oder?«
»Ja, nichts mehr.«
Corde wartete noch vier oder fünf Minuten, lief dann den Damm hinunter und fragte: »Bist du fertig?«
»Ja, Sir. Fahren wir jetzt zurück?«
»Ich fliege mit einem Grashüpfer nach St. Louis, um mit dem Vater des Mädchens zu sprechen. Bin gegen drei Uhr wieder da. Sag den anderen Bescheid, dass wir um vier, nein, lieber halb fünf im Büro eine Lagebesprechung abhalten. Du bleibst hier, bis die Jungs von der Spurensicherung aufgetaucht sind.«
»Heißt das, ich soll mir hier nur die Beine in den Bauch stehen und nichts tun?«
»Sie kommen bestimmt gleich. Dauert sicher nicht lange.«
»Ach, du weißt doch, wie das hier auf dem Land so läuft. Bis die aufkreuzen, kann noch eine Stunde vergehen.« Slocums Art, Protest einzulegen, bestand darin, die hiesigen Zustände zu beklagen.
»Die Stelle muss abgeriegelt bleiben, Jim.«
»Also gut.« Slocum wirkte alles andere als begeistert, aber Corde würde es nicht dulden, einen Tatort unbeaufsichtigt zu lassen; vor allem dann nicht, wenn eine Bande von Reportern schon auf der Lauer lag.
»Ich möchte halt bloß nicht den ganzen Tag hier verplempern.«
»Ich kann mir wirklich vorstellen, dass …«
Knacken im Unterholz. Schritte, die rasch näher kamen.
Die Polizisten fuhren herum und starrten auf den Waldrand. Cordes Rechte wanderte wieder zum Revolver. Slocum ließ das Band fallen. Die Rolle machte sich selbständig, und eine deutlich sichtbare gelbe Spur zog sich über den Boden. Auch seine Hand bewegte sich zur Dienstwaffe.
Die Geräusche wurden lauter. Sie konnten den Verursacher noch nicht ausmachen, doch er kam eindeutig aus der Richtung des Rosenbusches.
»Daddy!«
Sarah rannte atemlos auf ihn zu. Das Haar folgte ihr wie ein Schweif, und auf ihrem schmutzigen Gesicht zeigten sich zahllose Schweißperlen. Einer ihrer Kniestrümpfe war bis zum Knöchel hinuntergerutscht, und Lehm und Dreck bedeckten einen Arm und ein Bein.
»Sarah!«
Großer Gott! Seine Tochter. Er hatte den Revolver schon halb aus dem Holster gezogen und hätte, ohne zu zögern, abgedrückt. »Sarah, was machst du denn hier?«
»Tut mir wirklich Leid, Daddy, aber ich habe mich so komisch gefühlt. Als ich in der Schule war, dachte ich schon, ich würde krank.« Die vorher eingeübten Worte kamen ihr etwas zu monoton über die Lippen.
Gott im Himmel.
Corde ging vor ihr in die Hocke. Er roch das Aroma des Shampoos, das sie vor ein paar Wochen vom Osterhasen bekommen hatte. Veilchenduft. »Du sollst doch nie, nie dorthin kommen, wo dein Daddy arbeitet! Hast du das vergessen? Niemals, außer ich nehme dich mit.«
Sarah machte ein zerknirschtes Gesicht. Dann hob sie ihr verschmutztes Bein und zeigte ihm den Arm. »Ich bin hingefallen.«
Corde holte sein frisch gebügeltes Taschentuch hervor und wischte ihr den Dreck von der Haut. Nachdem er sich davon überzeugt hatte, dass sie weder Schnittwunden noch Kratzer abbekommen hatte, sah er sie wieder ernst an. Der Ärger war ihm noch immer anzumerken, als er fragte: »Hast du da oben irgendwen gesehen? Hat dich im Wald jemand angesprochen?« Der Sturz hatte Sarah nicht das Mitgefühl eingebracht, das sie sich erhofft hatte. Und der Blick ihres Vaters erschreckte sie.
»Antworte mir!«, verlangte er streng.
Was sagte sie jetzt am besten? Sie entschied sich dafür, den Kopf zu schütteln.
»Ist dir irgendjemand begegnet?«
Sarah zögerte und schluckte dann. »Mir ist in der Schule schlecht geworden.«
Corde betrachtete ihre hellen Augen. »Schatz, darüber haben wir doch schon oft genug geredet. Du wirst in der Schule nicht wirklich krank. Das bildest du dir nur ein.«
Ein junger Reporter hob seine Kamera und schoss ein Foto von den beiden, wie er ihr über das blonde Haar strich. Corde warf ihm einen finsteren Blick zu.
»Es fühlt sich aber so an, als hätte ich Heugabeln im Bauch.«
»Du weißt doch, dass du zur Schule gehen musst.«
»Ich will aber nicht! Ich hasse die Schule!« Ihre schrille Stimme erfüllte die Lichtung. Corde sah sich kurz nach den Reportern um, die die Szene teils interessiert und teils mitfühlend verfolgten.
»Jetzt komm zum Wagen.«,
»Nein!«, schrie Sarah. »Ich will nicht. Du kannst mich nicht zwingen!«
Corde hätte sie am liebsten angebrüllt, musste sich aber beherrschen. »Junge Dame, du steigst auf der Stelle ins Auto. Ich werde dir das nicht zweimal sagen.«
»Bitte …« Sie sah maßlos enttäuscht aus.
»Keine weitere Diskussion.«
Sarah erkannte, dass ihr Plan nicht aufging, und trottete zum Streifenwagen. Corde beobachtete sie und rechnete fast damit, dass sie jeden Moment losrennen und im Wald verschwinden würde. Sie blieb tatsächlich auf halbem Weg stehen und starrte auf die Bäume.
»Sarah!«
Sie drehte sich nicht um, sondern stieg ins Auto und knallte die Tür hinter sich zu.
»Kinder«, murmelte Corde.
»Hast du was gefunden?«, erkundigte sich Slocum.
Corde band ein Kärtchen an die Plastiktüte, in der sich das Stück Zeitung befand, das er vorhin entdeckt hatte. Er schrieb seinen Namen darauf und reichte es dann seinem Kollegen. Der Artikel befasste sich mit dem Mord in der letzten Nacht. Die Meldung war erst kurz vor dem Umbruch hereingekommen und bestand aus nur wenigen Zeilen. Derjenige, der den Artikel ausgeschnitten hatte, hatte sich dabei große Mühe gegeben. Die Schnittstellen wirkten so sauber, als hätte er eine Rasierklinge benutzt.
»Auden-Studentin vergewaltigt und ermordet«, hieß die Überschrift.
Das Foto darunter zeigte nicht den Tatort, sondern eine ältere Aufnahme von Corde, als er mit seiner Familie am alljährlichen Kirchweih-Picknick teilgenommen hatte. Die Bildunterschrift lautete: »Detective William Corde, Leiter der Ermittlungen im Mordfall, hier im März dieses Jahres zusammen mit seiner Frau Diane und seinen Kindern Jamie (15) und Sarah (9).«
»Verdammt, Bill.«
Slocum meinte nicht die Aufnahme, sondern die Worte, die in roter Tinte neben das Bild gekritzelt waren.
Dort stand: »Jennie musste sterben. Das könnte auch anderen widerfahren.«
2
Sie stiegen langsam die Treppe hinauf. Der eine der beiden spürte unter seinen Stiefeln den teuren Teppichbelag, der andere bekam nichts davon mit.
Draußen heulte der Wind. Ein Frühlingssturm tobte sich über diesem vornehmen Vorort aus. Doch im Innern des eleganten Hauses herrschte angenehme Wärme, und Wind und Regen schienen weit weg zu sein. Bill Corde, der die Stiefel auf der Fußmatte abgerieben hatte, stand jetzt mit dem Hut in der Hand da und verfolgte, wie der Mann in der halbdunklen Diele anhielt und dann abrupt einen Türknauf drehte. Er zögerte einen Moment, ehe er eintrat und den Lichtschalter betätigte.
»Sie müssen nicht dort hineingehen«, sagte Corde leise.
Richard Gebben betrat, ohne ein Wort zu erwidern, das mit rosafarbenem Teppich ausgelegte Zimmer, in dem seine Tochter aufgewachsen war.
»Sie wird schon darüber hinwegkommen«, erklärte Gebben mit kaum vernehmbarer Stimme. Corde wusste nicht, ob er damit seine Frau oder seine Tochter meinte. Erstere lag unten im Schlafzimmer und war aufgrund der vielen Beruhigungsmittel, die sie eingenommen hatte, zurzeit nicht ansprechbar. Letztere ruhte zweihundert Meilen weit entfernt auf dem emaillierten Tisch des Leichenbeschauers.
Sie wird schon darüber hinwegkommen.
Richard Gebben war Geschäftsmann, trug das Haar sehr kurz geschnitten und schien in seiner Pubertät unter starker Akne gelitten zu haben. Er stammte aus dem Mittleren Westen, war in den Vierzigern und galt als schwer reich. Für einen Mann wie Gebben wurde das Leben nicht vom Schicksal, sondern von den Realitäten bestimmt. Corde vermutete, dass Gebben gerade zu ergründen versuchte, warum seine Tochter ermordet worden war. »Sind Sie die ganze Strecke bis hierher gefahren?«, erkundigte sich Gebben.
»Nein, Sir, ein Dienstflug.«
Gebben strich sich geistesabwesend mit dem Glas seiner Rolex über die mit Narben übersäte Wange. Dann rieb er sich auf seltsame Weise die Augen, so als könnte er nicht verstehen, warum er nicht längst in Tränen ausgebrochen war. Corde zeigte auf die Kommode. »Darf ich mir das einmal näher anschauen?«
»Ich erinnere mich noch, wie sie das letzte Mal zu Hause war und dann zur Uni zurückgefahren ist. Das war Thanksgiving … Verzeihung, was sagten Sie?«
»Die Kommode. Ich würde gern einen Blick hineinwerfen.«
Gebben nickte automatisch. Corde trat an den Schreibtisch, öffnete ihn aber nicht. »Thanksgiving … Sie ließ ihr Bett in der größten Unordnung zurück. Laken und Decke waren ein einziger Haufen. Nachdem sie abgeflogen war, kam ihre Mutter herauf und hat alles so hergerichtet, wie Sie es jetzt sehen …«
Corde schaute auf die drei rosafarbenen und weißen Kissen, die sich auf der Tagesdecke befanden. Ein Plüschhund mit schwarzen Knopfaugen lugte unter ihnen hervor. »Meine Frau hat viel Aufhebens darum gemacht, den Hund genau richtig hinzulegen.«
Gebben atmete einige Male tief durch, um sich zur Ruhe zu bringen. »Sie … Das Besondere an Jennie war, dass sie so sehr geliebt hat …«
Was wollte er damit sagen? Dass sie das Leben geliebt hatte? Die Menschen? Blumen, Haustiere, Poesie? Aber Gebben führte den Satz nicht zu Ende, wohl weil es ihn verdross, dass ihm in diesem Moment nur Klischees einfallen wollten. Corde wusste, dass der Tod einen so betroffen machen konnte, dass der Verstand davon gelähmt zurückblieb.
Er wandte sich von Gebben ab und näherte sich der Kommode. Eine merkwürdige Duftmischung drang ihm in die Nase. Ein Dutzend Parfümflaschen stand unter dem Spiegel am Ankleidetisch aufgereiht. Die mit L’Air du Temps war noch voll, die mit Kölnisch Wasser fast leer. Er nahm sie in die Hand, betrachtete kurz das Etikett und stellte sie wieder hin. Seine Hand würde noch in einigen Tagen danach riechen. Er erinnerte sich daran, dass ihm dieser Duft schon letzte Nacht am Teich in die Nase gedrungen war.
Über dem Schreibtisch waren an einer Pinnwand aus Kork unzählige Postkarten und Schnappschüsse befestigt. Jennies Arm lag bei mindestens einem halben Dutzend Jungs um die Taille, die sich nur in ihren Gesichtern, nicht aber in ihren Posen voneinander unterschieden. Jennies schwarzes Haar wirkte im Sommer noch dunkler, was aber auch auf die Kodakfilme zurückzuführen sein mochte. Sie trug es oft nach hinten gebunden. Allem Anschein nach hatte sie gern Volleyball gespielt. Mehrere Aufnahmen zeigten, wie sie entschlossen und voller Spielfreude den Ball warf oder fing. Corde fragte, ob er eins von den Fotos mitnehmen dürfe, und nachdem Gebben nur mit den Schultern zuckte, entschied er sich für eine Nahaufnahme von ihrem Gesicht. Corde hasste diesen Teil seines Jobs, in dem er gezwungen war, mitten ins Zentrum des Schmerzes der Zurückgebliebenen vorzustoßen.
Corde deutete auf mehrere Bilder, auf denen Jennie mit Freunden und Freundinnen zu sehen war. Gebben erklärte ihm, dass alle mittlerweile andere Hochschulen besuchten, mit Ausnahme von Emily Rossiter, die mit Jennie im Studentenwohnheim das Zimmer teilte. Corde fielen außerdem folgende Dinge auf: Jennies Schülerausweis von der High School, Eintrittskarten von Konzerten der Cowboy Junkies, von Bon Jovi, Billy Joel und Paula Poundstone sowie eine lustige Glückwunschkarte für die bestandene Führerscheinprüfung.
Corde zog den Stuhl unter dem Schreibtisch hervor und ließ sich darauf nieder. Dann betrachtete er die Schreibtischplatte mit ihren Kerben, Kratzern, Flecken und Kritzeleien, dem Tintenfass und daneben ein gerahmtes Foto von Jennie mit einem Cockerspaniel. Weiter hinten stand eine Aufnahme, die sie zeigte, wie sie aus einer Kirche kam (vermutlich Ostern). Blaue Krokusse lagen zu ihren Füßen.
Sie starb auf einem Bett von milchig blauen Hyazinthen.
In einem schiefen selbst gemachten Tonbecher befand sich ein angekauter Bleistift, dessen Radiergummi vollkommen abgenutzt war. Corde zog ihn heraus und spürte unter seinen dicken Fingern die Zahnabdrücke. Er rieb ihn kurz zwischen Zeigefinger und Daumen und stellte sich vor, wie das Holz einst von ihrem Speichel feucht gewesen war. Nach einer Weile steckte er ihn wieder in den Becher.
Er durchsuchte die Fächer und Schubladen des Schreibtischs und fand High-School-Belege, Geschenkpapier und alte Geburtstagskarten.
»Hat sie keine Briefe oder Tagebücher?«
Gebben sah Corde zum ersten Mal an. »Keine Ahnung. Wenn welche existieren, müssen sie dort sein.« Er nickte in Richtung Schreibtisch.
Corde ging noch einmal alles durch. Aber da waren weder Drohbriefe von abgewiesenen Freunden noch andere. Der Schreibtisch enthielt überhaupt keine Privatpost von Jennie. Corde trat zum Kleiderschrank, schob die vielen teuren Kleider beiseite und untersuchte die Ablagen und Fächer. Als er auch hier nichts fand, was ihm weiterhelfen konnte, schloss er die Doppeltür des Schranks wieder.
Er stemmte die Fäuste in die Hüften und sah sich um.
»War Ihre Tochter verlobt? Hatte sie einen festen Freund?«
Gebben zögerte, ehe er antwortete: »Sie hatte eine Menge Freunde. Keiner von denen würde ihr je etwas antun. Jennie war bei allen beliebt.«
»Hat sie vielleicht vor kurzem mit jemandem Schluss gemacht?«
»Nein.« Gebben zuckte mit den Schultern, und Corde begriff, dass der Mann keine Ahnung vom Privatleben seiner Tochter hatte.
»Gab es jemanden, der ganz verrückt nach ihr war, aber keine Chancen bei ihr hatte?«
»Niemand, der Jennie kannte, hätte ihr je etwas antun können«, wiederholte Gebben und fügte nach einem Moment hinzu: »Wissen Sie, woran ich gerade denken musste? Seit ich den Anruf erhielt, habe ich noch niemandem etwas davon gesagt. Ich arbeite noch daran, meinen ganzen Mut zusammenzunehmen. Für all diese Menschen – ihre Großeltern, ihre Freunde, die Familie meines Bruders – ist Jennie noch am Leben. Vermutlich glauben sie, dass sie in diesem Moment in der Bibliothek sitzt und büffelt.«
»Ich denke, ich lasse Sie jetzt allein, Sir. Falls Ihnen irgendetwas einfällt, von dem Sie glauben, dass es uns weiterhelfen könnte, zögern Sie bitte nicht, mich anzurufen. Und wenn Sie irgendwelche Briefe oder Tagebücher von Ihrer Tochter finden, schicken Sie sie mir bitte umgehend.« Er reichte Gebben eine seiner billigen Visitenkarten.
Dieser studierte den Aufdruck, als hätte er Mühe, ihn zu entziffern, dann blickte er Corde mit ernsten mandelförmigen Augen an. »Es wird schon irgendwie weitergehen.«
Für Corde klangen diese Worte so, als sähe der Mann seine Hauptaufgabe darin, ihn zu trösten.
Wynton Kresge saß in seinem Büro im Hauptverwaltungsgebäude der Auden University. Der Raum hatte eine hohe Decke und war mit Eiche verkleidet. Der marineblaue Teppich war von der gleichen Farbe wie die Matten in seinem Cutlass Supreme, doch mindestens doppelt so dick. Sein Mahagoni-Schreibtisch verfügte über gewaltige Ausmaße. Wenn er am Telefon jemandem zuhören musste, mit dem zu reden er keine sonderliche Lust hatte (was gar nicht so selten vorkam), überlegte er sich Möglichkeiten, dieses Monstrum aus dem Büro zu bekommen, ohne dafür ein Loch in die Wand schlagen zu müssen. Und an ausgesprochen langweiligen Tagen dachte er ernsthaft daran, das Stück zu bewegen. Die körperlichen Voraussetzungen dazu besaß er durchaus: Kresge war eins neunzig groß und wog hundertdreißig Kilo. Der Umfang seiner Oberarme betrug dreiunddreißig Zentimeter, der seiner Oberschenkel fünfzig, und nur ein minimaler Prozentsatz davon war Fett. (Er hatte in seinem ganzen Leben noch keine Hantel gestemmt; die Muskeln hatte er vielmehr in der Zeit entwickelt, als er bei den Dan Devine Tigers, einem College-Footballteam, als Linebacker eingesetzt worden war.)
Auf seinem Schreibtisch befanden sich ein Telefon mit zwei Leitungen, eine Messingleuchte, eine Schreibunterlage, ein in Leder gebundener aufgeschlagener Terminkalender, ein eingerahmtes Foto von einer attraktiven Frau, sieben weitere Bilder von Kindern und ein Blatt Papier.
Letzteres hielt er mit beiden Händen auf der Schreibtischplatte, als befürchtete er, es könnte jeden Moment fortgeweht werden. Auf dem Blatt stand: »Jennie Gebben. Dienstag, 22.00 Uhr, Blackfoot Pond. McReynolds-Haus. Feste Freunde, Studenten, Dozenten. Raubmord? Vergewaltigung? Weitere Motive? Susan Biagotti?« Unter diesen Worten war eine grobe Skizze vom Campus, dem Teich und der Straße, die um ihn herumführte. Kresge berührte sein Ohrläppchen mit dem Ende seines silbernen Kugelschreibers, den er in der vergangenen Nacht poliert hatte, und betrachtete seine Notizen.
Er fügte der Skizze einige Details hinzu, strich ein paar Wörter durch und schrieb neue hin. Dann zog er eine gestrichelte Linie vom Campus zum Teich. Es klopfte an der Tür, und er zuckte erschrocken zusammen. Seine Sekretärin stürmte ohne weitere Ankündigung herein. Als sie vor dem Schreibtisch stehen blieb, war das Blatt längst zerknüllt und im Papierkorb verschwunden.
»Sie will Sie sehen«, erklärte die Sekretärin, eine hübsche Enddreißigerin.
»Soso …«
»Sie sind hier wirklich weitab vom Schuss.«
»Wie bitte?«
»Ich dachte immer, der Ausdruck beziehe sich auf Drogen und habe die Bedeutung, man sitze auf dem Trockenen und sei vom Nachschub abgeschnitten?«
»Vom Nachschub abgeschnitten?«
»Aber mittlerweile habe ich herausgefunden, dass diese Redewendung recht alt ist und im übertragenen Sinne bedeutet, dass man sich fernab von dem Ort befindet, wo etwas los ist.«
»Wenn Sie es sagen … Sofort?«
»Ja, sie meinte sofort.«
Kresge nickte. Er schloss die oberste Schublade auf, entnahm ihr eine dunkelgraue Taurus 9 mm Halbautomatic, überprüfte das Magazin und schob die Waffe in das Holster am Gürtel. Dann machte er sich auf den Weg. Die Sekretärin hielt seine nachdenkliche Miene für den Ausdruck grimmiger, vielleicht etwas zu theatralischer Entschlossenheit.
So wollte sie ihr Haus bauen: Sie würde ein schönes Stück Land finden – wie dort das wunderbare Feld mit den goldenen und weißen Blumen, das man durch das von grünsilbernen Bäumen umrahmte Fenster erkennen konnte. Das Fenster befand sich am Ende ihrer Zelle. Das lange Gras wehte in der sanften Brise träge wie der Schwanz eines Kätzchens. Sie würde ihre Freunde, die Tiere, rufen und »Sarah, bist du noch bei uns?«
Ihr Kopf drehte sich abrupt vom Fenster fort, und sie musste feststellen, dass zweiunddreißig Kinder und eine Erwachsene sie anstarrten. Sarahs Atem entwich mit einem leisen Plopp, und dann bekam sie keine Luft mehr. Sie sah in die Gesichter der anderen. Ihr Herzschlag geriet für einen Moment aus dem Rhythmus und galoppierte dann wie verrückt.
»Sarah, ich habe dich aufgerufen. Komm zu mir.«
Sie saß wie erstarrt da und spürte, wie die Hitze vom Gesicht in Arme und Brust strömte.
Mrs. Beiderson lächelte sie an. Sie schaute genauso lieb wie Sarahs Großmutter. Die Lehrerin lächelte sehr viel. Sie war nie streng zu ihr, schrie sie nie an, hob nie ihre Hand gegen sie und schickte sie nie zum Rektor, wie sie das bei den Jungs tat, die etwas auf ihr Pult gekritzelt oder sich geprügelt hatten. Mrs. Beiderson sprach zu Sarah stets so sanft wie eine schnurrende Katze.
Sarah hasste sie mehr als alles andere auf der Welt.
»Jetzt komm doch zu mir nach vorn. Es ist nur eine Übungsaufgabe. Keine Angst, du wirst nicht benotet.«
Sarah starrte auf ihr Pult. Im Fach lag die Tablette, die ihre Mutter ihr mitgegeben hatte. Aber es war noch nicht Zeit, sie einzunehmen.
»Sarah, komm jetzt bitte.«
Sarah erhob sich und ließ die Arme herunterhängen, weil sie in diesem Moment zu schwer waren. Sie begab sich zur Vorderseite des Kerkers und drehte sich zur Klasse um. Mrs. Beidersons Blick schien wie Peitschenhiebe die Haut an ihrem Nacken aufzureißen. Sarah schaute kurz aus dem Fenster. Die Bäume – wie viel Freiheit sie doch verhießen? Sie konnte die Rinde riechen und das Getrappel kleiner Füße unter dem Pilz hören, der sich durch den Efeu schob. Und sie entdeckte die Tür des geheimen Tunnels, der in ihr Haus führte.
Dann fiel ihr Blick auf die Gesichter der Klassenkameraden: Priscilla Witlock kicherte, Dennis Morgan verzog seine fetten Lippen zu einem gehässigen Grinsen, und Brad Mibbock verdrehte die Augen. Prusten und Gelächter brandete so stark heran, dass es sie wie Nadeln in die Wangen stach. Sie sah, wie die Jungs ihre Fäuste vor der unaussprechlichen Stelle auf und ab bewegten. Sie bemerkte die Mädchen mit ihren roten Fingernägeln und klimpernden Armkettchen, Mädchen in ihrem Alter, aber mit perfekt runden Brüsten, schickem Make-up und hochhackigen Schuhen. Junge Dinger, die sich einen Spaß daraus machten, sie zu verspotten. Und Mrs. Beiderson, die nichts von alldem hörte oder sah, sondern nur Sarahs Wimmern mitbekam, sagte: »Sarah, dein Wort lautet ›klären‹.«
Das Wort traf Sarah mit der Wucht eines Hiebs auf dem Schulhof. Ihr Daddy hatte mit ihr »klären« geübt. Aber trotzdem war es ein furchtbar schweres Wort. Sie fing an zu weinen. »Du hast das doch früher schon geschafft«, sagte die lächelnde Mrs. Beiderson mit ihrer verlogenen, hinterhältigen und schlangenfalschen Stimme. »Du strengst dich nicht genug an, Sarah. Wir alle müssen uns Mühe geben.« Sie berührte die Rosenkamee an ihrem Hals. »›Klären‹ steht auf der Liste. Hast du dir die Liste nicht angesehen?«
Sarah nickte.
»Nun, dann besteht überhaupt kein Grund, Tränen zu vergießen.«
Jetzt wusste auch der Letzte in der Klasse, dass sie weinte. »Ich kann es nicht.«
»Du möchtest doch bestimmt nicht, dass wir alle hier denken, du wärst verstockt, oder? Also, ›klären‹.«
Zwischen zwei Schluchzern begann sie: »K.«
»Sehr gut«, lobte die Natter lächelnd.
Sarahs Knie zitterten. »Ich kann es nicht. Es geht nicht.« Neue Tränen.
»Wie heißt der nächste Buchstabe?«
»Ich weiß es nicht.«
»Versuch es.«
»K-l-e …«
Mrs. Beiderson seufzte vernehmlich. »Also gut, Sarah …, dann …«
»Zu Hause konnte ich es noch …«
»… setz dich wieder. Wer kann ›klären‹ buchstabieren?«
Priscilla Witlock machte sich nicht einmal die Mühe, sich von ihrem Platz zu erheben. Den Blick auf die Versagerin gerichtet, schnarrte sie die Buchstaben in dem Zeitraum herunter, den Sarah benötigte, um tief einzuatmen und so zu versuchen, ihre Angst zu ersticken.
Und dann spürte sie es. Zuerst nur ein leichtes Tröpfeln, dann ein wahrer Sturzbach. Ihr Höschen wurde immer nasser, und sie presste die Hand unten hin, um den Strom aufzuhalten. Aber sie wusste, dass es zu spät war. Die warme Flüssigkeit rann ihr bereits die Beine hinab, und Mrs. Beiderson sagte: »Ach, herrje.« Einige in der Klasse wandten den Blick ab, was fast noch schlimmer war als das Starren der anderen. Sie wusste, dass sich diese Geschichte in der ganzen Stadt verbreiten würde, und selbst ihr Großvater oben im Himmel würde davon erfahren. Sarah schlang die Arme um sich, rannte zur Tür und stieß sie mit der Schulter an. Die Glasscheibe überzog sich mit einem Spinnennetz von Sprüngen. Sie raste die Treppe hinunter und nahm immer zwei Stufen auf einmal. Blindlings rannte sie den Flur zum Haupteingang entlang und hinterließ auf dem Linoleum die Tropfen und Kleckse ihrer Schande. Sie sahen aus wie Fragmente der Buchstaben, vor denen Sarah sich wieder einmal hatte geschlagen geben müssen.
Die Frau sagte: »Alles Notwendige wird unternommen werden, und damit ist es mir bitter ernst.«
Die Dekanin Catherine Larraby war fünfundfünfzig, und wenn man die Augen zusammenkniff, hätte man sie glatt für Margaret Thatcher halten können. Das gleiche graue Haar, das gleiche runde Gesicht. Auch die eher stämmige Figur war ähnlich. Die Wangenknochen ließen auf Entschiedenheit schließen. Die Augen wirkten müde, blickten aber streng drein. Eine gewisse Kälte ging von ihr aus, die Bill Corde für permanent und nicht etwa für die Reaktion auf den Tod der Studentin hielt. Die Dekanin hatte ihr Make-up nicht sehr sorgfältig aufgetragen, denn das Puder hatte sich in den Falten an den Mundwinkeln und auf der Stirn gesammelt.
Er atmete schwer und fühlte sich noch etwas benommen von dem unruhigen Rückflug von St. Louis und noch mehr von der eiligen Fahrt vom kleinen Flughafen zu diesem Treffen in der Universität.
Durch das Fenster ihres zugigen Büros blickte Corde auf das Viereck des sorgfältig getrimmten Rasens, der von leuchtend grünen Bäumen umrahmt wurde. Studenten gingen über die Wege und Straßen. Für den Detective bewegten sie sich wie in Zeitlupe. Er erinnerte sich, dass es in seiner Jugend auf einem College viel hektischer zugegangen war. Damals hatte er sich nie anders als im Dauerlauf fortbewegt, um verschwitzt und unvorbereitet von einer Vorlesung zur nächsten zu gelangen.
Ein Mann kam zur Tür herein, ein großer, schwerer Schwarzer. »Detective Corde«, sagte die Dekanin, »darf ich Ihnen Wynton Kresge vorstellen, den Leiter der Campus-Polizei.« Corde schüttelte eine narbenübersäte Hand von den Ausmaßen einer Bratpfanne und zuckte sichtlich zusammen, als Kresges teure Jacke aufging und sich darunter eine schwere Automatic zeigte.
Als Dekanin Larraby weitersprach, sah sie zwar den Sicherheitsbeauftragten an, schien sich aber in Wirklichkeit an die sechzehntausend Eltern ihrer achttausend Zöglinge zu wenden. »Wir müssen diesen Mann fassen. Wir müssen ihn zur Strecke bringen.«
»Ich würde gern so rasch wie möglich damit beginnen«, sagte Corde, »die Freunde und Lehrer von Jennie zu befragen.«
Der dicke Zeigefinger der Dekanin strich dreimal über einen Stift. »Natürlich.« Und nach einer kleinen Pause: »Ist das unbedingt notwendig?«
Corde zog einen Stapel Karteikarten aus der Tasche. »Ich möchte vorab ein paar Antworten von Ihnen. Ich habe hier eine Adresse: McReynolds Hall. Ist das das Haus, in dem sie wohnte?«
»Korrekt. Sie war eine GVU«, antwortete Kresge. Dekanin Larraby runzelte die Stirn.
Corde notierte sich das. Er schrieb Informationen grundsätzlich in Großbuchstaben nieder. Seine Handschrift hatte etwas Orientalisches an sich. »GVU? Ist das eine Studentenverbindung?«
»Nein, so bezeichnen sich die Bewohner des Hauses selbst«, erläuterte der Sicherheitschef. »Es steht für Gottverdammt Unabhängig und bedeutet, dass sie weder einer Bruder- noch einer Schwesternschaft angehören.« Die Dekanin warf ihm einen missbilligenden Blick zu, und so fügte Kresge noch rasch an: »Naja, so sind Studenten eben.«
»Es gibt dabei so viele Verwicklungen zu bedenken«, bemerkte Dekanin Larraby.
»Wie bitte?«, fragte Corde.
»Es könnte zu einer Klage kommen«, entgegnete die Dekanin. »Als ich letzte Nacht mit ihrem Vater gesprochen habe, meinte er, er behalte sich rechtliche Schritte vor. Ich habe ihm erklärt, dass die Tat nicht auf dem Universitätsgelände begangen wurde.«
»Das stimmt«, bestätigte Kresge.
Corde wartete höflichkeitshalber einen Moment, um den beiden Gelegenheit zu geben, noch etwas dazu zu äußern, dann sagte er: »Ich benötige eine Liste sämtlicher Studenten und Universitätsangestellten, die mit diesem Wohnheim zu tun haben …«
»Es ist ein ziemlich großes Haus«, erklärte die Dekanin. »Ich fürchte, eine solche Maßnahme könnte eine Panik auslösen.«
»… und außerdem die Namen aller Lehrer und Studenten ihrer Vorlesungen und Seminare.« Corde fiel auf, dass die Dekanin sich keine Notizen machte. Aber neben ihm vernahm er entsprechende Geräusche. Kresge kritzelte etwas mit einem silbernen Stift in ein in Leder gebundenes Buch.
»Des Weiteren muss ich wissen«, fuhr Corde fort, »ob Jennie irgendwelche Therapeuten oder Selbsterfahrungsgruppen besucht hat. Und ich brauche eine Liste aller Angestellten der Universität, die schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten sind.«
So eisig wie eine aus dem Amt gekippte Premierministerin entgegnete Dekanin Larraby: »Solche Leute haben wir hier nicht.«
»Oh, Sie wären überrascht«, sagte Corde.
»Ich finde das für Sie heraus«, versprach Kresge.
»Ich versichere Ihnen, dass wir hier keine Kriminellen angestellt haben.«
»Vermutlich nicht«, meinte Corde versöhnlich und wandte sich an Kresge. »Wollen Sie hier mein Kontaktmann sein?«
»Selbstverständlich.«
Corde ordnete seine Karteikarten. »Können Sie mir die gewünschten Informationen so rasch wie möglich zukommen lassen?«
»Kein Problem. Und es wird mir auch eine große Freude sein, für Sie einige der Studenten und Professoren zu befragen. Ich kenne eine Menge von ihnen persönlich, und …«
Corde gestand sich ein, die Verhältnisse hier falsch gesehen und Kresge unterschätzt zu haben. »Das wird nicht nötig sein, trotzdem danke«, unterbrach er ihn lächelnd.
»Ich möchte Ihnen nur zur Hand gehen.«
Corde wandte sich an die Dekanin. »Können Sie mir ein Zimmer zur Verfügung stellen?«
Dekanin Larraby wirkte verwirrt. »Wollen Sie hier einziehen?«
»Nein, ich brauche einen Raum, in dem ich die Befragungen durchführen kann. Es empfiehlt sich, so etwas auf dem Campus zu tun.«
»Der Allgemeine Studentenausschuss verfügt über eine Anzahl von Räumlichkeiten«, sagte Kresge.
»Dann besorgen Sie mir dort bitte ein Zimmer«, entgegnete der Detective und hakte auf einer seiner Karten einen Punkt ab.
Kresge zögerte einen Moment, ehe er antwortete: »Natürlich.«
»Detective …«, begann die Dekanin, und in ihrer Stimme schwang ein Anflug von Verzweiflung mit. Beide Männer sahen sie an. Sie legte die Hände flach auf den Schreibtisch, so als wollte sie zu einem Vortrag ansetzen. Ihre Finger erzeugten ein leises Klacken, als sie das Holz berührten. Corde bemerkte zwei Ringe, einen mit einem dicken roten Stein an der Linken und einen mit einem noch größeren gelben an der Rechten. Die hat sie sich wohl selbst gekauft, dachte er. »Wir haben hier ein ziemlich kniffliges Problem«, erklärte sie. »Wenn Sie den Register gelesen haben, wissen Sie, dass unsere Anstalt mitten in einer Finanzkrise steckt. Wir haben die niedrigste Immatrikulationsrate seit dreiundzwanzig Jahren.« Sie lächelte humorlos. »Die Zeit der Babyboomer scheint ihrem Ende zuzugehen.«
Corde hatte den Register gelesen, aber trotzdem keine Ahnung, wie es um die Finanzen der Auden University bestellt war.
»Natürlich liegt es in unserem Interesse, den Mörder so rasch wie möglich aufzuspüren. Aber wir wollen nicht den Anschein erwecken, als hätten wir die Dinge nicht im Griff oder wären gar in Panik geraten. Ich habe bereits einen Anruf von einem unserer Förderer erhalten. Er zeigte sich sehr besorgt. Und wenn unser Förderverein sich Sorgen macht, fange auch ich an, mir welche zu machen.«
»Wir haben die abendlichen Sicherheitspatrouillen verstärkt«, bemerkte Kresge.
Corde entgegnete, das sei gut so.
Die Dekanin fuhr fort, als hätten die beiden Männer kein Wort von sich gegeben: »Wir erhalten in diesen Tagen die Anmeldungen für das Herbstsemester, und bis jetzt haben wir deutlich weniger Bewerbungen als erwartet.« Sie strich sich mit dem kleinen Finger über die Wange und verfehlte eine Unebenheit im Make-up nur um einen Millimeter. »Ist es nicht wahrscheinlich, Detective, dass es sich bei dem Täter um einen Landstreicher handelt? Oder zumindest um jemanden, der in keiner Beziehung zur Universität steht.«
»Zum gegenwärtigen Zeitpunkt können wir noch keine Schlüsse ziehen, Dekanin«, antwortete Kresge.
Dekanin Larraby ignorierte ihn. Schließlich war sie seine Chefin, und außerdem verstand sie sowieso mehr von den Zusammenhängen als er oder der Detective.
»Zum gegenwärtigen Zeitpunkt wissen wir eigentlich noch gar nichts«, erklärte Corde.
»Da wäre noch etwas, das ich vielleicht erwähnen sollte«, sagte Kresge. »Der Biagotti-Mord.«
Die Dekanin lachte auf. »Wynton, Susan hat doch nicht einmal auf dem Uni-Gelände gewohnt. Sie wurde bei einem versuchten Raubüberfall getötet. So war es doch, nicht wahr, Detective?«
»Susan Biagotti? Ja, wenn ich mich recht erinnere, ging es dabei um einen Raub.«
»Unsere Anstalt hatte nichts damit zu tun«, fuhr die Dekanin fort. »Was soll das also, Wynton?«
»Der Fall ist nie aufgeklärt worden«, erwiderte Kresge. »Ich dachte ja nur, es sollte nicht unerwähnt bleiben.«
»Das hat doch nun wirklich überhaupt nichts mit dieser Geschichte hier zu tun.«
»Ich glaube auch nicht, dass da ein Zusammenhang besteht. Trotzdem werde ich mir die Akte noch einmal vornehmen.«
»Es gibt zwischen den beiden Fällen keine Verbindung«, erklärte die Dekanin säuerlich.
»Ja, Ma’am, das denke ich auch. Nun, je eher ich mich an die Arbeit mache, desto schneller fassen wir den Burschen. Sie verschaffen mir die Unterlagen, William?«
»Ich heiße Wynton.«
»Oh, entschuldigen Sie.«
»Ach, Detective, da wäre noch etwas, das ich Sie fragen möchte. Und zwar geht es um das mögliche Motiv für …«
»Tut mir Leid«, fiel Corde ihm ins Wort, »aber ich bin schon recht knapp mit meiner Zeit. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie innerhalb der nächsten Stunden so viele Informationen wie möglich heranschaffen könnten. Und kümmern Sie sich bitte um einen Raum für mich.«
Kresge nickte langsam mit ernstem Gesicht. »Das Zimmer steht Ihnen zur Verfügung, wann immer Sie es brauchen.«
Diane Corde hörte zu. Sie stützte den Kopf in die Linke und hielt mit der Rechten den Hörer ans Ohr. Und in der Armbeuge balancierte sie eine Einkaufstüte.
»O nein …« Sie lauschte noch einen Moment, dann ließ sie den Hörer sinken und rief: »Sarah? Bist du zu Hause, Sarah?« Doch da war nur Stille, die lediglich vom Klicken und Brummen des Kühlschranks unterbrochen wurde.
»Nein, sie ist noch nicht da. Wenn sie etwas sehr beschäftigt, versteckt sie sich manchmal im Wald.«
Die Lehrerin klang sehr besorgt, während sie berichtete, was in der Schule vorgefallen war. Doch dann fügte Mrs. Beiderson hinzu, dass Sarah sich den ganzen Morgen über bis zum Buchstabiertest irgendwelchen Tagträumen hingegeben habe. »Ich mag sie, Mrs. Corde, ich mag sie wirklich, das können Sie mir glauben. Aber Sarah muss sich mehr anstrengen. Die meisten Schwierigkeiten, die sie hat, kommen von ihr selbst.« Diane nickte. Schließlich sagte sie die Worte, die sie schon so oft am Ende solcher Gespräche gebraucht hatte: »Wir reden mit ihr darüber, ganz bestimmt.«
Die beiden Frauen legten auf.
Diane Corde trug Bluejeans und eine burgunderrote Baumwollbluse. Mit dem goldenen Kreuz, das sie beim High-School-Abschluss erhalten hatte und das jetzt an ihrem Hals funkelte, wirkte sie wie eine Country-Sängerin, die sich mitten in ihrer zweiten Karriere befand. Ihr Mann sagte immer, ihre Frisur sei aufgedonnert, bloß weil sie das Haar zurückbürstete und mit Haarfestiger in Form hielt. Mit ihren breiten Schultern und schmalen Hüften besaß sie immer noch eine tolle Figur, der man nicht ansah, dass sie zwei Kinder zur Welt gebracht hatte und schon dreiundvierzig Jahre lang dem Zug der Erdschwerkraft standhielt. Auf ihrer Stirn zeigte sich eine halbmondförmige Narbe, die den halben Umriss des Bleirohrendes wiedergab, gegen das sie im Alter von vier gelaufen war.
Diane stellte die Einkaufstüte auf die Anrichte und lief zur Hintertür, um den Schlüsselbund aus dem Schloss zu ziehen.
Aber da waren keine Schlüssel.
Diane versuchte sich zu erinnern. Sie war aus dem Wagen gleich ins Haus gestürzt, als sie das Klingeln des Telefons gehört hatte. Jetzt sah sie überall nach, an den Garderobenhaken, in ihrer Handtasche und im Kühlschrank (mehr als einmal hatte sie die Schlüssel dort liegen lassen). Wenig überzeugt, aber der Vollständigkeit halber ging sie wieder nach draußen und blickte durch das offene Seitenfenster ins Innere des Kombis. Dort steckte der Schlüssel samt Bund noch im Zündschloss. Diane schüttelte angesichts ihrer Schusseligkeit den Kopf und zog den Schlüssel heraus. Sie kehrte zur Küche zurück und blieb auf halbem Weg stehen.
Wie hatte sie ohne Schlüssel ins Haus gelangen können? Die Hintertür musste offen gewesen sein.
Die Tür war nur mit einem Riegel gesichert, und der ließ sich einzig mit dem Schlüssel betätigen. Diane erinnerte sich noch genau daran, abgeschlossen zu haben, bevor sie zum Supermarkt gefahren war. In der Zwischenzeit musste jemand das Haus betreten und vergessen haben, die Hintertür zu verriegeln.
Bill war seit zwölf Jahren bei der Polizei und hatte sich in dieser Zeit so manchen Feind gemacht. Deswegen hatte er den Kindern wohl mehr als tausendmal eingeschärft, stets die Türen abzuschließen, wenn sie aus dem Haus gingen.
Aber Sarah vergaß gern Ermahnungen, auch wenn sie sie mehr als tausendmal zu hören bekommen hatte.
Sie war vermutlich nach dem Missgeschick gleich nach Hause gekommen und hatte sich gewaschen, um danach in den Zauberwald zu laufen und ihr Versteck aufzusuchen. Und dabei hatte sie natürlich vergessen, hinter sich abzuschließen. Noch ein Thema, über das ich mich eingehend mit ihr unterhalten muss … Aber dann sagte sich Diane, dass ihre Tochter für diesen Tag schon genug durchgemacht hatte und es heute kein Schimpfen mehr geben würde. Sie ging in die Küche, ließ den Schlüsselbund in die Handtasche fallen und fing an, sich Gedanken über das Abendessen zu machen.
Sie hockt im magischen Kreis der Steine, hat die Knie angezogen und das Kinn darauf gelegt. Sarah Corde kann bereits wieder langsamer atmen. Sie hat Stunden dafür gebraucht. Als sie hier angekommen ist – sie ist die ganzen zwei Meilen von der Schule bis zu ihrem Versteck in einem Stück gelaufen –, waren ihr Kleid und ihre Unterhosen getrocknet; aber sie fühlt sich auch jetzt noch schmutzig, so als hätte ein Zauberer ein böses Gebräu über sie auskippt.
Wenigstens weint sie nicht mehr.
Sarah legt sich zurück auf das Gras, das sie auf den Feldern ringsum ausgerupft und dann wie ein Lager in einem Kreis aufgeschichtet hat. Nun hebt sie den Saum des Kleides bis über den Bauch, als wolle sie das Gift von den Sonnenstrahlen wegbrennen lassen, und schließt die Augen. Sie fühlt sich schläfrig. Der Kopf wird ihr so schwer wie ein Stein, und es kommt ihr vor, als triebe sie in einem Burggraben. Beiderbug Castle …
Sarah öffnet die Augen und blickt hinauf in die Wolken.
Ein großer weißer Hund, so groß wie das ganze Land, ein Wagen, der von einem fliegenden Fisch gezogen wird, und dort drüben – wo sich Gewitterwolken ballen – ein Gott, der grimmig eine Keule schwingt. Er trägt goldene Sandalen, Zauberschuhe, die ihn hoch und fort von diesem grässlichen Ort tragen, den man die Erde nennt …
Als sie einschläft, verwandelt sich der Gott in einen Magier.
Später wacht sie auf und stellt fest, dass über eine Stunde vergangen ist. Der Wagen ist fort, ebenso wie der fliegende Fisch und der Gott mit der Keule.
Aber Sarah ist nicht allein.
Sie richtet sich auf, zieht den Rock nach unten und nimmt vorsichtig Redford T. Redford in die Hand, den gescheitesten Bären der Weit, der neben ihr sitzt und sie mit seinen lustigen Glasaugen anschaut. Dabei hat Sarah ihn doch heute morgen auf dem Bett zurückgelassen, nachdem sie sich mit Tränen in den Augen von ihm verabschiedet und sich dann auf den Weg zur Schule gemacht hatte. Sie hat keine Ahnung, wie er hierher gelangt ist. In dem Halsband, das er trägt, steckt ein zusammengefalteter Zettel, Sarah zieht ihn heraus, faltet ihn auseinander und wird kurz von Panik ergriffen, weil auf ihm Worte stehen, die sie buchstabieren und lesen muss. Dann beruhigt sie sich und fängt langsam und Wort für Wort an zu lesen. Nach fünfzehn Minuten qualvoller Mühe ist sie in der Lage, den ganzen Text zu lesen.
Die Nachricht erschreckt sie. Da sie ihrem Buchstabiervermögen nicht traut, sagt sie sich, dass sie etwas falsch gelesen haben muss. Sie macht sich noch einmal über den Text her und kommt zu dem Schluss, dass ihr kein Fehler unterlaufen ist. Ihr erster Gedanke ist, dass sie niemals das tun kann, was die krakeligen Buchstaben ihr vorschlagen.
Doch als sie sich umsieht und den dichten Wald betrachtet, in dem sie sich so oft nach einer Flucht aus der Schule versteckt hat und in dem sie sich mehr zu Hause fühlt als in ihrem Kinderzimmer, ebbt die Furcht langsam ab.
Und allmählich wird sie von erwartungsvoller Vorfreude erfüllt. Sarah steht auf und ist überzeugt, dass zumindest ein Teil der Nachricht hundertprozentig stimmt: Ihr bleibt wirklich nichts anderes mehr übrig.
3
Das New Lebanon Sheriff’s Department war nicht sehr groß – vier Büros für den Sheriff, die Detectives Corde und Locum sowie die Sekretärin Emma. Im Zimmer für die Deputies standen acht einfache graue Tische. Auf einer Seite führte ein langer Korridor zu den beiden Arrestzellen. An der Wand hing ein Waffenregal, das drei Schrotflinten und fünf schwarze AR-15 enthielt. In dem Raum befand sich ebenso viel ungelesenes und noch nicht abgelegtes Papier wie in jeder anderen Kleinstadt-Polizeibehörde des Landes.
Jim Slocum, gerade vom Teich zurück, schaute von seinem Schreibtisch auf, an dem er in dem Sessel mit den kaputten Sprungfedern gesessen und im Register gelesen hatte. Sheriff Steve Ribbon ragte vor ihm auf. Ribbon, wuchtig und sonnenverbrannt wie das Fleisch eines gegrillten Lachses, klopfte mit einem Buch gegen seinen stämmigen Oberschenkel. Was will dieser Westentaschenangler nun wieder? Slocum hob eine Augenbraue. »Verdammtes Durcheinander.« Er hielt die Zeitung hoch wie ein Schülerlotse sein Stoppschild. Sie war mit dem Artikel über den Gebben-Mord nach oben gefaltet.
Ribbon nickte, als wollte er sagen: Ja, ja, hab ich schon gelesen. »Komm mit in meine gute Stube, Jim.«
Slocum folgte dem Sheriff die paar Schritte bis zu dessen Büro. Ribbon setzte sich. Slocum blieb im Türrahmen stehen.
Das war ja richtig clever, wir haben bloß unsere Positionen getauscht.
»Ist Bill hier?«, erkundigte sich Ribbon.
»Er ist heute morgen nach St. Louis geflogen, um mit dem Vater des Mädchens zu sprechen …«
»Er hat was gemacht?«
»Ist nach St. Louis geflogen. Um mit dem Vater des Mädchens …«
»Des Mädchens, das getötet wurde? Dieses Mädchen? Warum hat er das getan? Denkt er, wir drucken unser Geld selbst?«
Slocum zog es vor, nicht anstelle von Bill Corde zu antworten, und sagte nur: »Er meinte, wir sollten uns alle wegen des Falls treffen. Um sechzehn Uhr, glaube ich.«
»Wir müssen unsere Pennys zusammenhalten. Ich hoffe, das ist ihm klar. Nun, jedenfalls wollte ich mich mal mit dir unterhalten. Dieser Mordfall macht mir Sorgen. Wie ich hörte, war es kein Raubüberfall?«
»Sieht nicht so aus.«
»Ich habe festgestellt, dass es ein paar Parallelen gibt zwischen dem, was hier geschehen ist, und einer Reihe anderer Fälle, über die ich gelesen haben. Kommt mir so vor, als könnten wir es hier mit einem Kultmörder zu tun haben.«
»Kult?«, fragte Slocum vorsichtig.
Das Buch landete auf dem Schreibtisch. Ein Taschenbuch, geknickt vom Lesen in der Badewanne oder einer Hängematte. Blutige Rituale. Auf dem Cover waren drei Schwarzweißfotos von hübschen Mädchen zu sehen, angeordnet über der Farbaufnahme eines Stoßes blutbespritzter Tarotkarten. »Was ist denn das?« Slocum nahm das Buch in die Hand.
»Lies es. Denk darüber nach. Es handelt von diesem Satanisten unten in Arizona vor ein paar Jahren. Eine wahre Geschichte. Es gibt eine Menge Ähnlichkeiten zwischen dem, was hier passiert ist, und dem Kerl dort.«
Slocum blätterte bis zu den Fotos des Tatorts. »Du glaubst doch nicht, es ist derselbe Kerl?«
»Nee, den haben sie geschnappt. Sitzt lebenslänglich in Tempe, aber es gibt … Ähnlichkeiten.« Ribbon dehnte das letzte Wort. »Ist irgendwie unheimlich.«
»Verdammt, die sahen richtig gut aus.« Slocum betrachtete die Seite des Buchs, auf der die Fotos vom High-School-Abschluss der Opfer abgedruckt waren.
Ribbon strich geistesabwesend seine Krawatte aus schwarzem Polyester glatt. »Ich möchte, dass du dich persönlich nach Higgins begibst. Die Staatspolizei hat dort oben eine eigene psychologische Abteilung. Sprich die Geschichte mit denen durch.«
»Meinst du wirklich?« Slocum las eine Passage, in der der Autor schilderte, was der Arizona-Killer einer Mitschülerin angetan hatte. Zögernd ließ er das Buch sinken und sagte: »Ich werde es Bill ausrichten.«
»Musst du nicht. Ruf einfach die Jungs in Higgins an, und mach einen Termin aus.«
Slocum grinste. »Okay. Ich fliege auch nicht.«
»Was?«
»Ich fliege nicht dorthin.«
»Warum solltest du … O ja.« Dann fügte der Sheriff hinzu: »Wir müssen sicherstellen, dass die Geschichte allgemein bekannt wird.«
»Warum das?«
»Nun, die jungen Frauen in der Stadt müssen gewarnt sein«, erklärte Ribbon.
»Behindern wir uns damit nicht selbst?«
»Zu unseren Aufgaben gehört es auch, Leben zu retten.«
Slocum blätterte wieder in Blutige Rituale. Ribbon beugte sich vor und tippte auf das Buch. »Lies es. Wird dir gefallen. Es ist ein richtiger – wie nennt man das gleich – ein richtiger Schmöker.«
Man konnte kaum behaupten, dass die Stadt New Lebanon ihren vollmundigen Namen wirklich verdiente. Als der Ort um das Jahr 1840 herum gegründet wurde, waren alle guten Namen – die europäischen Hauptstädte und die klangvollen biblischen Ortsbezeichnungen – bereits vergeben. Zum Schluss der Debatte standen der New-Lebanon-Fraktion die New-Luxumberg-Anhänger gegenüber. Da Erstere auf den alttestamentarischen Klang ihres Vorschlags verweisen konnte, war der Ausgang der Abstimmung vorhersehbar.
Die Stadt lag im Harrison County, benannt nach William Henry, allerdings nicht wegen seiner dreißig Tage dauernden Amtsperiode als Präsident, sondern wegen seiner Zeit als Gouverneur von Indiana, während der er die eingeborenen Indianerstämme dezimierte und es Countys wie jenem, das seinen Namen trug, ermöglichte, die Form anzunehmen, in der sie sich heute präsentierten: überwiegend weiß, überwiegend protestantisch, überwiegend ländlich. New Lebanons Wirtschaft basierte in erster Linie auf Milch, Mais und Sojabohnen, obwohl es auch ein paar kleinere Fabriken gab sowie eine große Druckerei, die viele Arbeiten für Verlage in Chicago, St. Louis und New York übernahm (darunter auch den Druck des skandalösen und stets begierig erwarteten Magazins Mon Cher, dessen Druckfahnen allmonatlich die Stadt wie die Spreu bei der Ernte überschwemmten).
In New Lebanon befand sich außerdem das einzige College mit vier Jahrgangsstufen im Umkreis von hundert Meilen. Die Auden University erhöhte die Einwohnerzahl der Stadt in den Monaten von August bis Mai auf vierzehntausend und bot den Ortsansässigen die Möglichkeit, den Vorstellungen zweitklassiger Orchester und Avantgarde-Theatergruppen beizuwohnen, wovon diese allerdings trotz gegenteiliger Beteuerungen kaum Gebrauch machten. Die nationale College-Sportvereinigung NCAA stellte den einzigen echten Kontakt zwischen Auden und den Einheimischen her, von denen es sich praktisch niemand leisten konnte, siebzehntausend Dollar Studiengebühren zu zahlen, was einem, sofern man diesen Betrag viermal aufgebracht hatte, zu einem Abschluss in Geisteswissenschaften verhalf – und wozu sollte der schon gut sein?