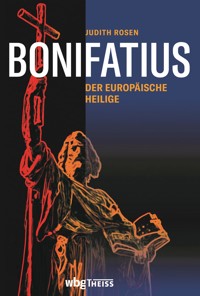
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Konrad Theiss Verlag GmbH
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Bonifatius, 672 (vermutl.) in England geboren, 754 oder 755 in Friesland erschlagen, ist einer der wahrhaft europäischen Heiligen, eine der ganz großen Gründergestalten der Kirche und zentral für die Geschichte des Fränkischen Reiches. Bis heute heißt der päpstliche Legat, Bischof von Mainz und Gründer vieler bedeutender Klöster wegen seiner Missionstätigkeit in Germanien »Apostel der Deutschen«. Judith Rosen schreibt die höchst anschauliche Biographie dieses großen Heiligen, die uns den Menschen Bonifatius in seiner Zeit nahebringt, indem sie sich stark auch auf die vielen erhaltenen Briefe stützt – eine ungewöhnliche und sehr persönliche Quelle für diese frühe Zeit. Sie zeigt seinen enormen Aktionsradius zwischen Exeter, Rom, dem östlichen Germanien und Friesland auf und damit die europäische Dimension seines Wirkens. Klar wird die Bedeutung der Spiritualität in der frühmittelalterlichen Frömmigkeit und die der Frauen, die ihn unterstützten und die er in ihrem Glauben unterstützte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Die Statue des heiligen Bonifatius vor dem Stadtschloss in Fulda.
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung in und Verarbeitung durch elektronische Systeme.
wbg Theiss ist ein Imprint der wbg.
© 2022 by wbg (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt
Die Herausgabe des Werkes wurde durch die Vereinsmitglieder der wbg ermöglicht.
Lektorat: Nathalie Möller-Titel, Hamburg
Satz: Arnold & Domnick, Leipzig
Gedruckt auf säurefreiem und alterungsbeständigem Papier
Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de
ISBN 978-3-8062-4503-5
Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlich:
eBook (PDF): ISBN 978-3-8062-4529-5
eBook (epub): ISBN 978-3-8062-4530-1
Menü
Buch lesen
Innentitel
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zur Autorin
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
»Liebhaber der Schönheit«
I. Leben auf der Insel
Die Heimat
Landschaften der Kindheit
Klosterjahre
II. Leben auf dem Kontinent
Abenteuer Mission
Ein Bund fürs Leben
Eine »kluge Biene« in Germanien
Römischer Ritterschlag
Bewährungsprobe in Hessen und Thüringen
Ein Angelsachse in Bayern und Rom
III. Das sanfte Antlitz der Mission
Bonifatius und die Frauen
Eadburg von Thanet – eine geistliche Institution
Charismatische Frauen: Bugga – Lioba – Walburga
Das Kreuz mit der Moral
IV. Reformen und Rückschläge
Konziliare Politik
Widerstand
Späte Liebe und Enttäuschung
Bis zum bitteren Ende
V. Leben aus dem Wort
Praktische Theologie
Wurzeln der Spiritualität
Prüfsteine der Spiritualität
Der »Gute Hirte«
VI. Ein »europäischer« Heiliger
Von heiligen Leichen, Streit und Wundern
Vom Heiligen zum »Ampelmännchen«
VII. Anhang
Dank
Ein Leben in Daten
Anmerkungen
Quellen und Literatur
Bildnachweis
»So musst du Nachsicht mit meinen Fehlern haben.«
Bonifatius an die Äbtissin Bugga, Brief 27
Vorwort
Das Kreuz ragt in den Himmel. Es schmiegt sich in die rechte Armbeuge des Mannes, der den Ehrennamen »Apostel der Deutschen« bekam. Aufrecht und unerschütterlich steht der bronzene Bonifatius mit wallendem Haar und langem Gewand auf dem gleichnamigen Platz vor dem Barockschloss in Fulda. »Im Kreuz ist Heil, im Kreuz ist Leben, im Kreuz ist Hoffnung« – der Ruf der Litanei vom Leiden Jesu drängt sich in den Sinn. Bonifatius hat daran geglaubt und sein Leben in den Dienst des Kreuzes gestellt, bis er am 5. Juni 754 in der Nähe des friesischen Dokkum ermordet wurde.
In der linken Hand der Statue liegt aufgeschlagen die Heilige Schrift, die der Angelsachse aus Exeter seinen Betrachtern entgegenhält. Sie war das Herzstück seiner Mission auf dem Kontinent und der Kompass in seinem über achtzigjährigen Leben. Die Geste der Statue erinnert an das Bekehrungserlebnis des Augustinus: »Nimm und lies«, forderte eine Stimme den späteren Kirchenvater auf, als er unruhig im Garten seines Mailänder Anwesens hin- und herlief. Er gehorchte und las ein Wort des Apostels Paulus, das ihm endgültig die Tür zum christlichen Glauben und zu einer geistlichen Weltkarriere aufstieß.
Das etwa fünf Meter hohe Bonifatius-Kunstwerk stammt von dem deutschen Bildhauer Johann Werner Henschel (1782–1850). Zehn Jahre arbeitete er an der Statue. Noch länger, 15 Jahre, benötigte die Bürgerschaft Fuldas, um das etwa drei Tonnen schwere Ensemble zu finanzieren. Von den 8000 Talern Gesamtsumme schulterten die Bürger und Bürgerinnen bescheidene 500 Gulden. Den Restbetrag spendeten der bayerische König Ludwig I., etliche protestantische Fürsten, Adelshäuser sowie die Städte Ingolstadt, Passau, Vohenstrauß und Bayreuth. 1842 wurde die Monumentalstatue endlich eingeweiht.
Es war das imposanteste Denkmal, das die Einwohner dem Patron ihrer Stadt und Diözese setzten. Denn Bonifatius war der geistliche Vater des Klosters Fulda, das sein bayerischer Schüler Sturmi in seinem Auftrag 744 gründete und das er sehr liebte.1 In der Abteikirche St. Salvator fand er auf eigenen Wunsch sein Grab. Seit 1712 wölbt sich über der historischen Grablege in der Krypta der barocke St.-Salvator-Dom, Begegnungsstätte der deutschen Bischöfe, die seit 1867 ihre jährliche Herbsttagung in Fulda abhalten.
Das Grab des heiligen Bonifatius in der Krypta des Hohen Doms zu Fulda.
Eine Inschrift des Sockels, auf dem die wuchtige Bonifatius-Statue ruht, erinnert: Verbum domini manet in aeternum – »Das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit«, so wie die Erinnerung an Bonifatius, seinen dienenden Apostel. Papst Zacharias lobte ihn 744 in einem Brief: Der Heilige Geist habe ihn wie den Apostel Paulus und dessen Schüler Barnabas zur Predigt bei den Heiden auserwählt (Brief 57). Der Ehrentitel »Apostel« ist universal. Vor diesem Hintergrund verengt die spätere Bezeichnung »Apostel der Deutschen« das Wirken und die Ausstrahlung des Bonifatius, zumal er nicht der erste und einzige Missionar in den »deutschen« Gebieten war.2 Das Apostolat des ehemaligen Mönchs, Lehrers, Diplomaten und Abts im Kloster Nursling bei Southampton hatte europäische Dimensionen, die bis in die Gegenwart nachwirken. Mithilfe angelsächsischer Missionare und Missionarinnen hat Bonifatius die Bindung zwischen seiner Heimat und dem Kontinent vertieft. Auf den Spuren seines Landsmanns Willibrord missionierte er unter den Friesen in den heutigen Niederlanden, gründete und reformierte Klöster und Bistümer in Thüringen, Hessen und Bayern. Das tat der Kirchenpolitiker in Absprache mit dem Papst, und er half maßgeblich mit, nördlich der Alpen eine romorientierte Landeskirche aufzubauen und den Einfluss des Adels auf den Episkopat zu schwächen. Zu Recht gilt er daher als »Baumeister des christlichen Europa«, so der Bonifatius-Biograph Lutz von Padberg. Vor allem Bonifatius verkörpere »den Übergang von der Phase der Mission in einer religionsgeographisch noch zersplitterten Zeit zu jener der Christianisierung, welche die Kirche zu dem Fundament eines einheitlichen Europa werden lassen sollte«.3 Seine beeindruckende Bautätigkeit und sein Nachleben machen Bonifatius zu einem europäischen, vielleicht sogar zum ersten gesamteuropäischen Heiligen, was angemessener erscheint als sein späterer unhistorischer Beiname »Apostel der Deutschen«.
Der Missionsbischof war ein tief im Glauben verwurzelter Grenzgänger, eine Persönlichkeit zwischen den Welten, zwischen der Antike und dem frühen Mittelalter. Er stellte die Weichen für die Transformation der spätantiken Kirche zur fränkischen Reichskirche, und er ist auch ein Beweis dafür, dass Umbruchzeiten herausragende Persönlichkeiten hervorbringen.
Was sich so leicht als Erfolgsgeschichte liest, war ein schwerer Weg, gepflastert mit bitteren Rückschlägen. Sein großes Ziel, die Bekehrung der Sachsen, hat Bonifatius nicht verwirklicht. So monumental, fast furchteinflößend die Bonifatius-Statue von Fulda den Menschen entgegentritt, so wenig trifft sie das Selbstverständnis des Heiligen. Der um die 1,90 Meter große, mit einer kräftigen Statur gesegnete Bonifatius war ein Zweifler, der sich und seine Leistungen infrage stellte. Sein überfeines Gewissen ließ ihn ständig grübeln, ob es ihm wegen seiner Sünden nach dem Tod vergönnt sei, in der ewigen Anschauung Gottes zu leben. Die Sorge steigerte sich zu einer Ängstlichkeit, die in seinen Briefen durchschimmert. Obwohl er Freundschaften pflegte und sich um seine Freunde und Freundinnen kümmerte, belastete ihn Einsamkeit – eine Einsamkeit, die das Leben in der Fremde noch verstärkte. Neben dem Gebet und der Bibel waren seine Brieffreundschaften sein Rettungsanker, der ihm die peregrinatio erleichterte. Er liebte den intellektuellen Austausch, das Spiel mit den Worten und einen gepflegten bilderreichen Stil. Ein großes theologisches Werk hat er nicht hinterlassen. Sein Charisma lag in der Verkündigung, in der Fähigkeit, Menschen für den christlichen Glauben zu begeistern; seine Begabungen äußerten sich in Organisations- und Reformfreude. Wer gegen Glaubenswahrheiten, die Kirchendisziplin oder die christliche Moral verstieß, konnte die raue und unerbittliche Seite des Missionsbischofs erleben. Seine Konsequenz und sein Bemühen um Wahrhaftigkeit trugen ihm nicht nur Freunde ein.
Bonifatius’ Persönlichkeit vereint widersprüchliche Facetten, was ihn umso inspirierender macht. Sollten sich seine Gegner aus der fränkischen Elite und im Episkopat am Ende seines Lebens darüber gefreut haben, dass der lästige Mahner im kirchenpolitischen Abseits stand, demonstrierte ihnen dieser ein letztes Mal seine Unabhängigkeit. Er kehrte zu den Friesen zurück, dorthin, wo seine Berufung zum Missionar ihren Anfang genommen hatte. Im Rückblick scheint für Bonifatius die Kirchenpolitik mit all ihren Fallstricken die Pflicht gewesen zu sein, die Mission aber die Kür. So tat er am Ende seines Lebens das, was jedem Menschen vergönnt sein sollte und ein französisches Sprichwort auf den Punkt bringt: On revient toujours à ses premières amours – oder weniger poetisch auf Deutsch: »Alte Liebe rostet nicht«.
»Weisheit siegt über Bosheit.«
Bonifatius an den Jüngling Nithard, Brief 9
»Liebhaber der Schönheit«
Die Mörderbande plünderte das Lager und raffte, was ihr in die Hände fiel.1 Hastig schnappten die Räuber die schweren Kisten und trugen sie zu den Schiffen der Ermordeten am Ufer der Boorne, eines kleinen Flusses unweit von Dokkum in der heutigen niederländischen Provinz Friesland. An Bord befanden sich Proviant und einige Gefäße mit Wein. Gierig begannen die Männer zu trinken, als ob sie sich für den Höhepunkt ihres Beutezugs, die Verteilung der geraubten Kostbarkeiten, stärken wollten. Als der Zeitpunkt nahte, disziplinierte sich die Horde und fing an zu beraten, wie viel jedem von ihnen zustehe. Die Verhandlungen waren von kurzer Dauer. Gier und Neid siegten, und die Männer droschen aufeinander ein. Nur wenige überlebten das Gemetzel. Die Sieger öffneten die Kisten und wähnten sich schon im Gold- und Silbersegen. Doch der Schatz, den sie entdeckten, war von anderer Natur: Bücher und Reliquien lagen vor ihnen. Es war der Seelenschatz des Bonifatius, seine geistliche Wegzehrung, der treue Begleiter seiner Missionsreisen, der Wächter seiner Seele und die unverbrüchliche Verbindung zum Himmel.
Bevor er im Herbst 753 von Mainz aus zu seiner letzten Missionsreise zu den Friesen aufbrach, hatte Bonifatius seinen bischöflichen Nachfolger Lul in Mainz gebeten: »Und leg in meine Bücherkiste auch ein Leintuch bei, darin mein zermürbter Leib eingehüllt werden kann.«2 Der Greis spürte seinen nahen Tod, hatte er doch die damalige Lebenserwartung schon weit übertroffen. Seine Reisebibliothek umfasste etwa 20 bis 25 Werke. Herz des frommen Vademecumwar die Heilige Schrift. Ob der Missionsbischof sie als Gesamtwerk oder nur in Teilabschriften mit sich führte, ist nicht sicher. Überliefert ist, dass er seine Brieffreunde und Briefreundinnen aus der angelsächsischen Heimat mehrfach gebeten hat, für ihn biblische Texte abschreiben zu lassen und auf den Kontinent zu schicken. Ab und an revanchierte er sich mit »Sprüchen«. So entschuldigte er sich einmal bei der angelsächsischen Äbtissin Bugga: »Wegen der Zusammenstellung von Sprüchen, um die du gebeten hast, so musst du Nachsicht haben mit meinen Fehlern, denn wegen drängender Arbeit und fortwährender Reisen habe ich das, was du wünschtest, noch nicht vollständig niedergeschrieben; sobald ich aber damit fertig bin, werde ich Sorge tragen, es in die Hände Deiner Liebden zu senden.«3 Der Äbtissin ging es nicht viel anders als ihrem Briefpartner. In einem Schreiben aus dem Jahr 720 bedauerte Bugga, sie habe »die Märtyrerakten, um deren Zusendung du mich gebeten hast«, noch nicht erhalten.4 735 bat Bonifatius seinen ehemaligen Schüler Abt Duddo, der ihm wohl bei der Abfassung seiner Grammatik geholfen hatte und dessen Kloster unbekannt ist,5 ihn mit Abschriften, »vor allem mit den geistlichen der heiligen Väter«, zu stärken. Seinen Wunsch begründete er: »Weil bekanntlich eine geistliche Lehrschrift ein Lehrmeister derer ist, welche die Heilige Schrift lesen, so bitte ich dich, den mir fehlenden Teil der Schrift über den Apostel Paulus zuzusenden, um meine Gottesgelehrtheit zu fördern; ich habe nämlich nur über zwei seiner Briefe Lehrschriften, über den an die Römer und den ersten an die Korinther.« Der selbst in fortgeschrittenem Alter wissbegierige Gelehrte ging noch einen Schritt weiter: »Ebenso wollen wir, wenn es dir recht ist, es beide miteinander so halten, dass du den Auftrag gibst, was du in deinem Klosterarchiv findest und deiner Meinung nach für mich von Nutzen ist, aber deines Erachtens mir unbekannt und nicht schriftlich zur Hand ist, mir dann mitzuteilen wie ein getreuer Sohn seinem unwissenden Vater.« Auch an kirchenrechtlichen Abhandlungen war der bildungsbeflissene »Vater« interessiert, weil er als Bischof Recht sprach. In einem besonderen Fall sollte ihm Abt Duddo Amtshilfe leisten. Sie betraf eine Eheschließung zwischen einem Paten und einer Patin, die vermutlich miteinander verwandt waren. Der Mitbruder wurde beauftragt, das kanonische Eherecht zu studieren und Bonifatius umfassend zu unterrichten. Seinen wissenschaftlichen Anspruch hielt der Gelehrte auch in der Fremde aufrecht.6
Mit hoher Wahrscheinlichkeit begleiteten Bonifatius die Lehrbücher des Alten Testaments, der Unzial-Kodex mit den sechs Büchern der Propheten, das Neue Testament und die Petrusbriefe. Liturgische Werke wie Sakramentar, Lektionar, Passionale und vermutlich ein Psalter kamen hinzu. Bibelkommentare, Schriften der Kirchenväter und kirchenrechtliche Literatur vervollständigten die theologische Handbibliothek.7
Wie existentiell das Studium der Bibel für Bonifatius war, hatte er 716/717 dem jungen Nithard anvertraut, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband.8 In seinem ältesten überlieferten Brief fragt er den Mitbruder: »Was wird von jungen Leuten in angemessenerer
Weise erstrebt oder von alten Männern schließlich einsichtiger besessen als die Kenntnis der heiligen Schriften?« Denn sie lenkt ohne Zwischenfall »das Schiff unserer Seele« durch bedrohliches Unwetter, damit sie ihr Ziel, das Paradies, erreicht. »Weisheit siegt über Bosheit«, fährt der Lehrmeister fort und bekennt: »Diese habe ich von Jugend an geliebt und gesucht, und ich bin ein Liebhaber ihrer Schönheit geworden.« Vor der Weisheit der Bibel verblassen irdische Kostbarkeiten, »sei es im Glanz von Gold und Silber, sei es in der Buntheit glitzernder Edelsteine oder im Genuss luxuriöser Speisen und dem Kauf feiner Kleidung«.
Alles vergeht. Nur die Weisheit der Heiligen Schrift überdauert die Zeit. Daher erwartet Bonifatius zufolge die Jäger irdischer Güter ein qualvolles Schicksal in der Unterwelt: »Und aus diesem Grunde legen sich, wie man weiß, sämtliche habgierigen Goldsucher fern von den Wissenschaften, vom Heiligen enttäuscht niedergeschlagen auf die Lauer und haben die leicht zerreißenden Netze der Spinnen ausgespannt, die Nichtiges fangen wie leeren Wind oder Staub. Denn nach dem Psalmisten sammeln sie Schätze, wissen aber nicht, für wen sie diese zusammenraffen. Und wenn der Scherge des verhassten Pluto, ich meine den Tod, mit blutigen Zähnen grausam knirschend an der Schwelle bellt, dann werden sie zitternd und von jedem göttlichen Beistand verlassen, plötzlich ihre kostbare Seele und zugleich den trügerischen Schatz, dem sie habgierig Tag und Nacht voll Unruhe dienstbar waren, fallen lassen und einbüßen, und danach treten sie, von teuflischen Händen fortgerissen, ein in die verriegelten Tore der Unterwelt, um ewige Strafen zu verbüßen.« Der Asket Bonifatius kannte offensichtlich die Verführungskraft des Konsums und glaubte, ihr nur mit Höllenangst beikommen zu können. Im Rückblick muten seine Worte fast prophetisch an. Fast 50 Jahre vor seinem Tod im Jahr 754 scheint er im Brief an Nithard sein Urteil über seine raffgierigen Mörder bereits gefällt zu haben.9
Wer der Besitzer der spirituellen Juwelen war, wussten die Bischofsmörder wohl nicht. Sie wussten auch nicht, dass Bücher nicht nur immaterielle Kostbarkeiten waren, sondern damals auch Wertgegenstände. Wütend warfen sie Bücher und Reliquienbehälter ins Gebüsch, zerstreuten sie auf den Feldern, begruben sie im Dickicht der Sümpfe oder schleppten sie in ihre Verstecke. So beschrieb der Mainzer Presbyter Willibald, der Autor der ältesten Bonifatius-Vita, das Schicksal der geistlichen Handbibliothek.10 Dem Priester angelsächsischer Herkunft, der an der Mainzer Kirche St. Viktor wirkte,11 hatten die Bischöfe Lul von Mainz und Megingoz von Würzburg den Auftrag gegeben, eine Lebensbeschreibung des Bonifatius zu verfassen. Willibald folgte dem literarischen Geschmack seiner Zeit und seines geistlichen Standes und schrieb eine hagiographische Biographie. Bonifatius’ vita, virtus (Tugend), pietas (Frömmigkeit) und abstinentia (Enthaltsamkeit) sollten den künftigen Lesern als exemplum dienen, um ihr Leben zu vervollkommnen.12 Denn schon zu Lebzeiten stand der Missionsbischof im Ruf der Heiligkeit. Unter diesem Blickwinkel war sein gewaltsamer Tod und der seiner Begleiter mehr als ein Kapitalverbrechen: Die Missionare hatten das Martyrium erlitten, die Krone der absoluten Nachfolge Christi erkämpft, und der größte Kämpfer unter ihnen war Bonifatius.
Jahrhunderte später werden Historiker und Theologen zweifeln, ob der Tod bei Dokkum ein Märtyrertod war. Dabei wird nicht das Glaubenszeugnis der Ermordeten infrage gestellt, sondern das Motiv der Mörder. Starb Bonifatius aus »Glaubenshass« der Friesen, ist er unter die Märtyrer zu rechnen. Doch das Gebaren der Mörderbande in Willibalds ausführlicher Darstellung legt ein anderes Motiv nahe: Habgier. Das Beutemachen übertrumpfte etwaige religiöse Gründe.13 Da Bonifatius auf seiner letzten Missionsreise starb, als er die vornehmste christliche Pflicht, die Glaubensverbreitung, erfüllte, machte ihn dies nicht nur in Willibalds Augen zu einem verehrungswürdigen Blutzeugen. Nicht diskutiert hat der Hagiograph den Umstand, dass es unter den friesischen Banden auch »christliche« Ganoven gab.14
Doch die Auszeichnung martys wurde Bonifatius sofort zugebilligt. Fortan wurden die Ereignisse im irdischen Leben des Verstorbenen himmlisch gedeutet. Sämtliche Bücher seien gefunden worden, berichtete Willibald und fügte sogleich eine Erklärung des erstaunlichen Erfolgs an: »Doch wurden sie durch die Gnade des allmächtigen Gottes sowie durch die Fürbitte des heiligen Bonifatius, des hohen Bischofs und Märtyrers, nach Verlauf langer Zeit unverletzt und unversehrt gefunden und von den einzelnen Findern in das Haus zurückgesandt, in dem sie noch bis zum heutigen Tag liegen.«15 Die wiedergefundenen Schriften begründeten eine Tradition, welche die drei Handschriften im Fuldaer Domschatz unter die Besitztümer des Heiligen rechnet.16 Aber wie fast alle »Traditionen« ist auch diese umstritten. Aus Willibalds Worten lassen sich mehrere Erklärungen herauslesen: Ehrliche Finder können auf Gottes Lohn hoffen. Gegenstände, die Bonifatius besessen hat, strahlen seine Heiligkeit aus. Sie überdauern den natürlichen Verfall und sind Grundstock der einsetzenden Verehrung seiner Reliquien.
Als die Räuber den Missionar erschlugen, forderten sie Gott heraus, davon ist der Biograph überzeugt. Willibald zufolge haben die Christen drei Tage nach dem tödlichen Überfall »ein gewaltiges Heer« aufgestellt, und als »Krieger der zukünftigen Rache« drangen sie in das »Land der Ungläubigen« ein, brachten ihnen eine »verheerende Niederlage« bei und machten die Fliehenden »in gewaltigem Metzeln« nieder. Die Überlebenden, »Frauen, Kinder, Knechte und Mägde der Götzenanbeter«, wurden als Beute in die Heimatorte der Sieger verschleppt. Was Bonifatius als Missionar versagt geblieben war, die Bekehrung der Friesen, habe die Angst vor dem göttlichen Strafgericht schließlich bei den Überlebenden der Strafexpedition erreicht, so Willibald. Der Gerechtigkeit war augenscheinlich Genüge getan. Sie hatte die christliche Lehre der Barmherzigkeit in den Hintergrund gedrängt. Der Mord an Bonifatius und seinen Gefährten war der Anlass für einen Religionskrieg. Die Gewalt kann nicht im Sinn des Mannes gewesen sein, der im Angesicht des Todes die Männer, die ihn und seine Brüder begleiteten, ermahnt haben soll, ihre Waffen ruhen zu lassen: »Lasst ab, Männer, vom Kampf, tut Krieg und Schlacht ab, denn das wahre Zeugnis der Heiligen Schrift lehrt uns, nicht Böses mit Bösem, sondern sogar Böses mit Gutem zu vergelten.«17 Der Bibelkundige und Verehrer des Paulus zitierte dessen Ersten Brief an die Thessalonicher 5,15.
Selbst wenn Willibald seinem Helden die Worte in den Mund gelegt hat, um ihn – wohl auch Luls Wunsch entsprechend – als Märtyrer und Idealheiligen zu stilisieren, spricht der Tenor der Bonifatius-Briefe für einen friedfertigen, liebenswürdigen Menschen, der aber auch einmal schroff sein konnte. Obwohl er durchaus zu rigorosen Missionsmethoden wie der Zerstörung paganer Kultstätten greifen konnte, hat er keine Gewalt im Namen Gottes gegen störrische Vielgötterverehrer propagiert. Denn er war der »Liebhaber des wahrhaften Glanzes der Schönheit, nämlich der Weisheit Gottes, die glänzender ist als Gold, stattlicher als Silber, feuriger als Karfunkelstein, weißer als Bergkristall und kostbarer als Topas«.18 Seine Liebe zur Weisheit und sein Bildungsdurst bewahrten ihn auch vor kultureller Engstirnigkeit. Die Vermittlung christlicher Werte gehörte ebenso zu seinem Missionsauftrag wie zu seinem bischöflichen Selbstverständnis. Das eine war die Verkündigung des Wort Gottes, das andere eine überzeugende christliche Lebensführung und das dritte Element die Humanisierung von Gesellschaft und Kultur – ein Anspruch, der allen Kulturen galt und gilt.
»Über das Gute unseres Volkes [der Angelsachsen] und seinen Ruhm empfinden wir Freude und Jubel, aber über seine Sünden und das, was man ihm vorwirft, Kummer und Schmerz.«
Bonifatius an den Priester Herefrid, Brief 74
I. Leben auf der Insel
Die Heimat
Britannien, die Heimat des Wynfreth-Bonifatius kam erstmals in den Jahren 55 und 54 v. Chr. in nähere Berührung mit Rom. Gaius Iulius Caesar überquerte zweimal den Ärmelkanal, um jenseits des Meeres seine Eroberungen in Gallien fortzusetzen und zu sichern. Ihn ärgerte, »dass in fast allen gallischen Feldzügen unsere Feinde von dort Unterstützung bekommen hatten«.1 Die Kriegshilfe hatten Kelten geleistet, die auf der Insel in zahlreiche selbstständige Völkerschaften zerfielen. Außer der Strafexpedition interessierten die Römer die florierenden Handelsbeziehungen zwischen Südbritannien und Gallien und vor allem das Zinnvorkommen, das die Forschung inzwischen auf der Insel St. Michael’s Mount in Cornwall und auf der Halbinsel Mount Batten bei Plymouth lokalisiert.2
Große Erfolge fielen dem Eroberer Caesar nicht zu, und es dauerte fast ein Jahrhundert, bis sich Kaiser Claudius 43 n. Chr. entschloss, Britannien zu erobern und die Insel den Provinzen des Imperium Romanum einzuverleiben. Unter seinem Oberbefehl nahm der Feldherr Aulus Plautius den gesamten Süden der Insel ein. In den folgenden Jahren hatten die Römer mit wachsendem Widerstand zu kämpfen. Kaiser Nero (54–68) betrieb die Besetzung von Wales, während Boudicca, die Königin der Icener, eine Revolte gegen die römischen Besatzer anführte. Nachdem ihre Mannen Camulodunum (Colchester) und Londinium (London) verwüstet hatten, verließ sie das Kriegsglück, und die Römer gewannen die Oberhand. Ihre militärische Überlegenheit und Hartnäckigkeit führten die Eroberer schließlich 84 n. Chr. unter dem Oberbefehl des Gnaeus Iulius Agricola zum Sieg. In der Entscheidungsschlacht am Mons Graupius im südlichen Caledonia, dem heutigen Schottland, brachen sie endgültig den Widerstand der Kaledonier.3 Nordengland und weitere Gebiete bis zum schottischen Hochland fielen an Rom.
Die Linie zwischen der Tyne-Mündung und dem Solway Firth wurde die Nordgrenze der Provinz Britannia, die Kaiser Hadrian (117–138) mit dem Hadrianswall schützte. Sein Nachfolger Antoninus Pius (138–161) schob die Grenze weiter vor und errichtete zwischen Firth of Forth und Firth of Clyde gegen Schottland den Antoninuswall. Doch scheiterte er, den Süden Schottlands auf Dauer zu erobern.4 Im Süden der Insel schritt die Romanisierung voran, zu der Militär und Zivilverwaltung, Handelsverkehr und Kulturaustausch beitrugen. In diesem Prozess spielten auch Christen und Christinnen eine Rolle. Die literarischen Hinweise bei den Kirchenschriftstellern Tertullian und Origenes zu Beginn des 3. Jahrhunderts, denen die Forschung oft die Glaubwürdigkeit abgesprochen hat,5 werden inzwischen durch archäologische Zeugnisse bestätigt.6
Im 4. Jahrhundert, nach der sogenannten Konstantinischen Wende, nahmen auch Bischöfe aus Britannien an den Synoden teil.7 Für das Konzil von Arles 314 sind drei britannische Bischöfe belegt. 325 wird die erste sicher bezeugte Kirche in Colchester errichtet.8 Das Christentum verbreitete sich zunächst in der Oberschicht. Der Vater des Patricius, des späteren irischen Nationalheiligen Patrick, gehörte nach dessen Aussage in seiner Confessio dem Dekurionenstand an und hatte sich zum Diakon weihen lassen. Nach einer turbulenten Jugend, die ihn nach Irland geführt hatte, kehrte Patricius auf eigenen Wunsch, vielleicht als Bischof, auf die Insel zurück. Er begann mit einer Mission, die er vor allem mit Klostergründungen festigte. Patricius soll etwa 30 Jahre lang bis zu seinem Tod 461 oder 491 auf der Insel gewirkt haben.9
Das Verhältnis zwischen Vielgötterverehrern und Christen blieb gespannt. Obwohl Kaiser Theodosius 391/2 das Christentum de facto zur Staatsreligion erhoben hatte, überlebte der Götterglaube in britannischen Nischen bis ins Mittelalter.
Bevor sich Magnus Maximus, der Oberbefehlshaber der römischen Truppen in Britannien, im Frühjahr 383 zum Kaiser ausrufen ließ, empfing er die Taufe. In einem Brief an Papst Siricius bekannte er sich als treuer Beschützer des christlichen Glaubens.10 Als sich in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts die Häresie des aus Britannien oder Irland stammenden Laienmönchs Pelagius verbreitete, schickte Papst Coelestin I. 429 auf Veranlassung des Diakons Palladius die Bischöfe Germanus von Auxerre und Lupus von Troyes über das Meer.11 Es war wohl derselbe Palladius, den Papst Coelestin I. 431 als »ersten Bischof« zu den Schotten genannten Iren, sandte.12 Er dürfte Angehöriger der Palladii gewesen sein, die im 5. und 6. Jahrhundert zu den vornehmen und reichen gallorömischen Senatorenfamilien gehörten. Auch später kamen aus der Familie mehrere Bischöfe.13 Pelagius und seine Anhänger hatten Unruhe unter den Christen geschürt und deren Einheit gefährdet, weil sie die Erbsündenlehre und die Theologie der göttlichen Gnade ablehnten – beides anerkannte Lehren ihres Zeitgenossen Augustinus von Hippo. Mitte des 5. Jahrhunderts eilten Germanus und ein Bischof Severus den britischen Christen ein zweites Mal zu Hilfe.14 Auch ein weiterer Gegner des strengen Pelagianismus, Faustus, der spätere Bischof von Riez in der Provence, stammte aus Britannien.
Der britische Historiker George M. Trevelyan urteilte in seiner Geschichte Englands: »Die christliche Eroberung der Insel bedeutete die Rückkehr der mediterranen Kultur in einer neuen Form und mit einer neuen Botschaft. […] Christentum bedeutete auch die Rückkehr der Bildung auf die Insel und unter den Barbaren der Beginn einer politischen und gesetzlichen Zivilisation, die auf den Fähigkeiten von Lesen und Schreiben im praktischen lateinischen Alphabet gründete. Christentum sprach auch von ungewöhnlichen Dingen, die dem nordischen Geist völlig fremd und zum großen Teil auch dem antiken römischen Geist fremd waren.«15
Die Umwälzungen, die Britannien im 5. und 6. Jahrhundert erlebte; das Ende der römischen Herrschaft 409/410, das Kaiser Honorius mit einem freiwilligen Truppenabzug besiegelte, waren in der Geschichte der Insel ein tiefer Einschnitt. In das politische Vakuum drangen sächsische Teilvölker aus dem nördlichen Germanien: Angeln von der Unterelbe, Sachsen aus Nordelbien und Jüten von der Halbinsel Jütland, zudem vielleicht Friesen.16 Im Verlauf des 5. Jahrhunderts unterjochten sie trotz erbitterten Widerstands die kelto-römische Bevölkerung und bildeten Königreiche. Literarisches Relikt der politischen Wirren ist die Artus-Legende, die den Widerstandswillen der einheimischen Bevölkerung für alle Zeit verewigt hat. Realpolitisch hatte mit Ausklang des 5. Jahrhunderts die germanisch-angelsächsische Geschichte Britanniens begonnen. Sie sollte Jahrhunderte andauern, bis 1066 die Normannen das Ruder übernahmen.17
Die angelsächsischen Kolonisatoren bedrängten auch das Christentum, ohne es jedoch völlig zum Verschwinden zu bringen. An die überlebenden Glaubenszellen konnten erste Missionsvorstöße anknüpfen, die im 6. Jahrhundert von Gallien aus wieder einsetzten. Ein Missionsstützpunkt war das Kloster Iona vor der Westküste Schottlands, das der heilige Columban 563 gegründet hatte. Die irischen Mönche verschrieben sich der Bekehrung der schottischen Pikten, missionierten aber auch im angelsächsischen in den nördlichen Gebieten Südenglands.18
Einen Schub erhielt die Christianisierung, als Papst Gregor der Große die Insel remissionieren wollte und 596/597 Augustinus, den Prior des römischen Andreasklosters, mit etwa 40 Mönchen nach Britannien sandte. Inzwischen verstanden sich die Angeln, Sachsen und Jüten mehr und mehr als »große Völkerschaft der Engländer«.19Aethelberht, König von Kent (Cantia), der mit der fränkischen Christin Bertha verheiratet war, unterstützte den in Gallien geweihten Augustinus. Dem britischen Althistoriker Peter Brown zufolge war Aethelberht ein Herrscher, »der entschlossen war, jeden Vorteil – einschließlich einer neuen Religion – zur Aufrechterhaltung seines eigenen Stils hegemonialer Oberherrschaft zu nutzen«.20 Bertha, die Tochter des Merowingerkönigs Charibert I., soll es gewesen sein, die Papst Gregor zur angelsächsischen Mission veranlasst hat.21 Ihre Eltern hatten die Zustimmung zu ihrer Heirat mit dem noch heidnischen König nur unter der Bedingung gegeben, dass sie der fränkische Bischof Liudhard begleiten und sie am angelsächsischen Königshof ihren Glauben ausüben durfte.22 In der Nähe des Hofes befand sich seit römischer Zeit eine Kirche des heiligen Martin von Tours, die sie regelmäßig zum Gebet aufsuchte.23 Berthas Einfluss und Augustinus’ erfolgreiche Missionsarbeit veranlassten König Aethelberht, sich taufen zu lassen. Adlige und Untertanen taten es ihm gleich.24 Bei seiner ersten Begegnung mit Augustinus hatte er noch auf einem Treffen im Freien beharrt, weil er die angeblich magischen Kräfte der Missionare fürchtete.25
Bertha hatte die Erwartungen erfüllt, welche die Kirche an Christinnen stellte, die Nichtchristen heirateten. »Gemischte Ehen« wurden nur akzeptiert, weil die christliche Ehefrau die Möglichkeit bekam, ihren Mann zu bekehren, also den Glauben zu verbreiten.26 Diese Erwartung hatte Papst Bonifaz V. (619–625) in einem Brief an Königin Aedilberga, die Tochter Aethelberhts und Berthas und Gemahlin des northumbrischen Königs Edwin ausgedrückt. Beda Venerabilis hat den Brief später nach einem ersten päpstlichen Brief an Edwin in voller Länge in seine Kirchengeschichte aufgenommen.27 Mit einem abgewandelten Bibelzitat ermahnte Bonifaz die Herrscherin: »Ein ungläubiger Mann wird durch eine gläubige Frau gerettet werden« (1 Kor 7,16; 1 Petr 3,1). Unter diesen Vorzeichen war Bertha eine vorbildliche christliche Ehefrau und Familienmissionarin, deren Mission ins Land ausstrahlte.
Mit Aethelberhts Hilfe verwandelte der inzwischen zum Erzbischof aufgestiegene Augustinus eine Vorgängerkirche zu seiner Kathedralkirche von Canterbury. Unterstützung leistete auch Bischof Syagrius von Autun. Er pflegte enge Beziehungen zur mächtigen merowingischen Königin Brunchildis, die im Briefwechsel mit Papst Gregor stand. Nach dessen Plan sollten den Metropolen London und York jeweils zwölf Bistümer zugeordnet werden. Rückschläge blieben nicht aus. Zwistigkeiten zwischen den einzelnen Königsherrschaften trugen eine Mitverantwortung an dieser Entwicklung. Nach Aethelberhts Taufe wurde Kent zum Zentrum und Ausgangspunkt der Mission. Doch ließ der Herrscher die Mönchsgemeinschaft nicht aus den Augen. Seine Überwachung beeinträchtigte die Pläne Papst Gregors, die Bistümer aus der römischen Zeit wiederzubeleben.28 Als Aethelberht im Jahr 616 starb, waren Kent und das benachbarte Essex christlich geworden.29 Doch eine pagane Gegenwehr schmälerte die missionarischen Erfolge. Sein Nachfolger König Raedwald von Ostanglien nahm trotz seiner Taufe eine polytheistische Haltung ein. In einem Heiligtum ließ er zwei Altäre errichten, einen christlichen und einen für heidnische Opfer.30 Dass die Mission fortgesetzt werden konnte, verdankte sich König Edwin, der seit 617 über Northumbrien herrschte. Am Osterfest 627 empfing er unter Aedilbergas Einfluss die Taufe. Seinem Beispiel folgte wiederum eine Reihe von Granden und Klienten. Das Taufsakrament spendete Bischof Paulinus von York, der ebenfalls aus dem Andreaskloster in Rom stammte und eine erfolgreiche Missionsarbeit entfaltete. Als Edwin 633 in einer Schlacht fiel, musste sich der bischöfliche Missionar jedoch zurückziehen. Obwohl die Ausbreitung und Inkulturation der christlichen Religion einen bitteren Rückschlag erlitt, war die Grundlage für die weitere Christianisierung des bedeutenden nordenglischen Königreichs gelegt.31
In Irland hatte sich inzwischen eine blühende Klosterlandschaft entwickelt, die auch für eine kulturelle Blüte sorgte. Die Missionsrichtung kehrte sich um. Irische Mönche zogen auf das Festland, um im Frankenreich den Glauben zu verbreiten. Der Bedeutendste unter ihnen war Columban der Jüngere aus dem Kloster Bangor, das zu einem Ausbildungszentrum für Missionare heranreifte. Columban wirkte zwischen 591 und 613 in Gallien, Alemannien und Oberitalien. Dort gründete er mehrere bedeutende Klöster. Einige merowingische Könige förderten seine Anstrengungen, andere bekämpften den charismatischen Mönch. Seine peregrinatio pro Christo – Pilgerschaft für Christus sollte Beispiel für die späteren Missionare und Missionarinnen von den britischen Inseln werden.
Die Synode von Whitby an der Küste von Yorkshire, die 664 unter dem Vorsitz Königs Oswin von Northumbrien stattfand, sollte die zwei britannischen Missionsbewegungen einen: die angelsächsische und die irisch-keltische, die sich zum Teil überschnitten. Der Gegensatz war ablesbar an den unterschiedlichen Osterterminen. Der römische 19-jährige Zyklus, dem König Oswin zustimmte, setzte sich durch. 668 weihte Papst Vitalianus den gelehrten Theodor von Tarsos im südlichen Kleinasien zum Erzbischof von Canterbury. Unterstützt vom Mönch und späteren Abt Hadrian von Neapel gelang es ihm bis zu seinen Tod 690, durch die Einrichtung neuer Diözesen sowie mehrerer Synoden die Einheit der Kirche Britanniens zu fördern. Wahrscheinlich hatte sich Theodor in Antiochia und Konstantinopel eine umfassende Bildung angeeignet, zu der nicht nur Theologie gehörte, sondern auch kirchliches und weltliches Recht, Rhetorik, Philosophie, Medizin und Astronomie. So war er gut vorbereitet, um in Canterbury, dem »neuen Rom«, eine Kathedralschule aufzubauen. Sie stieg zu einem weit ausstrahlenden geistigen und geistlichen Zentrum auf.
Mit Theodor kam Benedict Biscop (628–690) in die Heimat zurück. Er war Gefolgsmann (gesith) König Oswins gewesen, war dann Mönch geworden und lebte längere Zeit in Rom. Auf Reisen zu italischen und gallischen Klöstern investierte er sein beträchtliches Vermögen in Bücher, Reliquien, Ikonen und liturgische Geräte. Die Bücher, die er damals und auf weiteren Reisen sammelte, wurden der Grundstock zweier reichhaltiger Bibliotheken in den Klöstern Wearmouth und Jarrow, die Benedict mithilfe von König Ecgfrith von Northumbrien 681 begründete. Sie versetzten den Mönch Beda Venerabilis in die Lage, ein riesiges literarisches Werk zu schaffen und so zu einem der größten Gelehrten des mittelalterlichen Englands zu werden, zum bedeutendsten Repräsentanten der »northumbrischen Renaissance«.32
Beda, um 672 in Northumbrien geboren, berichtet am Ende seiner Kirchengeschichte des englischen Volkes, er sei im Alter von sieben Jahren von Verwandten dem Abt Benedict zur Erziehung übergeben worden. Sein ganzes Leben habe er in den beiden Klöstern verbracht, und er habe Freude an beständigem Lernen, Lehren und Schreiben gehabt. Mit 19 Jahren sei er zum Diakon und mit 30 zum Priester geweiht worden. Vier Jahre vor seinem Tod im Jahr 731 zählt er gut 30 Titel auf, die er zum Teil in mehreren Büchern bis zu dieser Zeit verfasst hatte. Die Mehrzahl waren Kommentare zum Alten und Neuen Testament, ferner Heiligenviten und weitere historische Arbeiten. Schriften aus dem Lehrbetrieb über Orthographie und Metrik sowie Naturwissenschaften vervollständigten sein Werk. Während er an seiner Kirchengeschichte schieb, führte er eine ausgedehnte Korrespondenz mit Bischöfen, die ihm Nachrichten zukommen ließen. Bonifatius bat elf Jahre nach dem Tod des Gelehrten den Abt Huetberht von Wearmouth, ihm einige Werke »des so scharfsinnigen Erforschers der heiligen Schriften« zu schicken.33 Kurz zuvor hatte er bereits Erzbischof Ecgberht von York ersucht, ihm Schriften Bedas kopieren zu lassen: Er wolle von dem Licht, das Gott gerade in dem geistbegabten Lehrer habe aufstrahlen lassen, auch profitieren.34 Bonifatius lag also vor allem an Bedas religiösen Schriften, von denen er sich geistlichen Gewinn versprach.
»Wenn nämlich das Volk der Angeln […] ein schändliches Leben führt,so wird zuletzt das ganze Volk […] weder in einem weltlichen Krieg starknoch im Glauben standhaft,weder bei Menschen geehrt noch von Gott geliebt sein.«
Bonifatius an König Aethelbald, Brief 73
Landschaften der Kindheit
Bonifatius wurde um 672/675 bei Exeter im südenglischen Königreich Wessex geboren,35 einem der sieben britannischen Königreiche, die sich seit dem 6. Jahrhundert im mittleren und südlichen Teil der Insel gebildet hatten. Die Einwanderer aus den Küstengebieten des Kontinents und die spätantike romano-britische Bevölkerung lebten in Wessex zunächst nebeneinander und vermischten sich erst im Laufe der Zeit.36 In Wessex übten Angehörige einer Sippe die Oberhoheit aus, die Beda Gewissae nannte.37 Einer anderen Überlieferung zufolge sollen sich in Wessex (»Westsachsen«) – der Name erscheint erst im späten 7. Jahrhundert – germanische Jüten niedergelassen haben.38
Wynfreth nannten die Eltern ihren Sohn, der gelegentlich auch Wynfrid gerufen wurde.39 Hinter der elterlichen Namenswahl steckte wohl der Wunsch, ihr Sohn werde ein Mann des Friedens sein. Der zweisilbige altenglische Name setzt sich aus wyn – Freude und freth – Friede zusammen. So sollte Wynfreth nicht nur Frieden, sondern auch Freude ausstrahlen. Noch heute inspiriert der Name dazu, über die Verbindung von Freude und Friede nachzudenken. Wer zur Freude fähig und dafür dankbar ist, kann nicht anders als ein Botschafter, eine Botschafterin des Friedens sein.
Glaubt man Willibalds Darstellung, taten die Eltern alles, um ihr Söhnchen auf diesen Weg zu führen. Die frühkindliche Erziehung oblag der Mutter, und Willibald lobte, sie habe ihren Wynfreth »mit großer mütterlicher Sorge und Mühe entwöhnt und aufgezogen«. Vom Vater heißt es, er habe seinen Sohn »in großem Wohlgefallen vor den anderen Söhnen bevorzugt«. Wie der Biograph ausführt, handelte die Mutter, »wie es zu geschehen pflegt«.40 Hat Willibald seine schütteren Informationen etwa mit Allgemeinplätzen kaschiert? Sicher scheint, dass der kleine Wynfreth unter Brüdern aufgewachsen ist, wahrscheinlich auch mit Schwestern, die Willibald, wenig genderfreundlich, überging. Und vielleicht galt die besondere väterliche Liebe seinem Jüngsten, dessen frühkindliches Charisma ihn bezauberte.
Englische Küste bei Brixham, Devon, Großbritannien.
Den Namen Bonifatius gab ihm Papst Gregor II. auf seiner ersten Romreise am 15. Mai 719. Es war der Name des Märtyrers Bonifatius, dessen Fest in Rom, wo seine Reliquien an der Via Latina verehrt wurden, am Tag zuvor gefeiert worden war.41 In der Heimat setzte sich der neue Name erst nach einiger Zeit durch. Für die allmähliche Adaption ist ein Brief der angelsächsischen Äbtissin Eangyth und ihrer Tochter Bugga bezeichnend. Sie wandten sich an den »verehrungswürdigen Wynfrid mit Beinamen Bonifatius« – venerabili Wynfrido cognomento Bonifatio (Brief 14,52,9 f.).
Die gebildete Äbtissin eines Doppelklosters hatte an die gängige römische Sitte der Cognomina gedacht, hinter denen oft praenomen und nomen gentile verschwanden, wie das dann auch bei Bonifatius der Fall war. In dem Namen steckt ein christliches Lebensmotto: Der Träger des Namens ist ein Mann, der das Gute tut (bonum facit) oder das Gute bekennt (bonum fatur). Eine dritte Deutung sieht in Bonifatius das Wort fatum. Demzufolge ist Bonifatius ein Mensch des guten Schicksals. Die Bedeutungen Wohltäter oder Bekenner dürften Bonifatius mehr zugesagt haben.
»Die Saat des heiligen Glaubens« hatte erstmals Bischof Birinus in der Heimat des kleinen Wynfreths verbreitet. Papst Honorius (625–638) hatte ihn beauftragt, im äußersten Teil der Insel zu missionieren, »wohin bisher noch kein Gelehrter (doctor) gekommen war«.42 Asterius von Genua hatte den Missionar zuvor zum Bischof geweiht. Birinus hatte Erfolg, und es gelang ihm, König Cynigilsus und die gesamte Sippe der Gewissae zu bekehren. Unterstützt wurde er dabei von dem northumbrischen König Oswald. Beide Herrscher übergaben ihm Dorchester als Bischofssitz, damals der Hauptort von Wessex.43 Da sich das Christentum in der königlichen Sippe noch nicht verfestigt hatte, gab Coinualch, der Sohn des Cynigilsus, die neue Lehre wieder auf und trennte sich von seiner Frau. Ihr Bruder Penda, der das mittelenglische Mercien regierte, rächte die Verstoßene und vertrieb seinen Schwager. Nach dreijährigem Exil gelang Coinualch die Rückkehr, nicht ohne sich zum Christentum zu bekennen.44
Die christliche Religion war offensichtlich in den dynastischen Querelen zu einer propagandistischen Begleiterscheinung geworden, deren tatsächliches Gewicht schwer einzuschätzen ist. Der reuige Rückkehrer begrüßte immerhin, dass sich Agilberctus als Missionar anbot. Für ihn sprach, dass er in Irland studiert hatte. Nach einigen Jahren drängte ihn jedoch der König, das Bischofsamt aufzugeben. Ihm missfiel, dass Agilberctus die sächsische Sprache noch immer nicht beherrschte. Sein Nachfolger wurde Uini, der im Frankenreich zum Bischof geweiht worden war und nun Winchester, die neue Hauptstadt, als Residenz erhielt. Die anfänglichen Hoffnungen erfüllten sich nicht. Da Coinualch sich als Herr der Kirche sah und sich entsprechend aufspielte, musste auch Uini weichen.45 Coinualch bat Agilberctus zurückzukommen, der mittlerweile den Bischofsstuhl im heimatlichen Paris bestiegen hatte. Der aber lehnte das Angebot ab und schlug einen Verwandten vor, den Priester Leutherius. König und Volk war der geistliche Ersatzmann genehm, und Theodorus, der Erzbischof von Canterbury, weihte Leutherius zum Bischof. Er übte sein Amt viele Jahre aus. Durch seinen unermüdlichen Einsatz machte die Christianisierung Fortschritte.46 Theodorus weihte weitere Bischöfe, um vakante Bischofssitze zu besetzen oder übergroße Diözesen zu verkleinern.
672/73, ungefähr ein Jahr vor Bonifatius’ Geburt, berief Theodorus eine erste Synode nach Hertford, südlich von London gelegen, welche »die notwendigen Angelegenheiten der Kirche behandeln sollte«.47 Hinter dem Singular »Kirche« stand Theodorus’ Bestreben als Metropolit von Canterbury, die Einheit der angelsächsischen Kirche in allen sieben Königreichen zu festigen. Die Synodalen einigten sich auf zehn Kanones, die Theodorus seinem Sekretär ins Protokoll diktierte und von allen Bischöfen unterschreiben ließ. Eine Abschrift gelangte in Bedas Hände, der das Dokument in vollem Umfang in seine Kirchengeschichte aufnahm.48 An erster Stelle stand das umstrittenste Thema: der Ostertermin. Das Fest der Auferstehung Christi sollte wie in Rom am ersten Sonntag nach dem Frühlingsvollmond im März gefeiert werden, damals noch der erste Monat des Jahres (dominica post XIIII lunam mensis primi).49
An zweiter Stelle folgte die Bestimmung, dass kein Bischof über seine Diözese hinaus in eine andere Diözese eingreifen dürfe. Den Machtgelüsten einzelner Bischöfe sollte ein Riegel vorgeschoben werden. Das galt auch für den dritten Kanon, das Verbot, sich in Klöster einzumischen oder ihren Besitz zu beschneiden. Andererseits durften die Mönche im vierten Kanon ihr Kloster nur mit Erlaubnis ihres Abtes verlassen. Sie sollten »nicht von Ort zu Ort wandern«. Für den Klerus eines Bischofes galt die stabilitas loci in Kanon 5. Fremde Bischöfe und Kleriker sollten die Gastfreundschaft in anderen Diözesen nicht nutzen, um unaufgefordert liturgische Handlungen vorzunehmen (Kanon 6). Wenigstens einmal, nach Möglichkeit aber zweimal im Jahr sollten sich die Bischöfe zu einer Synode versammeln (Kanon 7). Einen Vorrang unter den Bischöfen sollte es nicht geben, lediglich eine Anciennität nach dem Datum der Weihe (Kanon 8). Vorsorglich wies Kanon 9 darauf hin, dass sich mit wachsender Zahl der Gläubigen auch die Zahl der Bischöfe vergrößern könne, was e silentio zu einer Teilung der Diözesen führen würde: »aber über diesen Punkt haben wir im Augenblick geschwiegen«. Schließlich sollten sich die Bischöfe mit ihren rechtlich angetrauten Ehefrauen begnügen und sich im Fall einer Scheidung keine andere Frau nehmen, sondern sich lieber als rechte Christen mit ihrer früheren Gemahlin versöhnen (Kanon 10).
Vor allem die Grenzziehungen zwischen den Diözesen und innerhalb der Diözesen zu den Klöstern sprachen für eine zunehmende Christianisierung und einen aktiven Episkopat mit manchen ehrgeizigen Amtsinhabern. Deren ambitio – Ehrgeiz (Kanon 8) und Machthunger mussten die bischöflichen Mitbrüder zügeln. An keiner Stelle in den zehn Kanones war die Rede vom Verhältnis der Bischöfe zur königlichen Macht. Aus dem beredten Schweigen kann man auf das Selbstbewusstsein der sich bildenden angelsächsischen Gesamtkirche gegenüber den Königen schließen.
Bei der Abfassung der einzelnen Kanones griff der Wortführer Theodorus auf die Bestimmungen früherer Synoden zurück. Den Osterfeststreit hatte schon das Konzil von Nicäa 325 entschieden.50 Damals war den Bischöfen, Priestern und Diakonen auch die Residenzpflicht auferlegt worden, die das Konzil von Serdica im Herbst 342 (oder 343) erneut einschärfte. Die Unabhängigkeit der Klöster von der bischöflichen Amtsgewalt war ein Anliegen selbstbewusster Äbte und Äbtissinnen, die den Aufbau und die Führung ihrer klösterlichen Gemeinschaften oder auch ihre missionarischen Anstrengungen nach eigenen Vorstellungen regeln wollten. Ihre Bedeutung erkannten die Bischöfe an. Vor allem die größeren Klöster verfügten mittlerweile über beachtlichen Grundbesitz, der von Laienbrüdern bearbeitet wurde. So konnten sich die Mönche unbelastet dem täglichen Gebet, dem Studium sowie der Lehre und Erziehung der ihnen anvertrauten Jungen widmen.
In jener Zeit bestanden schon Doppelklöster von Mönchen und Nonnen, etwa in Whitby, wo 664 eine Synode stattgefunden hatte. Geleitet wurden die Doppelklöster von Äbtissinnen, die meist aus königlichen Familien stammten.51 Sie besaßen daher genug Autorität und Bildung, um das Klosterleben zu gestalten und ihre Gemeinschaft nach außen zu repräsentieren. Leitfaden war die Regula Benedicti, die dem Mönchsvater Benedikt von Montecassino zugeschrieben wird. Benedict Biscop und Wilfrid, die beide aus angelsächsischem Adel stammten, hatten sie in Rom kennengelernt und in der Heimat als Äbte und später als Bischöfe eingeführt.52
Nicht nur für junge Männer, sondern auch für junge Frauen war der Eintritt in ein Kloster ein erstrebenswertes Karriereziel. Das Leben hinter den Mauern bot Möglichkeiten, die Angehörigen der niederen Stände in der Regel verschlossen blieben. Dazu gehörte die Freiheit, sich geistigen Interessen widmen zu können, eines der verschiedenen Ämter des Klosters zu übernehmen oder gar Abt oder Äbtissin zu werden. Bonifatius hat daran schon in frühen Jahren gedacht. Sein Biograph Willibald vergoldet die Absicht in der typischen Form der Heiligenvita. Bereits der Vier- oder Fünfjährige habe Abschied von allen vergänglichen Dingen genommen, sich dem Ewigen zugewandt und beschlossen, sich dem Dienst Gottes zu weihen und Tag für Tag mit allen Kräften des Herzens nach dem Klosterleben zu streben.53 Auch der berühmte Bischof Cuthberht von Lindisfarne brannte von früher Kindheit für ein heiligmäßiges Leben und wurde mit Beginn der Jugendzeit Mönch.54
Mit der frühkindlichen Berufung zu einem gottgeweihten Leben stellte Wynfreth oder wohl richtiger sein frommer Biograph die beiden exemplarischen Vorbilder der abendländischen Hagiographie, Athanasius’ Vita des Wüstenvaters Antonius und Sulpicius Severus’ Vita des heiligen Martin, weit in den Schatten. Antonius erlebte seine Berufung mit 18 Jahren, Martin mit zehn Jahren.55 Auch Jesus, das Urbild des christlichen puer senex, war zwölf Jahre alt, als er im Jerusalemer Tempel, dem Haus seines Vaters, mit den Schriftgelehrten diskutierte und alle mit seiner Weisheit und seinen klugen Antworten in Erstaunen setzte.56
Der Topos des puer senex spiegelt die Auffassung, dass sich bereits in kindlichem Alter die Begabungen und Taten des Erwachsenen andeuten. So konnte der kleine Wynfreth-Bonifatius gar nicht anders, als tief fromm sein und Tag und Nacht über Gott nachsinnen. Und da seine späteren Schüler und Bewunderer wie sein Biograph Willibald in ihm eine Ausnahmegestalt sahen, musste er selbst unter den Heiligen der Kirchengeschichte einen hohen, wenn nicht den höchsten Rang einnehmen. Bei diesem geistlichen Wettbewerb wurde der Realismus kluger Eltern ausgeblendet. Ihr Ehrgeiz durfte keinen Schatten auf den heiligmäßigen Sohn werfen. Immerhin ging es darum, wie sich die Nachwelt an den großen Missionar erinnern sollte.
Willibald stand bei seiner Lebensbeschreibung vor der schwierigen Aufgabe, das Porträt eines Mannes zu entwerfen, dem er nie begegnet war. Er blieb auf die Erinnerungen seiner Auftraggeber angewiesen. Lul, ein Schüler und Vertrauter von Bonifatius, hatte das bischöfliche Erbe seines geistlichen Ziehvaters in Mainz angetreten. Den Franken Megingoz hatte Bonifatius kurz vor seinem Tod als Bischof in Würzburg eingesetzt. Beide scheinen wenig über die Kindheit ihres Mentors gewusst zu haben. Ihre Wissenslücken sind eine Erklärung für Willibalds schüttere Hinweise, aus denen er auch keinen Hehl macht: »Wir wollen also versuchen, das herrliche und in der Wahrheit selige Leben des heiligen hohen Priesters Bonifatius sowie sein durch Nachahmung der Heiligen hochgeweihtes Wesen, obschon durch das Dunkel der Erkenntnis behindert, in den dünnen Grundfaden dieses Werkleins einzuflechten.« Der Biograph verweist auf Augen- und Ohrenzeugen, spricht von einer »Sammlung der spärlichen Mitteilungen« und will sie zu einem »Gewebe verknoten«, um mit »der größten uns möglichen Genauigkeit« die »Heiligkeit seiner Gottesgefolgschaft vom Anfang bis zum Ausgang« darzustellen.57
Für die spätere Lebenszeit beruft sich Willibald einmal auf die »Berichte glaubhafter Männer«58, aber auch auf »Erzählungen von Mund zu Mund«, die er erfahren habe.59 Am Ende der Vita nennt er Lul als Gewährsmann für ein Quellwunder an dem Ort, wo Bonifatius erschlagen worden war.60 Lul war überhaupt der beste Zeuge für das Leben seines Lehrers. Hatte Bonifatius doch ihn, »seinen mit hohen Geistesgaben ausgerüsteten Schüler«, zum Bischof geweiht und als seinen Erben eingesetzt, nachdem der ihn »auf seiner Pilgerfahrt« begleitet hatte und »ein Zeuge in beidem, in seinem Leben und seiner Tröstung« war.61 Daher wandte sich Bischof Milret von Worcester kurz nach Bonifatius’ Tod mit der Bitte an ihn, »nähere Kenntnis über dessen ehrwürdiges Leben und ruhmvolles Ende« mitzuteilen.62
Das Dunkel, das die Kindheit des kleinen Wynfreth verschleiert, hängt wohl auch mit einer gesellschaftlichen Prägung zusammen. Im frühen Mittelalter wie in der gesamten Antike widerfuhr der Kindheit keine besondere Aufmerksamkeit. Sie galt als Durchgangsstadium zum Erwachsenenleben, eine Entwicklungsstufe, die am besten rasch bewältigt wurde. Mit Blick auf die hohe Kindersterblichkeit und das geringe Durchschnittsalter verwundert diese Denkweise nicht. Die pragmatische Haltung führte jedoch nicht dazu, dass allgemein die Kindheit entwertet wurde. Antike und mittelalterliche Eltern haben wie die meisten Eltern aller Epochen ihren Nachwuchs geliebt und emotionale Bindungen gepflegt.63
Wem die Fakten fehlen, wird in der Literatur und in der Phantasie fündig. Dem Auftritt des zwölfjährigen Jesus im Jerusalemer Tempel ist ein folgenreicher Besuch im Elternhaus des Bonifatius nachgebildet. Willibald zufolge schmiedete er Pläne, wie er sein Ziel erreichen könne. Ein Zufall half ihm: »Als aber einst, wie es in jenen Gegenden Sitte ist, einige Presbyter oder Kleriker wegen der Predigt die dortigen Laien und Volksgenossen besuchten und zum Hof und Haus des vorgenannten Familienvaters gekommen waren, begann er sofort, wie es sein noch schwaches kindliches Vermögen gestattete, sich mit ihnen über himmlische Dinge zu unterhalten und sich nach dem zu erkundigen, was ihm und seiner Schwachheit in Zukunft nützen könne.«64 Bei den damals verbreiteten autoritären Strukturen in Familie und Gesellschaft ist ein naseweiser Wynfreth kaum vorstellbar. Immerhin erfährt der Leser bei dieser Gelegenheit, dass der Junge auf einem Gehöft aufwuchs. Im lateinischen Text ist von einer villa und einer domus die Rede, Begriffe, die ausgedehnteren Grundbesitz voraussetzten und dazu führten, Bonifatius’ Familie zum niederen Adel zu rechnen. Am Ende seines ersten Kapitels bemerkt Willibald, Wynfreth habe, um »den Schatz der ewigen Erbschaft« zu erlangen, »Vater und Mutter, Äcker und anderes, was von dieser Welt ist«65





























