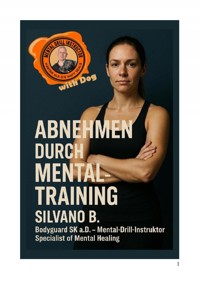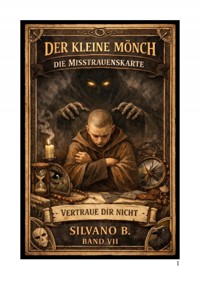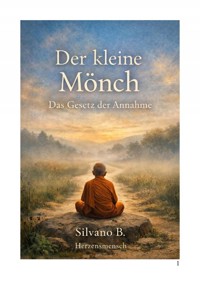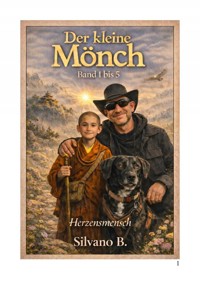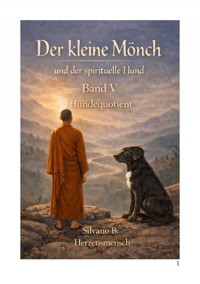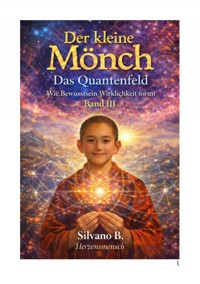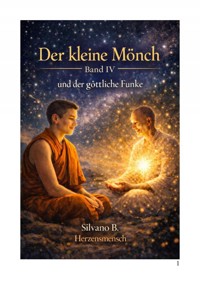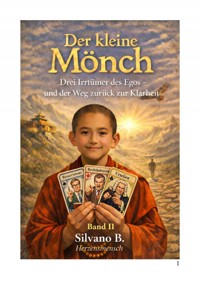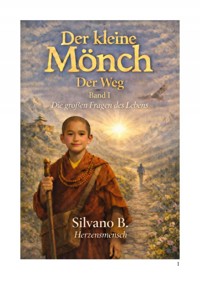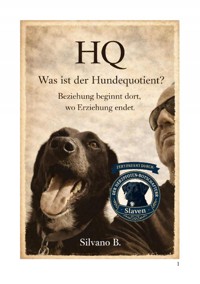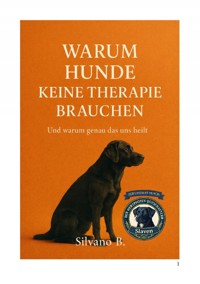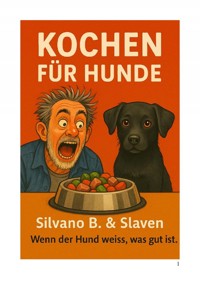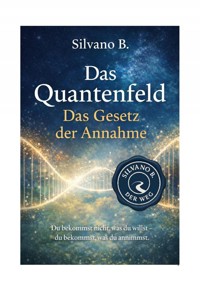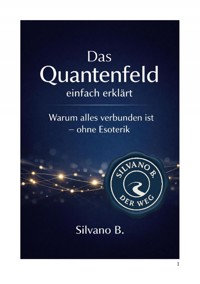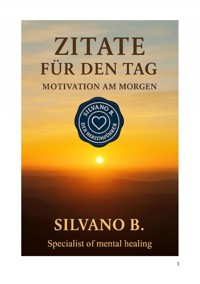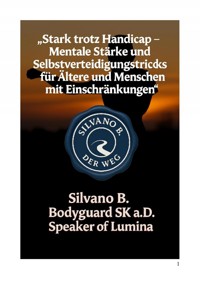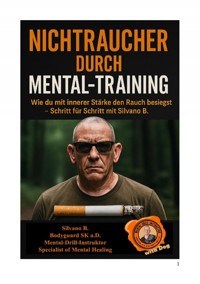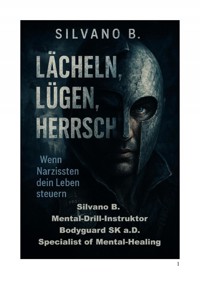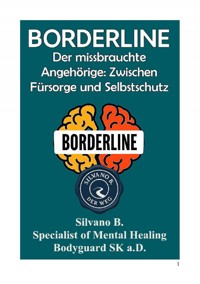
Dieses Buch gibt den Menschen eine Stimme, die sonst kaum jemand hört – den Angehörigen. Wer an der Seite eines Menschen mit Borderline lebt, kennt das Auf und Ab: zwischen grenzenloser Nähe und plötzlicher Kälte, zwischen Liebe, Hoffnung und tiefster Verzweiflung. "Borderline – Der missbrauchte Angehörige" erzählt von diesen unsichtbaren Kämpfen. Von den Schuldgefühlen, die nicht die eigenen sind. Von der Fürsorge, die zur Selbstaufgabe wird. Von dem Missbrauch, der oft nicht als solcher erkannt wird, weil er sich hinter dem Wort "Liebe" verbirgt. Dieses Buch ist mehr als ein Erfahrungsbericht. Es ist ein Spiegel für alle, die sich in der Zerrissenheit wiederfinden – und zugleich ein leiser Wegweiser für den Mut, sich selbst nicht zu verlieren. Ein Werk für alle, die verstehen wollen, was im Schatten dieser Krankheit geschieht. Und ein Trost für jene, die endlich sehen: Du bist nicht allein.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist all den Menschen gewidmet,
die einen geliebten Menschen mit Borderline
Persönlichkeitsstörung begleiten.
Dieses Buch ist auch all jenen gewidmet,
die lieben – auch wenn es manchmal weh tut.
Den Müttern, Vätern, Partnern, Geschwistern, Freun-
den – die bleiben, obwohl sie oft nicht wissen, wie.
Die zuhören, obwohl sie selbst keine Antworten mehr
haben. Die mittragen, mitweinen, mitzweifeln – und
trotzdem nicht aufgeben.
Es ist auch jenen gewidmet, die sich auf den Weg ma-
chen, sich selbst besser zu verstehen. Die sich trauen,
Hilfe anzunehmen. Die nicht perfekt sind, aber echt.
Die fallen – und wieder aufstehen.
Und es ist dir gewidmet, der du diese Zeilen liest.
Vielleicht bist du erschöpft.
Vielleicht bist du voller Hoffnung.
Vielleicht weißt du gerade nicht weiter.
Dieses Buch soll dir Mut machen.
Mut, weiterzugehen.
Mut, dich abzugrenzen, ohne Schuldgefühle.
Mut, wieder zu lieben – dich selbst eingeschlossen.
Mit tiefem Respekt und ehrlicher Verbundenheit,
Silvano B.
Specialist of Mental Healing & Autor „Es braucht keine perfekten Menschen, um einander zu
heilen. Es braucht nur den Mut, da zu sein – ehrlich,
mitfühlend und ohne sich selbst zu verlieren.“
— Silvano B.
„Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. In diesem
Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und un-
sere Freiheit.“
— Viktor E. Frankl
„Manchmal besteht wahre Liebe nicht im Festhalten,
sondern im Verstehen, wann Loslassen heilender ist.“
— Unbekannt
Prolog – von Hans Meisner, Mental-Coach,
Begleiter, Freund
Es gibt Begegnungen im Leben, die hinterlassen Spuren. Nicht nur auf der Haut, sondern tiefer – im Denken, im Fühlen, im eigenen Weltbild.
Meine Begegnung mit Silvano B. war eine solche.
Kennengelernt habe ich ihn in einer Welt, in der Stärke, Disziplin und Wachsamkeit über Leben und Tod entschei-den können: im Personenschutz. Wir arbeiteten Seite an Seite – bei internationalen Einsätzen, in Krisengebieten, bei hochsensiblen Mandaten. Silvano war damals schon jemand, der auffiel: nicht laut, nicht auftrumpfend, aber präsent. Klar in der Beobachtung, präzise im Handeln, auf-richtig in der Haltung.
Ein Mann, der wusste, wie man schützt – andere. Was ich damals noch nicht wusste: wie schwer es ist, sich selbst zu schützen, wenn das Leben zuschlägt.
Im Laufe der Jahre kamen private Gespräche dazu. Ich durfte einen anderen Silvano kennenlernen – einen Vater, einen Suchenden, einen Menschen, der sich mit voller Kraft für andere einsetzt, oft über seine Grenzen hinaus. Und ich erlebte mit, wie er mit der Realität konfrontiert wurde, die so viele überfordert: ein geliebter Mensch mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Was das bedeutet, kann man nicht einfach nachlesen. Man muss es leben. Man muss fühlen, was es heißt, zwischen Hoffnung und Verzweiflung zu schwanken, zwischen Nähe und Ablehnung, zwischen bedingungsloser Liebe und tiefer Erschöpfung.
Ich selbst bin Mental-Coach. Ich begleite Menschen durch schwere Lebensphasen, helfe ihnen, neue Perspektiven zu entwickeln, Kraftquellen zu finden. Auch Silvano kam zu mir in dieser Zeit – nicht als Klient, sondern als Gefährte auf einem sehr anspruchsvollen Weg. Unsere Gespräche waren intensiv, ehrlich, schmerzhaft und – immer wieder – heilsam.
Denn Silvano ist keiner, der sich in der Opferrolle einrich-tet. Er ist ein Mensch, der lernen will. Der verstehen will. Der durch das Dunkel hindurchschaut, um das Licht nicht aus den Augen zu verlieren.
Dieses Buch ist ein Resultat dieser inneren Entwicklung. Es ist keine trockene Analyse, keine wissenschaftliche Ab-handlung – und gerade deshalb so wertvoll. Es ist ein Er-fahrungsbericht, ein ehrliches, mutiges Zeugnis. Es gibt Angehörigen eine Stimme, die oft überhört werden. Und es gibt Hoffnung – nicht in Form von leeren Phrasen, sondern durch gelebte Erfahrung.
Silvano beschreibt, was viele nur heimlich fühlen. Er spricht von Schuldgefühlen, von Hilflosigkeit, von Mo-menten, in denen man nicht mehr weiß, was richtig oder falsch ist. Aber auch von Liebe, von Verbundenheit, von kleinen Wundern, die inmitten des Chaos geschehen. Er zeigt, dass mentale Stärke nicht bedeutet, immer stark zu sein – sondern immer wieder aufzustehen. Nicht gegen die Gefühle zu kämpfen, sondern mit ihnen zu wachsen. Nicht aufzugeben, auch wenn man den Weg nicht kennt.
Als Coach, als Freund, als Mensch kann ich sagen: Dieses Buch ist wichtig. Für Angehörige von Borderliner*innen. Für alle, die in schwierigen Beziehungen leben. Für alle, die am Rande stehen und nicht wissen, wie sie helfen kön-nen – oder ob sie es überhaupt noch schaffen. Und es ist ein Buch, das Mut macht. Weil es zeigt: Auch in den verworrensten Lebenslinien kann man Spuren der Hei-lung finden.
Danke, Silvano, dass du diesen Weg nicht nur gegangen, sondern auch mit uns geteilt hast.
Hans Meisner
Mental-Coach, Begleiter, Freund
Vorwort von Silvano B..
Ich habe sie geliebt. Mit ganzem Herzen. Wir hatten ein Kind zusammen, bauten eine gemeinsame Zukunft – zumindest glaubte ich das. Drei Jahre lang lebten wir zwischen Himmel und Hölle. Es waren intensive, lei-denschaftliche, wunderschöne – und zugleich verstörende, erschöpfende, zerstörerische Jahre. Ich verstand lange nicht, was da eigentlich geschah. Wa-rum aus Liebe plötzlich Wut wurde. Warum sie mich an einem Tag idealisierte – und mich am nächsten hasste. Wa-rum sie verschwand, ohne Vorwarnung. Warum sie wie-derkam, als wäre nichts gewesen. Und warum ich immer wieder blieb.
Erst später, viel zu spät, fiel das Wort: Borderline. Ich kannte den Begriff damals nur oberflächlich. Wie so viele. Ich dachte an schwere Kindheiten, an emotionale Instabilität – aber nicht daran, wie sehr es auch das Leben der Menschen um sie herum verändert.
Ich habe sie mehrfach nach Suizidversuchen gefunden. Habe Ärzte gerufen. Bin mit ihr durch Nächte gewandert, voller Angst. Habe sie festgehalten – und mich selbst dabei verloren.
Die Trennung war die Hölle. Aber die Zeit danach fast noch schlimmer. Die Scheidung dauerte elf Jahre. Elf Jahre ständiger Machtspiele, Manipulation, Erniedrigung. Elf Jahre juristische und emotionale Folter.
Und das Tragische – oder vielleicht das Zeichen, dass ich selbst noch nicht heil war:
Ich geriet wieder an Frauen mit Borderline-Strukturen. Nicht weil ich verrückt bin, sondern weil ich geprägt war. Weil meine Sehnsucht nach Nähe, Geborgenheit und emo-tionaler Tiefe mich blind gemacht hat – und weil ich dach-te, ich könnte helfen. Ich wollte retten, trösten, stark sein. Was ich nicht verstand: Ich musste zuerst mich selbst ret-ten.
Dieses Buch ist kein Abrechnung. Und auch kein Ratgeber im klassischen Sinn.
Es ist ein persönlicher Erfahrungsbericht. Roh, ehrlich, schmerzhaft – aber auch mit Momenten der Klarheit und des Wachstums. Ich schreibe es nicht, weil ich perfekt da-mit umgegangen bin. Sondern gerade weil ich es nicht war.
Ich schreibe es für dich – wenn du gerade an deiner Bezie-hung verzweifelst.
Ich schreibe es für dich – wenn du nicht mehr weißt, ob du krank oder gesund bist.
Ich schreibe es für dich – wenn du denkst, du bist allein.
Borderline ist eine der komplexesten und am meisten miss-verstandenen Persönlichkeitsstörungen. Und Angehörige geraten dabei oft an den Rand – nicht nur emotional, son-dern auch psychisch und körperlich. Man hört viel über Betroffene – aber viel zu wenig über die Menschen, die sie lieben.
Wenn dieses Buch dir ein Stück Verständnis, ein bisschen Licht oder einen kleinen Schritt zu dir selbst bringt – dann hat sich der Schmerz gelohnt, den ich in Worte verwandelt habe.
Silvano B.
Specialsi of Mental Healing
Angehöriger – und Überlebender
Inhaltsverzeichnis
Prolog – von Hans Meisner
Einblicke eines langjährigen Weggefährten
Vorwort von Silvano B.
Kapitel 1 – Wenn das Leben plötzlich anders wird Erste Anzeichen – erste Fragen. Wie Angehörige oft völlig unvorbereitet in eine emotionale Achterbahn geraten.
Kapitel 2 – Zwischen Nähe und Rückzug: Das unsicht-bare Band
Die Dynamik von Borderline-Beziehungen verstehen – und überleben.
Kapitel 3 – Äusser Anzeichen
Medikamente, Drogen und Alkoholmissbrauch.
Kapitel 4 – Suizidversuchen
Warum will der Boderliner sich umbringen oder ist es nur ein Hilferuf?
Kapitel 5 – Die Diagnose: Erleichterung oder Schock? Was es bedeutet, wenn ein geliebter Mensch als „Borderli-ner“ gilt – und wie man damit umgehen kann.
Kapitel 6 – Lügen ist nicht gleich Lügen Die falsche Wahrnehmung wird von uns als Lüge gesehen Kapitel 7 – Wenn der Psychiater nicht recht hat Oft sind die medizinische Helfer aus sicht des Borderliner nicht in der Lage, ihnen zu helfen.
Kapitel 8 – Die Macht der Trigger Wie scheinbar harmlose Situationen eskalieren – und wie man damit umgehen kann.
Kapitel 9 – Co-Abhängigkeit: Wenn Helfen krank macht.
„Ich dachte, ich helfe – doch ich habe mich selbst verlo-ren.“
Kapitel 10 – Was ist „normal“? Was ist manipulativ? Wie Angehörige lernen, Realität von Illusion zu unter-scheiden.
Kapitel 11 – Kommunikation mit einem Menschen im Sturm
Was hilft – und was alles nur schlimmer macht.
Kapitel 12 – Schuldgefühle, Selbstzweifel und die ewige Frage: Bin ich genug?
Der emotionale Ausnahmezustand der Angehörigen.
Kapitel 13 – Sexualität – Ausschweifend oder A-Sexuel Viel oder wenig – bis gar nicht - Gefühlskalt
Kapitel 14 – Grenzen setzen – ohne Schuldgefühle Selbstschutz und Liebe müssen kein Widerspruch sein. Kapitel 15 – Leben auf Eierschalen? Warum Klarheit wichtiger ist als Rücksicht.
Kapitel 16 – Helfersyndrom
Zieht man mit einem Hefer oder Messiassyndrom Border-liner in sein Leben?
Kapitel 17 – Was sagt der Psychiater dazu? Viele Leute haben das Helfersyndrom
Kapitel 18 – Der tägliche Balanceakt zwischen Helfen und Retten wollen
Warum wir nicht heilen können, aber unterstützen dürfen.
Kapitel 19 – Fremdgefährdung und Eigengefährdung Muss man Angst haben, wenn man ein Boderlinder in der Umgebung habt?
Kapitel 20 – Wenn Liebe allein nicht reicht Was Angehörige tun können, wenn sie an ihre Grenzen kommen.
Kapitel 21 – Selbstfürsorge: Kein Luxus, sondern Über-lebensstrategie
Kleine Schritte, um nicht selbst zu zerbrechen.
Kapitel 22 – Der eigene Weg zurück ins Leben Wie Angehörige lernen, wieder an sich selbst zu glauben. Kapitel 23 – Gespräche mit anderen Angehörigen Erfahrungsberichte, Ohnmacht, Hoffnung, neue Perspekti-ven.
Kapitel 24 – Hilfe annehmen ist kein Versagen Therapie, Selbsthilfegruppen, Coaching – was wirklich un-terstützen kann.
Kapitel 25 – Eltern, Partner, Kinder: Rollen und Rol-lenkonflikte
Wenn das Familiengefüge erschüttert wird.
Kapitel 26 – Und wenn ich gehe? Trennung, Kontaktabbruch oder bewusste Distanz – ein Tabuthema unter Angehörigen.
Kapitel 27 – Die Stärke derer, die bleiben Ein ehrliches Kapitel über Resilienz, Liebe und mentale Kraft.
Kapitel 28 – Wenn Hoffnung wieder Raum bekommt Der lange Weg zur Akzeptanz und zur inneren Ruhe.
Kapitel 29 – Worte, die bleiben
Abschließende Gedanken – für dich als Angehöriger.
Kapitel 30 – Das sagt der Psychiater zu Borderline
Kapitel 31 – Das sagt der Psychologe zu Borderline
Kapitel 32 – Das sagt der Mental-Trainer zu Borderline Kapitel 33 – Das sagt ein Angehriger zu Borderline
Kapitel 34 – Das sagt ein Jemand von der Strasse zu Borderline
Kapitel 35 – Nachwort von Silvano B. Autor, Mental-Trainer und Mental-Healing Specialst.
Anhang
– Wichtige Anlaufstellen und Notrufnummern – Buchempfehlungen und Links
– Selbsthilfegruppen und Online-Foren – Reflexionsfragen für Angehörige – Übungen zur Selbststärkung (Atem, Achtsamkeit, Ab-grenzung)
Kapitel 1 – Wenn das Leben plötzlich an-
ders wird
Erste Anzeichen – erste Fragen. Wie Angehörige oft völlig unvorbereitet in eine emotionale Achterbahn geraten.
Es gibt Momente im Leben, da verändert sich alles – nicht mit einem lauten Knall, sondern mit einem Flüstern. Eine Begegnung, ein Blick, ein Gespräch. Und plötzlich ist da ein Mensch, der dich in den Bann zieht. Mit dem du dich so verbunden fühlst wie noch nie zuvor. Der dich sieht, hört, spürt. Intensiv. Nah. Überwältigend.
So beginnt es oft, wenn Angehörige von Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung in deren Welt eintau-chen. Es ist nicht das Offensichtliche, das einem zuerst auf-fällt. Es ist die Tiefe, die Verletzlichkeit, das Gefühl von Nähe, das so stark ist, dass man glaubt: "Das ist mehr als Liebe. Das ist Seelenverwandtschaft."
Doch was als Märchen beginnt, verwandelt sich für viele in einen Albtraum.
Die ersten feinen Risse
Zuerst sind es kleine Spannungen. Ein Missverständnis, das sich plötzlich zu einem riesigen Drama auswächst. Ei-ne Nachricht, die nicht sofort beantwortet wird – und schon steht der Vorwurf im Raum, man liebe nicht genug. Ein Moment des Rückzugs – und man wird beschuldigt, herz-los zu sein.
Du fragst dich: Habe ich etwas falsch gemacht? Warum ist plötzlich alles anders? Warum schwankt dieser Mensch so extrem zwischen Liebe und Wut, zwischen Nähe und Rückzug?
Angehörige tappen in dieser frühen Phase meist im Dun-keln. Sie erklären sich das Verhalten des Partners, der Tochter, des Bruders mit Stress, Unsicherheit oder viel-leicht einer schweren Vergangenheit. Man will helfen, nicht urteilen. Man liebt. Man will retten. Man will verste-hen.
Und genau hier beginnt die emotionale Achterbahnfahrt.
Der schleichende Kontrollverlust Was viele nicht begreifen – weil es ihnen niemand gesagt hat: In Beziehungen mit Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung verlieren Angehörige oft schlei-chend ihre innere Stabilität. Man passt sich an. Man ver-sucht, Konflikte zu vermeiden. Man beginnt, auf Zehen-spitzen zu leben.
Du überlegst zweimal, was du sagst. Du vermeidest be-stimmte Themen. Du nimmst Schuld auf dich, obwohl du weißt, dass du nichts falsch gemacht hast. Du wirst emoti-onal manipuliert – oft ohne es zu merken.
Wenn du liebst, versuchst du zu geben. Doch was, wenn nie genug ist? Wenn das, was du gibst, nicht ankommt – oder umgedeutet wird? Wenn du mit einem Menschen lebst, der heute sagt, du bist seine Rettung, und morgen, dass du sein größter Feind bist?
Es sind diese emotionalen Extreme, die Angehörige zer-mürben. Sie erschüttern dein Selbstbild, dein Vertrauen, deinen inneren Kompass. Du verlierst dich – Stück für Stück – ohne es zu bemerken.
Isolation und Unsicherheit
Ein weiterer Aspekt, den viele Angehörige erleben, ist die soziale Isolation. Wer nicht selbst mit einem Menschen mit Borderline lebt oder lebt hat, kann oft nicht nachvollziehen, was da passiert. Freunde verstehen deine Sorgen nicht. Familie spielt es herunter. Therapeuten konzentrieren sich oft auf den Betroffenen – und du stehst allein da.
Und so fragst du dich irgendwann: Bin ich noch normal? Oder bin ich das Problem? Du beginnst, an dir zu zweifeln. Vielleicht sogar, dich selbst zu hassen, weil du wütend wirst. Oder weil du Gedanken hast wie: "Ich halte das nicht mehr aus."
Diese Gedanken sind keine Schwäche. Sie sind ein Zei-chen, dass deine Seele Hilfe braucht. Dass du an der Gren-ze deiner Belastbarkeit angekommen bist. Und das darfst du erkennen – ohne Schuldgefühle.
Was ist Borderline – und was bedeutet es für Angehörige? Die Borderline-Persönlichkeitsstörung ist komplex. Sie entsteht oft durch schwere frühkindliche Traumatisierun-gen, durch emotionale Vernachlässigung oder Missbrauch. Betroffene haben eine instabile Selbstwahrnehmung, ein tiefes Gefühl innerer Leere und eine panische Angst vor dem Verlassenwerden. Ihre Gefühlswelt ist intensiv, wider-sprüchlich, schnell wechselnd. Das macht das Leben mit ihnen so unvorhersehbar – für sie selbst und für ihr Um-feld.
Als Angehöriger bedeutet das oft: Du wirst idealisiert – und dann entwertet. Du wirst geliebt – und dann zurück-gewiesen. Du wirst gebraucht – aber nie darfst du selbst schwach sein.
Ein erster Schritt: Dich selbst ernst nehmen Wenn das Leben plötzlich anders wird, weil du dich in ei-ner Beziehung mit einem Menschen mit Borderline befin-dest, brauchst du nicht nur Verständnis für den anderen – sondern vor allem für dich selbst. Du darfst dir eingeste-hen, dass du überfordert bist. Dass du Fragen hast. Dass du manchmal verzweifelt bist. Dass du nicht mehr weißt, wo oben und unten ist.
Dieses Buch will dir kein Rezept geben. Aber es will dir Raum geben: Für deine Gefühle. Für deine Widersprüche. Für deine Geschichte.
Denn du bist nicht allein.
Und dein Schmerz verdient genauso viel Aufmerksamkeit wie der der Betroffenen.
Reflexionsfragen für dich:
•Wann hast du das erste Mal bemerkt, dass in deiner
Beziehung etwas "nicht stimmt"?
•Wo hast du dich selbst zurückgenommen, um Kon-
flikte zu vermeiden?
• Was würdest du einem guten Freund oder einer
Freundin raten, wenn er oder sie in deiner Situation wäre?
Kapitel 2 – Zwischen Nähe und Rückzug:
Das unsichtbare Band
Die Dynamik von Borderline-Beziehungen verstehen – und überleben
1. Einführung: Das Paradox der Nähe
In Beziehungen mit Menschen, die an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) leiden, ist oft das zentrale Thema das schwankende Gefühl zwischen tiefster Nähe und schmerzhafter Distanz. Diese Ambivalenz, dieses ständige Hin- und Hergerissen-Sein, prägt das Erleben aller Beteiligten. Es ist ein unsichtbares Band, das verbindet, aber gleichzeitig droht, jederzeit zu reißen.
Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsmerkmalen seh-nen sich intensiv nach emotionaler Nähe und Bestätigung. Sie möchten gesehen, verstanden und gehalten werden – oft mehr als andere Menschen. Doch diese Nähe birgt auch eine große Angst: die Angst vor dem Verlassenwerden, vor Zurückweisung und vor Kontrollverlust. Das Ergebnis ist ein widersprüchliches Verhalten, das sowohl Nähe sucht als auch vermeidet. Dieses Muster wird für Außenstehende schnell unverständlich und belastend.
Die Liebe und Bindung zu einem Menschen mit Borderline kann sich deshalb anfühlen wie eine emotionale Achter-bahnfahrt: Momente der innigen Verbundenheit wechseln mit Phasen des Rückzugs, der Enttäuschung oder gar Wut. Es ist ein ständiger Balanceakt zwischen dem Wunsch, fest zusammenzuhalten, und dem Bedürfnis, sich zu schützen. Für Betroffene und ihre Partner ist das eine große Heraus-forderung – und gleichzeitig ein Schlüssel zum Verstehen.
2. Das unsichtbare Band: Bindung in der Borderline-Dynamik
Das „unsichtbare Band“, von dem hier die Rede ist, be-schreibt die intensive emotionale Verbindung, die trotz al-ler Schwierigkeiten und Konflikte existiert. Menschen mit Borderline erleben Bindung sehr intensiv und oft auf eine Weise, die sie selbst kaum kontrollieren können. Dieses Band wird genährt durch ein tiefes Bedürfnis nach Zugehö-rigkeit und durch die Angst, allein zu sein.
Die Rolle der Bindung
Bindung ist ein elementares menschliches Bedürfnis. Schon im frühen Kindesalter prägen Bindungserfahrungen unser Bild von Nähe, Sicherheit und Vertrauen. Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung hatten häufig belas-tende oder instabile Bindungserfahrungen – beispielsweise durch Vernachlässigung, Missbrauch oder emotionale Un-verfügbarkeit der Eltern.
Diese frühen Erfahrungen hinterlassen Spuren, die sich im Erwachsenenalter in Beziehungsdynamiken zeigen. Das Bedürfnis nach Bindung ist einerseits groß, gleichzeitig ist das Vertrauen in dauerhafte Nähe gestört. Die Betroffenen suchen Nähe, fühlen sich aber oft bedroht oder überwältigt davon. Das un-sichtbare Band ist deshalb nicht einfach nur Verbindung, sondern ein Geflecht aus intensiven Emotio-nen, Hoffnungen und Ängsten.
Idealisierung und Abwertung – zwei Seiten derselben Me-daille
Typisch für Borderline-Beziehungen ist das Wechselspiel von Idealisierung und Abwertung. In der Nähe wird der Partner oft als „perfekt“, „unersetzlich“ und „rettend“ wahrgenommen. Doch diese Idealisierung ist instabil. So-bald der Partner eine Enttäuschung oder einen vermeintli-chen Fehler zeigt, wandelt sich das Bild schnell in Abwer-tung: „Du bist nicht mehr der, den ich liebe.“ Diese starken Schwankungen erschüttern die Beziehung.
Dieses Phänomen hat einen psychologischen Grund: Um den Schmerz der Angst vor Verlassenwerden zu bewälti-gen, wird zunächst die Nähe idealisiert – ein Schutzmecha-nismus, um Halt zu finden. Wenn dann aber Angst, Enttäu-schung oder Wut aufkommen, schlägt die Stimmung um, um sich emotional abzugrenzen. Das macht das Band un-sichtbar – mal gespannt, mal locker, mal fast zerreißend.
3. Das Wechselspiel von Nähe und Rückzug im Alltag
In der Praxis zeigt sich die Borderline-Dynamik oft im „Push and Pull“-Verhalten: Menschen mit BPS suchen die Nähe zum Partner, Freund oder Familienmitglied, ziehen sich aber genauso schnell wieder zurück. Dieses Hin- und Her ist kein bewusstes Spiel, sondern Ausdruck der inneren Verfassung und der Schutzmechanismen.
Beispiele aus dem Alltag
•Nach intensiven Liebesbekundungen folgt plötzli-
ches Schweigen oder Rückzug. Ein Partner meldet sich kaum noch, obwohl er kurz zuvor Nähe und Vertrautheit gezeigt hat. Der Rückzug wirkt ver-letztend und verwirrend.
•Häufige Konflikte wegen vermeintlicher Missver-
ständnisse oder Ablehnung. Kleinigkeiten können eskalieren, weil Ängste und Unsicherheiten hochko-chen. Was für Außenstehende banal wirkt, wird emotional zum großen Problem.
•Dauerhafte Sorge um die Beziehung. Die Be-
troffenen leben oft in permanenter Angst vor Verlas-senwerden – auch wenn es keine objektiven Anzei-chen gibt. Dieses innere Alarmgefühl führt zu ver-stärktem Kontrollverhalten oder übermäßiger Ab-hängigkeit.
Diese Muster führen zu einer emotionalen Überforderung für alle Beteiligten. Angehörige fühlen sich oft hilflos, ver-letzt oder überfordert, während die Betroffenen selbst in-nerlich zerrissen sind zwischen dem Wunsch nach Liebe und dem Impuls, sich zu schützen.
4. Psychologische Hintergründe: Warum entstehen die-se Dynamiken?
Die Ursachen für die komplexen Beziehungsdynamiken bei Borderline sind vielschichtig und wurzeln in psychologi-schen, biologischen und sozialen Faktoren.
Frühe Bindungserfahrungen
Wie bereits angedeutet, spielen frühe Bindungserfahrungen eine zentrale Rolle. Wenn Kinder in ihrer Entwicklung er-leben, dass Bezugspersonen unzuverlässig, inkonsistent oder gar verletzend sind, lernen sie, Nähe mit Unsicherheit und Schmerz zu verbinden. Dieses Bindungsverhalten be-einflusst später das Verhalten in Partnerschaften und Freundschaften.
Emotionale Dysregulation
Ein weiteres Kernmerkmal der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist die emotionale Dysregulation. Das bedeutet, dass Betroffene Gefühle oft sehr intensiv er-leben und Schwierigkeiten haben, diese zu steuern oder zu beruhigen. Die Folge ist, dass sich emotionale Spannungen schnell aufbauen und entladen, was zu impulsiven Hand-lungen oder plötzlichen Stimmungsschwankungen führt.
Angst vor Verlassenwerden
Die Angst vor Verlassenwerden ist fast immer präsent und kann sich in vielfältigen Verhaltensweisen äußern: von klammerndem Verhalten bis hin zu Selbstverletzung oder extremen Wutausbrüchen. Diese Angst entsteht aus tief verwurzelten Erlebnissen und wird durch die instabile Bin-dung verstärkt.
Impulsivität und Selbstverletzendes Verhalten
Impulse wie Wutausbrüche, riskantes Verhalten oder Selbstverletzungen sind häufig Ausdruck der inneren Über-forderung und dienen kurzfristig dazu, emotionale Span-nungen abzubauen oder Angst zu kontrollieren. Für Au-ßenstehende sind diese Verhaltensweisen oft schwer nach-vollziehbar, doch sie sind eine Form der Bewältigung.
5. Überleben in der Borderline-Dynamik: Strategien für Angehörige und Partner
In einer Beziehung mit einem Menschen, der Borderline-Symptome zeigt, ist es wichtig, Wege zu finden, mit der emotionalen Herausforderung umzugehen. Dabei gilt es, einerseits Mitgefühl zu zeigen, andererseits aber auch die eigenen Grenzen zu wahren.
Grenzen setzen und Selbstschutz
Der erste Schritt ist, klare Grenzen zu definieren. Dies schützt vor Überforderung und hilft, eine Balance zu fin-den. Grenzen können z.B. sein: „Ich nehme mir eine Aus-zeit, wenn die Kommunikation zu emotional wird“ oder „Ich gehe nicht auf Beschimpfungen ein.“
Kommunikation verbessern
Eine offene und achtsame Kommunikation ist entschei-dend. Statt Vorwürfe zu machen, hilft es, eigene Gefühle und Bedürfnisse ehrlich zu äußern. Beispielsweise: „Ich fühle mich verletzt, wenn du dich zurückziehst, weil mir dann die Verbindung fehlt.“
Achtsamkeit und Selbstfürsorge
Für Angehörige ist es wichtig, die eigenen Bedürfnisse nicht zu vernachlässigen. Pausen, Hobbys, Freunde und professionelle Unterstützung helfen, emotional stabil zu bleiben.
Professionelle Hilfe suchen
Therapeutische Unterstützung für beide Seiten kann entlas-ten. Für Betroffene ist die Dialektisch-Behaviorale Thera-pie (DBT) eine bewährte Methode, um emotionale Regula-tion zu erlernen und die Beziehungsmuster zu verändern. Partner und Angehörige profitieren von Beratung, um die Dynamik besser zu verstehen und sich selbst zu schützen.
6. Hoffnung und Veränderung: Wege zu stabileren Be-ziehungen
Trotz aller Schwierigkeiten gibt es immer Hoffnung auf Veränderung. Der Weg aus dem ständigen Schwanken zwischen Nähe und Rückzug ist möglich – mit Geduld, Verständnis und professioneller Begleitung.
Bewusstwerdung als erster Schritt
Das Erkennen der eigenen Muster und der Dynamik in der Beziehung ist entscheidend. Es ermöglicht, aus eingefahre-nen Verhaltensweisen auszubrechen und neue Wege zu gehen.
Entwicklung emotionaler Resilienz
Sowohl Betroffene als auch Angehörige können lernen, emotional belastende Situationen besser zu meistern und innere Stärke aufzubauen.
Aufbau stabiler Bindungen
Mit der Zeit und durch therapeutische Arbeit können stabi-lere und vertrauensvollere Bindungen entstehen. Das un-sichtbare Band wird dann nicht mehr zum Drahtseil, son-dern zu einem starken Netz.
Kapitel 3 – Äußere Anzeichen: Medika-
mente, Drogen- und Alkoholmissbrauch
und weitere Warnsignale
1. Einleitung: Sichtbare Zeichen eines unsichtbaren Lei-dens
Die Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS) ist eine tief-greifende psychische Erkrankung, deren komplexe und oft widersprüchliche innere Dynamik sich im Verhalten der Betroffenen äußert. Für Außenstehende können die vielen Facetten der Störung schwer verständlich sein, oft bleiben jedoch bestimmte Verhaltensmuster und Symptome sicht-bar. Gerade der Missbrauch von Medikamenten, Drogen und Alkohol gilt als eines der häufigsten und gefährlichsten äußeren Anzeichen. Doch es gibt noch viele weitere Ver-haltensweisen, die Hinweise auf die Erkrankung geben können: von selbstverletzendem Verhalten bis hin zu im-pulsivem, riskantem Handeln.
Dieses Kapitel beleuchtet ausführlich die typischen äuße-ren Anzeichen von BPS, erklärt ihre Hintergründe aus wis-senschaftlicher Sicht, präsentiert reale Fallbeispiele und gibt Empfehlungen zum Umgang mit diesen Symptomen.
2. Substanzmissbrauch bei Borderline: Ein weit verbreite-tes Phänomen
2.1 Medikamentenmissbrauch – Hilfe und Risiko zu-gleich
Viele Menschen mit Borderline erhalten Medikamente als Teil ihrer Therapie, insbesondere:
•Antidepressiva (zur Behandlung von Depression
und Angst)
•Stimmungsstabilisierer (gegen emotionale
Schwankungen)
•Anxiolytika/Benzodiazepine (zur kurzfristigen Be-
ruhigung)
Diese Medikamente können im Rahmen eines Therapie-plans hilfreich sein. Jedoch kommt es häufig zu einer prob-lematischen Einnahme: Entweder werden die Medikamente ohne ärztliche Anweisung in Dosierung oder Häufigkeit verändert, oder sie dienen als Mittel zur Selbstmedikation, um unerträgliche Gefühle zu dämpfen.
Risiken und Folgen
Der Missbrauch insbesondere von Benzodiazepinen führt zu Abhängigkeit, Toleranzentwicklung und kann zu ge-fährlichen Überdosierungen führen. Die Kombination mit Alkohol oder anderen Substanzen potenziert die Risiken.
Eine Studie von Zanarini et al. (1998) zeigte, dass fast 60 % der Borderline-Patienten Probleme mit Medikamenten-missbrauch haben. Dabei handelt es sich oft um ein ver-zweifeltes Mittel zur Emotionskontrolle.
„Viele Betroffene nehmen Medikamente nicht nur zur Symptomlinderung, sondern als temporären Schutzschild gegen ihre starke emotionale Überforderung.“ — Prof. Dr. Martin Bohus, Borderline-Experte
2.2 Drogenmissbrauch als Selbstmedikation
Studien belegen, dass bis zu 65 % der Personen mit BPS gleichzeitig eine Substanzgebrauchsstörung aufweisen (Skodol et al., 2002). Der Konsum von Drogen wie Canna-bis, Kokain, Amphetaminen oder Heroin dient häufig der Suche nach Erleichterung, insbesondere:
•Betäubung intensiver negativer Gefühle (Leere,
Angst, Verzweiflung)
•Erleben von emotionaler Wärme oder Euphorie
•Flucht aus zwischenmenschlichen Konflikten
Neurobiologische Hintergründe
Neurowissenschaftliche Untersuchungen zeigen eine Dys-regulation im Belohnungssystem des Gehirns, speziell in den dopaminergen Bahnen. Diese führen dazu, dass Dro-gen kurzfristig starke positive Gefühle erzeugen, die aller-dings nicht lange anhalten. Das erhöht das Rückfallrisiko und kann eine Abhängigkeit begünstigen (Schmahl & Bremner, 2006).
2.3 Alkoholmissbrauch: Der gefährliche Alltagsbeglei-ter
Alkohol ist aufgrund seiner gesellschaftlichen Verbreitung ein besonders häufig genutztes Mittel zur Selbstmedikati-on. Er verschafft kurzfristig Erleichterung und Entspan-nung, führt aber bei chronischem Missbrauch zu einer Ver-schlechterung der emotionalen Stabilität, erhöht die Impul-sivität und begünstigt suizidale Handlungen (Zanarini et al., 2004).
Beispiel: „Lisa – Der lange Weg aus der Sucht“
Lisa, 27 Jahre alt, begann schon als Jugendliche regelmä-ßig Alkohol zu trinken. Mit der Diagnose Borderline im Erwachsenenalter eskalierte ihr Konsum. Sie geriet immer wieder in Konflikte mit Freunden und Familie, verlor Jobs und wurde gesundheitlich schwer beeinträchtigt. Nach mehreren Klinikaufenthalten begann sie schließlich eine integrative Therapie, in der sie lernte, ihre Emotionen ohne Alkohol zu regulieren.
3. Weitere äußere Anzeichen bei Borderline
Neben Substanzmissbrauch zeigen Betroffene oft weitere auffällige Verhaltensweisen, die für Angehörige und Fach-leute wichtige Hinweise liefern.
3.1 Selbstverletzendes Verhalten (SVV)
Selbstverletzung – meist in Form von Schneiden, Verbren-nen oder Kratzen – ist bei Borderline besonders verbreitet (etwa 70–80 % der Betroffenen). Die Verletzungen dienen als ein Versuch, innere Spannungen abzubauen oder uner-trägliche Gefühle greifbar zu machen.
Narben, frische Wunden oder Verbände an Armen, Beinen oder anderen Körperstellen sind häufig sichtbare Zeichen.
„SVV ist keine Manipulation, sondern Ausdruck tiefster innerer Not und ein Ventil für unerträgliche Emotionen.“ — Dr. Marsha Linehan, Entwickler der Dialektisch-Behavioralen Therapie (DBT)
3.2 Impulsives und risikoreiches Verhalten
Impulsivität ist ein Kernmerkmal der BPS. Sie äußert sich in diversen Verhaltensweisen:
•Rasante Fahrweise
•Unüberlegtes Geldausgeben oder Glücksspiel
•Promiskuitiver oder riskanter Sexualkontakt
•Essstörungen (Binge Eating, Bulimie)
Diese Verhaltensmuster führen oft zu sozialen Problemen, Konflikten und gesundheitlichen Risiken.
3.3 Stimmungsschwankungen und emotionale Ausbrü-che
Die starken und oft plötzlichen Stimmungsschwankungen sind für Außenstehende häufig schwer nachvollziehbar. Gefühle können von Euphorie zu tiefer Verzweiflung wechseln, häufig begleitet von Wutausbrüchen oder Wein-krämpfen.
3.4 Instabile soziale Beziehungen
Betroffene erleben häufig Konflikte und Trennungen, die sie emotional zusätzlich belasten. Das kann sich in häufi-gem Kontaktabbruch, intensiven Versöhnungsversuchen oder auch in starkem Nähe-Rückzugs-Verhalten zeigen.
4. Konkrete Fallbeispiele
4.1 Fallbeispiel: Sarah und der Kampf mit Beruhi-gungsmitteln
Sarah (24) nahm von ihrem Psychiater Benzodiazepine ge-gen Angstzustände. Nach einigen Monaten begann sie, die Dosis eigenmächtig zu erhöhen, da die Wirkung nicht mehr ausreichte. Parallel begann sie mit Cannabis, um die Beru-higungsmittel zu ergänzen. Ihre Familie bemerkte ihre zu-nehmende Verwirrtheit und Abhängigkeit erst spät. Ein langer Entzug und begleitende Therapie halfen ihr schließ-lich, die Abhängigkeit zu überwinden.
4.2 Fallbeispiel: Jens und die Gefahr des Alkohols
Jens (32) trank Alkohol, um seine innere Leere zu betäu-ben. Bei emotionalen Tiefs konsumierte er große Mengen. Dies führte zu häufigen Gewaltausbrüchen und sozialer Isolation. Nach mehreren Krisen begann Jens eine Kombi-nationstherapie aus DBT und Suchtbehandlung.
4.3 Fallbeispiel: Maria und die Narben ihrer Seele
Maria (29) verbarg jahrelang ihre Schnittverletzungen. Die Narben zeugten von Jahrzehnten emotionaler Not. In der Therapie lernte sie, Gefühle anders auszudrücken und ent-wickelte Strategien zur Stressbewältigung.
5. Wissenschaftliche Hintergründe
5.1 Emotionale Dysregulation und Impulsivität
Studien zeigen, dass bei BPS das limbische System, insbe-sondere die Amygdala, überaktiv ist, während der präfron-tale Kortex, der für Impulskontrolle zuständig ist, unterak-tiv arbeitet (New et al., 2007). Diese neurologischen Gege-benheiten erklären die emotionale Instabilität und impulsi-ves Verhalten.
5.2 Substanzmissbrauch und neuronale Belohnungssys-teme
Der Missbrauch von Substanzen kann als maladaptive Form der Selbstregulation verstanden werden, die kurzfris-tig das Belohnungssystem stimuliert, langfristig aber zu Abhängigkeit und Verschlechterung der Symptomatik führt (Schmahl & Bremner, 2006).
6. Expertenstimmen und Therapievorschläge
„Die Herausforderung bei Borderline mit Substanzmiss-brauch ist die doppelte Diagnose. Nur integrierte Behand-lungsansätze, die beide Störungen adressieren, können langfristig helfen.“
— Prof. Dr. Michael Lieb, Psychiater
Die Dialektisch-Behaviorale Therapie (DBT) hat sich als wirksam erwiesen, besonders im Umgang mit selbstverlet-zendem Verhalten und Suchtproblemen (Linehan, 1993). Sie vermittelt Fähigkeiten zur Emotionsregulation, Acht-samkeit und zwischenmenschlichen Fertigkeiten.
7. Umgang für Angehörige und Helfer
•Informieren Sie sich über die Störung und deren
Symptome
•Bewahren Sie Empathie und Verständnis, ohne
sich ausnutzen zu lassen
•Ermutigen Sie zur professionellen Hilfe und be-
gleiten Sie bei Bedarf
•Achten Sie auch auf die eigene psychische Ge-
sundheit8. Von äußeren Anzeichen zu echtem Verstehen
Die äußeren Zeichen von Borderline sind oft dramatisch und herausfordernd, doch sie spiegeln eine tiefe innere Not wider. Das Erkennen und Verstehen dieser Signale kann der erste Schritt sein, um Betroffenen Hilfe zu ermöglichen und gemeinsam den Weg aus der Krise zu finden.
Kapitel 4 – Suizidversuche: Warum will
der Borderliner sich umbringen – oder ist
es nur ein Hilferuf?
1. Einleitung: Die erschütternde Realität von Suizidver-suchen bei Borderline
Suizidversuche und Suizidalität zählen zu den gravierends-ten Symptomen der Borderline-Persönlichkeitsstörung (BPS). Die Schätzungen in der Literatur variieren, doch Studien gehen davon aus, dass bis zu 70 % der Betroffenen mindestens einen Suizidversuch unternehmen und etwa 8– 10 % der Betroffenen tatsächlich durch Suizid versterben (Oldham, 2006; Leichsenring et al., 2011). Dies ist eine erschreckend hohe Rate und stellt BPS neben anderen psy-chischen Erkrankungen als besonders gefährlich dar.
Doch hinter dieser nüchternen Statistik verbirgt sich eine komplizierte, vielschichtige Wirklichkeit. Suizidversuche bei Borderline sind häufig nicht nur ein Ausdruck eines konkreten Todeswunsches, sondern oftmals ein verzweifel-ter Hilferuf, ein Mittel zur Emotionsregulation, eine Reak-tion auf akute Krisen oder auch impulsiv ohne vorgeplante Absicht. Es ist essenziell, die Hintergründe zu verstehen, um angemessen und wirksam Hilfe leisten zu können.
2. Psychologische Hintergründe von Suizidversuchen bei Borderline
2.1 Emotionsregulation und der unerträgliche innere Schmerz
Ein zentrales Merkmal der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist die emotionale Dysregulation. Betroffene erleben intensive, schnell wechselnde Gefühle, die sie kaum steuern können. Diese Gefühle können von überwältigender Angst, Wut, Traurigkeit bis hin zu tiefer Leere und Verzweiflung reichen (Linehan, 1993).
Für viele Betroffene wird der emotionale Schmerz so uner-träglich, dass der Suizidversuch als scheinbar einzige Mög-lichkeit erscheint, dem Leiden ein Ende zu setzen. Dabei geht es nicht zwingend darum, tatsächlich sterben zu wol-len, sondern darum, die innere Qual zu beenden.
„Der Schmerz ist wie ein inneres Feuer, das brennt und al-les zu verschlingen droht. Suizidversuche sind ein verzwei-felter Versuch, dieses Feuer zu löschen.“ — Prof. Dr. John Gunderson, einer der führenden Forscher im Bereich Borderline
2.2 Suizidversuch als Hilferuf: Kommunikation durch Selbstverletzung
Viele Borderline-Patienten haben Schwierigkeiten, ihre Bedürfnisse und ihre innere Verzweiflung verbal auszudrü-cken. Die fehlende Fähigkeit, über Gefühle zu sprechen, führt häufig dazu, dass Suizidversuche als Ausdruck von Hilflosigkeit und Einsamkeit dienen.
Diese Handlungen sind in vielen Fällen nicht als Todes-wunsch zu verstehen, sondern als ein dramatischer Auf-schrei nach Beachtung, Verständnis und Unterstützung. Das Problem dabei ist, dass Angehörige und Helfer den Ernst dieser Botschaft manchmal nicht erkennen oder falsch interpretieren.
2.3 Impulsivität und Selbstschädigung