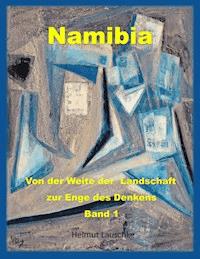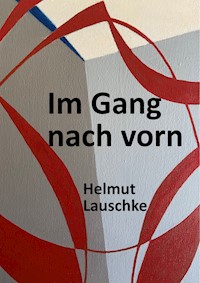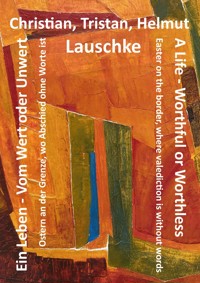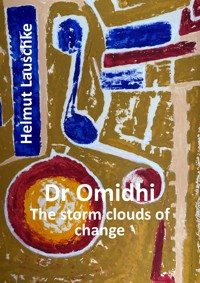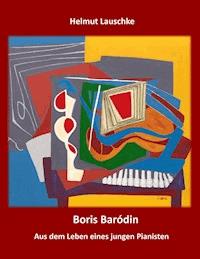
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Boris Baródin ging aus einer ungewöhnlichen Liebesbeziehung zwischen dem ersten russischen Stadtkommandanten von Bautzen, dem Generalmajor Ilja Igorowitsch Tschrerbilski, und Anna Friederike Dorfbrunner, der Tochter des einstigen Breslauer Superintendenten Eckhard Hieronymus Dorfbrunner hervor. Ilja, der fünf Sprachen sprach, sich in deren Literatur erstaunlich gut bewegte und ein großartiger Pianist war, erkannte früh die musikalische Begabung seines Sohnes und wurde sein erster Klavierlehrer. Boris hatte es schon in jungen Jahren zu großen pianistischen Erfolgen gebracht. Er spielte das zweite Brahms-Konzert in Warschau und dann in Moskau. Beide Aufführungen fanden hervorragende Kritiken. In Warschau lernte er Vera kennen. Sie verliebten sich und hatten eine Liebesnacht noch vor der Konzertaufführung mit der Warschauer Philharmonie unter ihrem Dirigenten Wiktor Kulczynski. Wiktor umarmte Boris, pries seinen Vortrag und sagte, dass er durch sein Spiel Brahms neu lieben gelernt hätte. Boris holte Vera nach Berlin, wobei Sergej Wladimir Woroschilow, der als junger Major den kleinen Boris wenige Tage nach seiner Geburt in den Armen gehalten hatte, nun als hoher General in Moskau die bürokratischen Hürden hinter dem eisernen Vorhang für Vera's Umsiedlung von Warschau nach Berlin beiseite geschoben, beziehungsweise entschärft und überwindbar gemacht hatte. Sie waren standesamtlich Mann und Frau, und Vera war im 6. Monat schwanger, als Boris mit 26 Jahren an den Folgen einer massiven Magenblutung verstarb, und die Wiederbelebungsmaßnahmen durch den Notarzt erfolglos waren. So blieb auch die von ihm begonnene "Russische Sonate", die seinem musikalischen Vater Ilja Igorowitsch gewidmet war, im letzten Satz vom Aufbau einer Fuge unvollendet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 865
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helmut Lauschke
Boris Baródin
Aus dem Leben eines jungen Pianisten
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Anmerkung
Musik, Begegnungen, Hilfe zur Befreiung
Anzeigenerstattung beim Drogendezernat im Polizeipräsidium
Der Flug nach Warschau
Über die Emotion der Schwermut in der Musik
Der Alptraum vom Konzert
Die Konzertprobe mit der Warschauer Philharmonie
Die Liebesnacht mit Vera
Der Konzertabend in Warschau
Der Weiterflug nach Moskau und die Begegnung mit dem Vater
Der Traum
Der Konzertabend in Moskau
Besuch im Heim für hirngeschädigte Kinder
Rückflug nach Berlin mit Zwischenstation Warschau
Die neuen Herausforderungen und der Tod des Ilja Igorowitsch Tscherebilski
Das Begräbnis des Ilja Igorowitsch Tscherebilski
Der Klavierabend mit den Schülern und die Anstrengungen, Vera nach Berlin zu holen
Der Beginn des „russischen” Sonate
Auf dem Weg zur jungen Familie
Die Kieler Musikwochen
Besuch bei seiner Mutter Anna Friederike Elbsteiner in Blankenese
Die letzten Tage und die unvollendete „russische” Sonate
Worte des Abschieds
Impressum neobooks
Anmerkung
Die Namen der Personen im Roman sind frei erfunden.
Musik, Begegnungen, Hilfe zur Befreiung
Boris Baródin saß am Flügel in der Knesebeckstraße 17 in Berlin-Charlottenburg. Es war ein regnerischer Herbstabend. Seit Wochen regnete es, und Boris hatte sich für sein nächstes Konzert vorzubereiten, dass er in Warschau und danach in Moskau zu geben hatte. Für die Vorbereitung blieben ihm noch knapp zwei Wochen. Er hatte sich bei seiner Asientournee eine Erkältung mit heftigen Hustenattacken zugezogen, die ihn hartnäckig in Mitleidenschaft nahmen. So saß er mit erhöhter Temperatur am Flügel und probte die schwierigen Passagen am B-Dur, dem zweiten Brahms-Konzert, Opus 83. Damit das Schwitzwasser nicht auf die Tasten tropfte, hatte er den roten Seidenschal, rot war seine Lieblingsfarbe, zusammengerollt über die Stirn gebunden und die Enden über dem Hinterkopf verknotet. Die Medikamente zur Fiebersenkung und Hustenbekämpfung, die ihm die Hausärztin, Dr. Gaby Hofgärtner, vor einer Woche verschrieben hatte, schienen trotz regelmäßiger Einnahme wenig zu helfen. Boris hatte deshalb um einen neuen Termin gebeten, den er aufgrund seiner beruflichen Besonderheit für den nächsten Tag, einem Freitag für elf Uhr bekam, bei dem er die Ärztin bitten wollte, ihn gründlich zu untersuchen, um etwas Ernsthaftes auszuschließen, was die Ursache sein könnte, da sich die Rekonvaleszenz über das normale Maß hinaus verzögerte. Denn eine Erkältung mit Husten war für ihn nicht ungewöhnlich, wenn er in den Monaten eines verspäteten Sommers oder früh einsetzenden Winters auf Konzertreisen war.
Boris saß am Flügel und probte an der Solo-Kadenz, als gegen acht das Telefon läutete. Es war seine Mutter, Anna Friederike Elbsteiner, die ihn aus Hamburg anrief, wo sie mit dem Kaufmann und Frühwitwer Gerald Elbsteiner in einem vornehmen Hause in Blankenese mit unverbautem Blick auf die Elbe wohnte. Sie hatte den fünf Jahre älteren Kaufmann vor vier Jahren auf einer zweiwöchigen Kreuzfahrt durchs Mittel- und Schwarze Meer kennengelernt und vor drei Jahren geheiratet. Gerald Elbsteiner hatte zwei Töchter aus erster Ehe, von denen Eleonore, die ältere, mit einem Amerikaner verheiratet in Houston und Alaine, die jüngere, unverheiratet mit einem Maler des gleichen Alters in Südfrankreich zusammenlebte. Die Mutter war, wie sie es immer war, um den Gesundheitszustand ihres Sohnes sehr besorgt. Der Kontakt zwischen Mutter und Sohn war von jeher eng. So gehörte der tägliche Anruf zur Routine, der von beiden Seiten erwünscht war, aber häufiger von der Mutter als vom Sohn ausging. Diesmal bestand die Mutter darauf, dass sich Boris von einem Spezialisten untersuchen lassen solle, weil der Husten, der härter war als sonst und das Telefonieren störend attackierte, länger anhielt als gewöhnlich, was für seine Konzerte äußerst lästig sei. „Deine häufigen Erkältungen mit dem Husten hast du von deinem Großvater geerbt.“ Das sagte Anna Friederike jedesmal zu ihrem Sohn, wenn er hustete, und verwies dabei auf die anfällige Lunge, wie sie es nannte, und auf ihren Vater, Eckhard Hieronymus Dorfbrunner, den Prediger von Breslau, der nach dem verlorenen Weltkrieg eine Stelle als Prediger nicht mehr fand und als Predigerersatz Lehrer für Deutsch, Geschichte und Geographie an der Ernst Thälmann-Grundschule in Bautzen war, um sich und die Familie am Leben zu halten. Manchmal sprach Anna Friederike Elbsteiner, geborene Dorfbrunner, von der Immunschwäche, die bei ihrem Vater von dem praktischen Arzt Dr. Bodenbach diagnostiziert und als Ursache für die erhöhte Anfälligkeit der Luftwege für Bakterien und Viren der verschiedensten Arten angesehen wurde.
Diese „Immunschwäche“ hatte sich bei Boris Baródin wegen der ständigen Erwähnung vonseiten der Mutter, selbst bei dem leisesten Husten, den er nicht unterdrücken konnte, wenn er mit ihr telefonierte, fest ins Hirn gesetzt. Sie hat sich wie eingemeißelt im Hirn festgesetzt, und bei jeder Erwähnung schüttete er im Stoß sein Adrenalin aus und bekam einen roten Kopf, für den er sich schämte, auch wenn es die Mutter am anderen Ende der Leitung in dem vornehmen Bürgerhaus in Blankenese mit dem ungetrübten Blick auf die Elbe weder sehen noch die Schärfe der vermehrten Schweißabsonderung riechen konnte.
Bei dem Telefonat teilte Boris der Mutter mit, dass er einen Brief von seinem Vater, Ilja Igorowitsch Tscherebilski, dem ehemaligen Bautzener Stadtkommandanten der Roten Armee, erhalten habe. Der Brief sei von der Krim abgeschickt worden, wo der Vater in einer Datscha für die hohen Offiziere einen mehrwöchigen Urlaub verbringe. Er schrieb, dass er geschieden sei und mit einer jüngeren Lettin, die er in Leningrad kennengelernt hatte, zusammenlebe. Seine Gesundheit sei nach dem tragischen Einmarsch der Warschauer-Pakt-Truppen in die Tschechoslowakei angeschlagen. Er leide unter Kopfschmerzen und einem hohen Blutdruck, habe sich vor zwei Monaten wegen eines blutenden Magengeschwürs einer Notoperation in Moskau unterziehen müssen. Vater Ilja Igorowitsch freue sich auf das Brahms’sche Klavierkonzert, dass sein Sohn mit der Moskauer Philharmonie spielen werde. Er selbst habe sich in seiner Jugend an diesem Konzert probiert, es aber seiner spielerischen Schwierigkeiten wegen wieder zur Seite gelegt. Anna Friederike sprach immer mit tiefer Empfindung von Ilja Igorowitsch und kam ins Schwärmen, wenn sie von seinen musikalischen Exkursionen auf dem Flügel in Bautzen erzählte. „Er ist ein gebildeter und hoch musikalischer Mensch“, pflegte sie zu sagen, wenn die Rede auf seinen Vater kam.
Boris hatte seine Zweifel, ob seine Mutter eine glückliche Ehe mit Gerald Elbsteiner führte. Sie erwähnte lediglich, dass er ein tüchtiger Geschäftsmann sei und vor einigen Wochen bei einer Auktion in Paris einen Seurat für 87000 DM ersteigert habe. Auch sei die Renovation des Hauses fast abgeschlossen, das diesmal einen hellbraunen Außenanstrich bekommen habe. Mehr ließ Anna Friederike über ihr Privatleben nicht verlauten. Boris hatte die Vermutung, dass Wesentliches nicht ausgesprochen wurde, was sich in ihr angesammelt hatte. Doch wollte er da nicht hinein fragen, um ihr nicht noch einen Schmerz zuzufügen. So ließ er es bei der Frage nach ihrer Gesundheit bewenden, wie er es bei den Telefonaten in den letzten Monaten schon tat. Auf diese Frage erklärte Anna Friederike auch diesmal, dass sie sich bis auf gelegentliche Schlafstörungen, die sie auf das feuchte Klima in der norddeutschen Bucht schob, gesund fühle. Nachdem Boris seiner Mutter versprach, einen Spezialisten wegen seiner anhaltenden Erkältung aufzusuchen, wurde das Gespräch beendet.
Er ging in die Küche, brühte chinesischen Kräutertee auf, gab eine Löffelspitze Ingwer in die gefüllte Tasse, kehrte zum Flügel zurück und setzte die Tasse auf den Tisch mit den Notenbergen, der in Reichweite links neben der Klavierbank stand. Die ersten Takte aus der Kadenz im ersten Satz waren gespielt, als es an der Tür läutete. Boris ließ es dreimal klingeln, weil er sich nicht in der Verfassung fühlte, irgendeinen Besuch zu empfangen. Der rote Schal war über der Stirn schweißdurchnässt, als er sich nach dem dritten Klingelzeichen erhob, noch einen Schluck Tee aus der Tasse nahm und zur Tür ging. Es war Claude, ein begabter Schüler, den er seit fünf Jahren unterrichtete. Claude stand aufgeregt vor der Tür. Boris führte ihn ins Musikzimmer, das sein Arbeitszimmer war. Sie setzten sich in die beiden schmalen Sessel in der kleinen Klubecke, die dem Flügel gegenüber neben dem hohen Fenster war. Boris bot ihm vom chinesischen Kräutertee an, den sich Claude, der blass im Gesicht war, wortlos einschenken ließ.
Olga, seine junge Freundin, eine russische Emigrantin aus Leningrad, die seit zweieinhalb Jahren ohne deutschen Pass in der Bundesrepublik lebt, sei von einem Dealer in einem dunklen Hausflur in Wedding zusammengeschlagen worden, weil sie ihm das Heroin, das sie von ihm vor einer Woche bezogen hatte, nicht zahlte, weil ihr das Geld fehlte. Sie liege mit einem geschwollenen Gesicht, Hämatomen über der Brust und Hautschürfungen an Hals und den Armen im Bett. „Sie soll Anzeige bei der Polizei erstatten und sich von einem Arzt behandeln lassen.“ Das war der Vorschlag von Boris, den er dem begabten Schüler mit allem Nachdruck gab. Claude schüttelte den Kopf: „Zur Polizei kann Olga ohne Pass oder Aufenthaltsgenehmigung nicht gehen. Da kommt sie als Emigrantin ohne Papiere gleich in die Zelle und auf die Liste der Illegalen, die nach Russland wieder abgeschoben werden.“ Boris wischte sich den Fieberschweiß von der Stirn: „Dann kann sie also gar nichts machen, sondern nur warten, dass sie wieder zusammengeschlagen wird.“ „So ist’s“, bemerkte Claude mit blassem Gesicht, in dem die Augenlider nervös zuckten.
Boris spürte, dass zwischen Claude und Olga eine Beziehung war, die schon enger war. Eine Gleichgültigkeit der illegalen, russischen Emigrantin Olga Zerkow gegenüber gab es nicht. Eine solche, in der bundesrepublikanischen Gesellschaft verbreitete Einstellung war hier nicht erwünscht und auch nicht zulässig. Dafür hatten beide, Lehrer und Schüler, Boris Baródin und Claude Zerbal noch den Anstand vor dem Menschen im Allgemeinen und das Mitgefühl zum Menschen, der in Not geraten war, im Besonderen, wenn auch bei Claude noch etwas anderes, etwas Persönliches dazukam. „Was können wir dann tun?“, fragte Boris und wischte sich den Schweiß von der Stirn. „Das weiß ich auch nicht“, erwiderte Claude mit dem nervösen Zucken über seinen Augen. Dann sagte er besorgt: „Der Kerl, der Türke, wird wiederkommen und das Geld eintreiben, und wenn es mit Prügel ist. Doch ich habe das Geld nicht, um es Olga zu geben, um sie freizukaufen.“ „Wieviel muss sie denn zahlen?“, fragte Boris, einen Schluck kalten, chinesischen Tee aus der Tasse trinkend. Dabei sah er in das ratlose Gesicht von Claude, der den Freikauf von Olga aus eigener Tasche nicht bewältigen konnte. „Die Summe ist auf etwa 900 DM angelaufen“, sagte Claude mit leiser, besorgter Stimme. „Das Geld kann ich dir geben, aber erst morgen, weil ich es von der Bank holen muss“, sagte Boris. „Seit wann nimmt Olga denn Drogen?“, fragte er. Sie beschafft das Heroin für einen Bekannten, der versprochen hat, ihr eine zurückdatierte Aufenthaltsgenehmigung zu beschaffen, damit sie damit einen deutschen Pass beantragen kann“, antwortete Claude. Boris machte ein ernstes Gesicht: „Dann hat sich Olga von diesem Typen abhängig gemacht. Die ganze Sache ist sehr dunkel und wird eines Tages entdeckt werden. Dann kommt eine harte Strafe auf beide zu und Olga wird, weil sie illegal in Berlin ist und mit dem Betrug eine zweite Straftat begangen hat, sofort und unwiderruflich in ihr Heimatland abgeschoben, wo sie das zweite Mal und wahrscheinlich noch härter bestraft wird.“ Die Hände von Claude zitterten. Sein Gesicht wurde aschfahl, als er mit leiser Stimme, wobei er sich in unregelmäßigen Abständen verschluckte, sagte, dass Olga eine Halbwaise sei. Ihr Vater war Soldat in der Roten Armee und kam bei einem Manöver ums Leben. Die Mutter habe eine Lungentuberkulose, die sich trotz Medikamente nicht bessert. Sie arbeite in einer Blumenbinderei und verkaufe zweimal in der Woche Blumen auf dem Markt, um sich mit dem kleinen Erlös am Leben zu halten, wobei das Geld zum Teil für die Medikamente draufgehe. Die Mutter habe Olga zur Emigration in die Bundesrepublik geraten, damit sie sich dort ein besseres Leben aufbauen könne. Die Worte der Mutter waren: „Hier haben wir keine Zukunft. Mich wird die Tuberkulose vertilgen, und du sitzt dann alleine da. Helfen wird dir hier keiner.“
Boris machte ein betroffenes Gesicht. Er wusste, dass viele Mädchen aus den Ländern des Ostblocks unter falschen Versprechungen in die Bundesrepublik geschleust und hier in die Prostitution getrieben werden. Der Traum vom besseren Leben wich schnell und unaufhaltsam der Erkenntnis eines Höllendaseins, wenn sie in totaler Abhängigkeit ohne oder mit gefälschten Papieren in erbärmlichen Unterkünften leben und machtlos den rücksichtslosen, oft brutalen Geschäften und Machenschaften ausgeliefert sind. Da müssen sie sich Prügel und Vergewaltigungen wehrlos gefallen lassen. Dagegen können sie nichts machen. Denn die Alternative ist das Abschieben durch die Behörde wegen des illegalen Aufenthalts. Und das fürchteten sie am meisten, in ihre Heimatländer abgeschoben zu werden. So nahmen sie das rechtlose, unmenschliche, ja Sklavenleben, als „heiße“ Ware im Dschungel des blühenden Sexgeschäfts verkauft zu werden, ohne ein Widerwort hin. Unter den miserabelsten Lebensbedingungen in der Bundesrepublik ließen sie sich im Wissen der totalen Abhängigkeit von den Bossen und Zuhältern deren willkürliche Misshandlungen gefallen.
In seiner Sprachlosigkeit ging Boris zum Flügel und spielte den zweiten Satz, das d-Moll >Allegro appassionato<. Er legte das Gefühl des Schmerzes auf die Tasten und drückte es „brahmsisch“ ein. Er schwitzte, und der Schweiß tropfte von der Stirn, weil er sich das Stirntuch nicht umgebunden hatte. Der Weltschmerz ertönte mit seinen weiten elegischen Bögen. Im Wechsel zwischen Dur [F; B] und Moll [d; g] war die Atmung der tönenden Welt zu spüren. „Großartig, wunderbar!“, murmelte Claude, der seinen jungen Lehrer ob seiner außergewöhnlichen Musikalität zutiefst verehrte. Rasch hatte die „Ton-Atmung“ den Raum gefüllt, und Boris atmete ihr mal erleichternd heiter, als riss die Wolkendecke auf, mal angestrengt und schwer zu, wenn sich neues und schweres in „violetten“ Tonfarben ankündigte und sich auf den weiten elegischen Bögen auslegte, auf diesen Bögen wie über eine Brücke von Pfeiler zu Pfeiler zog. Die Brücke, die gesucht und nötig ist, um von einer Seite auf die andere Seite zu kommen, wenn ein Tal, eine Schlucht, ein Abgrund zu überqueren ist. Das Gefühl bedarf der Brücke, um nicht haltlos abzustürzen, beziehungsweise sich himmelwärts in „Luft“ aufzulösen. Das Wort im Zuspruch, dem menschlichen, versucht auf die Brücke mit dem Überschreitbaren zu weisen, versucht zu sagen, dass noch nicht alles verloren ist, dass es noch Hoffnung und Liebe gibt. Stärker als das Wort, selbst das Wort der größten Zuneigung und des tiefsten Mitempfindens, weil viel ausgefüllter, harmonietragender, herznäher und gefühlvoller, sprechen die Töne durch vertikale Verknüpfung zu Sept-, Non- und anderen Akkorden sowie die horizontalen Reihungen bis zu den Ausladungen der elegischen Bögen vom tröstenden Dasein der Brücke. Dieses Brückendasein hatte wohl Boris im Sinn, als er im zweiten Teil des Satzes fester die Akkorde mit der linken Hand griff als im ersten Teil. Er träumte und schwitzte beim Spiel. Er verzog seine Lippen, hob und senkte den Kopf, aber drehte ihn nicht. „Da kommt die Hoffnung!“, sagte er, und seine Augen blitzten vor Erleichterung und Freude. „Da durchatmet Musik das Leben tief drinnen. Ist das nicht herrlich?! Das ist die beste Botschaft, die ich dir heute Abend mitgeben kann“, sagte er und wandte das Gesicht Claude in der Klubecke zu, der vom Spiel fasziniert und verzaubert war. Da war ihm selbst das Problem mit Olga, das doch ein Existenzproblem erster Güte war, aus dem Kopf entglitten. Auch seine Augen leuchteten, als hätte sich das Problem gelöst, hätte Olga eine ordnungsgemäße Aufenthaltsbescheinigung, bräuchte sie nicht mehr den teuren „Stoff“ für den Kerl beschaffen, der ihr so große Versprechungen bezüglich der Ausweispapiere gemacht hatte und weiter machte, wenn und solange er den „Stoff“ gratis bekam, hätte Olga diesen lästigen Kerl endlich vom Hals, würde ihre Schulden bei dem Türken bezahlen und hätte sich vor ihm und seiner Prügel nicht mehr zu fürchten.
Claude zeigte keine Zeichen des Gehens. Vielmehr saß er regungslos mit verklärtem Blick in der Klubecke und hörte sich noch den >Andante<-Satz an. Da ergriff ihn doch die Sensibilität und Feinheit der tonalen Versetzungen zwischen Dur und Moll mit ihren elegischen Ausziehungen. Er versuchte seine Atmung auf die musikalische mit ihrem Hinundherschwingen abzustimmen. Ein- und Ausatmen, mit jedem Atemzug das Bewusstsein zu halten und zu stärken, dass es die Brücke über die Schlucht gibt, an die man sich halten kann, die man betreten kann, wenn man von der einen Seite zur anderen, von der dunklen zur hellen, von der schwermütigen zur heiteren, zur frohen Seite will ohne den gefürchteten Absturz von Gefühl und Leben. Keiner hätte diese Atmung mit der Sensibilität für Frieden und Sanftheit oder so schwingungsvoll in der Bestimmtheit des Wollens, des Lebenwollens so voll und fein in den Raum gespielt wie er, dachte Claude im stummen und stillen Staunen. Boris spielte mit geschlossenen Augen. Das Notenbuch brauchte er nicht zum Lesen, die Blätter waren auch nicht umgeschlagen. Die Finger taten es besser als beim Lesen. So brachte das Spiel die große Botschaft vom Frieden in den Raum, von der Bedeutungsfülle der ruhigen und rhythmischen Atmung; es war die unglaubliche Offenbarung von der Einmaligkeit mit der weiten Öffnung des Genies.
„Claude, sei mir nicht böse, aber nun muss ich ins Bett; ich fühle mich nicht wohl“, sagte Boris mit verschwitzter Stirn und blickte dabei auf die ruhenden Tasten nach Beendigung des >Andante<-Satzes. „Entschuldige, dass ich nicht selber darauf gekommen bin“, erwiderte Claude, der sich aus dem Sessel erhoben hatte, „aber dein Spiel hat mich in eine Welt gehoben, in der ich gerne länger geblieben wäre. Sie war so groß wie die Weite der Frühlingswiese, über der das Blütenmeer in sanften Wellen wog und der frische Duft die Ankunft der neuen Hoffnung verhieß. Du hast die schöne Welt in den Raum gespielt, nach der ich mich sehne.“ „Diese Welt findest du auch in der Beethoven-Sonate, an der du arbeiten sollst. Tu es mit ganzer Hingabe, und die schöne Welt kommt auf dich zu, wird in dir lebendig“, sagte Boris mit einem sanften Lächeln. Darauf meinte Claude, dass es ihm gegenwärtig schwerfalle, sich auf das Klavierspiel zu konzentrieren, so lange das Problem mit Olga nicht gelöst sei. „Dabei werde ich dir helfen und tun, was in meinen Kräften steht“, versuchte Boris seinen Schüler zu beruhigen und ihn zur Arbeit an der Sonate zu ermutigen und zu stärken. Denn er war von der musikalischen und technischen Begabung von Claude überzeugt. „Geh ans Klavier und übe, damit aus dir ein guter Pianist wird, dessen Spiel die Menschen mit Freude und Begeisterung erfüllt. Doch ins Üben muss Stetigkeit kommen, dann kommt auch der Erfolg. Bedenke, dass die Welt der Musik nicht nur schöner ist, sie ist durch ihre Herznähe um ein Vielfaches größer als die äußere Welt, in der wir stehen.“ Bei dieser Anmerkung der prinzipiellen Art über die Bedeutung des stetigen Übens wischte sich Boris einige Male den Schweiß von der Stirn. Claude hatte ihn wohl verstanden und dankte dem Lehrer für seine Ermahnung, aber noch mehr für seine Hilfsbereitschaft in Sachen Geld, um Olgas Schulden zu bezahlen. Er verabschiedete sich und wünschte Boris eine gute Besserung. „Komm morgen Nachmittag gegen drei; dann habe ich auch das Geld.“ Mit diesem Schlusssatz brachte Boris seinen Schüler an die Tür und gab ihm zum Abschied die Hand. Sie fühlte sich heiß und feucht an. Die depressive Stimmung bei Claude entging ihm nicht. Er überging sie, indem er ihm einen freundschaftlichen Klaps auf die Schulter gab und ihn dabei anlächelte, um ihm die Zuversicht mit auf den Heimweg zu geben.
Die Bettlake war nass, als Boris nach einer schlaflosen und durchschwitzten Nacht die Quecksilbersäule im Fieberthermometer runterschlug und in die rechte Achsel schob. Es waren über 38 Grad Celsius, als er vor dem Versuch des Einschlafens, es war doch halb elf geworden, gemessen hatte. Er hatte noch einmal eine Tablette zur Fiebersenkung zerkaut und dann mit Mineralwasser runtergespült, weil er alles tun wollte, was ihm die Ärztin, Dr. Gaby Hofgärtner, verordnet hatte. Auch sehnte er sich nach einer ruhigen Nacht, denn seit drei Nächten hatte er nicht mehr richtig geschlafen. Und zum Fieber kamen die Fieberträume, in denen es nicht nur um technische Fehler beim Vortrag des Klavier-Konzertes ging, sondern ihm den Blackout mit dem Verlust der Erinnerung über eine ganze Passage der Kadenz des ersten Satzes ins fiebernde Bewusstsein suggerierte, was ihn stöhnen, dann aufschreien ließ, dass ihn Frau Müller, die freundliche Mieterin in der nächst höheren, der zweiten Etage, besorgt am Morgen, es war vor zwei Tagen, fragte, ob ihm etwas zugestoßen sei. Auch in dieser Nacht wurde er vom Blackout geplagt, diesmal im letzten Satz, dem >Allegretto grazioso<, dort, wo der Presto-Schlussteil einsetzt. Da klappte nichts: die Dezimen der linken Hand vergriff er ebenso wie die Oktavläufe und Oktavsprünge der rechten Hand. Diese Träume haben ihn doch stark mitgenommen. Sie haben ihn verunsichert, ja erschüttert. Am Morgen stand ihm der Angstschweiß im Gesicht. Er fühlte sich gedrückt und unfähig, das große Konzert vorzutragen. Dabei wusste er, dass Musiker unter diesen Alpträumen auch dann leiden, wenn sie kein Fieber haben und das, je näher der Konzerttermin rückt.
Das Quecksilber stieg an diesem Morgen wieder bis 38 Grad. Boris hängte sich den Bademantel um und legte ein Handtuch um den verschwitzten Hals. Er ging ins Bad und betrachtete das gerötete Gesicht im Spiegel. Bei dieser Betrachtung sah er, dass der Hals leicht angeschwollen war. Er fühlte ihn ab und spürte einen Druckschmerz unter dem Kieferwinkel. Beim Blick in den geöffneten Mund sah er, dass die Mandeln geschwollen und gerötet waren. Zudem waren auf ihnen einige bis stecknadelkopfgroße, grauweiße Eiterpunkte zu sehen. Da es nicht das erste Mal war, dass die Mandeln entzündet waren, stellte er vor dem Spiegel ‚ad hoc‘ die Diagnose: eitrige Tonsillitis. „Warum hat nicht schon Mutter die Mandeln rausnehmen lassen? Nun machen sie Probleme, wenn ich sie wirklich nicht gebrauchen kann“, dachte er mit leichter Verärgerung. Er ging in die Küche, rührte zwei Löffel Kochsalz in ein Glas mit aufgekochtem Wasser, ging ins Bad zurück und gurgelte mehrmals das Salzwasser mit hochgestrecktem Kopf im Rachen, sah im Spiegel, dass sich an den Mandeln nichts verändert hat, putzte die Zähne, wusch das Gesicht, ging wieder in die Küche und machte sich einen Kamillentee. Während das Wasser zum Kochen gebracht wurde, setzte er sich an den Flügel und spielte die Passagen aus dem Brahms-Konzert, die ihm im Fiebertraum aus den Fingern wie aus der Erinnerung genommen waren. Es klappte, wenn auch nicht zur vollen Zufriedenheit, denn der Tonfluss, das „Asyndeton“, war nicht so, wie es sein sollte und auch schon war. Dennoch, Boris fand das Selbstvertrauen zurück, strafte den Alptraum Lügen und nahm sich ernsthaft vor, die Ärztin gegen elf aufzusuchen, sich gründlich untersuchen zu lassen, das Antibiotikum gegen die Tonsillitis verschrieben zu bekommen, um vom Fieber und den nächtlichen Alpträumen befreit zu werden. Mit diesen Träumen wollte er sich nicht länger herumquälen, die ihm die Unfähigkeit des Klavierspielens mit dem Blackout suggerierten. So musste er etwas Wirksames zur Stärkung seiner Kräfte unternehmen, um seine Übungen erfolgreich fortzusetzen. Das Konzert musste inwendig wie auswendig sitzen; es musste musikalisch wie technisch beherrscht werden. Die Partitur musste bis zur letzten Note und dem letzten Detail im Gedächtnis und die technische Problemstellung in den Fingern gelöst sein. Letzteres musste das Ohr und Gemüt des Zuhörers durch die Selbstverständlichkeit der spielerischen Leichtigkeit, als hätte es nie ein Problem gegeben, treffen, überzeugen, mitreißen, einnehmen und „sprachlos“ machen, damit er den Pianisten „im“ Werk als „Held des Werkes“ bewundern und feiern kann. Denn ob Brahms oder Beethoven, beide treten nicht mehr auf das Podium. Würden sie es tun, man würde großartige Pianisten erleben, die ihre großartigen Tonschöpfungen selbst im Solopart vortrügen. [Der junge Beethoven bezauberte in Wien die Zuhörer durch sein Klavierspiel. Er spielte sich die künstlerischen Beinamen: „der Teufelspianist“ oder, „der Paganini des Klaviers“ ein.] Das wusste Boris sehr wohl. So durfte auch bei seinem Vortrag nicht erst gesucht oder nachgedacht werden. Der vortragende Pianist ist der Mittelpunkt, auf den alles zugeschrieben ist, auf den alle hören und schauen, wie er’s macht; er ist der Kronzeuge und Beherrscher des gigantischen Tonwerks, der sich vom Orchester tragen und begleiten lässt. Beim Spiel der Finger mit den Tasten ist der Pianist die „Verkörperung“ des Tonwerks. In diesem Gebäude gibt er den Ton an. Der Dirigent verfolgt sein Spiel mit „gespitzten Ohren“ und führt den großen, im Halbrund ums Klavier sitzenden Klangkörper ihm mit sensibler Aufmerksamkeit zu und dann wieder weg, wenn das Klavier mehr zu sagen hat oder es allein sagen soll, wie beim Vortrag der Kadenz. Darum war es dringend erforderlich, dass Boris wieder zu Kräften kam, und das in allen Bereichen seiner künstlerisch empfindsamen Individualität, denn die Zeit bis zur Aufführung in Warschau drängte.
Es war Freitag. Boris saß zehn vor elf im Wartezimmer der Ärztin Dr. Gaby Hofgärtner. Die Arzthelferin Margit Hoffmann begrüßte ihn freundlich mit den Worten: „Guten Tag, Herr Baródin. Nehmen Sie bitte einen Moment Platz. Es wird nicht lange dauern. Frau Doktor Hofgärtner weiß, dass Sie für elf Uhr bestellt sind.“ Boris nahm Platz und behielt sein Augenmerk auf der Arzthelferin, sowohl beim Telefonieren und Festmachen von Terminen als auch beim Herausziehen der Karteikarten aus dem Karteischrank. Sie gab eine gute Figur ab, wenn sie schrieb oder irgendwelche Eintragungen machte. Die Arzthelferin war eine hübsche junge Frau, die Boris auf etwa zwei- bis fünfundzwanzig schätzte. Sie hatte ein schönes, ovales Gesicht mit dunklen Augen und dunklem Haar. Auch hatte sie schön geformte, lange Finger an weichen, schmalen Händen. Als Pianist bestätigte er ihr, ohne es ihr zu sagen, die richtigen Hände fürs Klavier.
Nach etwa zehn Minuten verließ eine Patientin, die schon die Mitte ihres Lebens erreicht haben musste, das Sprechzimmer. Sie schaute Boris ins Gesicht und grüßte ihn mit Namen. Er grüßte zurück, ohne jedoch ihren Namen nennen zu können. Da ihm das fast täglich geschah, hatte er sich daran gewöhnt. Er wünschte dieser Patientin gute Genesung und einen guten Tag, als ihn die Arzthelferin mit den Worten: „Herr Baródin bitte!“ zum Eintreten ins Sprechzimmer aufforderte. Dr. Gaby Hofgärtner, eine sympathische Erscheinung der Anfangvierziger, saß hinter ihrem Schreibtisch und machte einige Notizen auf der Karteikarte der Patientin, die, das hörte Boris wohl, die Tür zum Betreten wie Verlassen der Praxis leise, wahrscheinlich gedankenvoll schloss. „Nehmen Sie doch Platz, Herr Baródin“, sagte Dr. Hofgärtner, während sie ihre Eintragungen machte. Boris setzte sich auf den Patientenstuhl links neben dem Schreibtisch, als die Ärztin sich aus ihrem Stuhl erhob, zum Waschbecken ging und sich die Hände wusch. Sie war eine hochgewachsene Frau mit aufmerksamem Gesicht, in dem Züge einer Nervosität nicht zu verkennen waren. Von fraulich hervortretenden Brüsten konnte man bei ihr nicht sprechen. Überhaupt fanden sich an ihr maskuline Züge. Bei genauer Betrachtung hatte sie ein eher scharf geschnittenes Gesicht mit einer relativ langen Nase und scharf gezogene Lippen, die dünner ausgefallen waren, als sie sonst Frauen trugen. Im stramm zurückgekämmten Haar waren erste dünne Grausträhnen, und auf dem leicht vortretenden Kinn war ein feiner Bartflaum. Dr. Hofgärtner hatte ein blendend weißes Gebiss, was sie zur Schau brachte, wenn sie lachte, was sie gerne tat. Für einen Spaß oder eine ironische Bemerkung war sie jedesmal zu haben. „Lachen ist Medizin. Wer lacht, der lebt gesünder.“ Das war ein Satz, den diese Ärztin häufig ihren Patienten gab, wenn sie den Eindruck einer beginnenden Depression bekam. Dann fragte sie: „Haben Sie heute schon gelacht?“ Wenn der Patient oder die Patientin dies verneinte, dann sagte sie: „dann haben Sie etwas Wichtiges versäumt.“ Stellte die Ärztin ein erhebliches Lachdefizit fest, dann machte sie zweierlei: erstens den Eintrag in die Karteikarte: ernst, neigt zur Depression; und zweitens: „ich erzähle Ihnen etwas Lustiges, damit wir darüber lachen können.“ An lustigen Geschichten besaß Dr. Hofgärtner ein großes Repertoire. Das Geschichtenerzählen war Teil ihrer Therapie, soweit es die seelische Verfassung des Patienten betraf. Diese Verfassung spielte ihrer Meinung nach eine große Rolle sowohl beim Krankwerden, während der Krankheit, als auch in der Bemühung, wieder gesund zu werden. Dabei sollte der Patient ärztlicherseits unterstützt werden.
Dr. Hofgärtner schaute Boris ins fiebernde Gesicht. „Na, Sie hat es ja ordentlich erwischt, das sehe ich ihrem Gesicht an“, sagte sie mit markanter Stimme, die von der Stimmlage her durchaus von einem Mann hätte kommen können. Boris fand diese Bemerkung banal und flach. Er war nicht ganz ihrer Meinung und sagte: „Auch wenn es mich stark erwischt hat, um bei diesem Wort zu bleiben, ordentlich finde ich das weniger als im höchsten Grade störend für meine Konzertvorbereitung. Mir bleiben nur noch knapp zwei Wochen zum Üben, dann muss der Brahms vom Flügel perlen. Doch das sehen Sie mir an, dass ich in meiner gegenwärtigen Verfassung ein Werk wie das Brahms-Konzert nicht vom Flügel perlen kann. So sitze ich tief in der Klemme.“ „Das verstehe ich voll und ganz“, erwiderte die Ärztin, „da muss noch ein bakterieller Infekt sein, der sich auf den grippalen Infekt draufgesetzt hat.“ Boris: „So ist es, und mich wundert, dass Sie es dem geschwollenen Hals nicht gleich angesehen haben.“ Darauf sagte Dr. Hofgärtner, dass ihr der geschwollene Hals durchaus aufgefallen war: „Ich wäre auf den Hals noch zu sprechen gekommen. Doch zunächst hat der Patient das Wort.“ Boris zweifelte an dieser Aussage. Er lenkte ein, um schneller zur zweiten Stufe, der Untersuchung zu kommen. Er sagte: „Heute morgen habe ich vor dem Spiegel die Diagnose der Tonsillitis gestellt. Ich darf Sie heute bitten, mich noch einmal zu untersuchen, das Wort „gründlich“ ließ er weg, und mir das richtige Antibiotikum zu verschreiben.“ Auch erwähnte er kein Wort von seinen nächtlichen Träumen mit dem Blackout, die ihn so stark mitgenommen hatten. Da hielt er sich zurück, denn ein Missverständnis wollte er aus beruflichen Gründen nicht erst aufkommen lassen. „Wer versteht schon die Ängste und Sorgen eines Pianisten vor einem Konzert“, dachte er und verstummte. Dr. Gaby Hofgärtner sah ihn schweigend an. Offensichtlich erwartete sie weitere Bemerkungen, die Boris machen würde in Hinsicht auf die Vorbereitungen auf das Konzert. Sie wusste, Boris hatte es ihr bereits gesagt, dass er in Kürze das zweite Klavierkonzert von Brahms in Warschau und danach in Moskau spielen werde.
Sie sah ihn an und wartete noch eine kurze Zeit. Doch Boris schwieg und sah in seinen Gedanken verloren auf das Schlauchstethoskop auf ihrem Schreibtisch. „Da wollen wir mal schaun“, sagte sie, stand auf, holte das Laryngoskop aus der oberen Schublade des Schreibtisches, klappte den Mundspatel auf, prüfte das Licht im Birnchen und stellte sich vor den sitzenden Patienten. „Machen Sie den Mund weit auf“, sagte sie und drückte mit dem Metallspatel die Zunge nach unten. „Sie haben die richtige Diagnose gestellt“, sagte sie und zog den Spatel aus dem Mund des Patienten. „Nun möchte ich nochmal die Lungen abhören.“ Boris stand auf, zog Jacke und Hemd aus und stellte sich vor die Ärztin, die ebenso groß wie er, nämlich einmeterachtzig war. „Bitte durch offenen Mund tief ein- und ausatmen.“ Boris tat wie aufgefordert. „Der Lungenbefund hat sich nicht verschlechtert. Ich höre zwar noch ein Giemen und Pfeifen, vor allem in den unteren Abschnitten der Lungen. Aber eine Lungenentzündung kann ich nicht feststellen. Legen Sie sich nun auf die Liege, dass ich den Blutdruck messen, das Herz abhören und den Bauch abtasten kann.“ Boris legte sich auf die Untersuchungsliege und hielt den linken Arm gestreckt nach oben, um den Dr. Hofgärtner die Manschette des Blutdruckapparates wickelte. „Der Blutdruck ist mit 135 über 90 im Bereich der Norm.“ Dann hielt sie den rechten Zeige- und Mittelfinger auf die Speichenarterie von Boris unmittelbar oberhalb vom Handgelenk, schaute auf ihre Armbanduhr und zählte die Pulsschläge pro Minute, wofür sie fast fünf Minuten brauchte. „Der Puls ist mit 96 Schlägen pro Minute beschleunigt. Das steht Ihnen in Anbetracht des fieberhaften Infektes zu.“ Sie hörte das Herz ab, an dem keine krankhaften Geräusche über den Herzklappen waren, und tastete schließlich den Bauch ab, wobei sie sagte, dass die Leber leicht vergrößert sei. „Doch die Leber tut mir nicht weh“, erwiderte Boris auf ihre tastdiagnostische Feststellung. „Das mag sein“, sagte Dr. Hofgärtner, „die Leber ist bei entzündlichen Erkrankungen jeglicher Art oft vergrößert. Die Schwellung, die nicht schmerzhaft sein muss, geht wieder zurück, wenn der Körper von der Entzündung kuriert ist.“ Boris hörte sich den diagnostischen und prognostischen Kommentar an, ohne ein Wort zu sagen. Denn eine diagnostische Bemerkung von seiner Seite wäre hier sicherlich fehl am Platze gewesen. „Sie können sich wieder anziehen.“ Boris erhob sich von der Liege und zog Hemd und Jacke wieder an. Da er kein Schlipsverehrer war, hatte er auch keinen Schlips bei sich. Dr. Hofgärtner saß am Schreibtisch und notierte die Befunde auf der Karteikarte. Boris setzte sich auf den Patientenstuhl links neben dem Schreibtisch. „Die Diagnosen lauten“, fasste die Ärztin die Untersuchung zusammen und schaute dem Patienten mit Bestimmtheit ins Gesicht, „1. Eitrige Tonsillitis; 2. Bronchitis rechts wie links, stärker in den unteren als in den oberen Lungenabschnitten. Ich verschreibe Ihnen ein wirksames Penicillinpräparat, das Sie rasch von beidem kurieren wird“, fasste sie ihre therapeutische Maßnahme zusammen. Sie ergänzte den Therapieplan mit dem Hinweis, das Rauchen einzustellen, dem Boris als Nichtraucher mit Leichtigkeit zustimmte. Ein neuer Termin wurde für den folgenden Dienstag vereinbart. Die Arzthelferin Margit Hoffmann machte die entsprechende Eintragung in die Einbestellungskladde, deren Deckel mit braunem Kunstleder überzogen waren. Im Frontdeckel war die Jahreszahl „1973“ eingepresst. Beim Verlassen der Praxis wünschte die Arzthelferin mit einem charmanten Lächeln dem ihr offensichtlich sympathischen Patienten eine gute Besserung.
Boris ging in die nächste Apotheke, die Langerhans-Apotheke [nach dem Entdecker der endokrinen Inseln in der Bauchspeicheldrüse benannt, deren Zellen das Insulin und Glukagon produzieren], die nur ein paar Häuser weiter von der Praxis von Dr. Gaby Hofgärtner gelegen war. Er trat ein und atmete den Apothekengeruch mit dem undefinierbaren Gemisch aus Kräutern, ätherischen Ölen, dem Baldrian (Radix valerianae), Penicillin und anderem tief ein, das ihm zusagte, ihn neugierig machte und seine Lebensgeister schlagartig weckte. Den Atemzügen beim Eintreten gab er die volle Aufmerksamkeit, weil ihm bei dem „blumigen“ Geruchskorb in den Sinn kam, dass so das Gesundwerden riecht. Da berührten die Heilgeister bereits die Riechknospen in der Nasenschleimhaut. Manchmal glaubte Boris, wenn er in der Apotheke etwas zu besorgen hatte, diese Heilgeister auf der Zunge zu schmecken. Hinter dem Tresen stand Herr Brockmann, der untersetzte und beleibte Apotheker, ein stiller, freundlicher Mann der Mittfünfziger, der sich die Brille in auffallend kurzen Abständen auf dem schmalen Rücken seiner leicht nach links verbogenen Nase zurecht, beziehungsweise nach oben schob, als er einer älteren, schon etwas tütteligen Kundin, die offenbar auch schwerhörig war, die auf dem Rezept verschriebenen Medikamente nebeneinander auf den Tresen stellte und ihr die Häufigkeit der Tabletten- und Tropfeneinnahme pro Tag sorgfältig und lauter als normal mit hochgezogener Stirn erklärte. Dabei traten seine buschigen, dunklen Augenbrauen hervor, die im Grau das Überschrittenhaben der Lebensmitte beiläufig signalisierten. Vielleicht hatte er, wenn die Stirn hochgezogen war, die Nebenwirkungen eines jeden Medikamentes im Sinn, dachte Boris, der das Nebeneinanderstellen der Heil-, Schmerz- und Aufbaumittel, wie sie bei der Behandlung älterer und alter Menschen, also in der Geriatrie, üblich sind, mit Geduld und Interesse verfolgte. Auch hob er die Brille der Kundin vom Boden auf, die ihr beim Anblick auf die stattliche Zahl der verschiedenen Medikamente und beim Zuhören auf die erklärenden Erläuterungen des Apothekers, der doch auch Probleme mit seiner ständig runterrutschenden Brille hatte, runtergefallen war.
Nachdem die Kundin bezahlt, sie das gewechselte Geld, das ihr Herr Brockmann an der Kasse zurückgab, gezählt, das braune Lederportemonnaie in die braune Lederhandtasche gesteckt, die Handtasche sorgfältig und nachprüfend geschlossen hatte und schließlich die Apotheke mit der Apotheken-Plastiktüte und den Medikamenten verließ, sie stand noch im Eingang und drehte sich der Apotheke zu, um die Tür umständlich zu schließen, während der Apotheker die Brille auf seiner etwas schiefen Nase nach oben schob und sich dem nächsten Kunden zuwandte. „Was kann ich für Sie tun?“, war seine sicherlich in die Stereotypie abgerutschte Routinefrage. Er nannte den Kunden nicht beim Namen, obwohl er die ältere, vertüttelte Kundin mit Namen verabschiedete, als er ihr das Geld gewechselt und die Medikamente im hellbraunen Plastikbeutel verstaut hatte, und Boris nicht das erste Mal in dieser Apotheke war. Boris legte das Rezept seiner Ärztin auf den Tresen, das der Apotheker mit wichtiger Miene und hochgezogener Stirn begutachtete und seine Brille auf der Nase mit dem leichten Linksschlag nach oben schob, als er das Rezept nach seiner Begutachtung in der rechten Hand hielt. „Sie sind nicht der erste“, sagte er zu Boris, während er auf die Tür und den nächsten, eintretenden Kunden, eine Frau mit zwei kleinen Kindern, schaute, „bei vielen war die Grippe nicht kuriert; da hat sich dann in opportunistischer Weise eine bakterielle Infektion draufgesetzt. Etliche Kunden klagen nun über eine Pharyngitis oder Bronchitis mit Schluckbeschwerden oder Hustenanfällen. Bei den Kindern ist die Tonsillitis weit verbreitet. Da haben die Hals-Nasen-Ohrenärzte Hochkonjunktur, die vereiterten Rachenmandeln zu entfernen.“ Boris hörte sich den Kommentar an, ohne darauf einzugehen, worauf der Apotheker mit hochgezogener Stirn vom Tresen weg zu den Regalen ging und nach den verschriebenen Medikamenten griff. Mit runtergerutschter Brille kam er zum Tresen zurück, stellte die Sachen nebeneinander und meinte, wobei er sich die Brille nach oben schob, falls das Penicillin aufgrund von Resistenzerscheinungen nicht anspricht, dann solle sich der Kunde ein synthetisches Penicillin der neueren Generation verschreiben lassen. Boris spürte, dass er nun etwas sagen sollte. „Ich werde es erstmal mit dem einfachen Penicillin versuchen“, sagte er mit ruhiger und fester Stimme, um weiteren Diskussionen aus dem Wege zu gehen. Darauf meinte der Apotheker Brockmann mit einem Seitenblick auf den nächsten Kunden, die Mutter mit den zwei kleinen Kindern, dass er damit durchaus einverstanden sei. Als er die Preise an der Kasse eindrückte, sagte er mit diplomatischer Zunge, offensichtlich im Bestreben, den Kunden nicht nur nicht zu verlieren, sondern ihn zu seinem Stammkunden zu machen, dass es durchaus vernünftig sei, erst mit dem Penicillin der alten Generation zu beginnen und nur dann zu wechseln, wenn sich keine Besserung einstellt. „Das macht einhundertzwölf DM und achtundfünfzig Pfennig.“ Den Kostensatz schloss der Apotheker nahtlos an seine Bemerkung über den sinnvollen Gebrauch der Antibiotika an. Boris konnte da weder einen Punkt noch ein Komma am Übergang vom Anwendungssatz zum Kostensatz bemerken. Er zahlte den Betrag, bekam die Quittung, nahm den hellbraunen Plastikbeutel mit den bezahlten Medikamenten und verließ die Langerhans-Apotheke in der Potsdamer Straße. Dabei entging ihm nicht, dass Apotheker Brockmann ihn beim Weggehen mit dem Namen verabschiedete und ihm eine gute Besserung und „bis zum nächsten Mal!“ wünschte.
Boris machte noch eine Runde zur nächsten Konditorei. Er hatte nicht gefrühstückt und freute sich auf ein Stück Apfelkuchen mit Sahne und eine Tasse guten Kaffee. An der zweiten Kreuzung bog er von der Potsdamer Straße links ab und betrat nach weiteren hundertfünfzig Metern die Bäckerei und Konditorei Pollack. Schon beim Öffnen der Tür kam ihm der köstliche Geruch frisch gebackener Brötchen entgegen. Er ging an die Theke, sah sich die Auslagen an und bestellte sich ein Stück Apfelkuchen mit Sahne und ein Stück Käsekuchen, dazu eine Tasse Kaffee. Die junge Angestellte mit blütenweißer Schürze servierte ihm die Bestellung höflich und geschickt auf den zweiten der drei kleinen Tische mit den kleinen quadratischen Tischplatten, die Platz für jeweils zwei Kuchenteller und zwei Tassen, also für jeweils zwei Kunden gaben. Boris nippte an der Tasse mit dem heißen Kaffee, der ein starkes, würziges Aroma entströmte und begann mit dem Stück Apfelkuchen, das er dick mit Sahne bestrich. Der Fensterplatz gewährte ihm einen ungestörten Straßenblick, mit dem er die meist hektisch ablaufende Szene der Großstadt kurz nach zwölf verfolgte. Die Fußgänger waren in Eile, entweder nach Hause zu kommen und das Mittagessen herzurichten oder andere Besorgungen zu machen. Kinder kamen von der Schule, Mütter holten ihre Kleinen vom Kindergarten, der Eismann schob das Dreirad mit dem weißen Kühlkasten langsam auf dem Bürgersteig entlang und schaute nach Käufern, die meist Jugendliche oder eben jene Mütter waren, die ihre Kleinen an der Hand führten, entweder beim Gang vom Kindergarten oder mit vollen Plastiktüten vom Einkaufen kamen. Es gab auch magere und heruntergekommene Menschen, meist Männer, die ganz offensichtlich ohne Arbeit waren und vielleicht auch keine Arbeit suchten, die auf der Straße zu leben schienen und sich vom Betteln ernährten. Sie waren schäbig gekleidet, ihre Gesichter waren unrasiert und ihre Haare lagen wirr und versträhnt. Oft waren ihre Schuhe abgelaufen. Manche hoben Zigarettenstummel auf und steckten sie in die Jackentasche. Andere holten etwas aus den Taschen raus, ob ein Stück Brot, das sie in den Mund steckten, oder einen Flachmann, den sie nach Losdrehen des Schraubdeckels an den Mund führten. Diese obdachlosen Kreaturen, die das gnadenlose Schicksal mitschleppten, waren die einzigen Langsamgänger, wenn von den Liebespaaren und ihren Verfolgern abgesehen wurde, mit denen um diese Zeit, wenn die Sonne statt des Mondes über der Stadt stand, kaum zu rechnen war. Diese Langsamgänger waren Augenmenschen, die die Straßenszene aus dem ‘ff ’ kannten und jeden Tag neu und professionell analysierten, wen der Passanten sie ansprechen und um eine milde Gabe bitten sollten. Es muss Alkoholisches in den Flachmännern sein, denn ein stark Heruntergekommener in verwahrloster Kleidung mit versträhntem braungrauen Vollbart, der gerade einen Schluck genommen hatte und den Verschluss auf die Flasche aufschraubte, schaute noch mit der Flasche in der rechten Hand durchs Fenster, hinter dem Boris nun sein Stück Käsekuchen verzehrte, und streckte ihm seine belegte Zunge raus. Boris nahm es zur Kenntnis und dabei einen Einblick in einen Außenseitermund mit einem „asozialen“ Gebiss, das nur noch wenige Zähne hatte, die eine Zahnbürste nicht sahen und als alte, skurrile, braun verschmierte Ruinenreste übrig geblieben waren. Mit dem ihm vergönnten Einblick in die Höhle der Verwahrlosung machte sich Boris sogleich seine Gedanken über Ursache und Konsequenzen eines Lebens, in dem die Regeln und Sitten einer scheinbar geordneten bürgerlichen Gesellschaft entgleist, ohne Boden und ohne Dach und für das Dasein bedeutungslos waren, in dem die Straße das einzige und letzte „Zuhause“ mit dem letzten Halt zum Aufenthalt war. Nur so konnte Boris die Sprache der rausgestreckten Zunge aus dem verwahrlosten Mund verstehen, indem er dem Rausstrecken die Respektverweigerung, Ablehnung und Verachtung einer Gesellschaft zuordnete, die sich bei der politischen Spiegelbetrachtung marktschreierisch, Säle füllend, dass die Wände wackeln und die Fenster zum Luftholen geöffnet werden müssen, oder „gut erzogen“ und moderat als gerecht, sozial und human bezeichnet, was sie laut dieser stummen Zeichensprache mit der rausgestreckten und belegten Zunge von draußen, der Straße her gesehen durch das sauber geputzte Fenster zum kleinen Verzehrtisch mit der quadratischen Platte in der Bäckerei und Konditorei Pollack eben nicht war. Nach dem Höhlenblick in den ruinierten Mund schaute Boris diesem „Straßenwesen“, dem es vielleicht einmal besser ging, ins Gesicht mit den rissig-trockenen Lippen zwischen dem versträhnten, braungrauen Bart und den dunklen Augen mit dem trüben Blick unter der zerfurchten Stirn mit der wetterfesten Haut und dem wirren Kopfhaar. Das war ihm klar, dass der Flachmann eine Folge des permanenten Straßendaseins war, denn der Mann schwankte in keiner Weise, war also nicht betrunken. Der Inhalt des Flachmanns, der billige Schnaps, war ihm Medizin, dieses Dasein von Tag zu Tag neu durchzustehen. Dieser Inhalt schluckweise genommen gab ihm den Mut, die Zeichensprache mit der Zunge zu wagen und mit zunehmender Übung die Skrupel zu überwinden, diese Sprache der „besseren“ Gesellschaft gegenüber zu gebrauchen. Daran zweifelte Boris nicht, dass diese Sprache echt und eindeutig genug war, um verstanden zu werden. Denn diese Sprache konnte selbst ein Tauber verstehen; und wie oft stellt sich die Gesellschaft gegenüber den Nöten der Armen und Verelendeten taub! Boris gab diesem Mann ein Zeichen, holte eine zwanziger Note vom Wechselgeld der Apotheke aus der Jackentasche und zeigt sie ihm. Darauf ging der Mann vor die Tür der Pollackschen Bäckerei und Konditorei, während er selbst den Rest Käsekuchen auf dem Teller liegen ließ, vom Tisch zur Tür ging, sie öffnete und den Geldschein dem Mann gab. Der bedankte sich mit einem Diener und entschuldigte sich für die rausgestreckte Zunge. Er sagte: „Das kommt nicht alle Tage vor, dass es Menschen gibt, die durch die Tat helfen. So wolle der Herr bitte verstehen, dass die Zungensprache für mich eine Art Notwehr zur Rettung des letzten Restes Selbstachtung ist. Denn die Gesellschaft hat für unser Dasein und unsere Probleme weder ein Ohr noch ein Verständnis noch einen Platz. Wir haben die Achtung und Beachtung durch die Straße verloren. Ich war ein gelernter Bauingenieur. Die Firma ging Pleite, meine Frau trennte sich von mir, weil sie aus gutem Hause kommend ohne genügend Geld nicht leben wollte. Sie schmiss sich einem anderen Mann an den Hals, einem Pharma-Vertreter, der das genügende Geld brachte. Er heiratete sie, beziehungsweise sie heiratete ihn. Sie leben in Hamburg. Seitdem bin ich für diese Frau gestorben. Von meinem kleinen Besitz ist mir nichts geblieben. Den hat sie mir ganz geradeaus weggepfändet. Nun führe ich ein Leben, das kein Leben mehr ist. Meine Eltern drehen sich im Grabe rum. Noch einmal Entschuldigung und vielen Dank.“ Boris nickte, womit er sein Verständnis signalisierte. Der Mann ging fort. Boris ging zum Tisch zurück, um den Käsekuchen fertig zu essen. Er bestellte sich noch eine Tasse Kaffee und sah dem Mann in seiner schäbigen Kleidung gedankenvoll nach, wie er schließlich in der Menge der Passanten verschwand.
Für Boris war es ein Erlebnis, das ihn ergriffen hat. Auch er setzte an der Gesellschaft aus, dass sie ungerecht, geistlos und materialistisch sei. Einkommen und Besitz entschieden über die Achtung und den Stand in der Gesellschaft. Während er bei der zweiten Tasse Kaffee die Verfolgung der Straßenszene wieder aufnahm, traf ihn die zweite Überraschung. Es waren Claude und Olga, die die Straße überquerten und auf die Bäckerei und Konditorei Pollack zugingen. Ob sie ihn am Tisch sitzen sahen, wie er durchs Fenster auf die Straße sah, konnte Boris mit Sicherheit nicht ausmachen. Sie traten ins Geschäft, gingen auf die Theke zu, als wollten sie was kaufen, drehten die Köpfe auch in Richtung Speiseraum und kamen an den Tisch. „Na, das ist ja eine Überraschung“, sagten beide wie aus einem Mund, „dass wir uns hier treffen“, setzte Claude den Satz fort. „Setzt euch!“, und die junge Angestellte mit der blütenweißen Schürze stellte den dritten Stuhl, den sie vom unbesetzten Nebentisch nahm, hinzu.
„Was treibt euch denn her?“, fragte Boris mit einem Quantum Neugier, wie es mit Olga weitergegangen war, wie es um sie steht. „Hunger ist’s, der uns hierher trieb“, antwortete Claude, ohne groß nachzudenken. „Für eine warme Mahlzeit im Restaurant reicht das Geld nicht“, erklärte er schlicht und einfach. Es war eine plausible Erklärung, die keine weiteren Erläuterungen brauchte. „Dann bestellt euch einen Apfelkuchen mit Sahne und einen Käsekuchen. Die kann ich euch empfehlen. Ich lade euch zum Kuchenessen ein“, sagte Boris. Dabei blickte er in das melancholische Gesicht von Olga mit den slawischen Merkmalen der vortretenden Jochbögen im fast quadratischen Gesichtsmuster mit den dunkelbraunen Augen, den leicht abstehenden Ohren und dem flachen Hinterkopf. Er gab die Bestellung für die beiden auf. Dazu bestellte er für jeden eine Tasse Kaffee, für sich also die dritte Tasse. Claude bemerkte die besondere Aufmerksamkeit, die Boris seiner Freundin gab. Da wollte er vermitteln. „Es hat sich seit gestern nichts Neues ereignet, was zu berichten wäre“, sagte er mit ruhigem Ton. Doch entging Boris nicht das nervöse Zwinkern seiner Augen. Offenbar scheute sich Olga, in sein Gesicht zu sehen. Sie hielt ihren gesenkten Blick auf den Tisch gerichtet und schwieg. Sie schwieg auch, als Claude erwähnte, dass der Kerl, der türkische Dealer, hinter ihnen, beziehungsweise dem ausstehenden Geld hinterher sei. Olga hielt ihren Blick auf den Tisch gerichtet, als Boris sagte, dass er im Anschluss zur seiner Bank, der Dresdner, gehen werde, um das Geld zu beschaffen. Die beiden aßen ihre Kuchen mit Heißhunger, so dass Boris sie fragte, ob er noch Kuchen bestellen solle. Olga enthielt sich der Aussage, während Claude mit zwinkerndem Blick zugab, dass er noch ein Stück vertragen könnte. Boris gab der jungen Angestellten mit der blütenweißen Schürze ein Zeichen, die darauf an den Tisch kam, die Bestellung entgegennahm, zur Theke ging und drehenden Fußes zwei Teller mit Käsekuchen brachte. Boris, der die Verfolgung der Straßenszene mit Unterbrechungen fortsetzte, als sich die beiden ein Kuchenstück in den Mund schoben, dachte über die Welt, die beiden und sich selbst nach. Er fragte sich, was die Zukunft für alle und für sich im Besonderen bereit hält. Er machte es im Stillen, um das Kuchenessen den beiden nicht zu vermiesen und bei seiner Meditation aus dem Blickwinkel der Straße und seiner, nicht immer nachvollziehbaren Hektik nicht anzuecken oder angeeckt zu werden.
„Besteht denn überhaupt die Chance, diesen Kerl, der Ihnen einiges versprochen hatte, wieder loszuwerden?“, fragte Boris nach seiner „Rückkehr“ von der Straße die beiden, nachdem sie die Kuchengabeln auf die geleerten Teller gelegt hatten. Claude wischte mit der Serviette über den Mund: „das können wir nur hoffen; und wir hoffen das, denn ein Leben unter ständiger Bedrohung ist fürchterlich. Nachts können wir nicht mehr ruhig schlafen, weil wir befürchten, dass dieser Kerl mit einem Messer, einer Pistole oder sonst einem Mordinstrument vor uns steht. So liegen wir über viele Stunden schlaflos im Bett und erschrecken beim kleinsten Geräusch im Hause. Da Olga auch jetzt noch auf die Tischplatte blickte und schwieg, was für Boris bei aller Geduld und dem Höchstmaß an Verständnis nicht zu erklären und auch nicht mehr annehmbar war, weil ja Olga das Problem hatte, beziehungsweise war, fragte er nun direkt, was sie, Olga, dazu zu sagen hätte. „Nichts anderes“, antwortete sie, nachdem eine Denkminute stumm verstrichen war, „was Claude bereits gesagt hatte.“ Das passte nicht ins Denkmuster von Boris, der sich Sorgen um seinen begabten Schüler machte. Es waren doch Sorgen, die nicht er, sondern sie verursacht hatte. Boris schaute ihr auf die markante, etwas tiefe Stirn und betrachtete ihr rechtes Halbprofil quasi von schräg oben mit dem vollen dunklen Haar, unter dem sich das größer als normal ausgefallene Ohr versteckte, so dass das stärkere Abstehen der oberen Ohrmuschelpartie verdeckt blieb. Boris entging nicht die blau verfärbte rechte Wange, die ihr die Ohrfeige vom türkischen Dealer eingebracht hatte. Ihr Blick haftete weiter auf der Tischplatte, fuhr die leer gegessenen Kuchenteller ab und schien sich an der Form der kurzen, dreizinkigen Kuchengabel auf ihrem Teller festgeblickt zu haben, an der die linke Gabelzinke fast an die Mittelzinke herangebogen war.
Während Boris auf eine Antwort von ihr wartete, fragte er sich, ob Olga schüchtern, verstockt oder dickköpfig sei, denn so lange brauchte sie mit der Reaktion, eine Antwort auf seine Frage zu geben, doch nicht zu warten. Claude zwinkerte verlegen von der anderen Seite über den Tisch und so bis ins Gesicht von Boris. „Sag doch etwas, Olga, du weißt es doch am besten. Jetzt musst du schon reden!“, sagte Claude. Olga hob ihr lädiertes Gesicht, schaute Boris kurz an, dann senkte sie das Gesicht und hielt sich mit dem Blick an der Tischplatte fest, von der die junge Angestellte die leeren Teller und Tassen geschickt und taktvoll wegräumte, nachdem Boris ihre Frage, ob weiterer Kuchen und Kaffee gewünscht würde, verneint hatte. „Ich denke schon“, begann Olga mit der lang erwarteten Erklärung und dem deutlich russischen Sprachakzent, „dass ich diesen Mann loswerde, wenn ich ihn erst bezahlt habe. Das Problem ist der andere Mann, der versprochen hatte, mir eine rückdatierte Aufenthaltsbescheinigung zu beschaffen. Es ist ein junger Bankangestellter, der den Stoff braucht. Wenn ich ihm den nicht weiter beschaffe, wird er sein Versprechen nicht einlösen.“ Nun schwieg sie wieder, brachte aber nach einer weiteren Schweigeminute, wobei sich ihr Blick an der Tischplatte wieder festhakte, ihre Sorge zum Ausdruck, dass sie nicht wisse, wie sie sich verhalten solle. Claude zwinkerte nicht weniger besorgt seinem Lehrer ins Gesicht, der ein ernstes Gesicht machte: „Wissen Sie, Olga, dass Sie in einer gefährlichen Gesellschaft sind? Zwei Männer, die alles andere sind als ehrbare Gestalten, haben Sie in die Zange genommen, der eine, der türkische Drogendealer von links und der junge Bankangestellte, der Ihnen da was versprochen hatte, was mit sauberen Mitteln nicht zu machen ist, von rechts. Da fällt mir im Augenblick auch nichts ein, wie Sie aus der gefährlichen und gemeinen Zange herauskommen können. Doch aus dieser Zange müssen Sie heraus, bevor Sie ganz vor die Hunde gehen, wenn ich das so formulieren darf.“
Olga blieb mit dem Blick auf der Tischplatte kleben, während Claude mit dem nervösen Augenzwinkern hin und her, durch das Fenster auf die belebte Straße und von der Straße zurück auf den abgeräumten Tisch sah und dabei das Gesicht von Boris mit Unsicherheit und Hilflosigkeit streifte. „Ich verstehe Ihr Problem“, fuhr Boris fort, „dass Sie in der Bundesrepublik bleiben wollen und dazu die entsprechenden Papiere brauchen, aber so, wie Sie es begonnen haben, um an eine Aufenthaltsgenehmigung zu kommen, haben Sie sich gleich selbst den Weg versperrt. Denn glauben Sie doch nicht, dass das mit einem gefälschten Papier zu machen ist. Früher oder später, ich meine sehr bald, wird die Sache auffliegen und Sie werden wegen Drogenbesitz und Anstiftung zum Betrug eine dicke Strafe bekommen, die es verbietet, dass Sie in Deutschland bleiben können. Sie werden dorthin abgeschoben, woher Sie gekommen sind, nämlich nach Russland, wo Ihnen dann eine noch härtere Strafe droht, die Sie mit einigen Jahren Gefängnis unter russischen Bedingungen abbüßen werden. Bedenken Sie das bitte! Je eher wir Sie aus dieser gefährlichen Zwangslage, dieser gemeinen Zange der Erpressung von rechts und von links herausholen können, um so besser ist es für Sie.“ Diese Worte waren stark genug, dass Olga ihren Blick von der Tischplatte löste und aus ihren dunklen Augen Boris ins Gesicht sah. Sie schaute ihm direkt in die Augen, hielt dem Augenblick für einige Sekunden stand und sagte: „Herr Baródin, ich sehe das auch so, doch weiß ich eben nicht, wie ich aus dieser Zwangslage herauskomme.“ „Darüber müssen wir nachdenken, und das müssen wir gründlich tun, ehe alle Bemühungen zu spät sind“, erwiderte Boris.
Er fuhr fort: „Wir müssen beide Männer bei Tageslicht vor Gesicht bekommen, wir müssen mit ihnen reden, was ihre Bedingungen sind, damit die Sie aus ihren Erpresserklauen freigeben. Ich weiß nur noch nicht, wie wir das am besten anstellen. Doch um ein Treffen mit einer Gegenüberstellung und einem Gespräch kommen wir nicht herum.“ „Ich glaube nicht“, warf Olga ein, „dass der Türke wie auch der junge Bankangestellte dazu bereit sind.“ „Dann wird es schwierig. Da habe ich jetzt auch keine Antwort drauf. Wissen Sie denn, wie die beiden Männer heißen?“, fragte Boris. „Der Türke heißt angeblich Isman und der Bankanstellte Rudolf. Mehr weiß ich nicht. Auch weiß ich nicht, ob das die richtigen Namen sind“, so Olga. Boris: „Aber Sie wissen, wo die beiden zu finden sind.“ Olga: „Der Türke wohnt in einem verkommenen Mietshaus in Wedding mit anderen Ausländern zusammen. Rudolf, der Bankangestellte, den traf ich jedesmal am Abend auf dem Reuter-Platz, wo ich ihm den Stoff übergab. Wo Rudolf wohnt, und wo er arbeitet, das weiß ich nicht.“ Da unterbrach Claude: „Hast du nicht mal gesagt, dass du ihn in der Filiale Reuter-Platz der Dresdner Bank gesehen hast?“ Olga: „Sicher war ich mir nicht, auch wenn der Typ am Schalter dem Rudolf verdammt ähnlich sah.“ Nun funkte es bei Boris, der sein Konto bei derselben Filiale derselben Bank hatte. „Mir kommt die Idee“, sagte er, „dass ihr mich zu dieser Filiale begleitet, denn dort habe ich mein Konto. Ich werde nach einem Herrn Rudolf fragen, wenn ich meinen Scheck einlöse.“ So brachte der Zufall des Zusammentreffens in der Bäckerei und Konditorei Pollack einen ersten Lichtblick, dem zu folgen war, um das Problem ‘Olga’ anzugehen.
Boris: „Wir müssen uns hier schon überlegen, wie wir es am klügsten anstellen, damit Olga den Mann am Schalter als Rudolf identifizieren kann, ohne dass er Olga sieht. Von draußen ist es nicht, vom Eingang bei geöffneter Tür vielleicht zu machen. Olga muss also die Bank betreten. Sie darf ihn nur kurz ins Visier nehmen, muss mit dem Rücken zum Schalter stehen oder sich an den Tisch mit den Bankformularen setzen und ein Formular ausfüllen.“ Olga sah mit fragendem Blick Boris an. Claude zwinkerte mehr unentschlossen als tatendrängerisch über den Tisch und durchs Fenster auf die Straße, wo nach der Mittagszeit der Passanten- und Autoverkehr zugenommen hatte, und von der Straße zurück auf den leeren Tisch. „Lasst uns das Glück probieren! Mehr, als es auf die Probe zu stellen, können wir jetzt auch nicht“, gab Boris das Fanal zum Aufbruch und mit erhobener Hand der jungen, freundlichen und geschickt servierenden Angestellten mit der blütenweißen Schürze das Zeichen zum Bezahlen. Er steckte ihr aufgrund ihres charmanten Auftretens auch ein stattliches Trinkgeld zu, was das darüberhinaus auch hübsche Mädchen mit einem breiten Lächeln und einem wohlklingenden Dankeschön entgegennahm. „Vielen Dank und bis zum nächsten Mal“, sagte die Angestellte und öffnete den Tischkunden die Tür. Beim „bis zum nächsten Mal“ kam Boris der Apotheker Brockmann mit der nach links verbogenen Nase und der ständig runterrutschenden Brille in den Sinn, der ihn erst beim Verlassen der Apotheke mit dem Namen verabschiedete und auch „bis zum nächsten Mal“ sagte, dem er statt des „vielen Dank“ eine gute Besserung vorausschickte.
Claude und Olga begleiteten Boris zur Filiale Reuter-Platz der Dresdner Bank. Sie nahmen, da die Zeit vorübergeeilt war, ein Taxi. Sie hatten nur wenige Meter zur Bank. Ein austretender Kunde hatte die Tür geöffnet und hielt sie denen geöffnet, die im Begriff waren, einzutreten. Olga stand hinter Boris und sagte „am Schalter links“. Offenbar hatte sie den jungen Angestellten mit dem Namen „Rudolf“ hinter diesem Schalter erkannt, der mit dem Geldzählen beschäftigt war, so dass er Olga am Eingang nicht sah, die sich zudem hinter dem Rücken von Boris versteckt hielt. So ging Boris auf den linken Schalter zu und stellte sich ans Ende einer kurzen Warteschlange. „Rudolf“ hinter dem Schalter machte einen sympathischen und hellen Eindruck. Er bediente die Kunden freundlich und schnell. Ihm ging die Arbeit mit dem Geld, den entgegengenommenen Schecks und den Formularen flott von der Hand. Boris konnte sich gar nicht vorstellen, dass dieser junge, gut gekleidete Mann mit dem olivgrünen Schlips (grün war die Logofarbe dieser Bank), dem sympathisch-freundlichen Auftreten und der zügig-flotten Kundenbedienung zu jenen Entgleisten gehörte, die zur Droge greifen. Vor ihm stand eine junge Frau der Mittdreißiger, die diesem „Rudolf“ sogar schmeichelte, als sie ihm sagte, wie gut ihm der sandfarbene Anzug mit der olivgrünen Krawatte stünde. Sie erntete für das Anziehkompliment ein dürftiges „Danke, sehr freundlich“, während er auf die Geldnoten blickte, sie abzählte und vor ihr hinblätterte, die Scheine mit den Wasserzeichen und den anderen Vorkehrungen zur Erschwerung des Nachmachens und je nach eingedruckter Zahl geordnet, die dreistelligen rechts, die zweistelligen links. Die Dame grüßte den Angestellten auf der anderen Schalterseite beim Verlassen, nachdem sie die Geldscheine in ihre Handtasche reingeschoben und die Verriegelung der Tasche geschlossen hatte. „Rudolf“ wünschte ihr darauf noch einen schönen Tag.
Nun war Boris an der Reihe. Er zeigte sich von der höflichen Seite, hatte der schmeichelnden Frau der Mittdreißigerin mehr als nötig Platz gemacht, als sie den Schalter verließ, wobei er ihr noch kurz nachblickte, zum Ausgang sah, um sicher zu sein, dass Claude und Olga nicht zu sehen waren, was sie auch nicht waren. Er hielt den ausgefüllten Scheck über zweitausend DM in der Hand, als er die Probe aufs Exempel startete: „Guten Tag! Haben Sie einen schönen Namenstag gefeiert?“ „Wie kommen Sie darauf?“ „Gestern war doch der Namenstag von Rudolf. Oder sind Sie vielleicht nicht katholisch?“ „Katholisch bin ich schon, aber mein Name ist Eberhard.“ „Dann entschuldigen Sie bitte, ich dachte, ihr Name sei Rudolf.“ „Was kann ich für sie tun?“ „Drei Dinge: erstens den Scheck einlösen; zweitens mir sagen, wieviel auf meinem Konto ist; und drittens benötige ich ein kurzfristiges Darlehen, wobei ich mein Konto überziehen möchte.“ „Fangen wir mit Punkt ‘zwei’ an“, schlug der Bankangestellte Eberhard, alias Rudolf vor. „Das ist mir auch recht“, erwiderte Boris zufrieden, dass er in der Sache ‘Olga’ einen ersten Schritt in die richtige Richtung getan hatte. Der Bankangestellte tippte die Kontonummer in den Computer: „Auf ihrem Konto sind fünftausendsiebenhundertsechsundreißig DM.“ „Dann lösen Sie bitte erst einmal den Scheck ein.“ Eberhard, der junge freundliche Mann schien noch keinen Verdacht geschöpft zu haben, als er die Summe in hunderter Noten auf die Schalterplatte hinblätterte. „Wie hoch soll der Kredit sein?“, fragte er, als Boris die Scheine in die rechte Hosentasche schob. „Fünfunddreißigtausend soll er sein.“ „Aber Sie können das Konto nur bis fünfundzwanzigtausend DM überziehen.“ „Das hilft mir aber nicht.“ „Dann müssen Sie bitte mit dem Filialleiter sprechen, denn der von Ihnen gewünschte Betrag überschreitet meine Kompetenz.“ „Da darf ich Sie bitten, mich bei ihrem Filialleiter anzumelden.“ „Einen kleinen Augenblick, ich versuche Herrn Groß, unseren Filialleiter zu verständigen.“