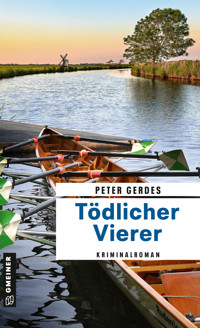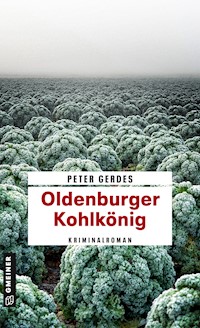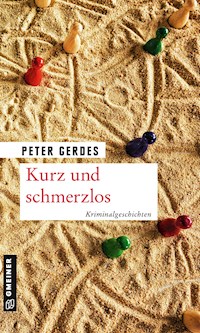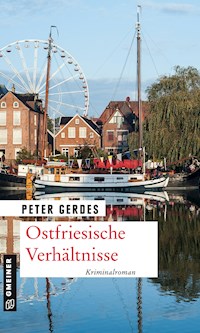Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Stahnke
- Sprache: Deutsch
Musiker Steffen Baalmann wird auf Borkum ermordet und seine Leiche vor dem Haus aufgefunden, in dem er aufgewachsen ist - genau dort, wo alljährlich das Klaasohm-Spektakel stattfindet. Baalmann hatte viele Feinde, darunter seinen Bruder Klaas, der ein halbes Jahr vor ihm in Oldenburg starb. Dessen Tod wirft im Nachhinein Fragen auf. War Rache das Motiv für den Borkumer Brüdermord? An Verdächtigen mangelt es nicht, und mit jedem Ermittlungsschritt werden es mehr. Am Ende muss alles ganz schnell gehen …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Gerdes
Borkumer Rache
Ein Krimi aus dem Nordwesten
Zum Buch
Rache und Recht Steffen Baalmann stirbt auf Borkum, der Insel, die er vor Jahrzehnten verlassen hat, um Karriere zu machen. Ermordet aufgefunden wird er direkt vor dem Haus, in dem er aufgewachsen ist. Seine Leiche hängt an der Litfaßsäule, die jedes Jahr im Mittelpunkt des Klaasohm-Spektakels steht. Wer hatte ein Motiv, den Musiker und Lehrer zu töten? Wie sich herausstellt, mangelt es nicht an Verdächtigen, denn Steffen Baalmann war ein egoistischer und rücksichtsloser Mensch. Sein größter Feind war sein eigener Bruder Klaas – der aber ein halbes Jahr zuvor in Oldenburg starb. Sein Tod wirft im Nachhinein Fragen auf. Hauptkommissar Stahnke bringt nicht nur sein Oldenburger Team, sondern auch seine früheren Leeraner Kollegen zum Einsatz. Die recherchierten Motive reichen teils Jahrzehnte zurück – in einer Zeit der Gesinnungsschnüffelei, als schon ein falscher Satz genügte, um eine Existenz zu zerstören. Am Ende geht dann alles ganz schnell …
Peter Gerdes, 1955 geboren, lebt in Leer (Ostfriesland). Er studierte Germanistik und Anglistik, arbeitete als Journalist und Lehrer. Seit 1995 schreibt er Krimis und betätigt sich als Herausgeber, seit 1999 leitet Peter Gerdes die »Ostfriesischen Krimitage«. Seine Krimis „Der Etappenmörder“, „Fürchte die Dunkelheit“ und „Der siebte Schlüssel“ wurden für den Literaturpreis „Das neue Buch“ nominiert. Gerdes organisiert für das SYNDIKAT das jährliche Krimifest CRIMINALE. Er ist außerdem Mitglied im PEN Berlin.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Animaflora PicsStock / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-7726-3
1.
November 1964
Er wachte von seinen eigenen Schreien auf. Zuerst erkannte er seine Stimme gar nicht, die war so hell und grell und klang so verzweifelt. Als ihm klar wurde, dass er wach war, hörte er auf zu schreien, aber der Krach ging weiter. Alles heulte, knarrte und krachte, und der Boden unter ihm bebte und schwankte, als ob ein Riese daran rüttelte. Ein wilder, ein wütender Riese. Konnte er das sein? War es möglich, dass der Große Klaasohm erwacht war, vorzeitig erwacht in dieser tosenden Dunkelheit? Wenn das so war, dann würde sein Zorn keine Grenzen kennen. Niemand durfte den Großen stören, nicht vor der Zeit! Klaas spürte, wie sich alles in ihm verkrampfte. Ihm wurde übel.
Da waren Hände an seinem Rücken, an seinem Hals. Zugleich eine Erschütterung, als hätte sich der Riese mit seiner Schulter gegen das Haus geworfen, um es zum Einsturz zu bringen. Klaas stockte der Atem. Dann eine Stimme: »Was ist los? Was schreist du denn so? Reg dich nicht auf, ich bin doch hier.« Die Stimme seines großen Bruders, herablassend, aber beruhigend. Gott sei Dank, dachte Klaas, er war noch in dieser Welt! Steffen war da. Und das da draußen, das war nur ein Sturm. Stürme hatte Opas Haus schon viele erlebt. Und überstanden.
Ein neuer Schlag, härter als alles zuvor, ein Geheule wie von den verdammten Seelen, von denen der Pastor immer erzählte, wenn die Klasse in Reli keine Ruhe geben wollte. Konnte dieser Sturm Gedanken lesen? Dann wollte er sich wohl nichts nachsagen lassen. Er drückte gegen die Fensterscheiben, dass es knirschte und die Rahmen knarrten, und fegte zwischen den Dachpfannen hindurch, dass Staub und kleine Krümel auf die beiden Jungen herabrieselten. Hoffentlich waren keine Käfer und andere kleinen Viecher dabei, dachte Klaas. Die Ritzen zwischen den Pfannen waren mit Heidekraut abgedichtet, da konnte so was passieren. Hatten sie alles schon erlebt, wenn sie im Sommer hier oben schliefen, weil ihr Zimmer für Badegäste gebraucht wurde.
»Steffen?«, fragte Klaas, als der Sturm neuen Atem holen musste. »Steffen, glaubst du, das ist der Große?«
»Der große Sturm?« Sein älterer Bruder lachte ihn aus. »Als ob es nur einen großen Sturm gäbe! Stürme gibt es ständig neu, und wie groß sie werden, das weiß man vorher nie so genau. Ihre Stärke ist unbegrenzt. Glaub ja nicht, dass bei Windstärke zwölf schon Schluss ist!«
»Das weiß ich doch!« Klaas drehte sich zu seinem Bruder um. In der Dunkelheit der Dachkammer konnte er nicht einmal seinen Umriss erkennen, aber er spürte seinen Atem. Steffen, drei Jahre älter als er, aber gar nicht mal so viel größer. Wenn sie miteinander balgten, wie es sich gehörte für richtige Jungs, dann musste der Ältere sich schon richtig anstrengen, um ihn mit den Schultern auf den Boden zu drücken. Manchmal ließ Steffen seinen jüngeren Bruder sogar gewinnen, aus lauter Mitleid und Nettigkeit, wie er behauptete. Klaas glaubte ihm das, er glaubte alles, was Steffen sagte. Der hatte immerhin schon fast die Grundschule hinter sich, da lernten die Großen, was sie fürs Leben brauchten, Lesen und Schreiben und Rechnen. Und Heimatkunde, das wichtigste Fach überhaupt. Natürlich wussten Borkumer Jungs sowieso schon, wie es sich verhielt mit Ebbe und Flut, mit Dünen und Deichen, mit Sandwatt, Schlickwatt und Mischwatt, mit Strandhafer und Queller. Aber es war schön, all das, was man von Eltern und Großeltern, von Onkeln und Tanten und deren Nachbarn und Kollegen längst aufgeschnappt hatte, noch einmal geordnet und sortiert vorgesetzt zu bekommen. Das machte alles richtig offiziell, hatte Steffen erzählt. Offiziell, das hieß amtlich, also mit Stempel, Brief und Siegel. Und wenn Steffen das sagte, dann stimmte das auch. Auch wenn Klaas selbst bisher nicht viel davon gemerkt hatte, aber er war ja noch in der ersten Klasse.
»Ich habe gar nicht den Sturm gemeint«, widersprach Klaas, wie so oft mit Verspätung. Die anderen lachten, wenn er das tat, und behaupteten, er wäre wohl etwas langsam im Denken. »Wenn du mit dem Heu kommst, ist die Ziege schon tot!« Dabei stimmte das nicht, er war gar nicht langsam, im Gegenteil; in seinem Kopf waren immer so viele Gedanken zugleich, dass es einfach dauerte, daraus einen Satz zu formen. »Den Großen hab’ ich gemeint, verstehst du? Den Großen Klaasohm! Der immer beim Großen Kaap schläft, bis zum 5. Dezember. Bis seine Zeit gekommen ist.« Klaas schluckte. »Was meinst du, kann es sein, dass der Große vor der Zeit erwacht ist?«
»Vor der Zeit erwacht? Der Große Klaasohm?« Steffen schnappte hörbar nach Luft. »Das wäre schlimm! Dann geht die Welt unter!«
Klaas konnte seinen Bruder im Dunkeln nicht sehen, aber er konnte den Klang seiner Stimme deuten. Steffen machte nur Spaß, veralberte ihn, Gott sei Dank. Er wusste eben Dinge, die sein kleiner Bruder, der bis letzten Sommer noch in den Kindergarten Borkumer Bande gegangen war, nicht wissen konnte. Dafür durfte er schon mal veräppelt werden, das war völlig in Ordnung. Klaas musste selbst herausfinden, wann der Ältere etwas ernst meinte und wann nicht. Das gehörte zum Größerwerden dazu. »Stimmt ja gar nicht!«, krähte er gegen die nächste donnernde Sturmböe an.
Steffen lachte. »Der Große Klaasohm hat einen guten Schlaf«, sagte er. »Der ist nicht einmal bei der großen Hollandflut aufgewacht, vor ein paar Jahren, als drüben in Zeeland fast 2.000 Menschen ertrunken sind und in England und Belgien auch noch welche. Damals hat es noch viel doller gestürmt als heute! Aber das weißt du natürlich nicht, da warst du noch gar nicht geboren.«
Klaas versuchte, den Ton zu überhören, der nichts anderes war als Geringschätzung, aber das gelang ihm nicht. Immer diese drei Jahre! Was konnte er denn dafür, dass er der Jüngere war? So sehr er sich auch mühte, diesen Rückstand aufzuholen, die Kluft war einfach unüberbrückbar. »Irgendwann bin ich auch groß!«, platzte er heraus. »Dann bin ich auch ein Klaasohm! Erst der Kleine, dann der Mittlere und am Ende der Große! Einer der beiden Großen Klaasohms bin ich dann!«
Steffen lachte. »Da träum du nur von!«, höhnte er. »Aber das entscheidest du nicht selbst, das weißt du hoffentlich! Das bestimmen die Leute vom Borkumer Jungsverein. Die lassen nicht jeden Klaasohm werden! Du musst dich richtig einsetzen dafür, sonst wird es nichts. Und wenn du kein Borkumer bist und nicht hier lebst, hast du sowieso keine Chance.«
»Aber ich bin doch Borkumer! Und ich lebe hier!«, rief Klaas.
»Ja, jetzt! Kunststück, du Baby«, erwiderte Steffen. »Aber was ist, wenn du mal 14 Jahre bist? So alt musst du mindestens sein für den Kleinen Klaasohm. Was willst du dann hier auf Borkum machen? Kellnern in Opa sein klein Häuschen? Im Hotel Betten beziehen? Oder Pensionskühe hüten und melken? Andere Arbeitsstellen gibt es kaum. Als Erwachsener musst du irgendwann dein Geld verdienen!«
Erwachsen? Geld verdienen? Für den kleinen Klaas mit seinen sechseinhalb Jahren war das noch so weit weg, meilenweit außerhalb seiner Vorstellungswelt. Aber er hatte schon mitbekommen, dass die Eltern und Großeltern einen anderen Lebensrhythmus hatten als er und die anderen Kinder. Dieser Rhythmus wurde nicht von Ebbe und Flut bestimmt, sondern vom Geld. Das musste man sich holen, wenn es da war, nämlich im Sommer. Es kam mit den Badegästen vom Festland, die so viel reicher waren als die Insulaner. Wenn die Badegäste auf Borkum waren, in großen Scharen, viel zahlreicher als alle Robben oder Möwen zusammen, dann hielt das Leben den Atem an, dann zählte nichts anderes als das Wohlergehen der Besucher. Und das Geld, das sie für dieses Wohlergehen zu zahlen bereit waren. Dann hatten die Erwachsenen alle Hände voll zu tun. Kinder störten in dieser Zeit nur, die mussten sich verkrümeln und durften nicht im Weg sein. Sie mussten sogar ihre Zimmer hergeben, denn die wurden an die Badegäste vermietet. Die Kinder schliefen auf dem Boden, unter dem Dach, ganz egal, wie heiß es dort war. Im Keller wäre es im Sommer angenehmer gewesen, klar, aber die Keller wurden zur Kühlung der Lebensmittel gebraucht, das hatte Vorrang. Kinder kamen mit der Hitze schon klar, die hielten etwas aus.
»Fischer könnte ich werden«, sagte Klaas, wieder einmal mit Verspätung. »So wie Onkel Hermannus! Mit eigenem Kutter. Schollen fangen und Granat!« In seiner Fantasie stampfte ein leuchtend roter Fischkutter durch die aufgewühlte Nordsee, dass die Gischt nur so spritzte. Prallvolle Netze hingen an den Kurrbäumen, und am Steuerruder stand ein lachender Mann mit blonder Schifferkrause und einer kleinen Shagpfeife im Mundwinkel. Das war er selbst, Klaas, der große Klaas. Zum ersten Mal sah er sich so. Das fühlte sich seltsam an, wie ein wohliges Erschrecken.
»Fischerei hat auf Borkum keine Zukunft, sagt Papa.« Steffen wischte die Idee seines kleinen Bruders beiseite. »Die Kutter gehen alle rüber zum Festland, in die Sielhäfen, wegen Verarbeitung und Vermarktung, sagt er. Bringt doch nichts, den Fang abends in Borkum anzulanden, nur damit ihn die Fähre am nächsten Tag kistenweise nach Emden transportiert! Viel zu teuer, und richtig frisch ist die Ware dann auch nicht mehr. Nee, sogar wenn du wirklich Fischer werden wolltest, müsstest du runter von der Insel, da geht kein Weg dran vorbei.«
Runter von der Insel? Von seiner Insel? Klaas schüttelte stumm den Kopf. Das kam überhaupt nicht infrage! Jedenfalls nicht für ständig. Er war schon mit seinen Eltern nach Deutschland gefahren, klar, mit der Fähre, das war jedes Mal spannend gewesen. Das Gedränge auf der Gangway, das Rollen und Stampfen der Rheinland in den rauen Wellen der Außenems, das laute Tuten des Schiffes beim Anlegemanöver am Borkumkai im Emder Außenhafen. Der weite Weg mit dem Bollerwagen vom Hafen bis in die Stadt. Dieses Gedränge, so viele Menschen, so viele Autos! Riesige Schaufenster voller unglaublicher Dinge. Und dann noch so kleine Fenster vor manchen Läden, die tagsüber geschlossen hatten, Fenster wie flache Kisten mit Glasdeckeln, mit Bildern von Frauen drin, Frauen mit fast nichts an und mit komischen Bildern auf der Haut. Mama hatte ihn weiter gezerrt, Papa hatte ihm eine gescheuert, Steffen hatte hämisch gelacht. Und sich gleich auch eine eingefangen. Beim Einkaufen in diesem merkwürdig großen Kaufmannsladen, wo man sich die Sachen selbst aus den Regalen nehmen konnte, hatte Klaas zum Trost einen Lutscher bekommen und Steffen ein Päckchen Kaugummi. Ja, das war spannend gewesen, das konnte man hin und wieder machen. Aber das war doch nichts für ständig! Nur, wenn das stimmte, was Steffen sagte, was sollte er denn hier auf der Insel machen, wenn er mal groß war? Tatsächlich kellnern? Betten beziehen konnte er überhaupt nicht.
Plötzlich hatte er die Idee. »Wattführer!«, rief er laut. »Ich kann doch Wattführer werden! So wie Onkel Bertus, der macht das doch auch. Den Badegästen was erzählen und dafür Geld kassieren. Abends sitzt er immer im Inselkeller. Der kellnert nicht, nee, der kriegt sein Bier gebracht!« Klaas spürte, wie sich trotz der kalten Zugluft eine wohlige Wärme in ihm ausbreitete, ausgehend vom Bauch. So fühlte sich Glücklichsein an, das kannte er schon. Weihnachten war es genauso.
»Wattführer? Du kannst doch nicht einmal schwimmen.« Steffen höhnte nicht, er mäkelte. Für Klaas war das ein gutes Zeichen. Seine Idee war anscheinend wirklich gut, so gut, dass Steffen sie ihm missgönnte. »Außerdem musst du Wattwürmer ausgraben und anfassen. Traust du dich das denn?«
»Und ob ich mich das traue! Eher als du!«, tönte Klaas stolz. In solchen Dingen war er wirklich mutiger als sein älterer Bruder, das sagte ihr Vater auch immer. Klaas kletterte auf jeden Baum und sprang auch wieder runter, während Steffen sich zierte und Ausreden erfand, immer neue Ausreden. Darin war er groß. Als sie neulich angeln waren, hatte Steffen sich sogar einen alten Handschuh angezogen, ehe er den Köder an den Haken steckte. Hatte wohl gedacht, Klaas würde das nicht sehen. Aber Klaas mochte wohl langsam im Reden sein, aber im Merken, da war er ziemlich schnell!
»Wattführer ist gar nicht schlecht«, gab Steffen widerwillig zu. »Aber ich habe eine noch bessere Idee.«
Klaas konnte spüren, dass sein Bruder ihn anstarrte, auch wenn er es in der Dunkelheit nicht sehen konnte. Das machte er extra. Er schwieg, bis sein kleiner Bruder vor Neugier platzte und ihn mit Fragen bestürmte. Dann ließ er ihn zappeln, gebärdete sich wie ein Star aus dem Fernsehen und fühlte sich vermutlich auch so. Klaas hätte das nie gekonnt; wenn ihm etwas am Herzen lag, dann lief ihm der Mund über, mit Verspätung zwar, aber unaufhaltsam. Er wollte sich immer mitteilen, ob er ein Publikum hatte oder nicht. Steffen dagegen mochte sich gerne bitten lassen, dann fühlte er sich groß, dann hatte er Macht. Klaas hasste das. Am liebsten hätte er ihn dort im Dunklen warten lassen, bis er schwarz wurde. Aber das konnte er nicht. Seine Neugier war einfach zu groß. »Was für eine?«, stieß er hervor. »Sag es mir bitte!«
Wider Erwarten spannte Steffen ihn nicht lange auf die Folter. »Ich werde Musiker«, verkündete er stolz. »Ich lerne Gitarre! Und Singen lerne ich auch. Dann singe ich im Sommer für die Gäste und im Winter für die Insulaner. Damit kann man gut Geld verdienen! Natürlich fängt man klein an, wie die Beatles vor zwei Jahren in Hamburg. Aber guck sie dir jetzt an! Jetzt sind sie reich.«
»Du willst Musik machen?« Klaas blieb der Mund offen stehen. Sicher, Steffen sang im Kirchenchor, und einmal hatte ihm der Pastor anerkennend zugenickt. Aber reichte das schon zum Musiker? »Wo willst du denn Gitarre lernen?«, fragte er. »In der Schule haben wir doch nur Blockflöte. Onkel Bertus hat mal gesagt, er würde mir zeigen, wie Akkordeon geht, wenn ich mal groß und stark genug bin, um die große Quetschkommode zu halten. Aber der hat doch auch keine Gitarre.«
»Nee, der nicht.« Steffen lachte lautlos, Klaas konnte spüren, wie die alte Seegrasmatratze unter ihnen bebte. »Aber Tant’ Etti hat eine! Und du würdest dich wundern, wie gut die damit umgehen kann.«
»Was? Arig Etti?« Klaas schlug sich erschrocken beide Hände vor den Mund. Klar, die alte Etti von gegenüber, gleich auf der anderen Seite vom D, galt allgemein als merkwürdig, auf Plattdeutsch arig, aber das sagte man natürlich nicht! Nicht nur, weil sich das nicht gehörte, sondern weil keiner so recht wusste, wo er bei Etti dran war. Wie die immer rumlief! Bunte, weite Klamotten, affige Stiefelchen, lange Ketten aus Perlen und Bernstein und in den zotteligen Locken ein breites Band voller Glitzersteine, dick Puder auf den Wangen und die Lippen grellrot geschminkt. Es hieß, sie hätte früher mit einer anderen Frau zusammengelebt, worüber sich immer noch viele Leute empörten, vor allem Frauen. Die meisten Männer lachten nur; einige meinten: »De hett Adje woll vergeten!« Adje war Adolf, das wusste Klaas, Adolf Hitler, aber wobei der die arige Etti vergessen haben sollte, wollte ihm niemand erklären.
»Kein Wort gegen Etti!«, schnauzte Steffen ihn an. »Die hat mehr Bücher gelesen als der Pastor und alle Lehrer zusammen! Und sie weiß noch viel mehr, als in solchen Büchern steht. Ich hab schon gesehen, wie sie durch ihre Kristallkugel in die Zukunft geschaut hat! Und wenn ihr schwarzer Kater auf ihrer Schulter sitzt, kann sie noch ganz andere Sachen machen. Pass bloß auf, was du sagst, sonst verhext sie dich!«
Klaas schrie entsetzt auf, als sich spitze Knochenfinger in seine Seiten krallten. Es dauerte, bis er merkte, dass das nur Steffen war, der ihn ruppig durchkitzelte. Wütend trat er in dessen Richtung, aber der Ältere hatte das vorausgesehen und wich geschickt aus.
»Tant’ Etti bringt mir nicht nur das Gitarrespielen bei, sie hat auch viele alte Bücher mit Liedern, die kaum noch einer kennt«, erzählte Steffen weiter, sobald sich die Brüder wieder beruhigt hatten. »Da sind ganz tolle Texte dabei, viele auf Platt, andere auf Hochdeutsch. Die meisten sind in altmodischer Sprache geschrieben, aber das kann man ändern. Bei manchen steht eine Melodie dabei, aber viele sind ganz ohne. Etti meint, da kann man noch viel draus machen. Und dass da keine Rechte mehr drauf sind, sagt sie. Das soll wohl auch wichtig sein.«
»Rechte? Was für Rechte?« Klaas verstand überhaupt nichts.
»Na, Rechte bedeutet, dass man einem Dichter Geld bezahlen muss, wenn man seine Lieder singt. Und dem Komponisten auch. Weil, diese Leute haben sich das ja ausgedacht, die Texte und die Melodien, darum ist das ihrs.«
Klaas lachte laut. »Wie, ich soll Leuten was bezahlen, wenn ich deren Lieder singe? Wie soll das denn gehen? Ich dachte, die Leute, die einem zuhören, die müssen dafür bezahlen!« Er krähte los: »Hänschen klein, ging allein, in den Emder Turnverein … so, und jetzt? Muss ich wem was bezahlen?«
»Ach, du bist blöd, du Baby.« Steffen schlug nach Klaas, traf aber nur das klumpige Kopfkissen. Es staubte, beide mussten niesen und danach lachen. »Du wirst schon sehen«, fuhr Steffen dann fort, »das wird eine große Sache, das mit der Musik. Wenn ich ins Radio komme und Schallplatten mache, verdiene ich später Geld, auch wenn ich gar nichts dafür tue! Alles wegen dieser Rechte, die du so blöd findest. Ich muss nur immer fleißig üben, sagt Tant’ Etti. Talent hätte ich, meint sie, und Showtalent auch!«
»Showtalent? Weil du auf Geburtstagen immer Witze erzählst?« Klaas maulte halbherzig weiter. Tatsächlich aber hatten Steffens Worte etwas in ihm ausgelöst. Etwas angeknipst, einen hellen Funken entfacht, der jetzt nach Nahrung suchte. »Wenn du Talent hast«, fragte er, »hab ich das dann vielleicht auch? Wir haben ja auch beide die blonden Haare von Mama und Papa geerbt. Vielleicht auch so ein Talent?«
»Keine Ahnung, wo das Talent herkommt«, erwiderte Steffen. »Von Papa sicher nicht, dem alten Bullerballer. Der darf doch nicht mal in der Kirche mitsingen! Von Mama schon eher, die hat eine schöne Stimme, und den Ton halten kann sie ganz gut.«
»Den Ton halten kann ich auch, das hat unsere Musiklehrerin gestern erst gesagt!«, rief Klaas durch den Sturm, der immer noch ihr Mansardenzimmer umtoste. Er wartete die nächste Bö ab, dann fragte er: »Meinst du, ich kann später auch mitmachen bei deiner Musik? Gitarre spielen und singen und Geld verdienen, damit ich nicht kellnern muss oder runter von der Insel?« Als Steffen nicht sofort antwortete, schob Klaas nach: »Dafür kannst du dann auch Wattführer werden so wie ich! Dann machen wir das beide immer abwechselnd, mal machen wir Musik, dann führen wir die Leute durchs Watt. Alles für Geld! Was meinst du, wäre das nicht was?«
Steffen lachte leise. »Na klar, das wär was«, antwortete er gutmütig. »Aber du müsstest schon etwas dafür tun. Fleißig singen üben und Instrumente lernen. Nicht nur Gitarre, die spiele ich ja schon. Du müsstest andere Instrumente können! Von mir aus Quetschkommode und Flöte. Womit du anfängst, ist egal. Hauptsache, du hängst dich richtig rein. Meinst du, du kannst das?«
»Na klar kann ich das! Ganz bestimmt kann ich das!« Klaas war wie beseelt, die Wärme in seinem Bauch breitete sich aus und schien sogar das klamme, steife Bettzeug zu erfassen. Was genau das war, das ihn so begeisterte, wusste er zwar nicht, aber er verstand, dass hier und jetzt eine Weiche für sein künftiges Leben gestellt wurde. Sein Leben als Insulaner, als echter Borkumer, der eines Tages auch der Große Klaasohm sein konnte. Und weil ihm das Herz so groß wurde, fand er sogleich, dass darin auch Platz für einen mehr sein musste. »Und mein Freund Siemen kann das auch! Der singt doch auch so gerne. Und gut! Was meinst du, Steffen, kann Siemen Schlieter auch mitmachen?«
»Siemen Schlieter, der kleine Schieter? Der zu dumm war für die Grundschule und deshalb noch eine Runde im Kindergarten drehen muss? Geh mir weg mit dem Döskopp! Der kann uns höchstens unsere Sachen hinterhertragen.« Steffens Stimme klang wieder hart und verächtlich. »Willst du vielleicht die ganze Insel einladen? Hör mal, als Musiker Geld verdienen, das klappt nur, wenn man etwas Besonderes ist, kapiert? Und auf keinen Fall darf man das rumerzählen, ehe es soweit ist! Wenn du dich nicht im Griff hast, Kleiner, dann lass ich dich doch lieber raus. Verstanden?«
Klaas bekam es mit der Angst. »Nein, keine Sorge, ich erzähl nichts, ich hab alles im Griff«, sprudelte es aus ihm hervor. »Und das mit Siemen, das muss überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht wichtig. Siemen ist egal! Hauptsache, du und ich! Ist doch so, oder?«
Steffen knurrte etwas, das vielleicht eine Zustimmung war, aber durch den Sturm nicht zu verstehen war.
»Ist doch so?«, wiederholte Klaas drängend. »Du und ich, wir machen das zusammen, richtig? Wir machen alles zusammen. Und wir bleiben und halten immer zusammen. Ist doch so, oder?«
»Ja klar, natürlich tun wir das«, sagte Steffen und lachte. Dann drehte er sich auf die andere Seite. »Ganz klar, auf immer und ewig«, fügte er noch hinzu. Dann zog er sich die Decke über den Kopf. »Und jetzt schlaf. Der Sturm wird schon nachlassen.«
Klaas nickte eifrig. Aber in dieser Nacht bekam er kein Auge mehr zu.
2.
Juli 2022
Oberkommissar Nidal Ekinci war der angenehmste Mitarbeiter, den man sich vorstellen konnte, immer gut gelaunt, hilfsbereit, humorvoll und schlagfertig. So sah er sich nicht nur selbst, das bekam er auch von seinen Kolleginnen und Kollegen bestätigt. Von den meisten jedenfalls und fast immer. Manchmal jedoch war Nidal Ekinci nicht er selbst, und dann lagen die Dinge anders. Zum Beispiel, wenn er schlecht geschlafen hatte.
Wie hatte er sich gefreut auf sein zweites Kind! Mit dem ersten war alles so super einfach gelaufen, komplikationslose Geburt, tolle Entwicklung, guter Appetit, unproblematische Verdauung – vor allem hatte die Kleine schon nach wenigen Wochen angefangen durchzuschlafen! Emine war ein Musterkind, ein echtes Reklamebaby, für das sie überall nichts als großes Lob und viel Anerkennung ernteten. Nidal Ekinci war aus dem Posieren als erfolgreicher junger Vater kaum noch rausgekommen. Die ganze Arbeit mit dem kleinen Mädchen hatte Nasrin, seine Frau, locker alleine erledigt. Alles war perfekt.
Alles bis auf das eine. Emine war das süßeste Mädchen der Welt, aber eben ein Mädchen. Es dauerte nicht lange, da wurde Nidal vor allem von seinen Cousins geneckt und gehänselt. Irgendwann hieß es: »Na, war das schon alles, du Büchsenmacher?« Da hatte er kaum an sich halten können. Cousin Ferhat hatte sich einen Vortrag über die Gleichwertigkeit der Geschlechter anhören müssen, der sich gewaschen hatte. Das blöde Grinsen konnte Nidal ihm aber nicht aus dem Gesicht wischen.
Eigentlich hatten er und Nasrin mit dem zweiten Kind noch warten wollen. Drei Jahre Abstand galten als ideal, jedenfalls sah man das hier in Deutschland so. Aber hier galten Paare mit drei Kindern auch schon als Großfamilie. Nidal, der in der Türkei geboren war und kurdische Wurzeln besaß, hatte ein ganz anderes Ideal im Kopf. In seinem Träumen sah er sich am Kopf einer langen Tafel thronen, an der seine Nachfahren wimmelten, bedient und betreut von seiner treusorgenden Ehefrau. Damit aber war er bei Nasrin gar nicht gut angekommen. »Schlag dir das aus dem Kopf, du Pascha«, hatte sie ihm ultimativ erklärt. »Ich bin doch keine Gebärmaschine!«
Ein zweites Kind aber wollten sie beide, und als Nidal gar nicht mehr aufhörte zu drängeln, gab Nasrin schließlich nach. Drei oder knapp zwei Jahre Altersunterschied, was konnte das groß ausmachen!
Wie sich herausstellte, machte das eine Menge aus. Zwei Wickelkinder gleichzeitig, beide impulsgesteuert und vernunftbasierten Argumenten noch nicht zugänglich. Zudem entpuppte sich der von Nidal so ersehnte Junge als extrem schwierig, bekam eine Kinderkrankheit nach der anderen, hatte Probleme mit Magen und Darm, wollte nicht richtig trinken und schon gar nicht schlafen, schrie dafür stundenlang. Emine verlangte ihrerseits Beachtung und wurde ebenfalls unruhig und anstrengend. Für Nasrin hatte sich die Arbeit schlagartig nicht etwa verdoppelt, sondern vervierfacht. Keine Chance mehr für Nidal, sich dem zu entziehen und zurückgelehnt den stolzen, aber passiven Papa zu spielen. Er musste mit ran, wann immer es ging, morgens und abends und die halbe Nacht lang. Übermüdung wurde zum Normalzustand, seine Nerven waren ständig überreizt, und die einzige Chance, etwas Ruhe zu finden, war seine Arbeit. Ruhe im Fachkommissariat eins der Polizeiinspektion Leer/Emden, ausgerechnet! Das war, als würde sich ein Dachdecker im Sommer zum Abkühlen in die Sauna legen. Aber was waren schon klingelnde Telefone, schimpfende Kollegen und fordernde Vorgesetzte gegen zwei ständige brüllende Kleinkinder? Die reinste Erholung!
Gerade randalierte wieder eines der Tischtelefone. Welches? Kollege Kramer telefonierte selbst, einen Finger im hörerfreien Ohr, denn dieses andere Telefon war unverschämt laut eingestellt. Natürlich das von Schmatze-Schmitz. Oberkommissar Schmitz, eigentlich als Verstärkung von Emden hierher beordert, fehlte schon seit zwei Wochen. Chronische Bandscheibenprobleme in der Lendenwirbelsäule, das hatte er nun von seinem Bodybuilding, dieser Klops, dessen Kiefer ständig in Bewegung waren, weil er andauernd etwas kaute! Damit konnte er jetzt zu Hause seiner Katze auf die Nerven gehen. Sein Büroschreibtisch war vollkommen leer, bis auf das Telefon. Offenbar hatte Schmitz nicht vor, allzu bald wiederzukommen.
Nidal Ekinci stöhnte leise, dann nahm er sein eigenes Telefon ab und holte sich das Gespräch mit einem Tastendruck herüber. »Was?«, schnauzte er in den Hörer. Irgendwie und völlig grundlos ging er davon aus, dass Schmitz selbst am anderen Ende der Leitung war.
War er aber nicht. »Oberkommissar Reents, Polizeistation Borkum«, erklang es zackig. »Wo bin ich denn da gelandet? Etwa beim Wasserschutz? Oder was?«
Ekinci verstand den Witz, riss sich jedoch zusammen. Jetzt bloß nicht auch noch lachen! »Oberkommissar Ekinci, FK eins, PI Leer/Emden«, meldete er sich korrekt, wenn auch verspätet. »Ich bitte um Entschuldigung, hier ist gerade … wie kann ich helfen?«
»Kein Problem, bei uns ist auch gerade Stress«, erwiderte Reents. »Wir haben hier gerade einen Toten am D. Allem Anschein nach handelt es sich um einen öffentlichen Selbstmord. Aber ich als zuständiger Todesermittler bin mir unsicher, was die Strangulationsmarken angeht, und auch der Notarzt sieht sich nicht in der Lage, den Tod durch eigene Hand zu bestätigen. Also hat mein Dienststellenleiter die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, und die sagt, dass Ihre Abteilung das übernehmen soll. Kriegen Sie noch schriftlich, aber mein Chef meinte, ich soll Ihnen schon mal Bescheid sagen.« Er wartete einen Moment, dann hakte er nach: »Fachkommissariat eins, das sind Sie, oder? Sagten Sie doch gerade?« Er klang irritiert.
Nidal Ekinci rieb sich mit der freien Hand die brennenden Augen. War er eigentlich wirklich wach? »Einen Toten am D«, wiederholte er verständnislos. Dabei stellte er sich einen altmodischen Karteikasten vor, mit einem Register von A bis Z. Wie sollte das gehen, ein Toter am D?
»Ja, am D«, bestätigte Reents. »Das ist ein Platz mitten im Ort, der so heißt, weil er so aussieht. Von oben. Also vom Umriss her. Waren Sie noch nie auf Borkum? Auf dem D steht auch die Litfaßsäule, wo traditionell jedes Jahr der Klaasohm-Umzug endet. Genau dort wurde heute früh der Tote aufgefunden.«
Seit Übermüdung für ihn zum Normalzustand geworden war und das sägeblatthafte Singen in seinem Hirn zur Begleitmusik seines Lebens, wunderte er sich über nichts mehr und gleichzeitig über alles. »Klaasohm«, wiederholte er Reents’ Worte. »Litfaßsäule. Ein Platz mit dem Namen D. Dort liegt also Ihr Toter?«
»Er hängt«, korrigierte Reents. »Unser Toter hängt an der Litfaßsäule. Vielmehr hing, wir haben den Leichnam natürlich abgenommen, nachdem wir alle Spuren gesichert und dokumentiert hatten, soweit uns das möglich war. Die Meldung kam ganz früh am Morgen rein, trotzdem waren natürlich gleich Schaulustige da, so was spricht sich rasend schnell herum, vor allem auf einer Insel wie Borkum. Rund um die Säule ist jetzt alles abgesperrt. Mutmaßlich war es Selbstmord, aber wie gesagt, wir wollen lieber auf Nummer sicher gehen. Wann kann Ihr Team hier sein? Gerichtsmediziner, Ermittler und Spurensicherung? Mit dem Katamaran dauert die Überfahrt nicht sehr lang.«
»Mein Team.« Nidal Ekinci schaute sich im Großraumbüro seiner Abteilung um; außer ihm saß hier nur Kramer, und der telefonierte immer noch. Aber dem Borkumer Oberkommissar ging es offenbar vor allem um die Kriminaltechnik. »Ich kümmere mich«, versprach er. »Sobald ich die Ankunftszeit weiß, schicke ich Ihnen eine Nachricht.« Er schloss kurz die Augen und massierte sich die Stirn. Da war doch noch etwas. Was war denn da noch? Ach ja. »Haben Sie den Toten schon identifiziert?«, fragte er. »Wissen Sie, wie er heißt?«
»Haben wir, wissen wir«, entgegnete Reents. »Der Tote war auf Borkum ziemlich bekannt, obwohl er schon lange nicht mehr hier wohnt. Der Name ist Baalmann.«
»Baalmann.« Ekincis rechte Hand irrte über den Schreibtisch, fand einen Stift, kritzelte direkt auf die Schreibunterlage. »Vorname?« Er notierte alles, was Reents ihm diktierte.
»Der Verstorbene ist in dem Haus aufgewachsen, das gleich bei der Litfaßsäule steht. Hat mal seinen Großeltern gehört. Da könnte es natürlich einen Zusammenhang geben.«
»Haus seiner Großeltern«, wiederholte Nidal Ekinci. Der Stift entglitt ihm, seine Finger fühlten sich taub an. »Gebürtiger Borkumer, der aber nicht mehr dort wohnt. Wo wohnte er denn?«
»In Oldenburg«, antwortete Reents. »Adresse habe ich. Das ist aber nicht mehr euer Beritt, oder? Da muss ich wohl die Kollegen direkt vor Ort anrufen.«
Kollegen vor Ort, dachte Ekinci automatisch. Also Stahnkes Abteilung. Stahnke. Den hätte er jetzt gerne hier. Wie so oft. »Das kann ich übernehmen«, bot er an. »Schicken Sie mir ruhig alles, was Sie noch an Daten haben. Apropos Oldenburg – haben Sie den zuständigen Gerichtsmediziner bereits informiert? Doktor Mergner?«
»Ach, der sitzt in Oldenburg? Ich dachte, der wäre bei euch und käme gleich mit.« Inselpolizist Reents schien sich mit den Verhältnissen und Zuständigkeiten in der Nordwest-Region nicht auszukennen. Hatte seinen Posten wohl noch nicht lange inne, schlussfolgerte Ekinci. Für Borkum war das nicht ungewöhnlich. Die dortige Polizeistation war wesentlich größer und stärker besetzt als die auf den anderen Ostfriesischen Inseln, da herrschte wohl automatisch mehr Fluktuation.
»Kein Problem, wenn Sie möchten, informiere ich ihn für Sie«, bot er an.
»Das ist nett, Kollege.« Reents klang deutlich verbindlicher als zu Beginn des Gesprächs. »Dann bis nachher!«
Nidal Ekinci legte den Hörer auf und versuchte, sich zu sammeln. Was jetzt, was als Nächstes? Das Singen in seinem Kopf drohte alles zu übertönen. Ob Kramer ihm helfen konnte? Er schaute hinüber zu dessen Schreibtisch. Dort aber saß niemand mehr.
Kein Wunder, denn Oberkommissar Oliver Kramer stand hinter ihm und beugte sich gerade über seine Schulter. Nidal Ekinci zuckte zusammen. »Himmel noch mal, musst du dich so anschleichen?«, schimpfte er.
»Ganz ruhig, Brauner.« Kramer klopfte ihm auf die Schulter. »Was hast du da aufgeschrieben? Baalmann? Der Name sagt mir etwas. Ein Baalmann hat vor zwei oder drei Monaten noch hier in Leer gespielt.«
»Im Frühjahr? Was gespielt? War Baalmann Fußballer?«, fragte Ekinci.
»War?« Kramer legte seine Stirn in Falten. »Der Betreffende ist also tot? Gewaltsam ums Leben gekommen?«
»Wissen wir noch nicht.« Nidal Ekinci seufzte; bloß nicht die versprochenen Anrufe vergessen! »Selbstmord oder Fremdeinwirkung, das muss noch geklärt werden. Du kanntest ihn? War er Sportler?«
»Wenn es der ist, den ich meine, dann war er Musiker«, erwiderte Kramer. »Liedermacher, bisschen schlagermäßig. Meistens mit einem Begleitmusiker unterwegs. Trat in den letzten Jahren nur noch sporadisch auf. Passable Stimme, interessante Melodien, sehr gute Texte. Auf der Gitarre eher solide, aber das fiel nicht auf, das hat sein Begleiter immer überspielt. Die beiden haben in der Altstadt gespielt, in dieser Buchhandlung, wo im Schaufenster eine Bühne steht. War nicht einmal ausverkauft, schade eigentlich.«
»Bist du sicher, dass es derselbe Baalmann war?«, fragte Ekinci.
»Was sagtest du, wie er mit Vornamen hieß?«, fragte Kramer zurück.
»Sagte ich noch gar nicht.« Nidal Ekinci kniff seine Augen zusammen; er konnte sein eigenes Gekritzel auf der fleckigen Schreibunterlage kaum entziffern. »Steffen hieß der Tote. Steffen Baalmann, 65 Jahre alt. Kommt das hin?«
»Ja«, bestätigte Kramer. »Das kommt hin.«
»Wir sollen den Fall übernehmen, hat die Staatsanwaltschaft angeordnet«, seufzte Ekinci. »Der Borkumer Todesermittler hat Zweifel, ob es sich wirklich um Selbstmord handelt.« Der Oberkommissar stutzte. »Wieso haben die dort auf der Insel eigentlich einen eigenen Todesermittler? Was haben denn die für eine Verbrechensstatistik?«
»Jedenfalls keine mit einer auffälligen Häufung von Tötungsdelikten.« Kramer lächelte nachsichtig. »Die Kolleginnen und Kollegen dort bearbeiten allesamt die ganz normalen Fälle – Diebstähle, Ruhestörungen, Rangeleien von Betrunkenen, Körperverletzungen. Gelegentlich auch Sexualdelikte, klar, wie das so ist in Urlaubsregionen. Aber über den letzten Mord, den es dort gegeben hat, reden die Borkumer heute noch, und das ist schon eine Weile her! Mordermittler heißt, dass es dort einen Kollegen gibt, der die Befähigung für solche Fälle besitzt. Soll heißen, er hat die entsprechenden Lehrgänge gemacht. Deswegen schiebt er vermutlich trotzdem den ganz normalen Dienst wie seine Kollegen auch.«
»Immerhin haben wir damit einen Ansprechpartner vor Ort«, sagte Ekinci. Wie war noch mal der Name dieses Kollegen? Ach richtig, Reents. Ekincis Gedächtnis war durchlässiger als ein Sieb. Er war dermaßen durch den Wind, eigentlich war er überhaupt nicht dienstfähig. Flehend schaute er Kramer an: »Sag mal, könntest du das nicht für mich übernehmen? Wo du den Toten immerhin kanntest?«
»Bedaure.« Kramer schüttelte den Kopf. »Aktuell kann ich hier nicht weg. Du weißt, diese Querdenker mit ihren Morddrohungen. Kann sein, dass da noch mehr dranhängt. Da kann ich mich jetzt nicht rausziehen.«
Nidal Ekinci nickte ergeben. Natürlich hatte er das gewusst. Aber man würde doch auf ein Wunder hoffen dürfen! Er griff nach dem Telefon und rief die Kriminaltechnik an. Zum Glück war wenigstens die zuständige Kollegin dort hellwach. Sie stellte ein Team zusammen, besprach parallel die nötige Ausrüstung und organisierte einen Wagen, während Ekinci online den Fährfahrplan studierte. Mist, dachte er, den Katamaran um 9 Uhr würden sie unmöglich schaffen. Blieb nur der um 12.30 Uhr. Fahrzeit 60 Minuten, das war schnell, die normale Fähre brauchte doppelt so lange, aber danach kam in beiden Fällen noch die Inselbahn. Weitere 25 Minuten. Sollten sie ein Taxi nehmen? Schwer zu begründen, es war schließlich keine Gefahr im Verzug. Nicht, dass ihnen nachher die Spesenabrechnungen um die Ohren gehauen wurden. Wann war die letzte Rückfahrt? Aha, 19.30 Uhr, okay, das sollte genügen. Nicht, dass sie noch auf Borkum übernachten mussten.
Übernachten auf Borkum, dachte er. In einem frisch bezogenen Pensionsbett, ganz allein, in himmlischer Ruhe. Durchschlafen bis zum nächsten Morgen, ohne Kindergebrüll, ohne Gerüttel an der Schulter, ohne verbrühte Finger am Fläschchenwärmer, ohne stinkende Windeln. Was für eine traumhafte Vorstellung!
»Alles klar soweit? Dann sehen wir uns nachher. Abfahrt 11.30 Uhr, oder lieber 11.15 Uhr, man weiß nie, wo gerade wieder gebuddelt wird auf der Autobahn. Wir sehen uns in der Fahrbereitschaft. Nidal? Bist du noch dran?«
»Ja sicher, alles klar, bis dahin, wir sehen uns.« Nidal Ekinci schreckte aus seinem Tagtraum hoch.
Die Kollegin von der Kriminaltechnik lachte. »Na klar, alles sicher! Weißt du was, du Doppelpapa? Ich fahre. Keine Widerrede!«
Zack, aufgelegt. Nidal starrte den Telefonhörer an. Wie hieß die Kollegin noch? Er wusste, dass sie ihren Namen gesagt hatte, aber an den erinnerte er sich beim besten Willen nicht mehr.
Einen anderen Namen aber wusste er noch. Doktor Mergner. Die Nummer des Gerichtsmediziners musste er nicht heraussuchen, die steckte tief in seinem kinetischen Gedächtnis. Er musste seine Finger nur machen lassen.
Doktor Mergner war sofort dran. »Kollege Ekinci, sehr erfreut, was gibt’s?« Die geisterhafte Stimme des Pathologen jagte ihm einen Schauer über den Rücken. Rasch erläuterte er ihm, worum es ging, so kurz und präzise es ihm möglich war.
»Ach«, erwiderte Doktor Mergner. »Steffen Baalmann, sagen Sie? Das ist ja interessant.«
3.
Juli 2022
Den Weg zum Emder Außenhafen verschlief Nidal Ekinci auf dem Rücksitz des alten VW Passat. Am Steuer saß die Kollegin, mit der er telefoniert hatte – sie hieß übrigens Gundula Lücht, trug einen blonden Pferdeschwanz und war einen knappen Kopf größer als er, so groß, dass die Rückseite des Fahrersitzes kräftig gegen seine Knie drückte, nachdem sie ihn passend eingestellt hatte. Aber nicht einmal das konnte ihn wachhalten.
Beim Einschiffen hielt er sich zwischen Gundi Lücht und ihrem graugesichtigen Kollegen, dessen trüber Miene überdeutlich anzusehen war, wie sehr er sich auf seine Pensionierung freute. Im Katamaran der AG Ems zwängten sie sich in eine Sitzreihe, die an das Innere eines Urlaubsfliegers erinnerte, und noch ehe die Schnellfähre abgelegt hatte, war der junge Oberkommissar bereits wieder weggetreten. Der Graugesichtige dämmerte ebenfalls vor sich hin, seine Kollegin spielte irgendetwas auf ihrem Smartphone. Draußen vor den Fenstern glitten der Borkumkai, die riesigen Getreidesilos, die gewaltigen Autotransporter am VW-Verladekai und die Molenköpfe unbeachtet vorbei. Erst als der Katamaran das freie Fahrwasser erreicht hatte und Fahrt aufnahm, als sich die beiden Rümpfe über die graubraunen Wogen erhoben und sie mit ihren scharfen Steven zu zerteilen begannen, schenkten die drei Ermittler dem eindrucksvollen Panorama ein paar Momente Aufmerksamkeit. Aber auch nicht mehr.
Am Borkumer Fährhafen wurden sie tatsächlich abgeholt – mit einem richtigen Polizeibulli. Ekinci, der von den Ostfriesischen Inseln bisher nur Langeoog kannte, wo Fahrräder als Transportmittel das Höchste der Gefühle waren, staunte nicht schlecht. Der Bullifahrer trug Uniform und stellte sich als Oberkommissar Johann Reents vor: »Nennt mich Joke!« Er war höchstens 30 Jahre alt, ebenso groß wie Gundi Lücht und genauso blond. Nidal Ekinci kam sich vor wie Gulliver im Land der Friesen.
Joke Reents fuhr sie zügig bis in den Ort, der Ekinci ziemlich städtisch vorkam, und hielt am Seiteneingang eines imposanten Klinikgebäudes, dessen Vorderfront direkt an die Kurpromenade grenzte. »Doktor Sahin hatte gerade Notdienst, als wir die Nachricht von dem Toten an der Litfaßsäule bekamen«, erklärte Reents, während er sie durch einen gefliesten, hallenden Gang zu einer Kellertür führte. »Wir konnten den Leichnam schlecht dort hängen lassen, andererseits war eine Freigabe zur Bestattung nicht möglich, weil die Strangulationsfurche nicht zur Auffindesituation passte. Vielmehr die Furchen. Also schlug Doktor Sahin vor, den Toten erst einmal hier zu lagern. Hier ist es zuverlässig kühl.«
Sie stiegen eine Treppe hinab, die kein Ende nehmen wollte. Dieser Keller war mal so richtig tief, dachte Nidal Ekinci. Die abgestandene Luft war tatsächlich so kalt, dass sich die dichten schwarzen Haare auf seinen Unterarmen aufrichteten.
Der Tote lag in einem kleinen, ansonsten vollkommen leeren Raum auf einem weiß abgedeckten Tisch, von einem weiteren weißen Laken bis zu den Schultern verhüllt. Als Joke Reents die Leuchtstoffröhre an der Decke einschaltete, bemerkte Ekinci, dass unter dem Saum des unteren Lakens die dünnen Beine eines Tapetentisches hervorlugten. Improvisation war eben alles, dachte er anerkennend.
Steffen Baalmann schien ein knapp mittelgroßer, schlanker Mann gewesen zu sein. Sein halblanges weißes Haupthaar war noch voll, sein sorgfältig gestutzter Musketierbart war dunkelgrau. Aus dem totenbleichen Gesicht mit den breiten, blutleeren Lippen ragte eine schmale, leicht gekrümmte Nase heraus. Unter dem linken Auge zeichnete sich ein Schatten ab, vielleicht ein Hämatom. Der Mann hatte bestimmt einmal gut ausgesehen, dachte Nidal Ekinci. Mehr der kunstbeflissene, vergeistigte Typ als der wetterfeste Insulaner, soweit sich das vom Äußeren her beurteilen ließ. Aber wenn dies tatsächlich der Musiker war, dem Kramer vor einigen Monaten noch andächtig gelauscht hatte, dann kam der Eindruck wohl hin.
Joke Reents deutete auf den Hals des Toten. »Hier haben wir die Strangulationsfurche, die zum Tod geführt haben dürfte«, sagte er und deutete auf eine ringförmige, immer noch deutlich verfärbte Hautverletzung. »Und das da stammt von dem Seil, an dem er hing.« Reents achtete darauf, mit seiner Fingerspitze nicht die Haut des Leichnams zu berühren, während er den Verlauf der zweiten Furche in die Luft malte.
»Nach hinten verläuft sie aufwärts«, stellte Nidal Ekinci fest. »Typisch für Tod durch Erhängen. Vorne verlief die Schlinge, hinten war der Knoten. Dort wirkte der Zug des Seils.«
»Untypisch ist jedoch, dass die Haut in dieser Furche nicht verfärbt war«, erwiderte Reents. »Die erste Furche ist blutunterlaufen, die zweite nicht.«
»Und was schließt du daraus?«, fragte Ekinci.
»Dass der Tote post mortem aufgehängt wurde«, sagte eine geisterhafte Stimme hinter ihnen. Ekincis Armhaare, die sich eben erst niedergelegt hatten, standen schlagartig wieder zu Berge. »Der Tod trat hier nicht durch Erhängen ein, sondern durch Erdrosseln, also auf keinen Fall durch eigene Hand. Hier waren noch mindestens zwei weitere Hände im Spiel.«
Nidal Ekinci fuhr herum. In der Tür zum Kellergang stand Doktor Mergner, der Gerichtsmediziner aus Oldenburg, die dürre Gestalt von einem weißen Kittel umbauscht, das ledrige, ausgedörrte Langläufergesicht von tiefen Längsfalten durchzogen. Seine Stimme schien von viel weiter her zu kommen, mindestens aus dem Nebenraum, wenn nicht gar aus einer anderen Galaxis. »Die Kollegen Reents und Sahin hatten also völlig recht mit ihren Bedenken, vorschnell Selbstmord zu bescheinigen. Hier haben wir es eindeutig mit einem Mordopfer zu tun.«
Joke Reents lächelte selbstzufrieden. Dass der baumlange Oberkommissar der Borkumer Todesermittler war, mit dem er telefoniert hatte, war Ekinci mit der inzwischen üblichen Verspätung klar geworden. Wenn Reents’ einschlägiges Wissen allein von Lehrgängen stammte, dann hatte er wohl sehr gut aufgepasst.
»Herr Doktor Mergner.« Ekinci deutete eine Verbeugung an. »Sie sind schon hier? Auf dem Katamaran habe ich Sie gar nicht bemerkt.«
»Wie denn auch, kleine Schlafmütze«, warf Gundi Lücht ein. Joke Reents grinste beifällig. Der graue Kollege verzog keine Miene, wie bereits die ganze Zeit zuvor.
»Es mag Ihnen entgangen sein, aber dank des Erfindergeistes der Gebrüder Wright verfügt die Menschheit seit einigen Jahren über die Möglichkeit zum sogenannten motorisierten Flug«, hauchte Doktor Mergner. »Sie wissen vermutlich, wann Orville und Wilbur Wright der erste Flug gelang?«
»17. Dezember 1903«, antwortete Nidal Ekinci prompt. Quizduell auf dem Smartphone spielen war seit Monaten der einzige Trost in seinen end- und schlaflosen Nächten. »37 Meter haben die beiden damals geschafft. Da ist es von Oldenburg nach Borkum ein Stückchen weiter.« Nutzloses Wissen, dachte er, aber wenigstens wischte seine Replik den beiden großen Blonden das Grinsen aus dem Gesicht.
»Im Weltmaßstab gesehen eine unbeträchtliche Differenz«, entgegnete Doktor Mergner. »Heutzutage ist Fliegen kaum teurer als eine Autofahrt und eine Fährpassage. Die Mehrausgabe schien mir gerechtfertigt. Immerhin hat die öffentliche Auffindesituation des Toten für allerhand Aufmerksamkeit gesorgt. Würde mich wundern, wenn nicht auch die Presse bereits vor Ort wäre.«