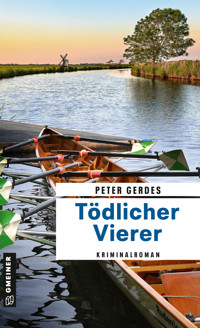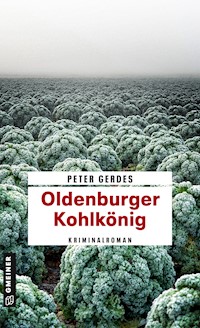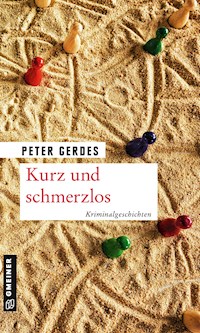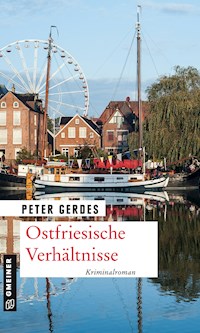Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Stahnke
- Sprache: Deutsch
Während auf der Leiner-Werft im Binnenland ein neuer Kreuzfahrtriese auslaufbereit gemacht wird, geschehen weiter unten an der Ems unerklärliche Dinge. Dabei verschwindet Journalist Marian Godehau spurlos. Hauptkommissar Stahnke und sein Kollege Kramer suchen nach Erklärungen. Stecken Umweltschützer hinter den mysteriösen Vorkommnissen? Was planen Kapitänleutnant Holm und seine Schnellboot-Besatzung? Steht ein Anschlag auf den Neubau bevor? Bald erkennen die beiden Ermittler, dass hier Mächte im Spiel sind, mit denen nicht zu spaßen ist …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Gerdes
Der siebte Schlüssel
Ostfriesland-Krimi
Zum Autor
Peter Gerdes, geb. 1955, lebt in Leer (Ostfriesland). Studierte Germanistik und Anglistik, arbeitete als Journalist und Lehrer. Schreibt seit 1995 Krimis und betätigt sich als Herausgeber. Seit 1999 Leiter des Festivals »Ostfriesische Krimitage«. Die Krimis »Der Etappenmörder«, »Fürchte die Dunkelheit« und »Der siebte Schlüssel« wurden für den Literaturpreis »Das neue Buch« nominiert. Gerdes betreibt mit seiner Frau Heike das »Tatort Taraxacum« (Krimi-Buchhandlung, Veranstaltungen, Café und Weinstube) in Leer.
Impressum
Alle Charaktere und Ereignisse in diesem Roman sind Fantasie des Autors und reine Fiktion.
Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder toten Personen, mit tatsächlichen Ereignissen oder Institutionen wäre rein zufällig.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
(Originalausgabe erschienen 2007 im Leda-Verlag)
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: Katrin Lahmer
unter Verwendung eines Fotos von: © hoffi99 / photocase.de
ISBN 978-3-8392-6522-2
Widmung
Für Schnucki, JoJo und den Heuhaufen
Mein herzlicher Dank gilt Heike, die zuweilen noch verrücktere Einfälle hat als ich. Und natürlich Maeve, der Unbestechlichen.
1.
Keuchend leckte er sich das Blut von den Lippen. Es schmeckte metallisch. Na toll, dachte er und verzog sein Gesicht. An Eisenmangel sterben werde ich also schon mal nicht.
Sterben aber würde er, und das ziemlich bald. Jedenfalls sah alles danach aus. Soweit von Sehen überhaupt die Rede sein konnte, denn es war Nacht und ziemlich dunkel, abgesehen vom grauen Schimmer der tief hängenden Wolken, hinter denen sich ein Dreiviertelmond verborgen halten musste. Womit der Schimmer erklärt war, nicht aber die sattgelben Blitze, die in unregelmäßigen Abständen zuckten und ihm bizarre Schatten vor die stolpernden Füße warfen. Ohne jeden Donner.
Mündungsfeuer? Schalldämpfer?
Mit zitternden Fingern zerrte er sein Taschentuch heraus, um sich das Blut abzuwischen, was ihm gleichzeitig vollkommen sinnlos und unverzichtbar erschien. Sein Schlüsselbund rutschte aus der Hosentasche und fiel rasselnd zu Boden. Keine Zeit jetzt, sich danach zu bücken. Er ließ das Taschentuch stecken und versuchte schneller zu rennen, aber es war ihm klar, dass das nicht ging. Laufen war einfach nicht sein Ding, und aus seinem Körper hatte er sowieso schon das Letzte herausgeholt. Selbst die adrenalingespeiste Panikreserve ging bereits zur Neige. Lange würde seine Flucht nicht mehr dauern.
Mit voller Wucht knallte er gegen eine Wand aus Stahl. Es dröhnte hohl. Seine Brille flog in hohem Bogen davon, und die Blitze, die jetzt über seine Netzhäute zuckten, waren weiß und rot. Der metallische Blutgeschmack verstärkte sich, ergänzt um Noten von Bleimennige und Rost. Offenbar ein älterer Container, aber allemal härter als sein Schädel.
Als die weißen und roten Blitze vor seinen Augen langsam verblassten, wurden die gelben Blitze wieder heller. Sie kommen näher, dachte er, während er sich vor Schmerzen krümmte, nach Luft rang und einen Anfall von Übelkeit niederkämpfte. Gleich können sie mich sehen, und dann haben sie mich. Noch nicht, sonst müsste ich zumindest das Pfeifen der Querschläger schon hören können. Noch nicht, aber bald. Und das war’s dann wohl.
Jetzt hörte er doch etwas. Querschläger aber waren das nicht. Überhaupt keine Schüsse, auch keine schallgedämpften. Viel zu regelmäßig war das Geräusch. Und auf keinen Fall stammte es von einem Maschinengewehr.
Vielleicht eine Maschine? Oder mehrere?
Das Geräusch näherte sich schnell. Eine Art Wummern, das man mehr mit dem Zwerchfell erspüren konnte als mit den Trommelfellen, die vom pumpenden Pochen seines Blutes ohnehin halb betäubt waren. Es erinnerte entfernt an die Propellerschläge eines Helikopters. So laut aber war es nicht, und man hätte auch den Luftdruck fühlen müssen. Also kein Heli.
Er wischte sich mit beiden Händen über das bärtige Gesicht, durch das rinnende Blut und über seine brillenlosen Augen. Der Schmerz hatte nachgelassen. Im fahlen Schimmer des verborgenen Mondes glaubte er, undeutlich eine Gasse zwischen den Containern zu erkennen. Hatte er etwa doch noch eine Chance?
»Scheißegal«, zischte er und stürzte los. Aber es war eher ein Taumeln als ein Rennen, und schon nach wenigen Schritten rasselte sein Atem wie ein kaputtes …
He, das war’s! Jetzt wusste er, wonach das Wummern klang. Nach schweren Motorrädern.
Das Geräusch näherte sich jetzt rapide. Er spürte, wie das Blut auf seinen zum Keuchen geöffneten Lippen Blasen warf und ihm das Gesicht mit prickelnden Spritzern überschauerte. Sein Spurt war längst zu einem schlurfenden Trab verkümmert. Der Tod war wieder ganz nah.
Er sah den dunklen Spalt und schlug einen Haken. Jede Chance war besser als keine. Schließlich verkrochen sich auch waidwunde Tiere in dunklen Löchern. Häufig genug, um darin zu sterben. Aber daran dachte er in diesem Augenblick nicht, nur daran, dass dieser Spalt breit genug für ihn war. Und er schien zum Wasser zu führen. Nun, warum nicht. Verzweifelt genug war er.
Die Schwärze vor ihm erblühte zu einem sattgelben Oval, das sich rasend schnell näherte. Wieder dröhnte es hohl, obwohl er diesmal eindeutig keinen Container gerammt hatte. Etwas hob ihn aus, ließ ihn schweben. Über allem lag das laute Wummern. Jetzt war es da.
Ein lautes Klatschen. Ein Rauschen, ein Plätschern. Dann war es auf einmal ganz still.
2.
»Und? Was haben wir?«
Der schmächtige Kriminalbeamte richtete sich auf, knickte seinen Notizblock zusammen und legte die hohe Stirn in Falten. Ausdruckslos musterte er den großen, massigen Mann, der sich vor ihm aufgebaut hatte und ihn auffordernd musterte. »Guten Morgen, Chef.«
»Jaja! Moin, Kramer. Und? Was ist nun?« Frühmorgens um 5.30 Uhr, unausgeschlafen und ohne Frühstück im Bauch. Hauptkommissar Stahnke klang genauso, wie er sich fühlte.
Der schmale Mann zuckte die Achseln. »Unklar. Heute Nacht um 2.45 Uhr hat ein junger Mann über den Notruf Schreie und laute Geräusche am Containerterminal gemeldet. Eine Funkstreife war ganz in der Nähe und traf wenige Minuten später hier ein, konnte aber zunächst nichts entdecken. Vor allem keinerlei Personen auf dem Gelände.« Kramer referierte auswendig, ohne seine Notizen eines Blickes zu würdigen. »Danach haben sich die beiden Kollegen erst einmal den Anrufer vorgenommen.«
»Was ist das denn überhaupt für einer? Einsamer, verirrter Zecher mit Hang zu rosa Elefanten?« Stahnke blinzelte in die Sonne, die sich bereits über den Horizont gewagt hatte. Immerhin war Juli, die Tage waren lang, und sie waren heiß. Vermutlich wieder ein Jahrhundertsommer, hieß es. Den letzten hatte es erst vor drei Jahren gegeben. Ziemlich kurz, diese Jahrhunderte im Zeitalter des Klimawandels.
»Weder noch.« Kramer quittierte den schlappen Scherz seines Vorgesetzten nicht einmal mit dem Zucken eines Mundwinkels. Das tat er nie. »Bei dem Anrufer handelt es sich um den männlichen Teil eines gemischtgeschlechtlichen Pärchens. Er war einigermaßen nüchtern und scheint sich seiner Sache recht sicher zu sein. 22 Jahre, Marinesoldat, gehört zur Besatzung eines Schnellbootes, das zur Reparatur hier im Hafen liegt. Na ja, und an Bord konnten die beiden ja nun schlecht … Immerhin war es eine laue Nacht, nicht wahr, so was bringt einen auf Ideen, und hier im Bereich des Binnenhafens ist um diese Zeit gewöhnlich nicht allzu viel los.«
Wohl wahr. Die Boomzeit des Emder Hafens war schon eine Weile her. Der Erzumschlag war wegen der nachlassenden Nachfrage, des schwierigen Emsfahrwassers und der niederländischen Konkurrenz praktisch zum Erliegen gekommen. Ohne die Autoverladung am VW-Kai im Außenhafen wäre hier jahrelang fast überhaupt nichts mehr gelaufen. Inzwischen ging es zwar wieder aufwärts, das alte Niveau aber war noch weit entfernt. Immerhin bemühte sich die Emder Hafenwirtschaft um Anschluss an die aktuelle Entwicklung. Zum Beispiel in Sachen Marineschiffbau. Und Windkraftanlagen. Und Container.
»Dann fühlten sich die jungen Leute also in ihrer Zweisamkeit gestört?«, vermutete Stahnke. »Frechheit aber auch. Oder hatten die beiden etwa schon selber ein Feuerwerk entzündet?«
Kramer hob die Augenbrauen: »Wie bitte?«
»Nichts. Vergessen Sie’s.« Stahnke winkte ab. »Und kommen Sie vor allem mal auf den Punkt. Denn wenn alles nur ein Hirngespinst wäre, stünden wir jetzt ja wohl nicht hier.«
»Nein. Vielmehr ja, richtig. Ein Hirngespinst war es wirklich nicht.« Kramer wies auf einen mattrot gestrichenen, rostigen und schon ein wenig verbeulten Container, den untersten eines hohen Stapels. »Wir haben Blutspuren gefunden. Dort, etwa in Kopfhöhe, und dann auch am Boden. Eine richtige Blutspur. Als ob ein Verletzter hier entlanggelaufen wäre.«
»Von wo nach wo? Und wo ist er jetzt?«
»Das wissen wir noch nicht. Die Kollegen sind ja noch an der Arbeit.« Kramer wies auf die Kriminaltechniker, die in ihren dünnen, weißen Kapuzenoveralls auf dem Gelände herumstapften wie Astronauten auf dem Mond. Einem Mond voller Container.
»Unklar ist auch, ob es einen Kampf gegeben hat. Oder ob gar geschossen worden ist. Vielleicht war es ja auch nur ein Unfall mit Personenschaden.«
»Vielleicht.« Stahnke seufzte, stemmte die Hände in die Nierengegend und streckte das Kreuz. Sein Rücken schmerzte, und er begann zu wippen und zu trippeln, um die verspannte Muskulatur zu lockern. Der Gedanke, womöglich für einen schnöden Unfall aus dem bei dieser Hitze ohnehin sehr knappen Nachtschlaf gerissen worden und fast 30 Kilometer weit gefahren zu sein, setzte seiner Laune weiter zu. Wenn schon, dann sollte es wenigstens ein richtiger Fall sein. Darauf hatte er doch wohl moralisch wie dienstgradmäßig Anspruch.
Nachdenklich blickte er sich um. Die Umgebung war ihm, mal abgesehen von den Containerstapeln in seinem Rücken, sehr vertraut. In Emden geboren und aufgewachsen, hatte er sich oft in der Hafengegend herumgetrieben. Zum Entsetzen seiner überängstlichen Mutter ebenso wie zur stillen Freude seines Vaters, der selber eine Vorliebe für alles Maritime gehabt hatte. Die Große Seeschleuse, deren inneres Tor direkt gegenüber auf der anderen Seite des Neuen Binnenhafens zu erkennen war, die Liegeplätze der Bugsierschlepper rechts davon, daneben die Jachtanleger, dort, wo früher die Festmacherboote in Lauerstellung gelegen hatten – das waren geradezu Plätze seiner Jugend. Links vom Schleusenhöft lag jetzt ein Dreimaster, ein Restaurantschiff; dann kam der Erzkai, früher das Herz des Hafenumschlags, heute weitgehend verwaist. Nur noch drei der hochbeinigen Verladebrücken waren übrig, die restlichen hatte man mangels Auslastung demontiert. Dahinter, schon jenseits des Emsdeichs, ragte eine gigantische Fünf-Megawatt-Windkraftanlage empor, ein Versuchsmodell für den Offshorebetrieb. So etwas hatte es damals natürlich noch nicht gegeben.
Ach ja, damals. Da hatte er natürlich Kapitän werden wollen, was denn auch sonst, aber dann hatten sich die Dinge doch anders entwickelt. Na, immerhin hatte er zwischenzeitlich schon einmal rund um die Seeschleuse ermittelt. Erfolgreich. Vielleicht ein gutes Omen.
Unter seiner linken Schuhsohle knirschte es leise. Stahnke erstarrte in der Bewegung. Die größte Gefahr für eine Spur am Tatort war ein unvorsichtiger Polizist, das wusste er, und deshalb hatte er sich auch gehütet, irgendetwas anzufassen. Aber auch mit den Füßen konnte man Schaden anrichten.
Er drehte sich leicht in der Hüfte und peilte an seinem Bein entlang nach unten. Da lag tatsächlich etwas. Schien aus Metall zu sein. Und aus Glas, denn es blitzte auf in den Sonnenstrahlen, die soeben zwischen den aufgetürmten Containern hindurch ihren Weg bis auf das Betonpflaster des Stellplatzes gefunden hatten. Das Ding sah aus wie …
»Eine Brille«, sagte Kramer.
Als er sich bückte, hatte er Latexhandschuhe an und eine Plastiktüte in der Hand. Kramer tat immer das Richtige und war immer auf alles vorbereitet. Unheimlich. Geradezu unmenschlich, fand Stahnke. Vermutlich deshalb siezte er seinen Kollegen nach all den Jahren der Zusammenarbeit immer noch.
»Zum Glück stehen Sie nur auf einem der Bügel. Wenn Sie vielleicht mal eben das Bein heben könnten?«
Stahnke trat einen Schritt zur Seite. Tatsächlich eine Brille. Dort, wo sie lag, hatte sich ein Büschel Gras durch einen Spalt im Beton ans Licht gezwängt. Gerade genügend Halme, um das Metallgestell und die beiden ovalen Gläser vor seinen Blicken zu verbergen. Und vor denen der Kriminaltechniker auch. Das tröstete ihn ein wenig.
Das Brillengestell glänzte silbrig. Es war ein bisschen zu flott gestylt, um intellektuell auszusehen. Und es kam Stahnke vage bekannt vor. Vermutlich ein gängiges Modell, das er schon einmal in der Werbung gesehen hatte.
Einer der Overallträger näherte sich. Der Hauptkommissar kannte ihn nicht. Seine und Kramers Abordnung von Leer nach Emden war erst ein paar Tage her, zu kurz, als dass er bereits jeden in seiner neuen Dienststelle kennen konnte. Zudem war es eine Abordnung auf Zeit, da lohnte es sich wahrscheinlich gar nicht, sich jedes einzelne Gesicht dauerhaft einzuprägen.
Ein Lächeln aber konnte wohl nicht schaden. »Moin. Na, wie sieht’s aus?«
»Moin.« Der Overallträger war ebenso groß wie Stahnke; die untere Hälfte seines Gesichts war hinter einem dunklen, kurz gestutzten Vollbart verborgen. In seiner behandschuhten Rechten hielt er einen Kugelschreiber, an dem ein Schlüsselbund baumelte. »Wir sind der Blutspur gefolgt. In beide Richtungen. Sie führt zu einem Pkw, der außerhalb des Terminalgeländes abgestellt ist. VW Polo, dunkelblau, Oldenburger Kennzeichen. Unverschlossen. Zündschlüssel steckt.«
»Irgendwelche Schäden am Fahrzeug, die auf einen Unfall hindeuten?«
Der Bärtige schüttelte den Kopf. »Nein. Aber es gibt Blutspuren am Türgriff auf der Fahrerseite. Dem Augenschein nach auch im Inneren. Bei unserem Verletzten dürfte es sich also wohl eher um den Fahrer gehandelt haben.«
Stahnke fuhr sich mit der Hand durch die weißblonden, stoppelkurz geschnittenen Haare. »Und er kam bereits blutend hier an.« Das klang merkwürdig, hütete er sich, diesen Gedanken auszusprechen. Manche Fakten wirkten für sich genommen genauso sinnlos wie umherliegende Kettenglieder. Wenn man aber erst die ganze Kette kannte, war plötzlich alles völlig logisch. Also bloß nicht zu früh mit dem Bewerten anfangen.
»Und das da? Noch mehr Schlüssel?« Er deutete auf die rechte Hand des Overallträgers.
»Ja. Haben wir dort drüben gefunden, im Verlauf der Blutspur. Könnte also dem Opfer gehört haben.«
»Oder dem Täter.« Stahnke stöhnte innerlich auf. Offenbar konnte er es einfach nicht lassen.
»Wohin führt denn die Blutspur?«, schaltete sich Kramer ein.
»Na, zum Auto«, sagte der Bärtige. »Hab ich doch gerade …« Er stutzte, als er Kramers nachsichtigen Blick bemerkte. »Ach so, Sie meinen die andere Richtung. Zum Hafen.«
»Wie bitte?« Jetzt stand Stahnke auf der Leitung. »Hafen, das ist doch wohl das alles hier, oder nicht?«
»Ja. Nein.« Der Overallträger begann herumzufuchteln. Das Schlüsselbund klimperte hell. »Natürlich. Ich meine, die Blutspur führt auf der anderen Seite zum Wasser. Dorthin, zum Kai. Dort bricht sie ab.«
»Zum Wasser«, murmelte Stahnke. Es mochte ja Hochsommer und tagsüber brütend heiß sein, aber in das bedrohlich dunkle Wasser des Emder Binnenhafens sprang doch keiner freiwillig. Jedenfalls nicht an dieser Stelle und nachts. Und schon gar nicht einer, der durch Blutverlust geschwächt war. Es sei denn …
»Vielleicht hat dort ein Boot gelegen«, sagte Kramer. »Vielleicht hat jemand auf ihn gewartet. Hat ihn aufgenommen, in Sicherheit gebracht und versorgt. Per Handy herbeitelefoniert. Das würde erklären, warum der Verletzte überhaupt hier seinen Wagen verlassen hat.«
»Ja, würde es«, sagte Stahnke. »Wenn’s denn stimmt. Tut es vielleicht sogar. Vielleicht. Wahrscheinlicher aber ist wohl etwas anderes.«
»Nämlich?«
Stahnke wandte sich wieder dem Bärtigen zu. »Wir brauchen Taucher. Und benachrichtigen Sie die Kollegen vom Wasserschutz. Die Schlüssel können Sie hierlassen.«
Der Overallträger nickte, ließ das Schlüsselbund in die Plastiktüte gleiten, die Stahnke ihm hinhielt, und sprintete davon. Auch er schien eine Wasserleiche für das Wahrscheinlichste zu halten.
Kramer hantierte immer noch mit der Brille herum. Der Bügel, auf dem Stahnke gestanden hatte, ließ sich nicht mehr richtig einklappen, und jetzt wollte das ganze Ding nicht so ohne Weiteres in die Klarsichttüte hinein. Der Oberkommissar aber ließ nicht locker.
Diese Brille. Wo hatte Stahnke die schon einmal gesehen? Das Gefühl, sie zu kennen, wurde zur Gewissheit. Wer trug solch ein Ding? Irgendein Kunde von ihm? Oder ein Kollege? Ein Promi vielleicht?
Dann schwante ihm etwas. »O Gott«, murmelte er.
»Was?« Kramer ließ von der Brille ab, die er allen Widrigkeiten zum Trotz fast schon eingetütet hatte. Er wusste Stahnkes Gesichtsausdruck zu deuten. »Was ist denn?«
»Schauen wir uns doch mal dieses Auto an«, sagte Stahnke und setzte sich in Bewegung. Kramer musste rennen, um mit seinem lang ausschreitenden Vorgesetzten Schritt zu halten.
Ein Tor gab es nicht; das Gelände mündete einfach in eine Asphaltstraße, die hier einen fast rechtwinkligen Bogen beschrieb. Sie führte vom Jarßumer Hafen zur Borssumer Schleuse. Von dort war es nicht weit zur Autobahnauffahrt. Diesen Weg hatte auch Stahnke bei seiner Ankunft genommen.
Auf den parkenden Wagen, der etwas weiter vom Straßenrand entfernt stand als üblich, hatte er vorhin nicht geachtet. Als er ihn jetzt in Augenschein nahm, war das wie ein Schlag in die Magengrube. Ein dunkelblauer Polo. Das Kennzeichen begann mit OL-RR. Die Heckscheibe trug eine kleine zweistellige Nummer aus weißer Klebefolie. Eindeutig ein Redaktionsdienstwagen der »Regionalen Rundschau«.
»Was ist?«, fragte Kramer erneut. »Kennen Sie das Auto?«
»Nicht direkt«, sagte Stahnke. »Aber ich fürchte, ich weiß, wer es gefahren hat.« Er sog seine Lippen zwischen die Zähne und zwinkerte, weil seine Augen zu brennen begannen. Nur nicht die Fassung verlieren jetzt. Dann atmete er heftig aus.
»Kramer, bitten Sie mal Oldenburg um Amtshilfe. Personenüberprüfung. Marian Godehau, Journalist. Redakteur bei der »Regionalen Rundschau«. Die Kollegen sollen seinen derzeitigen Aufenthaltsort feststellen. Und lassen Sie auch die Schlüssel ins Labor bringen.« Er drückte ihm die Tüte in die Hand.
Kramer blickte überrascht; er kannte den Journalisten ebenfalls, wenn auch nicht so gut wie sein Vorgesetzter. »Und was sollen die Kollegen sagen oder tun, wenn sie Marian Godehau finden?«
Stahnke schüttelte den Kopf. »Schätze, das wird nicht passieren.«
3.
Der Bahnhof von Emden musste einer der hässlichsten der gesamten Republik sein. Jedes Mal, wenn Stahnke ihn sah, drängte sich ihm dieser Gedanke auf. Und das kam in jüngster Zeit oft vor, denn die Emder Polizeiinspektion lag dem Bahnhof genau gegenüber, nur durch einen weitläufigen Parkplatz getrennt.
Wie er vom Binnenhafen hierhergekommen war, wusste er nicht. Die Autofahrt musste er wie in Trance absolviert haben. Schalten, blinken, lenken, Gas geben und bremsen, alles mit dem Unterbewusstsein. Das hielt sich ohnehin für den besseren Fahrer.
Marian Godehau tot.
Vermutlich tot, korrigierte er sich, als er einparkte. Aber höchstwahrscheinlich, da brauchte er sich keinen Illusionen hinzugeben. Die Spuren sprachen eine allzu deutliche Sprache.
Er hatte einen Freund verloren.
Einen Freund? Stahnke schüttelte leicht den Kopf, während er ausstieg und die Zentralverriegelung seines Wagens betätigte. Freunde, richtige Freunde waren sie eigentlich nicht gewesen, Marian und er. Der Schnüffler und der Bulle. Aber Kumpel. Zwei Schnüffler eben, genau genommen. Es gab einiges, das sie verband, Erlebnisse, die sie mehr oder minder gemeinsam durchgestanden, Fälle, die sie zusammen zum Abschluss gebracht hatten. Miteinander – zuweilen aber auch gegeneinander.
Anfangs hatte er nicht viel von Godehau gehalten, hatte ihn rücksichtslos für seine Zwecke benutzt und damit in Gefahr gebracht, hatte ihn bei sich verächtlich einen fusseligen Schmierfinken genannt, einen langweiligen Gutmenschen, einen weltfremden Weltverbesserer. Godehau wiederum hatte ihn zunächst für einen absoluten Spießer gehalten, einen obrigkeitshörigen Bürokraten, dem alles zuzutrauen war, solange es durch irgendeine Vorschrift gedeckt blieb. Oder auch nur durch das mutmaßliche Staatsinteresse. Ein Apparatschik eben.
Dann aber, mit den Jahren, hatten sie einander besser kennen und schätzen gelernt. An ihrer Verschiedenheit hatte sich nichts geändert. Oder jedenfalls nicht viel. Aber sie hatten beide gelernt, den anderen wichtig und ernst zu nehmen. Irgendwie hatte sie das beide weitergebracht.
Ein Lernprozess also. Wie langweilig. Aber egal, so etwas verbindet. Irgendwann einmal hatte es sogar zum Du gereicht. Dabei war Stahnke damit überhaupt nicht freigiebig.
Aber da war noch etwas. Vielmehr jemand. Nämlich Sina.
Als er Sina Gersema kennengelernt hatte, war sie Marian Godehaus Freundin gewesen. Und damit für ihn automatisch tabu. Eine Sichtweise, für die Sina ihm fast den Kopf abgerissen hätte, als er sie ihr gegenüber später einmal erwähnte. »Wie siehst du eigentlich Frauen? Als Besitz? Bin ich vielleicht ein Stück Vieh, oder was?« Zu diesem Zeitpunkt war Sina bereits nicht mehr Godehaus Freundin gewesen. Sondern Stahnkes. Weil sie es so gewollt hatte. Womit ihre eigene Frage eigentlich gegenstandslos gewesen war.
Alles lange vorbei. Sina ging längst wieder eigene Wege. Weil sie es so wollte. Er wurde das Gefühl nicht los, dass Godehau und er nur Stationen auf Sinas Weg gewesen waren, einem Weg, der sie wohin auch immer führen mochte, aber auf jeden Fall weiter. Und weiter weg. Während er, Stahnke, eher auf der Stelle trat. Was Sina nicht reichte.
Durchgangsstationen waren sie gewesen, Marian ebenso wie er. Auch so etwas konnte verbinden.
Stahnke betrat das Gebäude und nickte dem wachhabenden Uniformierten flüchtig zu. Der Gegengruß klang zackig, fast herausfordernd, und wurde von einem neugierigen Blick begleitet. Klar, die Emder Kollegen wussten noch nicht so recht, was sie von ihrem Neuzugang zu halten hatten. Zumal der Ruf, der ihm vorauseilte, zumindest zwiespältig war. Schrulliger Einzelgänger mit merkwürdigen Methoden, launisch und unberechenbar. Schätzte Spekulationen mindestens ebenso sehr wie Spuren. Aber hohe Aufklärungsquote. Immer mal wieder in der Zeitung. Widersprüchlich. So einer lief jetzt hier rum. Da wollte natürlich jeder gerne wissen, woran er war.
Auf der Treppe nahm Stahnke zwei Stufen auf einmal. Seit er ein wenig abgespeckt hatte, machte ihm das wieder Spaß. War gar nicht so schwer gewesen. Weniger Fleisch und Wurst, mehr Fahrrad, abends keinen Dosenfisch mehr und nur noch gelegentlich Wein. Alles eine Frage des Durchhaltens. Schlank war er dadurch zwar noch lange nicht, aber wenigstens nicht mehr fett. Stattlich eben. Ein Wort, das ihm gefiel.
Oben war Tumult. Vier, nein fünf Uniformierte balgten sich mit einem Festgenommenen. Der Kerl inmitten der Beamtentraube schien über Bärenkräfte zu verfügen, denn die Polizisten bekamen ihn einfach nicht unter Kontrolle. Im wohligen Gefühl seiner neu erfahrenen Körperlichkeit reckte Stahnke die breiten Schultern. Handfeste Hilfestellung war sicherlich keine schlechte Art, sich auf der neuen Dienststelle einzuführen.
Der Kollege direkt vor ihm schrie auf, presste beide Hände auf seine Nase und drehte sich zur Seite. Blut quoll zwischen seinen Fingern hindurch. Höchste Zeit, dem Treiben hier ein Ende zu machen. Stahnke stieß in die Lücke.
Zuerst glaubte er, die Polizisten kämpften mit einem Bündel wild zappelnder, peitschender Schlangen. Dann erkannte er, dass es nur die dicken, roten Rastazöpfe des kämpfenden Kerls waren, die um seinen wie rasend hin und her zuckenden Kopf herumschleuderten. Als Nächstes fiel ihm auf, dass dieser unbezähmbare Bursche alles andere als ein Riese war, sondern auffallend klein und dünn. Als Letztes bemerkte er, dass es sich überhaupt nicht um ein männliches Wesen handelte, sondern um eine Frau. Eine kleine, dünne, punkig gekleidete junge Frau.
»Nun mal halblang, Mädel«, sagte Stahnke, so väterlich es eben ging. »Sei vernünftig, so bringt das doch nichts. Wir können doch über alles …«
Der Blick, der ihn traf, kam aus eisgrauen Augen und schien doch zu lodern. Das Nächste, was ihn traf, war die Sohle eines schweren, schwarzen Arbeitsschuhs, stark profiliert und verdammt hart. Weder hatte er den Tritt kommen sehen, noch hatte er ihn angesichts seiner winzigen Gegnerin in dieser Höhe erwartet. So war sein Kinn ungeschützt. Das schmale, dreieckige Gesicht mit den flammenden eisgrauen Augen verschwand aus seinem Blickfeld, als sein Kopf in den Nacken flog. Sterne zuckten über den ergrauten Deckenanstrich.
Auf dem Hosenboden sitzend fand er sich wieder. Der Kollege mit der lädierten Nase, die inzwischen aufgehört hatte zu bluten, hatte sich neben ihn gehockt und ihm die Hand auf die Schulter gelegt.
»Na, geht’s wieder?«
Leiden verbindet, dachte Stahnke, während er eine undefinierbare Antwort knurrte. So hatte er sich ja nun nicht einführen wollen. Aber egal, Hauptsache Fühlung nehmen.
»Was ist denn das für eine?«, fragte er, sobald es wieder ging. Das schlangenköpfige Mädchen kämpfte immer noch, aber inzwischen hatte einer ihrer Widersacher ihre Handgelenke zu fassen bekommen und ihr die Arme auf den Rücken gedreht. Ein weiterer stand mit Handschellen bereit, während die beiden restlichen versuchten, den wild ausschlagenden Trampelschuhen auszuweichen. Ein Ende der Kampfhandlungen war absehbar.
»So ’ne Umweltschützerin«, sagte der mit der Nase. »›Greenpeace‹, ›Robin Wood‹ oder noch was Heftigeres. Wurde in der Fußgängerzone erwischt, nachdem ein Ladenbesitzer sie angezeigt hatte. Hat Kaugummis in Pelzmäntel geschmiert. Ob die wohl weiß, was für einen Schaden sie damit angerichtet hat?«
Die Handschellen klickten, begleitet von schrillen Schreien. Immer noch zuckten die Schlangenlocken.
Stahnke suchte den eisgrauen Blick. Ob diese junge Frau wusste, was sie tat? Für ihn war das keine Frage.
Ächzend erhob er sich, die helfend angebotene Hand des Nasenmannes ignorierend. Erst als er stand, ergriff und schüttelte er sie. »Stahnke, übrigens. Fachkommissariat eins.«
Sein Gegenüber versuchte ein Lächeln, das den Nasenbereich aussparte. »Ich weiß. Coners, Conny Coners. Hiesiger Leiter der Schutzpolizei.«
Stahnke wischte sich mit der freien Hand über Stirn und Augen. »Ach, eigentlich kennen wir uns auch schon, nicht?« Es hatte eine Begrüßung beim Dienststellenleiter gegeben, mit Schnittchen und Saft, in kleinem Kreis. Da musste Coners mit dabei gewesen sein. Natürlich hatte sich Stahnke wieder einmal weder Gesicht noch Namen gemerkt.
Coners grinste und winkte ab. »Klar haben wir uns schon gesehen. Aber da trug ich keine Uniform, war also praktisch verkleidet. Außerdem, richtig kennenlernen kann man sich ja sowieso erst bei der Arbeit, oder?«
Er fasste sich an die Nase, Stahnke rieb sich das Kinn. Beide lachten gleichzeitig und schallend los. Die Schlangenhaarige schrie und wand sich immer noch.
»Diese Umweltschützer sind hier sehr aktiv in letzter Zeit«, sagte Conny Coners. »Haben wohl Emden als geeigneten Schauplatz für ihre Aktionen entdeckt. Ausgerechnet. Dabei ist hier die Welt doch noch in Ordnung, vergleichsweise.«
Stahnke nickte versonnen, obwohl er am liebsten den Kopf geschüttelt hätte. So waren sie eben, die Ostfriesen. Für sie war Natur nichts Schützenswertes, dafür gab es hier einfach zu viel davon. Umwelt war zum Nützen da, nicht zum Schützen. Wenn überhaupt, dann musste der Mensch vor der Natur geschützt werden, zum Beispiel durch Deiche. Dass die Natur ihrerseits einmal bleibenden Schaden nehmen könnte, ging vielen Menschen hier einfach nicht in den Kopf. Oder es war ihnen schietegal.
»Aber Sie sind ja auch schon fix bei der Arbeit, wie ich höre«, fuhr Coners fort. »Früh aus den Federn heute Morgen, was? Und, gibt es schon verwertbare Erkenntnisse?«
»Ja und nein«, sagte Stahnke. »Eindeutige Hinweise auf eine Bluttat, aber keine auf den Täter. Dafür auf das Opfer.«
»Ach. Wer ist es?«
»Ein Journalist.« Stahnke zögerte kurz, sah dann aber doch keinen Grund, das Vermutete für sich zu behalten. »Einer aus Oldenburg. Wir haben Dienstwagen, Brille und Schlüssel gefunden. Wagen und Brille weisen auf einen gewissen Marian Godehau hin.«
»Marian?!«
Der Schrei kam unverhofft. Stahnke starrte Coners einen Moment lang mit großen Augen an, bis ihm bewusst wurde, dass es natürlich nicht sein Kollege gewesen war, der da so schrill geschrien hatte. Sondern die junge Frau mit den Schlangenhaaren.
»Marian«, schrie sie noch einmal. »Was ist mit Marian? Was habt ihr mit ihm gemacht?« Mit einem Schmerzlaut brach sie ab. Einer der Polizisten hatte ihre gefesselten Hände hinter ihrem Rücken nach oben gerissen. Die junge Frau knickte in der Hüfte ein.
»He, lasst das«, rief Coners, ehe Stahnke reagieren konnte. »Immer schön sinnig, klar? Und Sie, junge Frau, beruhigen sich jetzt endlich. Was soll denn die ganze Schreierei, das bringt doch überhaupt nichts. Außer ein paar Stunden in der Arrestzelle. Da kommen Sie nämlich hin, wenn Sie nicht endlich Ruhe geben.«
Die Schlangenhaarige schwieg tatsächlich. Ihre grauen Augen funkelten. »Was ist mit Marian?«, fragte sie leise.
»In mein Büro«, sagte Stahnke. »Bitte.«
Die Polizisten schauten ihn erstaunt an, ehe sie sich zum Gehen wandten, die junge Frau rechts und links untergehakt. Stahnke konnte nur vermuten, dass Coners hinter seinem Rücken genickt hatte. Ihm war es recht. Auch geliehene Autorität war schließlich Autorität.
4.
»Kann man in diesen Dingern überhaupt laufen?« Stahnke zeigte auf die klobigen, schwarzen Treter, aus denen spindeldürre Beine ragten wie Streichhölzer aus Kastanien. Dicke, rote Schnürbänder hielten die viel zu weiten Schäfte halbwegs zusammen. An den Außenseiten der Schäfte prangten weiße Embleme, die handgemalt aussahen. Sie erinnerten an die »Echt Leder«-Gütesiegel. Er schaute genauer hin. »Echt Leiche« stand da.
Die junge Frau reagierte auf seine onkelhafte Gesprächseröffnung mit Schweigen und einem weiteren finsteren Blick. Die vollen Lippen blieben aufeinander gepresst, die ungezupften Augenbrauen zusammengezogen. Arme verschränkt, Beine übereinandergelegt. Abwehrhaltung wie aus dem Bilderbuch.
»Wie ist denn Ihr Name?« Vielleicht ging es ja auf die korrekte Tour besser.
»Was ist mit Marian?«, fragte sie zurück. Es klang, als spucke sie ihm die Worte auf den Schreibtisch.
»Marian Godehau, Journalist aus Oldenburg.« Stahnke vermied es, ihre Frage zu beantworten, schließlich antwortete sie ja auch nicht auf seine. Außerdem wollte er sich angewöhnen, an Marian als an einen Betroffenen in einem Fall zu denken. Schließlich musste er sich irgendwie unter Kontrolle halten. »Sein Dienstwagen steht im Hafen. Containerterminal.« Er blickte sie auffordernd an. Dabei fiel ihm Kramer ein, der so auffordernd blicken und schweigen konnte wie sonst niemand. Ob er bei den Oldenburgern schon weitergekommen war?
»Und wo ist er?« Die junge Frau strich sich die roten Haarschlangen aus dem Gesicht. Für einen Moment schien die Abwehrhaltung zu bröckeln, dann wurden die Arme wieder fest verknotet. Ihre Halskette, die eher an den zusammengefädelten Inhalt einer Krimskramsschublade erinnerte als an richtigen Schmuck, klimperte leise. Im Zentrum der bunten Kleinteile baumelte ein glänzendes Vorhängeschloss. Verschlossener ging es kaum noch.
»Gute Frage.« Stahnke neigte sich nach vorn, wobei er zum wiederholten Male zufrieden feststellte, dass sein Bauch bei dieser Bewegung die Schreibtischkante nur noch leicht touchierte, und stützte die Ellbogen auf. »Ich hatte gehofft, Sie könnten mir vielleicht etwas dazu sagen. Immerhin scheinen Sie ihn ja zu kennen.«
Ihre Kiefer mahlten, ihre Lippen zuckten. Aber noch war sie nicht zur Kooperation bereit. »Ich brauch Ihnen gar nichts sagen«, stieß sie hervor.
»Zu«, sagte Stahnke.
»Was?«
»Zu. Es heißt ›zu sagen‹. Nach ›brauchen‹ steht der erweiterte Infinitiv mit ›zu‹. Neuerdings ist diese Regel zwar etwas aufgeweicht, Rechtschreibreform und so, aber …«
Stahnke verstummte erstaunt. Sein Gegenüber hatte zu weinen begonnen.
»Ach herrje, was ist denn? Was, äh … haben Sie etwas?« Seine befangene Hilflosigkeit störte ihn mächtig. Nach all den Dienstjahren immer noch nicht wasserdicht! Peinlich, peinlich.
»Nee.« Sie wischte sich mit dem Handrücken übers Gesicht. »Es ist nur … Marian sagt das nämlich auch immer.«
»Genau.« Gegen seinen Willen musste Stahnke schmunzeln. »In Sachen Sprache kennt er keine Verwandten. Da ist er absolut pingelig. Richtig altmodisch. Sonst kann’s ja gar nicht alternativ genug sein, aber wenn es um die deutsche Sprache geht, lässt er sich von keinem Konservativen übertreffen.« Er fischte ein halbvolles Päckchen Papiertaschentücher aus seiner Schublade, reichlich verknittert und etwas angestaubt, aber noch brauchbar, und warf es der jungen Frau über den Schreibtisch hinweg zu. »Hier.«
Die Schlangenhaarige ignorierte es. Überraschung hatte den Ärger aus ihren Zügen verdrängt. »Sie kennen ihn wirklich, was? Sogar richtig gut.«
»Das will ich meinen«, bestätigte Stahnke. »Nach so vielen Jahren.«
»Wer sind Sie?« Jetzt angelte sie doch nach dem Tempopäckchen. »Wie ist Ihr Name?«
Die Fragen stelle ich, dachte Stahnke. So heißt es doch immer. Ach, drauf gepfiffen. »Stahnke«, stellte er sich vor. »Hauptkommissar Stahnke. Herr Godehau und ich …«
»Ja, ich weiß«, unterbrach die junge Frau und schnäuzte sich, ohne den Blick von ihm zu wenden. »Er hat mir so allerhand von Ihnen erzählt. Aber sind Sie sonst nicht in Leer?«
»Richtig. Zeitweise nach Emden abgeordnet. Emden gehört inzwischen organisatorisch sowieso mit zur Inspektion Leer dazu. Aber jetzt Sie. Wie heißen Sie, und woher kennen Sie Marian Godehau?«
Sie biss sich auf die Lippen, gab sich dann aber einen sichtbaren Ruck. »Ich bin Lina. Aus Oldenburg. Marian und ich, wir sind zusammen bei den ›Wächtern‹.«
Sie musterte ihn, als erwarte sie Nachfragen. Aber Stahnke nickte nur. Die »Wächter«‹ waren ihm ein Begriff. Dabei handelte es sich um so etwas wie die deutsche Variante der »Sea-Shepherds«. Eine dezentral aufgebaute Organisation mit verschwörerhaften Strukturen, die ähnliche Ziele verfolgte wie »Greenpeace«, aber weit weniger Skrupel zu haben schien. Jedenfalls ging es bei »Shepherd« oder »Wächter«-Aktionen nicht so mediengerecht märtyrerhaft zu wie bei den Regenbogenkriegern, sondern richtig ruppig. Walfänger zum Beispiel wurden nicht einfach nur behindert, sondern gerammt. Bisweilen, so hatte er zumindest mal irgendwo gelesen, sogar versenkt.
»Lina. Und wie weiter?«, fragte Stahnke stattdessen.
»Snuck«, sagte die junge Frau. »Angelina Snuck.«
Stahnke konnte nicht anders, er musste einfach losprusten. Wie sie da saß, ein kleines, knochendürres Häuflein Mensch mit diesen klumpigen Schuhen, in flatterweiten Jeans und Sweatshirt, dazu mit dieser krakenhaften, signalroten Frisur, die ihr schmales Gesicht wie mit Schlangenarmen zu umfassen schien – und dann dieser Name! Unglaublich.
Dann erinnerte er sich seines eigenen Vornamens, den er so gut wie niemals nannte, weil er ihn einfach nur peinlich fand. Und seine eigene körperliche Erscheinung war ja auch nicht gerade normgerecht, den jüngsten Verbesserungen zum Trotz. Nein, er hatte wirklich keinen Grund zu lachen. Genau genommen waren sie beide typmäßig Außenseiter. Leidensgenossen. Leiden verbindet, dachte er wieder einmal.
Wider Erwarten wurde Lina nicht wütend. Vielmehr lachte sie ebenfalls. »Ja, beknackt, nicht wahr? Aber wer kann schon etwas für seine Eltern.«
Ihr Lachen erlosch wie ausgeknipst. »So, jetzt sind Sie wieder dran. Was ist mit Marian?«
Stahnke spürte einen Stich quer durch die Brust. Fast hatte er schon verdrängt, worum es hier eigentlich ging. »Wir haben seinen Wagen gefunden, wie gesagt. Und seine Brille. Außerdem eine Blutspur. Noch wissen wir nichts Genaues.« Er schluckte. »Aber ich mache mir Sorgen.«
Ihre geweiteten Augen schienen durch ihn hindurchzublicken. »Am Hafen«, murmelte sie tonlos. »Also doch. Also doch. Ich wusste es.«
Ehe Stahnke nachhaken konnte, läutete sein Telefon. Blöd, das passte jetzt gar nicht. Aber schon hatte er im Reflex nach dem Hörer gegriffen. »Ja?«
»Kramer hier. Bin noch am Containerterminal. Die Oldenburger Kollegen haben sich über Handy bei mir gemeldet. Marian Godehau ist weder in seiner Wohnung noch auf seiner Arbeitsstelle. Derzeitiger Aufenthaltsort unbekannt.«
Stahnke drehte sich auf seinem Schreibtischstuhl herum. Die Wanduhr, die aussah, als hätte sie eigentlich gegenüber auf einem der Bahnsteige montiert werden sollen, zeigte 9.30 Uhr. »Haben die bei der ›Rundschau‹ denn überhaupt schon Dienstbeginn? Vielleicht ist er ja gerade auf dem Weg dorthin oder trinkt irgendwo einen Kaffee.«
»Wäre im Prinzip möglich. Aber nicht heute.« Natürlich hatte Kramer mal wieder an alles gedacht. »Eigentlich fängt die Reportage-Abteilung tatsächlich erst um 10 Uhr an. Für heute aber war eine Besprechung aller Ressortleiter mit der Chefredaktion angesetzt, zu der auch die Reporter gebeten worden sind. Um neun. Herr Godehau ist nicht erschienen. Hat sich auch nicht abgemeldet. Was sofort auffiel, denn Herr Godehau gilt als äußerst zuverlässig.«
»Na gut«, sagte Stahnke, »einen Versuch war’s wert. Vielen Dank auf jeden Fall.« Dann fiel ihm noch etwas ein: »Und der Wagen?«
»Den Dienstwagen meinen Sie? Der gehört der ›Rundschau‹.«
»Na klar tut der das«, knurrte Stahnke. »Aber wer ist zuletzt damit gefahren? Die ›Rundschau‹ hat eine eigene Werkstatt, da wird darüber Buch geführt, wer wann welchen Wagen fährt. Fragen Sie da mal nach.«
»Jawohl. Mach ich.« Man konnte förmlich hören, wie Kramer errötete. Dabei war Stahnke froh, dass sein Kollege mal nicht an alles gedacht hatte. Das machte ihn geradezu menschlich. Jedenfalls ein bisschen.
Das stimmte Stahnke milde, und er wechselte das Thema. »Und sonst? Wie sieht es momentan am Hafen aus? Sind die Taucher schon da?«
»Bereits im Einsatz«, sagte Kramer. »Bisher aber noch ohne Resultat. Kein Wunder bei 30 Zentimetern Sichtweite unter Wasser.«
»Nochmals danke.« Stahnke schwang sich auf seinem Drehstuhl zurück, um den Hörer aufzulegen und sich wieder seiner Gesprächspartnerin zuzuwenden.
Aber der Stuhl auf der anderen Seite seines Schreibtisches war leer.
5.
Der Schwarze schlich vorsichtig um den Container herum und achtete darauf, in Deckung zu bleiben. Nicht, dass das wirklich nötig gewesen wäre; seine Anwesenheit an diesem Ort wäre bestimmt niemandem aufgefallen. Er hatte Übung darin, nicht aufzufallen.
Die Aktivität auf dem Gelände hatte sich an die Kaimauer verlagert. Und aufs Wasser. Zwei Polizeifahrzeuge, eine schwimmende Arbeitsplattform und ein großes Schlauchboot waren im Einsatz. Gerade gingen zwei Froschmänner wieder auf Tiefe, und ein Helmtaucher machte sich zum Abstieg bereit. Lächerlich sahen sie aus in ihrem Aufzug, lächerlich und doch vertraut. Bisher hatten sie allesamt noch nichts entdeckt.
Sie würden auch nichts entdecken, jedenfalls nicht das, wonach sie suchten. Das wusste er genau.
Ein schmaler, drahtig wirkender Mann stand am Wasser, so dicht, dass seine Schuhspitzen über die eisenbewehrte Kante ragten, und ließ die Taucher und ihre Helfer nicht aus den Augen. Er schien die Aktion zu leiten. Ein energischer, gewissenhafter, sehr verlässlicher Mann, das spürte der Schwarze genau. Aber nur der Stellvertreter des eigentlichen Leiters, dieses großen, etwas chaotischen, intuitiv agierenden Kerls, der vor einiger Zeit das Gelände verlassen hatte. Das konnte er unbesorgt, denn der Schmale war ein guter Stellvertreter.
Der Schwarze fühlte eine gewisse Verbundenheit. Schließlich war er ja selber auch eine Art Stellvertreter. Auch er bemühte sich, seinen Job immer möglichst gewissenhaft zu erledigen. Wobei Gewissen eigentlich kein Begriff war, den er auf sich beziehen würde. Aber solche Spitzfindigkeiten waren nicht seine Sache.
Auch letzte Nacht hatte er seinen Job sehr gewissenhaft erledigt. Zur vollsten Zufriedenheit. Das hatte er jedenfalls angenommen. Bis sich dann herausstellte, dass er eine Kleinigkeit übersehen hatte. Es waren immer Kleinigkeiten. Konnte es nicht einmal genügen, dass etwas im Großen und Ganzen korrekt gelaufen war? Offenbar nicht.
Er stellte fest, dass er leise vor sich hin knurrte, und rief sich zur Ordnung. Bloß nicht doch noch auffallen. Das hätte nun wirklich gerade noch gefehlt.
Der eigentliche Fehler war hier und jetzt ohnehin nicht mehr zu beheben. Die Brille war weg, so viel stand fest. Sie hatten sie gefunden. Ärgerlich. Also würde er die Sache anders regeln müssen, um seinen kleinen Fehler auszubügeln.
Bügeln! Der Gedanke erheiterte ihn. Lustige Metapher.
Unbemerkt machte er sich aus dem Staub.
6.
Stahnke saß an seinem Schreibtisch im Polizeihauptgebäude der Stadt, in der er geboren war, und hatte Heimweh. Heimweh nach Leer. Genauer gesagt nach seinem Büro in der Polizeiinspektion an der Georgstraße. Nach seinem kleinen, stickigen, im Sommer backofenheißen Büro mit Aussicht auf die Lagerhalle einer Installationsfirma. Wie oft hatte er dieses Büro schon verflucht! Aber es hatte einen Vorteil, einen ebenso anachronistischen wie unschätzbaren Vorteil: Es gehörte ihm allein.
Natürlich waren Einzelbüros im Zeitalter des Teamworks nicht mehr angesagt. Natürlich war es leichter, sich abzusprechen, Informationen auszutauschen oder spontane Brainstormings zu veranstalten, wenn man sowieso im selben Raum hockte. Mit diesem Argument hatte Kriminaldirektor Manninga ihn und Kramer schon mehrmals umsiedeln wollen. Aber Stahnke hatte sich stets mit Zähnen und Klauen gewehrt. Erfolgreich, schließlich konnten sie durch ihre Ermittlungserfolge nachweisen, dass sie auch dann als Team funktionierten, wenn sie in getrennten Zimmern saßen.
Außerdem gab es ja eine Zwischentür, die fast immer offen stand. Das hatte Stahnke als formales Hauptargument ins Feld geführt. Teufel, was hatte Manninga böse geguckt. Aber er war schweigend gegangen, und alles war beim Alten geblieben.
In Emden aber war alles anders. Hier hatte man ihnen einfach Plätze zugewiesen, zwei Schreibtische in einem Dreier-Büro. Verweise auf alte Gewohnheiten hatten nur Achselzucken zur Folge gehabt. Platz war knapp, freie Räume gab es nicht, also bitte.
Da hockten sie jetzt. Sie beide und der neue Dritte ihres neuen Teams. Kriminalkommissar Schmitz.
Dieter Schmitz sah aus, als hätte ihn jemand aufgepumpt. Sein Poloshirt Größe XXL konnte die Massen seiner schwellenden Schultern und Oberarme, seiner gut isolierten und gepolsterten Brust-, Rücken- und Bauchmuskulatur kaum bändigen. Auch die blau marmorierten Jeans machten den Eindruck, als sollten sie jeden Moment von Schmitz’ Oberschenkeln und Hinterbacken gesprengt werden. Ganz oben auf diesem Schwerathletenkörper thronte ein pausbäckiges Babygesicht, gekrönt von einer blonden Frisur der Marke Topfschnitt. Allerdings musste der Friseur einen sehr kleinen Topf für seinen Rundschnitt verwendet haben, denn die verbliebene, steil aufwärts gegelte kleine Haarinsel oberhalb der kahlrasierten Flanken bedeckte kaum das Schädeldach.
Um seine Massen in Form zu halten, futterte Schmitz fast pausenlos. Brötchen, Schokolade, Gummibärchen, Energieriegel und Kekse verschwanden in automatenhafter Regelmäßigkeit zwischen seinen stetig mahlenden Kiefern. Erstaunlich, dass Schmitz trotzdem in der Lage war, Akten zu bearbeiten und Telefongespräche zu führen. Das Essen ging bei ihm einfach nebenbei – wie bei anderen Menschen das Atmen.
Mit einem kleinen Unterschied allerdings: Es ging nicht lautlos vonstatten. Schmitz schmatzte.
Er selbst schien das gar nicht zu merken. Oder es war ihm wurscht. Gerade hatte er wieder einmal eine Tüte Haribo aufgerissen und sich zwei Stückchen Lakritz mit farbiger Zuckerpaste in den Mund geschoben. Kraftvoll und routiniert zermalmten seine gut trainierten Kiefer die schwarzbunten Süßigkeiten, pressten und mahlten das Zeug in einer abgeflachten Kreisbewegung, lösten sich dann wieder voneinander, um neu anzusetzen. Dabei verloren die Lippen den wechselseitigen Kontakt. Und da war es wieder.
Schmitz bemerkte Stahnkes Blick, missverstand ihn jedoch. Auffordernd hob er das Tütchen mit fleischiger Pranke hoch, rundete fragend die Augenbrauen und stieß einen Laut hervor, der mit etwas Fantasie als »Auch eins?« gedeutet werden konnte. Weitere Schmatzlaute untermalten das höfliche Angebot.
»Ach nein, danke«, erwiderte Stahnke. Mit großer Mühe schüttelte er die Lähmung ab, die ihn befallen hatte. War das so etwas wie ein Schock, ausgelöst durch den Verlust, den Marians Verschwinden bedeutete?
Er sollte hier nicht herumsitzen, er sollte etwas tun. Irgendetwas.
»Ich hol mir lieber einen Kaffee.« Fluchtartig verließ er den Raum.
Der Kaffeeautomat gurgelte und zischte. Als die bräunliche Brühe endlich in den Plastikbecher schäumte, glaubte der Hauptkommissar sogar, einen Schmatzlaut vernommen zu haben. Einen einzelnen. Aber einer Maschine nahm er das nicht krumm. Die konnte ja nichts dafür.
Das brachte ihn wieder auf diese Angelina Snuck. Dass er für deren außerplanmäßigen Abgang nichts gekonnt hätte, ließ sich beim besten Willen nicht behaupten. Natürlich war er sofort bei Conny Coners vorstellig geworden, und Coners hatte durchaus die Ruhe bewahrt. Hatte sich sogar für die Mitteilung des Namens und des mutmaßlichen Wohnorts der flüchtigen Person bedankt: »Wenigstens etwas, damit kommen wir bestimmt weiter.« Immerhin ging es um massive Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt, das konnte man nicht so einfach auf sich beruhen lassen.
Die Art, wie Coners ihn gemustert hatte, war aber alles andere als schmeichelhaft gewesen. Stahnke musste jetzt zur Abwechslung unbedingt einmal etwas Vernünftiges zustande bringen, und das möglichst bald. Sonst war er hier unten durch, ehe er überhaupt richtig angefangen hatte.
Den heißen Kaffeebecher zwischen spitzen Fingern, schlurfte er den Gang entlang. Um sich abzulenken, warf er einen Blick in die »Ostfriesen-Zeitung«, die aufgeschlagen auf einem Besucherstuhl lag. Regelmäßige Medienbeobachtung gehörte schließlich zu seinem Berufsbild. Morgen würde er im Regionalteil auch etwas über den Vorfall im Hafen lesen können. Noch hatte keiner der örtlichen Journalisten bei ihm angerufen. Vermutlich hatte ihn noch keiner auf der Rechnung. Schließlich war Kollege Heinemann, der etatmäßige Leiter des Ersten Emder Kriminalkommissariats, noch nicht lange schwer erkrankt, und sein Stellvertreter Gautier war erst kurz zuvor auf eigenen Wunsch nach Hessen versetzt worden. So war Stahnke mit seinen gut 50 Lenzen jetzt »der Neue« – zum ersten Mal seit Jahrzehnten.
Er überflog den regionalen Aufmacher. »Mysteriöse Wolke über Ostfriesland«, davon hatte er schon im Radio gehört. Irgendetwas Unsichtbares, aber mächtig Ausgedehntes war da vor einiger Zeit im Luftraum geortet worden, aber nicht gesichtet. Jetzt wurde gerätselt, worum es sich handeln konnte. Von militärischen Experimenten, meteorologischen Phänomenen oder umweltschädlichen Gasen war die Rede. Klang nach haltlosen Mutmaßungen. Stahnke tippte auf Sommerloch.
Wo Kramer nur blieb? Von dem waren wenigstens Informationen zu erwarten, wenn schon keine Ergebnisse. Aber der hielt nach wie vor am Hafen die Stellung und ließ ihn hier allein. Allein mit dem schmatzenden Schmitz.
Schmatzeschmitz. Ha! Stahnke musste grinsen. Fiese Spitznamen waren eine billige Rache. Aber besser als nichts.
Er schlürfte seinen heißen Kaffee und stellte fest, dass er immer noch auf dem Gang stand. Alles in ihm sträubte sich, in das ungeliebte Gemeinschaftsbüro zurückzukehren. Aber was gab es im Augenblick zu tun, das ihn mit Fug und Recht von seinem Schreibtisch fernhalten konnte? Wieder raus zum Containerterminal fahren? Sinnlos, Kramer hatte dort alles im Griff. Sein Kollege würde es bestimmt als Misstrauensvotum ansehen, wenn er jetzt grundlos dort auftauchte. Oder, noch schlimmer: Er würde ihn sofort durchschauen. Planlose Pseudoaktivität, nur dazu geeignet, eine trügerische, vielleicht widersinnige Hoffnung zu nähren. Nämlich die, dass Marian Godehau doch noch lebte, allen gegenteiligen Indizien zum Trotz.
Der Becher war schon halb leer. Oder noch halb voll? Nein, eher halb leer, das passte besser zu seiner Stimmung.
Dann aber fiel ihm doch noch etwas ein. Was hatte diese Angelina Snuck, diese schlangenhaarige Lina, noch gesagt, unmittelbar ehe das Telefon klingelte und sie sich kurz darauf auf Französisch verabschiedete? »Am Hafen« hatte sie gesagt, und dann: »Also doch.« Als habe sich eine böse Vorahnung bestätigt. Hm. Was sagte ihm das?
Vorerst noch nichts. Aber es brachte ihn auf etwas anderes. Kettenglieder, immer eins am anderen hängend. Zusammenhang. Sinnlose Kettenglieder gab es nicht, auch wenn das nicht immer gleich auf den ersten Blick klar wurde.
Marian war dienstlich im Emder Hafen gewesen, hatte offenbar eine Vermutung gehabt, der er nachgegangen war. Marian war Journalist, einer von der Sorte, die nicht auf billige Sensatiönchen und schlüpfrige Schlagzeilen aus war, sondern auf Enthüllungen. Ein Robin Hood im Blätterwald, sozusagen. Zudem war er nicht nur als sehr zuverlässig und sprachbeflissen bekannt, sondern auch als sehr pingelig. Er pflegte alles Wichtige aufzuzeichnen und seine Aufzeichnungen aufzuheben. Für Folgestorys und für alle Fälle. Und zwar nicht zu Hause, sondern an seinem Arbeitsplatz.
Das war’s doch.
Stahnke leerte den Plastikbecher und warf ihn schwungvoll in den nächsten Papierkorb, wo er eigentlich nichts zu suchen hatte. Marian hätte das sicher nicht gefallen.
Das Klingeln seines eigenen Telefons stoppte ihn, als er gerade an der offen stehenden Tür des Großraumbüros vorbei flüchten wollte. Schmitz wies mit beiden Zeigefingern auf den lärmenden Apparat, stumm, die Backentaschen geschwollen. Stahnke grapschte nach dem Hörer.
»Kramer hier. Sie hatten recht. Der fragliche ›Rundschau‹-Dienstwagen wurde gestern Nachmittag von Marian Godehau telefonisch bestellt und um 18 Uhr abgeholt. Per Unterschrift quittiert, wie üblich. Tja.«
»Tja.« Stahnke stand einen Augenblick lang nur da, den Blick an Schmitz’ mahlenden Unterkiefer geheftet. Eine unverbindliche Bemerkung wollte ihm nicht einfallen, eine verbindliche schon gar nicht. Schließlich hatte sich ja nichts geändert. Geahnt hatte er es sowieso, bewiesen war nach wie vor nichts. Also weiter wie gehabt.
Dann schnippte er mit den Fingern seiner freien Hand. »Wir sollten uns jetzt mal um die Schlüssel kümmern. Erst Fingerabdrücke abnehmen, falls welche drauf sind, dann ab dafür nach Oldenburg und checken, zu welchen Schlössern die Dinger gehören.« Als ob die Identität des Verschwundenen nicht schon klar genug gewesen wäre.
Eigentlich könnte er das Bund ja auch selber mitnehmen, fiel ihm ein. Falls das mit den Fingerabdrücken nicht zu lange dauern sollte. Das wollte er sagen, aber Kramer kam ihm zuvor.
»Schon erledigt. Das Schlüsselbund ist bereits unterwegs. Per Kurier.«
»Danke.« Stahnke legte auf.
Kramer war also doch noch der alte Perfektionist, gelegentlichen menschlichen Anwandlungen zum Trotz. Beruhigend.
»Ich muss los«, rief Stahnke seinem neuen Kollegen zu. »Nach Oldenburg. Recherche wegen Godehau.« Er winkte kurz und wandte sich ab, um seinen erleichterten Gesichtsausdruck verborgen zu halten.
Schmitz antwortete etwas, aber das konnte der Hauptkommissar nicht verstehen. Nur ein herzhaftes Schmatzen war zu identifizieren.
7.
Die »Regionale Rundschau« hatte früher anders geheißen, erinnerte sich Stahnke. Ein bürgerlich-konservatives Blatt aber war sie schon immer gewesen. Ein Abbild der Geisteshaltung ihrer Besitzer eben, die viel Wert darauf legten, alle Leitungsfunktionen mit Gleichgesinnten zu besetzen, um Überraschungen in der Berichterstattung bestmöglich vorzubeugen. Das nannte sich dann Pressefreiheit. Was die subalternen Positionen anging, war man etwas großzügiger, offenbar aus der Überzeugung heraus, dass die abweichenden Ansichten einzelner Redakteure ohne Richtlinienkompetenz auf Dauer keinen Schaden anrichten konnten, solange nur die Hauptrichtung stimmte. So kam es, dass auch ein Marian Godehau für diese Zeitung arbeitete.
Oder gearbeitet hatte?
Stahnke versuchte, sich aufs Autofahren zu konzentrieren. Auf der Ofener Straße ging es nur stockend voran, und je näher er dem Pferdemarkt kam, desto dichter wurde der Verkehr. Er ärgerte sich, diesmal nicht in Wechloy abgefahren zu sein und die Alternativstrecke genommen zu haben. Aber die blieb ihm ja noch für die Rückfahrt. Wenigstens fand er auf Anhieb einen Parkplatz, fast genau vor dem Pressehaus. Zwar nur ein Kurzzeitplatz, aber allzu lange gedachte er sich ja ohnehin nicht aufzuhalten.
Die Eingangshalle war umgestaltet worden, seit er vor Jahren dienstlich hier gewesen war; jetzt war es nicht mehr so leicht, am Pförtner vorbei zu den Fahrstühlen zu stürmen, wie es eine Gruppe autonomer Jugendlicher vor Jahren einmal gemacht hatte, um die Monopolzeitung zu zwingen, auch andere Ansichten zu veröffentlichen als die ihres Verlegers und seiner Meinungs-Klone. Stundenlang hatten sie die Nachrichtenzentrale besetzt und das Blatt damit von allen überregionalen Meldungen abgeschnitten, ehe ein mobiles Einsatzkommando die Tür aufgebrochen und dem Spuk ein Ende bereitet hatte. Marian hatte es damals empörend gefunden, dass die »Rundschau« nicht einmal über den Vorfall berichtet hatte. Angeblich, um keine Nachahmungstäter zu produzieren. Vor allem aber ging es wohl auch darum, zu zeigen, wer am längeren Hebel saß.
In anderen Zusammenhängen war natürlich durchaus über die Autonomen geschrieben worden. Nämlich immer dann, wenn es ins vorgefertigte Bild passte. Einmal hieß es, Mitglieder dieser Gruppe hätten bei einer Demo die Polizei mit Stahlkugeln aus Schleudern beschossen. Allerdings hatte sich der Berichterstatter vertippt, und so wurden »Stuhlkugeln« daraus. Darüber lachten die Leute heute noch.
Der Pförtner ließ Stahnke anstandslos durch, nachdem der sich ausgewiesen hatte; Polizisten schienen hier keine ungewohnten Gäste zu sein. Im vierten Stock empfing ihn eine Sekretärin. Ein bekanntes Gesicht, aber natürlich fiel ihm der Name nicht ein. »Guten Tag, Frau, äh, mein Name ist …«
Die kleine Frau grinste spitzbübisch. »Stahnke, ich weiß. Schließlich bin ich schon länger hier als die Teppichböden, und das will etwas heißen! Nennen Sie mich ruhig Fräulein Trudel, das tun hier alle.«
Marian Godehaus Ressortleiter ließ sich nicht blicken. Ihn hatte Stahnke schon von unterwegs angerufen, und er hatte seine Zustimmung gegeben. Nach einigem Zögern und mit von »schwersten Bedenken« geschwängerter Stimme. Aber die »Rundschau« hatte sich erst letzte Woche für eine Ausweitung der Kompetenzen der Polizei »angesichts der näher rückenden Bedrohung durch den internationalen Terror« ausgesprochen. Stahnkes zarter Hinweis auf einen möglichen Widerspruch zwischen Reden und Handeln hatte den letzten Widerstand des Ressortleiters gebrochen.
Woran Marian zuletzt gearbeitet hatte, konnte sein direkter Vorgesetzter erstaunlicherweise nicht sagen. »Er schreibt wohl an einer Serie über regionale Motorradklubs. Ansonsten …« Das Achselzucken war förmlich zu hören. Vom kurzen Führzügel hielt dieser Chef offenbar nichts.
Marians Büro war großzügiger, als Stahnke es in Erinnerung hatte. Vermutlich war es auch nicht mehr dasselbe wie vor Jahren. Man hatte Marian Godehau, der seine Ausbildung einst hier absolviert hatte und nach einem kurzen Intermezzo in Ostfriesland hierher zurückgekehrt war, seither zwar nicht zum Redaktionsleiter oder gar Ressortchef befördert, aber er schien in der internen Rangfolge deutlich aufgerückt zu sein.
Und, vor allem, es war ein Einzelbüro. Auch im Zeitungsgewerbe eine Ausnahme im Zeitalter der Großraumvolieren für dienstbar gemachte bunte Vögel. Geradezu ein Statussymbol. Stahnke spürte Neid – und ein absurdes Bedauern darüber, dass er Marian Godehau nicht beerben konnte. Er hasste es, wenn ihn solche Gedanken heimsuchten.
Der Schreibtisch war unverschlossen. Aus den Schubladen quollen ihm vergilbte, eng und kaum leserlich bekritzelte Notizblöcke entgegen. Ein Ordnungsschema war, zumindest auf den ersten Blick, nicht erkennbar. Stahnke stöhnte entsetzt auf.
»Was suchen Sie denn?«, fragte Fräulein Trudel.
»Irgendwelche Hinweise darauf, mit welchen Themen sich Herr Godehau in letzter Zeit befasst hat«, antwortete der Hauptkommissar. »Oder was er für die nähere Zukunft so auf dem Plan gehabt hat.«
»Gehabt?« Die Frau kniff misstrauisch die Augen zusammen. »Sie sagten, Marian würde vermisst. Stimmt das, oder verheimlichen Sie etwas?«
»Er wird vermisst. Genau das ist der Stand der Dinge.« Er zögerte kurz, dann fügte er hinzu: »Ich wüsste selber gern mehr, das können Sie mir glauben. Deshalb bin ich ja hier. Vielleicht gibt es hier etwas, das uns weiterbringt.«
Marian schien wirklich überall beliebt zu sein. Was Stahnke von sich selber nicht behaupten konnte. Diesmal aber konnte er jedes Neidgefühl unterdrücken. In diesem Punkt war die Schuldfrage wohl eindeutig.
Fräulein Trudel musterte ihn noch einen Moment lang, dann nickte sie. »Okay. Dann suchen Sie mal. Aber nicht in den Schubladen. All das Zeug da ist Jahre alt. Marian legt längst alles im Computer ab. Den Papierkram wirft er bloß aus lauter Nostalgie nicht weg.«
Stahnke lächelte sie dankbar an. »Da hätte ich ja lange wühlen können.«
Der PC sah recht neu aus, der Monitor war von beeindruckender Größe. Marian hatte mal etwas von »Bildschirmumbruch« erzählt, erinnerte sich Stahnke. Eine kostspielige Neuerung, die Redakteuren Mehrarbeit verschaffte, dafür aber eine komplette andere Berufssparte überflüssig machte und sich daher für den Verlag ausgezeichnet rechnete. Marian als einer der wenigen reinen Reporter hatte damit zwar kaum zu tun, die entsprechende Ausrüstung aber, eingekauft en gros, hatte man auch ihm hingestellt.
Der Hauptkommissar drückte auf den Powerknopf. Der Computer begann brummend hochzufahren.
»Eigentlich soll ich ja bei Ihnen bleiben, falls Sie noch etwas brauchen«, sagte Fräulein Trudel. »In Wirklichkeit soll ich Ihnen natürlich auf die Finger schauen. Um die Pressefreiheit vor Ihnen zu schützen.« Ihre wegwerfende Handbewegung sprach Bände. »Andererseits habe ich noch eine Menge zu tun.« Es klang bedauernd. »Also, wenn Sie mich noch brauchen, mein Zimmer ist gleich da vorne, kurz vor den Klos.« Sie ließ ihn allein.
Erstaunlich, dachte Stahnke. In dieser Redaktion schien man andere, weit wichtigere Sorgen zu haben als die Pressefreiheit. Vielleicht, weil man zu genau wusste, wie es hier um sie stand. Wie auch immer, ihm konnte es recht sein.
Zahlenkolonnen flitzten über den großen Bildschirm, unverständliche Abkürzungen, dann Wortfolgen, die Stahnke ebenfalls nichts sagten. Was, wenn er es hier mit Programmen zu tun bekam, die ihm ebenso fremd waren? Allzu lange hatte er sich gegen die Neuerungen des Computerzeitalters gesperrt. Inzwischen hatte er zwar notgedrungen einiges nachgeholt, beherrschte die unverzichtbaren Benutzergrundlagen, aber so wie es komplizierter wurde, fühlte er sich furchtbar hilflos.
Als das Windows-Emblem erschien, war er erleichtert. Wenigstens arbeiteten auch die Computer der »Rundschau« mit dem vertrauten Basisprogramm. Also durfte er hoffen.
Das Nächste aber, was ihm der Bildschirm zeigte, ließ seine Zuversicht wieder sinken. Nämlich eine Eingabeaufforderung: »Benutzername« und »Passwort«. Ach herrje, passwortgeschützt! Hatte Marian Godehau etwa kein Vertrauen in seine Kollegen? Wollte er womöglich eventuelle polizeiliche Nachforschungen erschweren? Dann hatte er bestimmt nicht geahnt, worum es dabei gehen würde.
Vermutlich weder noch, entschied Stahnke. Marians Computer war schlicht und einfach Teil eines Netzwerks, da waren Passwörter eine ganz normale Vorsichtsmaßnahme. Behörden wie die Polizei hatten so etwas ja schließlich auch. Allgemeine Passwörter, mit denen man Zugang zu bestimmten Speicherplätzen bekam, und personalisierte, die man benötigte, um an die interessanteren Dinge heranzukommen. Ein allgemeiner Benutzername konnte hier zum Beispiel »Redaktion« sein. Vielleicht war dieses Wort sogar allgemeiner Benutzername und allgemeines Passwort zugleich. Aber was nützte ihm das? Am Hafenbericht oder an den Meldungen der samstäglichen Landwirtschaftsseite war er nicht interessiert. Was er wollte, waren Marian Godehaus Aufzeichnungen für den höchsteigenen Gebrauch. Und um dort heranzukommen, benötigte er auch dessen persönliches Passwort.
Er durchstöberte die bunten Ablagekörbe, die Stiftschale und den alten Becher mit Büroklammern und sonstigem Kleinkram, schaute noch einmal in alle Schubladen und unter die Schreibunterlage. Keine entsprechende Notiz, kein Merkzettel, nichts.
Ob Marian das Passwort etwa auf einem der vielen Spiralblöcke notiert hatte? Irgendwo zwischen längst veralteten Notizen, an einer Stelle, die nur er finden konnte? Dann gute Nacht.