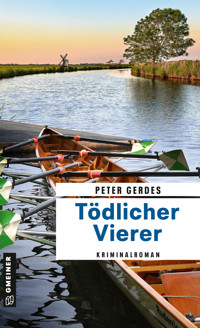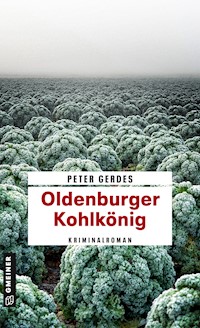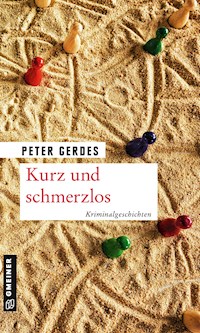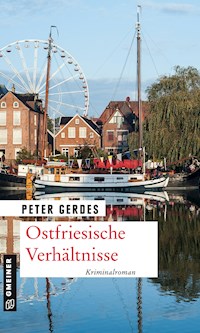Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Stahnke
- Sprache: Deutsch
Aufwachen am Inselstrand - idyllisch? Eigentlich schon, auf Langeoog. Aber aufwachen mit Blut an den Händen, nicht wissen, wer man ist, woher man kommt und was man getan hat? Das sieht böse aus. Was tun? Suchen. Nach dem eigenen Namen, ein paar trockenen Sachen, nach etwas zu essen und nach dem Koffer - denn irgendwo muss doch ein Koffer sein, in einem Zimmer, das man ja gebucht haben muss. Und während der eine sich selbst sucht, vermisst der Chorleiter seine junge Solistin, Ulfert Janssen Tant' Lütis Testament und Stahnke, tja - Hauptkommissar Stahnke sucht seine Badehose.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Gerdes
Solo für Sopran
Langeoogkrimi
Zum Autor
Peter Gerdes, geb. 1955, lebt in Leer (Ostfriesland). Studierte Germanistik und Anglistik, arbeitete als Journalist und Lehrer. Schreibt seit 1995 Krimis und betätigt sich als Herausgeber. Seit 1999 Leiter des Festivals »Ostfriesische Krimitage«. Die Krimis »Der Etappenmörder«, »Fürchte die Dunkelheit« und »Der siebte Schlüssel« wurden für den Literaturpreis »Das neue Buch« nominiert. Gerdes betreibt mit seiner Frau Heike das »Tatort Taraxacum« (Krimi-Buchhandlung, Veranstaltungen, Café und Weinstube) in Leer.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
(Originalausgabe erschienen 2005 im Leda-Verlag)
Herstellung: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: Katrin Lahmer
unter Verwendung eines Fotos von: © Olaf Schlenger / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6468-3
1.
Wuchtig rollte es heran, krachend schlug es zu, schleifend und saugend zog es sich zurück. Er schnappte nach Luft.
Das stetig dröhnende Donnern der Brandung hatte seinen Kopf rhythmisch durchrauscht, seit er sich auf dieser Insel befand, Woge um Woge, Tag und Nacht. Was aber jetzt in seinem Kopf rauschte, war nicht die See, sondern der Schmerz, der ihn immer wieder aufs Neue ansprang und schüttelte und ihn zurück unter die Oberfläche zu drücken versuchte. Welle um Welle. Mühsam hielt er stand, während er so viel kühle Nordseeluft wie möglich durch seine rasselnden Bronchien presste. Die Schmerzen tosten, tauchten ihn aber nicht unter, spülten ihn nicht davon. Fürs Erste blieb er bei Bewusstsein.
Vorsichtig stemmte er sich hoch, stolperte mit kurzen, schlurfenden Schritten über den festen Sand in Richtung Spülsaum, bückte sich, was das inwendige Rauschen gefährlich anschwellen ließ und einen heftigen Anfall von Übelkeit auslöste, und tauchte schließlich seine Hände in den prickelnden Schaum des nächsten Brandungswellenausläufers. Breite, dicke Hände mit kurzen, dicken Fingern. Sie zitterten. Das Blut, das an ihnen haftete, war bereits getrocknet, und er musste kräftig rubbeln, um die Krusten zu lösen.
Auch seine Füße waren breit und dick, stellte er fest. Und sie waren nackt, wie auch seine Beine, die gänsehäutig und stachelhaarig aus kurzen, weiten Hosen ragten. Merkwürdig, dachte er, wieso habe ich nackte Beine? Er konnte sich überhaupt nicht erinnern, schwimmen gegangen zu sein.
Dann fiel ihm auf, dass er sich an gar nichts erinnern konnte. An überhaupt nichts. Null.
Im ersten Moment erheiterte ihn dieser Gedanke. Wie, an nichts erinnern! Das gab es vielleicht im Kino, vorzugsweise in Hollywoodschinken, wo sich hübsche junge Amnesierte in höchst fotogener Weise auf die Suche nach dem verschollenen Ich und seinem meist ebenso attraktiven Gegenstück vom anderen Geschlecht machten. Aber doch nicht … hier. Und doch vor allem nicht er.
Nur: Wo war »hier«? Und wer er?
Als er spürte, dass er mit diesen Fragen ins Dunkle stocherte wie mit einem Blindenstock, schwoll das Rauschen in seinem Kopf wieder zu einem Tosen an. Sitzend fand er sich wieder, auf dem Hosenboden im Sand, dessen Feuchtigkeit unangenehm kalt durch seine Badehose drang. Badehose? Nein, das waren Boxershorts, weite, blau-weiß gestreifte, vorne geknöpfte Boxershorts. Oben herum trug er nichts als ein Unterhemd, Feinripp weiß. Himmel, in welchem Aufzug lief er hier herum?
Wer – er? Und wo?
Moment mal, einen Moment mal. Beschwichtigend klappte er seine dicken Hände hoch und richtete die Handflächen nach vorne, als wollte er die unaufhörlich anrollende Brandung zum Innehalten auffordern. Vielleicht galt die Geste auch den Schmerzwellen in seinem Kopf – vergebens war sie in beiderlei Hinsicht. Immerhin aber half sie ihm, seine wild und schäumend flutenden Gedanken zu kanalisieren.
Dies hier war eine Insel, so viel wusste er. Und dass er hier nicht lebte, sondern nur zu Gast war, wusste er auch. Zu Besuch war er hier. Aber bei wem?
Wirklich zu Besuch? Aber warum war ihm dieser Ort dann so vertraut? Und wenn ihm diese Insel vertraut war, warum wusste er dann ihren Namen nicht?
Er versuchte es anders herum. Sein eigener Name? Nichts, gar nichts. Sein Alter? Er schaute an sich herab, musterte seine kräftigen Gliedmaßen und seinen noch weit kräftigeren Bauch, erspähte ergraute Brusthaare im Ausschnitt seines Unterhemds, fuhr sich mit den Händen über den pochenden Schädel, ertastete eine recht weit entwickelte Stirnglatze, einen kurz gestutzten Haarkranz und eine kräftige, äußerst druckempfindliche Schwellung über dem linken Ohr. Der Jüngste war er nicht mehr, eindeutig. Irgendwas zwischen fünfzig und sechzig. Und angeschlagen, in des Wortes wörtlicher Bedeutung.
Aber wo waren sie hin, diese fünfzig oder sechzig Jahre? In seinem Gedächtnis waren sie jedenfalls nicht.
In seinem Gedächtnis waren ja nicht einmal die letzten fünf oder sechs Stunden. Alles wie ausgelöscht. Auf einen Schlag.
Ein Schlag?
Plötzlich bemerkte er, dass ihm kalt war. Saukalt sogar. Nicht nur seine Hände zitterten, nein, er bebte am ganzen Körper. So, als hätte er die ganze Nacht im Freien verbracht, nur mit Unterwäsche bekleidet.
Welche Tageszeit war eigentlich gerade? Automatisch blickte er auf sein linkes Handgelenk: Keine Uhr, nichts, nur ein dicker Arm samt dazu passender Hand. Den Unterarm zierten ein paar rotblaue Flecken, die sich frisch anfühlten, sowie eine verwaschen aussehende Tätowierung, dunkelblau, irgendetwas Rundes, Ausgefranstes. Keine Idee, was das sein konnte, jedenfalls keine Uhr.
Er blickte hoch, sah in einen blauen, fast wolkenlosen Himmel, ohne zu blinzeln, spürte einen Anflug von Wärme hinter dem rechten Ohr und auf dem rechten Schulterblatt. All das schien auf den frühen Morgen hinzudeuten. Warum? Er wusste es nicht.
Was konnte geschehen sein? War er ein Frühaufsteher, ein Frühsportler, der sich beim Strandlauf übernommen und einen Blackout gehabt hatte? Nein, das passte nicht zu ihm, da war er sich sicher, wer immer er auch sein mochte. Außerdem trug er kein Sportzeug, sondern Unterwäsche. Und nirgendwo um ihn herum lagen andere Kleidungsstücke. Zum Glück war auch kein anderer Mensch in Sichtweite. Nichts als Meer, Strand und Dünen. Und das rote Dach eines eckigen weißen Turms, der die Dünen überragte.
Moment, was war das gerade gewesen?
Wieder klappte er seine Hände hoch, machte die Geste des Beschwichtigens, des Abstoppens. Hitzewellen jagten durch seinen vor Kälte bebenden Körper. Welcher seiner Gedanken hatte das ausgelöst? Meer, Strand? Nein. Düne? Auch nicht.
Rotes Dach?
Rot?
»Rot«, murmelte er und erschrak vor seiner eigenen, unerwartet hell und krächzend klingenden Stimme. »Blut.« Die Ränder der abgewaschenen Krusten waren noch gut zu erkennen. Was für Blut war das? Wessen Blut?
Erneut musterte er seinen Körper, fuhr sich mit den Handflächen über Kopf, Nacken und Schultern. Ohne Ergebnis.
Sein eigenes Blut war das jedenfalls nicht.
2.
Heiden hielt im Laufen inne, schüttelte seine Beine aus, deutete ein paar Dehnübungen an und tupfte sich mit dem Handtuch, das er elegant um seinen Nacken geschlungen trug, den dünnen Schweißfilm von der Stirn. Er liebte Bewegung am frühen Morgen, vor allem nach kurzen, unruhigen Nächten. Und hier auf der Insel, an einem herrlichen frühherbstlichen Morgen wie diesem, bereitete ihm sein Standardprogramm, kombiniert aus kräftezehrendem Strandlauf und dem kaum weniger anspruchsvollen Auf und Ab der Höhenpromenade, doppeltes Vergnügen. Einen Heidenspaß sozusagen.
Selbstzufrieden lächelte er über das kleine Wortspiel, das er schon hundertfach aus Schülermündern vernommen hatte. Ihm machte es nichts aus, wenn mit seinem Namen gewitzelt wurde, im Gegenteil. Sein Name war schließlich Teil seiner Persönlichkeit, und jede Aufmerksamkeit, die diesem Namen zuteil wurde, wurde auch ihm zuteil. Das war wichtig für Leopold Heiden.
Das Rauschen der Brandung schien ihm heute früh besonders intensiv, und er tänzelte ein wenig auf der Stelle, um die Promenade, die von diesem Punkt aus einen herrlichen Blick über Strand, Sandbänke und Nordsee bot, noch nicht gleich wieder in Richtung Hotel verlassen zu müssen. Was für ein Klang! So gleichmäßig und doch niemals monoton, so unterschwellig und dabei doch so präsent. Ob man eine Symphonie für Brandung und Chor komponieren konnte? Heiden lächelte. Solche spontanen Einfälle liebte er an sich. Nicht, dass er diesen etwa umzusetzen gedachte; dafür gab es im Augenblick zu viel anderes zu tun. Dinge, die ihm genügend Aufmerksamkeit verschaffen würden. Die Sache mit der Brandung konnte er ja für spätere Gelegenheiten in der Hinterhand behalten.
Hatte sich da unten am Strand gerade etwas bewegt?
Heiden kniff die Augen zusammen; seine Sehkraft hatte in jüngster Zeit etwas nachgelassen, aber eine Brille verweigerte er sich. Schließlich arbeitete er hart an seiner äußeren Erscheinung und das mit einigem Erfolg, wie er fand, da wäre eine sichtbare Sehhilfe mehr als nur ein Rückschlag gewesen. Geradezu ein Stilbruch. Ausgeschlossen. Außerdem sah er auch ohne Brille noch gut genug, um zu erkennen, dass die Gestalt dort unten ein Mann war, ein älterer offensichtlich und dick dazu, ein Mann also, der sich weit weniger gut gehalten hatte als er selbst. Vor allem aber handelte es sich ganz eindeutig nicht um ein Mitglied seines Chores, und darauf kam es ihm an.
Seine Schäfchen, für die er eher unwillig die Verantwortung trug, wohnten nämlich über den halben Ort verteilt. Selbst jetzt, in der Nachsaison, war es nicht möglich gewesen, alle fünfundsechzig Mitglieder des Jann-Berghaus-Chores in ein und derselben Wohnanlage unterzubringen. Schließlich waren Herbstferien, zahlreiche Stammgäste befanden sich auf der Insel oder hatten sich angekündigt, und kein Langeooger Vermieter würde einem Stammgast absagen, nur um für ein paar Tage eine Horde Gymnasiasten zu beherbergen. Heiden konnte froh sein, dass es ihm letztlich überhaupt gelungen war, alle Sänger in den verschiedensten Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen unterzubringen, ohne auf den Campingplatz zurückgreifen zu müssen.
Die Folge war natürlich, dass sich der wimmelnde Haufen, überwiegend kaum der Pubertät entwachsen, nur sehr unzureichend überwachen ließ. Er und seine Kollegin vom Leeraner Jann-Berghaus-Gymnasium, Oberstudienrätin Margit Taudien, mussten sich auf überraschende Stippvisiten in willkürlich bestimmten Unterkünften beschränken. Trinkgelage und verbotswidriges Rauchen befürchtete er weniger; seine Chorsänger waren überwiegend ehrgeizig und wussten genau, worum es hier ging und dass sie all ihre Kondition brauchen würden, um zu bestehen. Mehr Sorgen bereiteten ihm die Techtelmechtel, die sich gleich im halben Dutzend anzubahnen schienen, direkt unter seinen gestrengen Blicken. Der Himmel mochte wissen, was sich abends und nachts in den Dünen so alles tat. Bloß gut, dass es um diese Jahreszeit nach Sonnenuntergang schon empfindlich kühl wurde. Das würde manchen Gefühlsüberschwang dämpfen. Hoffentlich. Jedenfalls fehlte ihm jede Spur von Lust, sich mit den möglichen Folgen solcher Hemmungslosigkeiten herumzuärgern.
Heiden schlenkerte mit den Armen und setzte sich trippelnd wieder in Bewegung. Andererseits, was war so schlimm daran, wenn in den Langeooger Randdünen zusammenfand, was sowieso früher oder später zusammenfinden würde? Schließlich gab es Kondome, und sie waren frei verkäuflich.
Ein schallendes Lachen platzte aus ihm heraus, so laut, dass es von den Dünenkämmen widerhallte. Nein, die Erziehung seiner Schüler zu geschlechtlicher Enthaltsamkeit war gewiss nicht seine Aufgabe. Und auf seine Schülerinnen traf das ebenso zu. Ganz besonders auf eine.
Leise vor sich hin pfeifend trabte er weiter in Richtung Wasserturm.
3.
»Guck mal hier! Voll trendy, was?« Sabrina hielt sich ein winziges, spitzenartig durchbrochenes Etwas, dessen fransige Ausläufer knapp bis zur Nabelgegend baumelten, vor den Busen und schaute ihre Mitbewohnerinnen erwartungsvoll an.
»Lass mal sehen. Ach du Schande, wo willste das denn tragen? Bei Rotlicht?« Wiebke Meyers Reaktion lag irgendwo zwischen Anerkennung und Neid, ungeachtet der Empörung und Ablehnung signalisierenden Wortwahl, und wurde auch so aufgefasst. Auf den Klang kam es an in der Kommunikation unter Teenagern, das benutzte Vokabular war zweitrangig. Bis zur Nonverbalität war es nur noch ein kleiner Schritt.
»Oder wenn du zu Hause für deinen Liebsten mal wieder Lapdance machst.« Theda Schoons schneidender Kommentar war von ganz anderer Qualität, das war unüberhörbar. Ihre Ablehnung war scharf und auch so gemeint, was ihr Gesichtsausdruck deutlich widerspiegelte. Gerade deshalb ging Sabrina nicht darauf ein.
»Aber da ziehst du doch etwas drunter, oder?« Stephanie Venema war, ungeachtet ihrer fast 180 Zentimeter Körperlänge, die Kindlichste des Quartetts, das in der kleinen Ferienwohnung untergebracht worden war. Ihr Gesicht mit den leicht schräg stehenden Augen und der kräftigen Kieferpartie war nicht gerade klassisch schön, aber doch sehr apart, und ihre hellblond leuchtende Mähne sicherte ihr jederzeit Aufmerksamkeit. Noch wirkte sie mit ihren dünnen, schlaksigen Armen und Beinen und den großen Händen und Füßen wie ein Fohlen bei den ersten Gehversuchen. Dass sich dieser Eindruck jedoch bald ändern würde, war absehbar.
»Na logo, was denkst du denn!« Sabrina Tinnekens lachte, teils erheitert, teils abfällig. Obwohl sie mit ihren sechzehneinhalb Jahren nur ein knappes Jahr älter war als Stephanie, hatte ihre Ausstrahlung nichts Kindliches mehr. Selbst in ihrem züchtig geschlossenen, wadenlangen und geblümten Nachthemd, eigens für die Insel-Tour aus Altbeständen hervorgekramt, waren ihre fraulichen Formen unverkennbar. Das Spitzentop ließ ahnen, wie sie die zur Geltung bringen konnte. »Natürlich trage ich was drunter. Ein schwarzes Top. Oder ein Bustier, je nachdem.«
»Na, dann wird’s aber very sexy, heieiei!« Wiebke Meyer drehte sich um ihre eigene Achse, als trage sie selbst das so verrucht wirkende Kleidungsstück, passend zu dem verklärten Lächeln auf ihrem Gesicht. Ihr drahtiger, fast knabenhafter Körper wirbelte nur so herum, und man konnte sich gut vorstellen, wie sie vergangenen Monat ihre Voltigiergruppe zum Bezirkstitel geführt hatte. »Wo hast du das denn gekauft, etwa hier auf der Insel? So etwas muss ich auch haben, unbedingt.«
»Wozu? Da rutscht du doch glatt durch mit deinen spitzen Gräten.« Theda wickelte sich energisch in ihren Bademantel und raffte Wäsche, Socken und Jeans zusammen. »Wenn von euch keiner ins Bad will, dann geh ich eben. Keine Lust, wieder zu spät zur Probe zu kommen.« Eine Spur lauter als nötig fiel die Badezimmertür hinter ihr ins Schloss.
»Was die nur wieder hat!« Wiebke rümpfte die Nase. »Total spießig, die dumme Kuh. Nichts als Schule und Chor im Kopf. Mit der kannste überhaupt keinen Spaß haben.« Barfüßig huschte sie in den Flur und musterte sich im Garderobenspiegel: »Spitze Gräten, pah.«
»Ach, die ist im Stress, da musst du dir nichts bei denken.« Stephanie war wie immer auf Versöhnung aus, das war so etwas wie Prinzip bei ihr, aber ihre Miene signalisierte deutlich, dass auch sie Theda für reichlich zickig hielt. »Sie will eben unbedingt mit nach Amiland.«
»Ameland? Wieso will die denn auf noch ’ne Insel? Reicht ihr Langeoog etwa noch nicht?« Wiebke hatte ihr Pyjama-Oberteil bis über den Rippenbogen angehoben und war ganz mit der Inspektion ihres hageren Körpers beschäftigt.
»Amerika meine ich natürlich. U-S-A! Die Reise mit dem JBG-Chor über Weihnachten nach Illinois und Oregon, auf Einladung der Nachkommen ausgewanderter Ostfriesen. Schon vergessen?«
»Ach die!« Die Schlafanzugjacke fiel wieder herunter, und es überraschte, dass sie Wiebkes Rippen dabei nicht wie ein Xylophon zum Klingen brachte. »Die hab ich doch längst abgehakt. Da gibt’s überhaupt nur vierzig Plätze insgesamt, davon ganze fünfzehn für Sopran. Und wir sind über dreißig Sopranistinnen, wenn du alle mitrechnest, auch die Oberstufe. Wie sollen wir denn da eine Chance haben? So gut sind wir schließlich auch nicht.«
»Theda scheint davon nicht so überzeugt zu sein«, wandte Stephanie ein. »Jedenfalls entwickelt die voll den Ehrgeiz. Letzten Sommer hatte sie doch zu rauchen angefangen, weißt du nicht mehr? Und kaum kam die Nachricht von der Amerika-Fahrt, schon war wieder Schluss damit, von heute auf morgen. Die will mit, das hat die sich echt in den Kopf gesetzt.«
»Wenn das mal kein Hirngespinst ist!« Wiebkes grelle Stimme ging durch Mark und Bein. Inzwischen hatte sie ihre Aufmerksamkeit ihren mausbraunen, strähnigen Haaren zugewandt, raffte sie über dem Schädel zu einer Palme zusammen, um größer zu wirken. »Es gibt doch bestimmt mehr als fünfzehn Soprane in unserem Chor, die besser sind als sie. Das holt Theda in der kurzen Zeit niemals auf. Und erinnerst du dich, was sie sich vorgestern geleistet hat? Diesen fetten Patzer bei unserem Geburtstagsauftritt? Seitdem ist die Kleine bei Heiden doch sowieso unten durch.«
»Aber bei diesem Auftritt waren wir doch alle nicht besonders«, beschwichtigte Stephanie. »Nicht nur Theda. War ja auch eine Schnapsidee vom Heiden, dem Pastor die Zusage zu geben, ohne richtige Probe vorher und alles! Ganz egal, wie bedeutend diese Tante ist, die da achtzig wurde.«
»Bedeutend war«, schrillte Wiebke dazwischen. »Kurz nach unserem Auftritt ist sie gestorben. Heute früh beim Brötchenholen hab ich’s gehört. Ist das angesagte Gesprächsthema im Dorf.« Sie grinste breit: »Da siehst du mal, wie schlecht wir waren!«
Theda platzte mitten in ihr Gelächter hinein, einen Handtuchturban auf dem Kopf und eine Dampfwolke im Schlepptau. Mit einem mürrischen Seitenblick verschwand sie in ihrem Schlafzimmer und warf die Tür hinter sich zu.
»Hat die das schon wieder auf sich bezogen?« Stephanie sah besorgt aus. »Die ist aber auch empfindlich!«
»Ist doch scheißegal«, sagte Wiebke und wandte sich dem frei gewordenen Badezimmer zu. Sabrina aber war schneller gewesen und schloss lachend hinter sich ab.
»Blöde Gans«, maulte Wiebke. »Die hält sich auch wohl für was Besseres.«
»Jedenfalls glaubt sie auch, dass sie mitfährt nach Amerika«, sagte Stephanie. »Dabei singt sie auch nicht besser als Theda. Oder als du und ich.«
»Na ja, hör mal.« Wiebke setzte eine überlegene Miene auf. »Bei Sabrina liegen die Dinge doch ein bisschen anders. Wenn die mitfährt, dann hat das ja wohl nichts mit Singen zu tun.«
»Womit denn dann?« Stephanies Augen rundeten sich.
Wiebke schnaubte verächtlich: »Na womit wohl, du Baby.«
4.
Sie sitzen da wie zwei Schüler vor ihrem Lehrer, wenn es die Noten gibt, schoss es Lüppo Buss durch den Kopf. Ein ungehöriger Gedanke, gewiss, und er versuchte ihn auch gleich wieder aus seinem breiten, hochstirnigen Kopf zu verbannen. Das gehörte sich einfach nicht gegenüber trauernden Hinterbliebenen, so durfte man nicht denken. Aber was half’s, als Polizist war Lüppo Buss nun einmal darauf trainiert, Situationen möglichst schnell und treffend einzuschätzen. Und die Janssens saßen eben da wie erwartungsvolle Musterschüler, die sich nicht ganz sicher sind, ob es denn auch wirklich für eine Eins gelangt hat.
»Störe ich?«, fragte der Inselpolizist leise und blieb abwartend unter der Tür stehen. Nicole und Ulfert Janssen schauten stumm zu ihm herüber, überließen Pastor Rickerts das Antworten, als sei der jetzt hier Hausherr und nicht sie beide. Den Pastor schien das nicht weiter zu verwundern, vermutlich war er es gewohnt, in Trauerangelegenheiten das Heft in die Hand zu nehmen. Genau genommen verhielt er sich damit ebenso wie ein leitender Ermittler der Kriminalpolizei an einem Tatort. Eigentlich waren sich die geistliche und die weltliche Ordnungsmacht doch ziemlich ähnlich, stellte der Kommissar fest.
»Komm ruhig rein, Lüppo«, sagte Rickert Rickerts. »Wir sind auch bald durch mit allem. Nur noch ein paar Sachen klären fürs Abdanken, dann haben wir’s up Stee. Soll ja alles recht flott über die Bühne gehen.« Einladend zog er einen weiteren Stuhl heran: »Setz dich doch.«
»Ich hatte noch gar nicht kondoliert«, sagte Lüppo Buss und durchquerte den weitläufigen Raum. »Hab’s gerade erst erfahren.« Er reichte erst Nicole, dann Ulfert die Hand: »Herzliches Beileid zum Verlust eurer Tante.« Dann verbesserte er sich: »Großtante, meine ich natürlich. Ich habe sie ja immer nur Tant’ Lüti genannt.«
Nicole Janssens schmale, langknochige Hand fühlte sich kühl und trocken an, Ulferts fleischige dagegen heiß und feucht. Sie waren eben ziemlich verschieden, nicht nur äußerlich, er mit seinen kurzen, dunkelbraunen, krausen Haaren und sie mit ihren langen, glatten blonden. Der Tod der alten Dame schien sie unterschiedlich stark zu berühren. Aber Lütine war ja auch Ulferts Großtante gewesen, väterlicherseits. Verständlich, dass er einen mitgenommeneren Eindruck machte als Nicole.
Lüppo Buss nahm den angebotenen Stuhl und setzte sich an die Schmalseite des gläsernen Esstischs. Durch die transparente Platte hindurch konnte er die Tischbeine sehen. Sie bestanden aus kunstvoll geschmiedetem Eisen, ebenso wie die Stühle, und standen auf glasierten Terrakottafliesen. Eine niedrigere Version des Glastischs stand, wie er von früheren Besuchen wusste, in der Fernsehecke zwischen drei über Eck platzierten Ledersofas. Kalte Pracht, dachte er und strich sich mit dem Zeigefinger die buschigen blonden Augenbrauen glatt. Passt überhaupt nicht in die Landschaft hier, Langeoog ist doch nicht Südfrankreich. Im Sommer mag’s ja noch angehen, aber im Winter, da fröstelt es einen doch zwischen Glas, Eisen, Leder, Stein und diesen geweißten, unangenehm rauen Wänden, denen man schon von weitem ansieht, dass sie nicht berührt werden sollen. Kalt und ungemütlich. Da helfen auch Fußbodenheizung und Thermopanefenster nichts.
Früher hatte Tant’ Lüti selber dieses herrschaftliche Anwesen bewohnt, ganz allein, damals, als sie ihren Besitz noch persönlich verwaltet hatte. Ehe man ihr das Krankenzimmer direkt neben der guten Stube eingerichtet hatte. Da hatte es hier noch ganz anders ausgesehen, viel ostfriesischer, mit dunklem Holz, dicken Samtdecken und echten Kapitänsbildern an den Wänden, die sturmzerzauste Dreimaster zwischen schaumgekrönten Wogen und bedrohlich dunklen Wolken zeigten. Keineswegs ärmlich, alles andere als das, denn Lütine Janssens Besitz war ansehnlich, weiß Gott. Das wussten alle, auch wenn sie nicht mit ihrem Eigentum geprahlt hatte.
Geerbt hatte sie, natürlich, denn so ohne weiteres war ja an derart viel Grund und Boden auf dieser Insel nicht heranzukommen. Aber sie hatte durch viel Arbeit und eine Menge Geschick mit ihrem Pfund gewuchert. Früh verwitwet und kinderlos, hatte sie all ihre Energie in die Geschäfte gesteckt. Aus Ferienhäuschen hatte sie Pensionen gemacht, aus Pensionen Hotels, aus Hotels Kurkliniken. Ihre Betriebe liefen ausgezeichnet, auch jetzt noch, da die kapitalistische Marktwirtschaft unverhüllter und brutaler regierte und die Leute ihre Euros fester als früher zusammenhielten. Tant’ Lüti hatte es eben verstanden, zur rechten Zeit Stammgäste an sich zu binden, deren Finanzlage krisenunabhängig war. Leute, die gerne etwas mehr ausgaben, solange es um das eigene Wohl ging. So war nicht nur ihr Vermögen, sondern auch ihr Einfluss stetig weiter gewachsen. Kaum ein Projekt, zu dem sie nicht vorher gehört, kaum eine Entscheidung, die gegen ihren Willen gefällt worden wäre. Tja, Lütine Janssen war jemand auf Langeoog.
Gewesen. Denn jetzt war sie ja tot. Lüppo Buss hatte sich noch gar nicht an diesen Gedanken gewöhnt.
Selbst im Tode hatte Tant’ Lüti bewiesen, wie eng sie den Prinzipien der Insel und des Lebens für den Tourismus verbunden gewesen war: Ein echter Langeooger nämlich starb einfach nicht während der Hauptsaison, wenn niemand Zeit für solche Dinge hatte. Insulaner starben im Herbst und Winter, frühestens im Oktober, zu Zeiten also, da so etwas die Geschäfte nicht nachhaltig störte. Auch Lütine Janssen hatte bis Oktober durchgehalten. Allein damit hatte sie sich den Respekt ihrer Mitmenschen verdient.
Nicole Janssen stellte ihm eine Teetasse hin. Seine Haut prickelte, als er ihren schlanken, hochgewachsenen Körper wenige Zentimeter hinter seiner muskulösen Schulter spürte. Als ob ihre Aura die seine gestreift hätte. Verstohlen und ein wenig schuldbewusst genoss er das Gefühl.
Hart klapperte die Untertasse mit dem traditionellen Rosenmotiv auf der gläsernen Tischplatte, metallisch klirrte der reich verzierte kleine Silberlöffel, laut knallte der Kluntje in die zarte Porzellanschale. Lüppo war sich nicht sicher, ob er Nicole wirklich willkommen war. Das wusste man bei ihr ja nie.
Aber Ulferts Frau musste ein größeres Herz haben, als man vermutete, wenn man ihr gegenüberstand und ihr in die Augen blickte, die aussahen wie aus graublauem Porzellan. Schließlich hatte sie Lütine Janssen mehr als vier Jahre lang gepflegt. Ob »aufopferungsvoll«, der Ausdruck, mit dem der Pastor gerade Nicoles Tätigkeit umschrieb, der richtige dafür war? Egal, Ulfert nickte jedenfalls eifrig, und sicher war, dass seine Frau eine Menge Arbeit geleistet hatte. Eine Menge harter Arbeit, denn Tant’ Lütis Krebserkrankung war schwer und von der unangenehmen Sorte gewesen. Kein Zuckerlecken für Nicole, der die Pflegerinnenrolle ganz selbstverständlich zufiel, obwohl sie mit Lütine Janssen gar nicht leiblich verwandt war. Aber sie war schließlich eine Frau. Nein, wahrlich kein Zuckerlecken.
Nicht einmal mit einem ansehnlichen Erbe vor Augen.
»Na, dann haben wir wohl alles geklärt.« Rickert Rickerts klatschte in die schaufelartigen Hände, blickte noch einmal von einem seiner Schäfchen zum anderen, sicherheitshalber auch zu Lüppo Buss; ebenso sicherheitshalber schloss der sich dem allgemeinen Nicken an. Er wollte lieber nicht vom Pastor in ein weiteres »klärendes Gespräch« verwickelt werden, schließlich hatte er heute noch etwas vor. Schnell senkte er seine Nase in die Teetasse.
»Ist doch nett, dass der Leeraner Chor auch morgen auf der Beerdigung singen wird, nicht wahr? Wird sich gut machen in der schönen Kapelle«, sagte Pastor Rickerts.
»Morgen schon?« Lüppo Buss machte keinen Versuch, seine Überraschung zu verbergen. »So schnell? Aber sie ist doch gerade erst … Ich meine …« Weil ihm die Worte fehlten, breitete er die Arme aus.
»Stimmt schon.« Rickerts nickte. »Aber Ulfert und Nicole hier wollen es eben hinter sich bringen. Kann man ja auch verstehen.«
»Tant’ Lüti hätte das auch so gewollt«, versicherte Ulfert Janssen. »Ihr wisst doch, sie hat nie etwas davon gehalten, lange rumzutüdeln. Anpacken statt schnacken, das hat sie doch immer gesagt, nicht wahr?«
»Klar, hat sie. Weiß ich doch.« Rickerts tätschelte väterlich Ulferts Hand. »Auf Langeoog ist es ja außerdem kein Problem, alles rechtzeitig zu organisieren und dafür zu sorgen, dass auch jeder Bescheid kriegt. Ist ja alles hübsch überschaubar.«
»Schon geschehen«, bestätigte Ulfert Janssen.
»Na siehst du«, sagte Rickerts. »Und weil die Beerdigung bereits am Freitag ist, haben wir eben auch den Leeraner Chor dabei. Weil die doch am Sonnabend schon wieder nach Hause fahren. Der Chorleiter, Herr Heiden, hat sofort zugesagt, als ich ihn fragte. Na, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Mir schlägt er so leicht nichts ab. Nur zu einer Namensänderung konnte ich ihn noch nicht bekehren.«
Gegen Witzchen in einem Trauerhaus schien Rickerts keinerlei Vorbehalte zu haben. Laut lachend stemmte er seine Pranken auf die Glasplatte und hievte seinen athletischen, wenn auch etwas aus den Fugen geratenen Körper aus dem Stuhlpolster. Lüppo Buss erhob sich ebenfalls, mit erheblich weniger Kraft- und Lärmaufwand als der Geistliche, dafür eleganter und in der halben Zeit.
Rickerts’ Hand fühlte sich so rau und massiv an wie die eines Landarbeiters. Ulferts Hand war immer noch warm und schwitzig, Nicoles immer noch kühl und distanziert. Wirklich ein ungleiches Paar.
Im Hinausgehen ließ Lüppo Buss seinen Blick gewohnheitsgemäß durch den Raum schweifen. Ein paar Grafiken schienen neu zu sein, ebenfalls zwei schmiedeeiserne Plastiken, vermutlich teuer, allesamt. Und der gläserne Couchtisch war durch einen hölzernen ersetzt worden. Na sieh mal an, dachte der Inselpolizist, vielleicht kommen die Janssens ja doch noch zur Vernunft.
5.
Von draußen war es Leopold Heiden so vorgekommen, als summte es im Haus der Insel wie in einem Bienenstock. Als er jedoch die Tür zum Kleinen Konzertsaal aufstieß, schlugen ihm Lärmwogen entgegen wie sonst nur in der Pausenhalle des Jann-Berghaus-Gymnasiums. Sänger oder nicht, fünfundsechzig Schüler waren und blieben eben vor allem fünfundsechzig Schüler. Also in erster Linie laut.
Oberstudienrätin Margit Taudien stürzte ihm entgegen, das runde Gesicht strahlend wie die Morgensonne, ein Bündel Notenblätter mit beiden Armen gegen die Brust gepresst. »Einen wunderschönen guten Morgen, großer Meister«, rief sie wie jeden Tag mit lautem, etwas schrillem Diskant.
Heidens Reaktion bestand aus einem fingierten Zusammenzucken und einem entsagungsvollen Blick zur Saaldecke. Für den demonstrativen Eifer seiner Kollegin hatte er nichts als Verachtung übrig, die er mal mehr, mal weniger zu verbergen suchte. Heute verbarg er sie gar nicht. Sie würde das ignorieren, tapfer wie immer. Das wusste er, und das war gut so, denn er brauchte sie. Seine Verachtung aber wurde dadurch nur noch gesteigert.
»Gott zum Gruße, meine Beste«, gab er zurück. »Haben Sie Töne?«
»Wie bitte?« Margit Taudien stutzte, riss die Augen weit auf und blickte hilfesuchend in die Runde, ehe sie einen ihrer rundlichen Arme aus der Notenklammer löste und sich die Hand zum Zeichen einsetzenden Begreifens gegen die Stirn schlug: »Ach, so meinen Sie das!« All diese Gesten vollführte sie mit slapstickartiger Überakzentuierung, als befinde sie sich nicht zur Probe im Kleinen Konzertsaal, sondern im Großen Bühnensaal zur Aufführung. Absolut stummfilmreif, fand Heiden. Jetzt fehlte nur noch …
Da begannen sich auch schon die Notenblätter aus ihrer nur noch halbfesten Armklammer zu lösen und in einer gischtenden Papierkaskade zu Boden zu pladdern. Sofort sprangen mehrere Jungen und Mädchen hinzu, um ihrer Lehrerin beim Aufsammeln behilflich zu sein und damit vor ihrem Chorleiter einen guten Eindruck zu machen, kamen einander dabei zwangsläufig in die Quere und rempelten sich gegenseitig um. Slapstick in Reinkultur, Heiden hatte es ja gleich gewusst.
Jetzt aber genug damit. Er ignorierte seine Kollegin, die anscheinend noch etwas sagen wollte, und klatschte dreimal kräftig in die Hände. »Guten Morgen allerseits!«, donnerte er mit wohltrainierter, voluminöser Stimme, die durch das allgemeine Getöse fuhr wie ein Panzerkreuzer durch eine Horde Windsurfer. »Es wird ernst! Silentium und Aufstellung.«
Mehr als sechzig Jungen und Mädchen stoben nur so aus- und durcheinander, um sich gleich darauf in hundertfach geübter Weise wieder zu formieren. Aus lauter Individuen wurde in Sekundenschnelle eine Gemeinschaft, aus einem strukturlosen Gewimmel ein massiver Block. Heiden liebte diesen Anblick. Fast noch mehr aber liebte er die gespannte Aufmerksamkeit, mit der alles an seinen Lippen hing. Alle fieberten sie der Entscheidung entgegen, die einzig und allein er fällen und verkünden konnte. Himmel, das war Macht, und sie fühlte sich gut an.
»Die Auswahl ist getroffen«, verkündete er überflüssigerweise, schließlich hatten alle seit Wochen auf diesen Termin hingearbeitet. »Zu neunundneunzig Prozent wird sich daran nichts mehr ändern. Da müsste schon etwas ganz Außergewöhnliches passieren.« Er blickte kurz hoch und in die Runde, suchte ein ganz bestimmtes Gesicht, fand es und lächelte dünn. Seine Wimpern senkten sich wieder.
»Ich beginne mit den Herren der Schöpfung.« Umständlich nestelte er ein Bündel Notizzettel aus der Hosentasche. Das Papier knisterte unnatürlich laut in der atemlosen Stille. Nicht, dass Heiden seine Aufzeichnungen benötigt hätte; die Namen hatte er längst im Kopf, jeden einzelnen, jederzeit abrufbar. Aber warum sollte er die Spannung nicht noch etwas steigern, den gewissen Moment nicht noch ein klein wenig hinauszögern? Ihm gefiel das.
»Der Bass.« Der Chorleiter blätterte ein bisschen, als läge der betreffende Zettel nicht sowieso obenauf. »Henning Voss, Theodor Zenker, Martin Eden …« Heiden stellte fest, dass die Jungen recht gelassen blieben. Kein Wunder, beim Bass war die Sache relativ klar, ebenso wie beim Bariton. Die Leistungsunterschiede waren deutlich, und fast alle Sänger wussten längst, ob sie dabei sein würden oder nicht. Ein wenig anders sah es beim Tenor aus, da würde es gleich wohl zwei lange Gesichter geben.
Aber das war ganz gewiss nichts im Vergleich zu den Tränenfluten, die bei den Mädchen zu erwarten waren. Vor allem im Sopran. Nirgendwo war die Anzahl der Auszusondernden so groß, waren die Leistungsunterschiede insbesondere in der Grauzone zwischen brillant und bieder so gering wie dort. Von den insgesamt fünfundzwanzig Sängerinnen und Sängern, die hier und heute erfuhren, dass sie sich die Hoffnung auf eine kostenlose USA-Reise abschminken konnten, gehörten allein fünfzehn zum Sopran.
»… und Klaus Töbken. So, das war’s, meine Herren. Alle Aufgerufenen dürfen sich gratulieren, den anderen danke ich für ihr strebendes, wenn auch nicht vom erträumten Erfolg gekröntes Bemühen. And now upon the Ladies.«
Die Jungs trugen es allesamt mit Fassung, stellte Heiden fest. Auch die Aussortierten blieben betont cool, einige rangen sich sogar ein pflichtschuldiges Lachen über den alten Heinrich-Lübke-Witz ab. Ein paar der Mädchen lachten ebenfalls. Klar, die Favoritinnen, denen das Flugticket nicht zu nehmen war. Die anderen blieben stumm, standen bleich und starr, wie in Alabaster gemeißelt. Hopp oder topp – jetzt gleich würden sie es erfahren, aus seinem Munde. Heiden verspürte ein wohliges Kribbeln im Bauch, während er die Namen der Altistinnen verlas.
Dann war es so weit. »Sopran.« Kurze Raschelpause. »Maren Gödeke, Elisabeth Heeren, die drei Tanjas …« Gleichmäßig, wie nach dem Metronom, las er die Namen der Gesetzten herunter, deren Erwähnung niemanden überraschte, am allerwenigsten sie selbst. Dann aber hatte Heiden die Sektion erreicht, die er selber »die Grauzone« nannte; lauter Mädchen, die passabel, aber nicht überragend sangen, die man durchaus mitnehmen konnte, aber nicht musste. Fußballtrainer nannten so etwas »Ergänzungsspieler«.
Jetzt kam Bewegung in die Reihen des Chors, und auch die Stille war nicht mehr absolut. Name für Name rief ein heftiges Keuchen, ein unterdrücktes Juchzen, ein halblautes »Ja!« hervor. Da gehen Wunschträume in Erfüllung, dachte er, und sein Lächeln vertiefte sich. Träume, ja. Zwei Namen noch, dann werden wir hören, wie Träume zerbrechen.
»Sabrina Tinnekens.« Der vorletzte Name, das eine Gesicht. Sein Blick fing es ein. Sie lächelte, klar, aber keineswegs so, wie er erwartet hatte, nämlich dankbar und selig wie ein beschenktes Kind unterm Weihnachtsbaum. Oh nein. Dieses Lächeln fiel reichlich selbstsicher aus. So, als habe sich diese Person ihren Platz auf der Liste redlich verdient. Womit auch immer. Was die sich wohl einbildete! Heidens Hochstimmung war dahin.
»Und Hilke Smit. So, meine Damen, das war’s.« Er stopfte die Zettel zurück in seine Hosentasche.
Seufzer, gleich reihenweise, wie erwartet. Und ein Schluchzer, der sich Bahn brach, obwohl sich Theda Schoon beide Hände vor den Mund gepresst hatte. Ach ja, die kleine Theda. Sicherlich hätte er sie mitnehmen können. Aber eben nicht müssen. Einen zwingenden Grund hatte sie ihm nicht geliefert. Obwohl er ihr die Möglichkeit geboten hatte. Tja, Chance verpasst, so war das nun einmal.
Dabei fiel ihm auf, dass er Hilke Smit gar nicht hatte jubeln hören. Und als er den wohlvertrauten Sopranblock ins Visier nahm, stellte er fest, dass er sie auch nicht sah.
Er winkte die Taudien heran: »Haben Sie denn die Anwesenheit gar nicht kontrolliert?«
»Aber selbstverständlich«, erwiderte die Oberstudienrätin entrüstet. »Hilke Smit ist heute früh nicht erschienen, das ist mir bekannt. Ich hatte nur noch keine Gelegenheit, es Ihnen …«
»Schon gut, schon gut«, winkte er ab: »Und? Wo steckt sie?«
Margit Taudien breitete die Arme aus: »Ihre Mitbewohnerinnen wissen es nicht. Angeblich hat sie gestern am frühen Abend noch einmal die Ferienwohnung verlassen, und als die anderen Mädchen heute Morgen in ihrem Zimmer nachschauten, war ihr Bett unberührt.«
Heiden runzelte die Stirn; Hilke war nicht gerade für ein ausschweifendes Nacht- und Liebesleben bekannt. Andernfalls hätte er es gewusst. Im Chor wurde grundsätzlich über alles getratscht, und auf solche Dinge achtete er.
»Haben Sie es schon über Handy versucht?«, fragte er.
Margit Taudien nickte beflissen: »Habe ich, selbstverständlich. Aber da meldet sich nur die Mailbox. Anscheinend hat Hilke ihr Gerät ausgeschaltet.«
Heiden wurde sich plötzlich wieder bewusst, dass fünfundsechzig Augenpaare auf ihn gerichtet waren, das von Kollegin Taudien mitgerechnet. Die Jugendlichen hatten ihr Geschnatter eingestellt; offenbar hatten sie gemerkt, dass ihr Leiter-Duo ungewöhnlich lange abgelenkt war, und waren vor Neugierde verstummt. Besser, er machte jetzt erst einmal weiter wie gewohnt. Bloß nicht die Pferde scheu machen.
»Fragen Sie zur Sicherheit mal bei der Polizei nach, ob die etwas wissen«, zischte er der Taudien zu. »Hier gibt es doch eine Polizei, soweit ich mich erinnere, oder? Wenn schon keine Autos.«
Die rundliche Frau nickte. »Ist gut«, sagte sie leise und entfernte sich, sorgsam darauf bedacht, keine auffällige Hast an den Tag zu legen.
Sehr schön, dachte Heiden, froh, sich nicht selber kümmern zu müssen. Auch wenn er um einen Besuch bei der Polizei wohl nicht herumkommen würde.
Er klatschte laut in die Hände. »So, genug getrödelt, frisch ans Werk! Uns steht noch eine Menge Arbeit bevor.«
6.
Das Meer kam auf ihn zu. Merkwürdig. Aber eindeutig.
Nicht nur Welle um Welle, klar, das auch. Nach wie vor brandete Woge auf Woge heran, kräftig und lautstark, obwohl der Wind im Moment ziemlich sanft wehte, wie er fand. Aber woher wollte er das wissen? Hatte er denn einen Vergleich?
Wie auch immer, dachte der dicke Mann, das Meer kommt auf mich zu. Seit Stunden fixierte er nun schon den Spülsaum, jene Zone, in der sich die schaumigen Ausläufer der gebrochenen Brandungswellen im nassen Sand verliefen und eine Markierung aus Treibholzstücken, Möwenfedern, Pflanzenresten, Plastikflaschen und sonstigem Unrat zurückließen. Keine Welle war wie die andere, und so war auch der Verlauf des Spülsaums ständigen Veränderungen unterworfen.
Nur eins war unübersehbar: Er kam auf ihn zu.
»Flut«, krächzte der dicke Mann leise vor sich hin. Seit Stunden das erste Wort, das er gesprochen hatte. Flut, natürlich, Ebbe und Flut. Sechs Stunden und ein bisschen, jeweils. Zweimal am Tag kam und ging das Wasser. Na also, da war ja doch noch etwas, dort oben unter seiner geschwollenen Schädeldecke, die nicht mehr ganz so wütend pochte wie heute früh. Wie viel mochte da noch sein?
Aber vorerst wartete er vergebens. Die erhoffte Erinnerungsflut wollte nicht einsetzen.
Der Spülsaum näherte sich nicht nur, er schwankte auch. Vor und zurück, vor und zurück, ebenso wie der blaue Himmel und die Schäfchenwolken über dem stahlgrau schimmernden Meeresspiegel. Das verwunderte ihn, bis er feststellte, dass es sein eigener dicker Körper war, der da schwankte. Vor und zurück, vor und zurück, die Arme oberhalb des halbkugeligen Bauches um die füllige Brust geschlungen. Selbsthypnotisch. Wie nannte man das noch, wenn jemand so vor sich hin wackelte – Autismus? Nein, Hospitalismus, das war es. Wieder ein Fundstückchen Erinnerung. Leider wiederum keins, das ihm weiterhalf.
Immerhin war ihm nicht mehr so kalt wie am frühen Morgen. Seit Stunden saß er nun schon hier am Strand, auf ein und demselben Fleck, wie gefangen in seinem egozentrischen Gewackel und seiner Erinnerungslosigkeit, und wartete. Auf sich selbst, genau genommen. Bisher aber war die erhoffte Offenbarung ausgeblieben. Er war sich selber immer noch so fremd wie heute früh, war nichts weiter als ein dicker Mann in Unterwäsche. Mit einer schmerzenden Beule am Kopf. Und Blutkrusten an den Händen.
»Hast du denn kein Handtuch?«
Der dicke Mann erstarrte. Natürlich, in den vergangenen Stunden, in denen er sich darauf beschränkt hatte, seinen Körper rhythmisch vor und zurück zu wiegen und dabei vielleicht ein weiteres verschüttetes Stückchen Erinnerung an die Oberfläche seines Bewusstseins zu schütteln, war nicht nur das Meer ein wenig auf ihn zugekommen und die Sonne ein Stückchen höher in den Himmel geklettert. Der Strand rund um ihn her hatte sich auch belebt, Menschen hatten ihre Decken und Badelaken ausgebreitet, sich zuerst zögernd und dann immer freimütiger bis aufs Schwimmzeug entblößt und ihre nussbraunen, madenweißen oder himbeerrosa Körper den wechselseitigen Blicken und den Sonnenstrahlen dargeboten. Längst war das Fleckchen Sandstrand, auf dem er am Morgen noch mutterseelenallein gehockt hatte, von anderen Badegästen umgeben, umringt, umzingelt. Förmlich eingekesselt. Nicht, dass er das nicht wahrgenommen hätte, nur hatte er es irgendwie ausgeblendet. Bis jetzt.
»Und hast du denn auch keine Badehose?«
Ein Schwall Sand prickelte über seinen rechten Oberschenkel. Langsam drehte er seinen Kopf auf dem dicken, kurzen Hals, peilte misstrauisch aus den Augenwinkeln.
»Was machst du denn eigentlich hier, wenn du kein Handtuch und keine Badehose hast?«
Die Kleine mochte sechs Jahre sein, vielleicht acht, älter auf keinen Fall. Dafür reichlich altklug. Wie sie da stand, das rundliche Kinn vorgestreckt, die Ellbogen angewinkelt, beide Fäuste in die babyspeckigen Hüften gestemmt, hätte sie gut und gerne eine amtlich bestallte Strandaufseherin sein können. Vielmehr die Karikatur einer solchen, angefertigt für die tägliche Kinderseite der Badezeitung.