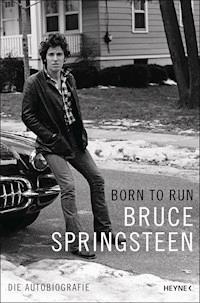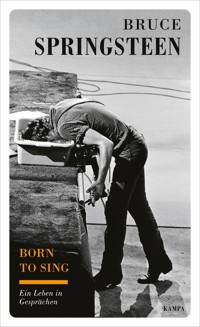
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kampa Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Kampa Salon
- Sprache: Deutsch
»I'm the president, he's the boss«, stellte Barack Obama seinen Freund Bruce Springsteen 2009 in Anspielung auf dessen Spitznamen bei einer öffentlichen Ehrung vor. Tatsächlich hat der Rockmusiker mit so populären Platten wie Born in the USA, das zu einem der meistverkauften Alben der Rockgeschichte gehört, für viele US-Amerikaner eine höhere Autorität als die meisten Politiker. Springsteen, der in einfachsten Verhältnissen in New Jersey aufgewachsen ist, erzählt in seinen Songs die Geschichten der Arbeiter und Benachteiligten, und das auf eine Weise, dass seine Musik identitätsstiftend geworden sind. Wie auf der Bühne, wo er zu den meisten seiner Stücke eine Anekdote zum Besten gibt, gelingt es Springsteen auch in Interviews, seine Gesprächspartner mit Erinnerungen und Reflexionen zu fesseln. Etwa wenn er von seinen legendären Tourneen und Shows erzählt, dem epochalen Konzert 1988 in Ostberlin zum Beispiel, von der zyklischen Zusammenarbeit mit seiner E Street Band und von seinen großen musikalischen Vorbildern: Bob Dylan und den Rolling Stones. Mit großer Offenheit berichtet Springsteen aber auch über Persönliches: seine langjährigen Depressionen, das schwierige Verhältnis zu seinem cholerischen Vater und die Frauen in seinem Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 172
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bruce Springsteen
BORNTOSING
Ein Leben in Gesprächen
Kampa
»So etwas kann man nicht lernen, man macht es einfach.«
Im Gespräch mit einem schwedischen Interviewer, 1975
Könnten Sie uns ein wenig über Asbury Park und die E Street erzählen?
Kennen Sie Küstenorte mit Kanälen? Uferpromenaden, cruisende Schlitten? So ist es da. Ein kleiner Ferienort, der seine besten Jahre hinter sich hat und in den vor allem ältere Leute kommen, die nicht genug Geld für die Fahrt in die größeren Küstenorte weiter südlich haben. Es ist okay dort, ich mochte es und habe längere Zeit da gelebt. Die E Street ist einfach eine Straße … in der der Pianist meiner ersten beiden Alben, Davey Sancious, damals wohnte. Wir haben die Band einfach nach der Straße benannt.
Was für Musik haben Sie in Ihrer Jugend und als Sie anfingen, in kleinen Bands zu spielen, gehört?
Zu der Zeit hörte ich alles, was die Mittelwellensender spielten. Es gab damals zwar noch kein UKW-Radio, aber es lief sehr gute Musik. In den frühen Sechzigern, als ich anfing, Musik zu machen … Elvis war damals groß, die Ronettes, die ganzen [Phil] Spector-Sachen und die Girlgroups aus New York, die waren für mich ziemlich wichtig. Die Ronettes, die Shirelles, die Crystals, die Chiffons, die brachten zu der Zeit eine Menge guter Musik raus. Und dann kam das große England-Ding, die Beatles, die Stones, Manfred Mann … Auf den MW konnte man gute Musik hören, bis etwa 1967, als sich der UKW-Rundfunk verbreitete und anfing, längere Stücke zu spielen, und damit das Ende der wirklich guten Drei-Minuten-Single einläutete. Geprägt hat mich also vor allem die Musik, die zwischen 1959 und 1965 im MW-Radio lief. Später habe ich dann die frühen fünfziger Jahre für mich entdeckt. Irgendwann gab es hier dann dieses große San-Francisco-Ding, damit hatte ich aber nicht viel zu tun. Meine musikalische Prägung war da im Wesentlichen schon abgeschlossen: Roy Orbison, die großen englischen Singles-Bands, die Girlgroups aus New York. Chuck Berry natürlich – die Klassiker.
Sie haben ziemlich jung angefangen, Musik zu machen. Wo sind Sie aufgetreten?
Überall. Highschool-Bälle, Bars, Hochzeiten. Ich weiß noch, wie ich mal die ganze Nacht aufgeblieben bin, um »Moon River« zu lernen, weil die Braut sich das Lied gewünscht hatte – »Moon River«! (Lacht.) So was haben wir eigentlich nicht gespielt, aber wir brauchten das Geld. Mein erster echter Auftritt war in einem Trailerpark, irgendwo auf dem Land. Es war Herbst, vor Leuten aus einem Trailerpark. In Schweden gibt es keine Trailerparks? Das sind mobile homes, Wohnanhänger, die man mit dem Auto zieht. Wissen Sie, in Amerika zieht jeder ständig um. Man parkt diese mobile homes dann in eigenen Siedlungen, eben Trailerparks. Dort lebt dann aber auch ein bestimmter Typ von Leuten. Da haben wir also gespielt, zusammen mit einer Countryband, bestehend aus einem Akkordeonspieler, einem Bassisten, einem Gitarristen und einer jungen Frau, die auf einem Hocker stand und in eines dieser riesigen RCA/Victor-Mikrophone sang, wie in einem dieser alten Shirley Temple-Filme … Dann kamen wir auf die Bühne und haben »Twist and Shout« und Songs von Ray Charles und Chuck Berry gespielt. Die Leute sind komplett durchgedreht … und wir haben an dem Tag ungefähr acht Stunden lang gespielt. Ich weiß noch, dass wir mittags angefangen und bis acht oder neun gespielt haben, bis wir aufhören mussten. Das war einer meiner ersten Auftritte.
Ich habe alles gemacht. Ich habe auf einem FeuerwehrBall gespielt, wo sie keine Ahnung hatten, was für eine Band sie da gebucht hatten, und dann sind wir hin und haben sie vom Hocker gehauen. Einmal auch bei den Pfadfindern, Highschool-Bälle, Clubs, alles, wir haben überall gespielt. In psychiatrischen Kliniken für die Patienten – überall.
Wer waren die anderen Musiker der Band? Waren das alles Leute, die Sie noch aus der Jugend kannten?
Miami Steve kannte ich, seit ich etwa fünfzehn war. Steve und ich hatten zuletzt jeder seine eigene Band. In meine jetzige Band habe ich ihn erst vor ein paar Monaten geholt, er hatte davor in allen meinen Bands gespielt. Es hat sich gut angefühlt, ihn wieder dabeizuhaben. Garry kenne ich seit etwa fünf Jahren, auch er war mit mir in anderen Bands. Danny kenne ich schon seit sechs oder sieben Jahren. Clarence habe ich vor etwa drei oder vier Jahren kennengelernt. Die meisten von ihnen sind Musiker aus der Gegend, außer Max und Roy. Roy kommt aus Long Island und Max aus North Jersey – was nicht als unsere Gegend gilt. (Lacht.) Dazu gehört deine Stadt und vielleicht noch ein Radius von zehn Meilen. North Jersey ist eine ganz andere Musikszene als die, in der ich lebe – es ist dort viel kommerzieller, eher wie New York.
Wenn Sie alle aus derselben Gegend kommen, fühlen Sie sich vermutlich auch durch ähnliche Interessen, Assoziationen und Witze verbunden?
Eigentlich nicht, nein; wir sind alle sehr verschieden. Wir haben ganz Unterschiedliches durchgemacht, sind unterschiedlich alt, haben unterschiedliche Erfahrungen. Aber wir harmonieren sehr gut, weil alle wissen, dass wir da eine ziemlich gute Sache am Laufen haben. Und es sind alles gute Jungs, unkomplizierte nette Typen, es läuft einfach sehr rund im Moment. Zu einem gewissen Grad stimmt es schon, alle kennen New Jersey – wenn man die Jungs aus der eigenen Gegend dabeihat, ist das schon unbezahlbar. Ich würde keinen von ihnen durch egal wen auf der Welt ersetzen wollen. Zum einen natürlich, weil es großartige Musiker sind, zum anderen aber eben auch, weil es noch diese zusätzliche Verbindung gibt.
Ich und Steve haben zum Beispiel diesen Rap für »E Street Shuffle« geschrieben, und genau so war es auch. Wir saßen um drei Uhr morgens an einem Tisch in einem Club und haben davon geträumt, dass irgendwann der Tag kommen würde, an dem wir Platten machen können. Das war die Hauptsache. Ich kenne Steve, seit er fünfzehn ist, und seitdem haben wir über nichts anderes geredet, wir wollten einfach nur eine Platte machen. Wir haben uns gefragt, was das Problem ist, wir sind so gut wie die und so gut wie die, warum haben wir keinen Plattenvertrag? Was ist da los? Neulich waren wir dann im Auto unterwegs, hier in der Gegend, und alle waren ganz aufgeregt: Es war so weit, unsere Musik wurde im Radio gespielt. Wir sind immer in diesem alten Van rumgebrettert, ich und Steve, die Ostküste rauf und runter, nach Virginia und Atlanta, in die verschiedensten Städte, und der verdammte Van blieb ständig liegen … und jetzt liefen wir im Radio. Ich habe nur »Steve« gesagt, und er: »Ja!« Und ich: »Es ist so weit! Erinnerst du dich an die zahllosen Städte, in die wir mit dem Van gefahren sind und wie wir immer gesagt haben: ›Wenn es so weit ist, wenn es endlich so weit ist …‹« – und dann musste ich die ganze Zeit denken: Es ist so weit. Steve ging es auch so. Aber ich würde das nie als selbstverständlich ansehen, nicht eine Sekunde. So wie gestern Abend, das Publikum in diesem vollen Saal, das würde ich nie als selbstverständlich ansehen. Auf jeden Abend wie gestern kommen hundert andere, an denen wir in irgendwelchen kleinen Bars in Jersey gespielt haben und niemand da war.
Was haben Ihre Familie und Ihre Lehrer in den ersten Jahren davon gehalten, als Sie in Bars Gitarre spielten?
Sie haben es natürlich gehasst. Meine Mutter … Mütter sind halt Mütter. Meine wollte hinter mir stehen und mich mein Ding machen lassen. Mein Vater hasste es und wollte, dass ich aufhöre. Er war immer dagegen. Er wollte, dass ich Anwalt werde, irgendwas Wichtiges, Arzt.
Festes Einkommen. Aber ich war ein trotziges und starkes Kind und machte, was ich wollte – ich dachte einfach, ich schaffe das schon irgendwie. Sie sind dann irgendwann weggezogen, und wenig später ging es richtig los.
Sie haben über Ihre Einflüsse gesprochen; wie sehr sehen Sie sich von R&B und lateinamerikanischen Songs beeinflusst?
Ich bin, glaube ich, ein Typ, der alles, was er hört, irgendwie in sich aufnimmt. Ich suche nicht groß rum, ich suche nicht nach bestimmten Sachen. Ich bin kein großer Plattensammler, ich kenne mich nicht gut aus mit den alten R&B-Musikern. Aber was ich höre, nehme ich sehr schnell in mich auf und nutze es direkt so, wie es für mich passt. Auf die ganzen Stax- und Atlantic-Sachen stehe ich sehr. Wilson Pickett, Sam Cooke, Sam and Dave, Eddie Floyd, [Booker T. &] the M.G.’s, Steve Cropper … also ja, die Band steht mit dem, was sie macht, immer wieder in der Tradition dieser Rhythm & Blues-Bands, vor allem aber darin, wie ich meine Band einsetze. Wenn Sie sich Otis Redding beim Monterey Pop Festival anschauen, wie er seine Band einsetzt; wie James Brown seine Band einsetzt – die meisten guten Bandleader waren Leader von Soulbands. Das liegt daran, dass weiße Typen oft dazu neigen, ein bisschen zu schlampig und zu faul zu sein; sie denken offenbar, es gehöre irgendwie zu ihrer Rolle, es nicht so genau zu nehmen, keine Ahnung. Die besten Bandleader der letzten zehn, zwanzig Jahre waren, nach allem, was ich mitbekommen habe, die Leader von Soulbands. Sie halten ihre Bands auf Zack, und so mache ich es auch. Ich mache andere Musik, stehe damit aber in deren Tradition … Keiner kann das besser als Soulmusiker. Wie Sam und Dave, James Brown. James Brown ist ein großes Idol, was das angeht … er schnippt mit dem Finger, und die Jungs schlagen Salti. Es ist unglaublich.
Sie schreiben keine gewöhnlichen Lovesongs; es geht eher allgemeiner um das Leben, und man könnte die Songtexte auch lesen, ohne die Musik zu hören, und bekäme eine Art Vorstellung vom Leben.
Das höre ich immer wieder. Wenn ich die Songs schreibe, schreibe ich sie aber so, dass sie als Song-Texte funktionieren. Man soll sich den Song anhören und dabei den Text hören. Man soll den Text nicht lesen, es ist schließlich ein Song-Text. Er gehört zu einem Song, das ist ja die Idee. Ich bin Songwriter, kein Dichter. Darin besteht meine Arbeit, und die Songs sagen aus, was auch immer ich in sie hineinschreibe: einfach, was ich kenne, womit ich aufgewachsen bin.
Könnten Sie ein wenig über Ihren familiären Hintergrund erzählen?
Ein Versager in einer Kleinstadt. Ich bin oft von zu Hause abgehauen, dauernd nach New York, da habe ich auch übernachtet und im Café Wha? unten im West Village gespielt, ein paar Jahre ging das so. Ich habe ein paar Leute kennengelernt, und meine Eltern sind weggezogen, ich blieb hier in der Gegend und habe einfach weitergespielt. Gespielt und gelebt. Ich war auf der Highschool, und das war’s im Grunde. Das ist die Kurzversion.
Was denken Sie darüber, dass Sie und Ihre Musik von der Kritik im Moment so viel Aufmerksamkeit bekommen?
Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das was Gutes. Es ist nett – na gut, es ist krass. Aber ich lasse mich davon nicht so beeindrucken oder reinziehen, letztlich sind Zeitungen einfach nur Zeitungen. Ich weiß nicht, wie sehr sie die Leute beeinflussen; wir bekommen viel Aufmerksamkeit und viele Besprechungen, aber ich verdiene nach wie vor 115 Dollar in der Woche und lebe immer noch in New Jersey. Hauptsache, ich bin froh, eine gute Band zu haben und dass ich Konzerte spielen kann und was zu tun habe und herumreisen kann. Ich weiß nicht viel über die Presse und was die so macht.
Aber Sie bekommen auf einmal sehr viel Anerkennung.
Ach, so auf einmal kommt das für mich gar nicht. Mein erstes Album vor zwei Jahren wurde sehr gefeiert, dann ließ die Begeisterung nach, auch bei der Plattenfirma, die unser zweites Album nicht promoten wollte. Dann haben sie beschlossen, dass sie das zweite Album doch promoten wollen. Dann haben wir in New York gespielt, zum ersten Mal seit langer Zeit, und die Band hatte sich sehr verändert. Irgendwie kommt es mir so vor, als würde ich besser werden.
Warum wollte die Plattenfirma das zweite Album nicht promoten?
Aus einer Million Gründen, die eigentlich gar keine waren. Irgendjemand hat wahrscheinlich nicht daran geglaubt und fand es nicht gut. Es ging ums Geschäft. Letztlich ist es aber völlig egal. Das ist den meisten gar nicht klar, dass sich dadurch nichts ändert, wenn man nicht promotet wird und dies nicht und jenes nicht passiert – dass es einfach egal ist. Wenn du die Musik hast und daneben noch etwas anderes – die Musik und –, dann reicht das. Wenn du es schaffst, schaffst du es auch so. Angenommen, das zweite Album wäre nicht promotet worden, was anfangs ja der Fall war. Als es draußen war, bekam es aber so viel gute Presse, dass sie es irgendwann nicht mehr ignorieren konnten. Es wurde keine Werbung für das Album gemacht, aber die ganze Zeit darüber geschrieben, darum glaube ich auch nicht an Werbung. Im Grunde hasse ich Werbung – ich habe noch keine für mich gesehen, die mir gefällt. Sie ist unnötig. Die Werbung lobt dich in den Himmel, dabei braucht es das gar nicht. Bei einem bestimmten Künstlertyp sollte dieser ganze Rummel nicht nötig sein. Leute, die nicht spielen können (lacht), muss man in den Himmel loben, da sie es anders nicht schaffen werden. Aber Leute, die es draufhaben, die gut sind, brauchen das nicht, weil die Musik für sich selbst spricht. Deshalb brauche ich auch gar nicht darüber zu sprechen, weil die Musik für sich selbst spricht und ich ihr nichts hinzuzufügen habe und sie nicht bereichern kann, indem ich über sie rede.
Wo haben Sie gelernt, Songs zu komponieren und zu texten?
Ich habe es nicht gelernt. So was lernt man nicht. Ich weiß nicht – lernen … Ich glaube nicht ans Lernen. (Lacht.) Man macht es einfach, das ist alles, und ich kann es eben. Okay, ich habe in der ersten Klasse schreiben gelernt, aber ansonsten … kann ich es eben. Ich bin irgendwann mit dreizehn oder vierzehn aufgewacht und habe angefangen, ein paar Songs zu schreiben. Am Anfang waren sie noch ziemlich schlecht, aber ich habe einfach immer weiter Songs geschrieben. So etwas kann man nicht lernen, man macht es einfach.
Wie sehr beruhen Ihre Songs auf persönlichen Erfahrungen?
Im Grunde beruht alles darauf. Ich habe noch kein Wort gesungen und keine Note gespielt, die nicht auf etwas zurückgeht, das mir irgendwann mal passiert ist. Die Frage ist, wie wörtlich man das versteht, aber es basiert alles direkt oder indirekt auf persönlichen Erfahrungen. Man verändert sie etwas – man ändert die Namen, um Unschuldige zu schützen (lacht) und Ähnliches.
Können Sie ein paar Beispiele nennen? Mir gefällt der Song »4th of July, Asbury Park«. Welche Erfahrungen haben Sie dazu inspiriert?
Na ja, ich lebe in Asbury Park! Schon eine ganze Weile. Ich wohne nur einen Block von der Strandpromenade entfernt. Bevor ich richtig zu arbeiten anfing – gut, die letzten zwei Jahre hatte ich viel zu tun, die letzten eineinhalb Jahre, aber davor habe ich kaum was gemacht. Ich wurde hier und da mal für einen Auftritt gebucht und hatte ansonsten viel Freizeit. Abends ist das halt, was man so macht: Man hängt eben rum. Und man begegnet Leuten und beobachtet Dinge, und das war’s. Ich will jetzt nicht sagen: »Da war dieses Mädchen, und dies und das.«
Oder anders gefragt: Was bedeutet Asbury Park für Leute, die in New Jersey oder in der Gegend, in der Sie Ihre Kindheit und Jugend verbracht haben, aufgewachsen sind?
Gar nichts. Es ist einfach nur eine schäbige Stadt. Sie hat keine Bedeutung.
Aber man begegnet dort sicherlich vielen Menschen.
Es gibt die Strandpromenade – die Leute werden immer von den hellen Lichtern angezogen, und den Fahrgeschäften und Spielen. Die Jugendlichen hängen da rum, abends sind wir alle dort. Allerdings war ich früher viel öfter da als jetzt; diesen Sommer war ich nicht ein einziges Mal da.
Wie sehen Sie New York City? Sie haben viel über die Stadt geschrieben, wie würden Sie den Unterschied zwischen den beiden Städten beschreiben?
New York war für mich der Ort, an dem ich ich selbst sein konnte. Es war wirklich hart in Asbury; wenn man mit fünfzehn oder sechzehn nach New York fährt und aus dem Bus steigt, ist man eine andere Person. Oder man ist man selbst. Es war ein Zufluchtsort, ein sehr guter. Um meinen Eltern zu entkommen, den anderen Jugendlichen, dem ganzen Umfeld. Wenn ich nach New York kam, war es schlicht überwältigend. Du kommst da an, ohne Plan und ohne Geld, nur mit ein paar Dollar, und steigst aus dem Bus: Das ist einfach nur überwältigend. Ich mochte dieses Gefühl sehr.
Und das haben Sie in Ihre Musik einfließen lassen, wie in »Does This Bus Stop on 82nd Street«?
Das habe ich im Bus geschrieben!
Oder »New York City Serenade«. Wie sind Sie auf diesen Song gekommen?
Teile davon lagen schon seit etwa einem Jahr herum, ein oder zwei Strophen; dann ging es sehr schnell und ich habe den Song an einem Tag oder so geschrieben. Viele meiner Songs sind so entstanden. Es geht um Dinge, die mir einfach sehr viel bedeuten. Das ist mein Leben, und die Songs beschreiben meist einen Teil meines Lebens, an den ich mich erinnern möchte – auch wenn sie wahrscheinlich aus Erfahrungen in meinem Leben entstanden sind, die ich am liebsten vergessen würde. Die Momente, die ich aufschreibe, sind die, an die ich mich erinnern möchte. Das ist vielleicht etwas verwirrend.
Wenn man also in Asbury Park aufwächst, aber nahe New York City …
… hat man ein bisschen mehr Freiräume. Das war meine große Freiheit als Jugendlicher, dass ich immer in die City abhauen konnte, und wenn es mir dort zu viel wurde, konnte ich wieder gehen. Es gab viele Typen, die diese Möglichkeit eben nicht hatten. Ich konnte mir also das Beste aus beiden Welten herauspicken und kann darum auch über viele schwierige Themen trotzdem optimistisch schreiben. Ich kann darüber schreiben, wie schön es im Sommer in der City ist, während viele Menschen dort nicht rauskommen. Ich hatte immer die Wahl: Ich konnte dorthin abhauen, um von hier wegzukommen, und ich konnte von da wieder hierher abhauen.
Sie arbeiten gerade an einem neuen Album, wie gehen Sie da vor?
Ich schreibe immer viel, während ich aufnehme, weil ich da solche Energieschübe bekomme. Es gibt ein paar neue Songs, ein oder zwei haben wir schon bei Auftritten gespielt, aber ich ändere meine Meinung während der Aufnahmen so oft und schreibe so viel Neues, dass ich noch nicht weiß, wie es wird.
Wir würden gern noch mehr mit Ihnen über einzelne Songs sprechen. Könnten Sie ein wenig über »Kitty’s Back« erzählen?
Es ist ein Striptease-Song. Die Fortsetzung von »The Stripper« von David Rose & His Orchestra. (Lacht.) Es ist ein merkwürdiger Song, irgendwie Big-Band-artig.
Ich mag ihn, weil er diese heiße Stimmung hat. Man spürt die Hitze. Darum will ich auch einen Trompeter in die Band holen, weil eine Trompete für unglaublich viel Hitze sorgen kann. Und die will ich. Instrumente haben unterschiedliche Temperaturen. Natürlich hängt es auch davon ab, wer sie spielt, aber eine Trompete hat einfach diese tolle lateinamerikanische Hitze, die ich mag. Und »Kitty’s Back« hat sie auch.
Benutzen Sie verschiedene Instrumente, um bestimmte Gefühle auszudrücken? Ich finde das bei »New York City Serenade« sehr gelungen, wie es langsam anfängt und sich dann immer weiter steigert …
Wir spielen das Stück jedes Mal ein bisschen anders. Ich spiele es bei unseren Auftritten besonders gern, und zwar lang. Es entsteht dabei dieser Beat, dieser Groove, und es geht immer weiter, ewig. Das ist einer dieser Songs, die sich mit einem Rhythmus vereinigen und gar nicht mehr aufhören, bis spät in die Nacht. Der Song ist wirklich etwas sehr Besonderes für mich. Ich weiß nicht mal genau, warum – es ist schwer, das zu erklären. Sie müssen es mal bei einem Konzert von uns miterleben.
Ich war bei Ihrem Konzert im Central Park.
Ich glaube nicht, dass wir die Nummer im Central Park gespielt haben.
Sie haben »Jungleland« gespielt.
Ja, das ist ein neuer Song. Aber Sie müssen uns »New York City« spielen sehen, um es wirklich zu verstehen, weil der Song so stark vom Rhythmus der Straße lebt. Und es gibt so viele kleine Kämpfe, die sich in dem Song abspielen, und doch fügt sich alles.
Wie würden Sie »Rosalita« beschreiben?
Das habe ich auch an einem einzigen Tag geschrieben. Es rockt. Es ist ein Tanzlied. Der Song spricht für sich selbst, ich habe da nichts hinzuzufügen. Ich könnte über die persönlichen Erfahrungen sprechen, auf denen er beruht, aber das will ich nicht.
Könnten Sie uns zumindest erklären, was der Song erzählt?