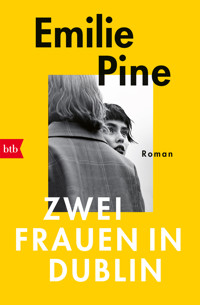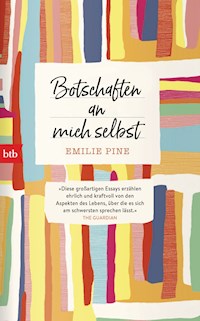
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein radikal aufrichtiges Debüt. Der Nummer-1-Bestseller aus Irland: Emilie Pine spricht wie niemand sonst darüber, was es heißt, im 21. Jahrhundert eine Frau zu sein. Es ist das Buch einer ganzen Generation. Ein Buch über Geburt und Tod, sexuelle Gewalt und Gewalt gegen sich selbst, weiblichen Schmerz, Trauer und Infertilität. Es ist ein Buch über den alkoholkranken Vater, über Tabus des weiblichen Körpers. Und es ist trotz allem ein Buch über Freude, Befriedigung und Glück – unbändig, mutig, und absolut außergewöhnlich erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 265
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zum Buch
Ein radikal aufrichtiges Debüt. Der Nummer-1-Bestseller aus Irland: Emilie Pine spricht wie niemand sonst darüber, was es heißt, im 21. Jahrhundert eine Frau zu sein. Es ist das Buch einer ganzen Generation. Ein Buch über Geburt und Tod, sexuelle Gewalt und Gewalt gegen sich selbst, weiblichen Schmerz, Trauer und Infertilität. Es ist ein Buch über den alkoholkranken Vater, über Tabus des weiblichen Körpers. Und es ist trotz allem ein Buch über Freude, Befriedigung und Glück – unbändig, mutig und absolut außergewöhnlich erzählt.
Zur Autorin
EMILIE PINE ist Associated Professor für Modernes Drama an der School of English, Drama and Film am University College Dublin. Ihre zahlreichen wissenschaftlichen Veröffentlichungen wurden vielfach ausgezeichnet. »Botschaften an mich selbst« ist ihre erste Sammlung persönlicher Essays, die international euphorisch gefeiert und unter anderem mit dem »Irish Book of the Year«-Award ausgezeichnet wurden.
EMILIE PINE
Botschaftenanmich selbst
Essays
Aus dem Englischen von Cornelia Röser
Die irische Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel »Notes to Self« bei Tramp Press, Dublin.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Copyright der Originalausgabe © 2018 by Emilie Pine
Umschlaggestaltung: semper smile, München nach einem Entwurf und unter Verwendung einer Illustration von Karine Picault © Éditions Delcourt, 2019
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25240-3V001www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Ronan
Inhalt
Über Unmäßigkeit
Aus den Babyjahren
Reden/Nicht reden
Über das Bluten und andere Verbrechen
Etwas über mich
Das steht nicht im Lehrplan
Danksagung
Über Unmäßigkeit
Als wir ihn finden, liegt er schon seit Stunden in seinem Kot.
Das Allgemeine Krankenhaus Korfu ist verwirrend. Im Foyer stehen lauter Patienten und rauchen, aber eine Information oder Anmeldung gibt es nirgends. Ich frage ihn per SMS, wo er ist, bekomme aber keine Antwort. Wir spüren ihn auf wie Bluthunde und finden ihn im fünften Stock, wo er entkräftet im Bett liegt. Es ist Abend, und er sagt, er habe seit mittags keine Pflegekraft und keinen Arzt oder Ärztin mehr gesehen. Er sagt, er brauche eine Bettpfanne. Meine Schwester und ich sind seit über vierundzwanzig Stunden unterwegs und haben nicht geschlafen. »Ruf eine Krankenschwester«, sage ich. Er sagt, das habe er schon, aber es sei nichts passiert. »Versuch es noch mal.« Er nimmt den Rufknopf und drückt ihn mehrmals. Nach einer Weile kommt eine gestresst aussehende Schwester, die erst ihn anschreit und dann uns. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich kein Griechisch kann. Mit sinnlosen Gesten deute ich auf den Mann im Bett. Ich versuche, ihr klarzumachen, dass er eine Bettpfanne und frische Laken braucht und gewaschen werden muss. Nichts davon scheint bei ihr anzukommen. Die Schwester sagt noch irgendetwas, wirft die Hände in die Luft und geht. Mein Vater sieht uns verzweifelt an. Ich bitte meine Schwester, bei ihm zu bleiben, und gehe hinaus in den Flur, wo ich jedoch nur andere Patientinnen, Patienten und deren Familien antreffe. Ich gehe zur Schwesternstation, aber da ist niemand. Als ich wieder umkehre, ohne die leiseste Ahnung, was ich jetzt tun soll, spricht mich eine Frau auf Englisch an. Sie fragt, ob alles in Ordnung sei, und ich ergreife die Chance und frage, ob sie wisse, wo die Krankenschwestern wären. »Krankenschwestern gibt es hier nicht«, sagt sie. Ein älterer Mann beugt sich zu mir: »Wenn man hier keine Familie hat, stirbt man.«
Das soll in den folgenden Wochen in Griechenland eine Art Mantra für uns werden, während wir versuchen, unseren Vater wieder auf die Beine zu bringen. Schon sehr bald erfahren wir, wie unterbesetzt das Krankenhaus wirklich ist: Nach vierzehn Uhr ist kein Arzt mehr im Haus und nach siebzehn Uhr nur noch eine Pflegekraft pro Station. Ich zähle sechs Zimmer auf diesem Flur, jedes mit bis zu sechs Patientinnen und Patienten. Für so viele Menschen kann eine Pflegekraft allein kaum die medizinische Grundversorgung leisten, um sich um Inkontinenz zu kümmern, fehlt ihr die Zeit. Außerdem erfahren wir, dass dieser Flur – offiziell die »Innere Medizin« – hier »Sterbetrakt« genannt wird.
Die englischsprechende Einheimische teilt mir mit, dass ich mich selbst um meinen Vater kümmern muss. Freundlich erklärt sie mir, wo ich Inkontinenzeinlagen, Feuchttücher und Papierhandtücher kaufen kann. Kaum fähig, das alles zu verarbeiten, gehe ich zurück in das Einzelzimmer, das mein Vater seinem ernsten Zustand verdankt, und erkläre meiner Schwester unsere Lage. Sie sieht mich ungläubig an. Sie steht am Kopfende von Dads Bett und schüttelt sein Kissen auf. Mir wird bewusst, dass ich bisher kaum mit ihm gesprochen habe, obwohl ich seinetwegen quer durch Europa angereist bin. »Immerhin bist du am Leben«, sage ich. Er nickt. Er sieht sehr klein aus in diesem Bett. Klein und verloren. Ich beschließe, dass das so nicht bleiben kann – irgendwo in diesem Krankenhaus muss doch jemand zuständig sein. Ich gehe wieder hinaus auf den Flur und frage die nette Frau, ob sie mir helfen würde, einen Arzt zu suchen. Sie spricht kurz mit ihrer Familie und geht dann los, den Flur hinunter. Ich folge ihr. Mit dem Aufzug fahren wir auf eine andere Etage, aber auch dort ist nirgendwo ein Arzt oder eine Ärztin. Wir steigen wieder in den Aufzug und versuchen es noch einmal. Das wiederholen wir so lange, bis wir im Keller landen und dort die Flure absuchen. Schließlich finden wir die Blutspendestation mit dem betreuenden Arzt. Meine neue Freundin schiebt mich durch die Tür und winkt mir zum Abschied.
Auf einem Sofa in einer Ecke des Raums liegt ein Mann, den Ärmel hochgekrempelt und über einen intravenösen Zugang an einen Transfusionsbeutel angeschlossen. Er spendet Blut, und der Arzt scheint zu glauben, ich wäre ebenfalls zum Spenden hier. Als er meine Überraschung bemerkt, erklärt er mir, dass in Griechenland landesweite Blutknappheit herrsche und Angehörige von Patienten gesetzlich zum Blutspenden verpflichtet seien. Ich denke an meine Schwester, die sich fünf Stockwerke über uns vermutlich schon fragt, wo ich bleibe. Ich schüttle den Kopf, finde aber keine Worte. Ich bin nicht in der Lage, ihm zu erklären, dass wir beide unter Anämie leiden und nicht spenden können. Ich ergreife seine Hand und bitte ihn, nach meinem Vater zu sehen. Ich sage ihm, dass ich nicht verstehe, was los ist, dass mein Vater allein in einem Zimmer liegt und kein Arzt da ist. Ich sage ihm, wir wollen nur jemanden, der uns alles erklärt – obwohl ich eigentlich jemanden will, der mir sagt, was ich tun soll. Der Adrenalinschub, der mich wie auf einer Welle bis hierher getragen hat, ebbt plötzlich ab, und ich fühle mich nur noch leer. Ich stehe einfach nur da und bitte den Arzt, nach meinem Vater zu sehen. Äußerst widerstrebend sagt er etwas zu der Frau an der Anmeldung und verlässt die Station. Wir fahren hinauf in den fünften Stock und gehen den Weg zurück, den ich gekommen bin, vorbei an den traurigen Patienten im Flur und in Dads Zimmer.
»Hier ist ein Arzt«, sage ich mit mehr Hoffnung als Überzeugung in der Stimme. Er nimmt Dads Krankenblatt, überfliegt es, nickt und sagt: »Ihr Vater hat viel Blut verloren. Er wird Transfusionen brauchen. Sie müssen Blut spenden.« Es erscheint mir einfacher, ihm zuzustimmen, obwohl ich mir eine gründlichere Untersuchung erhofft hatte. Die folgenden Wochen werden nach genau demselben Muster ablaufen: stundenlanges Warten gefolgt von einem Ringen um Aufmerksamkeit, nur um dann etwas zu erfahren, das wir bereits wissen. Jahrelang habe ich Beckett-Stücke unterrichtet, jetzt lebe ich in einem.
Nach seiner Verkündung nickt der Arzt noch einmal und geht. Als er fort ist, suche ich im Blick meines Vaters nach Rat, doch er sucht in meinem nach Halt, den ich nicht geben kann. Ich probiere ein Lächeln. Wir sind jetzt über eine Stunde hier, und ich weiß zwar, dass er erleichtert ist, uns zu sehen, und meine Schwester hat seine Hand gestreichelt, damit er sich nicht mehr so allein fühlt, aber er liegt immer noch in dem schmutzigen Bett. Da uns sonst niemand helfen wird, bitte ich meine Schwester mitzukommen. »Wir sind gleich wieder da.« Unten finden wir den Krankenhauskiosk, in dem es neben einer praktischen Auswahl an Snacks und Heißgetränken auch all jene Produkte zu kaufen gibt, die man zur Versorgung von Patienten braucht. Wir kaufen Feuchttücher und Einlagen. Einer nachträglichen Eingebung folgend, legt meine Schwester eine Packung OP-Handschuhe dazu, die sich noch als unbezahlbar erweisen werden.
Als wir Dad erklären, was wir vorhaben, reagiert er verstört und beschämt. Aber der Gestank im Zimmer ist inzwischen schlimm geworden, was uns so effizient und sachlich wie irgend möglich vorgehen lässt. Wir waschen ihn. Die schmutzigen Laken knülle ich zusammen, bringe sie in einen Raum, den ich für eine Wäschekammer halte, und lasse sie mit schlechtem Gewissen dort liegen. Auf einer offenbar nicht genutzten Station nehme ich mir das Laken von einem und die Decken von einem anderen Bett, denn mir ist klargeworden, dass man hier nichts bekommt, wenn man es sich nicht holt. Als ich wieder ins Zimmer komme, hat meine Schwester es geschafft, Dad zum Lachen zu bringen. Wir stecken die frischen Laken um ihn herum fest, und mir wird bewusst, wie sehr unser Empfinden von Menschlichkeit von solchen einfachen Dingen abhängt. Im Grunde hat sich nichts verändert, und ich weiß kein bisschen mehr über Dads Gesundheitszustand, aber ich habe das Gefühl, wir haben etwas Gewaltiges geschafft.
Es wird spät. Wir einigen uns darauf, dass ich die Nacht über im Krankenhaus bleibe und meine Schwester sich ein Hotel in der Stadt nimmt. Ich würde sie gern begleiten, aber von jetzt an werden wir immer abwechselnd bei Dad bleiben. Sie kommt gerade noch rechtzeitig von der Station – um dreiundzwanzig Uhr werden die Türen abgeschlossen. Es wird geduldet, dass Familienangehörige über Nacht bleiben, aber die Tür verhindert, dass sie kommen und gehen können. Ich umarme meine Schwester zum Abschied und gehe wieder ins Krankenzimmer. Um die einsame Suche nach einer Unterkunft beneide ich sie nicht, aber ich habe auch keine Ahnung, wie ich die Nacht hier im Krankenhaus durchstehen soll. Dad hat das Bewusstsein verloren. Ich lausche auf seinen Atem und lege die Hand auf seine Brust, um sein Herz zu spüren; es schlägt gleichmäßig, auch wenn es sich sehr schwach anfühlt. Skeptisch beäuge ich den Blutbeutel neben seinem Kopf, der beinahe leer ist. Ich glaube nicht, dass ich die Kraft habe herauszufinden, was zu tun ist, wenn er leer ist. Ich wähle die Nummer seiner Versicherung, erreiche aber nur eine Bandansage. Dann fällt mir ein, dass das Ladegerät noch in der Tasche meiner Schwester steckt, und ich verwerfe den Gedanken, noch jemanden anzurufen.
Ich schalte das Licht aus, schaue aus dem Fenster über die Hügel im Norden und lausche auf die Nachtruhe, die sich in der Station ausbreitet. Es wird so kalt, dass ich mehrere Decken über Dad breite. Ich selbst sitze im Mantel da und warte. Nach einiger Zeit geht die Tür auf, und die gestresste Schwester kommt herein. Stumm sehe ich zu, wie sie den leeren Blutbeutel abnimmt, einen frischen anhängt und ihn drückt, um sicherzugehen, dass das Blut einläuft. Sie trägt eine Schürze, die an einen Metzger im Schlachthof erinnert. Erst als sie wieder weg ist, fällt mir auf, dass sie weder Handschuhe getragen noch sich die Hände gewaschen hat.
Später in der Nacht kommt eine andere Schwester, und ich schaffe es, zu lächeln und ihr die Packung OP-Handschuhe anzubieten. Vorsichtig nimmt sie ein Paar heraus und steckt es sich in die Tasche. »Nein, nein«, sage ich liebenswürdig lächelnd. Ich gebe ihr pantomimisch zu verstehen, dass sie sie anziehen soll, doch sie wackelt nur mit den Fingern, um mir zu zeigen, dass sie bereits Handschuhe trägt. Auf ihren sind allerdings Blutflecken, und ich sage ihr mit Gesten, sie soll sie ausziehen und die neuen anziehen. Die ganze Pantomime muss lächerlich aussehen, und vermutlich hält sie mich für irre, aber ich mache so lange weiter, bis sie seufzend die Handschuhe wechselt. Das alte Paar wandert in ihre Tasche. Verstehen werde ich das alles erst einige Tage später, als mir ein anderer Besucher erklärt, dass das Krankenhaus keinerlei Einwegprodukte bereitstellt – weder Watte noch Papier noch Plastik. Die Pflegekräfte müssen sie selbst kaufen – von Löhnen, die ohnehin vorne und hinten nicht reichen. Die Handschuhpantomime wird zu einer regelmäßigen Aufführung, und jedes Mal, wenn ich einer Schwester ein neues Paar gebe, ist mir zum Heulen zumute.
In jener ersten Nacht jedoch, in der ich halb döste und halb ängstlich auf den nächsten Atemzug meines Vaters lauschte, war ich zu überwältigt, um zu weinen. Ich hatte seit Jahren mit diesem Anruf gerechnet und mir die Szenarien ausgemalt, sodass ich, als es so weit war, alle notwendigen Entscheidungen treffen konnte. Erst hier, im stillen, dunklen Krankenzimmer begriff ich, dass der Anruf erst der Anfang gewesen war.
Es ist Sonntagmorgen, als ich das Piepen höre, zu früh, als dass es eine harmlose Nachricht sein könnte. Der Text lautet: »Ich blute. Ruf nicht an.« Ich rufe an. Er klingt furchtbar. Er klingt nach dem, was er ist: einem Mann, der gerade verblutet. Er würgt und hustet und kann kaum sprechen, weil das Blut schwallweise aus ihm hervorbricht. Ich sage, er soll warten, und rufe seine Freundin P. an, die auf der anderen Seite der Insel wohnt, und sie ruft die Ambulanz. Doch der Fahrer will nicht rausfahren. Er verbringt den Sonntag mit seiner Familie. Offenbar glaubt er, die Fahrt würde sowieso vergebens sein, mein Vater wäre bei seiner Ankunft schon tot und könne dann auch bis Montag warten. P. schimpft und schmeichelt. Es dauert lange, bis sie und ihr Mann den Fahrer zum Aufbruch überreden können, obwohl Sonntag ist und die Fahrt eine Stunde dauert. All das erzählt mir P. erst später. Jetzt nimmt sie mir nur das Versprechen ab, dafür zu sorgen, dass Dads Haustür offen ist. Bei verschlossener Tür würden sie wieder umkehren. Ich rufe Dad zurück. Zum Glück ist er noch bei Bewusstsein, und er robbt zur Tür und dreht den Schlüssel um. Als der Krankenwagen in sein Dorf kommt, weisen ihm die Nachbarn den Weg zu seinem Haus. Das Notarztteam liest Dad vom Boden auf, wo er inzwischen ohnmächtig geworden ist, und bringt ihn ins Krankenhaus.
Im Winter gibt es keine Direktflüge von Irland nach Griechenland. Stunden nach dem Anruf fliegen meine Schwester und ich von Dublin nach Heathrow, wo unser erster Zwischenstopp ist. Das Flugzeug ist voller Männer mit Schals, offenbar läuft irgendein wichtiges Fußballspiel. Im neuen Terminal vier essen wir in einem italienischen Restaurant. Es ist grotesk, sich Gedanken ums Essen zu machen, wenn der eigene Vater im Sterben liegt, trotzdem bestelle ich Trüffelpasta, und sie ist köstlich.
Beim Essen sage ich meiner Schwester, dass ich nicht wisse, was uns bei unserer Ankunft in Griechenland erwartet. Ich sage ihr, dass ich müde bin. Ich erzähle ihr von dem Abend vor einigen Jahren, als ich Dad gebeten habe, mit dem Trinken aufzuhören. Ich erzähle, wie er sich, noch während ich sprach, das nächste Glas Wein einschenkte. Wie ich weinte und er sagte, ich solle mich nicht anstellen. Ich erzähle ihr, dass ich ihm gedroht habe, dass ich gesagt habe, ich würde ihn nicht mehr lieben. Obwohl ich es mir selbst kaum eingestehen kann, erzähle ich ihr, dass ich ihn irgendwann an jenem Abend angesehen und gedacht habe: »Stirb doch einfach.«
Während wir essen und reden, schauen wir immer wieder auf unsere Handys, ein Reflex, der genauso hilfreich wie furchtbar ist. Wir haben nichts mehr von ihm gehört, seit er ins Krankenhaus gebracht wurde, und wir wissen beide, dass er tot sein könnte. Mein Handy piept, und ich greife danach, aber es ist nur ein automatisches Update. Meine Schwester sieht mich an. Sie weiß, dass ich nie aufhören könnte, ihn zu lieben. Am nächsten Morgen nehmen wir den ersten Flug nach Athen, wo wir in eine Maschine nach Korfu steigen.
Sie nennen ihn »Leiche«. Er ist an Geräte angeschlossen, die sein Herz und andere lebenswichtige Organe überwachen. Er hat zwei intravenöse Zugänge, aber weil er so viel Blut verloren hatte, hatten die Schwestern Schwierigkeiten, eine brauchbare Vene zu finden. Die meiste Zeit ist er kaum bei Bewusstsein. Von seinem Spitznamen erfahren wir erst, als uns ein griechischer Besucher in den Witz einweiht. Es ist typisch: Wie das meiste, was mit Dad zu tun hat, ist es gleichzeitig lustig und nicht lustig. Niemand glaubt, dass er überleben wird, nicht einmal die Pflegekräfte. Aber … er stirbt einfach nicht. Nach einer Woche auf dieser Lebensendstation im Allgemeinen Krankenhaus, wo Tag und Nacht immer eine von uns beiden bei ihm ist, wird er für stabil genug befunden, um eine Verlegung in die »englische« Klinik zu überstehen, was übersetzt im Grunde so viel heißt wie »Klinik für Leute mit Krankenversicherung«. Es ist eine riesige Verbesserung: Sie haben zwei Pflegekräfte pro Schicht und nur halb so viele Patientinnen und Patienten. Dad wird zum ersten Mal gewaschen und bekommt einen Katheter. Dort wird es nicht als die Pflicht der Familienangehörigen angesehen, für Bettpfannen und deren Entleerung zu sorgen.
Jeden Tag kommen wir um elf Uhr vormittags in die Klinik, bleiben bis fünf am Nachmittag, gehen dann etwas essen und kommen noch mal für einige Stunden zurück. Seite an Seite sitzen wir da und beobachten ihn, stundenlang, fast ohne zu sprechen, wir wachen nur über den Mann im Bett. Noch immer rechnen wir damit, dass er stirbt, und sind ununterbrochen bei ihm, als könnten wir ihn mit unserer Willenskraft am Leben erhalten. Lange Stunden, unterbrochen von einer Reihe kurzer, frustrierender Unterhaltungen mit ausweichenden Ärzten, die ihn oberflächlich untersuchen, um dann zu verkünden, dass wir ihn nach Irland bringen sollen. Mit einer Lebererkrankung sei man nämlich, wie sie sagen, in Irland besser aufgehoben. Die Ärzte »da drüben« hätten reichlich Erfahrung damit.
Dad hat eine vollständige Leberinsuffizienz. Seine übrigen Organe haben die verminderte Leberleistung jahrelang kompensiert, doch jetzt, nach vier Jahrzehnten Alkoholismus, gibt sein Körper auf. Ich war immer davon ausgegangen, er würde an einer Zirrhose sterben, aber wie sich herausstellt, hat er mit einer ganzen Menge anderer tödlicher Erkrankungen zu kämpfen. Die Blutung aus einem Riss in seiner Speiseröhre hätte ihn zwar fast umgebracht, ist aber nur das sichtbarste Symptom. Ich erinnere mich an frühere Anzeichen: wie Dad im Auto anhält und Blut an den Straßenrand spuckt. Jetzt ist außerdem der Zustand seiner Nieren kritisch. Allerdings sagt der Spezialist, sein Herz sei in guter Verfassung. »Aus medizinischer Sicht vielleicht«, möchte ich sagen.
Nach einer Woche befinden die Ärzte, seine Speiseröhre sei ausreichend verheilt. Er darf wieder einfache, weiche Nahrung zu sich nehmen. Aber er will nicht essen. Oder er will nicht das essen, was er bekommt: Eier.
»Ich mag keine Eier.«
»Du musst essen.«
»Aber du weißt, dass ich keine Eier mag.«
»Ist mir egal, du musst essen.«
In diesem Rollentausch, das Kind, das sein Elternteil füttert, liegt eine bittere Ironie. Wir sind alle hier, weil er gern trinkt, und jetzt besitzt er die Frechheit, nicht essen zu wollen. Wir schließen einen Deal. Wenn er ein hartgekochtes Ei isst, kaufe ich ihm Stifte und Papier. Später verspreche ich ihm einen Tacker, wenn er ein zweites Ei isst. Als Schriftsteller verunsichert es ihn, wenn er nicht über die Mittel verfügt, um Sachen aufzuschreiben und zu ordnen. Er beschreibt mir lebhaft und detailliert, wo ich diese essentiellen Materialien kaufen soll, aber am Ende isst er doch nur ein halbes Ei.
»Kein Tacker«, sage ich zu ihm.
Er spricht einen ganzen Tag nicht mit mir.
*
Neil ruft täglich an, manchmal zweimal am Tag. Es ist eine der wenigen Nummern, bei denen ich unbeschwert ans Telefon gehen kann. Neil ist Dads bester Freund. Wenn Dad sich weigert zu essen, oder wenn seine Versicherung sagt, sie würde die Rechnung für die Privatklinik nicht übernehmen, oder wenn der Arzt sagt, Dad wird wahrscheinlich sterben, dann glaube ich, ich müsste vor Schmerz laut aufschreien. Aber dann klingelt das Handy, und Neil ist dran, und während ich seine beruhigend feste Stimme höre, kann ich wieder daran glauben, dass alles in Ordnung kommt. Er spricht über Dad und über die Ärzte und gibt mir das Gefühl, wir könnten es schaffen. Er weiß, dass er von Dublin aus nicht viel ausrichten kann, genau wie er weiß, dass sein Anruf nichts an der Prognose der Ärzte ändert. Aber er weiß auch, dass ich diese täglichen Anrufe brauche. Neil gibt mir die Nummer eines befreundeten Arztes in Irland, der übersetzen soll, was die griechischen Ärzte sagen. Ich rufe diesen Freund an und beschreibe ihm Dads Zustand, die Liste seiner Gebrechen. Er sagt, ich soll Dad nach Hause bringen. Sofort.
Z, y, x, w, v …
So wurde mir das Alphabet beigebracht. »Meine fünfjährige Tochter kann das Alphabet schneller rückwärts aufsagen als du.« So ging die Wette. Ich wurde aus dem Bett geholt, musste nach unten kommen und vor einem Tisch voller betrunkener Erwachsener das Kunststück vorführen. Die Wette wurde gewonnen und ich wieder ins Bett geschickt. Warum mein Dad beschlossen hatte, mir das Alphabet rückwärts beizubringen – ich weiß es nicht. Ich habe ihn gefragt, und er wusste es auch nicht. Ich schreibe es der Tatsache zu, dass er gern gegen den Strom schwimmt, dass er das Befolgen der Standardregel »a, b, c« als bedrückend normal empfinden würde und dass ich als sein erstes Kind das Experimentierfeld für die Erprobung seiner Theorien war. Und ich war gelehrig. Denn mehr als alles andere wollte ich so sein wie mein Vater und von ihm geliebt werden. Selbst heute verwechsle ich es noch, wenn ich Karteikarten für Studierende ausfülle: p, q, r oder r, q, p?
Dads ungewöhnlicher Erziehungsansatz machte nicht beim Alphabet Halt. Als ich vier war, gingen wir an den Strand, wo ich allein Sandburgen baute, während er auf einem Klappstuhl saß und las. Er hatte nichts zu essen eingepackt, und als ich Hunger bekam, schickte er mich los, andere Kinder zu suchen, damit ich von deren Eltern etwas zu essen bekäme. Es funktionierte. Dad erzählt diese Episode bis heute als Beispiel für seinen Einfallsreichtum. Er hat nie damit hinter dem Berg gehalten, wie gern er die Fürsorgepflicht für seine Kinder anderen überlassen hat.
Wir wurden älter und hatten inzwischen gelernt, dass wir von ihm nichts zu erwarten hatten. Als ich zehn war, ließ Dad uns allein in einem Pub zurück. Er war wütend, weil ich meine fünfjährige Schwester nicht davon abgehalten hatte, ihren Orangensaft in seinen Gin Tonic zu kippen. Er fuhr weg und kam nicht mehr zurück. Wir suchten uns jemanden, der uns etwas zum Abendessen besorgte. Wir suchten uns jemanden, der uns nach Hause fuhr. Wir brachten uns selbst ins Bett. Das war für uns nichts Ungewöhnliches. Wie alle Kinder von starken Trinkern entwickelten wir eine spezielle Art von Wachsamkeit. Wir lernten aus Erfahrung, nicht zu vertrauen. Wir lernten, Krisen zu bewältigen. Und wenn wir ihm in die Quere kamen, konnte er auf sehr kreative Weise verletzende Dinge sagen. Als ich in die Pubertät kam, fing er an, mich »Flittchen« zu nennen, was auf seine ganz spezielle Art gleichermaßen als Beleidigung und als Kompliment verwendet werden konnte.
Es ist schwer, einen Süchtigen zu lieben. Nicht nur physisch anstrengend in dem Sinne, dass man hinter ihm aufwischen und sich um die Aspekte seines Lebens kümmern muss, die er nicht selbst bewältigen kann, sondern auch metaphysisch. Es ist ein Gefühl, als würde man sich selbst gegen die Wand schlagen, nicht nur den Kopf, sondern das ganze Selbst. Gefangen zwischen endlosen Ultimaten (Hör auf zu trinken!) und radikaler Akzeptanz (Ich liebe dich, egal, was ist.) braucht die Person, die den Süchtigen liebt, ihre Liebe jeden Tag vollständig auf und erneuert sie wieder. Ich wollte mich zwingen, ihn abzulehnen, ihn zu verlassen, und schaffte es nicht. Ich schwankte zwischen meiner Sorge um den Mann, der mit einer so schrecklichen Krankheit geschlagen war, und dem Versuch, mich selbst vor den emotionalen Schäden zu schützen, die ein alkoholkranker Vater anrichtet. Erst nachdem ich ihm über Jahre hinweg mein Mitgefühl verweigert hatte, erkannte ich, dass ich damit nur mir selbst wehtat.
Als ich Anfang zwanzig war, zog mein Vater nach Griechenland. Ich setzte ihn ins Taxi und begleitete ihn zum Flughafen, und als ich ihm zum Abschied zuwinkte, war ich mir der Ironie bewusst, dass es normalerweise die Kinder sind und nicht die Eltern, die fortgehen und ein neues Leben beginnen. Ich winkte lächelnd, aber das Herz war mir schwer. Seit der Trennung meiner Eltern, als ich fünf war, hatte Dad immer am glücklichsten gewirkt, wenn er möglichst weit weg von seiner Familie war. Er ist nicht rein zufällig auf eine Insel gezogen, die die meiste Zeit des Jahres schwer zu erreichen ist.
Und jetzt, wie er da in seinem Krankenhausbett liegt, ausgemergelt und von der Krankheit ganz gelb – einer Krankheit, auf deren Fortschreiten er ausdauernd und sehenden Auges hingearbeitet hat –, frage ich mich: Wie kann ich ihn lieben? Wie kann ich ihn retten? Wie kann ich ihn überhaupt erreichen?
Ich muss Dads Pass und die Versicherungsunterlagen aus seinem Haus holen. Zwei Stunden sitze ich im Bus, der in sein Dorf im Norden der Insel fährt. Ein Nachbar entdeckt mich auf der Dorfstraße, und ohne dass ich weiß, wie mir geschieht, bin ich schon nach sehr kurzer Zeit von vielen besorgten Menschen umringt.
»Wo ist der Engländer?«
»Wir haben den Krankenwagen gesehen. Ist er noch am Leben?«
Der Krankenwagen scheint ein ziemlich großes Drama gewesen zu sein. Es werden viele Fragen auf Griechisch gestellt, die ich nicht beantworten kann, weil ich sie nicht verstehe. Ich sage, dass er im Krankenhaus ist. Sie werfen die Hände in die Luft und wehklagen. »Im Krankenhaus« bedeutet für sie praktisch dasselbe wie tot. »Er kommt wieder raus. Ich bringe ihn nach Irland.« Ihre Mienen hellen sich auf. Man winkt mir nach, es wird viel gelächelt, und mir wird der Arm getätschelt.
Ich schließe die Tür zu Dads baufälligem Bungalow auf, gehe durch die Räume und frage mich, wie ich in diesem Chaos aus Büchern und Papieren, die sich auf jeder ebenen Fläche stapeln, einen Pass finden soll. Im Schlafzimmer sind Bett und Fußboden voller Blut, und im Badezimmer sind Boden, Waschbecken und Toilette mit Blut und anderen Flüssigkeiten bedeckt. Es ist verkrustet und stinkt. Ich stehe unter Schock. Ich weiß, dass ich etwas tun muss, dass ich saubermachen muss, aber das überfordert mich. Über Freunde bekomme ich Kontakt zu einem Paar, das früher für die Armee gearbeitet hat und in einem Dorf in der Nähe wohnt. Die beiden zucken mit keiner Wimper, als ich ihnen das Haus und den Zustand der Zimmer zeige. Sie versichern mir, nachdem sie hinter dem Militär her geputzt hätten, würden sie mit allem fertigwerden. Sie machen einen so fähigen und robusten Eindruck, dass ich ihnen die Schlüssel gebe und sie der Aufgabe überlasse. Als ich ein paar Tage später wiederkomme, ist das Haus makellos, als könnte sich dieser Albtraum von Krankheit und Blut niemals hier abgespielt haben.
*
Nach drei Wochen ist Dad stabil, aber noch zu schwach, um zu reisen. Meine Schwester und ich wollen zurück in unser eigenes Leben. Wir sagen es Dad, der bei der Vorstellung, dass wir weggehen, panisch wird. Wir sind hin- und hergerissen. Mein Partner bietet an herzukommen, aber schließlich treffe ich die pragmatische Entscheidung, dass wir abreisen. Für mein Gefühl ist Dad im Krankenhaus gut versorgt und sicher – für sein Gefühl lassen wir ihn im Stich.
Die Heimreise dauert lange, und so bin ich gerade erst einen Tag zu Hause, als der Anruf kommt, der mich wieder nach Korfu zurückbestellt. Aus heiterem Himmel sagt die Klinikleitung, Dad müsse in einem Krankenhaus mit einer Spezialabteilung für Leberpatienten behandelt werden. Und schon wieder habe ich das Gefühl, als würde mein Herz pures Adrenalin pumpen. Wieder buche ich Flugtickets, diesmal um Dad nach Irland zu holen. Einer seiner Freunde hilft uns, indem er Dad vom Krankenhaus abholt und ihn auf dem Flug nach Athen begleitet, während ich ein weiteres Mal die Dublin-Heathrow-Athen-Schicht übernehme. Ich treffe die beiden in Athen in der Bar des Flughafenhotels. Dad schlingt ein Hühnchensandwich hinunter und trinkt Orangensaft. Das Sandwich ist salzig, und die Orangen enthalten Säure, und von beidem haben die Ärzte streng abgeraten. Ich bin erleichtert und wütend, eine vertraute Kombination von Emotionen. In dieser Nacht schlafen wir im selben Zimmer. Dad schafft es nur, vom Rollstuhl zum Bett zu schlurfen. Mit klagender Stimme gibt er Anweisungen. Ich versuche, die Kraft aufzubringen, nett zu sein, und frage mich im Stillen, wann ich hier in die Elternrolle gerutscht bin.
Die Flughafenangestellten am Morgen sind sehr freundlich, sie holen uns vom Hotel ab und bringen uns zum Gate. Der Flug verläuft ohne Zwischenfälle, ich schaue einen Film, Dad schläft. In Gatwick warten wir lange auf den Rollstuhl, und als er da ist und ich losschiebe, wird mir bewusst, wie groß so ein Flughafen eigentlich ist. Dad besteht darauf, durchs Terminal gefahren zu werden, und schaut sich von seinem Platz aus um. Er will in die Apotheke, aber dort sind die Gänge zu schmal. Ich kaufe für ihn ein, was er braucht, und manövriere ihn zur barrierefreien Toilette, damit er sich frisch machen kann. Wir erleben eine kurze, augenöffnende Einführung in die Welt der körperlichen Beeinträchtigung: Menschen lächeln mich sehr mitfühlend an und behandeln Dad, als wäre er unsichtbar.
Dann besteht Ryanair darauf, dass er die Außentreppe zum Flugzeug zu Fuß hinaufgehen muss. Dad sieht erledigt aus, denn das ist für ihn schlicht unmöglich. Ryanair ist unerbittlich, er darf nur an Bord, wenn er eigenständig hinaufkommt. Die Pattsituation wird endlich aufgelöst, als uns das Flughafenpersonal die Hebebühne benutzen lässt, mit der sonst die Bordverpflegung eingeladen wird. Es ist ein kurzer Flug, aber Dad ist jetzt erschöpft. In Dublin werden wir von meiner Schwester und ihrem Partner abgeholt und fahren auf direktem Weg zur Notaufnahme des St.-Vincent-Krankenhauses. Endlich der richtigen Sprache mächtig, melde ich ihn am Empfang an. Im Sichtungsraum stellt ihm die Krankenschwester Fragen. Dann sagt sie, sie wolle Blut abnehmen. Sie greift nach dem Bluttesttablett, und ohne richtig hinzusehen oder ihre Arbeit zu unterbrechen oder auch nur bewusst wahrzunehmen, was sie tut, nimmt sie ein frisches Paar Handschuhe aus einer Schachtel an der Wand. Und ich atme tief aus und denke: Alles wird gut.
Wir alle sind irritiert, als Dad noch am selben Abend aus St. Vincent entlassen wird. Er ist so offensichtlich krank und kann kaum gehen, und wir sind geschockt, dass er nicht zur Behandlung aufgenommen wird. Ich wende mich an die Pflegekraft, und sie erklärt uns, es gebe zwar leere Betten in der hepatologischen Abteilung, das Krankenhaus sei jedoch personell so unterbesetzt, dass sie diese nicht belegen könnten. Als ich mich bei der Leiterin der Notaufnahme beschwere, erklärt diese, mein Vater sei zu Hause besser aufgehoben als auf einer Transportliege in einem Flur. Dass er beinahe gestorben wäre, scheint ihr herzlich egal zu sein. Vielleicht erlebt sie so was auch einfach ständig. Er bekommt einen ambulanten Termin in der Leberklinik für die folgende Woche.
Während der Tage zu Hause hat Dad Zeit, sich zu erholen und wieder normal zu essen, aber im Wartebereich der Leberklinik sehe ich, dass es ihm nicht wesentlich besser geht. Er sitzt vornübergebeugt da, atmet flach und stöhnt immer wieder. Der Facharzt besteht darauf, allein mit ihm zu sprechen. Als Dad aus dem Sprechzimmer kommt, hat er ein Bündel Rezepte dabei und einen Folgetermin in zwei Monaten. Ich kann nicht glauben, dass das alles sein soll, dass ein so schwerkranker Mann keine medizinische Behandlung bekommen soll. Ich frage am Empfang, ob ich mit dem Arzt darüber sprechen könne, werde aber abgewiesen.