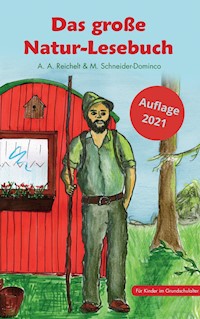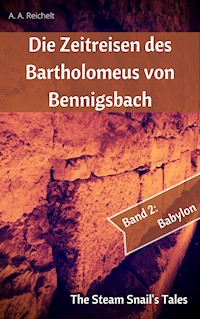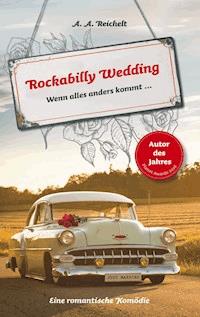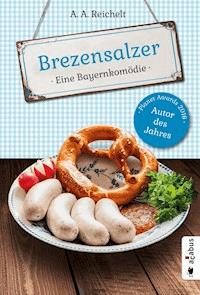
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Acabus Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Nach "Saisonabsch(l)uss" und "Haderlump" erlebt der schrullige Tollpatsch aus Pfarrkirchen ein weiteres humorvolles Abenteuer. In seiner neu gegründeten Praxis bekommt er es mit anhänglichen Angestellten und einem alten Freund mit psychopathischen Zügen zu tun. So hat er sich die letzten fünfzehn Jahre bis zur heiß ersehnten Rente nicht vorgestellt. Ein Glück, dass er die kommenden Wochen mit seiner Familie im Urlaub auf Sylt verbringt. Als ihm am Strand ein Verletzter vor die Füße fällt, bekommt er es auf der Insel erneut mit der Polizei zu tun. Und mit der bayerisch-preußischen Sprachbarriere ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 109
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A. A. Reichelt
Brezensalzer
Eine Bayernkomödie
Reichelt, A. A. : Brezensalzer. Eine Bayernkomödie Hamburg, acabus Verlag 2018
1. Auflage
ePub-eBook: ISBN 978-3-86282-514-1
PDF-eBook: ISBN 978-3-86282-513-4
Print: ISBN 978-3-86282-512-7
Lektorat: Theresa Saretz, acabus Verlag
Cover: © Annelie Lamers, acabus Verlag
Covermotiv: #141653106 | © Alexander Raths - Fotolia.com
Die Erzählung ist frei erfunden. Ähnlichkeiten mit wirklichen Personen oder Ereignissen sind nicht beabsichtigt und rein zufällig.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der acabus Verlag ist ein Imprint der Diplomica Verlag GmbH, Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© acabus Verlag, Hamburg 2018
Alle Rechte vorbehalten.
http://www.acabus-verlag.de
Für meine über alles geliebte Familie
Breze, die
Hochdeutsch: Brezel. Der Name der Breze geht auf das lateinische Wort für »Arm« zurück und weist auf die symmetrisch verschlungene Form hin. In Bayern wird es hauptsächlich als Laugengebäck mit Salz bestreut konsumiert, es sind jedoch auch andere Varianten im Gebrauch.
Brezensalzer, der
Abfällige Bezeichnung für eine Hilfskraft, deren Kompetenz als zu gering bewertet wird, um wichtigere Aufgaben zu übernehmen, wie etwa das Schlingen der Brezen.
Die neue Praxis
Alt.
Er wurde langsam alt.
Mehr konnte er zu solch früher Morgenstunde kaum denken.
Alt und fett.
Aber vor allem alt. Zehn Minuten saß er morgens zumeist auf der Bettkante, bis er genug Energie beisammen hatte, um sich zu erheben. An guten Tagen dachte er während dieser Zeit darüber nach, wie müde er war. Heute reichte es nur für drei Buchstaben, die ihm durch den Kopf gingen: ›alt‹.
Langsam erhob er sich und schleppte seinen Körper leicht humpelnd Richtung Bad. Nach der Morgentoilette war es Zeit, sich dem Frühstück zu widmen. Auf den letzten Metern vor der Küchentür konnte er seine Kinder aufgeregt plappern hören.
Da er alles andere als wach war, fiel es ihm schwer, diesen Geräuschpegel zu ertragen. Vor der Tür stehend holte er zweimal tief Luft und betrat anschließend die Küche.
»Hallo Papa !«, hörte er seine zwei ›Spätze‹ rufen.
»Morgen Kinder!«, antwortete er so fröhlich, wie er nur konnte. Als er dazu lächeln wollte, fühlte sich sein Gesicht wie das vom Joker aus den Batman-Filmen an: leicht verzerrte Mundwinkel, kombiniert mit blasser Haut und zerrauftem Haar. Vor seinem geistigen Auge sah er den Superhelden auf sich zu sprinten, um ihm den Garaus zu machen. Diesen Gedanken abwehrend schüttelte er kurz den Kopf, wischte sich den Schlaf aus den Augen und setzte sich an den Frühstückstisch. Seine Frau gab ihm einen Kuss auf die Stirn und kredenzte ihm einen frisch gebrühten Espresso. Er trank diesen in einem Zug aus und starrte in das Innere der Tasse. Gab es etwas Deprimierenderes als den blanken Boden einer jüngst noch gut gefüllten Espressotasse?
»Na, hast wieder deine ›Bodensehdepression‹, Schatz?«, frotzelte sie.
Sie nahm ihm die Tasse aus der Hand und füllte sie an der Espressomaschine. Das Hinunterdrücken des Handhebels in Kombination mit dem auf Porzellan auftreffenden Heißgetränk war derzeit sein Lieblingsgeräusch. Er schloss die Augen und genoss es.
»Jetzt gib endlich die Butter her!«, holte ihn eine seiner Töchter aus seinen Gedanken.
Als er zu ihnen hinüber sah, hatte die Große der Kleinen gerade die Butterschale aus der Hand gerissen, woraufhin diese langsam die Mundwinkel zu verziehen begann.
»Brauchst doch nicht …«, versuchte er noch rechtzeitig einzuschreiten.
Zu spät. Seine Kleine heulte los.
»Uwäää!«
Ein ganz normaler Morgen.
›Frühstück 2.0‹ würde man es heute wohl nennen.
Eine Stunde später saßen seine Kinder im Bus zur Grundschule beziehungsweise zum Kindergarten. Sein Schatz war damit beschäftigt, die Wohnung zu putzen. Er selbst machte sich zum ersten Mal auf den Weg in seine neue Praxis. Oder zumindest in die Räume, die einmal seine Praxis beherbergen würden. Tags zuvor hatte er die Schlüssel bekommen. Nun galt es, die genaue Anordnung des Mobiliars festzulegen sowie entsprechende Ergänzungen vorzunehmen, wo nötig.
Mit 50 Jahren hatte er es gewagt, sich selbstständig zu machen. Einen eigenen Betrieb zu gründen. ›Midlife Crisis‹ hatten es seine Freunde genannt. Er solle sich ein schnelles Auto kaufen, hatte man ihm geraten. Die Haare färben. Oder sich einen Vollbart und lange Haare wachsen lassen. Doch er hatte weder Interesse an Sportwägen noch an aufwendigen Frisur- oder Bartexperimenten. Aber sein eigener Chef sein, das lag ihm schon eher im Blut. Und da ihn seine Ehefrau darin bestärkte, freute er sich nun auf den neuen Lebensabschnitt.
Der Fußweg zum künftigen Arbeitsplatz führte ihn nun durch einen Teil Pfarrkirchens, der nicht gerade ein Luxusviertel zu sein schien. Je weiter er in diesen Abschnitt seiner Heimatstadt vordrang, desto häufiger waren die Wände mit Graffiti beschmiert. Von manchen Fassaden bröckelte der Putz, was aber nicht verhinderte, dass an jedem Balkon mindestens eine Satellitenschüssel montiert war.
Er schritt weiter einen Hang hinab und erreichte nun seine neue Praxis. In dem Altbau befanden sich bereits drei weitere medizinische Einrichtungen. Ein Zahnarzt, ein Allgemeinmediziner und ein Heilpraktiker hatten sich dort niedergelassen. Nun kam also noch ein Osteopath dazu. Er besah sich die Türschilder der Kollegen. Allesamt hatten sie sich mit ihren Namen verewigt. Dies bereitete ihm schon seit seinem Entschluss, das Angestelltenverhältnis aufzugeben, Kopfzerbrechen. Sein Name war hierfür schlecht geeignet.
Als er durch den Haupteingang trat, sog er die Luft im Treppenhaus tief ein, um sich Mut für das neue Abenteuer zu machen. Es roch nach Zahnarzt. Ihm war ganz und gar unklar, was genau diesen Geruch erzeugte, aber die Herren Zahnärzte konnte er zehn Kilometer gegen den Wind riechen. Oder nicht riechen, je nach Betrachtungsweise. Er hatte furchtbare Angst vor Zahnbehandlungen. Unbewusst rieb er sich die Wange, als ob er dadurch die Erinnerung an das letzte Mal Bohren – „Nein, das ist so oberflächlich, da brauchen wir keine Spritze“ – abwischen könnte. Schnell versuchte er, diese Gedanken zu verdrängen, erklomm die Treppe in den zweiten Stock, schloss die Tür zu seiner Praxis auf und trat ein.
Sein neues Reich.
Auch wenn der genaue Name des neuen Betriebes noch nicht feststand, es sollte sein Arbeitsplatz bis zur Rente werden. Es gab einen Flur, in dem ein kleiner Empfang Platz finden würde, eine Toilette, ein Wartezimmer und einen Behandlungsraum. Alles war noch leer, doch auf dem nagelneuen Parkett durch die Räume schreitend, stellte er sich regen Therapiebetrieb vor. Es würde toll werden. Und sobald er sein Inventar abbezahlt hätte, würde er auch Geld damit verdienen. So der Plan.
Zunächst galt es aber, die Praxis einzurichten. Seine Frau würde in einer Stunde nachkommen und ihm dabei helfen. Bis dahin sollten die wirklich wichtigen Entscheidungen getroffen sein. Er versuchte also, sich die Tische, Stühle und all die anderen Möbelstücke vorzustellen. Doch sobald er damit anfing, den zweiten Raum gedanklich auszustaffieren, hatte er wieder vergessen, was er für den ersten geplant hatte.
Hilfe musste her.
»Für einen Mann kein Problem!«, dachte er sich und ging zur Toilette.
»Die besten Ideen habe ich sowieso auf dem Klo!« Er nahm das Toilettenpapier aus der Wandhalterung und grinste. »Sag ich doch!«
Während er seinen geplanten Behandlungsraum betrat, rollte er das Papier ab. Unter Zuhilfenahme seiner Armspannweite maß er zwei Meter, riss es von der Rolle und legte es auf den Boden. Gleiches tat er ein zweites Mal. Nun versuchte er, achtzig Zentimeter abzuschätzen, und bildete mit den beiden vorigen Papierbahnen ein Rechteck mitten im Raum.
»Fertig ist die Klopapierliege! Jetzt brauche ich noch einen Schreibtisch«, sprach er mit stolzem Gesichtsausdruck zu sich selbst.
Es dauerte nicht lange und er hatte das notwendige Inventar seines neuen Arbeitsplatzes aus dem ›Endlos-Taschentuch‹, wie er selbst es stets zu nennen pflegte, geformt. Für die kleineren Gegenstände hatte er zwar nicht mehr genug Rollen verfügbar, aber ein Grundgerüst war möglich.
Lustig sah es aus, zweifelsohne. Aber nun konnte er sich vorstellen, wie es sein würde, hier zu therapieren.
Ein Klopfen an der Tür holte ihn zurück in die Gegenwart.
»Schatz?«, hörte er die Stimme seiner Frau.
»Komm einfach rein!«
Stolz wie ein Spanier freute er sich darauf, seiner Frau die geniale Idee mit den auf dem Boden ausgelegten Toilettenpapiermöbeln zu zeigen. Doch als sie samt ihrer Boxerhündin Inara den Flur betrat, wehte der Durchzug – die Fenster waren gekippt – alles durcheinander. Er versuchte noch, wenigstens die ›Therapieliege‹ zu fixieren, doch scheiterte kläglich. Als Inara die Streifen aus Zellstoff fliegen sah, regte sich ihr Jagdtrieb. Sie machte einen Satz nach vorne und schnappte danach. Seine Frau hielt die Leine fest, rutschte aber auf einem Teil des ›Bürostuhls‹ aus und landete auf ihrem Allerwertesten. Innerhalb weniger Sekunden war die Arbeit einer halben Stunde zerstört. Mit offenen Mündern besahen sich beide das Unheil – seine Frau auf dem Boden sitzend und er regungslos inmitten des Chaos stehend. Inara zerfetzte derweil die Zellstoffreste und wedelte eifrig mit dem Schwanz.
»Mei, das tut mir jetzt Leid, Schatzi«, entschuldigte er sich sofort und half seiner Frau beim Aufstehen. »Ich dachte, das mit dem Papier wäre eine gute Idee.«
»Ja … war es aber nicht! Wo ist denn die Toilette? Ich muss sowieso mal.«
»Gleich hier. Ganz neue sanitäre Anlagen. Wird dir gefallen.«
Sie schloss die Tür hinter sich, während er begann, die Fetzen aufzusammeln. Plötzlich hörte er seine Frau: »Wieso ist denn hier kein Klopapier?«
Tja, diesmal hatte er wohl doch nicht die beste Idee auf der Toilette …
Alte Freunde
Ein kleiner Umweg tat ihm gut. Der von seinem Schatz erteilte Auftrag, Semmeln und Brezen zu kaufen, hatte ihm den Fußmarsch durch das ›Glasscherbenviertel‹ Pfarrkirchens erspart, das sich leider zwischen seinem Haus und der neuen Betriebsstätte befand. Durch die Altstadt zu schlendern fühlte sich an wie eine Rückschau auf sein früheres Leben. Einige der Geschäfte, die sein damaliges Konsumverhalten geprägt hatten, existierten sogar noch: Der kleine Schreibwarenladen, in dem alljährlich die neuen Schulsachen gekauft wurden. Gab es etwas Schöneres, als einen neuen Malkasten? Oder der Buchladen, den jüngst ein alter Schulfreund übernommen hatte. Beinahe konnte er den Duft von Druckerschwärze riechen. Und die Bäckerei, die damals das allseits beliebte ›Zehnerl-Eis‹ führte. Mittlerweile müsste es allerdings ›Fünfundreißigerl-Eis‹ heißen. Wucher!
Seine Stammbäckerei betretend, sog er zunächst mit geschlossenen Augen den Wohlgeruch frischer Backwaren ein. Zu diesen kulinarischen Genüssen gesellten sich optische Verzückungen, als er sich schließlich umsah. Mohnschnecke, Bienenstich und Croissant. Käsebreze, Pizzastangerl und Weltmeistersemmel. All diese wundervollen Meisterstücke althergebrachter Handwerkskunst.
»Was darf’s denn sein?«, fragte eine junge Bäckereifachverkäuferin.
Als er seinen Mund zur Antwort öffnen wollte, lief ihm ein Schwall eigenen Speichels aus dem Mundwinkel, streifte sein Kinn und landete anschließend auf seinem Hemd. Schnell schluckte er, entschuldigte sich und wischte sich das Hemd mit dem Handrücken ab.
»Kein Problem. Letzte Woche ham’s eana aa scho voigsabbert1.«
Gott sei Dank befand sich niemand sonst in Hörweite.
Hungrig einzukaufen schien keine gute Idee zu sein, insbesondere, da er seinen Speichelfluss noch nie so recht hatte kontrollieren können.
Nachdem die nette Frau hinter dem Tresen die dritte große Papiertüte vollgepackt hatte, wurde ihm klar, dass er seit geraumer Zeit dabei war, das Missverhältnis zwischen ›Augengröße‹ und ›Magengröße‹ zu korrigieren. Bald würden die Augen nämlich nicht mehr größer sein als sein Bauch, wie es ihm seine Mutter als Kind immer vorgeworfen hatte, wenn er nicht aufessen konnte. Darin unterschied sich ein All-inclusive-Buffet von den Kochkünsten seiner Mutter. Bei ihr durfte er bis heute nicht selbst entscheiden, wann er satt war.
Gerade als er bezahlen wollte, sah er den Bäckereihelfer im hinteren Teil des Verkaufsraumes ein Blech voller Brezenteiglinge salzen. Ob man dafür eine Ausbildung brauchte? Seit Jahren dachte er über die Frage nach, warum die Gesellschaft manche Berufe hoch, andere niedrig bewertete. Beispielsweise werden Manager horrend bezahlt. Oder Fußballprofis. Männer, die einen Lederball in ein Netz treten können! Und die im Privatleben oft nur durch Skandale oder fehlende Manieren auffielen. Wohingegen Menschen, die andere pflegen, schlecht entlohnt werden. Oder Reinigungskräfte in Kliniken und Schulen. Deren Arbeit liefert einen in allerhöchstem Maß wertvollen Beitrag für die Gesellschaft. Und doch können sie von ihrem Gehalt kaum leben. Jüngst hatte er ein Interview mit einem Fußballer gelesen, der sich beklagte, zwei Spiele pro Woche zu bestreiten zu haben. »Beschweren kann er sich, wenn er mal vierzig Stunden im Schichtbetrieb spielen muss und dann nicht weiß, wie er seine Miete zusammenkratzen soll!«, hatte er damals wütend mit der Zeitung in der Hand gepoltert. »Irgendetwas stimmt heute ganz gewaltig nicht mehr«, war seine gedankliche Quintessenz. Oder eben der werte ›Brezensalzer‹, der seinen liebsten Backwaren gerade den letzten Schliff verpasste. Er selbst hatte vor einem Jahr beim Aufbacken tiefgefrorener Brezenteiglinge vergessen, diese mit dem dazugehörigen Salz zu versehen. Mit fatalen Folgen. Sie schmeckten einfach nicht. Gut, er war bei bayerischen Speisen wirklich empfindlich. Brezen waren neben Weißwürsten und Weißbier so etwas wie sein Grundnahrungsmittel. Eben deswegen schien ihm das Aufbacken und Perfektionieren von Lebensmitteln eine durchaus ehrenwerte und wichtige Berufstätigkeit. Doch die Menschheit im Allgemeinen teilte diese Haltung wohl nicht.
Bei all diesen Gedanken fiel ihm auf, dass der Mann, der nun das Brezenblech in den Backofen schob, nicht einmal eine Uniform der Bäckerei erhalten hatte. Die Verkäuferinnen zierten einheitliche Textilien. Doch jener arme Tropf musste sich seine Arbeitskleidung wahrscheinlich auch noch selbst bezahlen.