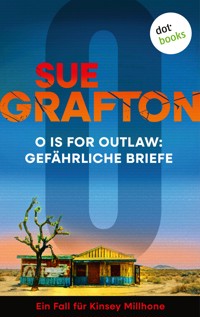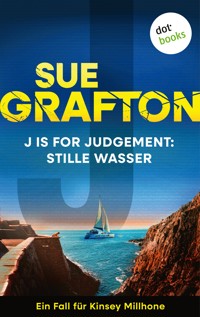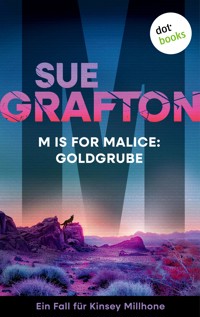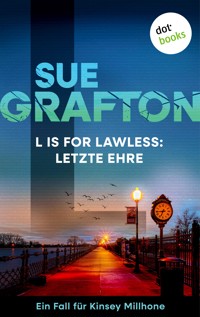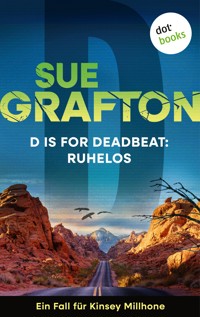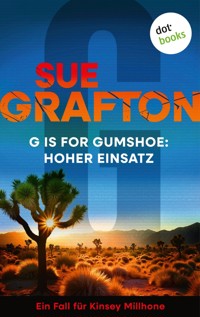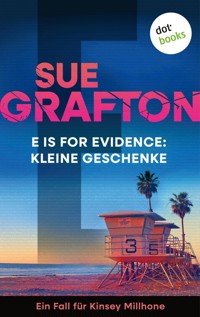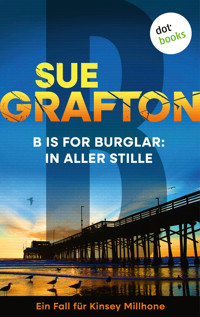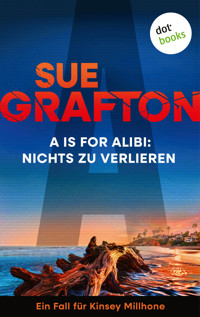9,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Ein Fall für Kinsey Millhone
- Sprache: Deutsch
Der dritte Fall für die scharfsinnigste Privatdetektivin Amerikas »Mein Name ist Kinsey Millhone. Ich bin als Privatdetektiv zugelassen. Ich bin zweiunddreißig Jahre alt, zweimal geschieden. Ich lebe gern allein, und ich fürchte, meine Unabhängigkeit gefällt mir besser als sie sollte.« Es gibt ungewöhnliche Fälle – und dann gibt es Fälle, die man nie wieder vergisst … Die Geschichte, die Privatdetektivin und Ex-Polizistin Kinsey Millhone von ihrem neuesten Klienten aufgetischt wird, klingt so abenteuerlich wie abwegig: Ein mörderischer Angriff auf einer einsamen Landstraße, ein Aufprall am Fuß einer 100 Meter tiefen Schlucht, zwei Wochen Koma und das Gedächtnis voller Lücken; der angehende Arzt Bobby Callahan ist überzeugt, dass er nur mit knapper Not einen Mordanschlag überlebt hat. Kinsey Millhone nimmt den Fall an – und je tiefer sie gräbt, desto mehr Verdächtige findet sie. Schon bald stellt sich ihr die unheilvolle Frage: Welche dunklen Abgründe lauern in Callahans Geist? Schließlich spitzt sich die Situation alptraumhaft zu … »Sue Grafton wird von Thriller zu Thriller besser.« Die Welt Der dritte Band einer der erfolgreichsten Krimiserien überhaupt, der unabhängig gelesen werden kann – ein packender Ermittlerkrimi für Fans der Bestsellerserien von James Patterson und Sara Paretsky. In ihrem vierten Fall bekommt es Kinsey Millhone mit einem großzügigen Spender zu tun – der kurz darauf tot am Strand liegt …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 400
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Über dieses Buch:
Es gibt ungewöhnliche Fälle – und dann gibt es Fälle, die man nie wieder vergisst … Die Geschichte, die Privatdetektivin und Ex-Polizistin Kinsey Millhone von ihrem neuesten Klienten aufgetischt wird, klingt so abenteuerlich wie abwegig: Ein mörderischer Angriff auf einer einsamen Landstraße, ein Aufprall am Fuß einer 100 Meter tiefen Schlucht, zwei Wochen Koma und das Gedächtnis voller Lücken; der angehende Arzt Bobby Callahan ist überzeugt, dass er nur mit knapper Not einen Mordanschlag überlebt hat. Kinsey Millhone nimmt den Fall an – und je tiefer sie gräbt, desto mehr Verdächtige findet sie. Schon bald stellt sich ihr die unheilvolle Frage: Welche dunklen Abgründe lauern in Callahans Geist? Schließlich spitzt sich die Situation alptraumhaft zu …
Über die Autorin:
Sue Grafton (1940–2017) war eine der erfolgreichsten Spannungsautorinnen Amerikas. Sie wurde in Kentucky geboren und verfasste Drehbücher, bevor sie ihren ersten Roman veröffentlichte. Ihre Bücher über die abgebrühte und einzelgängerische Privatdetektivin Kinsey Millhone wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und begeistern ein Millionenpublikum auf der ganzen Welt.
Die Website der Autorin: suegrafton.com/
Die Autorin bei Facebook: facebook.com/SueGrafton/
Bei dotbooks veröffentlichte die Autorin ihre »Alphabet«-Krimireihe um die eigenwillige Privatermittlerin Kinsey Millhone. Die ersten zwei Bände, »A is for Alibi: Nichts zu verlieren« und »B is for Burglar: In aller Stille« sind auch als Hörbücher bei Saga Egmont erhältlich.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2025
Die amerikanische Originalausgabe erschien erstmals 1986 unter dem Originaltitel »›C‹ Is For Corpse« bei Henry Holt, New York. Die deutsche Erstausgabe erschien 1988 unter dem Titel »C wie Callahan« bei Ullstein sowie 1997 in einer Neuausgabe unter dem Titel »Abgrundtief« bei Goldmann.
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1986 by Sue Grafton
Copyright © der deutschen Erstausgabe 1988 by Ullstein GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2025 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Shutterstock/CK Foto
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ma)
ISBN 978-3-98952-964-9
***
dotbooks ist ein Verlagslabel der dotbooks GmbH, einem Unternehmen der Egmont-Gruppe. Egmont ist Dänemarks größter Medienkonzern und gehört der Egmont-Stiftung, die jährlich Kinder aus schwierigen Verhältnissen mit fast 13,4 Millionen Euro unterstützt: www.egmont.com/support-children-and-young-people. Danke, dass Sie mit dem Kauf dieses eBooks dazu beitragen!
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit gemäß § 31 des Urheberrechtsgesetzes ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Sue Grafton
C is for Corpse: Abgrundtief
Kriminalroman – Ein Fall für Kinsey Millhone 3
Aus dem Amerikanischen von Birgit Herrmann
dotbooks.
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Epilog
Danksagung
Lesetipps
Widmung
Für die Kinder,
die mich gewählt haben:
Leslie, Jay und Jamie
Kapitel 1
Ich lernte Bobby Callahan am Montag jener Woche kennen. Am Donnerstag war er tot. Er war davon überzeugt gewesen, daß jemand ihn umzubringen versuchte, und er sollte recht behalten. Aber keinem von uns war das früh genug klar, um ihn zu retten, Nie zuvor habe ich für einen Toten gearbeitet, und ich hoffe, daß ich es nie wieder tun muß. Dieser Bericht ist für ihn, auch wenn es ihm nicht mehr helfen kann.
Mein Name ist Kinsey Millhone. Ich bin als Privatdetektiv zugelassen und gehe meinem Geschäft in Santa Teresa, Kalifornien, nach, fünfundneunzig Meilen nördlich von Los Angeles. Ich bin zweiunddreißig Jahre alt, zweimal geschieden. Ich lebe gern allein, und ich fürchte, meine Unabhängigkeit gefällt mir besser als sie sollte. Bobby stellte das in Frage. Ich weiß nicht genau wie oder warum. Er war erst dreiundzwanzig Jahre alt. Ich hatte in keiner Hinsicht ein Verhältnis mit ihm gehabt, doch ich mochte ihn, und sein Tod diente – wie die berühmte Sahnetorte im Gesicht – dazu, mich daran zu erinnern, daß das Leben manchmal ein großer, gefährlicher Scherz ist. Kein lustiges »Ha, Ha«, sondern ein grausames Lachen, wie man es von diesen Witzen kennt, die sich Schulkinder erzählen, seitdem es die Erde gibt.
Es war August, und ich trainierte im Santa Teresa Fitness Center, um die Nachwirkungen eines gebrochenen linken Armes auszukurieren. Die Tage waren heiß und voll unbarmherzigen Sonnenscheins und wolkenlosen Himmels. Ich war genervt und gelangweilt und machte meine Liegestütze und Curls und Hantelübungen. Ich hatte gerade zwei Fälle nacheinander bearbeitet und dabei größere Schäden als einen gebrochenen Oberarmknochen davongetragen. Ich fühlte mich emotional zerschlagen und brauchte eine Pause. Glücklicherweise hatte ich jetzt ein dickes Bankkonto und wußte, daß ich mir zwei Monate Urlaub leisten konnte. Gleichzeitig machte mich die Untätigkeit unruhig, und die gesunde Lebensweise durch die Krankengymnastik brachte mich an den Rand des Wahnsinns.
Das Santa Teresa Fitness Center ist wirklich kein Vergnügen: das »Sparta« der Gesundheitsvereine. Keinen Whirlpool, keine Sauna, keine Hintergrundmusik. Bloß Spiegelwände, Bodybuilding-Ausstattung und ein industrietauglicher Teppichboden in der Farbe von Asphalt. Der ganze achthundert Quadratmeter große Raum riecht nach männlichen Sportsuspensorien.
Drei Tage in der Woche erschien ich um acht Uhr morgens, wärmte mich fünfzehn Minuten lang auf und begann dann eine Serie von Übungen, die dazu dienten, meinen linken Deltamuskel, Brustmuskel, Bizeps, Trizeps und alles andere zu stärken und aufzubauen. Es saß einiges schief, seitdem man mir die Seele aus dem Leib geprügelt und ich die Flugbahn einer .22er Kugel gekreuzt hatte. Um das wieder in Ordnung zu bringen, hatte mir der Orthopäde sechs Wochen Krankengymnastik verordnet, von denen ich jetzt drei absolviert hatte. Eigentlich war nichts dabei. Ich mußte nur geduldig meinen Weg von einer Maschine zur anderen gehen. Gewöhnlich war ich dort die einzige Frau zu dieser Tageszeit, und ich neigte dazu, mich von den Schmerzen, dem Schweiß und der Übelkeit abzulenken, indem ich die Körper der Männer begutachtete, genau wie sie es mit meinem taten.
Bobby Callahan fing zur selben Zeit wie ich an. Ich war mir nicht sicher, was ihm zugestoßen war, aber egal, was es war, es hatte gesessen. Er war etwa knapp einen Meter achtzig groß und hatte die Figur eines Football-Spielers: großer Kopf, stämmiger Nacken, muskulöse Schultern, kräftige Beine. Jetzt war der struppige blonde Kopf zu einer Seite geneigt und die linke Gesichtshälfte zu einer ständigen Grimasse verzogen. Aus seinem Mund tropfte Speichel, als habe man ihn so mit Novocain vollgepumpt, daß er seine eigenen Lippen nicht mehr richtig spüren konnte. Meistens hielt er den linken Arm in Höhe der Taille und trug ein weißes, gefaltetes Taschentuch bei sich, mit dem er sich das Kinn abwischte. Ein schrecklicher dunkelroter Striemen lief über seinen Nasenrücken, ein zweiter über seine Brust, und kreuz und quer über seinen Knien waren Narben, als habe ihn ein Fechter aufgeschlitzt. Er lief in einer federnden Gangart, weil seine Achillessehne offensichtlich verkürzt war, und er zog die linke Ferse nach. Das Training muß ihm alles abverlangt haben, und doch hatte er es noch nie versäumt. An ihm war eine Zähigkeit, die ich bewunderte. Ich beobachtete ihn interessiert und gleichzeitig beschämt über meine eigenen heimlichen Klagen. Es war klar, daß meine Verletzungen heilbar waren, seine dagegen nicht. Ich hatte kein Mitleid mit ihm, aber ich war neugierig.
An jenem Montagmorgen waren wir zum ersten Mal allein in der Halle. Mit dem Gesicht nach unten machte er auf der Bank neben mir Beincurls. Er war in Gedanken versunken. Ich war zur Abwechslung zur Beindruckmaschine übergegangen. Ich wiege 107 Pfund und habe auch nur so viel Körper zu trainieren. Seit der Verletzung hatte ich das Joggen noch nicht wieder aufgenommen, deshalb dachte ich, ein paar Beindruckübungen könnten mir guttun. Ich machte sie nur mit 55 Kilogramm, aber weh tat es trotzdem. Um mich abzulenken, machte ich mir einen Spaß daraus zu überlegen, welchen Apparat ich am meisten haßte. Der Beincurler, an dem er arbeitete, war ein guter Kandidat. Ich sah zu, wie er eine Zwölferserie absolvierte und dann wieder von vorn begann.
»Ich hörte, daß Sie Privatdetektiv sind«, sagte er, ohne sich zu unterbrechen. »Stimmt das?« Seine Aussprache war ein bißchen schleppend, aber er überspielte das ganz gut.
»Ja. Suchen Sie einen?«
»So ist es. Jemand hat versucht, mich umzubringen.«
»Scheinbar hat nicht viel gefehlt. Wann war das?«
»Vor neun Monaten.«
»Warum Sie?«
»Ich weiß nicht.«
Die Rückseiten seiner Oberschenkel schwollen an, seine Kniesehnen strafften sich wie Spanndraht. Schweiß lief ihm das Gesicht hinunter. Ohne darüber nachzudenken, zählte ich mit. Sechs, sieben, acht.
»Ich hasse diese Maschine«, bemerkte ich.
Er lächelte. »Tut tierisch weh, nich?«
»Wie ist es passiert?«
»Ich fuhr spät nachts mit einem Kumpel den Paß hinauf. Ein Wagen folgte uns und begann uns von hinten zu rammen. Als wir an die Brücke gleich hinter dem Berggipfel kamen, verlor ich die Kontrolle über den Wagen, und wir gingen ab. Rick wurde getötet. Er sprang heraus, und der Wagen überrollte ihn. Ich sollte auch umgebracht werden. Das waren die längsten zehn Sekunden meines Lebens, verstehen Sie?«
»Klar.« Die Brücke, die er runtergeflogen war, überspannte einen felsigen Canyon, voller Gebüsch und hundertzwanzig Meter tief. Eine beliebte Absprungstelle für Selbstmordkandidaten. Tatsächlich hatte ich noch nie gehört, daß jemand diesen Fall überlebt hätte. »Sie machen sich großartig«, meinte ich. »Sie haben sich ganz schön abgerackert.«
»Was bleibt mir übrig? Direkt nach dem Unfall hieß es zuerst, ich würde nie mehr laufen können. Sie sagten, ich könnte überhaupt nie mehr etwas tun.«
»Wer sagte das?«
»Der Hausarzt. So’n alter Kauz. Meine Mutter feuerte ihn auf der Stelle und holte einen Orthopädie-Spezialisten. Er kriegte mich wieder hin. Acht Monate lang war ich in einer Rehabilitationsklinik, und jetzt mache ich das hier. Was ist Ihnen zugestoßen?«
»So’n Arschloch hat mir in den Arm geschossen.«
Bobby lachte. Es war ein wunderbares, schniefendes Geräusch. Er beendete seine letzte Übung und stützte sich auf die Ellenbogen.
»Ich muß noch vier Maschinen machen, dann können wir hier abhauen. Übrigens, ich heiße Bobby Callahan.«
»Kinsey Millhone.«
Er streckte mir seine Hand hin, und ich schüttelte sie. Eine unausgesprochene Abmachung war besiegelt. Damals wußte ich bereits, daß ich, egal unter welchen Umständen, für ihn arbeiten würde.
Wir nahmen den Lunch in einem Biorestaurant ein, so einem Laden, der spezialisiert ist auf die geschickte Imitation von Fleischpasteten, die dann doch keinen täuschen können. Ich kann auch den Sinn nicht einsehen. Nach meiner Einschätzung müßte ein Vegetarier ebenso angeekelt sein von etwas, das nur so aussieht wie gehackte Rinderteile. Bobby bestellte ein Burrito mit Bohnen und Käse von der Größe eines zusammengerollten Saunahandtuchs, das mit Guacamole und saurer Sahne bedeckt war. Ich wählte überbackenes Gemüse und braunen Reis mit einem Glas Weißwein unbestimmter Herkunft.
Für Bobby war das Essen ein ähnlich mühsamer Vorgang wie das Training, aber seine intensive Konzentration auf diese Aufgabe erlaubte mir, ihn aus der Nähe zu studieren. Seine Haare waren sonnengebleicht und struppig, die Augen braun mit Wimpern, wie sie die meisten Frauen kaufen müssen. Die linke Gesichtshälfte war leblos, aber er hatte ein kräftiges Kinn, betont von einer Narbe, die aussah wie ein aufgehender Mond. Nach meiner Vermutung waren seine Zähne irgendwann während des mörderischen Abgangs in die Schlucht durch die Unterlippe gestoßen worden. Wie er das alles überlebt hatte, blieb ein Rätsel.
Er sah auf. Er wußte, daß ich ihn angestarrt hatte, aber er beschwerte sich nicht.
»Du kannst von Glück sagen, daß du lebst«, meinte ich.
»Das Schlimmste kommt aber noch. Große Teile meines Gehirns sind hin, verstehst du?« Das Schleppen in seiner Aussprache war wieder da, als ob schon das bloße Thema seine Stimme beeinflußte. »Zwei Wochen lang hab ich im Koma gelegen, und als ich wieder zu mir kam, wußte ich nicht, was zum Teufel überhaupt los war. Ich weiß es immer noch nicht. Aber ich kann mich daran erinnern, wie ich vorher war, und das ist es, was schmerzt. Ich war klug, Kinsey. Ich wußte eine Menge. Ich konnte mich konzentrieren, und ich hatte Ideen. Mein Verstand machte mal wieder so magische kleine Sprünge. Weißt du, was ich meine?«
Ich nickte. Mit magischen kleinen Sprüngen des Verstands kannte ich mich aus.
Er fuhr fort. »Jetzt habe ich Lücken und Zwischenräume. Löcher. Ich habe große Teile meiner Vergangenheit verloren. Sie existieren nicht mehr.« Er hielt inne und tupfte sich ungeduldig das Kinn ab, dann warf er einen verbitterten Blick auf das Taschentuch. »Mein Gott, als ob das Gesabbere nicht schon schlimm genug wäre. Wenn ich immer schon so gewesen wäre, würde ich es nicht anders kennen, und es würde mich nicht so fertigmachen. Ich würde annehmen, jeder hätte so ein Gehirn wie ich. Doch ich war mal sehr clever. Das weiß ich. Ich war ein Einser-Student, auf dem Weg zur medizinischen Hochschule. Heute mache ich nur noch das Training. Ich versuche wenigstens so viel Koordinationsfähigkeit wiederzuerlangen, daß ich allein auf die verdammte Toilette gehen kann. Wenn ich nicht in der Halle bin, gehe ich zu diesem Seelenklempner namens Kleinert und versuche, mit dem ganzen Rest fertig zu werden.«
Plötzlich hatte er Tränen in den Augen. Er verstummte und kämpfte um seine Beherrschung. Er nahm einen tiefen Atemzug und schüttelte abrupt den Kopf. Als er weitersprach, war seine Stimme von Selbstekel erfüllt.
»So. Auf diese Art habe ich also meine Sommerferien verbracht. Und du?«
»Bist du überzeugt davon, daß es ein Mordanschlag war? Warum könnte es nicht irgendein Witzbold oder ein Betrunkener gewesen sein?«
Er dachte einen Moment lang darüber nach. »Ich kannte den Wagen. Zumindest glaube ich das. Offensichtlich kenne ich ihn jetzt nicht mehr, aber es kommt mir vor ... damals habe ich das Fahrzeug erkannt.«
»Aber den Fahrer nicht?«
Er schüttelte den Kopf. »Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Vielleicht kannte ich ihn damals, vielleicht nicht.«
»Weiblich? Männlich?« fragte ich.
»Nee. Das ist auch weg.«
»Woher weißt du, daß du das Opfer sein solltest und nicht Rick?«
Er schob seinen Teller weg und bestellte einen Kaffee. Er gab sich Mühe. »Ich wußte etwas. Irgendetwas war geschehen, und ich hatte es herausgefunden. Soviel weiß ich noch. Ich kann mich sogar daran erinnern, gewußt zu haben, daß ich in Schwierigkeiten steckte. Ich hatte Angst. Mir fällt bloß nicht mehr ein warum.«
»Was ist mit Rick? War er daran beteiligt?«
»Ich glaube nicht, daß es irgendetwas mit ihm zu tun hatte. Das kann ich zwar nicht beschwören, aber ich bin ziemlich sicher.«
»Was ist mit dem Fahrtziel in jener Nacht? Paßt das irgendwie hinein?«
Bobby sah auf. Die Kellnerin stand mit einer Kaffeekanne in Höhe seines Ellenbogens. Er wartete, bis sie uns beiden Kaffee eingeschenkt hatte. Als sie gegangen war, lächelte er unbehaglich. »Ich weiß nicht, wer meine Feinde sind, verstehst du? Ich weiß nicht, ob die Leute um mich herum über die ›Sache‹ Bescheid wissen, die ich vergessen habe. Ich will nicht, daß jemand mithört, was ich sage ... vorsichtshalber. Ich weiß, daß ich paranoid bin, aber ich kann’s nicht ändern.«
Sein Blick folgte der Kellnerin, als sie zur Küche zurückging. Sie stellte die Kaffeekanne wieder auf die Theke, nahm am Fenster eine Bestellung auf und sah sich nach ihm um. Sie war jung, und sie schien zu merken, daß wir über sie sprachen. Nachträglich tupfte Bobby sich das Kinn ab. »Wir waren auf dem Weg zur Stage Coach Tavern hoch. Da spielt gewöhnlich eine Bluegrass-Band, die Rick und ich hören wollten.« Er zuckte die Achseln. »Vielleicht gab es noch einen anderen Grund, aber ich glaube nicht.«
»Was lief zu diesem Zeitpunkt sonst noch in deinem Leben ab?«
»Ich hatte gerade die Universität in Santa Teresa abgeschlossen. Ich machte so einen Halbtagsjob im St. Terry und wartete auf einen Bescheid von der medizinischen Hochschule.«
Das Santa Teresa Hospital wurde St. Terry genannt, solange ich denken konnte. »War das nicht ein bißchen spät? Ich dachte, die Anwärter auf einen Platz an der medizinischen Hochschule bewerben sich im Winter und bekommen dann im Frühling die Antwort.«
»Tja, tatsächlich hatte ich mich schon beworben und war nicht angenommen worden, also versuchte ich es noch mal.«
»Was für eine Arbeit hast du im St. Terry gemacht?«
»Nun ja, ich war eine Art ›Springer‹. Ich machte alles Mögliche. Eine Weile arbeitete ich in der Aufnahme und kümmerte mich um die Papiere der Neuzugänge. Ich telefonierte herum und erfragte Daten zur Vorgeschichte, zu Versicherungsfragen und so’n Kram. Dann habe ich eine Weile im Krankenhausarchiv gearbeitet, wo ich Tabellen zusammenstellte, bis es mich langweilte. Beim letzten Job war ich als Schreibkraft in der Pathologie. Hab für Dr. Fraker gearbeitet. Der war prima. Hat mich gelegentlich Labortests durchführen lassen. Natürlich bloß so’n simplen Kram.«
»Klingt nicht nach einer besonders gefährlichen Arbeit«, meinte ich. »Wie steht’s mit der Universität? Könnte sich die Gefahr, in der du dich befunden hast, irgendwie bis zur Schule zurückverfolgen lassen? Fakultät? Seminare? Aktivitäten außerhalb des Unterrichts, an denen du beteiligt warst?«
Er schüttelte unentwegt den Kopf und verstand offenbar gar nichts mehr. »Ich wüßte nicht wie. Ich war seit Juni fertig. November war der Unfall.«
»Aber du hast das Gefühl, daß du der Einzige warst, der diese Information hatte, egal, was es war.«
Sein Blick wanderte durch das Café und kehrte dann wieder zu mir zurück. »Ich glaube ja. Ich und der, der versucht hat, mich zu töten, um mich zum Schweigen zu bringen. «
Ich saß da, starrte ihn eine Weile lang an und versuchte die Sache klar zu sehen. Ich schüttete etwas, das wahrscheinlich Rohmilch war, in meinen Kaffee. Gesundheitsfanatiker essen gerne Mikroben und so’n Zeug. »Hast du eine Vorstellung davon, wie lange du von dieser Sache schon wußtest? Weil ich mich frage ... warum du nicht gleich geplaudert hast.«
Interessiert sah er mich an. »Zum Beispiel? Zu den Cops gehen oder so was?«
»Klar. Wenn du über einen Diebstahl gestolpert wärst, oder du hättest herausgefunden, daß jemand ein russischer Spion ist. . .« Ich ratterte die Möglichkeiten so runter, wie sie mir in den Sinn kamen. »Oder du hättest eine Verschwörung zur Ermordung des Präsidenten aufgedeckt …«
»Warum hätte ich nicht vom nächstbesten Telefon aus um Hilfe rufen sollen?«
»Genau.«
Er wurde still. »Vielleicht habe ich das ja getan. Vielleicht. . . Scheiße, Kinsey, ich weiß es nicht. Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr mich das frustriert. Ganz am Anfang, in diesen ersten zwei, drei Monaten im Krankenhaus, konnte ich nur an die Schmerzen denken. Ich brauchte all meine Energie, um zu überleben. Über den Unfall habe ich überhaupt nicht nachgedacht. Aber als es mir besser ging, begann ich die Sache Stück für Stück zurückzuverfolgen und versuchte mich an die Vorgänge zu erinnern. Vor allem, als sie mir sagten, daß Rick tot war. Davon hatte ich wochenlang keine Ahnung. Ich vermute, sie fürchteten, daß ich mir die Schuld geben würde und daß das meine Genesung verzögern könnte. Mir wurde ganz übel, nachdem ich es erfahren hatte. Angenommen, ich wäre betrunken gewesen und ganz einfach von der Straße abgekommen? Ich mußte herausfinden, was geschehen war, oder ich wäre auch noch verrückt geworden. Na, jedenfalls war das der Punkt, an dem ich anfing, mir das ganze andere Zeug zusammenzureimen.«
»Vielleicht fällt dir der Rest auch wieder ein, wenn du dich schon an so viel erinnerst.«
»Aber das ist es doch«, meinte er. »Was, wenn es mir wirklich einfällt? Ich nehme an, das Einzige, was mich zur Zeit am Leben hält, ist die Tatsache, daß ich mich an nichts erinnere.«
Seine Stimme war lauter geworden, und er hielt inne. Sein Blick zuckte zur Seite. Seine Furcht war ansteckend, denn ich merkte, daß ich mich schon genau wie er umschaute und mich bemühte, meine Stimme gedämpft zu halten, damit unser Gespräch nicht belauscht werden konnte.
»Bist du tatsächlich mal bedroht worden, nachdem dir das Ganze wieder eingefallen ist?« fragte ich.
»Nein.«
»Keine anonymen Briefe oder merkwürdigen Telefonanrufe?« Er schüttelte den Kopf. »Aber ich bin in Gefahr. Ich weiß es einfach. Seit Wochen habe ich dieses Gefühl. Ich brauche Hilfe.«
»Hast du es mit den Cops versucht?«
»Sicher. Für sie war es ein Unfall. Es gibt keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Na gut, Fahrerflucht. Sie wissen, daß mich jemand von hinten angefahren und von der Brücke abgedrängt hat, aber vorsätzlicher Mord? Ich bitte dich. Und selbst wenn sie mir glauben würden, sie haben nicht genügend Leute für so etwas. Ich bin nur ein normaler Bürger. Ich habe keinen Anspruch auf Polizeischutz rund um die Uhr.«
»Vielleicht solltest du einen Leibwächter engagieren.«
»Vergiß es! Ich will dich.«
»Bobby, ich sage ja nicht, daß ich dir nicht helfen will. Natürlich werde ich das tun. Ich gehe nur die Möglichkeiten durch. Es klingt, als bräuchtest du mehr als mich.«
Angespannt beugte er sich vor. »Du sollst bloß dieser Sache auf den Grund gehen. Sag mir, was los ist. Ich will wissen, warum Leute hinter mir her sind, und ich will, daß sie aufgehalten werden. Dann brauche ich weder die Cops noch einen Leibwächter oder sonstwas.« Erregt klappte er den Mund zu und lehnte sich schwankend zurück.
»Scheiß drauf«, stieß er hervor. Unruhig bewegte er sich und stand dann auf. Aus seiner Brieftasche zog er einen Zwanziger, den er auf den Tisch warf. Dann machte er sich in dieser federnden Gangart Richtung Tür auf. Sein Humpeln war deutlicher, als ich bisher bemerkt hatte. Ich schnappte mir meine Handtasche und holte ihn ein.
»Mein Gott, nicht so schnell. Laß uns zu mir ins Büro fahren und einen Vertrag aufsetzen.«
Er hielt mir die Tür auf, und ich ging hinaus.
»Hoffentlich kannst du dir meine Dienste leisten«, sagte ich über die Schulter hinweg.
Er lächelte schwach. »Nur keine Sorge.«
Wir bogen nach links ab und gingen zum Parkplatz.
»Tut mir leid, daß ich die Beherrschung verloren habe«, murmelte er.
»Geschenkt. Mir macht das nichts aus.«
»Ich war mir nicht sicher, ob du mich ernst nimmst«, meinte er.
»Warum sollte ich nicht?«
»Meine Familie denkt, bei mir wär ’ne Schraube locker.«
»Tja, deshalb hast du ja auch mich engagiert und nicht sie.«
»Danke«, sagte er leise. Er hakte sich bei mir unter, und ich sah ihn an. Sein Gesicht war rosa angelaufen, und Tränen standen in seinen Augen. Gleichgültig tupfte er sie ab, ohne mich anzusehen. Zum ersten Mal wurde mir bewußt, wie jung er war. Mein Gott, er war noch ein Kind, ruiniert, konfus und zu Tode geängstigt.
Langsam gingen wir zu meinem Wagen zurück, und ich war mir der starrenden Blicke der Neugierigen bewußt, die ihre Gesichter voller Mitleid und Unbehagen abwandten. Am liebsten hätte ich jemanden verprügelt.
Kapitel 2
Gegen zwei Uhr nachmittags war der Vertrag unterzeichnet, und Bobby hatte mir einen Spesenvorschuß in Höhe von zweitausend Dollar überlassen. Ich ließ ihn an der Sporthalle raus, wo er vor dem Lunch seinen BMW stehenlassen hatte. Seine Behinderung gab ihm das Recht zur Benutzung des Behindertenparkplatzes, aber ich stellte fest, daß er keinen Gebrauch davon gemacht hatte. Vielleicht hatte jemand anderer dort geparkt, als er angekommen war, oder er hatte es, halsstarrig wie er war, vorgezogen, die zwanzig Meter weiter zu laufen.
Als er ausstieg, lehnte ich mich über den Vordersitz. »Wer ist dein Anwalt?« fragte ich. Er hielt die Tür an der Beifahrerseite geöffnet und den Kopf geneigt, so daß er zu mir hineinsehen konnte.
»Varden Talbot von Talbot & Smith. Warum? Willst du mit ihm reden?«
»Frage ihn, ob er Kopien des Polizeiberichts hat, die er mir überlassen könnte. Das würde mir eine Menge Arbeit ersparen.«
»Okay, wird gemacht.«
»Ach ja, und wahrscheinlich ist es das beste, wenn ich mit deinen nächsten Angehörigen beginne. Sie könnten die eine oder andere Theorie über die Vorgänge haben. Wie wär’s, wenn ich euch später mal anrufe und nachfrage, ob jemand Zeit für mich hat?«
Bobby verzog das Gesicht. Auf dem Weg zu meinem Büro hatte er mir erzählt, daß ihn seine Verletzungen gezwungen hatten, vorübergehend wieder in seinem Elternhaus zu wohnen, was ihm nicht besonders paßte. Seine Eltern hatten sich vor einigen Jahren scheiden lassen, und seine Mutter hatte wieder geheiratet; genaugenommen war das schon Ehe Nummer drei. Offensichtlich kam Bobby mit seinem gegenwärtigen Stiefvater nicht zurecht, aber er hatte eine siebzehnjährige Stiefschwester namens Kitty, die er zu mögen schien. Ich wollte mit allen dreien reden. Meistens fangen meine Untersuchungen mit Schreibkram an, aber diese war von Anfang an etwas Besonderes.
»Ich habe eine bessere Idee«, meinte Bobby. »Komm heute nachmittag bei uns vorbei. Mama erwartet so gegen fünf ein paar Leute. Mein Stiefvater hat Geburtstag. So hättest du Gelegenheit, alle gleichzeitig zu treffen.«
Ich zögerte. »Bist du sicher, daß das in Ordnung geht? Vielleicht hat sie etwas dagegen, wenn ich zu einem so besonderen Anlaß einfach reinplatze.«
»Das geht klar. Ich werde ihr sagen, daß du kommst. Es wird sie nicht stören. Hast ’n Stift? Ich erklär dir den Weg.«
Ich durchwühlte meine Handtasche nach einem Kugelschreiber und meinem Notizbuch und notierte mir die Einzelheiten. »So gegen sechs bin ich da«, sagte ich.
»Großartig.« Er warf die Wagentür zu und ging.
Ich beobachtete, wie er zu seinem Wagen humpelte, und fuhr dann nach Hause.
Ich wohne in einer ehemaligen einfachen Garage, die jetzt zu einem etwa zwanzig Quadratmeter großen Studioappartement für zweihundert Dollar monatlich umgewandelt worden ist. Es dient mir als Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Bad, Toilette und Waschraum. Alles, was ich besitze, ist vielseitig verwendbar und winzig. Ich habe eine Kombination aus Kühlschrank, Spülbecken und Kochplatte, eine Mini-Waschmaschine mit aufgesetztem Trockner, eine Couch, aus der man ein Bett machen kann (obwohl ich mir selten die Mühe mache, sie auszuklappen), und einen Schreibtisch, den ich manchmal als Eßtisch benutze. Ich neige zur Arbeitswut, und deshalb scheinen meine Wohnräume im Laufe der Jahre auf diese Miniaturgröße geschrumpft zu sein. Eine Zeitlang wohnte ich in einem Wohnwagen, aber das schien mir dann doch zu teuer. Ich bin oft auf Reisen und habe etwas dagegen, mein Geld für Räume auszugeben, die ich nicht nutze. Möglich, daß ich eines Tages meinen persönlichen Bedarf auf einen Schlafsack reduziere, den ich auf den Rücksitz meines Autos werfen kann, um völlig dem Zwang zu Mietzahlungen zu entgehen. Wie die Dinge liegen, sind meine Ansprüche gering. Ich habe weder Haustiere noch Pflanzen. Ich habe zwar Freunde, aber ich gehe keine gesellschaftlichen Verpflichtungen ein. Wenn ich überhaupt Hobbys habe, dann bestehen sie aus dem Reinigen meiner kleinen Halbautomatik und dem Aktenstudium. Ich bin nicht gerade ein Glückspilz, aber ich zahle meine Rechnungen, habe ein bißchen Geld auf die Seite gelegt und bin mit einer Krankenversicherung ausgestattet, um mich vor den Risiken meines Gewerbes zu schützen. Ich mag mein Leben so wie es ist, obwohl ich mir Mühe gebe, mich dieses Umstands nicht allzu sehr zu rühmen. Ungefähr alle sechs oder acht Monate treffe ich auf einen Mann, der mich sexuell aus der Fassung bringt, aber zwischen diesen »Seitensprüngen« lebe ich solo und unverheiratet, was meiner Ansicht nach keine besondere Leistung ist. Nach zwei erfolglosen Ehen bin ich in der Lage, die Augen offen und die Beine geschlossen zu halten.
Mein Appartement liegt an einer bescheidenen, mit Palmen gesäumten Straße einen Block vom Strand entfernt, und es gehört einem Mann namens Henry Pitts, der das Hauptgebäude auf dem Grundstück bewohnt. Henry ist einundachtzig Jahre alt und ein pensionierter Bäcker, der sein Einkommen jetzt durch die Herstellung von Brot und Kuchen aufbessert, die er bei den ortsansässigen Kaufleuten gegen andere Waren und Dienstleistungen tauscht. Er richtet Teegesellschaften für die alten Damen in der Nachbarschaft aus und schreibt in seiner Freizeit Kreuzworträtsel, die irre schwer zu lösen sind. Er ist ein sehr gutaussehender Mann: groß, schlank und braungebrannt, mit schneeweißem Haar, das weich ist wie Babyflaum, und einem schmalen, aristokratischen Gesicht. Seine Augen sind veilchenblau, in der Farbe von Zwergpurpurwinden, und sie strahlen Intelligenz aus. Er ist teilnahmsvoll, mitfühlend und süß. Deshalb hätte es mich nicht so überraschen sollen, ihn in der Gesellschaft eines »Schätzchens« vorzufinden, das mit ihm zusammen Mint Juleps im Garten trank, als ich nach Hause kam.
Wie immer hatte ich meinen Wagen vor dem Grundstück geparkt und lief ums Haus herum nach hinten auf meine Eingangstür zu. Mein Appartement geht zum Hof hinaus und gibt den Blick auf ein kleines Stück malerischer Landschaft frei. Henry hat ein Stückchen Rasen da hinten, eine Trauerweide, Rosensträucher, zwei Zwergzitronenbäumchen und einen kleinen, gepflasterten Innenhof. Er kam gerade aus seiner Hintertür, ein Tablett in der Hand, als er mich sah.
»Oh, Kinsey. Das trifft sich gut. Komm mal rüber. Da ist jemand, dem ich dich vorstellen möchte«, meinte er.
Mein Blick folgte dem seinen, und ich sah eine Frau, die auf einem der Klubsessel ausgestreckt lag. Sie muß Mitte Sechzig gewesen sein, plump, mit einer Krone aus braungetönten Locken. Ihr Gesicht war gefurcht wie weiches Leder, aber sie hatte geschickt Make-up aufgetragen. Es waren ihre Augen, die mich störten; ein samtiges Braun, recht groß und, nur einen Moment lang, boshaft.
Henry stellte das Tablett auf dem runden Metalltisch zwischen den Sesseln ab. »Das ist Lila Sams«, meinte er und nickte dann in meine Richtung. »Meine Mieterin, Kinsey Millhone. Lila ist gerade erst nach Santa Teresa gezogen. Sie hat ein Zimmer bei Mrs. Löwenstein am Ende der Straße gemietet. «
Mit einem Rasseln ihrer roten Plastikarmreifen streckte sie mir ihre Hand entgegen und machte Anstalten, auf die Füße zu kommen.
Ich überquerte den Hof. »Bleiben Sie sitzen«, sagte ich. »Willkommen bei uns.« Ich schüttelte ihre Hand und lächelte freundlich. Das Lächeln, das zurückkam, nahm die Kühle aus ihrem Gesicht, und ich merkte, wie ich in Gedanken einen zweiten Anlauf machte und mich fragte, ob ich sie falsch eingeschätzt hatte. »Aus welcher Gegend stammen Sie?«
»Heute hier, morgen dort«, antwortete sie und blickte verstohlen zu Henry hinüber. »Ich war mir nicht sicher, wie lange ich bleiben würde, aber Henry macht es mir seeehr angeneeehm.«
Sie trug ein kurzgeschnittenes Sommerkleid aus Baumwolle mit einem hellgrünen und gelben geometrischen Druck auf weißem Untergrund. Ihre Brüste sahen aus wie zwei Fünf-Pfund-Mehlsäcke, deren Inhalt etwas verschüttet worden war. Sie trug ihr Übergewicht vor allem an Busen und Taille, und ihre stämmigen Hüften und Oberschenkel liefen zu einem passablen Paar Waden und fast zierlichen Füßen aus. Sie trug rote Leinenschuhe und dicke rote Ohrklipse aus Plastik. Wie beim Betrachten eines Gemäldes kehrte mein Blick genau auf den Ausgangspunkt zurück. Ich wollte ihr noch mal in die Augen schauen, aber sie war dabei, das Tablett zu untersuchen, das Henry ihr darbot.
»Herrje. Ja, was haben wir denn da? Du bist vielleicht ein süßer Schatz!«
Henry hatte einen Teller mit Appetithappen zubereitet. Er ist einer jener Leute, die in die Küche sausen und mit Hilfe der Konserven aus der hintersten Schrankecke einen Feinschmeckerimbiß kreieren können. Alles, was in meiner Schrankecke steht, ist eine alte Schachtel Müsli mit Innenleben.
Lilas rote Fingernägel bildeten einen winzigen Kran. Sie hob einen der Happen an und beförderte ihn zum Mund. Es sah aus wie ein Kräcker mit einem Häppchen geräuchertem Lachs und einem Tupfer Remoulade darauf. »Hmm, das ist fantastisch«^ bemerkte sie mit vollem Mund und leckte sich die Fingerspitzen ab, eine nach der anderen. Sie trug ein paar billige Ringe, deren Steine wie verklebte Rubine aussahen, und einen viereckig geschliffenen Smaragd in der Größe einer Briefmarke mit Diamanten auf jeder Seite. Henry bot mir den Teller mit den Happen an. »Wie wär’s, wenn du jetzt mal einen davon probierst, während ich dir einen Mint Julep mixe?«
Ich schüttelte den Kopf. »Lieber nicht. Wahrscheinlich versuche ich gleich zu joggen, und dann muß ich noch arbeiten.«
»Kinsey ist Privatdetektivin«, sagte er zu ihr.
Lilas Augen weiteten sich, und ihre Lider klapperten verwundert. »Du meine Güte. Das ist ja interessant!« Sie sprach überschwänglich und mit größerer Begeisterung, als es der Situation entsprach. Ich war nicht gerade besonders beeindruckt von ihr, und ich bin sicher, daß sie es gespürt hat. In der Regel mag ich ältere Frauen. Ich mag eigentlich fast alle Frauen. Ich finde sie von Natur aus offen und vertrauenswürdig und von einer amüsanten Freimütigkeit, wenn das Gespräch auf Männer kommt. Diese hier war eine von der alten Schule: albern und kokettierend. Mich hat sie auf Anhieb verachtet.
Sie schaute Henry an und klopfte auf das Sesselkissen. »Komm, setz dich hierher, du böser Junge. Ich will nicht, daß du wie ein Diener auf mich wartest. Können Sie sich das vorstellen, Kinsey? Alles, was er heute nachmittag gemacht hat, war, mir einmal dies, einmal jenes zu holen.« Sie beugte sich über den Teller mit den Appetithappen und war wieder hingerissen. »Und was ist das für einer?«
Ich sah zu Henry und erwartete halb, daß er mir einen gequälten Blick zuwerfen würde, aber er hatte wie befohlen auf dem Sessel Platz genommen und schielte zum Teller. »Das ist geräucherte Auster. Und das ist ein bißchen Rahmkäse mit Chutney. Das wird dir schmecken. Hier.«
Offensichtlich war er nahe dran, sie zu füttern, doch sie gab ihm einen leichten Klaps.
»Laß das. Du nimmst jetzt selbst mal einen. Du verwöhnst mich bis zum Umfallen und, was noch schlimmer ist, du wirst mich dick und rund füttern. «
Ich fühlte mein Gesicht vor Unbehaglichkeit erstarren, als ich sah, wie sich ihre Köpfe näherten. Henry ist fünfzig Jahre älter als ich, und unsere Beziehung war immer höchst anständig gewesen. Jetzt fragte ich mich, ob er sich bei den wenigen Gelegenheiten in der Vergangenheit genauso gefühlt hatte, wenn er morgens um sechs einen Typen aus meiner Wohnung wanken sah.
»Wir sehen uns später, Henry«, sagte ich und ging auf meine Eingangstür zu. Ich glaube, er hatte mich gar nicht gehört.
Ich zog mir ein Turnhemd und Shorts an, schnürte mir die Joggingschuhe zu und schlüpfte dann wieder hinaus, ohne daß jemand auf mich aufmerksam wurde. In flottem Tempo ging ich einen Block weiter zur Cabana, dem breiten Boulevard, der parallel zum Strand verläuft, und verfiel in einen Trab. Der Tag war heiß, und es gab nicht die geringste Bewölkung. Es war jetzt drei Uhr, und sogar die Brandung wirkte träge. Die Brise, die einem vom Meer her zugefächelt wurde, war voller Salz.
Der Strand war mit Schutt verschmutzt. Ich wußte nicht mehr, warum ich mir eigentlich die Mühe machte zu rennen. Ich war nicht mehr in Form, schnaufte und prustete, und meine Lungen brannten innerhalb der ersten Viertelmeile wie Feuer. Mein linker Arm schmerzte, und meine Beine fühlten sich an wie Holz. Immer wenn ich arbeite, laufe ich auch, und ich nehme an, das war der Grund für den heutigen Versuch. Ich lief, weil es an der Zeit war zu laufen und weil ich den Rost und die Steifheit aus meinen Gliedern schütteln mußte. So pflichtbewußt ich das Joggen auch machte, war ich doch nie ein wirklicher Fan dieses Trainings gewesen. Mir fällt bloß keine bessere Methode ein, mir dieses gewisse Wohlbefinden zu verschaffen.
Die erste Meile bestand nur aus Schmerzen, und ich haßte jede einzelne Minute. Bei der zweiten Meile fühlte ich die Endorphine einrasten, und ab der dritten Meile hatte ich meinen Rhythmus gefunden und hätte für immer und ewig so weiterlaufen können. Ich sah auf meine Jogginguhr. Es war 3.33. Ich habe nie behauptet, ich sei schnell. Ich verringerte mein Tempo auf ein Gehen. Der Schweiß lief. Morgen würde ich dafür büßen, da war ich mir ziemlich sicher, doch im Moment fühlte ich mich locker. Meine Muskeln waren weich und warm. Ich benutzte den Heimweg, um mich abzukühlen.
Als ich zurück zu meiner Wohnung kam, hatte der verdunstende Schweiß mich zum Frösteln gebracht, und ich freute mich auf eine heiße Dusche. Der Innenhof war verlassen. Nur die leeren Mint-Julep-Gläser standen dort Seite an Seite. Henrys Hintertür war geschlossen, und die Jalousien waren heruntergelassen. Ich schloß meine Tür mit dem Schlüssel auf, den ich mir ans Schuhband geknüpft hatte.
Ich wusch mir die Haare, rasierte mir die Beine, schlüpfte in ein Kleid und fuhrwerkte eine Weile herum. Die Küche wurde aufgeräumt, der Schreibtisch geleert. Schließlich zog ich mir eine Hose, eine Tunika und Sandalen an und parfümierte mich. Um Viertel vor sechs schnappte ich mir meine große Lederhandtasche, ging wieder hinaus und schloß ab.
Ich sah mir die Wegbeschreibung zu Bobbys Haus an, bog links in die Cabana Richtung Vogelschutzgebiet ein und folgte der Straße, die sich nach Montebello hineinschlängelte. Von Montebello sagt man, es habe mehr Millionäre pro Quadratmeile als irgendeine andere Gemeinde im Land. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht. Die Bewohner von Montebello sind ein bunter Haufen. Obwohl die großen Grundstücke jetzt mit Häusern der Mittelschicht durchzogen sind, bleibt der Gesamteindruck von Geld. Sorgsam kultiviertes und haltbar gemachtes Geld, eine gereifte Eleganz, die zurückgeht auf Zeiten, in denen Wohlstand mit Diskretion behandelt wurde und materielle Zurschaustellung den finanziell Ebenbürtigen vorbehalten war. Die Reichen von heute sind nur noch geschmacklose Imitatoren ihrer früheren kalifornischen Pendants. Montebello hat seine »Slums«, einen merkwürdigen Streifen voller Schindelhütten, die für 140 000 Dollar das Stück verkauft werden.
Die Adresse, die Bobby mir gegeben hatte, lautete West Glen, eine schmale Straße, von Eukalyptusbäumen und Platanen beschattet, gesäumt von niedrigen, handbehauenen Steinen, die sich zu weit zurückliegenden, von vorbeifahrenden Motoristen nicht einsehbaren Villen schlängelten. Hin und wieder wies ein Pförtnerhaus auf die Prunkhütten im Hintergrund hin. Aber zumeist schien sich West Glen durch immergrüne Eichenhaine zu ziehen und aus nichts als gesprenkeltem Sonnenschein, dem Geruch französischen Lavendels und brummenden Honigbienen in den knallrosa Geranien zu bestehen. Es war jetzt sechs Uhr, und in den nächsten zwei Stunden würde es nicht dunkel werden.
Ich erspähte die gesuchte Hausnummer und bog langsam in die Einfahrt ein. Zu meiner Rechten standen weißverputzte Häuschen, die von den drei kleinen Schweinchen hätten gebaut sein können. Ich starrte durch die Windschutzscheibe, konnte aber keinen Parkplatz sehen. Ich rollte weiter, in der Hoffnung, irgendwo hinter der vor mir liegenden Kurve könnte eine Parkmöglichkeit sein. Über die Schulter hinweg schaute ich zurück. Ich fragte mich, warum keine anderen Autos zu sehen waren, und überlegte, welcher der kleinen Bungalows wohl Bobbys Familie gehören konnte. Einen Moment lang fühlte ich mich unbehaglich. Er hatte doch heute nachmittag gesagt, oder? Ich konnte mir nur zu gut vorstellen, daß ich am falschen Tag kam. Ich zuckte die Achseln. Nun gut. Ich habe schon schlimmere Peinlichkeiten in meinem Leben erlitten, obwohl mir im Moment keine einfallen wollte. Ich bog um die Kurve und suchte nach einer Stelle zum Anhalten. Unwillkürlich stieg ich voll auf die Bremsen, und der Wagen schlitterte zum Stillstand. »Ach du liebe Scheiße!« flüsterte ich.
Der Weg hatte sich zu einem großen gepflasterten Hof verbreitert. Genau gegenüber sah ich ein Haus. Irgendwie wußte ich in meinem Innern, daß Bobby Callahan hier wohnte und nicht in einem dieser gemütlichen kleinen Nester vorn. Das waren wahrscheinlich Angestelltenwohnungen. Hier stand das richtige Haus.
Das Gebäude war so groß wie die Schule, die ich besucht hatte, und wahrscheinlich vom selben Architekten entworfen worden. Das war ein Mann namens Dwight Costigan, der nicht mehr lebte, aber in den über vierzig Jahren seines Schaffens ganz Santa Teresa auf eigene Faust wiederbelebt hatte. Der Stil heißt, wenn ich mich nicht irre, Neuspanisch. Zugegeben, ich spotte gern über weißverputzte Mauern und rote Ziegeldächer. Ich verachte Rundbögen und Hortensien, und Balken und Balkone quälen mich, aber ich hatte sie noch nie in einer solchen Zusammenstellung gesehen.
Der Mittelteil des Hauses war zwei Stockwerke hoch und von zwei gedeckten Säulengängen flankiert. Bogen auf Bogen auf Bogen, getragen von graziösen Säulen. Es gab Gruppen zarter Palmen, mit Skulpturen geschmückte Portale, gotische Fenster mit Sprossen. Sie hatten sogar einen Glockenturm wie bei einer alten Missionskirche. War Kim Novak nicht aus etwas Ähnlichem verstoßen worden? Der Ort sah aus wie eine Mischung aus Kloster und Filmkulisse. Im Hof parkten vier Mercedes wie für eine Hochglanzreklame, und aus dem Springbrunnen in der Mitte schoß ein fünf Meter hoher Wasserstrahl.
So weit rechts wie möglich hielt ich an. Dann sah ich an mir herunter. Die Hose hatte, wie ich jetzt bemerkte, einen Flecken auf einem Knie, den ich nur verbergen konnte, wenn ich mich ständig geduckt hielt, so daß die Tunika weit genug hinunterhing. Die Tunika selbst war gar nicht so schlecht: schwarzer, hauchdünner Stoff mit einem tiefen, eckigen Ausschnitt, langen Ärmeln und einem passenden Stoffgürtel. Einen Moment lang zog ich in Erwägung, noch mal nach Hause zu fahren, um mich umzuziehen. Dann wurde mir klar, daß ich zu Hause auch nichts hatte, das besser als das hier aussah. Ich drehte mich zum Rücksitz um und wühlte die unglaubliche Krimskrams-Kollektion durch, die ich dort aufbewahre. Ich fahre einen VW, eine dieser nichtssagenden beigen Limousinen, die sich in den meisten Gegenden prima für Observierungsarbeiten eignen. Hier allerdings hätte ich mir besser einen Straßenkreuzer gemietet. Wahrscheinlich fuhren die Gärtner Volvos.
Ich schob die Gesetzestexte, die Karteikästen, das Werkzeug und die Aktentasche, in der ich meine Waffe unter Verschluß hielt, zur Seite. Ah, genau danach hatte ich gesucht: eine alte Nylonstrumpfhose, im Notfall gut als Filter zu gebrauchen. Auf dem Boden fand ich noch ein Paar schwarzer, hochhackiger Schuhe, die ich mir mal in der Absicht gekauft hatte, mich in einem schäbigen Teil von Los Angeles als Nutte auszugeben. Als ich hinkam, machte ich natürlich die Entdeckung, daß die Huren alle wie Collegeschülerinnen aussahen, also verzichtete ich auf die Verkleidung.
Ich warf die Sandalen, die ich trug, auf den Rücksitz und strampelte mich aus der Hose. Dann schlüpfte ich in die Strumpfhose, polierte die Pumps kurz mit Spucke und sprang hinein. Ich nahm den Gürtel von der Tunika und schlang ihn mir mit einem exotischen Knoten um den Hals. Auf dem Grund meiner Handtasche fand ich einen Eyeliner und etwas Rouge und veranstaltete damit eine Schnellrenovierung, zu der ich den Rückspiegel herabdrehte, damit ich mich sehen konnte. Meiner Ansicht nach sah ich ulkig aus, aber woher sollten die das wissen? Außer Bobby hatte mich keiner von denen jemals vorher gesehen. Hoffte ich.
Ich stieg aus dem Wagen und stützte mich ab. Ich hatte keine so hohen Absätze mehr getragen, seit ich mit den ausrangierten Sachen meiner Tante Verkleiden gespielt hatte, als ich in die erste Klasse ging. Ohne Gürtel reichte die Tunika bis zur Mitte der Oberschenkel, der federleichte Stoff haftete auf meinen Hüften. Wenn ich vor eine Lichtquelle geriet, würde man meinen Bikinislip sehen. Na und? Wenn ich es mir schon nicht leisten konnte, mich gut zu kleiden, konnte ich zumindest davon ablenken. Ich atmete tief durch und stelzte Richtung Tür.
Kapitel 3
Ich läutete und hörte das Geräusch durch das Haus hallen. Nach einer angemessenen Zeit wurde die Tür von einem schwarzen Dienstmädchen geöffnet, das eine weiße Uniform wie eine Krankenschwester trug. Am liebsten wäre ich ihr in die Arme gesunken, um mich zum Krankenhaus schleppen zu lassen, so sehr schmerzten mir die Füße. Stattdessen nannte ich meinen Namen und murmelte, Bobby Callahan erwarte mich.
»Ja, Miss Millhone. Wollen Sie nicht nähertreten, bitte?«
Sie trat zur Seite, und ich ging in die Halle. Die Wand am Eingang war zwei Stockwerke hoch, und Licht drang durch eine Reihe von Fenstern herein, die der Linienführung der breiten Steintreppe folgte, welche sich zur Linken hinaufwand. Die hellroten Bodenfliesen waren zu einem seidigen Schimmern poliert. Perserteppiche hingen von dekorativen schmiedeeisernen Stäben herab, die wie antike Waffen aussahen. Die Raumtemperatur war perfekt, kühl und ruhig, von einem riesigen Blumenarrangement parfümiert, das auf einem schweren Beistelltisch zu meiner Rechten stand. Ich kam mir vor wie in einem Museum.
Das Mädchen führte mich den Gang hinab in ein derart großes Wohnzimmer, daß die Gruppe von Menschen auf der gegenüberliegenden Seite in einem kleineren Maßstab gebaut zu sein schien als ich. Der offene Kamin muß drei Meter breit und gut vier Meter hoch gewesen sein, und er hatte eine Öffnung, die groß genug war, um einen Ochsen zu grillen. Die Möbel wirkten bequem; nichts war affektiert oder klein. Die Sofas, vier Stück, wirkten wuchtig, und die Sessel waren groß und dick gepolstert. Mit ihren breiten Lehnen erinnerten sie mich irgendwie an die Flugzeugsessel in der Ersten Klasse. Es gab keine bestimmte Farbskala, und ich fragte mich, ob nur die Mittelschicht hingeht und jemanden damit beauftragt, alles passend zusammenzustellen.
Ich erspähte Bobby, der glücklicherweise gleich in meine Richtung gehumpelt kam. Offenbar hatte er an meinem Gesichtsausdruck abgelesen, daß ich auf diesen ganzen Pomp nicht vorbereitet gewesen war.
»Ich hätte dich warnen sollen. Tut mir leid«, begann er. »Ich besorge dir was zu trinken. Was möchtest du haben? Wir haben Weißwein, aber wenn ich dir sage, was für einen, hältst du uns sicher für Angeber.«
»Wein ist genau das Richtige«, erwiderte ich. »Ich bin ganz verrückt auf die Angebersorte.«
Ein anderes Mädchen, nicht das, das an der Tür gewesen war, sondern eines, das speziell für den Service ausgebildet war, ahnte Bobbys Wünsche und näherte sich mit vollen Weingläsern. Ich hoffte inniglich, daß ich mich nicht blamieren würde, indem ich mir mein Getränk über das Kleid kippte oder mich mit dem Absatz im Teppich verfing. Er reichte mir ein Glas Wein, und ich nahm einen Schluck.
»Bist du in diesem Haus aufgewachsen?« fragte ich. Es war schwierig, sich Legosteine, Kasperlepuppen und Spielzeugautos in einem Raum vorzustellen, der wie ein Kirchenschiff aussah. Plötzlich nahm ich wahr, was in meinem Mund vor sich ging. Dieser Wein würde mir den Geschmack an dem Zeug aus Pappschachteln, das ich normalerweise trinke, für immer verderben.
»Ja, allerdings«, sagte er und sah sich jetzt interessiert um, als sei ihm dieses Mißverhältnis gerade erst aufgefallen. »Ich hatte natürlich ein Kindermädchen.«
»Oh, natürlich, warum auch nicht. Was machen deine Eltern? Oder soll ich raten?«
Bobby lächelte mich schief an und tupfte sich das Kinn ab. Beinahe verlegen, dachte ich. »Mein Großvater, der Vater meiner Mutter, gründete um die Jahrhundertwende ein großes Chemieunternehmen. Ich vermute, er hatte schließlich das Patent für ungefähr die Hälfte aller lebenswichtigen Produkte der Menschheit. Spülungen und Mundwasser und Verhütungsmittel. Auch freiverkäufliche Drogeriewaren, Lösungsmittel, Legierungen, Industrieprodukte. Die Liste ist noch ein bißchen länger.«
»Brüder? Schwestern?«
»Nur ich.«
»Wo ist dein Vater jetzt?«
»Tibet. Neuerdings steht er auf Bergsteigen. Letztes Jahr lebte er in einem Ashram in Indien. Seine Seele entfaltet sich im selben Tempo wie seine VISA-Rechnung.«
Ich legte eine Hand ans Ohr. »Höre ich da Feindseligkeit heraus?«
Bobby zuckte die Achseln. »Er kann es sich leisten, sich hobbymäßig mit dem großen Weltmysterium zu befassen, wegen der Abfindung, die er bei der Scheidung von meiner Mutter bekommen hat. Er tut, als wäre er auf dem großen spirituellen Trip, während er sich in Wirklichkeit einfach hängenläßt. Eigentlich war unser Verhältnis ganz okay, bis er direkt nach dem Unfall zurückkam. Er pflegte an meinem Bett zu sitzen, wohlwollend zu lächeln und mir zu erklären, daß meine Verkrüppelung eben etwas sei, durch das ich durch müßte in diesem Leben.« Er betrachtete mich mit einem seltsamen Lächeln. »Weißt du, was er sagte, als er hörte, daß Rick tot ist? ›Das ist schön. Das bedeutet, daß er seine Arbeit beendet hat.‹ Ich habe mich dermaßen aufgeregt, daß Dr. Kleinert ihm weitere Besuche bei mir untersagte, also zog er ab, um den Himalaya zu erklimmen. Wir hören nicht viel von ihm, aber ich glaube, das ist auch gut so.«
Bobby brach ab. Einen Moment lang schwammen Tränen in seinen Augen, und er kämpfte um Beherrschung. Er starrte auf die Gruppe von Menschen, die am Kamin standen, und ich folgte seinem Blick. Schnell überschlagen, schätzte ich sie auf ungefähr zehn Personen.
»Wer von denen ist deine Mutter?«
»Die Frau in der cremefarbenen Kleidung. Der Typ, der direkt hinter ihr steht, ist mein Stiefvater, Derek. Sie sind seit drei Jahren verheiratet, aber ich glaube nicht, daß es klappt.«
»Wie kommt’s?«
Bobby schien verschiedene Antworten zu erwägen, entschied sich schließlich aber doch für ein leichtes Kopfschütteln und Schweigen. Er sah mich wieder an. »Bist du bereit, sie kennenzulernen?«
»Erzähl mir erst noch etwas über die anderen Leute.« Reine Zeitschinderei, aber ich konnte nicht anders.