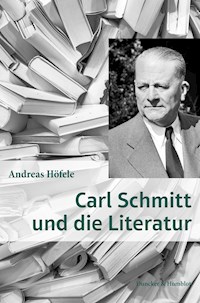
44,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Duncker & Humblot
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Andreas Höfeles Buch ist die erste Gesamtdarstellung von Carl Schmitts Umgang mit der Literatur. Es rekonstruiert die intellektuelle Biographie des umstrittenen Staatsrechtlers im Lichte der in den verschiedenen Phasen seines langen Lebens jeweils wichtigsten literarischen Autoren, Werke und Figuren. Schmitt war mit Dichtern befreundet, er hat über Literatur geschrieben und auch selber literarische Texte verfasst. Vor allem aber war ihm die Literatur zeitlebens eine unentbehrliche Denkressource. Das Buch beschreibt die politischen und persönlichen Konstellationen, von denen Schmitts Umgang mit Literatur geprägt war und in denen er Resonanz fand. Es zeigt, dass die Literatur kein Nebenschauplatz des Schmitt’schen Denkens ist. Sie ist Spiegel und immer wieder zentraler Referenzrahmen für Schmitts Sicht auf die Zeitgeschichte und für die mythische Überhöhung seiner eigenen Rolle in ihr.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
[1]
ANDREAS HÖFELE
Carl Schmitt und die Literatur
[3]
Carl Schmitt und die Literatur
Von
Andreas Höfele
Duncker & Humblot · Berlin
[4]
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation inder Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet über http://dnb.d-nb.deabrufbar.
Umschlag:
Hintergrundbild: © ginasanders/123RF.COM
Porträt Carl Schmitt: © Carl-Schmitt-Gesellschaft e.V.
(Foto: Horst Hassel)
Alle Rechte vorbehalten
© 2022 Duncker & Humblot GmbH, Berlin
Satz: L101 Mediengestaltung, Fürstenwalde
Druck: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany
ISBN 978-3-428-18608-2 (Print)
ISBN 978-3-428-58608-0 (E-Book)
Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706
Internet: http://www.duncker-humblot.de
[5]
Inhalt
Einleitung: Das dritte Auge
Kapitel 1
Mit der Dichtung gegen die Zeit:Die Schattenrisse und Das Nordlicht
I.Anfänge: Berlin 1907
II.Arm wie ein Landigel
III.Schattenrisse: gelehrte Versteckspiele
IV.Die Umrissenen
V.Der Dichter des Nordlichts
VI.Schmitts Nordlicht-Studie von 1916
VII.Nordlicht und politischer „Mythus“
VIII.„Bruch-Marmor“
Kapitel 2
Unter Literaten
I.Militär und Boheme
II.Kulturkatholizismus und Literatentum: Franz Blei
III.Die Buribunken
IV.Die Fackelkraus
V.Der magische Bischof: Hugo Ball
VI.„Weit mehr als eine bloße Episode“: Schmitts Begegnung mit Ball
VII.Balls Folgen der Reformation – und die Folgen
Kapitel 3
Shakespeare I: Der Othello-Komplex
I.„Von einem, der nicht klug, doch zu sehr liebte“
II.Gejagt von den Furien
[6]
III.Der Schatten Gottes
IV.Der Mohr mit dem germanischen Namen
V.Der treue Zigeuner
VI.Meer und Medusa: das Abjekt
VII.Arbeit am Begriff
Kapitel 4
Konrad Weiß: Der schwäbische Epimetheus
I.Der Verkannte
II.Der Freund
III.Morgengestirn
IV.Die eigentliche(re) katholische Verschärfung
V.Der christliche Epimetheus
VI.1933, oder: Die Aufbrecher
VII.Justitia: ein Gedicht und eine Widmung
Kapitel 5
Lange Schatten, geheime Zeichen:Herman Melvilles Benito Cereno
I.Das neue Reich
II.Eine Warnung
III.Melvilles Erzählung
IV.Geburt eines Mythos
V.Signale aus dem Bauch des Leviathans
VI.Der Besiegte
VII.Ableger
1.Enrique Tierno Galvan: „Benito Cereno oder der Mythos Euopas“
2.Nicolaus Sombart: „… das Allerschlimmste zu verhüten“
3.Sava Kličković: Atufal oder die Weltvernichtung
4.Marianne Kesting und die „Negerfrage“
5.Hans-Dietrich Sander: Blick zurück im Zorn
VIII.Die falsche Befreiung
[7]
Kapitel 6
Nachkrieg
I.Hitlerbilder
II.Davongekommen
III.Gespräch mit einem Kollegen
IV.Zwei Gräber in Berlin
V.Urworte, magische Klänge
VI.In der Stille
VII.Glossarium
VIII.Polarität der Zeitgenossen: Thomas Mann, Gottfried Benn
IX.Das Verhältnis zu Ernst Jünger
Kapitel 7
Shakespeare II: Hamlet in Plettenberg
I.Vorspiel: Fortinbras 1914
II.„Deutschland ist Hamlet“: ein Rückblick
III.Hamlet Stunde Null
IV.„Schreibtafel her!“
V.Sohn der Maria Stuart
VI.Einbruch der Zeit
VII.Der englische Garant: John Dover Wilson
VIII.Walter Benjamins Hamlet
IX.Reaktionen
X.Kurve abwärts
XI.Zauderer und Aufhalter
XII.Nachspiel: Fortinbras 1989
Kapitel 8
Auf zum letzten Gefecht, oder: Schmitt contra Blumenberg Literarisches in der Säkularisierungsdebatte
I.Goethes ungeheurer Spruch
II.Kontaktaufnahme
III.Säkularisierung: eine „Kategorie historischen Unrechts“
[8]
IV.Weltlichkeit gegen Verweltlichung
V.Erik Petersons ‚Legende‘
VI.Politische Theologie II
VII.Finale furioso
VIII.Arbeit am Mythos
Epilog: Die Verfolger
Dank
Verzeichnis der Kürzel
Auswahlbibliographie
I.Carl Schmitt
II.Weitere Literatur
Abbildungsnachweise
Personenregister
[9]
Einleitung: Das dritte Auge
Im März 1939 erhält Carl Schmitt einen Brief seines Hamburger Bekannten Wilhelm Stapel. Der bedankt sich für Schmitts Schattenrisse, eine Frühschrift aus dem Jahr 1913, in der der Rechtsprofessor – damals noch Rechtsreferendar – die Creme der zeitgenössischen Literatur persifliert hatte:
Sehr geehrter Herr Staatsrat,
Die „Schattenrisse“ habe ich teils an der Elbe, einsam Kaffee trinkend, teils beim Rotwein abends in der Stube gelesen. Also unter zwei entscheidenden Bedingungen.
Ich habe den sprachlichen Hohn genossen [...]. Ich habe mich ergötzt an dem „Lächeln des Menschen, dessen Wahrheitsdrang Genüge geschah, wenn er einen Blick hinter selbstgebaute Kulissen tun durfte“. Und besonders an dem, der „wünscht, es wüchsen ihm Hörner, wenn er so brüllt“. [...] Das „Zeitalter der Abspülbarkeit“ ist eine Prägung, die in der Tat Gemeingut aller Gebildeten werden sollte.
Es ist in Deutschland so selten, daß ein Gelehrter auch ein guter Schriftsteller ist. Hoffentlich aber kommt das Propaganda-Ministerium nicht dahinter, daß die französische Literatur eine Weltmacht ist; sonst würden unsere Gelehrten bald auf Hervorbringung besserer Qualitätsliteratur geschult werden. Mit dem einen Auge müßten sie auf ihr Werk sehen, mit dem anderen auf die Studenten, woher sollen sie ein drittes Auge, mit dem die Literatur zu betrachten wäre, nehmen?1
Schmitt wird sich über das Lob seiner Literatursatire gefreut haben, zumal aus so berufenem Munde. Mit Literatenwäsche (1930) hatte Stapel sich selbst recht erfolgreich in diesem Genre betätigt. Dass er in sein Lob Schmitts gesamtes Schaffen einbezieht, bestätigt nur, was auch von anderen längst bemerkt worden war: Schmitts schriftstellerische Brillanz, sein unverwechselbarer Stil galten von Anfang an als sein Markenzeichen. Natürlich hat er keine Nachhilfe in französischer oder sonst irgendeiner europäischen Literatur nötig. Also ist die anatomische Verlegenheit seiner Berufsgenossen für ihn auch kein Problem. Ganz offenkundig verfügt er über das, was seinen beschränkteren Kollegen fehlt: jenes dritte, auf die Literatur gerichtete Auge.
[10]
Schmitts Affinität zur Literatur ist bekannt, erklärt aber nicht, warum es lohnt, diesem Thema ein ganzes Buch zu widmen. Weder die literarischen Qualitäten seiner Schriften, noch seine enorme Belesenheit und nicht einmal die Tatsache, dass er sich als junger Mann selber als Literat versucht hat, sind ein hinreichender Grund. Fast schon im Gegenteil: Dergleichen wäre schließlich typisch für den Dilettanten, der sich an etwas ‚erfreut‘, das abseits seiner eigentlichen Profession liegt – der Internist etwa, der sich im Medizinerorchester an der Bratsche bewährt.
Darum aber handelt es sich bei Schmitt nicht. Von einer Nebenbeschäftigung, einem Freizeitvergnügen kann bei seinem Umgang mit Literatur keine Rede sein. Entscheidend – und der entscheidende Grund, sich mit dem Thema zu befassen – ist vielmehr, dass Schmitt, wenn er sich über Literatur äußert, die Hauptgebiete und -anliegen seines Denkens nicht verlässt. Literatur genießt bei ihm keinen Autonomiestatus. Sie ist kein Reich des schönen Scheins und freien Spiels. Sobald die Literaturwissenschaft ihren Gegenstand für autonom und politisch neutral oder schlechterdings apolitisch erklärt – so wie sie es in Deutschland nach 1945 aus leicht einsichtigen Gründen getan hat –, macht Schmitt diese Bewegung nicht mit. Programmatisch konstatiert der Untertitel seiner Hamlet-Studie von 1956 den „Einbruch der Zeit in das Spiel“. Nur Spiel ist Literatur für Schmitt nie. Reines Ästhetentum lehnt er ab. Nicht, weil er die Literatur zu wenig ernst nähme, gerät er in Widerspruch zu ihrer Wissenschaft, sondern weil er sie in gewisser Weise zu ernst oder jedenfalls anders ernst nimmt. Literarische Texte sind für ihn nicht weniger wahrheitsfähig als nur irgendein Sachdiskurs; literarische Ausdrucksmittel kein dekoratives Beiwerk oder bloße Einkleidung des ‚eigentlich‘ Gesagten. Schon gar nicht scheidet die Literatur aus der Kampfzone des Politischen aus. Vielmehr sieht Schmitt in ihr die Konfliktkonstellationen des Zeitgeschehens, die Umbrüche und Erschütterungen der gesellschaftlichen Welt oftmals seismographisch genauer registriert als in wissenschaftlichem Schrifttum. Dadurch wird ihm die Literatur zum Fundus, auf den seine Kultur- und Zeitkritik, seine politisch-theologische Großerzählung vom Niedergang des neuzeitlichen Europas und vom eschatologischen Ziel der Geschichte immer wieder zurückgreift.
Nur scheinbar widerspricht dem ein Tagebucheintrag vom September 1947, in dem Schmitt erklärt: „Ich habe immer nur als Jurist gesprochen und geschrieben und infolgedessen eigentlich auch nur zu Juristen und für Juristen.“ (G 23.9.1947)2 Wäre also doch allein die Juristerei von Belang und nur sie der angemessene Betrachtungsmaßstab seines Schaffens, alles Übrige – die Literatur eingeschlossen – dagegen nebensächlich? Zuweilen wird die Stelle in diesem Sinne zitiert, um Zuständigkeiten zu klären, das heißt die [11] Nichtzuständigkeit von Nichtjuristen für den Juristen Schmitt. Als eine Art „off limits!“-Schild also, ähnlich der Inschrift, die über dem Eingang der platonischen Akademie gestanden haben soll: „Niemand trete ein ohne Kenntnis der Geometrie.“
Das Zitat lässt sich aber auch genau andersherum lesen. Dass ein Jurist für Juristen schreibt, ist schließlich nichts Besonderes. Besonders ist, dass er glaubt, es eigens betonen zu müssen. Geht man danach, wer ihn tatsächlich las und liest, dann hat Schmitt eben keineswegs nur zu Juristen gesprochen und beileibe nicht nur geschrieben, was allein Juristen etwas anginge. Das Warnschild hebt also gerade hervor, was es in Abrede stellt: „daß Schmitt kaum jemals nur als Fachgelehrter und juristischer Praktiker dachte und schrieb.“3 Damit aber wird es zur Einladung, über Schmitt nicht nur als Juristen und nicht nur juristisch zu sprechen, sondern eben auch über die literarische Dimension seines Schaffens.
Nicht erst seit der ‚Schmitt-Renaissance‘ der 1980er Jahre ist der Staatsrechtler in die Hände von Nichtjuristen geraten.4 Schon die allererste Studie über ihn, erschienen 1924, stammt von einem solchen, einem Dichter sogar: dem Dada-Poeten Hugo Ball.5 Von Anfang an streut Schmitts Denken über juristische Fachkreise hinaus. Nur so erklärt sich seine anhaltende Wirkung. Mehr als einmal hat Schmitt versucht, die Streuung zu ‚zentrieren‘: sie auf den einen Punkt zu bringen, in dem alles zusammenläuft. An einer vielzitierten Stelle ist es „das Ringen um die eigentliche katholische Verschärfung“, von dem Schmitt sagt: „Das ist das geheime Schlüsselwort meiner gesamten geistigen und publizistischen Existenz.“ (G 16.6.1948) Auf eine für ihn charakteristische Weise erteilt Schmitt dem Einen dadurch, dass er es auch noch als das Geheime bezeichnet, eine geradezu magische Schlüsselgewalt für das Gesamte. Doch wiewohl er selber dazu neigt, derartige Fährten zu legen, ist Skepsis angebracht gegenüber einer Suche nach der Essenz, dem einen Zentralmotiv, das seine Gedankenwelt im Innersten zusammenhält. Diese Welt [12] hat mehr als nur ein Zentrum und erstreckt sich über mehr als eine Disziplin. Ein englischsprachiges Schmitt-Handbuch veranschaulicht dies mit einem Diagramm, das die ‚Trinität‘ von Schmitts legal thought, political thought und cultural thought in drei einander überschneidenden Kreisen abbildet.6 So lässt sich jede Schrift Schmitts der ihr gemäßen Schnittmenge zuordnen (legal- political, political-cultural, legal-political-cultural oder auch außerhalb der Überschneidungszonen als nur legal, political oder cultural). Ein solches Schema mag etwas mechanisch wirken und suggeriert eben doch auch wieder ein Zentrum – nur dass dieses nicht mehr eines der drei Elemente der Trinity of Thought privilegiert, sondern jetzt dort liegt, wo sie sich am dichtesten überschneiden. Jedenfalls aber bezeugt das Diagramm, wie das Handbuch insgesamt, den Wandel, der sich in der Schmittrezeption über die letzten Jahrzehnte vollzogen hat. Dass cultural thought nun in drittelparitätischer Gleichberechtigung neben den beiden ‚klassischen‘ Themenfeldern Recht und Politiktheorie steht, heißt natürlich auch, dass der Literatur und dem Literarischen bei Schmitt ein deutlich höherer Stellenwert zugemessen wird als früher. Noch bis in die achtziger Jahre hinein wurde dieser Aspekt als eher ornamental betrachtet oder allenfalls als Forschungslücke angemahnt. Von einer Lücke kann längst keine Rede mehr sein. Der Zustrom an Publikationen über Schmitt speist sich zu großen Teilen aus literatur- oder kulturwissenschaftlichen Quellen. Zahlreiche Einzelstudien sind Schmitts Beziehungen zu diversen literarischen Autoren und ihrer Bedeutung für sein Werk nachgegangen. Dass Schmitt der „am meisten literarische politische Denker des 20. Jahrhunderts“ sei, hat sich weltweit herumgesprochen.7
Das vorliegende Buch ist der Versuch einer Gesamtschau. Es erhebt nicht den Anspruch auf enzyklopädische Vollständigkeit – dem wäre bei Schmitts enzyklopädischer Belesenheit wohl wirklich nur in Form eines Lexikons Genüge zu tun –, sondern konzentriert sich auf die in den verschiedenen Phasen seines langen Lebens jeweils wichtigsten Autoren, Werke und Figuren der Literatur. Betrachtet werden sollen die intellektuellen und persönlichen Konstellationen und die durch diese Konstellationen gebildeten „Denkräume“ (Dieter Henrich), von denen Schmitts Umgang mit Literatur geprägt ist und in denen er Resonanz findet. So eigensinnig individuell Schmitts literarische Interessen auch sind, so mitteilsam, so gesellig ist er in der Kundgabe seiner Vorlieben und Abneigungen. Selten gibt es zwischen [13] diesen Gegensätzen ein unentschiedenes Drittes. „Ich hasse jedes Buch“, erklärt der Vierundzwanzigjährige, „das ich nicht selbst geschrieben habe oder in höchstem Maße bewundern muß.“ (T I 25.10.1912) Für die Gegenstände seiner Bewunderung wirbt er zeitlebens mit missionarischem Eifer, wenn auch nicht immer mit Erfolg: So bleibt die dunkle Poesie des von ihm verehrten Konrad Weiß selbst für wohlwollend Bemühte oft undurchdringlich. Anders Herman Melvilles Sklavenschiff-Erzählung Benito Cereno (1856). Schmitts Begeisterung für sie inspiriert andere zu Publikationen, die mit seinem Enthusiasmus zugleich auch seine Lesart übernehmen und produktiv weiterentwickeln. Benito Cereno ist auch ein besonders gutes Beispiel für Schmitts Auffassung vom unauflöslichen Zusammenhang zwischen ästhetischem Rang und politisch-historischem Erkenntniswert. Melvilles Erzählung ist für ihn deshalb so großartig, weil sie prophetisch gleich zwei politische Zentralthemen des zwanzigsten Jahrhunderts antizipiert: das Schicksal des Intellektuellen unter totalitärer Herrschaft und das Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und dem alten Europa, wie es die Weltordnung nach 1945 prägte.
Diese Untrennbarkeit von Ästhetik und Erkenntnis gilt auch bei der Lyrik, gerade bei der seiner Dichterfreunde Theodor Däubler und Konrad Weiß. Schmitt findet bei ihnen Verse, die ihm zum Losungswort seiner eigenen Überzeugungen werden. In Däublers „Sang an Palermo“ etwa den Satz: „Der Feind ist unsre eigene Frage als Gestalt“. Von allen Dichterworten dürfte dies das in der Schmittforschung weitaus meistzitierte sein. Das liegt an seiner offensichtlichen Nähe zum Begriff des Politischen und dessen zentralem Axiom: „Die spezifisch politische Unterscheidung [...] ist die Unterscheidung von Freund und Feind“.8 Vor allem aber liegt es wohl daran, dass das Zitat von Schmitt selber sein könnte. Sein Hang zum Aphorismus, zur ‚gemeißelten‘ Sentenz ist Ausdruck einer Sprachauffassung, die sich mit dem Gebrauchswert der Wörter nicht zufriedengibt. Wie der Gedanke ins Wort findet – und im Wort zündet –, das ist für Schmitt nicht einfach mit dem akademischen Alltagsgeschäft sachadäquater Formulierung abgetan und auch als Suche nach rhetorischem Effekt nicht hinreichend beschrieben. In Schmitts von Konrad Weiß angeregten Reflexionen über Wort und Sprache geht es um mehr. Weiß macht das Begriffspaar zur Antithese: Gegen die ‚Sprache‘ als Verkehrsmittel der Alltagskommunikation steht das ‚Wort‘ in jenem emphatischen Sinn, der sich direkt auf den göttlichen Logos, das in Christus fleischgewordene Wort bezieht. Mindestens genauso wichtig ist dabei die Vorstellung einer elementaren Beschwörungskraft, die sich in der Dichtung am ursprünglichsten erhalten hat. „Das Metrum gehört zur Magie“, [14] notiert er: „Es muß aber zwischen dem Metrum und dem gedanklich-gegenständlichen Sinn ein gewisser Spielraum bleiben [...]. In diesem Intervall, das leer bleibt, schwingt das Numinose. [...] Das Metrum ist das leere Gefäß nicht für den Inhalt, sondern für die magische Schwingung.“ (G 24.12.1947) Vom Juristen, der „eigentlich auch nur [...] für Juristen“ geschrieben haben will, merkt man hier wenig.9 Wohl aber von einer Sprachbewusstheit, die dem Schreibstil des Juristen sein Gepräge gibt: Das schlagende, zu äußerster Wirksamkeit gehärtete Wort, das sich geradezu mantrahaft in die Köpfe pflanzt – darin ist die Dichtung nicht allein Fundus, sondern auch Modell für den Gelehrten und den politischen Schriftsteller Schmitt.
Mehrfach auf den wenigen Seiten dieser Einleitung wurde nun schon aus Schmitts Tagebüchern zitiert, und auch im Weiteren wird dies häufig geschehen. Der – mitunter berechtigte – Einwand, die Verwendung solcher Aufzeichnungen verschiebe den Fokus vom veröffentlichten Œuvre eines Autors allzu sehr auf die bloß privaten Belange seiner Biographie, greift in unserem Falle nicht. Die Literatur und das Literarische werden von Schmitt zu großen Teilen in seinen Tagebuchaufzeichnungen abgehandelt. Und dabei geht es, wie etwa bei der Überlegung zum Metrum, keineswegs nur um Privates. Doch um dieses, das Private, eben auch, und es ist oftmals für unser Thema nicht weniger einschlägig. Schmitts Verhältnis zur Literatur ist hochgradig ichbezogen, auch wenn er sich (in seinem Tagebuch, wo sonst?) scharf gegen solche Ichbezogenheit verwahrt: „Sich mit Gelesenem vergleichen und es auf sich beziehen, Identifikationen und Übertragungen vornehmen; das ist das Bewußtsein? Es ist Krankheit, Neurose.“ (T I 16.11.1912) Zwar diagnostiziert er diese Krankheit im selben Atemzug „[b]ei allen Frauen“. Doch vor allem und in kaum zu überbietendem Maße ist er selbst von ihr befallen. Die Literatur bildet nicht nur ein unverzichtbares Element seines intellektuellen Bezugssystems, sondern auch ein Mittel der Lebensbewältigung und Selbstvergewisserung. Zuweilen auch, wie im Falle von Shakespeares Othello, einer zerstörerischen Selbstobsession. Der Verächter einer Politik des „endlosen Gesprächs“, die er in der Romantik inauguriert und im ‚zahnlosen‘ Parlamentarismus der Weimarer Republik untergehen sah,10 führt in seinen Tagebüchern ein endloses Selbstgespräch. Dort zeigt sich unter der Ich-Verpanzerung, die Helmut Lethen in den „Verhaltenslehren [15] der Kälte“11 exemplarisch an Schmitt darstellt, eine alles andere als ‚kalte‘, vielmehr von Hitzeschüben und heftigen Gefühlsschwankungen geplagte Person. Immer wieder dient die Literatur dabei als Spiegel der Selbstbeobachtung.
Schmitts Literaturbeschäftigung lässt sich in vier Modalitäten unterteilen: Er hat mit Literaten und Dichtern verkehrt. Er hat über Literatur geschrieben. Er hat selber literarische Texte verfasst. Und er hat Figuren und andere Fundstücke aus der Literatur für seine Welt- und Selbstdeutung verwertet. Eine strikte Systematik ergibt sich hieraus nicht. Allein schon, weil die Umgangsweisen sich ständig verbinden und überlagern. Die Begegnung mit dem Dichter Theodor Däubler etwa führt zu Schmitts Studie über dessen Epos Das Nordlicht (1916), zur Entstehung der Schattenrisse wie auch zur lebenslangen Präsenz der Däubler'schen Gedichte in Schmitts Denk- und Deutungsfundus.
Dieser Gemengelage trägt dieses Buch Rechnung. Seine Kapitel beschreiben Stationen einer intellektuellen Biographie. Die Chronologie bildet dabei kein striktes Raster. Der thematische Zusammenhang erfordert zuweilen Vorgriffe auf Späteres; entsprechend muss mitunter bei Früherem wiedereingesetzt werden. Kapitel 1 und 2 widmen sich Schmitts Begegnungen mit Dichtern und Literaten in ihrer zeitlichen Abfolge von Däubler, den er im Sommer 1912 kennenlernt, zu Franz Blei und Hugo Ball. Kapitel 3 folgt Schmitts Befassung mit Shakespeares Othello von den ersten Anzeichen vor 1914 bis zu ihrem manischen Höhepunkt in den zwanziger Jahren. Kapitel 4, zu Konrad Weiß, beleuchtet dessen Dichtung und ihre Bedeutung für Schmitt vor allem im Entscheidungsjahr 1933, in das die Publikation von Weiß' Programmschrift Der christliche Epimetheus fällt. Schmitts NS-Engagement der Jahre 1933–36 bildet den Ausgangspunkt von Kapitel 5. In dessen Mittelpunkt steht Schmitts Mythisierung der Titelfigur von Melvilles Benito Cereno, die in den frühen vierziger Jahren beginnt, sich in die Nachkriegszeit fortsetzt und bis weit in die siebziger Jahre hinein Schule macht. Zurück auf die unmittelbare Nachkriegszeit und Schmitts ‚inneres Exil‘ in der Bundesrepublik geht Kapitel 6, das sich mit Schmitts Literarisierung Hitlers, mit seiner Kleist- sowie Droste-Hülshoff-Rezeption und mit seinem Verhältnis zu den Zeitgenossen Thomas Mann, Gottfried Benn und Ernst Jünger befasst. Kapitel 7 widmet sich Schmitts bekanntester literaturwissenschaftlicher Arbeit Hamlet oder Hekuba von 1956, die, zu ihrer Entstehungszeit wenig beachtet, mittlerweile international Furore gemacht hat. Kapitel 8 schließlich führt zu Politische Theologie II (1970), Schmitts letzter Buchveröffentlichung und der in ihr angestoßenen Debatte über die Legitimität der säkularen Neuzeit, [16] die sich im Briefwechsel mit Hans Blumenberg bis in die zweite Hälfte der siebziger Jahre fortsetzt. Als Epilog folgt ein Ausblick auf Schmitts letzte Lebensjahre.
Die ‚Literaturgeschichte‘ des Juristen Schmitt, die hier erzählt werden soll, entfaltet sich in wechselnden Personenkonstellationen, Beziehungsgeflechten und intellektuellen Netzwerken. Ihre Stationen spiegeln zugleich die deutsche Krisengeschichte des 20. Jahrhunderts. Eine 1954 von Schmitt selbst verfasste, oft zitierte Kurzfassung seines Lebenslaufs lautet: „C. S. geb. 1888 in Plettenberg (Westfalen), studierte in Berlin, München und Straßburg, habilitierte sich 1916 in Straßburg, verlor infolge des Ausgangs des ersten Weltkriegs seine Dozentur; von 1921–1945 ordentlicher Professor des öffentlichen Rechts in Greifswald, Bonn, Köln und Berlin; 1933 Preußischer Staatsrat; verlor 1945 infolge des Ausgangs des zweiten Weltkriegs seinen Lehrstuhl und lebt seit 1947 in Plettenberg (Westfalen).“12 „Die Identität“ seiner Biographie „mit dem Schicksal Deutschlands“ werde „deutlich genug in diesen Daten“, fügt Schmitt hinzu und initiiert damit „eine verführerisch starke Legende“13, der allererst wohl er selbst verfällt. Auch ohne Legendenbildung ist indessen klar, dass ein Leben, das vom Kaiserreich Wilhelms II. über die Weimarer Republik und die NS-Diktatur hinaus noch für dreieinhalb Jahrzehnte in die Bundesrepublik hineinreicht, den Verwerfungen der Zeitgeschichte nicht entkommen konnte. Zumal dieses Leben, das in den Anfangsjahren der Naziherrschaft den Zenit seiner öffentlichen Sichtbarkeit erreichte und sich davon nie mehr erholt hat.
Mit dem Einbruch der Zeit in das literarische Spiel ist bei Schmitt mithin immer zu rechnen. Selbst dann, wenn es – wie im eingangs zitierten Brief Wilhelm Stapels vom März '39 – um etwas so Unverfängliches geht wie die satirischen Jugendspiele eines mittlerweile Berühmten und die Lektüre dieser Satiren ganz im Stillen stattfindet: einsam an der Elbe und in der Stube. Denn mit dieser Stille hat es eine politische Bewandtnis. Sie verbindet den Briefschreiber mit dem Adressaten. Und sie ist, so behaglich sie bei Kaffee und Rotwein klingen mag, nicht freiwillig. Beide, Stapel wie Schmitt, sind nach anfänglichem Karriereschub im Dritten Reich inzwischen auf dem Abstellgleis gelandet. Schmitts Sturz aus allen Funktionärsämtern, Resultat einer im SS-Blatt Das Schwarze Korps gegen ihn lancierten Kampagne, ist Ende 1936 besiegelt. Schon ein Jahr früher gerät Stapel ins Visier der SS.[17] Als Herausgeber der völkisch-nationalen Zeitschrift Das deutsche Volkstum und bekennender Antisemit,14 sieht er sich 1938 gezwungen, von seiner Herausgeberschaft zurückzutreten, und verliert auch seine Position als inoffizieller Programmleiter der Hanseatischen Verlagsanstalt, bei der Schmitts Schriften ab 1933 erscheinen. Die Parallelität der beiden Karriereknicke wird in der Schweizer Exilzeitschrift Deutsche Briefe mit dem Schillerwort vom Mohren kommentiert, der seine Schuldigkeit getan hat und gehen kann.15 Beide ‚Mohren‘ sind glimpflich davongekommen, auch wenn es für Schmitt 1936 zunächst bedrohlich aussieht. Nur ein Machtwort Görings erhält ihm den Lehrstuhl und – Stapels Anrede belegt es – den Titel Staatsrat. Eine Art Ruhe nach dem Sturm herrscht in diesem brieflichen Plausch zweier Gestrandeter. Vom Leviathan ausgespien, findet man in der Literatur ein Refugium, in dem sich diskret sogar die Ignoranz des Propagandaministeriums bespötteln lässt. Aber der Flüsterwitz zeigt gerade auch, wie fragil die in der Literatur gesuchte Zuflucht ist: ein Refugium, das der Leviathan jederzeit wieder verschlucken kann. Aus dieser Abhängigkeit gibt es für die Literatur kein Entkommen. Doch macht sie das für Schmitt nicht weniger unentbehrlich.
Schmitt lässt seiner Äußerung, er habe immer nur als Jurist und für Juristen geschrieben, einen Nachsatz folgen: „Mein Unglück war, daß die Juristen meiner Zeit zu positivistischen Gesetzeshandhabungstechnikern geworden waren, tief unwissend und ungebildet, bestenfalls Goetheaner und neutralisierte Humanitärs. So konnten sich die mithorchenden Nichtjuristen auf jedes Wort und jede Formulierung stürzen und mich als einen Wüstenfuchs zerreißen.“ (G 23.9.1947) Als er dies schrieb, konnte Schmitt nicht ahnen, welche Ausmaße das Heer der nichtjuristischen Mithorcher einmal annehmen würde. Sorge um den Wüstenfuchs muss man sich deswegen kaum machen. Eher schon um eine Zeit – die unsere –, die ihm mit der „Erosion liberaler Demokratie“ (Christoph Möllers) und der Wiederkehr martialischer Großraumpolitik zu solcher Aktualität verhilft.
1 Stapel an Schmitt, 12.3.1939, Nachlass Carl Schmitt, Landesarchiv NRW, RW 265-15680. Abgedruckt in: Siegfried Lokatis (Hg.), „Wilhelm Stapel und Carl Schmitt – Ein Briefwechsel“, in: Piet Tommissen (Hg.), Schmittiana V, Berlin: Duncker & Humblot, 1996, S. 27–108, hier: S. 64.
2 Das Verzeichnis der verwendeten Kürzel findet sich unten S. 501.
3 Wilhelm Kühlmann, „Im Schatten des Leviathan (1933). Carl Schmitt und Konrad Weiß“, in: Moderne und Antimoderne. Der Renouveau catholique und die deutscheLiteratur. Hg. von Wilhelm Kühlmann und Roman Luckscheiter. Freiburg i. B.: Rombach, 2008, S. 257–306, hier: S. 259.
4 Wesentlichen Antrieb erhielt die ‚Schmitt-Renaissance‘ durch die beiden Studien von Heinrich Meier, Carl Schmitt, Leo Strauss und „Der Begriff des Politischen“. Zueinem Dialog unter Abwesenden. Stuttgart: Metzler, 1988 (32013); sowie ders., DieLehre Carl Schmitts – Vier Kapitel zur Unterscheidung Politischer Theologie undPolitischer Philosophie. Stuttgart: Metzler, 1994 (42012). Zuvörderst auf Meier bezieht sich die kritische Sammelrezension von Günter Maschke, „Carl Schmitt in den Händen der Nicht-Juristen“, in: Der Staat 34/I (1995), S. 104–129.
5 Hugo Ball, „Carl Schmitts Politische Theologie“, in: Hochland XXI (1923/24), S. 263–286.
6 Jens Meierheinrich / Oliver Simons, „A Fanatic of Order in an Epoch of Confusing Turmoil: The Political, Legal, and Cultural Thought of Carl Schmitt“, in: Dies. (Hg.), The Oxford Handbook of Carl Schmitt. New York: Oxford University Press, 2016, S. 3–70, hier: S. 53.
7 „[T]he most literary political thinker of the 20th cy.“ Thomas O. Beebee, „Carl Schmitt’s Myth of Benito Cereno“, in: A Journal of Germanic Studies 42.2 (May 2006), S. 114–134, hier: S. 114.
8 Carl Schmitt, Der Begriff des Politischen. Berlin: Duncker & Humblot, 92015, S. 25.
9 Schmitts Behauptung, er habe nur für Juristen geschrieben, wird ohnehin schon durch ein verräterisches „eigentlich“ entkräftet. Zur Bedeutung und Funktion dieses Wörtchens Peter Panter [= Kurt Tucholsky], „eigentlich“, in: Vossische Zeitung, 14.3.1928.
10 Carl Schmitt, Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität (1922). Berlin: Duncker & Humblot, 102015, S. 59; ders., Die geistesgeschichtlicheLage des heutigen Parlamentarismus (1923). Berlin: Duncker & Humblot, 102017.
11 Helmut Lethen, Verhaltenslehren der Kälte. Lebensversuche zwischen den Kriegen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1994.
12 Schmitt an Armin Mohler, 27.11.1954, in: Carl Schmitt – Briefwechsel mit einem seiner Schüler. Hg. von Armin Mohler in Zusammenarbeit mit Irmgard Huhn und Piet Tommissen. Berlin: Akademie Verlag, 1995, S. 183. Zitate aus diesem Briefwechsel im Folgenden unter dem Kürzel MB mit Seitenzahlen im laufenden Text.
13 Reinhard Mehring, Carl Schmitt. Aufstieg und Fall. München: C. H. Beck, 2009, S. 13.
14 Von Wilhelm Stapel u. a.: Antisemitismus und Antigermanismus – Über das seelische Problem der Symbiose des deutschen und des jüdischen Volkes (1928); „Versuch einer praktischen Lösung der Judenfrage“ (1932); Die literarische Vorherrschaft der Juden in Deutschland 1918 bis 1933 (1937). Die Glossen seiner Literatenwäsche und deren Illustrationen von A. Paul Weber lassen es an antijüdischen Gehässigkeiten nicht fehlen.
15Deutsche Briefe Nr. 42, 19.7.1935: „Ist er [Carl Schmitt für das NS-Regime] noch nötig, während Herr Stapel seine Schuldigkeit getan hat und darum einen Fußtritt erhalten kann?“ In Nr. 116, 11.12.1936, heißt es dann: „ ‚Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr kann gehen‘ – kann man diesen klassischen Satz jetzt auch auf Carl Schmitt, den zynisch Gleichgeschalteten, anwenden?“
[18]
Kapitel 1
Mit der Dichtung gegen die Zeit: Die Schattenrisse und Das Nordlicht
Szene: Ein junger Mann im Zimmer. Geht herum, grunzt, schneidet Grimassen; dann arbeitet er wieder etwas. Dann sagt er zu sich: Schmitt sei fleißig.
Carl Schmitt, Tagebuch, 9.1.1915
I. Anfänge: Berlin 1907
Fast wäre ein Literaturwissenschaftler aus ihm geworden. Im Abiturzeugnis steht, er verlasse die Schule „mit der Absicht, Philologie zu studieren“. Philologie? protestiert sein Onkel: „Du bist ja verrückt. Das ist ja eine ganz kümmerliche Angelegenheit. [...] Ich geb' dir einen guten Rat: Studier Jura!“1 Der Onkel André Steinlein, Bruder der Mutter, war im Lothringischen ein „schwerreicher Mann geworden“.2 Sein Wort hat Gewicht. Und so kommt es, dass der achtzehnjährige Carl, ein „obskurer junger Mann bescheidener Herkunft“3, sich zum Sommersemester 1907 nicht an der Philosophischen, sondern der Juristischen Fakultät der Berliner Friedrich-Wilhelms- (heute Humboldt-)Universität einschreibt.
Was nicht heißt, dass die Philologie sich damit erledigt hätte. Sein erstes Semester, so schildert Schmitt es im Rückblick, stand paritätisch im Zeichen zweier Leitsterne, von denen nur der eine, Josef Kohler, Jurist war. Der andere war Philologe: Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. An ihn erinnert man sich heute vor allem wegen seiner jugendlichen Attacke auf Friedrich Nietzsches Geburt der Tragödie.4 Beide, Wilamowitz wie Kohler, gehörten[19] zu den Berühmtheiten des Berliner Geisteslebens und unterstrichen dies in ihrem Habitus: Kohler „süddeutsch barock“, Wilamowitz „preußisch verhalten“ (B 15). „Ehrfürchtig“, schreibt Schmitt, „betrat ich die Universität; ich dachte sie wäre der Tempel einer höheren Geistigkeit.“ Doch der herrschende Kult „war ganz wirr und konnte mich nicht zur Teilnahme bewegen. Seine Priester waren auf eine eigentümliche, widerspruchsvolle Weise Ich-bezogen.“ (B 14) „Es gab hier sehr viele große und bedeutende Gelehrte. [...] Es wurde viel gearbeitet, rasend gearbeitet, aber auch in Schauspielhäusern kann rasend gearbeitet werden.“ (B 15)
Rasend gearbeitet haben muss der juristische Hauptdarsteller auf dieser Bühne, Josef Kohler. Sein Publikationsverzeichnis umfasst über zweitausend Titel. Trotzdem fand er – neben seinen Studien auf nahezu allen Rechtsgebieten – noch Zeit, einen autobiographischen Entwicklungsroman mit dem Titel Eine Faust-Natur zu verfassen. „Ich las den Roman und schämte mich des berühmten Mannes“, schreibt Schmitt. Zwar findet er für Kohlers Einfallsreichtum durchaus anerkennende Worte. Doch konnte dieser
nichts denken oder sagen, ohne sich dabei mit sich selbst zu beschäftigen [...]. Sprach er von dem Asylrecht der Bantu-Neger, so hörte man nur: Ich und das Asylrecht der Bantu-Neger. Er hielt das für stilvoll, weil er sich für einen großen Künstler hielt. Seine Gesichtsmaske und seine Mähne trug er mit barockem Stolz zur Schau, wobei er sich auf eine Ähnlichkeit mit dem Großen Kurfürsten stilisiert hatte. (B 15)
Ganz anders der Altphilologe Wilamowitz-Moellendorff. Würdevoll, aristokratisch, von imposanter rhetorischer Prägnanz, fand er anfangs Schmitts rückhaltlose Bewunderung. Doch auch hier kam es zur „Repulsion“ (B 17). Ausschlaggebend war Schmitts Lektüre der vielgerühmten Rede, die Wilamowitz zum Jahrhundertwechsel 1900 gehalten hatte:5 ein „Meisterstück akademischer Vortragskunst“, „in allem ebenso sorgfältig durchgearbeitet und gepflegt, wie Josef Kohlers Roman von der Faustnatur liederlich hingeworfen und ungepflegt“ war. (B 17) Doch unter ihrem faustischen Motto, den Anfangszeilen des Prologs im Himmel,6 frönte die Rede dem gleichen[20] selbstgewissen Fortschrittsoptimismus, den auch Kohler vertrat. „[E]ntschieden komisch“, schreibt Schmitt, sei ihm geworden, „als der vornehme Mann […] das schilderte, was er den ‚Typus des modernen deutschen Mannes‘ nannte.“ Der „sollte so aussehen, wie die Gildenbilder von Rembrandt und Frans Hals den wetterfesten, freien Niederländer zeigen. Da waren wir also wieder bei der historischen Oper. […] Der einzige Raum, den diese Art Geistigkeit kannte, war der Bühnenraum.“ (B 17 f.) Das „würdevolle Gesicht“ des berühmten Professors wurde so zur Maske und diese wiederum zum Ausdruck der maskenhaften Gesamtphysiognomie der Epoche, die sich selbst im Bilde des ‚Olympiers‘ Goethe bespiegelte: „Mein […] Misstrauen“, erinnert sich Schmitt,
fand einen ersten Ansatz in der imposanten Gesichtsmaske des Mannes [Wilamowitz]. Ich sah ihn mir an und ging traurig von ihm weg. […] In dem Gesicht des geistigen Typus dieser Jahre trafen drei bürgerliche Gesichter zusammen, das eines Predigers, eines Professors und eines Schauspielers. Der Generalnenner […] kam durch ästhetische Harmonisierung zustande. Dadurch ergab sich eine Gesamttendenz zur Goethe-Maske. Die Goethe-Maske war das tiefste Unheil der Zeit. Mit ihr wurde Tausenden von begeisterungsfähigen Jünglingen das Scheinbild einer potestas spiritualis in die Seele gelegt. Nur weil die Erinnerung an eine echte potestas spiritualis in mir noch nicht verloren gegangen war, blieb ich davor bewahrt, dem Scheinbild zu verfallen. (B 18)
Autobiographische Reminiszenzen haben es an sich, dem Erleben von einst den Stempel nachträglicher Reflexion aufzudrücken. Schmitts Rückblick macht hierin keine Ausnahme. Dass ihm schon 1907 an zwei Exemplaren der Berliner Professorenprominenz die Krisensymptomatik des Zeitgeists samt der ihr angemessenen diagnostischen Begrifflichkeit aufgegangen wäre, ist unwahrscheinlich. An seiner tatsächlich empfundenen Distanz zum intellektuellen Milieu des wilhelminischen Berlins besteht dennoch kein Zweifel. Von diesem Milieu trennte ihn seine Herkunft: das strebsam kleinbürgerliche, fromm katholische Elternhaus. Der Goethe-Kult, der sich in Kohlers Mummenschanz zur Lächerlichkeit übersteigerte, diente der Selbstfeier einer gehobenen Bildungsschicht, zu der Schmitt (noch) nicht gehörte. Gegen die kunstreligiösen Tendenzen dieser Schicht dürfte ihn seine Sozialisation im Katholizismus gefeit haben; auch wenn er diese Tendenzen vorerst wohl noch nicht in den politisch-theologischen Gegensatz zwischen scheinbarer und echter potestas spiritualis zu fassen gewusst hätte.
Das Schauspiel, das Berlin dem Studienanfänger bot, versetzte ihn in die Position eines beobachtenden Außenseiters, der, „ganz im Dunkel stehend, [21] [...] in einen hellerleuchteten Raum hineinsah.“ (B 20) „Behagen“ ließ die Zuschauerrolle nicht aufkommen. „Die starke Repulsion [...] [d]as Gefühl der Traurigkeit, das mich erfüllte, verstärkte meinen Abstand und erweckte bei den Andern Misstrauen und Befremdung.“ (B 21)
Mit seiner ‚Repulsion‘, seinem Gefühl des Abgestoßen- und Ausgeschlossenseins, ist Schmitt in seiner Generation allerdings kein Einzelfall. Wenn Max Kommerell Anfang der dreißiger Jahre auf eine Jugend um 1900 zurückblickt, „die sich selbst als die Umkehrung zu den bürgerlichen Lebensformen und Lebenswerten begriff“, so hat er jene breite Strömung im Blick, die das Schlagwort der Zeit – Jugend – programmatisch im Namen führt: die Jugendbewegung. Ihr ist Schmitt gewiss nicht zuzurechnen. Eher schon jenen beiden anderen Gruppen, die Kommerell benennt: nämlich „eine engere, von heutiger Dichtung stark ergriffene Jugend, und als Drittes jene Suchenden, die zu scheu und mit sich selbst zu sparsam [sind,] um sich irgend einzureihen, aber stark genug um die Einsamkeit auszuhalten“.7
Auf die Schrift Kommerells, der diese Zitate entstammen, bezieht sich Schmitt in einer Tagebuchnotiz vom 17.5.1948: „Der entscheidende Schritt um 1900 war der Schritt vom Goethischen zum Hölderlin’schen Genialismus.“ Und tags darauf:
„Jugend ohne Goethe“ (Max Kommerell), das war für uns seit 1910 in concreto Jugend mit Hölderlin, d. h. der Übergang vom optimistisch-irenisch-neutralisierenden Genialismus zum pessimistisch-aktiven-tragischen Genialismus. Es blieb aber im genialistischen Rahmen, ja, vertiefte ihn noch in unendliche Tiefen. Norbert von Hellingrath ist wichtiger als Stefan George und Rilke. (G 18.5.1948)
Schmitt stellt seine Distanzierung vom bürgerlichen Goethe-Mythos in den Zusammenhang eines literatur- und zeitgeschichtlichen Umbruchs. Der junge Altphilologe Norbert von Hellingrath, 1888, im selben Jahr geboren wie Schmitt, stieß 1909 bei Recherchen in der Stuttgarter Bibliothek auf die späten Hymnen und Pindar-Übertragungen Hölderlins. Dieser Fund und Hellingraths Kommentierung des Gefundenen bewirkten eine Hölderlin-Renaissance, die den bislang weitgehend vergessenen Dichter in kürzester Zeit zum Leitbild einer ganzen Generation erhob. Entscheidend hierfür war Stefan George. Er erkannte sofort die Bedeutung der Forschung Hellingraths, sorgte für deren erste Publikation in seinen Blättern für die Kunst (1910) und vereinnahmte den neuentdeckten ‚wahren‘ Hölderlin als Vorreiter seines eigenen Schaffens und Propheten der in seinem Kreis vertretenen Reichsidee eines ‚Geheimen Deutschlands‘. Hellingraths Vortrag „Hölderlin und die Deutschen“, den er 1915 auf Fronturlaub in München hielt, gibt dem von Schmitt genannten Umbruch von Goethe zu Hölderlin eine deutlich georgeanische [22] Richtung. Er wolle „alles eher“, sagt Hellingrath, „als Goethe und Hölderlin gegeneinander ausspielen“,
ich will sie nur nebeneinander stellen, will von dem gewohnten Begriff: „Volk Goethes“ ausgehn und den sehr ungebräuchlichen: „Volk Hölderlins“ ins Licht stellen. [...] Ich nenne uns „Volk Hölderlins“, weil es zutiefst im deutschen Wesen liegt, daß sein innerster Glutkern unendlich weit unter der Schlacken-Kruste, die seine Oberfläche ist, nur in einem geheimen Deutschland zutage tritt [...].8
Soweit erkennbar, blieb Schmitt vom Sog des George-Kreises unberührt. Vielen seiner Altersgenossen bot das ‚Geheime Deutschland‘ ein unwiderstehliches Gegenmodell zur Verflachung der Zeit. Den Lockruf des ‚Meisters‘ muss auch Schmitt vernommen haben – er war um 1910 unüberhörbar. Gefolgt ist er ihm nicht. Vielleicht immunisierte die Goethe-Maske ihn gegen die George-Maske, von der sich erst recht behaupten ließe, sie habe „begeisterungsfähigen Jünglingen das Scheinbild einer potestas spiritualis in die Seele gelegt.“ (B 18)
In der hochgradig kontrastiven Verteilung von Schmitts literarischen Vorlieben und Aversionen bleibt Stefan George auch späterhin eine seltsam unbeleuchtete Gestalt. Nicht zwischen den Fronten, auch nicht mal auf der guten und mal auf der Feindesseite, sondern in einem geradezu schweizerisch neutralen Daneben. Gleichsam da und nicht da. Dass sich an George üblicherweise die Geister scheiden, dass man ihn aufgrund der politischen Dimension seiner Wirkung der sogenannten ‚Konservativen Revolution‘ zugerechnet hat (wie man es auch mit Schmitt, wenngleich mit ähnlich fraglicher Berechtigung, getan hat),9 macht diese Aussparung umso bemerkenswerter.
Anstatt sich in die zahlreiche und über die 1910er und ’20er Jahre anwachsende Jüngerschaft Stefan Georges einzureihen, erkor sich Schmitt einen anderen zum poetischen Leitgenie, einen, dessen Kreis – wenn von einem solchen denn überhaupt die Rede sein kann – sich auf eine verschwindend [23] kleine Schar von Bewunderern beschränkte: Theodor Däubler (1876– 1934). Schon zu Lebzeiten wenig gelesen, ist dieser Dichter mitsamt seinem ungeschlachten Hauptwerk, der episch-lyrischen Monumentaldichtung Das Nordlicht, heute so gut wie vergessen. Dass Däubler ein Verkannter war, konnte seine Attraktivität für Schmitt nur steigern. Mit Verkennungen aufzuräumen, ist ein zentraler Impuls der Schmitt’schen Denktätigkeit: im Juristischen, Politischen und eben auch im Literarischen. Däubler zum „größten Dichter der Gegenwart“10 auszurufen (und nicht in georgeanischen Chorälen mitzujubilieren), ließ etwas vom Pathos des genialen Außenseiters auch auf dessen Verkünder ausstrahlen. „Woran scheiterte Däubler als deutscher Dichter bei den Deutschen“? fragt Schmitt in einer späten Notiz: „Weil er kein Sekten-Stifter war; totale Unfähigkeit sich zum Mittelpunkt eines Kreises [zu machen wie] Stefan George.“11
Auch Däubler blieb, wie Schmitt es von dem Hellingrath'schen Hölderlin sagt, „im genialistischen Rahmen“, ein Ausläufer spätromantischen Dichtertums. Doch vertrat er dieses aus Schmitts Sicht ungleich authentischer als seine Zeitgenossen und war dabei „unendlich moderner als alle Aestheten und Literaten, deren ganzer Stolz es war, modern zu sein.“12
II. Arm wie ein Landigel
Schmitt absolviert sein Jurastudium in den als Mindestdauer vorgeschriebenen sechs Semestern und wechselt dabei zweimal die Universität: von Berlin zuerst für ein Semester nach München, dann nach Straßburg, wo er im Winter 1908/9 im Seminar seines Doktorvaters Friedrich van Calker auf Fritz Eisler trifft. Eisler ist der älteste Sohn eines jüdischen Verlegers, der in Hamburg neben mehreren Zeitschriften auch eine florierende „Annoncen-Expedition“ betreibt. Die beiden sind bald enge Freunde. Hinzustößt Franz Kluxen, kunstbegeisterter Sohn eines Münsteraner Kaufhausbesitzers. Ihn kennt Schmitt schon vom Gymnasium, wo Kluxen ihn in die „genialistische Geistigkeit des deutschen 19. Jahrhunderts, in R. Wagner und Otto Weininger, initiiert hat.“ (G 114) Komplettiert wird das Freundesquartett durch Eduard Rosenbaum, auch er, wie Eisler, Spross einer betuchten jüdischen Familie aus Hamburg. Mit Schmitt ist er seit dessen Münchner Semester [24] befreundet. Die soziale Kluft, die Schmitt von seinen finanziell wohlgebetteten Gefährten trennt, tut der Freundschaft keinen Abbruch. Ebenso wenig die konfessionelle Kluft, obwohl antijüdische Ressentiments, daran ist spätestens seit der Veröffentlichung seiner Tagebücher der Jahre 1912–1915 nicht zu deuteln, bei Schmitt zur weltanschaulichen Grundausstattung gehören. Sie hindern ihn aber nicht daran (und das ist eine zeitgenössisch weit verbreitete, um nicht zu sagen übliche Haltung), mit einzelnen Juden in nähere, auch genuin freundschaftliche Beziehung zu treten, was bei Schmitt vor allem für das Verhältnis zu seinem, man darf wohl sagen, besten Freund Fritz Eisler gilt.
Vereint sind die vier in ihrer Leidenschaft für Literatur und Kunst. Reihum schreiben sie an einem skurrilen Fortsetzungsroman über eine Figur namens Schnekke. Das Manuskript ist verschollen. Ein paar Bruchstücke haben sich in Schmitts Briefwechsel mit seiner Schwester Auguste („Üssi“) erhalten. Kostproben aus dem Gemeinschaftswerk sollen ihr, die mit knapp zwanzig im fernen Portugal eine Stelle als Hauslehrerin angetreten hat, das Heimweh vertreiben. „Von Zeit zu Zeit“, berichtet Schmitt Ende November 1911 nach Portugal, „trinke ich abends und nachts ein paar Gläser13 und schreibe dabei an unserem Schnekkeroman, der von mir zu Kluxen, Eisler und Rosenbaum zirkuliert und der täglich umfangreicher wird. Neulich hat Schnekke an seine Frau, die ihn um Nahrungsmittel bat, folgenden Brief geschrieben“:
Liebe Maria, unumwunden von der geziemenden Ehrfurcht erlaube ich mir die Beruhigung, daß das von mit dem Verhungern nicht in dieser Geschwindigkeit geht. Heutzutage ist das nicht so leicht. Wenn Du nichts zu Essen hast, lege Dir ruhig den Deutschen Staatsmännern zur Last. Verhungern dürfen die heutzutage keinen lassen, der naturalisierter beziehungsweise zivilisierter Bürgersmann respektive Frau ist, was Du doch zu sein nicht zu bezweifeln gewillt ist (sic!). Hochachtungsvoll Egon Maria Schnekke. (J 28.11.1911)
Zusammen mit seinem Freund Rosenbaum inszeniert Schmitt im Schnekke-Stil ein briefliches Duell um die Gunst der Schwester, er selbst in der Rolle des „Bullgaren“ Schnekkenichiphididas Lenö, Rosenbaum in der von dessen Rivalen Thomas: „heißgeehrtes fräulein! Was so die richtigen Bullgaren sind, als wie ich zum Beispiel, die lieben sage ich Ihnen mit Ffeuer! Und Schwerdt! [...] Ich knihe vor Sie hier zum Beispiel und weihe Ihnen meinen Dollch!“ Hüten soll die Heißgeehrte sich aber vor seinem „Erbfeind und Nebenbuhler“ Thomas. „Dem fallen die Haare aus dem Kopf. Ist also nichts vor Ihnen.“ „Alles nich wahr“, kontert dieser Thomas (Rosenbaum), „bin ich doch schön und klug“ und „in Deutschland promohwirt“. (J 28.11.1911)
[25]
Dass der Welt mit dem Schnekke-Manuskript Großes entgangen wäre, ist angesichts der Überbleibsel kaum zu befürchten. Aufschlussreich sind diese dennoch. Die Nonsens-Alberei lässt Realität durchscheinen. Etwa beim Thema Nahrungsknappheit. Nicht, dass Schmitt buchstäblich am Verhungern wäre – verhungern darf schließlich keiner mehr, siehe Schnekke –, doch chronischer Geldmangel ist das Leitmotiv der Briefe, verbunden mit Durchhalteappellen, die Schmitt genauso an sich selbst wie an die Schwester richtet: „Halt es aus, in 10 Jahren sind wir vielleicht schon reiche Leute.“ (J 12.10.1911) Wie knapp er bei Kasse ist, beklagt er, als er den ersehnten Besuch bei ihr in Portugal abblasen muss: „Ich kann mir weder die Kleider noch ein Billett für die Reise kaufen, habe keinen Koffer, nichts. Ich lebe von dem, was man mir pumpt, als Referendar verdiene ich nichts, ich habe Schulden und muß sie monatlich abbezahlen“. (J 12.11.1912) Als Hauslehrerin in Porto verdient Üssi mehr als ihr inzwischen promovierter Bruder. Sie unterstützt ihn, so gut sie kann, mal mit 40, mal mit 30 Mark, und er nimmt sich vor, sparen zu wollen: „Jeden Monat 15 Mark.“ (J 16.4.1912) Derweil kann sein Freund Kluxen es sich leisten, fünfzehntausend Mark für Bilder auszugeben, „ganz moderne“. (J 26.8.1912)14 Ein anderer Dankesbrief an Üssi (diesmal hat sie ihm 15 Mark geschickt) berichtet von Schmitts Einladung zu einer Hochzeit, bei der „für über 2.700 Mark französischer Sekt getrunken worden“ sei. (J 19.2.1912)
Schmitts Referendariat im preußischen Justizdienst, zuerst in Lobberich (bei Mönchengladbach), dann am Oberlandesgericht Düsseldorf, ist unvergütet. Er hat Glück, in dem Mönchengladbacher Fabrikanten Arthur Lamberts einen großzügigen Förderer zu finden, der mit einem Zuschuss dafür sorgt, dass seine Dissertation in Druck gehen kann.15 Schmitt übernimmt Arbeitsaufträge für die Kanzlei von Lamberts' Bruder, dem Justizrat Hugo Lamberts. Der freilich „ist so geizig, wenn er eine Brille aufhat, kuckt er über die Gläser, um das Glas nicht abzunutzen.“ (J 14.1.1913) „Ich [...] bin bei einem Anwalt“, klagt Schmitt, „der Prozesse hat, in denen es sich um 12 Millionen [26] handelt. Ich muß sie bearbeiten und bin froh, ein Zimmer für 70 Mark monatlich mit Pension zu haben.“ (J 9.10.1912)
Als er aufgrund seines zweiten Buches, Gesetz und Urteil, im Sommer 1912 von der juristischen Fakultät der Universität Straßburg eine Privatdozentur angeboten bekommt, kann er es sich nicht leisten, sie anzunehmen: „Dein Bruder könnte also, wenn er wollte, jetzt Privatdozent sein. Aber aus finanziellen Gründen (die Remuneration betrug nur 1000 Mark pro Jahr) mußte ich ablehnen. Schade, denn wenn ich jetzt ein reicher Junge wäre, wäre meine Situation geradezu sensationell.“ (J 20.6.1912)
Wenn er ein ‚reicher Junge‘ wäre, stünde auch seiner Verehelichung mit der angehenden Pianistin Helene Bernstein, der Tochter eines wohlhabenden jüdischen Arztes, nichts im Wege. Bernsteins „sind vornehme Leute. [...] Sie haben keine Ahnung, wie arm ich bin. [...] Was hat es aber für einen Zweck, daß ich mich gräme, arm zu sein.“ (J 31.3.1912) Schmitt scheint seinen Vorsatz beherzigt und sich wirklich nicht allzu sehr gegrämt zu haben, als Helenes Vater von seiner Mittellosigkeit erfährt und ihm nahelegt, von weiteren Besuchen im Hause Bernstein abzusehen.16
Wieder, wie schon in seinem Berliner Semester 1907, findet Schmitt sich in der Position des Außenseiters. Zwar steht er nicht mehr „ganz im Dunkel“, wird gelegentlich sogar eingeladen, an dem Schauspiel im „hellerleuchteten Raum“ (B 20) großbürgerlicher rheinischer Gastlichkeit teilzunehmen. Doch ein fester Platz darin bleibt ihm verwehrt. In Berlin war es die eigene „starke Repulsion“, die ihn auf Distanz hielt. Jetzt überwiegt die Frustration, trotz aller Anstrengung nicht dazuzugehören.
Gleichzeitig muss und will er alles daransetzen, in dieser abweisend-abstoßenden Welt wilhelminischer Bürgerlichkeit Fuß zu fassen. Den ‚kümmerlichen‘ Aussichten der Philologie entronnen, dennoch „[a]rm wie ein Landigel“, „ein sehr kleiner Lump, der sich durchbeißt“ (J 12.11.1912), bleibt ihm nur der Erfolgsweg einer juristischen Karriere, um selber ein Teil dieser Welt zu werden. Nach einem mit Referendariatskollegen verbrachten Abend reflektiert er im Tagebuch seine Lage: „Ich bin klüger und besser als sie. Aber in ihrer ungeheuerlichen Masse sind sie mir vielleicht ein unüberwindliches Hindernis. Ich muss sehen, fertig zu werden.“ (T I 20.11.1912)17
[27]
Zugleich plagt den Einzelkämpfer Schmitt im Konkurrenzgetümmel um den bürgerlichen Aufstieg die Furcht, zum Bourgeois zu verkommen. Von der Zerreißprobe dieses Zwiespalts zeugen die Tagebücher. Und immer wieder Geldnöte: Mehrfach wechselt er, um zu sparen, die Wohnung. Anfang 1913 ist er in einer „Kammer“ gelandet, „die von einem Bett, einem Kleiderschrank, einem Waschtisch, einem Öfchen und 3 Stühlen, so vollständig ausgefüllt wird, dass ein Mann von dem Umfange Herrn Piers18 auch nicht 3 Schritte im Zimmer tun könnte und auch meine turnerische Gewandtheit und Schlangenmenschlichkeit grosse Fortschritte gemacht hat.“ (J 14.1.1913)
Man fragt sich, wie er (nach erneutem Umzug) in nicht mehr ganz so beengten, aber doch ähnlichen Verhältnissen im Sommer 1912 wochenlang einen Menschen beherbergen konnte, von dem er schreibt, er sei „beinah 2 m groß, dick, hat einen langen Bart und ist immer heftig gestikulierend am Reden.“ (J 19.1.1912) Es ist Theodor Däubler, der hier – vorerst nur vom Hörensagen – beschrieben wird. „Auf diesen“, den er durch Eisler demnächst kennenlernen wird, „bin ich besonders gespannt.“ (ebd.) Aus erstem Kennenlernen wird bald eine Freundschaft. „Herr Däubler ist hier.“ meldet Schmitt der Schwester im Juli 1912. „Ein fabelhafter Kerl.“ (J 20.7.1912) Für ganze sechs Wochen nimmt der ambulante Dichter bei Schmitt Quartier. Zusammen mit dem Kunstmäzen Albert Kollmann unternimmt man eine Reise durchs Rheinland und das Elsass. Seltsame Weggefährten: der beinah zwei Meter große „ungepflegte Koloß“ (Ex 46) und der gewandte Jungjurist19 – mit seinen knapp 1,60 neben ihm fast ein Zwerg. „Däubler ist der freundlichste und herzlichste Mensch von der Welt.“ (J 26.8.1912) Aber eben nicht nur das. Er ist auch der bei weitem größte Dichter der Gegenwart. Doch das wird von den wenigsten anerkannt. Der Literaturbetrieb hat andere Favoriten.
Dieses Missverhältnis motiviert Schmitt zu literarischer Produktivität: Zusammen mit seinem Freund Eisler verfasst er das Bändchen Schattenrisse.20 Unter dem Pseudonym Johannes Negelinus, mox doctor, erscheint es 1913 im ebenfalls pseudonymen „Skiamacheten-Verlag“. In zwölf humoristischen Kurzporträts nimmt es Verirrungen des Zeitgeists an prominenten Vertretern desselben aufs Korn. Liest man den akademischen Titel „mox doctor“ des pseudonymen Negelinus als Datierungshinweis, dann müsste zumindest die Idee zu den Schattenrissen schon vor der Promotion der beiden Verfasser [28] und also auch – und sogar deutlich – vor der Begegnung mit Däubler entstanden sein. Lateinisch mox heißt ‚bald, demnächst‘; Schmitts Doktorexamen fand am 24. Juni 1910 statt.21 Erst im Oktober 1910 aber erschien Däublers Nordlicht erstmals im Druck, und erst 1912 kam es zur persönlichen Begegnung mit dem Dichter. Nach Schmitts eigenem Bekunden gab diese den entscheidenden Anstoß zu den Schattenrissen: „Antrieb“, schreibt er rückblickend, „war die Wut über die stupide Uninteressiertheit, mit der das damalige literarische Deutschland auf ein Werk wie Däublers Nordlicht reagierte.“ (MB 22.12.1948) Sollten also bereits die angehenden Doktoren Schmitt und Eisler sich mit der Idee einer Literatensatire getragen haben, so ist es zu deren Ausarbeitung mit ziemlicher Sicherheit doch erst 1912/13 gekommen.
III. Schattenrisse: gelehrte Versteckspiele
Der Titel Schattenrisse spielt auf die vier Jahre zuvor erschienenen Schattenbilder von Herbert Eulenberg an,22 der in den Schattenrissen selber zum „Umrissenen“, das heißt zum Gegenstand der Persiflage wird. Die Schattenbilder waren Eulenbergs bei weitem erfolgreichste schriftstellerische Hervorbringung. Ein Dauerbrenner, der schon 1911 in die achte Auflage ging und 1929 die neunzigste erreichte. Eulenberg selbst betrachtete sie eher als Nebenprodukt seines bedeutenderen dramatischen und erzählerischen Schaffens. Gleichwohl verfolgte er mit ihnen ein ernsthaftes volksbildnerisches Anliegen: den weniger Gebildeten die Größen der deutschen Geistesgeschichte in kurzen Porträts nahezubringen. Eine Fibel für Kulturbedürftige in Deutschland, so der Untertitel, sollten die Schattenbilder sein: „Mal sind es anekdotenhafte Schilderungen, mal erfundene Gespräche oder Begegnungen; mal [29] wählt er drei Tage exemplarisch aus, um das gesamte Leben zu zeichnen, mal gibt er einen kompletten Überblick.“23 Diese Variationsbreite ahmen die Verfasser der Schattenrisse persiflierend nach. Desgleichen die volksbildnerische Mission. Refrain der Sammlung und ihr ‚Running Gag‘ ist der Satz „Die „Schattenrisse“ müssen Gemeingut aller Gebildeten werden“, der in abgewandelter Form in jedem der zwölf Porträts vorkommt.24
Einen „für 1913 symptomatischen Ulk“ hat Schmitt die Schattenrisse später genannt: „Das meiste ist heute unverständlich, einiges wirkt noch, wenn man sich mit einigen Flaschen guten Weines in die für Anspielungen nötige Aufgelockertheit hineinversetzt hat. Das ganze ist Bierzeitung und Dadaismus avant la lettre.“25 Vor allem sind die Schattenrisse aber auch ein Gelehrtenspaß, der mit den Diskursgepflogenheiten der Wissenschaft sein Spiel treibt. Die zwölf Porträts sind mit einem Apparat von pseudowissenschaftlichen Beitexten ummantelt, der fast zwei Drittel des Bändchens füllt. Es gibt nicht nur ein mit arabischen und lateinischen Ziffern durchnummeriertes Inhaltsverzeichnis und eine „Systematische Tabelle“, die die Porträtierten typologisch in Kategorien von A. bis E. unterteilt. Es gibt auch ein Vorwort, ein Nachwort, ein Schlusswort sowie einen Anhang, bestehend aus „Anmerkungen für Ungebildete“, „Reimregeln für ganz Ungebildete“ (in Knittelversen) sowie „Satzungen der Schattenrißakademie“ und einem Preisausschreiben zur Frage „Welchen Schatten halten Sie für den gerissensten?“ Für die am besten begründete Antwort wird „die Hälfte derjenigen Summe“ versprochen, „die dem Verfasser der ‚Schattenrisse‘ als Preis für das vorliegende Werk zufallen wird.“26
Der Gelehrtenspaß beginnt schon mit dem lateinischen Verfasserpseudonym Johannes Negelinus. Es verquickt den Vornamen des Humanisten Johannes Reuchlin (1455–1522) mit dem Nachnamen eines gewissen Magister Petrus Negelinus. Der ist einer der fiktiven Briefschreiber, die in den Dunkelmännerbriefen[30] (Epistulae virorum obscurorum, 1515) borniert und in schlechtem Latein ihre eigene Unzulänglichkeit demonstrieren. Dasselbe satirische Verfahren verwenden auch die Schattenrisse. Die in ihnen Porträtierten desavouieren sich selbst, teils durch das, was sie sagen oder zu Papier bringen, teils dadurch, dass ihre Ansichten, Allüren und Stilmanierismen in komischer Überzeichnung parodiert werden.
Aus der Masse frühneuzeitlicher Polemiken ragen die Dunkelmännerbriefe als satirisches Meisterstück heraus. Sie bilden den literarischen Höhepunkt des ab 1510 mit äußerster Erbitterung geführten ‚Judenschriftenstreits‘. Ausgelöst wurde dieser von dem zum Christentum konvertierten Juden Johannes Pfefferkorn (1469–1522/23), der mit Unterstützung der Kölner Dominikaner die Beschlagnahme und Vernichtung aller jüdischen Religionsschriften forderte. Tatsächlich erwirkte Pfefferkorn für dieses Vorhaben ein kaiserliches Mandat, das aber bald schon wieder zurückgezogen wurde. Stattdessen wurden drei Gutachter beauftragt, den Fall zu prüfen. Nur einer von ihnen, der schwäbische Humanist Johannes Reuchlin, plädierte für den Erhalt der jüdischen Schriften, was ihm wütende Schmähungen und fast einen Häresieprozess einbrachte. Für Reuchlin ergriffen namhafte Humanisten wie Ulrich von Hutten und Philipp Melanchthon Partei. Ihre Schreiben gab Reuchlin 1514 unter dem Titel Clarorum virorum epistolae heraus (Briefe der hellen, der leuchtenden Männer). Auf der Folie dieser Episteln sind „die im folgenden Jahr publizierten ‚Epistolae obscurorum virorum‘ zu lesen […]. Die Briefe der ‚dunklen Männer‘ sind an ihren verehrten Meister Ortuin Gratius [den einflussreichen Förderer Pfefferkorns]27 adressiert, wie die der ‚hellen‘ (geistreichen, berühmten) Männer an Johannes Reuchlin. Mit dem Unterschied allerdings, dass die Dunkelmännerbriefe […] fingiert sind, um Pfefferkorn, die Kölner Geistlichen, den ganzen Klerus und überhaupt die scholastische Theologie lächerlich zu machen.“28
Sich am Vorbild der Dunkelmännerbriefe zu messen, zeugt von gesundem Selbstvertrauen. Desgleichen von polemischer Absicht, die der Verlagsname, das griechische Kunstwort Skiamacheten, unterstreicht. Es bedeutet Schattenkämpfer (zusammengesetzt aus skia – Schatten und machétes – Kämpfer), also Kämpfer gegen oder auch im Schatten. Auch hierin folgt ‚Johannes Negelinus‘ seinem humanistischen Ahnherrn: Aus dem Schatten der Anonymität bekämpfte dieser die Schatten der unerleuchteten Scholastiker. Ein [31] Schattenkämpfer ist aber auch, wer sich im Schattenfechten oder Schattenboxen betätigt, also einen Kampf mit dem eigenen Schatten oder mit seinem Spiegelbild führt. Selbstbespiegelung begegnet in den Schattenrissen ständig.29 Die Verfasser betreiben sie mit spürbarem Gusto. Es beginnt schon mit ihrem Pseudonym. Aus zwei Namen zusammengesetzt, kann es als Hinweis auf doppelte Autorschaft gelesen werden. Mit dem hinter der Maske des fiktiven Negelinus hervorblinzelnden realen Johannes (Reuchlin) kehrt das Pseudonym vor allem aber seine eigene Maskenhaftigkeit heraus. Lange galt Johannes Reuchlin als der (oder einer der) Verfasser der Dunkelmännerbriefe. Erst 1904 war dies schlüssig widerlegt und der Leiter der Benediktinerschule in Fulda, Crotus Rubeanus (mit deutschem Namen Johannes Jäger), als Hauptautor ermittelt worden.30 Ob Schmitt und Eisler davon wussten, ist unerheblich: Denn ob nun der eine oder der andere Real-Johannes hinter der Negelinus-Maske hervorlugt – in jedem Fall ist mit ‚Negelinus‘ ein Pseudonym gewählt, das ein anderes Pseudonym zitiert: ein Fall von mise en abime. Im ursprünglich heraldischen Sinn ein Wappen, das sich innerhalb eines Wappens identisch wiederholt: so wie die lachende Kuh, La vache qui rit, auf der französischen Käseschachtel, die als Ohrringe Käseschachteln der Marke La vache qui rit trägt, so dass die Wiederholung ihres immer winzigeren Bildes sich als prinzipiell grenzenlose Bilderflucht im Abgrund des Unendlichen verliert.
Um einen solchen unendlichen Regress handelt es sich bei dem Verfasserpseudonym der Schattenrisse nicht, vielmehr nur um eine einfache Spiegelung:31 ein erstes Signal, dem jedoch Steigerungen folgen. Ihren Höhepunkt erreichen diese im Schlusswort. So wie die in den Schattenrissen[32] Porträtierten durch ihre Porträtierung zum „Gemeingut aller Gebildeten“ werden oder schon geworden sind, streben die Verfasser der Schattenrisse dies auch für sich selbst an:
Auch unser höchstes Ziel ist es, unsere Schattenrisse dermaleinst zum Gegenstand von Schattenrissen und so umso sicherer zum Gemeingut aller Gebildeten gemacht zu sehen, wie die hier umrissenen Herrschaften durch die vorliegenden Schattenrisse Gemeingut aller Gebildeten geworden sind. Der Schattenriß aber, der unsere Schattenrisse umreißt, darf schon deshalb – eben weil er sie umreißt – sicher darauf rechnen, dermaleinst seinerseits wieder Gegenstand eines Schattenrisses zu werden und in dem Maße, wie die Zahl der in den letzten Schattenrissen enthaltenen Schattenrisse steigt, wird ihr Wert und damit die Gewißheit wachsen, daß sie alle auch ihrerseits Gegenstand immer neuer Schattenrisse werden. (S 55)
Als sei dies der Pirouetten noch nicht genug, lässt der „Anhang für Ungebildete“ weitere Drehungen folgen. Jedes neue Werk, „jeder neue Gedankensplitter“ erhöhe „das Maß der Forderungen, die – um zu den Gebildeten gezählt zu werden – zu erfüllen sind“. Also „werden Verfasser und Setzer der Schattenrisse im Augenblick ihres Erscheinens die einzig gebildeten, alle übrigen Menschen aber Ungebildete sein.“ (S 57) Der Nutzen der Schattenrisse bestehe insbesondere aber auch darin, dass sie „einen Ersatz bieten für vieles Voraufgegangene, so daß nach ihrer Lektüre nicht nur die bis dahin Gebildeten, sondern [...] gerade die bis dahin Ungebildeten wieder zu den Gebildeten zu zählen sind.“ Ebendieser letzteren Lesergruppe sollen die Anmerkungen (für Ungebildete) nütze sein, deren erste das Spiel der Selbstreflexion auf den lateinischen Fachbegriff bringt – der für Ungebildete freilich unverständlich bleiben muss:
Die Vorrede steht am Anfang des Werkes, stünde sie am Schlusse, so wäre sie ein Schlußwort. Der Verfasser konnte die Vorrede umso eher an den Beginn stellen, als er auch ein Schlußwort geschrieben hat. Dieses geht den „Anmerkungen“ unmittelbar voraus. Es enthält einen regressus in infinitum und kann den Ungebildeten leider nicht erläutert werden. (S 58)
Der infinite Regress der Selbstbespiegelung erreichte im Zeitalter des Manierismus und des Barock einen Höhepunkt. Eine Kunst, die sich auf ihre eigene Künstlichkeit zurückgeworfen sah und diese zugleich mit höchster Meisterschaft ausstellte, wurde zur Signatur der epochentypischen Vanitas-Thematik. Zu deren Motivinventar zählen neben dem Totenschädel auch Spiegelbild, Echo und Schatten. Das Fin de Siècle erkannte hier eine Affinität zu eigenen Vergeblichkeitserfahrungen.32 Dem „histrionenhaften“ Mummenschanz[33] des Wilhelminismus, dem Hang zu der, wie Schmitt es nennt, „historischen Oper“ (B 18), zu einer Geistigkeit, deren einziger Raum der „Bühnenraum“ (ebd.) ist, steht ein Krisenbewusstsein gegenüber, das in der Opulenz der Inszenierungen nur mehr die Erschöpfung aller sprachlich-literarischen wie generell ästhetischen Möglichkeiten erblickt. Ein Manifest dieser Ausdruckskrise ist Hugo von Hofmannsthals sogenannter „Chandos-Brief“ (1902). In ihm beklagt ein erfundener Poet der Shakespeare-Zeit, Lord Chandos, seinem Freund Francis Bacon, dass die Sprache, über die er sonst mit virtuoser Leichtigkeit verfügte, ihm nun „im Munde wie modrige Pilze“ zerfalle. „Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile, und nichts mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen. Die einzelnen Worte schwammen um mich; [...] Wirbel sind sie, in die hinabzusehen mich schwindelt, die sich unaufhaltsam drehen und durch die hindurch man ins Leere kommt.“33
Den „Ulk“ zweier Jungjuristen solch hehrer Klage benachbaren zu wollen, mag etwas hochgegriffen sein. Doch ein Weg, den das Fin de Siècle für sich entdeckt, um dem Leerlauf der Wiederholungen ein Schnippchen zu schlagen, ist Parodie. In einer Zeit, der kein eigener Stil, dafür aber die gesamte Menschheitsgeschichte als Fundus wählbarer Kostümierungen zu Gebote steht (Neo-Gotik, Neo-Barock, der Idealdeutsche als Rembrandt-Wiedergänger)34, ist sie, die Parodie, vielleicht ein erster Schritt aus der Sackgasse des Historismus. Dies hat Nietzsche im Blick, als er 1886 feststellt:
[W]ir sind das erste studirte Zeitalter in puncto der „Kostüme“, ich meine der Moralen, Glaubensartikel, Kunstgeschmäcker und Religionen, vorbereitet, wie noch keine Zeit es war, zum Karneval grossen Stils, zum geistigsten Fasching-Gelächter und Übermuth, zur transscendentalen Höhe des höchsten Blödsinns und der aristophanischen Welt-Verspottung. Vielleicht, dass wir hier gerade das Reich unsrer Erfindung noch entdecken, jenes Reich, wo auch wir noch original sein können, etwa als Parodisten der Weltgeschichte und Hanswürste Gottes – […].35
Vielleicht nicht der allerhöchste, aber doch ein höherer Blödsinn darf den Verfassern der Schattenrisse bescheinigt werden. Ihr „Fasching-Gelächter“ kühlt seinen Übermut an denen, die sich selbst für Herolde der Zukunft hielten: [34] an jenen „Aestheten und Literaten, deren ganzer Stolz es war, modern zu sein“. (Ex 46) Hier wirft die Vanitas-Topik ihren Schatten. Eitel sind zum einen die ‚Umrissenen‘ in ihrem anmaßenden Geltungsdrang. Eitel, nichtig – im Sinne des Predigers Salomo (Pred 1,2) – ist zum andern auch ihr Streben und Tun. Die beiden Eitelkeiten bedingen und eskalieren einander gegenseitig. Je nichtiger die Werke, desto größer die Selbstüberschätzung.
„Der Schatten ist lebendig.“ lautet das auf der Titelseite der Schattenrisse klein gedruckte Motto – auch dies ein Spiel mit Verdopplung und Spiegeleffekt. Es zitiert einen Text, der wie die Schattenrisse ein Gelehrtenspaß ist und dessen Verfasser sich wie die Verfasser der Schattenrisse hinter einem Pseudonym verbirgt: „Dr. Mises“. Unter seinem richtigen Namen hat Gustav Theodor Fechner (1801–1887) als Mediziner, Naturwissenschaftler und Philosoph Bedeutendes veröffentlicht – unter anderem eine zweibändige Vorschule der Ästhetik – und ein bis heute etabliertes Teilgebiet der experimentellen Psychologie begründet, die Psychophysik. Dr. Mises nannte er sich, wenn er eine ‚vergleichenden Anatomie der Engel‘ verfasste (sie sind kugelförmig) oder der Frage nachging, woraus der Mond besteht (aus grünem Käse). Oder eben, wenn er die These vertrat, dass der Schatten so lebendig sei wie der Mensch, den er begleitet: „Also kann mein Schatten mich ebenso für seinen Schatten, als ich ihn für meinen Schatten halten.“ Dabei behalte jeder Schatten, trotz aller Veränderlichkeit, „seine besondere Charaktereigentümlichkeit.“ Und darum benutze man „die Schattenrisse, den Charakter der Menschen festzuhalten.“36
IV. Die Umrissenen
Das Inhaltsverzeichnis der Schattenrisse nennt zwölf Porträtierte. Mit der systematischen Tabelle (die Pipin den Kleinen, die Nummer 7, stillschweigend auslässt) kommt ungenannt ein Dreizehnter ins Spiel: der Kulturhistoriker Arthur Moeller van den Bruck (1876–1925). Sein Monumentalwerk DieDeutschen, Untertitel: Unsere Menschengeschichte, erstreckt sich auf acht Bände: Verirrte Deutsche, Führende Deutsche, Verschwärmte Deutsche, EntscheidendeDeutsche, Gestaltende Deutsche und, als vorerst krönender Zwischenschluss: Goethe. Dieser, als „Der Universale“, umfasst alle zuvor einzeln personifizierten Charakteristika deutschen Wesens. In der Abfolge der Kapitel ist er „Der Verirrte – Der Führende – Der Verschwärmte – Der Entscheidende – Der Gestaltende“. Ein Musterbeispiel des Goethe-Kultes jener Jahre.37
[35]
Abb. 1: Schattenrisse: Inhaltsverzeichnis
Abb. 2: Schattenrisse: Systematische Tabelle
[36]
Moellers Typologie verbindet das nur allzu Offensichtliche mit dem Willkürlichen bis Skurrilen. Verirrt – ganz klar: der Sturm-und-Drang-Dichter Lenz, doch wieso Georg Büchner? Führend: Luther, der Große Kurfürst, Bismarck, aber auch Schiller und Nietzsche. Entscheidend (wieso aber nicht führend?): Friedrich der Große und Moltke, daneben Winckelmann, Lessing, Herder, Kant und Fichte. Nicht aber Karl der Große und Heinrich der Löwe, denn die werden unter den „Gestaltenden Deutschen“ geführt, ebenso wie Mozart, Beethoven und Wagner, Gerhart Hauptmann, Richard Dehmel und – Theodor Däubler. Die ‚Systematik‘ der Schattenrisse führt das Prinzip ihrer Vorlage parodistisch ad absurdum. Sie paart offensichtlich Unsinniges mit hintersinnig (oder auch hinterhältig) Treffendem: Richard Dehmel ist 1913 keineswegs tot, seine ekstatisch lebensbejahende Dichtung aber vielleicht schon. Wenn es in den „Reimregeln“ am Ende des Bandes heißt: „Repräsentant der Eleganz / Ist Anatole, der welsche France“, warum wird dieser dann unter den „Liebenden Deutschen“ tabelliert und nicht als „Nicht-Deutscher“? Und warum erscheint stattdessen Walther Rathenau in dieser unzutreffenden Rubrik? Raffael Gross erkennt hierin einen Beleg für Schmitts Antisemitismus. 38 Wieso wird dann aber nicht auch der Jude Fritz Mauthner als nichtdeutsch geführt? Und wie wahrscheinlich ist die antijüdische Spitze angesichts der Koautorschaft des Juden Fritz Eisler? Dieser war als ungarischer Staatsbürger tatsächlich ‚Nicht-Deutscher‘, aber just im Entstehungszeitraum der Schattenrisse darum bemüht, die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben.39
Am schlüssigsten lässt sich der „Nicht-Deutsche“ Rathenau aber wohl aus dessen eigener Schrift „Höre Israel!“ (1897) ableiten. Denn dieser Appell an die in Deutschland lebenden Juden, durch „Selbsterziehung“ zu einer „Anartung“ an die „Stammesdeutschen“ zu gelangen und sich damit aus ihrem (laut Rathenau großenteils selbstverschuldeten) Ghettostatus zu befreien, unterstellt den Juden, nach wie vor „Fremde und Halbbürger im Lande zu sein“ – also Nicht-Deutsche – und rät ihnen: „Schreiet nicht nach Staat und [37] Regierung. Der Staat hat euch zu Bürgern gemacht, um euch zu Deutschen zu erziehen. Ihr seid Fremde geblieben und verlangt, er solle nun die volle Gleichberechtigung aussprechen?“40
Es ist versucht worden, Fritz Eisler eindeutig als Verfasser des Rathenau-Porträts zu identifizieren,41 doch dafür fehlt der Beleg. Überhaupt erweist es sich als ziemlich aussichtslos, die einzelnen Porträts jeweils einem der beiden Autoren zuzuordnen. Schmitt selbst habe, so sein Nachlassverwalter Ernst Hüsmert, „auf Fragen, welche Beiträge in den ‚Schattenrissen‘ wem zuzuordnen sind, stets geantwortet, daß es für jeden Gebildeten ein Kinderspiel sei, zu unterscheiden, was jüdischer und was christlicher Intellekt hervorgebracht hat.“42 Schon wegen des Anklangs an den Spottrefrain der Schattenrisse („für jeden Gebildeten“) darf man dies getrost als Eulenspiegelei nehmen.43





























