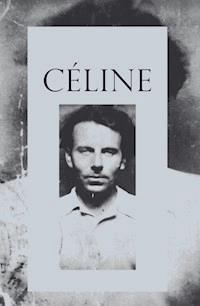
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Philippe Muray, in Deutschland noch völlig unbekannt, in Frankreich in den letzten Jahren zu einem Kultautor von Jahrhundertformat avanciert, hat in diesem brillanten literarischen Langessay einen so umstrittenen wie gewichtigen Beitrag zu Leben und Werk des infernalischen Louis-Ferdinand Céline geschrieben. Es ist für deutsche Leser die erste umfassende Auseinandersetzung mit dem Phänomen Céline, der wie kein anderer Widerstände provoziert und Fragen nach dem Bösen in der Literatur, den Grenzen der Kunst und ihrer Moralität aufwirft. Diesen unlösbaren Fragen geht Muray in seinem eleganten, klugen und pointierten Essay auf den Grund und erweist sich selbst als einzigartiger Autor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 394
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
[Cover]
Titel
Impressum
I
Der Mann, der spricht
II
Die Raserei des Verfolgens
III
Die Ameise und die Eisenspäne
IV
Die Offenbarungsreligion
V
Göttlich, allzu göttlich
VI
Reine-Nerven-Metro-auf-verzauberten-Gleisen-mit-drei-Punkte-Schwellen
VII
Wie lässt sich die Moderne überleben?
Anhang
Anmerkungen
Anmerkung zum Fußnotenteil
Literatur
Louis-Ferdinand Céline in seinen deutschen Übersetzungen
»Wir leben in Übersetzung« Ein Nachwort
Anmerkungen zum Nachwort
Dank
Philippe Muray
Céline
Aus dem Französischen und mit einem Nachwort von Nicola Denis
Die vorliegende Übersetzung wurde mit einem Stipendium des Deutschen Übersetzerfonds e.V. gefördert. Mit freundlicher Unterstützung des Centre national du livre.
Erste Auflage Berlin 2012 Copyright © 2012 Matthes & Seitz Berlin MSB Matthes & Seitz Berlin Verlagsgesellschaft mbH Göhrener Straße 7, 10437 Berlin. [email protected] Copyright © der französischen Ausgabe Céline, Gallimard, Paris 2001 Die erste Auflage von Céline erschien 1981 bei Éditions du Seuil, Paris Alle Rechte vorbehalten E-Book-Konvertierung: Fotosatz Amann, Aichstetten ISBN 978-3-88221-019-4www.matthes-seitz-berlin.de
I
Der Mann, der spricht
Die Träume der literarischen Moderne sind voller Gefangener: Sade in der Bastille und in Charenton, Ezra Pound erst im Pisaner Käfig, dann im St-Elizabeth’s-Krankenhaus in Washington, Antonin Artaud in Rodez, Jean Genet in Fresnes, Solschenizyn im Gulag, Robert Desnos in Buchenwald und in Auschwitz, Dostojewski in Sibirien; Kafka, in Prag festgehalten von seinem »Mütterchen mit Krallen«,1 Proust hinter korkverkleideten Wänden, die Kolonne der in Lateinamerika oder Osteuropa Verfolgten und schließlich Céline, zuerst im dänischen Eis, dann zurückgezogen in Meudon.
Nur ganz wenige sind diesem Gefangensein entkommen, das unsere Epoche Sprache und Delinquenz gleichsetzen, das Schreiben einsperren und das Wort mit dem dreifachen Fluch von Zuchthaus, Psychiatrie und tödlicher Einsamkeit strafen lässt.
Im Laufe des 20. Jahrhunderts offenbarte sich so die neue Welt, in der wir leben müssen und zu deren einziger Historikerin sich die Literatur aufgeschwungen hat, eine Welt aus Gittern und Fron unter dem wachsamen Auge von Satelliten, Radarschirmen und Raketen, eine Welt aus Züchtigungen und Knochenbergen, in der die Politik sich künftig nur noch nach dem Rhythmus der Flüchtlingsströme, sich kreuzender Schiffe und Züge mit Deportierten sowie immer spektakulärerer Schlachthäuser richtet – ein über die Menschen hinwegtönendes Echo des tödlichen Genusses ihrer Herren.
Jene in ihren Niederungen Eingemauerten, jene Überwachten, Verabscheuten, Verstoßenen, waren die Historiker einer Geschichte, die keine mehr ist, und wahrscheinlich haben aus eben diesem Grund ihre Werke nicht viel mit den friedlichen Überlegungen der historischen oder archäologischen Zunft gemein. Zum Thema des von Verstrahlung bedrohten Nuklearzeitalters, das den zu Atomwaffenlagern mutierten Nationen ausgeliefert ist, war wohl am Ende einzig von ihnen ein letzter Aufschrei zu vernehmen. Sie taten es in der Sprache der leicht spaltbaren Masse, die für diejenigen inakzeptabel klingt, die sich an die Wunschvorstellung einer auf immer und ewig von Theologie, Moral, Metaphysik, Philosophie, Politik und Psychoanalyse überdeterminierten Literatur klammern und die angesichts dieser aufflackernden Sprache, dieses tragischen Aufbäumens des entfesselten Tiers im Menschen, unversehens mit ihrem Latein am Ende sind.
In diese Reihe der Gefangenen und Verbannten fügt Céline sich jedoch nicht ohne Weiteres ein: Obgleich sein Genie einerseits von der Gemeinschaft (communauté) fast einhellig und beunruhigend vorschnell anerkannt wird, darf man andererseits die eigentlichen Beweggründe für seine Abstrafung, die Gründe für seine nachdrückliche Verfemung gar nicht erst hinterfragen. Sade, Dostojewski, Artaud, Solschenizyn waren durchaus auf ihre Art »Selbstmörder von der Hand der Gesellschaft«, auf deren tragisches Schicksal wir uns berufen können, um uns mit einer rückblickenden sozialen Jungfräulichkeit zu schmücken. Ihnen haben wir es zu verdanken, dass wir, selbst weder ins Zuchthaus noch als irre weggesperrt, zuweilen unsere schöne Seele zur Schau tragen können. Angesichts ihres Martyriums empfinden wir eine tiefe kollektive Erleichterung: Wir werden weder als Wärter noch als Henker gelten. Anders gesagt sind wir ganz dicht an dem Verbrechen, das gegen sie begangen wird und das wir gleichzeitig abstreiten. Nur Céline bleibt auf überwältigende Weise schuldig. Seine Schuld appelliert offenbar nicht an die Tiefen unseres Unterbewusstseins, um dort den automatischen Sympathiereflex auszulösen, mit dem wir sonst so gnädig über Verstorbene denken. Was also steckt hinter unserer Billigung des Gesetzes, das ihn verurteilt? Was bedeutet die ungebrochene Begeisterung für seinen »revolutionären« Stil sowie für das Verbot, mit dem das finstere Hauptkapitel seines Lebens belegt ist? Wie kommt es, dass wir in seinem Antisemitismus nur ein kurzes Intermezzo sehen möchten, das uns freistellt, seine »vorher« und »nachher« entstandenen Werke ebenso unbefleckt wie unschuldig zu lesen? Welche Leidenschaft erweckt in uns den Wunsch, es möge zwei Célines geben, einen tadellosen, sauberen Céline, eine für die euphorischen Paraden der Avantgarde eigens wieder aufpolierte Marionette, und einen düsteren, kontaminierten Céline, der endgültig in die Kloaken der Geschichte versenkt wird? Spricht ein gemeinsames Anliegen, der gesunde Menschenverstand, ein unbezwingbares kollektives Interesse dafür, Céline zu spalten? Welchem Konformismus wollen wir denn diese Hälfte servieren, den halbierten, in Einzelportionen tranchierten Céline? Und schließlich darf man sich fragen, welcher Nacht- und Schattenseite in uns selbst wir den (gerecht unter den Erben verteilten) unwirtlichen Teil seines Werks zum heimlichen Fraß vorsetzen wollen.
Schon mit seinen ersten Büchern gewann er unzählige Menschen für sich, die bereit waren, ihm zu helfen und den rechten Weg zu weisen. Dem von der Familie gefeierten Wunderkind streckten sich sämtliche Arme entgegen, um es zu seinen ersten Schritten zu ermutigen. Da sich indes ziemlich schnell alles zum Schlechten wendete, waren die Sanktionen entsprechend hart. Das verantwortungslose »enfant terrible« wurde in den Karzer gesperrt, sein Werk wurde lobotomisiert, man durchtrennte also die Fasern, die seine verschiedenen Bücher zusammenhielten, um einen Teil davon in die äußere Finsternis zu werfen. Verrät diese Doppeloperation, die darin besteht, seine zeitlichen Sünden zu beklagen und seinen enormen poetischen Beitrag zu würdigen, im Grunde nicht den doppelten Wunsch, weder von seiner künstlerischen Revolution noch von seinem Antisemitismus etwas wissen und so ihre Verbindungen ignorieren zu wollen, kurzum, seine eigenen Mystifizierungen zu wiederholen, ihm damit deutlich unterlegen zu bleiben und einen Sicherheitsabstand zu seinem blitzartigen Ausbruch zu gewinnen?
Ihn als Ganzes zu erfassen, als eine sowohl dem Ganzen als auch der Einheit und der Teilung entkommende Vielheit, würde uns vielleicht helfen, endlich die obligatorischen Banalitäten hinsichtlich seiner Widersprüche ad acta zu legen. Doch er bleibt ein Gefangener, ein toter Überlebender im Souterrain der Geschichte, eine außergeschichtliche Leiche in unserer gegenwärtigen Un-Geschichte. Von seinem Platz aus, zurückgezogen, in seinem abgelegenen Verlies, seinem Schlossverschluss, aus der Tiefe seiner auf Bewährung ausgesetzten Identität und seines ödemisierten Körpers hat er alles Wissenswerte über die Gefängnisse seines Lebens gesagt: »’ne Festung, die Zeit aufzuheben! … allmählicher Selbstmord! …«2 Er hat seinen Zeitgenossen gegenüber verkündet, für das Recht, das Jahrhundert aus seinem Mund sprechen zu lassen, habe er vorab bezahlt: »Es bedarf eines gewissen Ernstes, um einen Untersuchungsrichter, einen französischen oder deutschen, dazu zu veranlassen … darum, Sie verstehen, nicht wahr, all diese Leute von rechts, links oder Mitte, solange sie noch nicht eingesperrt sind, und selbst dann!!! … müssen als halb übergeschnappt, halb besoldet gelten … über das Publikum werde ich später sprechen.«3 Célines Werk ist weder übergeschnappt noch besoldet, es ist das eines Todes- und Totenarztes, genau das also, was seine Zeit verdiente. Aber wer will das schon wissen? Noch immer bleibt die Frage offen, wie er zwei sein konnte. Dabei hat er mit seiner Erfahrung vielleicht nur die Sprache in seinem aufgelösten Körper vervielfältigt, um letztlich sehr genau die vom Tod eingeforderte Summe der narrativen Sequenzen aufzustellen, diese Summe aus Literatur, über die er zu Beginn von Tod auf Kredit schreibt, dass sie das von Text durchwirkte, mit Text übersäte Leichentuch bildet, mit dem er auf die andere Seite gelangte, in den Tartarus oder Styx, in Plutons Reich, in den Scheol, in sämtliche Jenseitsregionen der Welt: »Das Krepieren ist nicht umsonst. Man muss dem Herrn ein schönes, mit Geschichten besticktes Schweißtuch überreichen.«4 Man wird sehen, wie seine Bücher eines nach dem anderen diese unendliche Reise an die Grenzen des Jahrhunderts mit all ihren Unterbrechungen und Umwegen bewältigen. Seine ungewisse und erbitterte Arbeit sollte darin bestehen, seiner Zeit über die Grenzen der Zeit hinwegzuhelfen, den Realitäten seiner Zeit im Boot ihrer eigenen Äußerungen das Ruder ihrer Grenzen in die Hand zu drücken. Indem er die überlebte Stimme seiner Zeit zu Gehör bringt, überlebt er sich selbst.
Doch bedeutet diese Durchdringung von Tod und Auferstehung, zu der einige wenige Schriftsteller in den Tiefen ihrer Zelle und zu ihren ungewissen »Lebzeiten« fähig sind, dass sie zwangsläufig den Rest ihres Lebens, jene aneinandergereihten albtraumhaften Bruchstücke des Alltags hellsichtig wahrnehmen? Natürlich hat auch Céline in Bezug auf sein eigenes Verhängnis nicht alles durchschaut, was seine Schuld freilich nicht mindert. Wie alle Welt muss auch er irgendwann zu dem Schluss gekommen sein, dass in ihm zwei »Menschen« koexistierten: Einer ließ sich zum versteckten Mord hinreißen, während der andere die Grenzenlosigkeit des Schreibens entfesselte. Kurz gesagt, ein archaischer Übeltäter und ein progressiver Befreier. Er war also dazu gezwungen, sich selbst zu beschränken, um seinen eigenen kriminellen Wahn zu überleben. Mithin hat er der Gemeinschaft das Ignorieren seiner Erfahrung erleichtert und ist zusammen mit ihr auf dem durch die rassistischen Bauchgefühle aufgeblähten Kopfkissen der Gesellschaft wieder eingenickt. Die gemeinschaftliche Lüge ist noch so intakt, dass Céline allgemein verrufen und teilweise verboten bleibt, obwohl er gleich zwei Mal in das kollektive Horn gestoßen hatte: vor dem Krieg, als er zur Verfolgung aufrief, und nach dem Krieg, als er sich wiederholt zu seinem »Faux-pas« bekannte. Verständlicherweise brachte ihn das selbst einigermaßen durcheinander.
Letztlich waren seine Zeitgenossen zu zeitgenössisch, um sein schreckliches Geheimnis zu ergründen. Daher dieser beispiellose Verneinungsmechanismus, der ihn bis ans Ende seines Lebens begleiten sollte und noch heute munter fortwirkt. Wirft man einen Blick auf die Kommentare und Kritiken vom Erscheinen der Reise ans Ende der Nacht (1932) bis zu seinem Tod (1961), dann stößt man auf eine ganze Palette von eigennützigen Missverständnissen, eifersüchtigen Kleinlichkeiten, katastrophalen Elogen, plumpen Schnitzern, beschränkten Erklärungen und verworrenen Vereinnahmungen. Daran lässt sich ablesen, wie geschwätzig, unbedarft und ignorant der Boden war, auf dem sich sein Werk entwickelte. Ich will mich hier auf drei exemplarische Einwände beschränken.
Zunächst stellt sich die berühmte Frage der Sprache, der »Céline’schen« Sprache, jenem ausführlichen musikalischen Aufstoßen, mit dem er angeblich so wirkungsvoll das kollektive Rumoren zum Sprechen brachte, diesem Stil, der sich unmittelbar aus den Emotionen von Bistro, Bett, Tisch, Revolte, Vergnügen, kurz, aus dem volkstümlichen Gegurgel speist. Alle haben sich begeistert damit beschäftigt, weshalb man sich fragen darf, was sie so dringend überspielen oder ausblenden wollten, indem sie Hals über Kopf in die riesige Grube sprangen, die Céline da für sie gegraben hatte (»Ich habe so geschrieben, wie ich spreche«, sagt er in seinem allerersten Interview). In seine Nachfolge stürzten sich wild durcheinander Nizan, Léon Daudet, Deleuze, Trotzki, Kerouac, Pound, Drieu La Rochelle und andere. »Eine gesprochene, muskulöse, kecke und nackte Syntax wie ein Mädchen des großen Courbet.«5 (Léon Daudet) »Die Literatursprache Célines transponiert die gesprochene Sprache des Volkes.«6 (Paul Nizan) »Céline schreibt so, als würde er sich als Erster mit der Sprache anlegen. Der Künstler mischt von Grund auf den Wortschatz der französischen Literatur durch.«7 (Trotzki) »Das zur Vollendung gebrachte Exklamative.«8 (Deleuze-Guattari) »Quai des brumes (Hafen im Nebel) in der über-göttlichen Version.«9 (Kerouac) »Jetzt ist Leben auf der Seite.«10 (Ezra Pound) »Er hat die französische Literatur zu einem ihrer sichersten Fundamente geführt, dem mittelalterlichen, tiefsten, hellseherischen Fundament.«11 (Drieu La Rochelle) Gehen wir darüber hinweg, wie komisch manche dieser eingeschränkten Lobesworte anmuten: Der eine sagt, die Reise sei um zweihundert Seiten zu lang (Nizan),12 andere urteilen, Céline habe nach Guignol’s Band nichts mehr vorzubringen gewusst »außer seinem Unglück, also hatte er keine Lust mehr zu schreiben, er brauchte lediglich Geld«13 (Deleuze-Guattari). Das sollte auch Malraux, allerdings noch negativer, in einem Interview mit Frédéric J. Grover 1973 wiederholen: Nach der Reise habe Céline nichts Wichtiges mehr zu sagen gehabt, Tod auf Kredit sei unleserlich, Märchen für irgendwannII »ein Buch für Psychiater«, sein Werk sei nichts als bloße Schmähung, seine Politik gleiche dem »Anarchismus der Musikbars« und seine Weltanschauung der eines »Taxifahrers«; letztlich läuft also alles auf den Abbé Prévost heraus: Ein einziger kleiner Roman überlebt siebzehn ebenso dicke wie angeblich überflüssige Bände.
Noch einmal in wenigen Worten: Für alle hat Céline, dies scheint unangefochten, die Emotion der gesprochenen Sprache in die geschriebene Sprache eingeführt. Fazit: Er hat einen natürlichen Stil. Übersetzung: Indem er den antiken Fluch überwindet, die Trennung der Geschlechter, die Verbote, die Unangemessenheit zwischen Sache und Wort, offenbart er uns mit seinem von triebhafter Glückseligkeit stammelnden Körper lebendiger als je den Traum der verängstigten Menschheit, ihren Durst nach verbaler Versöhnung der Geschlechter, nach dem Androgynen, nach der allgemeinen Rückkehr zu einer prägenitalen Sexualität. Alle scheinen ein Interesse daran zu haben, dass Céline nur gesprochen hat – dass er auf der Couch seiner Mama lebendig war.
Fast ist man versucht, der hellsichtigen Abneigung eines Léautaud zuzustimmen, der wiederholt betonte, es handle sich im Gegenteil um einen »absichtlich konstruierten«14 Stil, oder dem Scharfsinn Bernanos’, der ebenso, allerdings positiv gewendet, den komplexen Entstehungsprozess der Céline’schen Prosa hervorhebt, »diese unerhörte Sprache, gewachsen aus der Natur und aus dem Künstlichen, Erfindung, Schöpfung bis ins Letzte wie die Sprache der Tragödie, so weit wie nur möglich von einer unterwürfigen Reproduktion der Sprache der Armen entfernt, aber gerade dafür geschaffen, das auszudrücken, was die Sprache der Armen niemals auszudrücken vermag, ihre kindliche und düstere Seele, die düstere Kindheit der Armen.«15
Es versteht sich, dass Céline 1936 höchstpersönlich die Lösung des Problems in die Hand nimmt: »Eine Sprache ist wie alles andere auch, sie stirbt permanent. Sie muss sterben. Damit muss man sich abfinden. Die Sprache der üblichen Romane ist tot, Syntax tot, alles tot. Auch meine [Romane] werden fraglos in nicht allzu ferner Zeit sterben. Aber sie werden sich eine gewisse Überlegenheit gegenüber so vielen anderen bewahren, denn sie werden ein Jahr, einen Monat, einen Tag lang gelebthaben.«16
Es gibt keine ewige oder natürliche Sprache, und Céline hat auch keine lebendige Sprache geschrieben, sondern eine Sprache, die gelebt hat: Man sollte den immensen Abstand ermessen, zu dem er damals bereits fähig ist. Als hätte er sich immer schon von dem ganzen Betrieb distanziert. Als hätte er, immer schon, gelebt gehabt. Damit gewinnt die Frage wenigstens eine andere Dimension als mit dem üblichen Gerede über seinen Argot-Wortschatz. Die Gemeinschaft wollte glauben, dass Céline sprach, wollte, dass er die mythische Ursprache verkörpert, den in der mütterlichen Schallwolke planschenden Fetus; nicht denjenigen, der beim Schreiben unaufhörlich das überlebte Wort enthüllt, das die Sprechhemmung der Sterblichen zur Sprache bringt.
Dieser ästhetischen Inbesitznahme folgt automatisch die moralische und politische. Neben den Vereinnahmungen durch die Rechten, denen er sich, wie hinlänglich bekannt, in ebenso entgegenkommender wie komplexer Weise ausgeliefert hat, wurde er in der ideologischen Landschaft des 20. Jahrhunderts auf zwei weitere Arten instrumentalisiert. Zunächst mit der christlichen Vereinnahmung, für die Robert Poulet und Bernanos stehen. Ersterem hat Céline am Anfang seines letzten Buchs, Rigodon, ein grausames Denkmal gesetzt: »Schließlich ging er mir mit seinem Um-den-Brei-Herumgehen auf die Nerven! … sind Sie sicher, dass Ihre Überzeugungen Sie nicht zu Gott zurückführen!«17 Auch Bernanos ist der Versuchung des Bekehrens erlegen. Davon zeugt ein Abend bei Daniel Halévy, an dem Céline beweisen wollte, dass »der Wahn seiner Figuren die Sehnsucht des Autors nach Übersinnlichem verrät.«18 Ähnlich einer der letzten Sätze des glänzenden Artikels, den Bernanos 1932 zur Reise verfasste: »Das Ende der Nacht, das ist das milde Erbarmen Gottes …«19
Auf der »anderen Seite«, der linken, gab es, mit Aragon als Wortführer, ein regelrechtes Wetteifern, um ihm die Mitgliedskarte für die Revolution aufzudrängen: »Im Grunde entscheiden Sie sich nicht, ob Sie sich auf die Seite der Ausbeuter oder der Ausgebeuteten schlagen wollen (…) es ist an der Zeit, Céline, dass Sie Partei ergreifen.«20 Halten wir uns nicht an der gehörigen Prise Scharfsinn auf, die aus dieser Erklärung spricht, und sehen uns lieber das fromme Bedauern anderer an. Trotzki etwa: »Eine aktive Revolte ist mit Hoffnung verknüpft. In Célines Buch gibt es keine Hoffnung.«21 Derselbe Tenor bei Nizan, der bekanntlich befand, dass die Reise um zweihundert Seiten zu lang sei, während die Revolution unter den Tisch falle: »Es fehlt ihm die Revolution, die wahrhaftige Erklärung des angeprangerten Elends, der bloßgelegten Krebsgeschwüre, und eben jene Hoffnung, die uns vorantreibt.«22 Wären die zweihundert überflüssigen Seiten eher berechtigt, wenn Brecht sie umformuliert hätte? Simone de Beauvoir erwähnt die Begeisterung, mit der Sartre und sie die Reise entdeckt hätten: »Sein Anarchismus schien dem unsrigen verwandt.«23 Wer jagt nicht heute noch alles der Wunschvorstellung eines idealen libertären und fahnenflüchtigen Céline nach, eines »widerspenstigen Bardamu«24 (Glucksmann)? Eigentlich trifft meines Erachtens nur Georges Bataille hinsichtlich der aufkommenden Céline’schen Erfahrung unmittelbar ins Schwarze: »Der bereits berühmte Roman von Céline lässt sich als Beschreibung des Verhältnisses lesen, das der Mensch zu seinem eigenen Tod unterhält (…), er unterscheidet sich nicht grundlegend von der klösterlichen Meditation vor einem Schädel.«25 Und Bataille fügt jene Worte hinzu, die leider die Rechtfertigung vorwegnehmen, die später von Céline für sein eigenes ideologisches Engagement übernommen werden sollte: »Die Größe von Reise ans Ende der Nacht besteht darin, dass nie an das Gefühl des unsinnigen Mitleids appelliert wird, das die christliche Unterwürfigkeit mit dem Bewusstsein von Elend assoziiert hatte.«26 Besser lässt sich vorausschauend nicht beschreiben, was Céline während des epochalen Umbruchs der Vorkriegsjahre fehlte, um nicht in die Falle des Antisemitismus zu tappen.
Er hat den von der Linken entgegengereichten »Mitgliedsausweis« also nicht angenommen. Ebenso wenig hat er sich auf den Betstuhl gekniet, den ihm die Christen unterschieben wollten. War er also der ideale, der »lebensfähige Atheist«, von dem Lacan einst sprach, »das heißt jemand, der sich nicht ständig widerspricht«?27 Natürlich nicht. Er sollte bis zum Schluss ein Atheist der durchschnittlichsten Sorte sein, ein Kranker »des Gottesglaubens«,28 ein Kranker mit dem unheilbaren Glauben daran, dass Gott nicht in seine Krankheit eingreift. Und natürlich hat er sich selbst permanent in Widersprüchen verfangen und es damit seinen Getreuen, die sein Schwanken zu entschuldigen versuchten, nicht leicht gemacht. Dieser dritte Einwand äußert sich in erbaulichen Erklärungen seines Antisemitismus. Gide nimmt mit seinem unsäglichen Urteil dabei einen der vorderen Ränge ein: »Er spricht in Bagatelles von den Juden genauso wie in Tod auf Kredit von den Maden, die es ihm gerade heraufzubeschwören gelungen war.«29 Dominique de Roux sieht seinerseits gar nicht, wo eigentlich das Problem liegt: »Für Céline hat das Wort Jude nicht den üblichen Sinn. Es meint keine besondere ethische oder religiöse Gruppe: Der Beweis dafür ist, dass er unter dieser Vokabel alle Menschen, sich selbst eingeschlossen, hätte zusammenfassen können. In seinen Augen haftet diesem Wort etwas Magisches an. All seine Angst überträgt er darauf.«30 Schon eher horcht man bei der faschistischen Freimütigkeit eines Rebatet auf, der die göttliche Überraschung erwähnt, die für die Rechtsextremen das Erscheinen von Bagatelles (dt. Die Judenverschwörung in Frankreich) bedeutete, ein umso wunderbareres Buch, als Céline seiner Ansicht nach »derjenige Atheist war, der am wenigsten der Reaktion verdächtigt werden konnte«.31 Daraus ziehen wir den Schluss, dass es »normalerweise« keinen Antisemitismus ohne Religion gibt. Céline aber war Atheist und Antisemit. Insofern stellt sich die Frage, in welchem Namen wir, die wir uns als Atheisten verstehen, die undurchsichtige, aber unwiderrufliche Logik des Céline’schen Atheismus verurteilen, der mit seinem Antisemitismus den Platz der Religion beansprucht.
Gleichen die Schwierigkeiten, die wir bei der Einschätzung seiner Ungeheuerlichkeit empfinden, schließlich nicht jenem Unvermögen, das wir beim Begreifen dieses, seines Jahrhunderts, unter Beweis stellen, dieses Zeitalters des absoluten Mordens, der er eine Literatur hinzuzufügen wagte? Denn letztlich hatte er alles schonungslos vorausgesehen, hatte sich das ganze Negative der Epoche zu eigen gemacht und es mit seinen überempfindsamen Sinnen erfasst. Hinter dem Optimismus, der Fortschritt und Revolution registriert, das betonte er immer wieder, gebe es nur Niederlagen und Ruinen. Denen, die ihre Hoffnung auf den radikalen Gegensatz zwischen Kapitalismus und Sozialismus setzen, hat er tausendfach geantwortet, dass im Gegenteil beide harmonisch ineinandergriffen und nur gemeinsam und solidarisch reibungslos funktionieren könnten. Er hat die kühne Behauptung gewagt, das Proletariat sei nichts als eine Wunschvorstellung des Bürgers und der Klassenkampf ein Scheinbild, hinter dem sich die Wahrheit eines anderen uralten Krieges verstecke. Die Dialektik hat er frech als »Geschwätz«32 abgetan. Unsere dem technikorientierten Denken unterworfene, verwüstete Realität hat er unvorsichtig einen »Dekor aus elektrischen Stühlen«33 genannt, statt wie alle Welt ihren herrlichen Komfort zu genießen. Kurz, er hat Anstoß erregt, erregt immer noch Anstoß und wird es vermutlich bis in alle Ewigkeit tun: bei den Vertretern des Akademismus, die ihm stets Drieu oder Aragon vorziehen werden, wie bei denen des Progressivismus, die unaufhörlich gezwungen sind, sich aus dessen Trümmern einen analen, perversen, vielgestaltigen Avantgarde-Céline zurechtzubasteln, der die bedeutende epistemologische Zäsur mit schweren, triebhaften Stößen rhythmisch vertieft.
Es fragt sich nur noch, wie er, der so einhellig Anstoß erregt, auf weitaus heimlichere Art und Weise doch auch Anklang findet mit seinem kriminellen Delirium, das die Gemeinschaft offenbar im eigenen Interesse verbirgt und unter Verschluss hält, um es wie einen verschwiegenen Garten weiterhin kultivieren zu können.
Nur wenige konnten es mit einem Werk aufnehmen, das es vielleicht als Einziges mit diesem Jahrhundert aufzunehmen vermochte. Céline hat mit literarischen Mitteln beispielhaft vorgeführt, wozu die Entfesselung der befreiten Negativität führte, deren albtraumartige politische Konsequenzen wir zur Genüge kennen. So wie dieses 20. Jahrhundert nach der Tabula rasa für die Kunst verlangte und er diesem Wunsch nachkam, so wollte es auch den gemeinschaftlichen Mord, und er lieferte dazu die passende Form der schriftlichen Ergötzung. Beide Vorgänge sind ein und dasselbe. Folglich verläuft auch die Trennlinie nicht an dieser Stelle, wie ich versuchen werde nachzuweisen. Es gibt keine zwei Célines, da es nur einen gibt, und wenn dem so ist, ist er zwangsläufig vielschichtig. Von wem ist die Rede? Vom Verfasser der Reise oder von dem der anderen Bücher, die die Leute nicht gelesen haben und die sie gar nicht lesen können, weil sie angeblich unlesbar sind? Von Céline, dem schelmischen Komiker, oder von Céline, dem Propheten des Unheils? Geht es um den kleinbürgerlichen Céline oder den Wikinger, der von den Des Touches de Lentillière abstammt? Um den fäkalen oder den »feinen« Céline? Den gräko-keltischen Céline oder den messianischen Propheten? Um Spitzen oder Nudeln? Um Märchen oder Massaker? Sämtliche Differenzierungen erübrigen sich, sobald es sich um einen Schriftsteller handelt, um diese vage und immer schon abhandengekommene Person, die von einer beunruhigenden Aura umweht wird. Sie entspricht in etwa der, die den Jünger Johannes verwandelt, als der Auferstandene diese rätselhaften Worte zu ihm sagt (»Jesus antwortete ihm: ›Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Du aber folge mir nach!‹ Da verbreitete sich unter den Brüdern die Meinung: Jener Jünger stirbt nicht. Doch Jesus hatte zu Petrus nicht gesagt: ›Er stirbt nicht‹, sondern: ›Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt.‹« (Johannes, 21,22–23)). Angesichts dieser nie kontrollierbaren Wirbelstürme, deren Abfolge die unmögliche »Geschichte« der Literatur konstituiert, ist ein befriedetes Wissen undenkbar.
Die Frage ist vielmehr, wie es Céline gelungen ist, der Epoche zu geben, was sie ihm abverlangte, und zugleich so allein, absolut allein zu sein, dass er fanatisch versuchte, sich von dort fernzuhalten, wo wir am ehesten unter Unsresgleichen sind – nämlich im Hinblick auf den Rassebegriff. Auch darum geht es: wie ein Leben lang und ein ganzes Werk hindurch zwei unterschiedliche Weltsichten nebeneinander bestehen konnten. Die eine tiefgründig, unhaltbar, unerträglich, verzweifelt auf die Entlarvung der in jeder Gesellschaft wütenden menschlichen Gewalt und Bosheit bedacht; die andere verbindend, tröstlich für die Kollektivität (collectivité), die eine bestimmte Kategorie von Menschen für die Zersetzung des gesellschaftlichen Zusammenhalts verantwortlich macht. Welche Angst war es, die Céline unablässig zu bekämpfen versuchte? Denn der Antisemitismus ist kein Synonym für seine Angst, sondern bezeichnet im Gegenteil das, was ihm bei deren Beseitigung oder »Heilung« behilflich war. Und warum hatte er es nötig, mit seinem Antisemitismus den schwarzen Abgrund zu bezwingen, den seine Ästhetik nach und nach freigab?
Man darf sich fragen, was er Schreckliches entdeckt hatte, dass er um jeden Preis eine Politik, ein Projekt brauchte, um ihm zu entkommen.
Und was genau wurde schließlich eingekerkert und ins Loch gesteckt, ins Loch des gesellschaftlichen Gedächtnisses, als man ihn in den Nachkriegsjahren da oben, weit weg an der Ostsee, ins Eis schickte? Was wollte man mit dem Vergessen Célines unbedingt vergessen? Auf welche bewusste Amnesie verweist, für uns alle, der Signifikant Céline?
II
Die Raserei des Verfolgens
Wer verfiele heute noch ernsthaft auf den Gedanken, dass eine Formulierung wie die vom »Ende der Literatur« nicht an die wohlbekannte Formulierung von der »Endlösung« erinnert? Und dennoch wurden zur selben Zeit und im selben Jahrhundert genau diese Endvorstellungen konsequent zu Ende gedacht. Der Terror in der Literatur entstand aus dem ideologischen Terror. Die fröhlichen Parolen des Anarchismus in der Sprache gediehen im Schatten der politischen Kriminalität. Die schriftlichen Attentate überschlugen sich im Rhythmus der Bomben.
Céline war nicht so unschuldig wie wir. Er erfasste gleich den Zusammenhang, und das bekanntlich in einem positiven Licht. Als Verfechter der Tabula rasa, einer auf Null zurückgesetzten Literatur, gelang ihm ein fast unmerklicher Satz nach vorne, der ihn und seine Epoche dem Entwurf einer Utopie entgegentrug, besser gesagt, dem zu Taten gewordenen Glauben an ein künftiges goldenes Zeitalter auf Kosten eines bestimmten Teils der Menschheit.
Hin und wieder forscht jemand nach den Quellen für sein Werk, versucht, seine Genealogie aus tausenderlei Frustrationen abzuleiten, durchforstet den Intertext, um dort einen Schlüssel zu seiner Abstammung zu finden. Doch diese bemühte Illusion beruht auf der Vorstellung, das 20. Jahrhundert sei ein Jahrhundert wie jedes andere, weshalb auch Célines Werk schließlich nur ein Werk wie jedes andere sei. Indessen springt ins Auge, dass das 20. Jahrhundert dem 19., 18. oder 16. Jahrhundert wenig verdankt, dafür aber alles der Anhäufung dieser Jahrhunderte in der Gegenwart, die nichts als eine grandiose Wiederaufführung ist, ein Aufschrei zusammengeballter Narren aus aller Herren Länder als Finale. Dieser Epochenstau mit seinen tödlichen Auswirkungen eröffnet ein anderes düsteres Zeitalter, als hätten die zivilisierten Zeiten, die zwischen uns und der Urgeschichte liegen, nie existiert, als verdichteten sich Vergangenheit und Zukunft durch die Abkapselung der endlos übereinandergeschichteten sprechenden Menschheit in einer dunklen Gegenwart, die eine neue Ausdrucksweise einfordert: Céline spricht weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern in einer Zeit, die ich Präsens der Auferstehung nenne. Nur unser Zeitalter konnte eine solche Verbform hervorbringen. Doch um die Epoche tatsächlich erfassen zu können, musste sein Schreiben an der Macht des Todes vorbeischrammen und gleichsam als Erstgeborenes des Schattenreichs wieder zurückkehren: »Mit zwanzig Jahren«, schreibt er in der Reise, »hatte ich schon nichts mehr als Vergangenheit.«34
Wie ist die Angst beschaffen, an der ein Mensch des 20. Jahrhunderts vorzeitig zugrunde geht, um Schriftsteller zu werden? Welche Qualen mögen ihn dazu bewegen, seine Stellung zu verlassen und zu beginnen, sich selbst das Wasser abzugraben? Welche Entdeckung kostet ihn das Leben, macht ihn zu jemandem, dem angeblich der Tod nicht von der Seite weicht wie ein Hund, zu einem Überlebenden dieser Welt, verstoßen aus dem Gewimmel der Lebenden, die blind in ihren Untergang rennen?
Aus seinen Büchern quellen Wörter, die den Karnevalstrubel beschreiben, in den sich die Menschheit seiner Meinung nach unwiderruflich verwandelt. Das Genie der Übersteigerung, das ihn erfüllt (und in dem offensichtlich auch sein Antisemitismus anklingt), diese Art der Übertreibung, ja der Übertreibung der Übertreibung, die manchen Szenen seiner Romane einen geradezu comichaften Charakter verleiht,35 verrät das kontinuierliche stilistische Bemühen, sich der Übertreibung des Wirklichen anzunähern, die nur auf der Ebene des Deliriums fassbar zu sein scheint. Ohne Delirium nichts Konkretes, behauptet er während der Entstehung von Tod auf Kredit: »Ich musste auch den ganzen Ton auf die Höhe des Deliriums bringen. Dann prallen die Dinge ganz natürlich aufeinander. Da bin ich mir ganz sicher.«36 Ähnlich während der Arbeit an Guignol’s Band: »Ich musste bei diesem verfluchten Roman fast alles nochmal neu machen! So ’ne Schweinerei, die Vergangenheit! Wie schnell alles verwelkt und verdirbt! Es hat weder Hand noch Fuß!«37 Und, zwei Jahre später: »Ich musste alles wieder aufmöbeln. Sie [die Szene im Touit-Touit-Club] war lasch.«38 Noch einen Monat später: »Ich musste alles wieder ummodeln – überarbeiten. Es war tot.«39 Vierzehn Tage danach schließlich: »Alles musste zusammengeflickt, der Ton aufgefrischt werden.«40 Die Übertreibung, das Delirium, das Ausmaß des Lyrischen, die aufgebauschte Vision, die ständige Überstrapazierung seines Themas weit über die Wahrscheinlichkeit hinaus offenbaren im Grunde alle dasselbe. Ob es um die Bäume in Afrika geht, den Krebs in unseren Zellen, um das Tanzen der Bomben, die apokalyptisch ineinander verklammerten Körper, um das Bacchanal der Untoten im Touit-Touit-Club – immer ist vom Ursprung und den Konsequenzen einer gewissen Furcht die Rede, vom Ursprung und den Konsequenzen der definitiven Angst eines der übrigen Welt abhandengekommenen Subjekts.
All das konnte nur im 20. Jahrhundert ans Licht kommen, dem Jahrhundert der Konzentrationslager, der Weltkriege, der atomaren Bedrohung, dem Jahrhundert der Geburtenregelung, der Statistiken, der unfehlbaren Massen, der Deportationen und Meetings, der permanenten Vervielfältigung des Ganzen durch die Technik, das Bild, den Fetisch-Spiegel, kurz: dem Jahrhundert der Spektakularisierung des Vielfachen. Es ist das Jahrhundert, in dem sich der Tod des Menschen ereignet hat, nicht etwa durch eine philosophische Entscheidung, sondern durch ein sehr handfestes Ersticken, das unter der unaufhaltsamen Einwirkung jener zersplitterten Erscheinung des Bösen stattfindet, die gerade in ihrer Zersplitterung den Beweis des Bösen erbringt: der in metaphysischer Hinsicht demographische Druck.
Über Céline zu reden setzt voraus, dass wir unser eigenes Zeitalter umfassend vermessen. Um die Logik seines Werks zu verstehen, müssen wir die chaotischen Umstände analysieren, in denen das Drehbuch seines Lebens ablief, die Weltuntergangskulisse, die seine Bücher überhaupt ermöglicht hat.
Célines Entscheidung für das Schreiben fiel zwischen den beiden Kriegen, die von der Menschheit notgedrungen als »Weltkriege« bezeichnet werden. Wenn Reise ans Ende der Nacht noch durchaus »klassisch« auf uns wirkt, sich aber bereits mit dem zweiten Roman unweigerlich der Übergang zu einem für das Gros der Leser immer hermetischeren Stil verzeichnen lässt, dann deshalb, weil er seinen eigenen Tod bereits hinter sich hatte und ihn lediglich stärker verankern musste. Vielleicht findet sich in der Reise zum letzten Mal die akademische Sprache der akademischen Geschichte. Die Geschichte des »Subjonctif imparfait«,41 wie er selbst sagte. Was genau ist dieser Modus des Subjonctif? Das Mittel, einen Prozess zu deuten, ein Urteil abzugeben, aus der sicheren Position des Urteilenden, der den Standpunkt einer mittig platzierten subjektiven Einheit einnimmt. Céline war zutiefst davon überzeugt, dass der im Menschen voranschreitende Tod ihm diese Art des Schreibens zunehmend verbot. Zwischen der Reise und den anderen Büchern setzt sich immer deutlicher ein ganz bestimmter Tod durch, keiner dieser wohlbekannten Tode, die aus Menschen plötzlich Grabeinlagen machen, sondern ein schleichenderer, dem Leben anhaftender Tod, der den Sprechenden bis zu seinem letzten Stündlein unaufhörlich schreien lässt. Äußerst konsequent sollte Céline diesem Prozess im Laufe seiner Existenz immer mehr »Form«, immer mehr Bemühungen um die Form, den Stil, die Syntax und das Wort entgegensetzen, um zu zeigen, dass sich in der Metamorphose der Aussagen ein anderer Körper als sein inzwischen abhandengekommener ausdrückte, eine andere Wort-Welt, die die geschwätzige Welt überrundet hatte, eine Spracharchitektur, die den Sinn der Sprache der vermeintlich das Leben genießenden Toten hinter sich lässt. Dabei rückt unmittelbar die folgende Situation in den Blick: Jemand beginnt sein Werk gleichsam im Endstadium der Analyse, ist bereits über die Ursache der Symptome und ihre Entstehung im Bilde, macht sich von Anfang an keinerlei Illusionen, liefert dafür den schriftlichen Beweis und analysiert zugleich schon wieder ganz andere, dem menschlichen Verstand verschlossen bleibende Instanzen – zwangsläufig ein Abenteuer auf eigene Gefahr. Baudelaire erklärte, die Poesie sei «das Wirklichste, was es gibt, das, was nur in einer anderen Welt ganz wahr ist.«42 Genau in diesem ewigen Rest des Wirklichen, das sich nur von einem außerhalb der Weltordnung liegenden Punkt aus als Wahrheit definieren lässt, besteht das ganze Abenteuer der ungeordneten Entwicklung der Bücher Célines.
Schon bei der Reise merkte er, dass er etwas abschloss, bevor alles wieder neu anfangen sollte, dieselben Geschichten in einer Sprache jenseits der Geschichte, genau Dasselbe, allerdings nach der endgültigen Verankerung des Kataklysmus. Schon sah er voraus, dass man »jetzt still für sich ganz leise auf die andere Seite der Zeit hinüberwechseln kann, um wirklich mal zu sehen, wie sie sind, die Dinge und die Leute.«43 Schon im Motto wusste er (was im Übrigen jedes Romanvorhaben definieren könnte): »Es ist auf der anderen Seite des Lebens.« Später sollte er in Guignol’s Band die Form verdichten: »Ich durchsumme mich wie eine alte Hummel.«44 Natürlich mit den berühmten drei Punkten, die genau jenen »Schwellen« entsprechen (Gespräche mit Professor Y), an denen die »Schienen« der Emotion befestigt sind. Auslassungspunkte, natürlich; wie könnte man weiter außen vor bleiben als Céline, eleganter noch der Welt abhandenkommen, genau in dem Augenblick, da sein Werk immer präsenter wird? Worauf gehen fast alle seine Romane zurück? Auf einen Moment des Deliriums, der Halluzination, auf wiederholte Todesszenen. Im Allgemeinen hat er Fieber, Ohrensausen (Tod auf Kredit), Malaria (Von einem Schloss zum andern, Rigodon). In jedem Fall geht es darum, die narrative Raserei noch zu steigern. Besessen zu sein. Visionen zu haben. Wie am Anfang von Tod auf Kredit: »Über die Place de l’Etoile schwimmt mein schönes Schiff in den Schatten … voll mit Segeln bis zur Spitze des Mastes.«45 Ihm erscheint ein Totenschiff. Gespenster. Die Narration kann nur wiederkehren, denn sie ist Sache des Wiedergängers, des ewigen Wiedergängers. Es scheint sich dabei um ein »widerliches« und »erschreckendes« Zauberritual zu handeln: »Weißt du«, gesteht er Albert Paraz 1949, »ich schreibe, wie ein Medium Tische schieben lässt, mit Abscheu und Ekel.«46 Und ist es nicht sein eigenes Koma, dann ist es das der Welt, des Krieges und der Bomben. Das Fieber der Menschen macht sein »unleserliches« Schreiben zu einem Abdruck der »unverständlichen« Welt: »Der Betrachter muss sich in den Gegenstand seiner Betrachtung hineinversetzen« (Platon). Wie aber sieht jemand aus, der sich in diese Welt hineinversetzt? Nehmen wir Céline, seine Fotos, seine Auslassungspunkte. Wir schaffen es nicht, seine Romane zu lesen? Dann sollten wir sie wenigstens durchblättern, überfliegen, sie körperlich nacherleben, um das 20. Jahrhundert zu begreifen.
In der Reise gibt es noch Maximen. Jedem Ereignis, jeder Begebenheit, jeder Mikrosequenz folgt ein ethisches Mikrofazit. Es scheint, als erfülle Céline in seiner souveränen Einschätzung des Niedergangs der Dinge am Ende seines Denkprozesses ironisch den Kant’schen Imperativ, demzufolge die Maxime unseres Handelns im Idealfall zum allgemeinen Gesetz erhoben werden sollte. Die Maxime, die er aus jedem Absatz gewinnt, entspricht sehr wohl dem allgemeinen Gesetz der Lebenden. Natürlich waren diese Dinge 1932 schon seit Langem nicht mehr ernstzunehmen. In seinen anderen Büchern, die selbst riesige zersprengte Maximen darstellen, wird man immer weniger Beispiele finden. So ist der Leser gezwungen, in einem Ameisenhaufen nach den Trümmern zu suchen. Seine Entmutigung scheint vorprogrammiert. Hinsichtlich unserer Emotionen und unseres Selbstbildes befinden wir uns noch im 19. Jahrhundert.
Eigentlich jedoch sind wir im 20. Jahrhundert, dem Zeitalter der außer sich geratenen großen Zahlen, dem ersten Akt auf dem Sammelplatz der verblichenen Kulturen, sämtlicher Menschenalter, die sich wie ein zusammengezogenes Akkordeon verdichtet haben, der allüberall präsenten Wiederholung, der Neuauflage von Opferdramen, in denen ununterschiedene Vielheiten zueinander in Bezug gesetzt werden, in denen man die Jagdbeute ortet und wie bei einem gnadenlosen Streichholzspiel den anderen den Kürzeren ziehen lässt. Dieses Zeitalter des gemeinschaftlichen Mordens, der wiederholten und uns per Überinformation eingetrichterten Bacchanale beschreibt René Girard in Das Heilige und die Gewalt sowie in Das Ende der Gewalt. Wovon genau redet er? Von den Gründungsmomenten der Zivilisation und der Kultur. Anders gesagt, von der grauen Vorzeit, vom Geheimnis der Urgeschichte. Aber – auch von uns. Denn was sehen wir heute? Genau die mehr oder weniger ausgefeilte Wiederholung des immer Gleichen: den täglichen Beweis der größtmöglichen Nähe zwischen Raserei und Opfer, den mit dem Geopferten koexistierenden Strudel der kriselnden Masse, der mehr oder weniger an den Lynchmord des primitiven Hordenvaters anknüpft. Damit besteht eine permanente Bedrohung, in uns selbst und um uns herum, weil wir eine blutende und ängstliche Vielheit sind, die gerne Einheit wäre, es jedoch mit ihrer Sprache nicht schafft und folglich versucht, auf einer anderen Ebene die Einheit zu erreichen, gemeinschaftlich, in einer realen Vielheit, als Erstarrung individueller Vielheiten. Man nannte das Marxismus; aber der Marxismus war nur die provisorische Quantifizierung einer resistenteren Realität; und diese Realität nannte man Revolution, aber die Revolution war nur ein Symptom für das Charakteristische der Epoche, und dieses Charakteristische könnte man Revolte nennen; aber die Revolte wiederum ist nur die optimistische Bezeichnung für das zu Taten bereite Vielfache (multiple), für den Hang des demographischen Drucks zur Emotion, die die Meute zum Meutern bewegt.
Verfolgungen, Zerstörungen, Gruppenzähmungen, Kommunionen – im 20. Jahrhundert findet man überall jene alles vereinnahmende Wiederholung, sodass sich, zumindest bei normaler Veranlagung, leider kein Gesamtbild ergibt. Man befindet sich mittendrin, ohne es zu wissen. Die Sprache derjenigen, die es wissen und die darüber schreiben, ist entsprechend völlig verdreht, übertragen, sperrig, ebenso unleserlich wie faszinierend. Dennoch hängt man an ihr – um Einzelheiten nachzujagen, Bruchstücken von Schönheit, Dingen, die uns ähneln; und von diesem Standpunkt aus kann man eigentlich nur enttäuscht werden. »Willkommen auf diesem verfluchten Kontinent – die Leichen der letzten Massaker sind kaum unter der Erde, da denkt man schon wieder an neue Blubäder – der ganze Rest ist Geschwätz – eine einzige Obsession! Schlächtereien! Schlächtereien – Schlächtereien!«47 Das zivilisierte sprechende Tier schöpft sein beschränktes Glück von jeher und bis in alle Ewigkeit aus der Menschenjagd, allerdings in sehr viel globaleren Ausmaßen. Es hat gerade erst die geschmackvoll eingerichteten und mit Teppich ausgelegten Höhlen der Ursprünge bezogen. Das Zeitalter der anspruchsvollen Bedürfnisse hat den Anthropithecus zurückgebracht, den einzigen ernstzunehmenden Feind des im Verbund zusammengepferchten Tiers: den Unvorsichtigen, der auf Distanz gegangen ist und es nun aus der Entfernung betrachtet. Den Dichter eben, wie Céline es Milton Hindus gegenüber ausdrückte: »Für alle, die in dieser Welt keine Poeten sind, hege ich eine grässliche Verachtung, für mich sind sie ein Drittel Schwein, ein Drittel Gorilla, ein Drittel Schakal, sonst nichts.«48
Schreiben heißt nicht, zu philosophieren; und wenn Philosophieren im besten Fall bedeutet, dem Bösen ins Angesicht zu schauen, muss man sich unbedingt davon befreien, um es beschreiben zu können, muss sich nach den Bedingungen einer möglichen Verbesserung fragen; das heißt, dass jenes Böse, das ungreifbarer Staub, ein Schwarm vervielfachter Lebender ist und seine Macht aus der Zersplitterung bezieht, durch den Diskurs, der es zusammenzufassen versucht, gleichzeitig verfehlt wird und unangetastet bleibt. Lässt sich das flatterhafte Böse überhaupt in der zusammengeballten Faust eines Gedankens fangen? Wenn Claudel behauptete, das Böse sei das, was nicht ist, hatte er nicht Unrecht. Die Literatur ist lediglich der aus dieser Abwesenheit entstandene Schock. Heutzutage, da das Böse zunehmend als zahlenmäßige Größe auftritt, muss das Schreiben immer häufigere und längere Stöße abfangen. Versuchte man all das zu verdichten, wäre das Problem verkannt. Wenn die Literatur im 20. Jahrhundert in ihrer Seltenheit dringlicher als je zuvor geworden ist, dann deshalb, weil sie sich ganz wesenhaft nicht von dem beschriebenen Grauen trennen lässt. Sie haftet im Gegenteil daran, formt eine Art Abdruck und schwebt in Gefahr, dabei Schaden zu nehmen. Davon zeugen die kläglichen politischen Abenteuer der Avantgardebewegungen, und davon zeugt auch Céline. Diese Werke existieren und zeigen das Böse wie es ist, wie sonst niemand es zu sehen oder zu hören vermag, unbegreiflich und unendlich in seiner explosiven Schwangerschaft.
Célines im Herdenkrieg zersprengte Prosa erzählt nichts anderes. Sein erster Roman beginnt mit dem ersten Konflikt des Jahrhunderts, mit dem ersten Kreuzzug der Meute; der zweite reicht weiter zurück, um die Ursprünge besser ergründen zu können, und endet kurz vor dem Ersten Weltkrieg mit der Mobilmachung; seine Pamphlete triefen vor Angst angesichts der nächsten Krise und erneuter Auseinandersetzungen; jenseits der neuerlichen Metzeleien prophezeit Céline inmitten der inzwischen stagnierenden Meute die kommenden Blutbäder, indem er über die gerade zurückliegenden berichtet. Das macht ihn zum Historiker dieses Jahrhunderts, einem Jahrhundert, das nicht nur aus Daten, Amtszeiten, Staatsstreichen, Regimewechseln oder Klassenkämpfen besteht, sondern, weitaus finsterer, auch aus Kriegen und Massengräbern, sprich aus einer urzeitlichen Behandlung des Vielfachen. Um die Dinge beim Namen zu nennen: Die menschliche Unfähigkeit zur elementarsten Sicht, zur minimalsten Wahrnehmung dieser Realität verdankt sich der Hysterie, also der grundsätzlichen Unfähigkeit, die Dinge symbolisch zu nehmen, sie in ihrer sprachlichen Dimension zu hören – weshalb sie kollektiv wie ein gigantisches Quincke-Ödem anschwellen, das die Ausmaße ganzer Gesellschaften annimmt. Von diesem Standpunkt aus war Céline der Unhysterischste von allen – und sich dessen sehr genau bewusst: »ICH bins, mein Lieber, der hier die Hysteriker wie in der Salpetrière nacheinander verschiedenen Zuständen unterzieht – und das ist noch nicht vorbei! Der absolut klare Kopf voller Gründe ist MEINER – lass dir’s gesagt sein!«49 Die Kunst des 20. Jahrhunderts kann schon jetzt an ihrer mehr oder weniger ausgebildeten Fähigkeit, die allgemeine Hysterie symbolisch zu erfassen, gemessen werden, und alle wichtigen Erfahrungen dieser Epoche, ob auf dem Gebiet der Malerei oder der Literatur, sind davon geprägt: das Dornengesträuch auf Pollocks All-over-Paintings, de Koonings gelbliche Lymphfarben, die sprachmächtigen Veitstänze im Werk von Joyce. Und Céline natürlich. Céline, oder der auf den Drei-Punkte-Schwellen des ausgesparten Subjekts blind von Krieg zu Krieg gleitende Bienenschwarm.
Im Laufe dieses endlosen Massakers des 20. Jahrhunderts, im Laufe seines Lebens starb Céline aus Angst, Hass und Hellsicht Tag für Tag ein Stückchen mehr. Die Umstände hatten ihn von Anfang an über das Wesentliche aufgeklärt. Seine Biographie ist unzweideutig. Wessen Sohn er ist? Der von Proletariern? Von Bürgerlichen? Nein. Seine Eltern sind ein gesellschaftlich heterogenes Paar zweier auf den Handel mit Spitzen und Versicherungen heruntergekommener Bürgerlicher. Kleinbürger, heißt es, um den Eindruck zu vermitteln, es handle sich dabei noch um eine Klasse, während es doch die immer zahlreicher wimmelnde »Mitte«, die sich bereits zur weltweiten Eroberung anschickende Mittelklasse war. Das Reservoir der totalitären Regimes. Die, die in Deutschland Hitler an die Macht bringen sollten, die in Frankreich Petainisten, Gaullisten, Stalinisten, Anti-Stalinisten, was auch immer wurden, gesetzt den Fall, man verschwieg ihnen, dass ihre Zeit abgelaufen war und sie in gesellschaftlicher Hinsicht das Ununterschiedene darstellten, die Konfusion der neuen Höhle. Célines vermeintliche Volksnähe, sein Argot sind nichts anderes als die übermächtige Sehnsucht nach der verschwundenen Aristokratie; auch seine Preziosität, sein »Fingerspitzengefühl« signalisieren nur, dass es im Grunde damit vorbei ist. Argot und Spitzen. Das übermächtig werdende Dazwischen spielt sich zum Herrn und Meister auf.
Céline kommt 1894 auf die Welt, fünf Monate bevor ein gewisser Hauptmann wegen Hochverrats angeklagt wird. Im folgenden Jahr wird Dreyfus öffentlicht degradiert und anschließend deportiert. Der kleine Louis-Ferdinand Destouches ist acht Monate alt, als die entfesselte Menge im Hof der Pariser Ecole Militaire lauthals seinen Tod einklagt und dem Judas-Offizier antisemitische Beleidigungen ins Gesicht schleudert. Diese Ursprungskrise der Raserei des Verfolgens, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts an den kriminellen Wahn der schwarzen Pest im Mittelalter anknüpfte, hat vermutlich langsam in ihm nachgewirkt und seine erste, ja »natürliche« Weltsicht beeinflusst. Am erstaunlichsten ist die Tatsache, dass er bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg gewartet hat, bis er diese sowohl für die französische als auch für seine eigene Geschichte entscheidende Begebenheit erwähnte. Er sollte erst zahlreiche Schicksalsschläge einstecken müssen, bevor er endlich folgende »Verbindung« herstellte: »Das sind Probleme, die mir ganz fremd waren. Ich wurde in einer Zeit geboren, in der noch von der Dreyfus-Affäre die Rede war. Das alles ist ein unglaublicher Blödsinn, für den ich jetzt zu zahlen habe.«50
Auch wenn er nicht gleich sah, von welchem erfolgreich verdrängten Verbrechen die düstere Leidenschaft seiner Pamphlete herrührte, nahm er andererseits sehr genau wahr, in welches allgemeine Verbrechen die Menschheit sich gerade verstrickte: ein Verbrechen, an dem gemessen schließlich alle Kämpfe des Parzellierten, sämtliche lokalen Geschichten verblassen und aus jeder Familie, jedem einzelnen Menschen eine groteske regionale Enklave wird, an dem gemessen die hübsch gedrechselten Phrasen früherer Zeitalter verjährt sind, die Obsessionen der Individuen erbärmlich, auf wahrhaftige und grausame Weise erbärmlich werden und ihre Symbole auf der schiefen Ebene der Kollektivität ins Rutschen geraten. In seiner Hommage à Zola gibt Céline dafür einen genauen Anhaltspunkt, indem er zeigt, dass die Weltausstellung von 1900 ein Datum darstellte, nicht etwa, weil sie ein neues Jahrhundert einleitete, sondern weil sie das Zeitalter der Raserei des Verfolgens eröffnete und damit vielleicht das letzte richtige Datum der Geschichte war. In dieser Beschreibung ist das ganze, auf die Kinderperspektive heruntergeschraubte Gerüst seines Werks zu erkennen: ein unendliches Stampfen, die tausendfüßige Meute in dem von ihr aufgewirbelten Staub, darüber die Konvulsionen der Maschinen, die ihre Schatten vorauswerfende Invasion der Technik, der einstweilen reglos in den Balken abwartende Drache des Krieges. Hier ist nachgerade ein erstes Schema auszumachen, ein erstes symbolisches Verständnis der hysterischen Struktur, die im Begriff ist, sich herauszuschälen, im Kollektiv aufzuplustern und in den geplatzten Kokon der Individuen zu blasen. Céline hat nicht abgewartet, bis wir Tag und Nacht das Vielfache per Satellit empfangen, um darin den Kern des Problems zu erkennen: »Bei der Weltausstellung 1900 waren wir zwar noch sehr jung, aber wir erinnern uns lebhaft daran, wie unglaublich aggressiv das war. Vor allem Füße, überall Füße und zum Greifen dicke Staubwolken. Unendlich vorbeiziehende, stampfende Mengen, die die Ausstellung erdrückten, und dann dieser Rollteppich, der bis in die Maschinengalerie hinein quietschte, die, zum ersten Mal, mit brachial verbogenen Metallen angefüllt war, gigantischen Bedrohungen, Katastrophen in Schwebe. Hier begann die Moderne.«51
In Tod auf Kredit findet man, wunderbar übersteigert, das gleiche Phänomen der Angst, die ihn »umbringen« wird: »Auf der Place de la Concorde war das Geschubse so groß, dass man förmlich hineingesaugt wurde. Ganz verdattert standen wir plötzlich in der Maschinengalerie, einer wahren Katastrophe in Schwebe, einer durchsichtigen Kathedrale aus lauter Glaswerk, das in den Himmel ragte. Der Krach war so ungeheuer, dass man meinen Vater nicht mehr verstehen konnte, obwohl er sich heiser schrie. Der Dampf zischte, sprang an allen Seiten heraus. Ungeheure Kessel standen herum, so hoch wie drei Häuser, glänzende Kurbelstangen fuhren aus dem Hintergrund dieser Hölle auf uns los … Schließlich hielten wir’s drin nicht mehr aus, wir kriegten Angst, gingen fort …«52
Vierzig Jahre zuvor hatte Dostojewski in Winteraufzeichnungen über Sommereindrücke anlässlich der Weltausstellung in London 1862 Vergleichbares geahnt. Er diagnostizierte, auch dort gehe »derselbe hartnäckige, dumpfe und schon veraltete Kampf vor sich, der Kampf auf Tod oder Leben, des allgemein westlichen persönlichen Prinzips mit der Notwendigkeit, sich doch irgendwie miteinander einzuleben; irgendwie eine Gemeinschaft zu bilden und sich in einem einzigen Ameisenhaufen einzurichten; ja, meinetwegen sich in einen Ameisenhaufen zu verwandeln (…).«53
Und hier der Kristallpalast der Weltausstellung, anders gesagt, die Vision der modernen Welt als Wille zur Technik, wie Heidegger es ausdrücken sollte: »Man spürt die furchtbare Kraft, die hier alle diese unzähligen Menschen aus der ganzen Welt zu einer einzigen Herde zusammengetrieben hat; man erkennt einen Riesengedanken; man fühlt, dass hier bereits etwas erreicht ist: ein Sieg, ein Triumph. Und eine Angst vor irgendetwas beginnt sich in einem zu erheben. Wie frei und unabhängig man auch sein mag, um irgendetwas überkommt einen doch Angst. ›Sollte am Ende dies das erreichte Ideal sein‹, denkt man bei sich, ›ist hier nicht das Ende? Ist das nicht doch schon die verwirklichte ›eine Herde‹ der Weissagung?‹«54
Dostojewski kann immerhin noch Referenzen anführen, es sei wie »irgendein biblisches Bild«, »irgendetwas von Babylon«, ja wie »eine Prophezeiung aus der Apokalypse«; noch kann er der Bedrohung Die Besessenen oder Die Brüder Karamasow entgegensetzen, Proteste des Individuums gegen die matrixartige Hysterie, die uns zu politischem Nihilismus oder Vatermord verleitet. Ein halbes Jahrhundert später ist von derlei keine Rede mehr. Wenn die Literatur überhaupt noch Rettung verspricht und Céline noch daran glaubt, dann deshalb, weil allein sie uns mit der Wiederholung des Erzählten schnellstmöglich in den Tod befördern kann. Ja, weil sie uns bei der Beförderung in den Tod helfen muss, damit wir dem vielköpfigen Tier entkommen. Genau das bedeutet Tod auf Kredit





























