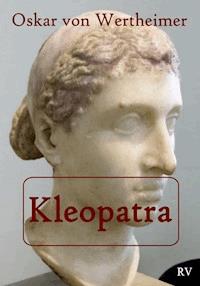Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Reese Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Die Biographie einer großen Frau (1626-1689), die wie ein Kronprinz ausgebildet wurde, die Bibliotheken kaufte und baute, dem Theater zugetan war, einen prunkvollen Hof führte und nach Rom ging, um mit dem Mann ihres Lebens vereint zu sein. "Die großen schwedischen Generäle des Dreißigjährigen Krieges, vor denen Europa zitterte, zeigten sich ängstlich und untertänig, wenn sie ihr gegenübertraten. Solche Macht strahlte ihre Person aus. (...) Unendlich vielfältig wie die Gesichter sind auch die Charaktere der Menschen. Jeder Charakter ist aus so vielen Elementen gebildet, so viel Gegensätzliches ist in ihm geformt, seine Triebe, seine Regungen und Reaktionen sind so zahlreich, daß er immer nur als Wunder betrachtet werden kann. Um wieviel mehr gilt diese Erkenntnis für die Königin Christine. Man kann sagen, daß in ihr das ewige Problem des Menschlichen überhaupt neue Gestalt annimmt, daß in ihr und mit ihr die tiefsten moralischen und geistigen Fragen lebendig werden und daß, wenn man von ihr spricht, man einen ebenso schönen wie gewaltigen Eindruck von der menschlichen Natur empfängt. (Oskar von Wertheimer in seinem Vorwort)
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 550
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Oskar von Wertheimer
Christine von Schweden
Reese Verlag
Christine von Schweden
Widmung
Zugeeignet
Clotilde Beck
der stolzen romantischen Seele
die nur
das Außerordentliche liebt
und nur
Vorwort
Ich möchte denen, die dieses Buch lesen, erklären, weshalb ich nach der Biographie einer großen Frau, der ägyptischen Königin Kleopatra, noch einmal versuche, den Charakter und das Wirken einer bedeutenden Frau darzustellen. Das hat einen rein persönlichen Grund. Wer auf seinem Lebensweg einer genialen Frau begegnete, der kann sich auch rein geistig von dem Phänomen, das in der Vereinigung von Frau und Genie liegt, nicht loszureißen. Eine unbestimmte Kraft treibt ihn dazu, es immer von neuem zu ergründen. Frau und Genie sind schon einzeln betrachtet schwer zu erfassende Erscheinungen. Um wieviel anziehender und großartiger wirken sie, wenn sie in einem Wesen, in einer Seele vereint sind. Da ergänzen, widersprechen und bereichern sie sich auf das wunderbarste.
Königin Christine von Schweden traf ein besonders merkwürdiges Los. Die Überlieferung hat so manche Gestalt der Vergangenheit in ein falsches Licht gerückt. Doch die Verkennung, die sie von ihren Zeitgenossen wie von der Nachwelt hinnehmen mußte, steht ohne Beispiel da. Das geschah nicht zufällig. Jene Verbindung von Genialität und Frauentum erschwerte den Einblick in ihr Wesen. Das Einmalige ihres Charakters hatte zur Folge, daß man sie leicht mißverstehen und nur schwer wirklich verstehen konnte. Sie trug das Ihre dazu bei, verkannt zu werden. Wie oft und mit welchem Geschick bemühte sie sich, ihre Handlungen oder wenigstens deren Motive vor den forschenden, frech neugierigen Augen der Menschen zu verbergen. Ein äußerer Umstand vollendete die Mißdeutung ihres Charakters. Während der größeren Hälfte ihrer Regierungszeit wurde Frankreich an ihrem Hof durch den Gesandten Chanut, einen glänzenden und geistvollen Diplomaten, vertreten. Ihm folgte in den letzten Jahren ihrer Herrschaft der Resident Picques. Die Berichte, die beide Männer an den französischen Hof sandten, wurden, noch als Christine lebte, im Auszug veröffentlicht. Man gewann den Eindruck, als stammten sie alle aus der Feder Chanuts. Sie enthalten viele Mitteilungen, die die Königin schwer belasten. Die Welt schenkte ihnen, da sie Chanuts Namen trugen, vollen Glauben. Erst vor etwa fünfzig Jahren machte ein schwedischer Gelehrter, Martin Weibull, die Entdeckung, daß alle Anklagen gegen die Königin in den Berichten von Picques stammen und daß sie in vollem Widerspruch zu dem stehen, was Chanut von ihr und ihrem Hof erzählte. Picques war ein gänzlich unbedeutender, eitler Mensch, der von den wahren Vorgängen in Schweden keine Ahnung hatte und deshalb die in Stockholm umlaufenden Gerüchte und Lügen als Tatsachen nach Paris meldete. Es bedurfte zweier Jahrhunderte, ehe man zur Einsicht kam, daß der größte Teil des Fundaments, auf dem die Anschauung über Königin Christine beruhte, faul und morsch war.
Diese Entdeckung rief nicht den großen Wandel in ihrer Beurteilung hervor, den man hätte erwarten dürfen. Die aufschlußreiche Arbeit war in einer gelehrten schwedischen Zeitschrift erschienen, und ihre Kenntnis beschränkte sich auf einen kleinen Kreis. Und viele, die sie gelesen hatten, scheuten sich, die letzten Folgerungen aus ihr zu ziehen. Wahrheiten setzen sich stets schwer durch. Die Verführungen der Lüge erwiesen sich auch in diesem Fall als mächtiger und verlockender. Manche ignorierten absichtlich die mitgeteilten Tatsachen, damit ihre Phantasie ungestört in dem überlieferten Bild der Königin schwelgen konnte. Denn gerade das scheinbar Widerspruchsvolle, Rätselhafte, Unergründliche, Abstoßende und angeblich Perverse ihrer Natur übte die stärkste Anziehungskraft aus. Es ist richtig, daß die Berichte des Residenten Picques nicht das einzige Material bildeten, auf dem die Auffassung einer sündhaft-verderbten Christine beruhte. Es existiert aus ihrer eigenen Zeit eine gewaltige Pamphlet-Literatur, in der sie der niedrigsten Taten und Laster beschuldigt wird. In mehreren Sprachen und unter anspruchsvollen Titeln erschienen in Amsterdam, in Köln, in Leipzig, in Brüssel Schmähschriften, sensationelle Broschüren und Bücher über sie. Die Veröffentlichung solcher gedruckter Schamlosigkeiten lag im Geist oder vielmehr im Un-Geist jener Zeit. Damals fanden sich überall erbärmliche Skribenten, die für Geld im Auftrag eines einzelnen oder einer politischen Macht, die auf diese Weise einen Gegner vernichten wollte, Fürsten und hervorragende Menschen verleumdeten. Es gab in dieser streitsüchtigen Epoche wohl niemanden, gegen den so viele Pamphlete verfaßt wurden, wie die Königin Christine.
Erst mit dem Fortschreiten der Zeit vertiefte sich die Beurteilung ihres Wesens. So erschien um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ein vierbändiges Werk vom Bibliothekar des damaligen Landgrafen von Hessen-Kassel, Arckenholtz, über sie. Es ist trotz aller seiner Mängel und Irrtümer, trotz der prunkenden Gelehrsamkeit, trotz der Verworrenheit der Erzählung ein ehrlich gearbeitetes Buch, das eine besondere Bedeutung durch die zahllosen Briefe und Dokumente von Christines eigener Hand besitzt. Andere Darstellungen, insbesondere die von Grauert: „Christina, Königin von Schweden und ihr Hof“, erweiterten die Erkenntnisse. Mit dem Gefühl für die Erhabenheit des geschichtlichen Wirkens und Geschehens näherte sich sodann Leopold von Ranke ihrer Gestalt. In seine Geschichte der Päpste schaltete er eine eigene Abhandlung über sie ein. Da er noch das Material benützte, das erst nach ihm als falsch erkannt wurde, gelangte er zu manchem irrigen Schluß. Doch welche künstlerische Intuition, wieviel eindringliche Weisheit und Erfahrung, welch ahnungsvolles Verständnis für die geistigen und moralischen Eigenschaften der Königin offenbaren sich in seiner kurzen Arbeit!
Die seither über Christine erschienene Literatur schlug andere Wege ein. Wenn es auch das Recht und die Pflicht der neueren Autoren sein mochte, die moderneren psychologischen und medizinischen Erfahrungen zu verwerten, so taten sie das mit wenig Verantwortungsgefühl. So begegnen wir heute einer geradezu beängstigenden Fülle von Anschauungen und Auffassungen über die Königin. Daß ein Christine-Drama Strindbergs höchst persönliche Färbung trägt, kann nicht überraschen. Unglücklicherweise ist es eines der schwächsten Werke dieses fruchtbaren und furchtbaren Genies. In seinem Gustav-Adolf-Drama gelang es ihm wunderbar, die geheimnisvoll-unsichtbaren Kräfte und Zusammenhänge der Geschichte zu gestalten, die sich dem Forscher entziehen und die nur der Dichter erschaut. Aus Christine machte er, gestützt auf die historischen Quellen, die ihm bekannt sein mochten, ein kindlich-katzenartiges Raubtier. Da verführte die Historie den Dichter, und der Dichter vergewaltigte die Historie.
Nach dem Feind der Frauen ergreifen die Frauen das Wort über Christine. Die französische Schriftstellerin Arvede Barine gelangt in ihrem Buch „Princesses et Grandes Dames“ zu dem Schluß, daß sie fast Genie hatte, aber in moralischer Hinsicht ein Ungeheuer gewesen ist. Die Schwedin Ellen Fries, die vortreffliche Studien über das Zeitalter der Königin veröffentlichte, hält fest an der Auffassung, daß sie wohl einzelne große Eigenschaften besaß, aber unberechenbar, hemmungslos, verworren, launenhaft und vor allem maßlos egoistisch war. Die Prinzessin Murat erblickte in Christine ein vorzügliches Objekt für erotische Betrachtungen und erweckte ihr Bild, in etwas gefälligerer Form als es in der Pamphlet-Literatur des siebzehnten Jahrhunderts lebte, zu neuem Dasein. Hannah Saß glaubt in einer simplen Formel das Rätsel ihres Wesens lösen zu können. Von den wirklichen Problemen und Tiefen ihrer Natur ahnt diese glückliche Biographin nichts. Der Weg zu ihnen wurde ihr auch durch die rührende Anhänglichkeit und Treue an ein selbst unzulängliches französisches Vorbild versperrt. Louise Marelle bemühte sich gewissenhaft, wenn auch wenig eindrucksvoll, um ihre Erkenntnis. Eine ganze Reihe von Werken sind durch die gemeinsame Auffassung verbunden, daß sie Christine nicht als normales Geschöpf gelten lassen. Worin das Anomale bei ihr liegt, darüber sind sie sich nicht einig. Da vertritt jeder eine andere Anschauung. Den sogenannten Sexualforschern gilt sie als Zwischenstufe, als Mann-Weib, als Travestitin, die auch Frauen liebte. Einzelne Symptome, das Männliche in ihrem Äußeren, in ihrem Gehabe, in ihrer Kleidung, ihre leidenschaftliche Freundschaft für eine ihrer Hofdamen, ihr Widerwille gegen Frauenarbeit begrüßen die Vorkämpfer dieser Richtung mit Jubel und Genugtuung als unwiderlegliche Beweise für ihre perversen, anomalen Triebe.
Wer wollte leugnen, daß ihr Charakter einen ausgesprochen männlichen Einschlag hatte!
Doch anstatt mit Gewissenhaftigkeit und Feinheit zu untersuchen, wie weit dies Maskuline in ihrer Natur ging, welche Bedeutung es besaß, treten sie mit vorgefaßter Meinung, die ihnen als Wissenschaftlichkeit gilt, mit plumpem Sinn an diese Frage heran und ziehen ihre Kenntnisse weniger aus Tatsachen als aus Theorien, die Zeugnis ablegen für ihr geheimes Bemühen, das Abnorme als das eigentlich Wesentliche im Menschen zu erklären. Von ihnen wird auch die Behauptung aufgestellt, Christine sei ein typisches Frühgenie und ihr ganzes Leben, etwa vom fünfundzwanzigsten Jahr an, sei nur Niedergang, zweckloses, verworrenes Umherirren und Abmühen gewesen. Einen solchen Schluß vermag nur zu ziehen, wer die Bestrebungen und Ziele der Königin in der zweiten Hälfte ihres Lebens nicht kennt und nicht begriffen hat, daß sie in allen erstaunlichen Wandlungen ihres Daseins bis zum letzten Atemzug sie selbst geblieben ist.
Eine andere moderne Anschauung geht dahin, sie einfach für verrückt zu erklären. In der großen, von Lavisse herausgegebenen „Histoire de France“ wird das mit schöner Deutlichkeit ausgesprochen. Auch eine medizinische Fachzeitschrift, die sich mit ihr beschäftigt, gelangt zum gleichen Urteil. Andere Kritiker sind milder und wollen sie nachträglich nicht in ein Irrenhaus, sondern bloß in ein Nervensanatorium einsperren. Der Arzt Cabanes hat den außerordentlich interessanten Versuch unternommen, Persönlichkeiten der Geschichte vom medizinischen Standpunkt aus zu bewerten. Als ungerufener Doktor kommt er zu den Fürsten und Fürstinnen, fühlt ihren Puls, horcht auf ihren Atemzug, wendet alle Kunstgriffe der Medizin an, um ihre Leiden zu erkennen, und beobachtet angespannt ihre Gesten und Reden, um ihre geistige und seelische Verfassung zu studieren. Nun zeigt die Erfahrung, wie leicht man auch bei Lebenden irrige Diagnosen stellt. Um wieviel mehr gilt das für Menschen, deren Existenzen, Worte, Handlungen, Krankheiten weit zurück in den Jahrhunderten liegen. In seiner Abhandlung über Christine, der er den Titel gibt „Eine gekrönte Hysterikerin“, bekennt Cabanes sich zu der Ansicht, daß sie eine geistig gestörte, hysterische Frau gewesen sei. Doch welchen Wert besitzt sein Urteil, da er es auf lauter unrichtige Behauptungen gründet? Er erklärt sie für ganz oberflächlich religiös. Allein es läßt sich der unwiderlegliche Beweis erbringen, daß tiefste, reinste, unbegrenzte Gläubigkeit sie erfüllte. Er sagt, daß ihr nervös krankhafter Zustand sie nie zur Ruhe kommen ließ, sondern sie von einer Stadt zur anderen jagte. In Wahrheit entschloß sie sich nur aus zwingenden Gründen zu Reisen und war jedesmal untröstlich, wenn sie Rom, in dem sie nach ihrer Abdankung lebte, verlassen mußte. Er nennt sie eitel. Doch wo gab es eine Frau, die weniger eitel gewesen wäre als sie! Er führt als Beweis ihrer Exzentrizität an, daß sie sich in Wien und Venedig in Hosen zeigte. Da schenkte er den Verleumdungen zu viel Glauben. Sie hat sich in einem solchen Aufzug schon aus dem Grund nicht in diesen Städten zeigen können, weil sie sie überhaupt niemals gesehen hat. Und ihre seelischen Beziehungen zu den Menschen, denen sie begegnete, werden von ihm völlig falsch dargestellt. Es ist die Christine der anonymen Pamphlete, mit derer sich befaßt, nicht die wirkliche Königin Christine.
Vor allem maßgebend für die Gestaltung der heutigen Auffassung über sie wurde jedoch die Anschauung des Baron de Bildt. Wer von denen, die sich mit der merkwürdigen schwedischen Herrscherin beschäftigen, fühlt sich nicht diesem Diplomaten und Schriftsteller zu allergrößtem Dank verpflichtet! Er brachte durch die Auffindung eigenhändiger Briefe von ihr die entscheidende Erkenntnis, daß sie den Kardinal Azzolini liebte, und er veröffentlichte auch sonst über sie eine Reihe wertvoller Arbeiten und enthüllte damit viel von ihrem Leben. Doch die Anerkennung so unendlich wichtiger Verdienste vermag die Tatsache nicht aus der Welt zu schaffen, daß er durch seine Gesamtauffassung ihres Wesens ihr Bild verfälschte und entstellte. So lautet das Urteil, das er über sie fällte: Sie ist eine junge Frau von schwächlicher Gesundheit, die ihr Leben in Mißachtung der Gesetze der Hygiene einrichtet, ihr Gehirn und ihre Nerven überreizt, Befriedigung für ihren Stolz und ihre Selbstliebe sucht, nach Lob und Beifall giert und ihre geistige wie materielle Überlegenheit genießt. Sie ist ohne Unterlaß tätig, erledigt im gleichen, höllischen Tempo die Geschäfte wie die Studien, kostet in einem Augenblick alle Süße und im nächsten alle Bitterkeit der Macht aus. Sie ist berauscht von der Größe und bald bedrückt von ihrer Last. Ein rätselhaftes, kompliziertes, furchtbares Wesen, dem eine sichere Hand fehlte, die ihre Jugend lenkte, und ein ergebenes Herz, um ihrer Jugend ein wenig Glück zu geben. Man hat ihr Gehirn mit Lektüre vollgestopft, aber niemand lehrte sie, zu lieben, und so geht sie durchs harte, kalte Leben, ohne Zärtlichkeit, ohne Mitleid, ohne Vaterlandsliebe: im ganzen eine neuropathische Egoistin.
So sprach ein Mann über sie, der in bewundernswürdiger Weise ihr Dasein kannte, dem als Schweden auch die so unentbehrlichen schwedischen Quellen und Arbeiten zugänglich gewesen sind. Geschützt durch die Distanz zweier Jahrhunderte brachte er den Mut auf, so scharf und doch so herablassend-väterlich über sie zu urteilen. Die großen schwedischen Generäle des Dreißigjährigen Krieges, vor denen Europa zitterte, zeigten sich ängstlich und untertänig, wenn sie ihr gegenübertraten. Solche Macht strahlte ihre Person aus. Alles, aber auch alles an Bildts Urteil ist falsch. Trotz Kenntnis jeder Einzelheit ihres Lebens, hat er dies Leben nicht begriffen und ist an ihrer inneren wie äußeren Größe blind vorübergegangen.
Es gibt noch eine weitere Anschauung über sie, die man als die gemäßigt-offizielle bezeichnen kann. Sie gesteht ihr geniale Begabung für Kunst und Wissenschaft zu, hält aber wenig von ihren Fähigkeiten als Herrscherin und Politikerin.
Ein anderer schwedischer Historiker, Curt Weibull, sagt in einem meisterhaften, ebenso gelehrten wie anschaulich geschriebenen Buch Wesentliches über Christines politische Größe und Talente aus.
1. Gestaltende Kräfte
Am 18. Dezember 1632, am selben Tag, da die Prinzessin Christine von Schweden ihr sechstes Jahr vollendete, traf in Stockholm die Nachricht ein, daß König Gustav Adolf, der Vater dieser Prinzessin, im Verlauf einer Schlacht in Deutschland gefallen war. Zuerst hatte sich in der Stadt das Gerücht eines großen schwedischen Sieges verbreitet. Aber der Jubel darüber wich infolge der Todeskunde sogleich der Verzweiflung. Einen Monat hatte es gedauert, bis die Kunde des Ereignisses der Schlacht von Lützen nach Schwedens Hauptstadt gedrungen war. Die übrigen Regierungen der europäischen Staaten erfuhren sie rascher, und jede von ihnen nahm sie auf, je nach ihrer Stellung in dem gewaltigen Kampf, der die Zeit erfüllte. So herrschte in Wien über den Tod des Königs große Freude. Obgleich die kaiserliche Armee den Rückzug hatte antreten müssen, dankte man Gott in den Kirchen für dieses glückliche Ereignis. In Madrid wurde zur Erbauung des Hofes und der Gesellschaft ein Schauspiel aufgeführt, das „Der Tod Gustav Adolfs“ hieß. Den französischen Hof bewegten in dieser Lage zwiespältige Gefühle. Der Schwedenkönig war ein Verbündeter gewesen. Seine Siege in Deutschland hatten ihn jedoch allzu groß gemacht, und so betrachtete Richelieu, der Lenker der Geschicke Frankreichs, den Fall „dieses Goten“ eher als ein Glück. Dagegen nahm das Haupt der katholischen Christenheit, der eigenwillige, leidenschaftliche und bedeutende Papst Urban VIII. die Nachricht mit Bestürzung auf, da er in diesem Fürsten den gefährlichsten Gegner der ihm verhaßten Habsburger sah. Es lag Schicksalhaftes darin, daß Gustav Adolf die Schlacht von Lützen, seinen zweiten und letzten Waffengang mit Wallenstein, bewußt erzwungen hatte. Etwa sechzehntausend Schweden stritten damals gegen fünfzehntausend Kaiserliche. Bestimmend für den Verlauf der Schlacht wurde der Umstand, daß an jenem Tag Nebel die Gegend bedeckte. Das verzögerte den Angriff. Es wurde aber dann, wie Wallenstein selbst sagte, mit einer Wut gefochten wie noch nie. Wallenstein mußte sich schließlich zurückziehen und erneuerte, obgleich er Verstärkung erhielt, die Schlacht am nächsten Tag nicht, um sein Heer nicht zu gefährden.
Was aber bedeutete die strategische Entscheidung gemessen an dem Tod des Königs! Dessen Leichnam wies, wie der Apotheker, der ihn einbalsamierte, angab, fünf Schußwunden, zwei Hiebwunden und eine Stichwunde auf. Das Unglück geschah vermutlich bei einem Kavallerieangriff, der um ein Uhr mittags erfolgte und den der König selbst anführte. Dabei soll Gustav Adolf zuerst eine schwere Armwunde erhalten haben, und dann soll ihm von hinten eine Kugel durch den Körper gejagt worden sein. Er, der schwere Mann, stürzte zu Boden, während sein auf dem Schlachtfeld umherjagendes Streitroß denen, die es erblickten, den jähen Gedanken eingab, dem König müsse ein Unglück zugestoßen sein. Der Page Leibelfinger harrte bei dem Schwerverwundeten aus. Kaiserliche Reiter fragten ihn, wer der Offizier neben ihm sei. Als er keine Antwort gab, töteten sie den König, verwundeten jedoch nur den Pagen, der noch vier Tage lebte und das Vorgefallene berichtete. Es heißt aber auch, der König selbst hätte den Reitern gesagt, wer er sei. Darauf versuchten diese, ihn als kostbare Beute wegzuschleppen. Als aber die Schweden im selben Moment zu einem neuen Angriff ansetzten, mußten sie ihr Vorhaben aufgeben und schossen ihm, ehe sie flohen, noch eine Kugel durch den Kopf.
Aus dem Unbestimmt-Geheimnisvollen, das den Abschluß einer so ruhmreichen Laufbahn bildete, wuchs rasch die Legende empor. Das Empfinden sträubte sich gleichsam dagegen, daß der Tod - der eigentliche Herr des Schlachtfeldes - seine Hand auch an die großartige Gestalt eines solchen Fürsten legen könne. Man wollte ihn nicht enden sehen wie den gemeinen Mann oder selbst wie einen Feldherrn. So entstand die Meinung, er sei das Opfer einer verräterischen Tat geworden. Unter den Männern, die man beschuldigte, ist der meistgenannte ein deutscher Fürst, der Herzog Franz Albrecht von Sachsen-Lauenburg. Aus einem längst vergangenen Streit beider Männer als Knaben, in dem Gustav Adolf den Herzog gezüchtigt hätte, und daraus, daß der Herzog kurz vor der Schlacht aus Wien gekommen war und im schwedischen Heer Dienste nahm und nach der Schlacht in das sächsische Heer übertrat, wollte man den Beweis für eine derartige Behauptung ableiten. Auch Richelieu wurde verdächtigt, er habe den ihm unbequemen König auf eine solche heimtückische Weise beseitigt. So versuchte menschlicher Verstand einen verworrenen Augenblick des Kampfes festzuhalten, neu zu gestalten. Diese Bemühungen konnten weder Gewißheit bringen noch den Verdacht zerstreuen. Ist es aber so unnatürlich, daß Gustav Adolf, der nicht nur ein König, sondern auch ein Held war, endlich ein Opfer dessen wurde, was er so liebte: des Krieges und des Ruhmes?
Wenn sich der tiefe Wandel, den sein Ende hervorrief, politisch auch auf ganz Europa erstreckte, so traf er menschlich am stärksten eine Frau, seine nunmehrige Witwe, Marie Eleonore. Diejenigen, die die Verhältnisse in der königlichen Familie kannten, dachten mit Zittern daran, wie diese Fürstin die Schreckenskunde aufnehmen werde. Sie hielt sich damals in Erfurt auf, wo sie wenige Tage zuvor vom Gatten Abschied genommen hatte, und ahnte noch nicht, was inzwischen bei Lützen geschehen war. Der Hofmarschall der Königin wurde aufgefordert, seiner Herrin „ohne Perikul für ihre Person“ das Geschehene mitzuteilen. Das war genau so unmöglich, wie jemanden zu foltern, ohne ihm Schmerzen zu bereiten. Als Marie Eleonore die Wahrheit erfuhr, gebärdete sie sich so, daß man fürchtete, sie werde Selbstmord begehen.
Und wie lange hatte es gedauert, wie viele Hindernisse mußten überwunden werden, bis diese Ehe zustande kam, die nun so plötzlich der Tod schied. Noch zu Lebzeiten seines Vaters, Karl IX., als Thronerbe, sollte Gustav Adolf die Tochter des englischen Königs Karl I., Elisabeth, heiraten. Doch kamen damals die schwedischen Bewerber zu spät. Die Prinzessin war eben dem ersten unter den protestantischen deutschen Fürsten, Friedrich V. von der Pfalz, versprochen worden, der dann, getrieben von dieser Fürstin, die sagte, sie wolle lieber mit einem König Sauerkraut essen, als mit einem Fürsten Gebratenes, die Hand nach der böhmischen Krone ausstreckte und darüber sein eigenes Land verlor. Als entthronter Fürst, der unbewußt der letzte Anstoß zu einer großen geschichtlichen Entwicklung geworden, begegnete Friedrich V. im deutschen Krieg Gustav Adolf. Das Geschick brachte später auch Elisabeth, seine edle Tochter, und Christine von Schweden auf eigentümliche Weise in Verbindung. Beide Frauen waren Verehrerinnen des Philosophen Descartes.
Damit Gustav Adolf seine Einwilligung zur Brautwerbung um die brandenburgische Prinzessin gab, die sich aus religiös-politischen Gründen aufdrängte, mußten in ihm erst echte Herzensgefühle zerstört werden. Er hatte sich mit achtzehn Jahren in die um ein Jahr jüngere Gräfin Ebba Brahe, ein berühmt schönes Mädchen, verliebt. Sie wurde am Hofe von Gustav Adolfs Mutter, Christine, erzogen, die dem deutschen Fürstenhaus Holstein-Gottorp entstammte. Diese Frau war eine starke, herrschsüchtige Persönlichkeit. Sie scheute sich nicht, für Geld, das sie ihrem Sohn borgte, Zinsen zu nehmen. In Briefen, die der feurige König Ebba Brahe aus seinen Kriegen schrieb, gelobte er ihr unwandelbare Treue bis in den Tod.
Voll Galanterie schickte er ihr Blumen, die die Deutschen, wie er bemerkte, „Vergiß mein nicht“ nennen. Als echter Ritter, versicherte er ihr, sei er stets bereit, für sie zu sterben. Aus Glaube, Krieg und Liebe schuf er ein Gefühl, indem er erklärte, der göttlichen Allmacht vor allem dafür dankbar zu sein, daß er zum Ruhme der Geliebten seine Feinde überwinden konnte.
Indes verlor Ebba Brahe die Freundschaft der Königin-Mutter im gleichen Maße, wie sie die Liebe des Sohnes gewann. Sie war nicht an den Hof gebracht worden, um die Hand nach der Krone auszustrecken. Die schönen Gefühle der beiden jungen Menschen wurden schließlich von Intrigen und ernsteren politischen Erwägungen besiegt.
Als Gustav Adolf im Winter 1614/15 aus Rußland zurückkehrte, mußte er feststellen, daß Ebba Brahes Herz und Sinn völlig verwandelt waren. Seine Mutter meldete dagegen triumphierend ihrem Vetter, Landgraf Moritz von Hessen-Kassel, der den Plan einer Verbindung Schwedens mit Brandenburg aufs eifrigste betrieb, die „Person“, die bisher ihre Absicht verhinderte, sei nunmehr glücklich beiseite geschoben und „man“, also ihr Sohn, spüre keine Neigung mehr für sie. Der König überließ die Braut seinem ersten Feldherrn, Jakob Pontusson de la Gardie, den er den Lehrmeister seiner Kriegskunst nannte, und der, nachdem er im Krieg Moskau und Nowgorod erobert hatte, nun auch die schöne Ebba Brahe gewann. Jakob de la Gardie erhielt, als er sich um ihre Hand bewarb, zunächst eine ausweichende Antwort. Vielleicht wollte die Schöne abwarten, wozu der König sich entschloß. Erst zwei Jahre darauf wurde sie die Frau des ebenso tapferen wie witzigen Feldherrn.
In Gustav Adolf wirkten die schmerzlichen Ereignisse lange nach. Geschlagen auf dem Felde der Liebe, sehnte er sich um so stärker nach ehrlichem männlichem Kampf. Wenn er in dieser Zeit seiner Umgebung versicherte, er hege eine unaussprechliche Liebe zum Kriege, so bestärkten ihn hierin die erlittenen Enttäuschungen. Der Held, der er von Natur aus immer gewesen, erwuchs nun vollends aus dem trauernden Liebhaber. So gewann die Welt, was zwei Herzen verloren. Noch eine andere Stimmung erweckten diese traurigen Vorgänge in ihm: Feindschaft gegen die Ehe. Während er selbst sich weigerte, eine Frau zu nehmen, mahnte er seinen jüngeren Bruder, es zu tun. Und als seine Stiefschwester Katharina, die Tochter aus der ersten Ehe seines Vaters mit Marie von der Pfalz, einen kleinen deutschen Fürsten, den Pfalzgrafen Johann Kasimir zu Kleeburg, heiratete, da erhoffte er aus dieser Ehe einen Thronerben. Anders als er es damals selbst wähnte, ging sein Wunsch in Erfüllung. Überhaupt erinnert diese Periode in Gustav Adolfs Leben ein wenig an das Schicksal seiner Tochter Christine. Seine Mutter, der Reichsrat, die Stände bestürmten ihn vergebens, dem Lande eine Königin zu geben. Seine Abneigung gegen eine Heirat war allerdings nur eine zwar leidenschaftliche, aber natürliche Reaktion, die mit der Zeit nachließ und endlich erlosch. Christines Widerwillen gegen eine eheliche Gemeinschaft wurzelt in den geheimsten Gründen ihrer Seele.
Auf brandenburgischer Seite stand der Kurfürst Johann Sigismund dem Projekt mit großer Sympathie gegenüber. Aber Johann Sigismund kam bereits als kranker Mann zur Regierung. Politik und mehr noch eigene Neigung hatten ihn zum Übertritt vom lutherischen zum calvinischen Bekenntnis bewogen. Seine Gattin Anna, eine preußische Prinzessin, Tochter des geisteskranken Herzogs von Preußen,
Albrecht Friedrich, war in allem ein ihm entgegengesetzter Charakter: eine starke Persönlichkeit, herrschsüchtig, von originellem Geist und ebenso leidenschaftlich lutherisch gesinnt wie ihr Mann calvinisch. Mit zunehmender Krankheit des Kurfürsten riß sie die Zügel der Regierung immer mehr an sich. Während der gutherzige Kurfürst seine Tochter bei Tisch bereits scherzend „Königin von Schweden“ nannte, ließ sie dergleichen Gedanken weder im Scherz noch im Ernst zu. Als Prinzessin von Preußen, über das Johann Sigismund als Schwiegersohn des Herzogs Albrecht Friedrich mit Polens Zustimmung die Vormundschaft ausübte, war sie an der Erhaltung der polnischen Freundschaft aufs stärkste interessiert. Die Polen und Schweden aber lagen miteinander im Krieg. Sie schrieb der Mutter Gustav Adolfs zu einem Zeitpunkt, als dieser bereits das Schloß in Stockholm umbauen und die Königinnengemächer herrichten ließ, sie möge die geplante Reise ihres Sohnes nach Brandenburg verhindern.
Seltsamerweise ebnete gerade der Tod Johann Sigismunds den Weg zu der Heirat. Der neue Herr in Brandenburg, sein Sohn Georg Wilhelm, dachte in dieser ganzen Frage wie seine Mutter. Doch der prinzipielle Gegensatz zu dem von ihr wenig geliebten Sohne rief bei der nunmehrigen Kurfürstin-Mutter einen völligen Gesinnungswechsel hervor. Genau so erfinderisch wie vorher im Bekämpfen zeigte sie sich nunmehr im Betreiben der Heirat. Ihr Entschluß wurde vollends unerschütterlich, als Gustav Adolf selbst inkognito nach Berlin kam. Da war zwar aus dem König ein schwedischer Hauptmann im Gefolge seines Schwagers, des Pfalzgrafen Johann Kasimir, geworden und aus dem stolzen Titel: Gustavus Adolfus Rex Sueciae durch Zusammenziehen der ersten Buchstaben dieser Worte der einfache Name: Gars. Als Hauptmann Gars sah Marie Eleonore den König zum erstenmal. Mit elementarer Gewalt fühlte sie sich zu ihm hingezogen.
Der brandenburgische Hofstallmeister befragte bei einem Mahl den neben ihm sitzenden Hauptmann Gars eingehend über Statur, Alter und Physiognomie des Königs von Schweden. Sein Auge hätte ihm verraten können, wonach sein Mund so begierig forschte. Gustav Adolf versicherte nach diesem ihm peinlichen Zwischenfall, er wolle lieber dem gefährlichsten Feind eine Schlacht liefern, als noch einmal inkognito reisen. Jedenfalls war das Verbergen und diplomatische Verhüllen nicht Sache dieses freien, offenen Menschen. Die Kurfürstin schrieb ihrem Sohn nach Preußen, sie habe noch an keinem Herrn so viel Bescheidenheit und Demut gesehen wie an dem König. Wie sollte er ihr nicht gefallen, da er ihr erklärte, er wolle lieber eine von der Mutter gesegnete Tochter haben als eine, die der Mutter zuwider wäre, und er wolle keine andere begehren als diese. Ein Zeuge seiner ersten Begegnung mit Marie Eleonore sagt aus, sie habe die Augen unverwandt auf ihn geheftet, und sie selbst versicherte in einem Brief an ihren „Herzer Bruder“, der König würde lieber sein Leben lassen als sie. So bestätigten die Gefühle die Pläne und Absichten der Staatspolitik.
Aber es gab am brandenburgischen Hof nicht nur ein verliebtes Paar und eine mit der Heirat einverstandene Mutter, sondern auch einen Geheimen Rat. Durch diesen erfuhr der Kurfürst, der in Preußen weilte, was in Berlin vorging. Er legte sogleich gegen die Beschlüsse seiner Mutter Protest ein, benachrichtigte, um seine eigene Stellung zu sichern, Polen sowie andere Mächte von dem, was sich an seinem Hof abspielte, und ließ bei verschiedenen Universitäten Rechtsgutachten einholen, ob er die Heirat, die seine Mutter begünstigte, verhindern dürfe. Aus Kummer über diese Verzögerung erkrankte Marie Eleonore. Auch der schwedische Kanzler Oxenstierna, der an der Spitze eines glanzvollen Gefolges nach Berlin kam, vermochte trotz seiner überlegenen Beweisführung und Diplomatie die Angelegenheit nicht zu fördern. Das ernsthafteste Hindernis bildete die Weigerung des Geheimen Rates, finanzielle Beihilfe zu leisten. Die Kurfürstin-Mutter mußte sich deshalb entschließen, einen Teil ihres Silbers herzugeben und sechstausend Taler vorzustrecken. Ja sie drang sogar durch einen geheimen Gang in die kurfürstliche Schatzkammer ein und verschaffte sich verschiedene Kleinodien als „Ersatz“ für die verweigerte Aussteuer.
Endlich wurde Marie Eleonore mit einer ihrer Schwestern, der Markgräfin Anna Sophie von Brandenburg, nach Wolfenbüttel in Braunschweig gebracht. Dort befand sich bereits Oxenstierna, der von ihr sagte, sie sei eine „tüchtige, wohlaufgezogene, wohlgestaltete“ Gemahlin, die jeder getreue Untertan gerne empfangen und der er gerne dienen würde. Auf der Überfahrt nach Schweden wurde die Braut von ihrer Mutter und ihrer jüngeren Schwester Katharina begleitet, der späteren Gattin des berühmten Gabriel Bethlen, Fürsten von Siebenbürgen. Gustav Adolf erwartete sie in Kalmar.
An der Hochzeit nahm auch noch Katharina von Stenbock, die fünfundachtzigjährige dritte Frau des ersten Wasakönigs, eine geborene Schwedin, teil. Wundervoll ertönte in die lärmende Hochzeitsfreude in Stockholm die Festrede des Kanzlers. „Möge diese Ehe“, sagte er, „in der Furcht des Herrn begonnen, christlich vollzogen werden, einträchtig verlaufen und selig enden. Der Allerhöchste Gott segne Ihre Majestäten mit Kindern und Leibeserben, welche die Krone dieses Landes tragen, sowie uns und unsere Nachkommen löblich regieren mögen.“ Mit diesen bedeutungsvollen Worten fand der Kampf Gustav Adolfs um die brandenburgische Braut seinen glücklichen Abschluß. Die Harmonie, in die er ausklang, sollte den Übergang zur Zukunft bilden. Aber auch Oxenstiernas weit vorausschauender Blick konnte nicht erahnen, was das kommende Schicksal in sich barg.
Wie geartet war die Frau, die zunächst die Politik und dann seine eigenen Gefühle Gustav Adolf als Gefährtin bestimmt hatten? Das Erlebnis, in dem sie sich ganz erfüllte, in dem sich alles, was sie an Anlagen in sich barg, mit höchster Intensität offenbarte, war ihre Liebe zu Gustav Adolf. Diese schwächte sich in zwölfjähriger Ehe nicht ab. Daß sie sich in den König verliebte, als er um sie warb, ist zu begreifen. Das Physische scheint die stärkste Macht über ihr Gemüt ausgeübt zu haben. Sie war in ihrer Ehe nur glücklich, wenn Gustav Adolf bei ihr weilte, und erlosch, sobald er sie verließ. Die vielen Sehnsuchtsrufe, die sie dem Abwesenden über das Meer nachsandte, nach Polen, Preußen oder Deutschland, lassen das leidenschaftliche Bedürfnis der Vereinigung mit ihm erkennen. Wieviel Verwirrung, die sie nur allzuoft als Königin um sich verbreitete, entsprang diesem Verlangen, in dem sich Stärke und Schwäche in erstaunlicher Weise vermengten. Soviel sie auch während der Abwesenheit ihres teuren Gatten litt und duldete - im Augenblick, da er zurückkehrte, schwand aller Kummer dahin. Der Jubel über seine Gegenwart verbannte jede trübe Erinnerung.
Allein jeder neue Feldzug - und in der Zeit ihrer Ehe fand nur in einem einzigen Jahr keiner statt - rief einen Sturm der Verzweiflung in ihr hervor. Manchmal sah sie den Gatten in einem Jahr nur drei Monate hindurch. Erst wenn die Jahreszeit das Weiterführen des Krieges unmöglich machte, kam sie als Weib zu ihren Rechten. Dann überließen die verschneiten nordischen Gegenden ihr für kurze Zeit den Gemahl. Erst die Kälte des Winters brachte ihrem Herzen die Wärme. Doch das Erwachen der Natur bedeutete das Sterben ihres Glücks. Wenn das Meer wieder schiffbar wurde, dann erstarrte ihr Herz.
Was waren ihr diese Kriege, die für Schwedens Größe und Existenz geführt wurden? Ereignisse, die ihr den Gatten raubten und sein Leben gefährdeten! Und die langen Reisen zu Land und zur See, bis er nach Polen gelangte? Raub an einem verliebten Zusammensein. Es gab nichts einander so Widersprechendes, wie ihre Wünsche und die Pflichten des Königs. Welch ein Jubel, wenn er ihr gestattete, ihn in einer dem Kriegsschauplatz nahe liegenden Stadt zu erwarten. Sie hatte für alles in der Welt nur einen Maßstab: die Nähe oder Entfernung von ihm. Davon allein hing ihr Urteil über Menschen und Verhältnisse ab. Wer ihr half, ihm näher zu sein, der war ihr Freund, wer sie fernhielt oder entfernte, ihr Feind. Die Kehrseite ihrer Liebe zu Gustav Adolf bildete der Haß gegen alles, was sich zwischen sie und ihn stellte. Von der inneren Notwendigkeit der Taten des Königs verstand sie wenig, und doch ist es ergreifend, wie sie ihm, als sie ihn nach sehr langer Trennung in Deutschland wiedersah, zurief: „Nun ist der große Gustav Adolf gefangen.“ Sie und die Geschichte waren ewige Rivalen um die Zeit, die Gunst, die Liebe des Königs. Alle seine Siege bedeuteten Niederlagen ihres Gefühls. Welch ein Triumph, daß sie ihn nach so vielen Entbehrungen der Geschichte entreißen und in ihre Arme schließen konnte. Sie trug ihr Empfinden rücksichtslos und, wenn man will, auch gedankenlos in alles hinein, in die Politik und in die Kriege, und begriff dann nicht, wenn ihr von dort ein rauhes, kaltes Echo entgegentönte. Sie war Königin Schwedens nur, weil sie die Gemahlin des Königs war. Sonst fühlte sie sich als deutsche Prinzessin. Solange Gustav Adolf lebte, verbarg sie solche Empfindungen, oder sie gingen in ihrer großen Liebe unter.
Zu einer echten hingebenden Liebe gesellten sich bei dieser Fürstin unzweifelhaft übergroße Empfindlichkeit der Nerven sowie geringe geistige und seelische Widerstandskraft. Sie war streng und sehr fromm erzogen, aber die Tatsache, daß sie schon in früher Jugend Putz und Staat liebte, fügt sich gut in das Bild ihres Charakters. Eine große Verwirrung entstand in ihrem Leben aus ihrer Unfähigkeit, ihre Finanzen in Ordnung zu halten. Überall bekundete sie eine gewisse Unordnung und Ungehemmtheit der Gefühle. Schon zu Lebzeiten des Königs mußte sie sich vom Pfalzgrafen Johann Kasimir Geld ausleihen. Gerühmt wird ihre Freundlichkeit und Herablassung. Ein scharfer französischer Beobachter bemerkt jedoch, sie sei entgegenkommender gewesen, als es einer Fürstin gestattet ist. Eine gewisse Neigung zeigte sie für Musik. Auffällig war ihr Interesse für Architektur. Sie entwarf selbst Pläne, und es ist nicht überraschend, daß sie an kostspieligen Bauten Freude hatte. Sie besaß also einige künstlerische Fähigkeiten, die aber ihren Charakter nicht beeinflußten. Dieser erschöpfte sich im rein Gefühlsmäßigen und Überschwenglichen.
Sosehr sich die Form ihrer Ehe aus ihrer Persönlichkeit sowie aus der Gustav Adolfs ergibt, wird deren Anfang wie Ausgang und damit ihr tieferes Wesen durch die großen Zeitereignisse bestimmt. Daß der schwedische König sich mit einer deutschen protestantischen Prinzessin vermählte, daß er Krieg gegen den Kaiser führte, daß er bei Lützen fiel und Marie Eleonore Witwe wurde, sind Folgen jener Ereignisse, unter deren Wucht die Welt erzitterte: der sogenannten Gegenreformation, des katholischen Gegenangriffes, der vom Süden her gegen den Protestantismus anstürmte.
Die Auseinandersetzung mit den geistigen und politischen Mächten der Reformation mußte einmal kommen. Das war unzweifelhaft geworden, nachdem sich die katholische Kirche von dem sündhaftgroßartigen Geist der Renaissance befreit, das Heidnische in sich überwunden hatte, da sie, erneut vom Geist des Loyola, sich in den Glaubenssätzen des heiligen Thomas von Aquino wiederfand. Das Konzil von Trient, bei dessen Ausgang die Ketzer feierlich verflucht wurden, schuf die Konzentration der Kräfte, stellte die Einheit der Kirche her und machte den Papst wieder zu ihrem Führer. In dem nunmehr mit steigender Gewalt anhebenden Kampf ging es um Seelen, aber die Seelen wohnen in Menschen, die Menschen in Dörfern, Städten, Ländern. Also ging es neben dem Himmlischen auch immer um sehr irdische Dinge. So stand im Mittelpunkt leidenschaftlicher Erörterungen und blutiger Kämpfe die Frage, wer Anspruch auf die von den Katholiken allmählich zurückeroberten Bistümer mit ihrem großen territorialen Besitz habe, wie Bremen, Verden, Halberstadt, Magdeburg.
Der deutsche Kaiser Ferdinand II., König Philipp IV. von Spanien und Kurfürst Maximilian von Bayern sind die Herrscher, die den geistigen Kampf des Katholizismus mit ihren weltlichen Mitteln führten. Ferdinand II. war von seiner begabten, willensstarken Mutter und den Jesuiten für die Aufgabe herangebildet worden, den Protestantismus, der sich fast alle österreichischen Erbländer erobert hatte, zu bekämpfen. Durch die Unerschütterlichkeit seiner religiösen Überzeugung, die in der Hingabe an die Mutter Gottes gipfelte, bezwang dieser Fürst, weder ein starker Geist noch ein starker Charakter, Hindernisse und Gefahren, denen größere Männer erlegen wären. In ihm lebten die Ideale der Brüder vom Orden Jesu. Seine historische Rolle steht in keinem Verhältnis zu seiner persönlichen Bedeutung. Daß ihm wirkliche Größe abging, wurde klar, als er die unerhörten Erfolge nicht auszunutzen verstand, die ihm das Schicksal auch in Deutschland beschied. Die rein politischen Entscheidungen während seiner Regierung gingen allerdings nicht von ihm, sondern von seinen Ratgebern aus. Er war persönlich ein freundlicher, wohlwollender Mensch, voll Familiensinn und durchaus den Freuden des Lebens zugewandt.
Kurfürst Maximilian von Bayern überragte ihn geistig bei weitem. Auch diesen Fürsten erfüllte echte fanatische Frömmigkeit. Auch er war überzeugt ketzerfeindlich, leidenschaftlich dem Marienkult ergeben und aufs innigste mit den Jesuiten verbunden. Kirchliche Übungen, fromme Werke, harte Kasteiungen, Fasten und Geißelungen waren ihm Gebot. Ihn unterschied von Ferdinand sein ausgesprochen männlicher Sinn, seine Welterfahrung, der Wille und auch die Fähigkeiten, Entscheidungen von Gewicht selbst zu treffen. Dazu gesellten sich Einfachheit der Sitten, großes Pflichtgefühl und außerordentliche Arbeitskraft, die jedoch auch Ferdinand eigen war. Maximilian erblickte die oberste Aufgabe des Herrschers darin, die Ehre Gottes, die katholische Religion und das Seelenheil seiner Untertanen, für das er seiner Überzeugung nach am Jüngsten Tag Rechenschaft abzulegen hatte, zu fördern.
Philipp IV. von Spanien ist der letzte dieser fürstlichen Vorkämpfer der Gegenreformation. Als sechzehnjähriger Jüngling bestieg er den Thron seiner Väter. Sein Interesse und Pflichtgefühl erlahmten aber rasch, und danach überließ er Spanien völlig seinem sechsundzwanzig Jahre älteren Freund Don Gasparo de Guzman, Grafen Olivarez. Er selbst beschränkte sich für sein weiteres Leben darauf, der Liebhaber schöner Frauen zu sein und mit seinem Hof ein glanzvolles Dasein zu führen. Nicht als Herrscher, wohl aber als Protektor von Velazquez und als Gönner anderer Künstler, die sich in seinen Vorzimmern drängten, erwarb er wirklichen Ruhm. Auch die Musik wurde an seinem Hof sehr gepflegt. Aber inmitten einer hohen kulturellen und gesellschaftlichen Blüte büßte Spanien, bedrängt vom unerbittlichen Genie Richelieus, Stück um Stück seiner Weltstellung ein. Graf Olivarez, der eigentliche Herrscher Spaniens, war hochmütig, hart und streitsüchtig, doch ebenso arbeitsam wie sein Herr genießerisch, und ehrlich bemüht, den Ruhm und die Größe Spaniens zu wahren. Sein politisches Dogma blieb unwandelbar das gemeinsame Interesse des Hauses Habsburg, die Einigkeit der Höfe von Madrid und Wien. Da er für dieses Ziel und für die prunkvolle Hofhaltung Philipps gewaltige Summen aufbringen mußte, gelang es ihm nicht, Ordnung in den Finanzen zu schaffen. Echten schöpferischen Genius hat er nicht besessen. Nachdem er dreiundzwanzig Jahre lang Spanien souverän regiert hatte, gelang es seinen Feinden, ihn aus der Gunst des Königs zu verdrängen. Er starb in der Verbannung.
Ganz im Vordergrund der Ereignisse stehen die Feldherren. Unter ihnen sind die markantesten Tilly und Mansfeld. Der größte war Wallenstein. Johann Tscherklas von Tilly war Niederländer von Geburt, wurde von Jesuiten erzogen, diente unter den Spaniern gegen sein eigenes Land und gegen Heinrich IV., kämpfte gegen die Türken und trat später in die Dienste Kaiser Rudolphs II. und schließlich in die Maximilians von Bayern. Er hatte das sechzigste Jahr überschritten, als er Feldherr der katholischen Liga wurde. Ein finsterer verschlossener Mann, streng katholisch, gab er sich ganz spanisch und war darum den deutschen Protestanten begreiflicherweise doppelt verhaßt. Habgierig war er wie alle Generäle und Politiker, aber er hielt Manneszucht unter seinen Truppen und war ein durchaus aufrichtiger Charakter.
Der berüchtigte Mansfeld, der natürliche Sohn des Reichsfürsten Ernst von Mansfeld, des Statthalters der kaiserlichen Niederlande, war von ganz anderer Art. Als Bastard, überdies klein und mißgestaltet, fühlte er sich gedemütigt, und so entstand der Wille in ihm, mit dem Schwert die Stellung zu erobern, die seine Geburt ihm zugleich gewährt und versagt hatte. Ein bösartiger, skrupelloser, maßlos ehrgeiziger Mann, diente er wahllos den verschiedensten Herren, Protestanten wie Katholiken. Auch der Vorwurf des Verrats wurde gegen ihn erhoben. Sein kühn-infames Dasein beendete er mit einer großartigen Geste. Als er in seiner Krankheit merkte, daß es mit ihm zu Ende gehe, ließ er mit letzter Kraft den Harnisch anlegen und erwartete, den Degen in der Faust, auf zwei Diener gestützt, den Tod. Wallenstein war es, der ihn vom ersten Platz unter den deutschen Feldherren verdrängte.
In Wallenstein, dem großen Gegner Gustav Adolfs, finden viele Elemente dieser Epoche der Geschichte ihren stärksten und sinnfälligsten Ausdruck. Ihn trieben auf seiner Bahn brennender Ehrgeiz, Überfülle an Kraft und Machtgier vorwärts. Nach dem Höchsten zu greifen, das die Zeit zu vergeben hatte, fühlte er, der einfache böhmische Edelmann, sich berufen. Beim Fortschreiten der Gegenreformation trat er, noch als Jüngling, zum Katholizismus über, mehr um seinen eigenen Zwecken als um dem Himmel zu dienen. Die Grundlage jedes Aufstiegs in dieser Zeit, Reichtum und Verbindung mit den herrschenden Familien, verschaffte er sich durch seine beiden Heiraten. Gleich allen führenden Persönlichkeiten bereicherte ersieh unbedenklich durch den Ankauf der von den Protestanten konfiszierten Güter. Aber er verstand es besser als die meisten, das einmal Erworbene wirtschaftlich auszunutzen. Indem er dennoch in Wien als Grandseigneur auftrat, zeigte er, daß er wußte, wann es galt zu sparen und wann zu verschwenden. Kostspielige Einquartierungen hielt er von seinen großen Gütern fern und belieferte selbst mit deren landwirtschaftlichen Erzeugnissen die Armeen, die er kommandierte. So verpflegte er seine Truppen und verdiente Geld an ihnen. Seine Abrechnungen mit der kaiserlichen Hofabrechnungskammer zeichnen sich durch Genauigkeit aus. Seine Kanzlei war ebenso trefflich organisiert wie seine Armee. Offiziere und Soldaten bewunderten und fürchteten ihn. Die Erkenntnis, daß sie finanziell unter ihm am besten daran seien, fesselte sie naturgemäß am stärksten an ihn.
Im Mittelpunkt seines Lebens stand gebieterisch seine eigene Person. Er hatte sich wohl die vornehme italienische Lebensart angeeignet und zeigte sich auch Frauen gegenüber sehr galant, aber das waren nur Hüllen um seinen dunkel gärenden, eruptiven Charakter. In ihm vereinten sich viele Gegensätze. Für seine Person einfach, entfaltete er in seinem Palast in Prag oder bei besonderen Anlässen eine fürstliche Pracht. Der Rausch eines gewaltigen, prunkhaft gesteigerten Daseins war seiner Natur Bedürfnis. Seine geradezu wilde Energie war jedoch nicht die Folge einer eisernen Konstitution. Er machte Nervenkrisen durch, während deren er, wie bekannt, das Krähen der Hähne, das Bellen der Hunde nicht ertragen konnte. Wahrscheinlich steigerten jedoch diese Krisen, die nie lange dauerten, das Triebhafte seiner Natur. Er liebte wohl eine heitere Tafel, doch im allgemeinen war der Umgang mit ihm wegen seiner Launenhaftigkeit, seiner Rücksichtslosigkeit und Härte sehr schwer.
Der geheimnisvolle Zug an ihm war sein Glaube an die Sterne, der wohl der Zeit anhaftete, bei ihm jedoch eine besondere Form annahm. Als ihn nach Regensburg die Abgesandten des Kaisers von seiner Absetzung verständigen wollten, fanden sie ihn mit dem Studium seiner eigenen Nativität sowie der des Kurfürsten von Bayern beschäftigt. Wie er ihnen mitteilte, ersah er daraus, daß sich der Geist des Kaisers von dem des Kurfürsten beherrschen ließ. Auch versicherte er ihnen, aus den Sternen im voraus ihre Mission gekannt zu haben. In Wahrheit hatte er sie vorher durch eine dritte Person erfahren. Dennoch besteht kein Zweifel, daß ihn, den so real denkenden, rücksichtslos handelnden Mann, vieles zum Großartig-Geheimnisvollen der Natur zog. Offenbar liegen hier die tieferen Wurzeln seiner Persönlichkeit. Am Hof in Wien sagten auch viele von ihm, er habe sich mit Leib und Seele dem höllischen Rachen, dem Teufel, ergeben. Vielleicht hängt mit seiner Liebe zum nächtlichen Himmel, von dem er seine Weisheit herabholte, auch die für ihn verderbliche Neigung zusammen, seine eigenen Pläne in ein geheimnisvolles Dunkel zu hüllen. Denn er ist wohl ein allzu selbstbewußter, ja ungehorsamer Feldherr des Kaisers gewesen, doch kein Verräter. Ferdinand II. sprach es in einem Kriegsrat einmal offen aus, er fürchte, man werde in den übrigen Staaten den Eindruck haben, er sei nicht mehr Herr in seinem Lande, Wallenstein sei sein Corex, sein Mitkönig.
Daß Wallenstein kaiserliche Befehle und Wünsche ablehnte, wußte man in Europa. Dieser Mann, der dem Krieg seinen großartigen Aufstieg verdankte, erstrebte nun, da er älter wurde, leidenschaftlich den Frieden. Um den Hof dazu zu zwingen, ließ er sich schließlich in allzu gewagte Experimente ein. Offenbar ist dies sein tiefster Gedanke, den er einmal dem kaiserlichen Minister, Graf Trauttmansdorff anvertraute: „Er möchte ein Favor bei dem Reich erlangen, daß er auch bei der Tranquillitierung desselben etwas gedient habe.“
Diesem sehnsuchtsvollen Streben entspringen seine verborgenen zwiespältigen Verhandlungen mit Sachsen, Brandenburg, Schweden und Frankreich. Daher sein auffälliges Verhalten seit dem zweiten Generalat und besonders seit dem Tod Gustav Adolfs: der ständige Wechsel der Methoden, das entschlossene Versammeln eines Heeres, um dann nicht anzugreifen, die Friedensverhandlungen, die mit einer überraschenden militärischen Operation endigen, die Drohungen gegenüber dem Kaiser, gegenüber den Schweden, Franzosen oder Spaniern, die den Frieden in Deutschland nicht wollten. So erlebte die Welt mit Staunen das Schauspiel, wie dieser große Feldherr Kämpfe fast ängstlich vermied, wie ihm die Winterquartiere wichtiger wurden als die Schlachtfelder. Die Strategie degradierte er zum Mittel der Politik. Den größten Sieg sah er in dem Besitz eines starken Heeres. Aber diese ungeschlagenen Schlachten, die entgangenen, versäumten Siege machten ihn in den Augen seiner Gegner zum Verräter. Gewiß wollte er die Armee fest in der Hand halten, um den Frieden zu erzwingen, nach dem sich damals, mit Ausnahme der Feldherren,
Soldaten und Politiker, alle Stände sehnten. Eben dadurch schien er sich über den Kaiser erheben zu wollen und geriet in Gegensatz zu der mächtigen spanisch-katholischen Partei. Diese arbeitete an seinem Sturz, weil sie fürchtete, er werde ihre Pläne durchkreuzen. Daß solche Bemühungen Erfolg hatten, dazu trugen die Intrigen seiner Generäle viel bei: des Fürsten Piccolomini, der einer vornehmen italienischen Familie entstammte und sich, obgleich kaiserlicher Generalleutnant, nicht scheute, den Papst - den erbitterten Gegner Ferdinands - über Zahl und Beschaffenheit des kaiserlichen Heeres zu informieren. Er war einer der schlimmsten Hetzer gegen Wallenstein. Dann Graf Matthias Gallas, aus Trient gebürtig, ein mittelmäßiger Kopf, der „Heerverderber“, wie er später genannt wurde, der seine Unfähigkeit nach dem großen Sieg von Nördlingen über die Schweden erwies, und Aldringen, einer der wenigen befähigten Generäle, auch von persönlichem Haß gegen Wallenstein erfüllt. Ferner Graf Balthasar Maradas, Spanier, der, nachdem er das Heer hatte verlassen müssen, bei Hof gegen den Feldherrn arbeitete. Die Gier, mit der diese Männer nach Wallensteins Ermordung dessen Güter an sich zu bringen trachteten, zeigt deutlich, welche Motive sie bei ihren Handlungen leiteten. Freilich hatte Wallenstein seinen eigenen Aufstieg nicht viel weniger rücksichtslos begründet. Wie falsch er übrigens zuletzt das Spiel der Kräfte und seine eigene Stellung einschätzte, bewies sein tragisches Ende. Tragisch nicht nur deshalb, weil Iren und Schotten den Mord ausführten, den der spanische Gesandte in Wien am lautesten und nachdrücklichsten gefordert hatte, sondern weil er in dem Augenblick, da er notgedrungen zum Feind flüchtete, völlig einsam dastand. Denn die Protestanten vermuteten anfangs auch hinter diesem neuen Vorhaben wie gewöhnlich bei ihm eine Kriegslist, und als sie ihm zu Hilfe kamen, war es zu spät.
Eindringlicher und wuchtiger noch als in den führenden Persönlichkeiten und deren Schicksalen enthüllt sich das Wesen der Zeit in der Verbindung von Großem und Hohem mit Entsetzlichem und Barbarischem. Das Göttliche versinkt in ein jahrzentelanges Morden und Rauben. Und doch ist der Zusammenhang klar. Gerade weil sich alles Leben von Gott herleitete, weil es bis in die geringste Alltäglichkeit von ihm erfüllt war, er sich überall offenbarte, weil der Glaube an ihn so selbstverständlich war, wie daß man atmen mußte, weil er seinen Willen in der Heiligen Schrift kundgetan hatte, mochte diese nun direkt ausgelegt oder von der Kirche erläutert werden - eben darum mußte alles, was sich gegen die eigene Meinung vom Glauben und damit gegen Gott richtete, Geister und Gemüter bis in die letzten Tiefen aufwühlen und zum erbitterten Kampf anspornen. Je mehr man Gott liebte, um so mehr haßte man die, die ihn durch abweichende Bekenntnisse schmähten oder verleugneten. Wer Gott auf andere Weise diente wie man selbst, der galt für verfallen seinem Widersacher, dem Teufel. Gott und der Teufel beherrschten die Welt. Und aus der Tiefe der Leidenschaft zu Gott, aus der Finsternis des Lebens heraus, entstand der Haß gegen alle übrigen Konfessionen, erstanden im hingebungsvollen Suchen nach der Wahrheit immer neue Sekten.
Es war auch natürlich, daß Religiöses sich mit Politischem vermengte und daß die immer vorwaltenden, niedrigen menschlichen Triebe sich beider bedienten, um ihren eigenen Lüsten zu frönen. Aber wie sollten die Söldner: Iren, Schotten, Niederländer, Wallonen, Kroaten, Polen, Kosaken, die an nichts dachten als an Sold und Raub, sowie die regulären fremden Armeen der Schweden, Spanier, Franzosen, verwirklichen, wovon religiöse Sehnsucht träumte, was Luther oder Loyola gelehrt hatten? Auch das vorangegangene sechzehnte Jahrhundert hatte gesehen, wie Söldnerheere in Städten auf entsetzliche Weise hausten. Es hatte die Bartholomäusnacht, die Bauernrevolten erlebt. Es bedurfte immer nur eines Anlasses, damit ein Teil der Menschen sich voll Raserei auf den anderen stürzte. Dadurch, daß der Dreißigjährige Krieg den gemeinen Instinkten Zeit, Raum und Gelegenheit gab, sich zu entfalten, machte er sie zu Herrschern über die Völker. Nicht die Schlachten, in denen sich die Heere bekämpften, waren das Schrecklichste, sondern der unaufhörliche Krieg zwischen den Schlachten, die Herrschaft des Schwertes auch dort, wo es keinen bewaffneten Feind gab, der Vernichtungskampf der Söldner gegen die Bürger und Bauern. Es wurden Dörfer und Städte angezündet, Kinder, Frauen, Knaben geschändet, Ehemänner und Eltern gezwungen, zuzusehen, wie die Soldaten ihre Frauen und Töchter öffentlich prostituierten. Man riß den Bauern mit Zangen das Fleisch vom Leib, man schnitt ihnen die Haut in Riemen vom Rücken, man trieb in ihre Leiber Hölzer, goß ihnen Pech, Blei und Unflat in Ohren, Nasen, Mund, zog durch ihre Zunge ein Roßhaar und marterte sie damit. Sie wurden lebendig vergraben, in Ofenröhren gesteckt und verbrannt, man schnitt ihnen Hände und Füße, Nasen und Ohren, den Frauen die Brüste ab.
Aber wehe all den Städten, die von Feinden erobert wurden. Aus der Feuersglut, die in diesen Jahren zum Himmel stieg, leuchteten am grellsten die Flammen von Magdeburg auf. Dessen Vernichtung erschütterte selbst die Zeit, der das Entsetzliche zur Gewohnheit geworden war. Gerade Magdeburg wurde aber vermutlich nicht das Opfer einer Brandstiftung, sondern ein Sturm trieb Feuer, das bei der Eroberung durch Tilly ausbrach, über sie und äscherte sie ein. Von etwa zweitausend Häusern der Stadt blieben kaum hundert stehen, und von diesen waren die meisten kleine Fischerhütten, die außerhalb der Stadt am Flußufer lagen, wohin das Feuer nicht drang. Zwanzigtausend Bürger kamen bei den Kämpfen um, verbrannten entweder in den Flammen, wurden von den zusammenstürzenden Häusern erschlagen, erstickten in den Kellern, in die sie geflüchtet waren, durch Rauch oder wurden von den Soldaten ermordet. Der Tod hauste in vielerlei Gestalten und in verschwenderischer Weise. Wo das Feuer ihnen nicht den Platz streitig machte, mordeten und plünderten die Söldner, die bei diesem großen Fest der Vernichtung ihren Anteil forderten. Tausende von Toten warf man einfach in den Fluß, weil niemand Zeit und Lust hatte, sie zu begraben. Erst am vierten Tag der Eroberung ließ Tilly durch Trommelschlag den am Leben gebliebenen Bürgern Pardon und Sicherheit verkünden.
Obgleich die Größe Gustav Adolfs aus dem Krieg erwuchs, hebt sich seine Gestalt um so strahlender von der Düsterkeit und Verworrenheit der Zeit ab. Die Ethik und Strenge seiner Auffassung geht aus seinen Kriegssatzungen mit aller Deutlichkeit hervor. Im Gegensatz zu Wallenstein, verbot er das Duell im Lager. Wem nachgewiesen wurde, daß er eine Frau genotzüchtigt habe, der wurde gehängt. Dirnen duldete er nicht beim Heer. In Wallensteins Lager bei Nürnberg sollen sich deren fünfzehntausend befunden haben. Dagegen durfte der schwedische Soldat seine Ehefrau in den Krieg mitnehmen. Wie sehr sticht auch von der sonstigen Auffassung der Zeitgenossen dieser Grundsatz ab: „Die Ordnung unter den Soldaten muß aufrechterhalten werden und den Bürgern Gerechtigkeit widerfahren.“ Der Schwedenkönig unterschied sich von den meisten deutschen Fürsten seiner Zeit darin, daß er Geld und Kraft für große Unternehmungen opferte, während sie nur Sinn für Prunk und Wohlleben hatten. Der Ausspruch, sein größtes Glück bestehe darin, daß er beruhigt in den Armen jedes seiner Untertanen schlafen könne, erhebt ihn über die anderen Fürsten seiner Epoche.
Sieht man von seinem gelegentlichen Jähzorn ab, der ihn ehrt, sofern er sein leidenschaftliches Empfinden, sein heißes Blut verrät, der ihn aber auch zu Ungerechtigkeiten fortriß, so wird man schwerlich auch nur einen schlechten Charakterzug an ihm entdecken. Vielmehr liegt sein eigentliches Wesen in dem Zusammenklang so vieler edler Eigenschaften. Er diente Gott und seinem lutherischen Glauben mit reiner leidenschaftlicher Hingabe. Gotteslästerung wurde bei Soldaten mit dem Galgen bestraft. Von Strenge und Humanität zugleich zeugt die Bestimmung, der zufolge der Geistliche, der im Lager die Stunde des Gebetes versäumte, den Sold eines halben Monates an das nächste Spital abzuliefern hatte. Doch zeigte er sich auch den Katholiken gegenüber duldsam, nicht nur wegen seiner Abmachungen mit dem katholischen Frankreich, sondern weil seine eigenen Anschauungen ihm das geboten. Nächst Gott war ihm das teuerste Gut sein schwedisches Vaterland. Gott, Vaterland und Krieg, in diese drei Begriffe verschmolz für ihn sein entscheidendes Tun. Er selbst dichtete Psalmen, die er dann vor der Schlacht im Angesicht seines Heeres sang. Gott bedeutete für ihn die höchste Hoffnung, Gewißheit und Zuflucht, er gab den Pflichten und Arbeiten seines Lebens Sinn. So vergaß er über der Erde nie den Himmel, aber auch über dem Himmel nie die Erde. Aus diesem Gefühl der Verbundenheit des Irdischen mit dem Göttlichen kam bei aller seiner Stärke seine fast kindhafte Zuversicht dem Schicksal gegenüber. Daher auch sein schönes reines Verhältnis zu den Menschen. Er war ein ergebener Sohn, ein treuer Gatte, ein unendlich liebevoller Vater, ein unerschütterlicher Freund. Bei aller Vertrautheit lag aber so viel natürliche Würde in ihm, daß sich der Abstand zu ihm von selbst ergab.
Ein Brief, den er etwa ein Jahr vor seinem Tod, am 14. Dezember 1631, an Oxenstierna richtete, zeigt die Größe und die Vorzüge seines Herzens. Was er in diesem Schreiben ausspricht, beschäftigte ihn schon lange und oft. Eine besondere Gelegenheit brachte seine geheimsten Gedanken und Gefühle zutage: Obgleich erklärte er, Unsere Sache gut und gerecht ist, bleibt doch der Ausgang des Krieges wegen der Erbsünde ungewiß. Man kann auf das Leben des Menschen nicht bauen. Wenn Uns zustößt, was die Bestimmung der menschlichen Natur und ihr Ziel ist, so verdient Unsere Familie Ihr Mitgefühl, sowohl um Unseretwillen, als auch wegen vieler anderer Gründe. Sie besteht nur aus zwei Personen des schwachen Geschlechtes, der unerfahrenen Mutter und der jungen, noch im kindlichen Alter stehenden Tochter. Ihre Lage ist ebenso gefährdet, wenn sie selbst herrschen, wie wenn sie von anderen beherrscht werden. Die natürliche Zuneigung als Gatte und Vater läßt Uns über diese Frage so offen zu Ihnen sprechen, zu Ihnen, den Uns Gott sandte, nicht nur zur Durchführung einiger großer Angelegenheiten und um drohende Gefahren abzuwenden, sondern auch um alles in Ordnung zu halten, was Uns in dieser Welt am meisten am Herzen liegt und was Wir dennoch Gottes heiliger Entschließung anvertrauen, gleich Unserem Leben und allem, was Wir von Seiner Freigebigkeit besitzen.
Gustav Adolfs Verhältnis zu Oxenstierna beruhte auf der Abgeschlossenheit zweier starker Persönlichkeiten, die sich in der Achtung, die sie füreinander hegten, sowie in der Liebe zum gemeinsamen Vaterland fanden. Sie durften sich gegenseitig bekennen, daß sie sich durch ihre Temperamente ergänzten. Um sich ergänzen zu können, dazu mußten sie in den Grundzügen ihres Wesens sehr verschieden sein. Dem König wies sein phantasievoller Genius den Weg, den er zu gehen hatte. Bei allem klaren Denken trieb ihn eine unbewußt gärende Kraft zu einem Ziel, das er selbst noch nicht vor sich sah. Ihm entströmten die gewaltigeren Impulse, das Schöpferisch-Fortreißende. Vom Kanzler kam die herrliche Weisheit und Besonnenheit, die kalt durchdringende Erwägung aller Umstände, die überragende Kenntnis von Menschen und Verhältnissen. Wenn je aus Gegensätzen eine Eintracht entstand, so war das hier der Fall.
Oxenstierna blieb nach Gustav Adolfs Tod in Deutschland. Trotz des unermeßlichen Verlustes, den dieser bedeutete, trotz der sich steigernden Schwierigkeiten, arbeitete er unermüdlich und unverzagt daran, die deutschen Protestanten zum Kampf gegen den Kaiser fortzureißen und dabei Schweden die Führung zu wahren. Ein großer Sieg der kaiserlichen Truppen bei Nördlingen über die Schweden bewog ihn dann, nach Paris zu Richelieu zu reisen, um die französische Hilfe wirkungsvoller zu gestalten. So tat Oxenstierna das Seine, um eine militärische Niederlage in einen diplomatischen Sieg zu verwandeln. Frankreichs Rolle machte es offenbar, daß, obgleich der Krieg in Deutschland mit unverminderter Wucht weiterging, die religiösen Impulse, die ihn entzündet hatten, allmählich erloschen. Immer stärker drängten die politischen Beweggründe und Interessen in den Vordergrund. Sie hielten die Welt in angstvoller Spannung und jagten die Heere gegeneinander. Zunächst verschlechterte sich noch die Lage für Schweden. Sachsen schloß 1635 in Prag seinen Frieden mit dem Kaiser. Brandenburg sollte ihm bald nachfolgen. Oxenstierna erklärte mit eiserner Beharrlichkeit, man müsse lieber mit den Waffen in der Hand untergehen als weichen. Dabei empörte sich sogar seine eigene Armee gegen ihn und hielt ihn fast drei Monate in Magdeburg als Geisel gefangen, bis ihre Geldforderungen befriedigt waren. Diese Armee bestand freilich nicht mehr wie zur Zeit Gustav Adolfs aus Schweden, sondern wie die anderer Länder aus Söldnern. Kaum ein Fünftel der Soldaten gehörte der schwedischen Nation an. Nunmehr anerkannte man auch auf schwedischer Seite den Grundsatz, daß der Krieg den Krieg ernähren müsse. Das war ein furchtbares Wort, oder vielmehr ein Wort, das eine furchtbare Wahrheit zu verbergen und gefällig zu machen suchte. Es war ein Versuch, die Greuel der Zeit in eine wirtschaftliche Formel zu bringen.
Als sich die Verhältnisse für Schweden günstiger gestalteten, kehrte Oxenstierna im Jahre 1636, nach langer Abwesenheit, in seine schwedische Heimat zurück.
Damals war Königin Christine zehn Jahre alt.
2. Der jugendliche Genius
Christine war das letztgeborene Kind Gustav Adolfs und Marie Eleonores, aber sie wurde Erbin, weil sie von allen als einziges am Leben blieb. Sie war ein Kind der Liebe und des Krieges. Marie Eleonore erwartete im März 1626 in Reval des Gatten Rückkehr von den polnischen Schlachtfeldern. Sie traten die Rückreise nach Schweden gemeinsam an. Bereits in Finnlands Hauptstadt, Abo, fühlte sie sich Mutter. Krieg und Liebe sind ja auch die Mächte, in deren Zeichen die Ehe Gustav Adolfs und Marie Eleonores stand. Alle Träume und Prophezeiungen kündigten damals den Eltern die Geburt eines Sohnes an. Die Astrologen weissagten auch, daß entweder das Kind oder die Mutter oder der Vater dabei sterben würden. Überlebe aber das Kind die ersten vierundzwanzig Stunden, dann sollte aus ihm etwas Großes werden. Die Ankündigung ist nichts weiter als ein wohlerwogenes Gemisch von bedrohlichen und hoffnungsreichen Voraussagen, geeignet, höchste Spannung zu erzeugen. Die rauhe Stimme des Neugeborenen und seine starke Behaarung erweckten, zusammen mit der angeführten Prophezeiung, im ersten Augenblick wirklich den Eindruck, als sei das Neugeborene ein Knabe. Die Freudenkunde verbreitete sich eilends im königlichen Schloß in Stockholm. Dem glücklichen Wahn hinkte die Erkenntnis der Wahrheit nach. Die Frauen, die der Geburt beigewohnt hatten, wagten es zunächst nicht, ihren Irrtum zu bekennen und den kaum entflammten Jubel des Herrscherpaares wieder zu ersticken. Endlich entschloß sich des Königs Halbschwester Katharina, Gustav Adolf die schmerzliche Kunde zu überbringen. Sie enthielt sich dabei aller Worte und überließ es der Natur, den Vater über das Geschlecht seines Kindes aufzuklären. Sie zeigte es ihm nämlich auf eine Weise, daß er erkennen mußte, ihm sei ein Mädchen geboren worden. In dieser Enttäuschung erwies er seine Seelengröße. Als die Prinzessin Katharina tröstend bemerkte, er und die Königin seien noch jung genug, um einen männlichen Erben zu bekommen, nahm er das Kind zärtlich auf den Arm und sagte, er hoffe, daß dieses Mädchen ihm einen Knaben ersetzen werde, und da Gott sie ihm gegeben habe, wolle er ihn auch bitten, sie ihm zu erhalten. Der Königin wurde der entdeckte Irrtum erst später mitgeteilt. Sie soll darunter anfangs gelitten haben. Vermutlich nicht so sehr ihretwegen, sondern weil sie, als liebende Frau, den natürlichen Wunsch hegte, dem Gatten und König den ersehnten männlichen Erben zu schenken. Den Schmerz der schönen Frau mag vermehrt haben, daß die Tochter wirklich häßlich aussah.
Die geheimnisvollen Begleiterscheinungen vor und während Christines Geburt fanden damit nicht ihren Abschluß. Auf Gustav Adolfs Befehl wurde die offizielle Geburtsfeier so begangen, als sei ein Sohn zur Welt gekommen. Diese Maßnahme erfolgte aus einem sehr realen Beweggrund. Man wollte die polnischen Könige, die ebenfalls der Familie Wasa angehörten und sich als die eigentlichen gesetzlichen Herrscher Schwedens betrachteten, warnen, sich mehr Hoffnungen auf den schwedischen Thron zu machen, weil ein Mädchen ihn einmal besteigen sollte. Von ihrer Taufe berichtet Christine noch einen Vorfall, der, wenn er wahr wäre, die Komödie der Irrungen vollendet hätte. Der Geistliche, der die Taufe vollzog, soll ihr, ganz gegen den Brauch der lutherischen Kirche, das Zeichen des Kreuzes mit Weihwasser auf die Stirne gemacht haben. Sie behauptet auch, ihrem Vater sei vorausgesagt worden, sie werde in einem anderen als dem lutherischen Glauben sterben. Als sie etwas über ein Jahr zählte, erkrankte sie ernsthaft. Gustav Adolfs Angst, solange sie in Gefahr schwebte, war ebenso groß wie sein Jubel über ihre Rettung. Die Zweijährige bereitete ihm eine besondere Freude, als sie in der Festung Kalmar bei dem Donner der Salutschüsse keine Angst zeigte, sondern in kindlicher Begeisterung in die Hände klatschte. Die Furchtlosigkeit seiner Tochter gefiel dem Krieger-König. Daraufhin nahm er sie gerne zu Musterungen mit, die damals, zur Zeit der Vorbereitung des deutschen Krieges, noch zahlreicher als sonst waren.