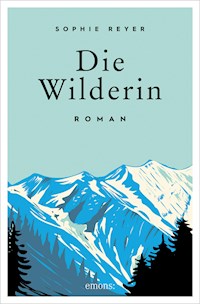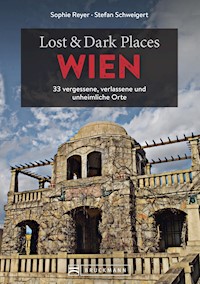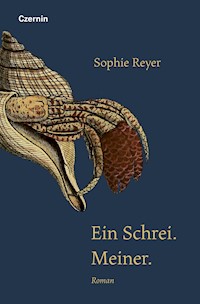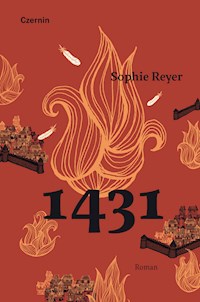Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Historische Fakten und phantasiereiche Fiktion kunstvoll verwoben zu einem besonderen Roman. Wien 1909: Der junge Historiker Johann ist fasziniert von der schönen Clara, die zusammen mit ihrem Mann Egon und den beiden Kindern in die benachbarte Villa im wohlhabenden Viertel Hietzing einzieht. Clara pflegt einen extravaganten Lebensstil, doch dann ereilt die Familie ein schreckliches Schicksal: Bei einem Arbeitsunfall verliert Egon ein Bein. Aber war es tatsächlich ein Unfall? Es gehen Gerüchte um, und die makellose Fassade von Clara beginnt zu bröckeln – was verbirgt die engelsgleiche Frau?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sophie Reyer wurde 1984 in Wien geboren, wo sie auch heute lebt. Nach dem Studium an der Kunsthochschule für Medien Köln erlangte sie 2017 den Doktor der Philosophie in Wien. Sophie Reyer hat bereits zahlreiche Theaterstücke sowie Romane geschrieben, die unter anderem bei S. Fischer, Edition Atelier oder Czernin erschienen. Sie erhielt 2010 und 2013 den Literaturförderpreis der Stadt Graz und 2013 den Preis »Nah dran!« für das Kindertheaterstück »Anna und der Wulian«. Sie gibt zudem Lehrgänge für Film-, Medien- und Theaterwissenschaft an der Uni Wien und der Pädagogischen Hochschule Hollabrunn.
Dieses Buch ist ein Roman. Teile der Handlung sind inspiriert von der Wiener Serienmörderin Martha Marek. Die beteiligten Figuren und deren Handlungen sind in weiten Teilen erfunden.
© 2021 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: Josephine Cardin/Arcangel.com
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
Printed in Germany 2021
ISBN 978-3-96041-785-9
Roman
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Kossack GbR, Hamburg.
Prolog
Zuerst war rote Farbe. Waren fremde Hände, die sich in sie schoben. Es roch nach Sommer und Tannennadeln, und von weit her kreischte ein Vogel. Ein Lied fiel ihr ein, das alt war und vermischt mit einem lange zurückliegenden Gefühl: Es begann in etwa so: »Kiwitt, kiwitt!« Das Lied hatte mit der Mutter zu tun, mit ihrem hellen Haardutt und den großen, traurigen Augen, dem Geschmack ihrer Brüste und den feinen Berührungen ihrer Finger. Die anderen Hände waren groß und grob. Zu wem gehörten sie denn? Zu wem nur? Und was war das für ein Lied? Sie versuchte, sich zu erinnern, doch die Farbe schwappte immer wieder in Wellen über sie, sodass sie schließlich die Augen schloss und irgendwann, viel später, wieder auftauchte, in einer anderen Zeit, in einem anderen Leben.
Früher
Du weißt noch: Alles beginnt mit der Mutter. Immer beginnt es mit der Mutter. Wie eine erste Wunde ist sie, oder? Jedenfalls: Du wirst geboren. Erinnere dich. In eine Welt hinein. Eine Kaiserhauptstadt, die sich Wien nennt. Diese ist ein Gewebe aus vielen Kulturen in jenen Tagen. Ja: so ist dein Anfang, Clara. Es ist ein Herbst, in dem du beginnst. Ein Herbst, in dem der Wind am Fenster der Wohnung rüttelt. Wie ein wilder Gesang klingt es. Es gibt keinen Vater, wird die Mutter dir später erzählen. Aber noch ist das egal. Deine frühe Kindheit besteht aus Geräuschen. Aus Sprachfetzen, die zu dir hineindringen, zu euch, der Mutter und dir, in die bescheidene Wohnung hinauf. Dass ihr arm seid, lernst du früh: An der Bassena muss man sich waschen, und Zucker ist kostbar. Und die Menschen böse. Das sagt die Mutter zwar nicht, doch du spürst es. Und ziehst früh vor allen den Kopf ein. Laut ist die Welt. Da tummeln sich die Kinder im Hof, brabbeln mit kindlichen Stimmen, da ruft immer wieder ein Zeitungsverkäufer nach Kundschaft.
»Birnen hama da!«, tönt es, und du weißt, es ist die Frau von der Trafik, die die Leute auf der Straße anzuwerben versucht. So beginnst du, Clara, oder?
Erster Teil
Neuland
1
»Hast du deinen Teddy eingepackt?«, fragte die Mutter.
Josef saß auf dem Bett und schaute ins Leere, während er mit der bestickten Decke spielte.
»Josef!«, sagte seine Mutter erneut und ging zu ihm.
Nun blickte er auf. Sah in das freundliche, offene Gesicht, das ihm entgegenlächelte.
»Na, kleiner Mann?«
Die Mutter setzte sich Josef zu Füßen hin und fixierte ihn mit ihren dicht bewimperten Augen. Josef merkte, wie seine Lippen sich zu einem kleinen, verhuschten Lächeln formen wollten, doch noch leistete er Widerstand und fuhr mit dem Zupfen an der Decke fort. Die Mutter sollte nicht glauben, dass er so einfach wieder zu beruhigen wäre.
»Ich bin nicht klein«, murmelte er also nur.
»Entschuldige bitte!« Die Mutter griff nach dem Teddy, der mit ausgebreiteten Armen auf Josefs Kopfkissen lag, getaucht in die ersten Sonnenstrahlen des Morgens, und nahm ihn aus dem Licht und auf ihren Schoß. »Ich glaube, Teddy freut sich schon!«, sagte sie, sah ihn erneut an und lächelte.
Josef betrachtete die Mutter. Es war schwierig, sie nicht zu mögen. War schwierig, nicht zu lächeln, wenn man in ihre braunen Augen, in ihr helles Gesicht guckte. Immer schon war für Josef ein Raum mit Mutter besser gewesen als einer ohne.
»Nein, das tut er nicht«, entgegnete er trotzdem bockig.
Seine Mutter verdrehte ihre großen Augen.
»Aber wieso denn bloß nicht, kleiner Mann?«, wollte sie wissen und schob die Unterlippe ein wenig über die Oberlippe, wie sie es immer tat, wenn sie schmollte.
»Er will nicht schon wieder umziehen!«, sagte Josef und baumelte leicht aggressiv mit den Beinen hin und her.
»Ach so, ich verstehe.« Die Mutter legte ihm eine Hand auf den Unterschenkel.
»Und ich übrigens auch nicht!« Josef ließ die Decke los und sprang vor der Mutter auf den Boden. Er griff nach dem Teddy, den sie immer noch an die Brust gepresst hielt, zog ihn an sich und wollte mit ihm in Richtung Tür stapfen. Die Hand der Mutter aber hielt ihn sanft an der Schulter fest.
»Josef«, sagte sie, und er spürte ihren Atem im Nacken, der warm war und gut roch, nach einer Mischung aus Milch und Honig vielleicht.
Sollte er sich umdrehen? Nein, die Freude würde er der Mutter diesmal nicht tun.
»Ich hab’s satt«, sagte er. »Das ist der dritte Umzug in einem Jahr.«
»Aber ist es denn jemals schlechter geworden?«
Für einen Moment schien es, als stünde ein schwarzer Schatten in der Mitte des Zimmers. Josef zuckte zusammen, drehte den Kopf zur Seite und kniff die Augen zu schmalen Schlitzen. Stand da tatsächlich ein dunkler Schemen? Am Ende sogar mit aufgefalteten schwarzen Flügeln? Josef bebte, während er mit den Augen rollte und dann noch einmal genauer hinsah. Nein, da war nichts. Seine Mutter hatte bloß das Fenster geschlossen und die Vorhänge zugezogen.
»Ist alles in Ordnung?«, fragte sie und legte eine Hand auf seinen Kopf.
Josef nickte und drückte den Teddy fest an seinen Bauch. Schon wieder ein neues Haus, dachte er. Das würde wieder brauchen, bis Teddy und er sich wohlfühlen würden. Er seufzte und ließ sich von der Mutter aus seinem Zimmer ziehen. Das mit altem Leinen bezogene Bett, den leeren Schrank und die seltsam vergreist aussehenden wenigen Möbel, mit denen sein Kinderzimmer eingerichtet war, ließ er traurig zurück.
Früher
Zum Donaukanal zieht es dich hin, früh bereits. Mit dem Nachbarsjungen. Denn die Wohnung ist eng und dunkel. Weißt du noch, Clara? Da spielt ihr untertags, wenn es warm genug ist. Für dich bedeutet der Weg ans Ufer des Flusses eine Weltreise. Die zehn Minuten, die du die Straße bergab gehst, kommen dir lang und gefährlich vor. An den Rand der Straße flüchtest du, sobald einer der Zeitungsverkäufer mit seinem Leiterwagen kommt, weichst zurück vor den Kutschen und den vereinzelten Automobilen, deren Auspuffe laut knattern. Denn: Die Welt ist böse. Das hast du von der Mutter gelernt, oder? Da zieren vereinzelte Bäume die Straße, deren Blüten im Sommer aussehen wie Watte, rosig, regen zum Träumen an. Als würden den Bäumen Wolken wachsen, denkst du. Und dass die Bäume klingen, aber anders als Worte. Die Bäume klingen als Wind! Erinnere dich: »Wart!«, rufst du dem Nachbarsjungen zu.
Füße laufen, straucheln, du folgst dem Jungen zum Ufer, der schon eifrig beginnt, Wasser in einen kleinen Holzkübel zu schöpfen.
»Ich koch jetzt Suppe«, sagt er. »Für den Vater.«
Du nickst. Du weißt, dass man so etwas eigentlich hat: einen Vater. Alle, nur du nicht. Egal, du hast einen Großvater, oder? Und noch ist der Tag magisch. Du lernst also von dem Nachbarsjungen, übernimmst die Gesten, die Worte, die Art zu gehen. Lässt dich von ihm auf eines der Bänkchen am Fluss ziehen, als er seine Schöpfarbeit beendet hat. Das Bänkchen ist grün lackiert und hat Spalten. Wie sich das seltsam anfühlt unter den Pobacken! Clara, noch bist du klein. Du schlenkerst mit den Beinen. Gemeinsam seht ihr in die Ferne und trinkt von dem Wasser der Donau, das ein bisschen lehmig schmeckt. Sonst geschieht nichts. Die Sonne brennt, Hitze sticht. Hin und wieder ein Vogel am Himmel, der gurrende Schreie ausstößt. Du baumelst mit den Beinen in die Tiefe, legst den Kopf schräg und siehst in den Himmel. Der erscheint dir so weit, dass dir mit einem Mal fast ein wenig bang ist.
»Wo hört der Himmel auf?«, fragst du den Nachbarsjungen.
»Der Himmel, der hört nicht auf«, entgegnet er.
»Woher weißt du das denn?«, bohrst du nach.
»Hat der Vater gesagt.«
Schon wieder das Wort: Vater. Weißt du noch, Clara, in dir wird es plötzlich doch schwer. Aber du nickst und tust wissend, obwohl du keine Ahnung hast, was das bedeutet, wenn etwas nicht aufhört. Können die Worte überhaupt in einen Rahmen fassen, was sie beschreiben? Manchmal kommt dir alles unendlich fremd vor, du betrachtest deine Glieder wie eigenartige Gebilde, die nicht zu dir gehören. Genauso, wie die Dinge nicht zu den Worten gehören. Nicht ganz. Nur fast. Ja: So siehst du dich an, Clara.
»Iss, Clara!«, sagt da der Nachbarsjunge und hält dir eine Semmel hin. Du nestelst nach der Milchflasche, die du in deinem Schürzchen verstaut hast, und reichst sie ihm.
Gemeinsam stopft ihr Semmeln und Milch in euch hinein, bis euch fast schlecht wird, sich alles aufbauscht in den Mündern. Du kannst gar nicht mehr hinunterschlucken, Clara, ehrlich! Aber satt bist du, endlich, und das ist selten, denn die Mutter hat wenig Geld. Jetzt willst du dich nur an die behagliche Schulter des Nachbarsjungen lehnen und schlafen. Du seufzt. Der Nachbarsjunge sitzt neben dir und riecht nach Milch und Sonnenbrand.
In dem Moment hüpft etwas vom benachbarten Baum auf euch herab. Du siehst eine Art Schliere in der Luft, die geschmeidig auf dem Erdboden vor euch aufkommt. Was ist denn das?
»Ein Kätzchen!«, ruft der Nachbarsjunge aus.
Schon wieder ein neues Wort, denkst du. Die Worte machen dir manchmal Angst, und manchmal geben sie Sicherheit. Wenn sie in einem Märchen sind zum Beispiel. Später wirst du deinen Männern Märchen erzählen, und du wirst gut darin sein, wirst daran glauben. Egal: Jetzt bist du klein. Schwer jedenfalls ist es auszusprechen, man muss es förmlich zerkauen: Kät-z-chen! Und wie das aufspringt im Rachenraum! Der Nachbarsjunge hebt das Tier hoch, schiebt es zwischen euch auf die Bank. Du staunst. Kätzchen ist also ein Fellbündel, das jetzt zwischen euch sitzt und leise maunzt. Es hat gezackte Ohren und Augen wie Knöpfe, es ist winzig und trotzdem am Leben, kaum zu glauben! Du schaust und schaust und kannst es nicht begreifen. »Kätzchen.«
»Das müssen wir mit heimnehmen«, sagt der Nachbarsjunge und lächelt.
»Ja!«, findest auch du, die du ohnehin alles findest, was der Nachbarsjunge findet. Du bestaunst das Tier.
»Kätzchen« hat eine rosige Zunge, mit der es leckt, und Kätzchen passt in eine Hand. Du denkst, dass du »Kätzchen« lieb hast. Und auf einmal hast du Angst, es könnte verwundet werden. Die Spitzhacke der Mutter in der Küche fällt dir ein. Aber du schiebst den Gedanken rasch weg.
2
Clara kam, schien es, mit dem Wind. Johann Glücksstein saß gerade am Schreibtisch, wie er es jeden Morgen tat, und ließ seinen Blick über die Straße schweifen. Vereinzelt gab es Schnee auf dem Fußweg neben den Villen, die streng, edel und hochgewachsen vor ihm dalagen. Die Bäume in der Allee sahen dürr und knorrig aus. Auch die Linde im Garten der Villa schräg gegenüber, die Johann während seiner Arbeit immer wieder betrachtete, bot einen nur ärmlichen Anblick. Johann kniff die Augen zusammen und bildete sich ein, an einzelnen Ästen schon kleine Blüten aufspringen zu sehen. Bald würde der Frühling kommen, dachte er, hoffte er. Johann mochte die Winter nicht. Sie krochen ihm, der ohnehin an Anämie litt, in die Glieder, sie zehrten und machten ihn traurig. Aber bald würde Ostern herannahen, und die Mutter würde der Haushälterin Felicitas wieder auftragen, Palmkätzchen zu kaufen. Sie würde die bunt bemalten Eier in die Zweige der Palmkätzchen hängen und dabei leise nach innen lächeln. Johann mochte diese Form von Kitsch eigentlich nicht, sie war ihm zu sentimental, doch seit Vaters Tod war er sanfter mit der Mutter und freute sich über jede lebensbejahende Regung, die sie von sich gab. In diesem Moment klopfte es an der Tür.
»Ja«, sagte Johann, und herein kam, wie zu erwarten, Felicitas.
»Herr, das Frühstück.«
Johann nickte gedankenverloren, ohne seinen Blick von der Straße zu wenden. Ein Blatt hatte sich von einem Ast gelöst. Stille. Felicitas räusperte sich.
»Ich nehme an, Sie gedenken, in Ihrem Zimmer zu frühstücken?«
Johann riss sich aus seinen Träumereien. »Ja, Felicitas, verzeihen Sie bitte. Das tue ich.«
Die Haushälterin nickte und zog sich das Häubchen, unter dem sich eine rötliche Haarlocke gelöst hatte, etwas tiefer in die Stirn. Johann betrachtete die alte Frau und merkte, wie ihn Sanftmut beschlich. Felicitas war klein und hässlich, die Nase erinnerte an den Schnabel eines Adlers, die Augen lagen zu nah beieinander, der Blick schielte etwas. Ihre Haut war hell und trocken und übersät mit Sommersprossen. Früher hätte man Frauen wie sie wahrscheinlich als Hexe verbrannt, dachte Johann und lachte sich gleichzeitig selbst aus. Dass er auch immer an seine Arbeit denken musste! Er war Historiker, spezialisiert auf das Mittelalter, und manchmal verschwand er mit seiner Nase in Geschichtsbüchern wie ein Maulwurf unter der Erde.
»Herr?«
Johann sah auf und räusperte sich verlegen, denn er merkte, dass er schon wieder die ganze Zeit geschwiegen hatte.
»Ja, es ist gut, Felicitas«, sagte er darum ein bisschen rau. »Bringen Sie es ins Zimmer.«
»Das Übliche?«
Johann nickte.
Felicitas buckelte ein wenig vor ihm, zog den Kopf ein wie eine Schildkröte und sagte, als hätte sie es auswendig gelernt: »Ein gekochtes Ei, nicht zu hart, nicht zu weich. Ein Kaffee, keine Milch, nur Zucker. Drei Scheiben Schwarzbrot, Marmelade, Schinken.«
»Wunderbar«, murmelte Johann und merkte, wie sein Blick schon wieder aus dem Fenster glitt. »Und sagen Sie der Frau Mutter, ich werde mit ihr zu Mittag speisen. Was macht sie denn so im Moment?«
Felicitas sah zu Boden und zuckte mit den Schultern. »Das Übliche«, sagte sie.
Das hätte er sich denken können.
»Sticken also.« Johann spürte, wie ihm ein leichter Stich ins Herz fuhr. Seit dem Tod des Vaters war seine Mutter mehr und mehr in ihre eigene Welt geflüchtet. Sie schien sich in den Strukturen der Stickmuster zu verlieren und kaum noch auf das zu achten, was um sie herum geschah, so wie er, Johann, sich in seinen Büchern verlor. Felicitas kannte ihn wahrscheinlich inzwischen gut genug, um zu wissen, was er dachte. Sie nickte traurig und zog den Kopf etwas mehr ein, bevor sie schweigend das Zimmer verließ. Johann aber hatte sich bereits wieder seinem Schreibtisch zugewandt. Das Geräusch des Sessels, den er nach hinten schob, ließ ihn kurz zusammenzucken. Er nahm sein Buch zur Hand und sah erneut aus dem Fenster, bevor er sich in seine Studien vertiefte. Doch schon nach kurzer Zeit drangen Geräusche an sein Ohr.
Johann erhob sich und blickte nach draußen. Ein Auto fuhr auf den Kiesweg vor der Villa gegenüber ein. Da waren sie also, erinnerte er sich. Seine Mutter hatte erzählt, dass die Villa an ein junges Ehepaar verkauft worden war, das mit zwei Kindern dort einziehen würde. Der Gedanke stimmte ihn froh. Vielleicht würden die beiden Kinder seiner Mutter ja helfen, wieder Mut zu schöpfen und Freude im Leben zu finden. Er selbst hatte keine Frau und auch keine Nachkommen, und er spürte, wie sehr seine geliebte Mama diesen Rückhalt im Moment brauchen würde.
Er schaute auf die Straße. Die Wagentür öffnete sich, und ein junger, athletischer Mann mit Melone und Stock stieg aus, gefolgt von einer Frau. Als Johann genauer hinblickte, erschauderte er. Sie schien älter zu sein als ihr Gatte, setzte ihre Schritte weiser und überlegter. Das Kleid war hell und wallend, sie trug weiße Handschuhe und ein samtenes Hütchen auf dem blonden Lockenkopf. Johann kniff die Augen zusammen und sah, wie sie eine der hinteren Türen öffnete und zwei Kinder von den Rücksitzen scheuchte. Sie zog die beiden – ein blond gelocktes Mädchen und einen Jungen mit hellem, wuscheligem Haar – nun neben sich her über den Kiesweg, der zu den Treppen der Villa hinaufführte. Johann sah ihren schlanken Rücken, sah die Schultern und den Nacken, denn das Haar war hochgesteckt. Der Junge – der im Übrigen das ältere der beiden Kinder zu sein schien – zog einen kleinen, struppigen Teddy hinter sich drein. Er wandte für einen Moment den Kopf. Nahm er wahr, dass Johann ihn beobachtete?
Johann sah, wie der Blick des Jungen langsam in die Höhe glitt und schließlich haltmachte, ihn mit traurigem Ausdruck fixierend. Peinlich berührt biss Johann sich auf die Unterlippe und wandte sich ab. War er tatsächlich so einsam, dass er es notwendig hatte, Fremden hinterherzustarren? Er setzte sich zurück an den Tisch und dachte nach. Das tiefe Bedauern in den Augen des Jungen hatte ihn berührt, und er erinnerte sich an den Ausdruck seiner Mutter nach dem Tod des Vaters. Ob es Sinn ergab, die beiden zusammenzuführen? Der Gedanke gefiel ihm nicht schlecht. Johann merkte gar nicht, wie er zu lächeln begann, als er das Buch aufklappte und zu lesen anfing.
Früher
In deiner Kindheit gibt es wenig Wärme. Eng ist die Wohnung, und früh atmet eine Angst in ihr. Sie hat eine rote Farbe, diese Angst. Ob sie von der Mutter kommt? Bald begreifst du: Zu einer Mutter gehört ein Vater. Du jedoch hast keinen, Clara. Aber du bist klein, und wer klein ist, tröstet sich. Ja. Es gibt den Großvater. Und genau wie der Großvater willst du sein. Denn er ist gut. Er kann Geschichten erzählen. Du magst werden wie er: ein Märchenerzähler, mit leberfleckigen Händen. Du liebst seine Geschichten. Und wenn er lacht, dann schiebt sich die Haut um seine Augen zusammen wie Ziehharmonikafalten. Immer wieder passt er auf dich auf, untertags, wenn deine Mutter arbeitet. Wenn du bei ihm bist, fühlst du dich immer wie im Himmel. Und der Himmel hört nirgends auf. Du fühlst dich schön und glänzend, so wie die Sonne, die sich an den Scheiben des Fensters eurer kleinen Wohnung bricht. Und du genießt ihr Leuchten auf deiner Haut. Ja. Aber nur wenn der Großvater da ist.
Es gibt auch andere Männer. Die kommen nachts. Dann springen die Lippen der Mutter auf, und sie bemalt sich mit allen möglichen Farben. Rot. Du hast Angst vor dem Rot. Es ist schrill, schreit. Dir schwillt dann immer der Blick zu. Du könntest taumeln, umfallen. Es ist, als zöge sich ein Vorhang über dein Hirn. Du weißt: Du wirst dann ins Nebenzimmer gesperrt. Und so geschieht es. Die Mutter dreht den Schlüssel im Schloss um, und du bist mit der Nacht allein. Hörst, wie Männer eintreten, im Nebenzimmer. Hörst es ruckeln. Wie wenn jemand rutscht. Dann knarrt das Bett. Es ächzt sogar manchmal. Das Bett stirbt!, denkst du. Dann hechelnder Atem. Du weißt nicht, was er bedeutet. Doch auch der Atem macht Angst. Ja: so ein kurzatmiges, wimmerndes Hecheln hast du einmal gehört, bei einem Straßenköter, der gestorben ist. Das Hecheln macht Angst. Denn es ist das der Mutter. Du weißt nicht, was du tun sollst. Du drehst dich im Bett zur Seite und betest dein Abendgebet. Das hast du vom Großvater gelernt. Dann ist so ein Friede in dir. Aber nur, bis es wieder rot wird.
3
An einem der nächsten Tage saß Josef im Garten und spielte mit Teddy, ohne dabei wirklich zu merken, was er tat. Er warf den Bären in die Höhe und fing ihn wieder auf, und währenddessen blickte er sich verloren im Garten um.
»Hast du Freude, Kleiner?«, drang eine Stimme vom Fenster her.
Josef schaute zur Villa hin, die weiß verputzt in seinem Rücken lag, und erkannte seine Mutter, wie sie in einem der Erker stand und ein paar Blumentöpfe aufstellte. Der Wind wehte ihr das helle Haar leicht aus der Stirn, ihr langes weißes Kleid wallte.
»Ich weiß noch nicht«, antwortete er.
»Warum denn nicht?«, fragte die Mutter gespielt schmollend, und Josef sah, wie sich in ihrer linken Backe ein Grübchen bildete.
»Ist noch alles zu neu hier«, murmelte er.
»Aber schau doch nur, wie schön der Garten ist!«, rief seine Mutter, verschwand kurz im Inneren des Hauses und kam mit einer Gießkanne wieder.
Josef zuckte mit den Schultern. Er versuchte ja, sich an die ungewohnte Umgebung zu gewöhnen, aber das war nicht so einfach. Freilich, seine Mutter hatte schon recht. Die Villa war hell und geräumig, das Dach mit schwarzen Schindeln bedeckt, und aus dem Schornstein qualmte es freundlich. Ein großer Garten umgab das Haus, und Josef hatte sich gleich zu Beginn ganz besonders in die Linde verliebt, die links neben dem Kiesweg stand. Dennoch: Es war nicht wie sein letztes Zuhause. Und er hatte das viele Umziehen satt. Er wusste, dass es an seiner Mutter lag. Seine Mutter war nun einmal wie der Wind. Sie konnte nirgendwo lange bleiben. Immer hatte sie die Idee, dass es irgendwo anders noch besser sein könnte. Und der Vater gab letzten Endes immer klein bei. Seine Mutter gewann einfach jeden Kampf, dachte Josef. Auch gegen ihn selbst. Denn nun sah er sie auch schon wieder mit einem warmen Gefühl im Bauch an und merkte, wie die Wut langsam wich.
»Was ist denn, Josef?«, rief seine Schwester Mariechen, die gerade mit einem kleinen hölzernen Puppenwagen an der Schnur den Kiesweg entlangtrottete. Josef winkte ab.
»Spielen?«, fragte die Schwester und sah ihn aus großen blauen Kulleraugen an.
Josef schüttelte den Kopf. »Ich bin schon mit Teddy beschäftigt«, murrte er. »Siehst du das denn nicht?«
Mariechen hielt inne, verlagerte das Gewicht auf ein Bein und scharrte etwas verlegen mit dem anderen im Kies herum.
»Spielen …«, sagte sie, doch Josef ließ sie einfach stehen und ging zum Gartenzaun. Er wollte jetzt alleine sein. Er setzte sich unter die Linde und kratzte mit den Fingernägeln ein wenig an der Rinde. So starrte er, den Teddy auf den Knien, ins Leere. Hin und wieder fuhr ein Auto vorbei; auf die Straße fiel Licht. Vögel zwitscherten. Wind kam auf. Josef hörte Mariechen leise hinter sich brabbeln, hörte, wie sie mit dem knirschenden Holzwagen den Garten abschritt. Irgendwann öffnete sich die Tür des gegenüberliegenden Hauses, und ein Mann kam heraus. Er sah edel aus, war schlank und nicht besonders groß gewachsen. Er trug einen hohen Hut und Handschuhe mit Knöpfen sowie einen Gehstock, den er ungeschickt neben sich herschwenkte. Mit einem freundlichen Lächeln näherte er sich.
»Grüß dich. Wie heißt du denn?«, fragte er, während er Josef anblickte.
Josef legte die Stirn in Falten. »Josef«, entfuhr es ihm grimmig.
Stille.
»Und du?«, fragte er dann den Mann, der keine Anstalten machte, wieder zu verschwinden.
Der Mann lächelte, und dabei leuchteten seine Augen.
»Fast so wie du«, sagte er.
Josef musterte ihn und dachte kurz nach.
»Johann!«, rief er dann.
Der Mann nickte und kam etwas näher an den grünen Gartenzaun heran. Dabei ließ er ein anerkennendes Schnalzen mit der Zunge ertönen.
»Du bist schlau«, sagte er.
Wieder schwieg Josef. Der Mann räusperte sich.
»Ich wollte«, sagte er, und Josef sah aus den Augenwinkeln, wie sein Blick etwas hinter ihm suchte, »mich nur vorstellen, kleiner Mann. Ich bin dein neuer Nachbar.«
Josef stand auf. »Ich brauch keinen neuen Nachbarn.«
Das Gesicht des Mannes bekam für einen Moment einen leicht traurigen Zug.
»Und wie heißt dein kleiner Freund?«, fragte er dann, Teddy anblickend, den Josef gerade fest an seinen Bauch presste.
»Ich brauch keinen Nachbarn«, entgegnete Josef stur. »Ich hab einen. Daheim, im alten, echten Daheim, in Simmering nämlich.«
Der Mann lächelte kurz, und um seine Augen bildeten sich Falten, die freundlich aussahen.
»Also weißt du, Nachbarn kann man nie genug haben.«
Josef wusste nicht, was er erwidern sollte. Der Mann wandte sich ab und schwang kurz den Stock in der Luft. Dann sagte er noch, mit einem eindringlichen Blick: »Außerdem haben deine Nachbarn in Simmering bestimmt keine Schwerter aus dem Mittelalter, oder?«
Mit diesen Worten legte er seine Hand an den Rand des Hutes und winkte kurz.
Josef bemühte sich, trotzig die Stirn in Falten zu legen und den Mund ordentlich zusammenzukneifen, doch er merkte, wie etwas in ihm mit einem Mal gespannt war. Er sah aus den Augenwinkeln und scheinbar desinteressiert der mageren Gestalt nach, die sich über die Straße entfernte und den Stock hin- und herschwenkte, als wäre sie ein großes Kind.
Früher
Kindheit also. Alles beginnt immer in der Kindheit. Erinnere dich: Damals gibt es noch keine Grenzen. Und du lauschst begeistert den Märchen des Großvaters. Es ist das Einzige, was hilft gegen die Enge der Wohnung, die Toilette am Gang, auf die man nachts gehen muss, ihr bedrohliches Plätschern, ihr alles verschlingendes Loch.
Du hast Angst vor dem Treppenhaus, das seltsam riecht und dessen Verputz abbröckelt. Angst vor den Frauen, die mit ihren Tüchern auf dem Kopf an der Bassena stehen, leiern. Angst vor dem Wasser, das aus der Bassena tropft. Ihre von Krampfadern durchzogenen Beine kommen dir vor wie Türme, sie ragen über deinen Kopf hinaus. Ihre Strümpfe sind voller Löcher, ihr Geschnatter laut und beängstigend, ihre Hälse labbern und sehen ungeordnet aus, »Schlampig«, hätte die Mutter gesagt.
Erinnere dich, Clara:
»Deine Mutter ist eine Hexe!«, sagt der Großvater nachts einmal zu dir.
»Warum?«, fragst du.
»Sie verzaubert die Männer!«
»Was heißt das?«
Der Großvater seufzt und schweigt.
Dass man darüber nicht reden soll, begreifst du. Und du überlegst, ob du vielleicht auch zaubern kannst. Du übst es, mit Worten. Erinnerst dich an die Formeln in den Geschichten, von denen der Großvater erzählt hat:
»Kiwitt!«, wisperst du abends, und das ist jetzt fast wie ein Gebet.
Manchmal hilft es gegen die Angst, die rote Farbe und das Ruckeln der Männer. Und gegen die Mutter, die eine Spitzhacke in der Küche hat, die scharf ist und Angst macht. Erinnere dich, Clara.
4
Für einen Moment zuckte Clara auf, als sie das Geräusch rollender Räder vernahm. Ein Schauer durchlief sie. Sie ließ von den Margeriten ab, die sie in den Erkerfenstern der Villa platziert hatte, und drehte sich um. Ihr Blick fiel auf Mariechen, die in ihr Zimmer geschlichen war und nun schüchtern den Puppenwagen vor sich herschob. Clara atmete erleichtert auf.
»Mariechen, Kleines!«, rief sie und ging auf ihre Tochter zu.
Mariechen lief ihr mit tapsigen Schritten entgegen, stellte sich ihr gegenüber hin und blickte sie aus großen blauen Kulleraugen an. Sie sah verstört aus.
»Was hast du denn?«, fragte Clara besorgt, während sie in die Knie ging und begann, Mariechen den Rocksaum zurechtzuziehen, der in die Höhe gerutscht war.
Mariechen kramte unter der karierten Decke, die sie der Großmutter einst weggenommen hatte und mit der sie seither ihre Puppe Clara einwickelte, ihren besonderen Schatz hervor. Clara lächelte, während sie Mariechen dabei beobachtete, wie sie die Porzellanpuppe mit den Wimpernlitzen aus Kunsthaar und dem blutrot bemalten herzförmigen Mund an sich presste und im Arm hin- und herwiegte, wobei sie die Lippen zu einem Strich verzog.
»Was ist denn, Mariechen?«
»Hab nur die Puppe«, sagte Mariechen leise.
Clara sah sie erstaunt an. »Das stimmt doch nicht!«, rief sie aus. »Wie kommst du denn darauf?«
Mariechen zuckte mit den Schultern und ließ die Puppe ein wenig nach hinten kippen, sodass ihre Augen zufielen.
»Josef mag nicht mit mir spielen«, schmollte sie.
Das war es also. Sie dachte, dass nun auch ihre Tochter begonnen hätte, sich von ihr getrennt zu fühlen und den Umzug in Frage zu stellen. Doch zum Glück war es wohl nicht so. Sie hatte schon genug Probleme damit, den kleinen Josef bei Laune zu halten und seine überschüssige Energie zu bändigen.
»Du weißt doch, wie er ist«, sagte sie.
Mariechen schüttelte den Kopf.
»Er ist nun mal ein Junge und kein Mädchen.«
»Und was heißt das?«, wollte Mariechen wissen und riss die hellen Augen mit den dichten Wimpern ganz weit auf. Clara lächelte.
»Er spielt eben lieber mit Teddys als mit Puppen. Und mit Schwertern als mit Porzellangeschirr.«
Mariechen trat mit ihren Füßen, die in weißen Lackschuhen steckten, auf dem Boden hin und her. »Aber ich mag Teddys auch! Josef mag mich nicht!«, murmelte sie.
Clara seufzte. Lag es an Egon? War ihr Mann es, der den Kindern das Gefühl vermittelt hatte, Mädchen seien weniger wert als Jungen? Oder war am Ende sie selbst es? Sie streckte die Hand aus und strich Mariechen über den hellblonden Lockenkopf. Das dünne Haar lag wie ein zartes Netz um den hellen runden Schädel. Wie zerbrechlich so ein Kinderkopf doch war! Clara spürte, wie sich in ihrer Herzgegend ein beklommenes Gefühl auszubreiten begann.
»Er wird schon wiederkommen, der Josef«, sagte sie bemüht optimistisch. »Er hat eben keine leichte Zeit, weißt du. Er wollte nun mal nicht umziehen.«
Ihre Tochter schniefte ein wenig. Clara wusste nicht, ob es die Pollen waren – denn es war bereits dabei, Frühling zu werden –, ob Mariechen kokettierte oder ob sie tatsächlich kurz davorstand zu weinen. Aber sie spürte, wie sich ihr Herz zusammenzog. Clara hob Mariechens kleinen Körper hoch und drückte ihn fest gegen ihre Brust. Sie spürte den kalten künstlichen Leib der Porzellanpuppe, das Kunsthaar kratzte an ihrem Dekolleté, während Mariechen sich warm anfühlte wie frisch gebackenes Brot. Wie gut und erdig so ein Kinderkörper doch war, dachte Clara und seufzte leise in Mariechens Haar hinein. Mariechen löste einen ihrer kleinen, speckigen Arme von der Puppe Clara und legte ihn zart um den Hals der Mutter. Warm war diese Kinderhand. Warm und ruhig. Alles würde gut werden, dachte Clara, auch wenn Egon wenig Zeit für sie hatte und der Schmerz vieler vergangener Jahre ihr noch immer im Nacken saß.
Ich muss nach vorne schauen, dachte Clara. Und dass sie Verantwortung für ihre Kinder hatte. Außerdem wusste sie im Grunde, dass Egon sie liebte. Er war eben nur ein bisschen jünger und musste das Leben entdecken, musste für sich sein. Dafür brachte er ja auch das Geld nach Hause.
Langsam löste Clara die Umarmung und sah ihre Tochter an, die lächelte. Sie stupste das Grübchen in der linken Wange ein Stück weit nach innen und nickte Mariechen liebevoll zu. Dann wickelte sie gemeinsam mit ihr die Puppe in die karierte Decke und schob Mariechen an den Schultern ein Stück weit vor sich her.
»Nun geh und spiel noch ein wenig«, sagte sie. »Ich gieße derweil die Blumen und sage der Köchin dann, sie soll das Essen richten, ja?«
Mariechen nickte und wollte schon gehen, da beschlich Clara noch einmal die Sorge.
»Mariechen?«, sagte sie.
»Ja?« Das Kind drehte sich um.
»Versprich mir, dass du nie irgendwas tust, nur weil jemand sagt, du musst es machen, weil du ein Mädchen bist, ja?«
Mariechen blickte sie verständnislos an. »Was denn tun?«, fragte sie unsicher und umklammerte den Holzgriff ihres Puppenwagens mit ihrer kleinen Hand.
»Ach«, winkte Clara ab, »nichts.«
Früher
In einer deiner frühesten Erinnerungen, Clara, da sitzt du im Hof und betrachtest dich im Fenster. Und darin ist die gesamte Welt. Auch du bist vorhanden. Du kannst dich in der Spiegelung erkennen, du kannst sie angreifen. Aber du staunst, denn als du das tust, da ist da mit einem Mal: nichts als glattes Glas. Du verschwindest. Rutschst ab an dir.
»Ich heiß Clara!«, sagst du dann. Ganz laut. Um die Angst wegzujagen, aus der dieser Moment gebaut ist. Aber es bleibt kein Bild übrig. »Spitzhacke« ist das einzige Wort, das dir dann einfällt. Und es ist rot.
5
Als Johann an diesem Nachmittag von seinem Spaziergang zurückkehrte, glaubte er bereits von Weitem zu erkennen, dass sich der Junge noch im Garten befand und auf den Weg vor dem Haus blickte. Er lächelte, kniff die Augen zusammen und ging ein wenig schneller. Tatsächlich, er hatte sich nicht getäuscht: Mit leicht zerzaustem hellen Haar stand der kleine Josef am grünen Gartenzaun und schien nur darauf gewartet zu haben, dass Johann wieder erschien.
»Grüß dich«, sagte Johann freundlich.
Der Junge schwieg. Johann blieb stehen, lüpfte kurz seinen Hut und beobachtete Josef durch die Gitterstäbe hindurch.
»Na, kleiner Mann?«, versuchte Johann es erneut, während er sich den Hut auf den Kopf zurücksetzte.
»He, so darf mich nur meine Mutter nennen!«, rief der Knirps aus und legte die Stirn in Falten.
Oh, nun kam etwas aus ihm heraus, und noch dazu mit einer Menge Temperament! Johann lächelte innerlich, doch er bemühte sich, den Jungen ernst zu nehmen.
»Tatsächlich?«, sagte er.
Nachdem Josef darauf nicht antwortete, fügte er sicherheitshalber noch ein leises »Tut mir leid« hinzu.
Josef näherte sich dem Zaun und legte eine Hand auf das grüne Gitter. »Schon in Ordnung«, sagte er, und auf einmal klang seine Stimme friedlicher.
Johann wusste, was nun kommen würde, und er täuschte sich nicht.
»Du hast also ein Schwert?«, fragte der Kleine, während er am Gartenzaun herumnestelte, den Teddy immer noch fest in der anderen Hand.
Insgeheim lachte Johann auf. Er liebte die Ehrlichkeit von Kindern! Warum nur wurden stets verhärmte, lügnerische und traurige Erwachsene aus ihnen? Er versuchte, Josef mit derselben Offenheit und Unmittelbarkeit zu begegnen, mit der dieser sich ihm gegenüber nun zeigte.
Er kniete sich nieder und legte auch eine Hand gegen die Gitterstäbe, etwas entfernt von Josef, sodass dieser sich nicht schreckte. »Ja, das habe ich.«
Josef blickte ihn mit zusammengepressten Lippen an. »Warum?«, fragte er dann ernst.
»Ich habe es geerbt.«
Josef nickte. »Von deinem Vater?«, fragte er.
Johann merkte, wie ihn Stolz auf den Jungen durchfuhr. »Ja. Du bist schlau.«
»Das hast du schon mal gesagt.« Zum ersten Mal huschte ein kleines Lächeln über Josefs Gesicht. »Mein Vater hat kein Schwert«, sagte er dann. »Ich glaub, der hat Angst vor Schwertern.«
Johann zog eine Augenbraue in die Höhe. »Das ist verständlich«, sagte er freundlich.
»Findest du?«
Er nickte. »Wenn man eine Waffe hat, Josef, muss man genau aufpassen, wie man sie einsetzt. Und das macht Angst.«
Josef schwieg und schien nachzudenken.
»Meine Mutter ist viel stärker als mein Vater«, sagte er schließlich, fast zu sich selbst, und Johann nickte, einfach nur, weil er dem Jungen das Gefühl geben wollte, dass er zuhörte.
In diesem Moment waren Schritte zu hören. Klackernd, leichtfüßig, schnell. Johann wandte den Blick und merkte, wie sich ein warmes und leicht nervöses Gefühl in seinem Bauch ausbreitete. Die Frau, von der seine Mutter ihm erzählt hatte, dass sie Clara heiße, war auf der Steintreppe, die in den Garten der Villa führte, erschienen. Mütter, dachte er, sie spürten es wohl einfach, wenn ihre Söhne über sie sprachen.
»Kann ich Ihnen helfen?«, rief sie, und es klang freundlich, aber überaus bestimmt.
»Ja«, sagte Johann und fühlte sich gemaßregelt. Er stand auf. »Gestatten, dass ich mich vorstelle«, sagte er höflich und lüpfte wiederum den schwarzen Zylinder. »Ich bin –«
»Sein Name ist auch mit ›Jo‹, Mama!«, platzte Josef heraus.
Johann lachte.
»Ach ja?«, sagte Josefs Mutter, und auf ihren Lippen bildete sich ein verstecktes sanftes Lächeln.
»Ja!«
Josefs Mutter ging langsam zum Gartenzaun. Johann sah, wie das Kleid ihre Beine umschmeichelte, die schlank, aber kraftvoll wirkten und in hohen teuren Schuhen endeten. Der Kies knirschte unter ihrem Schritt. Währenddessen eilte Josef bereits zur Gartentür.
»Darf ich?«, rief er aus und sah seine Mutter aus großen Augen an.
Sie nickte, und eine kleine Welle aus Licht schien über ihr helles Gesicht zu laufen. Johann erschauerte. Die Frau sah aus wie ein Engel, dachte er.
Josef öffnete die Tür, und ungeschickt betrat Johann nun den Kiesweg, der in den Garten der Villa führte.
»Johann Glücksstein«, sagte er freundlich und reichte Clara seine Hand, die sie ergriff.
»Clara Löwenberg«, entgegnete sie.
Ihr Händedruck war fest, ganz anders, als er es von so einer zierlichen Dame erwartet hätte. Johann stellte sich vor, wie sich wohl ihre Haut unter dem Handschuh anfühlen musste. Zart, nicht schweißig, eher kühl.
»Er hat ein Schwert!«, rief Josef nun und schmiegte sich ein wenig gegen das linke Bein seiner Mutter. Clara Löwenberg sah Johann aus blauen Augen an.
»Tatsächlich?«
Ihre Stimme war freundlich und offen, den Blick hingegen konnte Johann nicht deuten. Etwas Fremdes lag in ihm, etwas Magisches, das er noch nie bei einer Frau gesehen hatte.
»Tatsächlich?«, wiederholte Clara Löwenberg, und ihm wurde bewusst, dass er sie angestarrt hatte.
»Ja … ja«, stotterte er.
Nun lachte sie herzlich und legte ihre linke Hand auf den hellen Haarkranz ihres Sohnes, dessen Gesicht mit einem Mal vor Begeisterung leuchtete.
»Ich freue mich sehr, dass Sie meinen Sohn wieder zum Strahlen gebracht haben«, sagte sie.
Johann fühlte, wie er rot wurde. »Sehr gern«, erwiderte er, und es kam von Herzen.
»Wissen Sie«, sagte Clara, während sie Josefs Haar mit ihrer behandschuhten Hand durchwühlte, »der Umzug hat Josef ein wenig zugesetzt.«
Johann merkte, dass ihn das traurig machte. Er sah den Jungen an, der unsicher wurde.
»Umzüge sind ja auch anstrengend«, beeilte er sich zu sagen.
Clara nickte.
»Darf ich das Schwert sehen?«, fragte Josef nun ungeduldig und fuhr mit den Fingern ihr Bein auf und ab.
Clara lächelte. »In Ordnung, wenn Herr Glücksstein nichts dagegen hat?«, sagte sie mit einem Blick auf Johann.
»Freilich, gern! Ich bin Historiker und arbeite an den Vormittagen meist daheim, komm doch einmal vorbei, Josef!«, erklärte Johann da.
»Na?«, meinte Clara und betrachtete ihren Sohn.
Josef nickte begeistert. Clara lachte. Dann wandte sie sich an Johann und reichte ihm erneut die Hand. »Vielen Dank«, sagte sie.
Er winkte ab. »Wofür denn?« Und fast zögernd, da er der Dame nicht zu nahe treten wollte, fügte er hinzu: »Dasselbe gilt freilich für Sie.«
Ihr Blick senkte sich, wich seinem aus.
»Danke«, sagte Clara Löwenberg, und es klang plötzlich wieder kühl.
»Ich empfehle mich«, erwiderte Johann rasch, legte kurz zum Gruß die Hand an seinen Hut und zwinkerte Josef zu, dessen Gesicht erneut zu leuchten begann. Dann machte er, ohne es noch einmal zu wagen, Clara anzuschauen, kehrt und ging auf sein Haus zu. Er merkte, wie seine Knie weich geworden waren. Was war nur los mit ihm? Seine Fingerkuppen waren feucht, er konnte kaum schlucken, und am liebsten hätte er einfach nur die Augen geschlossen und in die Leere gestarrt, ins Licht. Da fiel ihm auf, dass er lächelte.
Früher