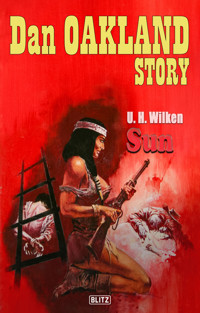Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Autor steht für einen unverwechselbaren Schreibstil. Er versteht es besonders plastisch spannende Revolverduelle zu schildern und den ewigen Kampf zwischen einem gesetzestreuen Sheriff und einem Outlaw zu gestalten. Er scheut sich nicht detailliert zu berichten, wenn das Blut fließt und die Fehde um Recht und Gesetz eskaliert. Diese Reihe präsentiert den perfekten Westernmix! Vom Bau der Eisenbahn über Siedlertrecks, die aufbrechen, um das Land für sich zu erobern, bis zu Revolverduellen - hier findet jeder Westernfan die richtige Mischung. Lust auf Prärieluft? Dann laden Sie noch heute die neueste Story herunter (und es kann losgehen). Wie ein Spuk wuchsen sie hinter den roten Felsen der trostlos öden Wüste empor und starrten hasserfüllt nach den Wagen hinüber, deren Planen hell in der Sonne leuchteten. Reglos standen sie im heißen Wind und beobachteten den Treck nach Westen. Knochige, eingefallene Gesichter trugen die Farben des Krieges. Langes, strähniges Haar fiel auf die Schultern. Sehnige Hände hielten Gewehre. Lautlos tauchten sie unter. Schnaubend wühlten sich die Wagenpferde durch den heißen Sand. Reiter flankierten die Wagen. Niemand hatte die Apachen entdeckt. Sie alle folgten dem dahin gehenden Tag und sahen die Sonne blutrot hinter den zerklüfteten Bergzügen im fernen Westen untergehen. Männer hielten die Zügel fest in den Händen. Manche Frau saß neben ihrem Mann auf dem Wagenbock. Kinder hockten unter dem Planenhimmel. Federvieh flatterte unruhig in den Bretterverschlägen. Ochsen trotteten hinter den Wagen. Wie eine graue Wand kam die Dämmerung von Osten heran. Im letzten Tageslicht las eine Frau aus der Bibel vor. Es war die Geschichte von Moses und dem gelobten Land … Gellendes Geheul zerriss die Stille des Abends. Wie Teufel schnellten Apachen hinter den Sandwehen und Bodenwellen hervor. Schüsse peitschten herüber, Pfeile sirrten heran.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 142
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die großen Western – 409 –Coyotero-Fährte
U.H. Wilken
Wie ein Spuk wuchsen sie hinter den roten Felsen der trostlos öden Wüste empor und starrten hasserfüllt nach den Wagen hinüber, deren Planen hell in der Sonne leuchteten. Reglos standen sie im heißen Wind und beobachteten den Treck nach Westen. Knochige, eingefallene Gesichter trugen die Farben des Krieges. Langes, strähniges Haar fiel auf die Schultern. Sehnige Hände hielten Gewehre. Lautlos tauchten sie unter. Schnaubend wühlten sich die Wagenpferde durch den heißen Sand. Reiter flankierten die Wagen. Niemand hatte die Apachen entdeckt. Sie alle folgten dem dahin gehenden Tag und sahen die Sonne blutrot hinter den zerklüfteten Bergzügen im fernen Westen untergehen.
Männer hielten die Zügel fest in den Händen. Manche Frau saß neben ihrem Mann auf dem Wagenbock. Kinder hockten unter dem Planenhimmel. Federvieh flatterte unruhig in den Bretterverschlägen. Ochsen trotteten hinter den Wagen.
Wie eine graue Wand kam die Dämmerung von Osten heran. Im letzten Tageslicht las eine Frau aus der Bibel vor. Es war die Geschichte von Moses und dem gelobten Land … Gellendes Geheul zerriss die Stille des Abends. Wie Teufel schnellten Apachen hinter den Sandwehen und Bodenwellen hervor. Schüsse peitschten herüber, Pfeile sirrten heran. Blei durchschlug die Planen, klatschte gegen die Wagen. Pfeile fauchten durch die heiße Luft.
Aufbrüllend trieben die Männer die Wagenpferde an. Die Räder wühlten sich durch den Staub, rissen den Sand hoch. Hufe stampften wild. Lanzen bohrten sich tief in die dahinrasenden Pferde eines Wagens. Röchelnd brachen die Pferde zusammen. Der Wagen knallte gegen einen Felsen, die Deichsel zersplitterte – und krachend zerschellte der Wagen am Felsen, wurde auseinandergerissen. Ein Wagenrad rollte springend durch den Sand und zwischen die heranstürmenden Apachen. Verzweifelt versuchten die Männer, die Wagen zu einer Wagenburg zusammenzufahren.
Wieder traf ein Pfeilhagel die Wagen. Die Frau mit der Bibel griff sich an die Brust. Ihr Gesicht wurde von einer Sekunde zur anderen furchtbar leer. Die Bibel fiel vom Wagen und schlug in den Sand. Langsam kippte die Frau vom Bock und stürzte hinunter, rollte leblos in eine steinige Senke und blieb mit ausgebreiteten Armen rücklings liegen.
Ihr Mann schrie voller Entsetzen, Angst und Verzweiflung, riss an den Zügeln, wollte abspringen – da trafen ihn die Kugeln aus den Gewehren der Apachen.
Heulend fielen die Apachen über den Wagen her, schwangen die Tomahawks und machten die beiden Kinder nieder.
Zweihundert Yards weiter rasten die Wagen zu einer Wagenburg zusammen. Die Männer des Trecks feuerten auf die Apachen.
Jäh erstarb das markerschütternde Geheul. Verschwunden waren die Apachen, weggetaucht.
Die Ochsen trotteten in die Wagenburg, als wäre sie der altgewohnte Stall. Die Pferde rissen am Geschirr und keilten aus. Männer schwangen sich von den Wagen, halfen ihren Frauen und den Kindern herunter.
»Alles hinlegen!«, brüllte der Treckführer. »Grabt Löcher! Kriecht in den Boden!«
Sie scharrten mit bloßen Händen. Staubwolken trieben über die Wagenburg hinweg. Geduckt hetzten die Männer mit ihren Gewehren über den Platz, verteilten sich, krochen unter die Wagen, gingen hinter den wuchtigen Rädern der Conestogas in Deckung. Dann war es totenstill.
Tot lag die gläubige Frau in der Steinsenke. Tot waren ihre Kinder und ihr Mann. Tot lagen die Pferde im Sand, und das dunkle Blut gerann auf den verstaubten Körpern der Tiere.
Die Apachen lauerten.
Zitternd legten die Frauen die Arme um ihre Kinder und kauerten mit ihnen in den Sandlöchern.
Sie hatten in das gelobte Land Kalifornien ziehen wollen. Jetzt hatten Apachen ihre Träume und Hoffnungen jäh zerstört. Der Tod umgab die Wagenburg.
Lautlos fiel die Dämmerung über die Wagenburg. Die Konturen der Conestogas verschwammen. Wasser rann glucksend aus den durchschossenen dickbauchigen Fässern.
Männer krochen heran, hielten ihre durchschwitzten Hüte unter die Fässer und fingen das kostbare Wasser auf. Metall klirrte gegen Steine.
Schreie gellten.
Die Apachen griffen wieder an.
Bösartig durchbohrten Pfeile die Planen und bohrten sich in den heißen Sand. Kugeln trafen dumpf klatschend die Wagenräder und rissen zwei Männer weg. Schlaff fielen sie zu Boden. Geschosse drangen tief in den angehäuften Sand ein, hinter dem die Frauen und Kinder lagen.
»Schießt sie zusammen!«, brüllte der Treckführer mit röhrender Stimme. »Spart Munition, aber knallt sie ab!«
Schüsse verzerrten seine Stimme.
Treibender Flugsand umgab die geduckten Apachen.Wie von der Kette losgelassene Bluthunde schnellten sie auf weichen Mokassins näher, rasten von einem Felsen zum anderen.
Wieder waren sie verschwunden.
Nervenzerrüttend war die Stille – und die geheimnisvollen wimmernden Stimmen wehten von weither heran. Der Wind wurde zu einer schaurigen Melodie, und der Hauch von Tod und Sterben lag über dem ausgedorrten und gottverdammten Wüstenland.
Unter den Wagen knackte es. Männer luden die Gewehre nach. Ihre Gesichter waren verzerrt, schweißnass, verstaubt und maskenhaft starr.
Die Dämmerung verdichtete sich. Die Umrisse der Felsen verwischten immer mehr. Gestalten schienen näher zu kommen, schienen zu tanzen, geisterten schwebend über die Bodenwellen und lösten sich auf. Der Spuk narrte die eingeschlossenen und umzingelten Weißen. Manchmal krachte ein Schuss.
Abgrundtiefer Hass wütete in den Herzen der Apachen. Niemals würden sie die Versöhnung mit den Weißen suchen, die in ihr Land eingedrungen waren. Niemals würden sie sich ergeben und diese mörderischen Kriege und Gemetzel beenden. Nur der Tod könnte sie von ihrem furchtbaren Hass erlösen.
Sie waren Ausgestoßene der Apachenstämme. Wie herumstreunende Kojoten fanden sie nirgendwo Ruhe und Frieden – und sie suchten auch nicht nach der Geborgenheit. Der greise Cochise hatte sie verstoßen. Für ihn waren sie Coyoteros, räudige, verkommene und dreckige Abtrünnige, die den Hass schürten und die Blauröcke in dieses weite Gebiet lockten.
In der Dämmerung flackerte hinter Felsen Feuer auf, drang gelb durch den Dunst. Die Männer des Trecks starrten sich die Augen aus, doch sie konnten nirgendwo Apachen erkennen. Sie sahen nur das Feuer und den zuckenden Flammenschein auf den anderen Felsen. Irgendwo hinter den Bodenwellen wieherten Ponys.
Vielleicht würden sie alle nicht mehr den Morgen erleben.
Noch vertrauten sie auf ihre Gewehre, noch lähmte sie nicht die Todesangst.
»Was hat das Feuer zu bedeuten?«, stöhnte ein Mann. »Warum machen diese verdammten Hunde denn Feuer!?«
Niemand antwortete.
Das letzte Wasser rann aus den Fässern und sickerte in den Boden.
Kinder schluchzten. Die Mütter versuchten, ihre Kinder zu beruhigen, aber sie selber waren von Angst erfüllt. Eine Frau sprach ein Gebet. Es klang wie das Gebet vor einem offenen Grab.
*
Hände und Knie rieben durch den Sand. Auf allen vieren krochen Apachen über den Boden. Gewehre rutschten durch den Sand.
Urplötzlich peitschten Schüsse herüber, und wieder prasselte Blei gegen die Wagen. Schrill schreiend sprangen die Apachen auf und rasten heran.
Unter den Wagen blitzte es hell auf. Kugeln trafen die Apachen, zerrissen Gesichter, schlugen in die Oberkörper hinein. Indianer torkelten sterbend umher und sanken dahin – doch viele andere kamen hinterher, hetzten durch die Mulden, setzten über Felsen und Gestrüpp hinweg.
Die Männer stöhnten, schrien und schossen.
Auf einmal flogen brennende Pfeile vom Feuer herüber, schienen vom Himmel zu kommen. Sie zogen einen Feuerschweif hinter sich her und trafen die Planen der Wagen. Feuer fraß sich in die Planen und breitete sich aus. Die Pferde tobten, keilten aus, zerrissen das Geschirr und rannten weg. Ein Wagen wurde umgerissen. Funken wirbelten über den Platz und versengten die Kleidung der Eingeschlossenen. Überall war Feuer, überall loderten die Wagen.
Auf struppigen zähen Ponys jagten Apachen heran. Feuer loderte aus den Wagen. Die Männer mussten zurückkriechen, warfen sich hinter die Deckung des Erdwalls und schossen.
Gespenstisch tauchten die berittenen Apachen zwischen den brennenden Wagen auf. Sekundenlang waren diese Fratzen des Bösen und des Hasses deutlich im roten Schein zu erkennen. Dann rasten die Indianer auch schon in die Wagenburg hinein und schossen erbarmungslos in die Rücken der Weißen.
Todesangst erfasste alle. Die Männer achteten nicht mehr auf die Deckung, sie feuerten auf die Reiter, schossen Ponys und Apachen zusammen. Mit schrillem Geheul rasten mehrere Indianer aus der Wagenburg. Zu Fuß kamen andere Krieger heran. Das Gewehrfeuer verdichtete sich zu einem einzigen Geknatter. Apachen fielen sterbend in die brennenden Wagen hinein.
Niemand vom Treck hatte ernsthaft mit den Apachen gerechnet. Es hatte geheißen, dass die Indianer ruhig wären. Aber sie waren nicht ruhig – sie fielen schreiend und schießend über den Treck her, und die Männer kämpften bis zur letzten Patrone.
Fern, kalt und bleich strahlte das Mondlicht über der Wildnis.
Die Apachen wichen plötzlich zurück, hetzten hinter die Felsen, rollten über die Sandwehen und verschwanden. Zurück blieben tote Krieger und erschossene Ponys, brennende Wagen, verwundete und stöhnende Männer, erschossene Weiße, verendete Ochsen und verkohltes Federvieh.
Niemand konnte und durfte die Wagen löschen. Es wäre der Tod für jeden, der sich jetzt aufrichten würde. Die Feuer erhellten den Platz, und das Sternenlicht traf die Wagenburg. Die Schatten waren wieder scharf, die Konturen klar.
»Sie kommen wieder!«, stöhnte ein Mann. »Großer Gott, wir sind verloren!«
»Hör auf!«, keuchte der Treckführer. »Verdammt, hör auf, du sollst das verfluchte Maul halten! Noch sind wir nicht am Ende! Wir geben nicht auf!«
Steif kam eine Frau halb hoch und starrte wie geistesabwesend an den brennenden Wagen vorbei. Ihr Blick verlor sich in der nächtlichen Ferne.
»Nein«, kam es klanglos über ihre Lippen, »es gibt keinen Gott. Nicht hier. Wir sind in der Hölle.«
Ihr Mann umfasste sie, schüttelte sie und stöhnte. »Wir leben noch, Mary! Noch ist nicht alles aus! Wir haben eine Chance, Mary, ganz bestimmt!«
Sie antwortete nicht, sackte zusammen und starrte in den Sand.
»Wie weit ist es bis zur nächsten Stadt?«, flüsterte ein Mann.
»Ich weiß es nicht!«, stöhnte ein anderer. »Und das nächste Fort ist auch weit weg! Frag doch nicht! Du machst mich wahnsinnig damit!«
Kinder weinten und bargen das Gesicht im Rock ihrer Mütter. Die Angst machte die Frauen fast verrückt – und doch zeigten sie ein Heldentum, wie es der tapferste Mann nur zeigen konnte. Sie wuchsen über sich selber hinaus in dieser Nacht, da der Indianertod überall wartete.
Das Sternenlicht hielt die Apachen zurück und ließ sie in ihren Deckungen bleiben. Manchmal brachte der kühle Wind die kehligen Laute der Coyoteros heran, verworrene Stimmen, die niemand verstand.
Horchend kniete der Treckführer neben einem toten Ochsen und witterte in den Wind. Wieder war dieses jämmerliche Winseln und Klagen zu hören, als würde irgendwo in der Wüste ein sterbendes Kind nach der Mutter rufen.
»Ich bin doch nicht schon verrückt!«, flüsterte der Mann. »Das ist nur der Wind …«
Die Nacht war ruhig und dennoch furchtbar. Die Männer lagen hinter den Gewehren. Manchem Manne kamen die Tränen vor Verzweiflung. Sie konnten ihre Frauen und Kinder nicht ewig beschützen und vor den Apachen bewahren. Hoffnung gab es nicht mehr.
Es wurde eine lange und furchtbare Nacht. Jeder hatte Angst vor dem Morgengrauen. Denn dann würden die Apachen erneut angreifen.
Munition wurde verteilt. Frauen starrten mit glanzlosen Augen in die Wüste. »Das kann Gott doch nicht zulassen! Wir haben den Indianern doch nichts getan, wir wollen doch nur nach Kalifornien!«
Worte der Verzweiflung.
Und es gab keine Antwort darauf.
Abseits kauerte ein Mann. Er zitterte am ganzen Körper. Wahnsinn war in den Augen. Er sprang auf und rannte los, lief durch die verkohlten Wagen und schrie in die Nacht hinaus.
»Komm zurück!«, brüllte der Treckführer.
Doch der Mann hörte nicht auf ihn, lief weiter und schrie: »Ich bring euch um, ihr Teufel! Ich …« Die Stimme erstarb. Ein Pfeil steckte in der Brust. Er fiel auf die Knie und kippte zur Seite weg. Leblos lag er im Sand.
Der Tod war allgegenwärtig.
Langsam ging die Nacht dahin. Das Licht der Sterne verblasste. Es begann zu dämmern. Der Morgen nahte.
*
Die Männer lagen bereit.
Während der Nacht hatten sie den Graben vertieft und den Erdwall erhöht. Die Gewehre zeigten in alle Richtungen.
Immer grauer wurde es. Die Felsen verwischten. Wie Nebelschwaden zog es über die Sandwehen.
»Aufpassen!«, raunte der Treckführer. »Lasst sie nahe genug herankommen, schießt erst, wenn ihr sie deutlich sehen könnt! Und schießt nicht vorbei!«
Irgendwo rieb und raschelte es. Wieder täuschte der Dunst sie, wieder geisterte es gespenstisch über den Sand.
Sie stierten in die Morgendämmerung hinein und horchten. Um sie herum bewegte sich was. Die Apachen mussten unterwegs sein.
Im Dunst erschienen Schatten. Es musste der Nebel sein. Die Männer zögerten.
Es war nicht der Nebel.
Es waren die Apachen!
Und dann griffen sie an, schnell und unaufhaltsam. Von allen Seiten kamen sie heran. Pfeile, Lanzen und Kugeln überschütteten die Eingeschlossenen. Die Verteidiger schossen die Gewehre heiß. Wie eine Welle kamen die Indianer. Sie schrien und heulten wie Teufel. Ihre Reihen lichteten sich unter den Schüssen der Weißen, doch diesmal ließen sie sich nicht aufhalten, diesmal drangen sie vor, schleuderten die Tomahawks, schossen die Waffen leer, schlugen mit den Gewehrkolben zu.
Pulverrauch zog in Schwaden über Angreifer und Verteidiger hinweg. Querschläger jaulten umher, überall war Blut.
Ponys trampelten über den Erdwall hinweg, brachen zusammen, fielen auf die Verteidiger. Der Graben brach ein. Sand erstickte Leben.
Frauen flüchteten mit ihren Kindern. Apachen verfolgten sie, entrissen ihnen die Kinder, fielen über die Frauen her, vergewaltigten sie, töteten alles Leben.
Als die Sonne aufging, war alles vorbei. Keine Frau betete mehr, kein Kind weinte, kein Mann kämpfte. Verschwunden waren die Coyotero-Apachen, verhallt war ihr Kriegsgeschrei.
Stunden später kam ein Mann dahergeritten, ein alter Mann, der zeit seines Lebens in der Wildnis gelebt hatte. Kreisende Aasgeier hatten ihn hergelockt.
Er ritt näher und starrte auf die Toten. Das welke Gesicht zuckte und zitterte.
»Mein Gott!«
Mehr sagte er nicht, über ihm schrien die kreisenden Geier scharf und wütend. Er rutschte vom Pferd und ging um die Toten. Er sah die Frauen, Kinder und Männer, die zurückgelassenen toten Apachen und die Kadaver der Tiere – und er wurde noch älter, schleppte sich durch den Sand und holte die Toten heran, legte sie in den Graben und deckte sie mit halbverkohlten Rädern und Planfetzen zu, warf Sand darauf und starrte zu den Geiern empor.
Dann ritt er davon.
Der Tag ging dahin. Die Nacht kam.
Erst am nächsten Morgen unterbrach dumpfer Hufschlag die Stille. Im klirrenden Trab zog die Doppelreihe der Kavalleristen heran. Erschüttert blickten die Soldaten umher. Die Totenvögel hatten sich über die Apachen und Tierkadaver hergemacht. Zögernd legten die Männer die leblosen Weißen frei. Der alte Mann stand daneben und machte ein steinernes Gesicht.
An diesem Morgen wurden die Menschen des Trecks begraben. Sie fanden dort ihr Grab, wo sie gefallen waren. Mit flackernden Augen blickte der Lieutenant den alten Mann an.
»Die Apachen sind wieder auf dem Kriegspfad«, flüsterte er, »und wir hatten geglaubt, dass der Frieden endlich erreicht worden wäre!«
»Es waren Coyoteros, Lieutenant.«
»Coyoteros oder nicht – jedenfalls waren es Apachen!«, entgegnete der Lieutenant. »Das bedeutet Krieg. Der Tod dieser Menschen muss gesühnt werden.«
»Ich versteh nichts davon«, murmelte der Alte, »ich hab euch nur diesen Platz zeigen wollen …«
Dann ritt er an den Gräbern vorbei und nach Osten, ein namenloser Mann und Einzelgänger.
Die Abteilung brach auf und ließ hinter sich die Gräber zurück, die verkohlten Wagen und die träge auf Felsen hockenden Geier. Das Stampfen und Klirren verlor sich in der Wüste.
Auf keuchenden Pferden zog die Abteilung nach Süden, durch Hitze und Staub, durch längst ausgetrocknete Flussläufe, durch öde Täler.
*
»Verdammter Mist!« Fluchend stieg die knochige Frau mit dem pechschwarzen Haar vom Wagen. »Du blöder Drei-Tage-Säufer hast den Karren festgefahren!«
Grimmig stand sie neben dem Wagen und blickte den kleinen dürren Mann auf dem Kutschbock an. Die Mädchen auf dem Wagen kicherten.
»Nun schimpf doch nicht, Vermillon!«, flehte der kleine Mann. »Wir haben eben Pech gehabt! Ich krieg die Karre schon noch aus dem Dreck raus, aber die Girls müssen runter vom Wagen!«
»Wie konnte ich dich nur mitnehmen, Amarillo!« Die Frau trat wütend gegen den Wagen, verzog das geschminkte Gesicht vor Schmerz und fluchte schlimmer als ein Mann. »Los, alles runter!«, schrie sie. »Hebt eure fetten Hintern hoch, Girls! Werft euch in die Speichen! Wenn wir jemals Tucson erreichen wollen, dann müssen wir auch was dafür tun!«
Murrend kletterten die Mädchen vom Wagen. Sie alle waren geschminkt und trugen eins der Kleider, die sie sonst im Saloon trugen.
»Wir sind doch keine Männer, Vermillon«, sagte die rothaarige Molly James.
»Aber ihr wollt zu den Männern, Molly. Nun zeigt, was ihr könnt und wie wichtig die Kerle für euch sind. In Tucson gibt es ein ganzes Nest voll von ihnen. Wir wollen doch Geld machen, oder? Vorwärts!«
Sie warfen sich gegen die Radspeichen, keuchten und wurden vor Anstrengung krebsrot.
Der dürre kleine Amarillo peitschte die Pferde.
»Los, Girls!«, schrie er. »Kräftiger! Werft euch ins Zeug!«
Wütend sah die schwarzhaarige Jennifer nach vorn. »Ich könnte ihm in den Arsch treten, diesem verdammten Großmaul!«, keuchte sie. »Schreit herum wie ein Irrer, dabei hat er diesen Mistkarren festgefahren!«
»Keine langen Reden«, rief Vermillon Rose, »schiebt, Kinder! Ja, weiter so! Gleich haben wir den Wagen wieder flott!«
Die Pferde zerrten und rissen. Langsam rollte der Wagen aus dem Sand und in das flache Bett eines Arroyo. Keuchend ließen die Mädchen los und ließen sich im Schatten der Felsen und staubigen Bäume nieder.
Amarillo grinste und kletterte vom Wagen. »Ruht euch aus, Girls«, sagte er gönnerhaft. »Das habt ihr gutgemacht. Hätte ich nie gedacht.«
»Halts Maul«, erwiderte Molly bissig.
»Schon gut«, winkte er beschwichtigend ab, »regt euch nicht auf. Ich halt ja schon das Maul.«