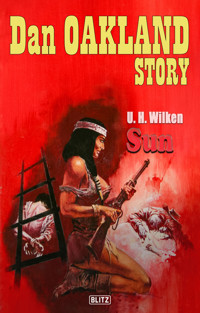Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blitz-Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dan-Oakland-Story
- Sprache: Deutsch
Die Steinerne Squaw Dan Oakland, ein Trapper, entdeckt ein friedliches Sioux-Lager, das von weißen Skalpjägern brutal überfallen wird. Die jungen Indianer werden getötet, und Dan schwört Rache. Er verfolgt die Mörder und rettet schließlich seinen Sohn Sky und dessen Frau Sun vor den Skalpjägern. Gemeinsam kämpfen sie gegen die Angreifer. Faustrecht der Prärie Dan Oakland und sein Sohn Sky finden zwei gehängte Crow-Indianer und folgen den Spuren der Mörder nach Prairie City. Dort wird Suns Leben bedroht, aber sie kann entkommen. Die Banditen planen, die Crows gegen die Siedler aufzuhetzen. Dan rettet die von den Crows verschleppten Kinder und bringt sie zurück. Sky und Sun kämpfen gegen die Crows und Banditen, wobei sie schließlich die Oberhand gewinnen. Die Siedler können ihre Reise fortsetzen, und die Gefahr durch die Crows wird gebannt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In dieser Reihe bisher erschienen
4301 U. H. Wilken Lockruf der Wildnis
4302 U. H. Wilken Teufelsbrigade
4303 U. H. Wilken Die Feuertaufe
4304 U. H. Wilken Der weiße Büffel
4305 U. H. Wilken Das Aufgebot des Bösen
4306 U. H. Wilken Grausame Grenze
4307 U. H. Wilken Omaha-Marter
4308 U. H. Wilken Blutige Säbel
4309 U. H. Wilken Der Unbezwingbare
4310 U. H. Wilken California-Trail
4311 U. H. Wilken Berg der zornigen Götter
4312 U. H. Wilken Die Teuflischen
4313 U. H. Wilken In Todesgefahr
4314 U. H. Wilken Schwarzer Horizont
4315 U. H. Wilken Der Raubadler
4316 U. H. Wilken Trail aus Blut und Eisen
4317 U. H. Wilken Der Wolfskiller
4318 U. H. Wilken Nachtfalken
4319 U. H. Wilken Der Geheimbund
4320 U. H. Wilken Tödliche Tomahawks
4321 U. H. Wilken Minnesota
4322 U. H. Wilken Die Revolver-Lady
4323 U. H. Wilken Sterben am Washita
4324 U. H. Wilken Langmesser
4325 U. H. Wilken Der Bärentöter
4326 U. H. Wilken Manitoba
4327 U. H. Wilken Yellow River
4328 U. H. Wilken Land der Sioux
4329 U. H. Wilken Todesvögel
4330 U. H. Wilken Shinto
4331 U. H. Wilken Blutmond
4332 U. H. Wilken Der Skalphügel
4333 U. H. Wilken Todestrommeln
4334 U. H. Wilken Skalpjäger
4335 U. H. Wilken Fort Lincoln
4336 U. H. Wilken Sky
4337 U. H. Wilken Canatta-Kid
4338 U. H. Wilken Sioux-Poker
4339 U. H. Wilken Die steinerne Squaw
4340 U. H. Wilken Rote Fracht
4341 U. H. Wilken Sun
DIE STEINERNE SQUAW
DAN OAKLAND STORY
BUCH 39
U. H. WILKEN
Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen
und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.
In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.
Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.
Copyright © 2024 Blitz-Verlag, eine Marke der Silberscore Beteiligungs GmbH, Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier
Redaktion: Alfred Wallon
Titelbild: Rudolf Sieber-Lonati
Umschlaggestaltung: Mario Heyer
Satz: Gero Reimer
Alle Rechte vorbehalten.
www.Blitz-Verlag.de
ISBN: 978-3-689-84320-5
4339 vom 21.02.2025
INHALT
Die Steinerne Squaw
Faustrecht der Prärie
Anmerkung
Über den Autor
DIE STEINERNE SQUAW
Hell sprühten die klaren Wasser des Bergflusses über die Felsklippen. Zwischen den Erlen und Birken im kleinen Tal stieg schwacher Rauch aus der Holzglut eines Lagerfeuers empor. Junge Indianer hängten Büffelfleisch in den Rauch. Scheckige Ponys weideten am Ufer des Flusses. Das Lachen der zufriedenen Jäger füllte das friedliche Tal. Die Jungen saßen auf ihren Fersen rund um das Feuer und hielten auf Äste gespießtes Fleisch in die Glut. Wie einen Windfang hatten sie das riesige Büffelfell zwischen den Bäumen ausgespannt. Es spendete Schatten und schützte sie vor der sengenden Sonne. Aber sie konnten dadurch auch nicht sehen, was sich am Talende tat. Dort tauchten Reiter auf. Das Moos unter den Bäumen dämpfte den Hufschlag ihrer Pferde. Matt schimmerten die Gewehre in ihren Fäusten. Der Wind trug ihnen die Stimmen der jugendlichen Sioux zu. Die Reiter sahen einander an und sprachen kein Wort Boshafter Triumph verzerrte ihre Gesichter. Lautlos trieben sie die Pferde an und jagten den steilen Talhang hinunter.
Das dumpfe Geräusch der herandonnernden Hufe ließen die jungen Indianer hochschnellen. Sie konnten nicht sehen, was da herantobte. Das Büffelfell nahm ihnen die Sicht.
Mit hellen Schreien hetzten sie zum Feuer und griffen zu ihren Waffen.
Schüsse zerrissen die friedliche Stille des Tals. Blei durchschlug das aufgespannte Büffelfell und zerfetzte es. Kugeln stießen die Holzglut auseinander, Reiter preschten um die lichten Bäume. Blasses Mündungsfeuer stach aus den Läufen der Gewehre hervor.
Die Schüsse streckten zwei Indianer nieder. Mit aufgerissenem Rücken stürzte ein dritter in das zerstampfte Gras. Eine Kugel, aus nächster Nähe abgefeuert, zertrümmerte den Kopf des vierten. Ein Blutschwall schoss über die Felsen am Ufer. Zuckende Körper rollten ins Wasser, und eine Blutwolke färbte den Fluss rot.
Schrill wiehernd, tobten die Pferde über den Lagerplatz. In Panik flohen Ponys durch den Fluss. Im Feuer verkohlte das Fleisch.
Ein einziger der jungen Indianer versuchte zu entkommen. In Todesangst irrte er um die Birken und sprang blindlings in den Fluss. Der Körper tauchte auf. Nass klebte das blauschwarze Haar im Nacken. Bronzefarben glänzte die nasse Haut. Verzweifelt kraulte der Junge zum anderen Ufer hinüber. Noch war er im Fluss als einer der Weißen das Gewehr kaltblütig an die Schulter setzte und schoss.
Blei durchschlug das Rückgrat. Flatternde Hände griffen zum Himmel. Klatschend fiel der Körper in das Wasser zurück und trieb in der schwachen Strömung langsam an der Sandbank vorbei.
Der Knall der tödlichen Schüsse verhallte in der Weite des Indianerlandes.
Die weißen Mörder sprangen von den Pferden und zogen ihre Messer. Gierig machten sie sich über ihre Beute her und achteten nicht auf ihre Umgebung.
Ein großer schwerer Mann erschien am Talhang. Auf seiner Schulter lag eine Antilope, die er für seinen Sohn und dessen junge Frau erlegt hatte: Dan Oakland, der Trapper. Sein Sohn Sky hatte aus dem Lande der Comanchen die hübsche kleine Sun mitgebracht. Sie sollte das Herz von Dakota kennenlernen, wo Sky eine glückliche Kindheit verbracht hatte.
Dan Oakland blieb stehen und ließ die Antilope fallen.
Er sprang auf einen Felsen am Hang und hob die Winchester an.
Die Unmenschen rissen den Indianern die Skalpe von den Schädeln. Unruhig tänzelten die Sattelpferde auf dem Lagerplatz.
Im Fluss stand ein Halunke und zerrte den erschossenen jungen Sioux an den Haaren auf die Sandbank.
In der Rechten blitzte die scharfe Klinge des Bowiemessers. Schon setzte er das Messer an und wollte den Indianer skalpieren.
Am Talhang peitschte die Winchester in den Händen des Trappers auf. Catch-the-Bear Dan Oakland schoss auf den Halunken im Fluss. Leblos kippte er zurück und rutschte von der Sandbank. Die Beine schlugen hoch, die Stiefel zogen Furchen in den Sand. Dann verschwand er im Wasser.
Blitzschnell repetierte Dan Oakland und jagte das nächste Blei durch das Tal. Die Kugel fauchte über den Fluss hinweg und verfehlte einen der Skalpjäger nur um Haaresbreite.
Mit blutigen Skalpen rannten die Kerle zu den Sattelpferden, rissen die Tiere an den Zügeln hinter sich her und nutzten sie als Deckung aus. So konnten sie hinter Bäumen und Felsen verschwinden.
Vom seichtblauen Himmel strahlte die Sonne heiß in das Tal. Träge trieb ein Körper im Fluss, Ponys standen weit abseits und wieherten klagend.
Dan Oakland wartete hinter dem Felsen und spähte über den Fluss. Er war entschlossen, die mörderischen Reiter bei einem Angriff aus dem Sattel zu schießen.
Aber sie griffen nicht an. Sie jagten in wilder Flucht unter den Bäumen am Fluss entlang und waren nur als huschende Schatten wahrzunehmen.
Dan wartete mit dem Gewehr im Anschlag. Jetzt überquerten die Mörder eine kleine Lichtung. Sofort drückte Dan ab. Einer der Halunken fiel vom Pferd und überschlug sich am Boden.
Hals über Kopf ritten die anderen davon und durchquerten das Tal. Im Galopp näherten sie sich dem engen Talausgang, wo rote Felsen zu einem Hohlweg zusammenrückten.
Langsam senkte Dan die Winchester. Die Spannung seiner Muskeln löste sich. Erschüttert blickte er auf die leblosen Körper im Fluss und schüttelte den Kopf. Sky und Sun mussten warten.
* * *
Sky, der Sohn des Trappers, stand auf einem der roten Felsen über dem Hohlweg. Er hatte Schüsse gehört.
Ein Schuss — das konnte ein Jagdschuss des Vaters gewesen sein. Aber was ihn aufgeschreckt hatte waren Detonationen aus verschiedenen Waffen.
Sky horchte den Hohlweg hinunter. Da nahte das Getrappel von mehreren Hufen. Die Tiere wurden offenbar vorangehetzt.
Mit der Geschmeidigkeit einer Raubkatze sprang Sky vom Felsen und lief den zerklüfteten Hang abwärts. In der Hand hielt er seine Winchester.
Schon polterten die Pferde über Geröll hinweg.
Auf langen Beinen lief Sky um die schlanken Fichten. Er sah die Reiter unter sich, glitt durch einen Felsspalt und duckte sich auf einem hervorspringenden Felsen.
Das Reiterrudel hatte sich aufgelöst. Einzeln jagten die Halunken durch den Hohlweg.
Sky machte sich bereit spannte die Muskeln an und berechnete Sprungzeit und Entfernung.
Jetzt kam der letzte Reiter näher — und Sky warf sich vom Felsen. Er stürzte in die Tiefe, als wollte er in die Wasser eines tiefen Sees springen.
Schwer prallte er auf Reiter und Pferd. Das Tier knickte in den Beinen ein und drohte zusammenzubrechen. Sky und der Halunke stürzten zu Boden. Der Schrei des Banditen erstickte unter dem Faustschlag des jungen Oakland. Mit leerem Sattel lief das Pferd weiter. Voller Kraft riss Sky den Bewusstlosen hoch, warf ihn sich über die Schulter, packte sein Gewehr und schleppte den Mann über den Talhang.
Die Reiter hielten an und schrien nach ihrem Komplizen. Laut vervielfachte das Echo die Stimmen im Hohlweg. Dann kamen die Reiter zurück und suchten.
Sky hörte ihre Flüche und Verwünschungen. In kalter Ruhe trug er den Bewusstlosen zwischen die Bäume und blieb mit der Last auf den Schultern stehen.
Aufgewirbelter Staub wallte aus dem Hohlweg empor. Die Banditen zögerten noch.
Entschlossen warf Sky den Skalpjäger zu Boden und glitt abwärts. Hinter einem Baumstamm ging er in Deckung und hielt sein Gewehr zum Kampf bereit.
Vom fernen Talhang tönte ein Wolfsschrei herüber.
Erleichtert atmete Sky auf, denn jetzt wusste er, dass sein Vater lebte.
Im Hohlweg klapperten beschlagene Hufe. Das Reiterrudel entfernte sich. Totenstille trat ein.
Sky stieg empor, lud sich den Bewusstlosen wieder auf die Schultern und trug ihn zum Talrand.
Hinter den rauschenden Douglasfichten standen drei Pferde. Zwischen den Bäumen erschien Sun — schön, zierlich und in weicher Lederkleidung. Sie lief ihm entgegen und suchte nach Verletzungen an seinem Körper.
Über sein braunes schmales Gesicht huschte flüchtiges Lächeln.
„Du wirst mich noch lange haben, Sun.“
Sie sah ihm nach, wie er den Fremden zum Lagerplatz trug. Hastig folgte sie ihm. Er warf den Skalpjäger auf den Waldboden und legte ihm lederne Fesseln an.
„Bleib bei ihm, Sun!“ sagte er. „Ich muss zu meinem Vater. Wenn der Halunke schreit, schlag ihm eins auf den Kopf.“
Er drückte ihr seinen langläufigen Colt in die zierliche Hand und fuhr weich über ihre Wange.
„Ja, Sky“, antwortete sie leise.
Er nickte, sprang auf und lief zu den Pferden, sattelte sie und ritt mit dem Pferd seines Vaters am Zügel davon.
* * *
Schwer stapfte Dan Oakland durch den Fluss und erreichte die Sandbank. Er zog den leblosen Indianer hoch und trug ihn auf den verwüsteten Lagerplatz. Behutsam legte er ihn ab und ging dann umher.
Wind blähte das durchschossene Büffelfell. Skalpiert lagen die jungen Menschen unter der heißen Sonne. Der Sioux, den Dan aus dem Fluss geborgen hatte, war der einzige, der nicht skalpiert worden war.
Reglos stand Dan zwischen den Toten.
„Himmel“, kam es dumpf über seine Lippen, „sie mussten sterben, weil ihre Skalpe vierzig Dollar wert sind.“
Er betrachtete die blutüberströmten Gesichter. Der Qualm des Lagerfeuers wehte ihm ins Gesicht. Seine Augen tränten. Er fuhr sich über das graue Gesicht und wandte sich ab. Er ging zum Wasser und setzte sich auf einen flachen Felsen.
Zusammengesunken wartete er auf seinen Sohn.
Als Sky mit den Pferden am Talhang erschien, leuchteten Dans Augen einen Herzschlag lang auf. Er liebte seinen Jungen über alles. Jetzt umso mehr, als er die viehisch entehrten jungen Toten vor sich sah. Den Schändern dieser Jugend musste das Handwerk gelegt werden.
Im Galopp kam Sky heran, jagte durch den Fluss, dass das Wasser hoch aufspritzte, und warf sich vom Pferd, hielt beide Tiere am Zügel und blickte sich um.
Im Gesicht zuckte es.
Aus braunen Augen sah er seinen Vater an.
„Ja“, sagte Dan schwer, „sie sind alle tot, mein Junge.“
„Hunkpapa Sioux. Das ist doch nicht ihr Gebiet.“
Dan erhob sich und stieß die Fellmütze vom aschgrauen Haar.
„Ich weiß, Sky. Die Hunkpapa haben ihr Dorf in der Paha Sapa, im Herzen von Dakota. Jetzt ist die Zeit der Jagd. Viele Sioux sind unterwegs. Manchmal werden sie sogar von ihren Squaws begleitet.“
„Glaubst du, dass ihr Lager hier in der Nähe ist?“
„Das werden wir bald wissen, Sky.“
„Ich fang die Ponys ein.“
Dan nickte und blickte dem davonreitenden Sohn nach. Wie unter einer schweren Last stapfte er dann gebeugt umher und trug die Toten zusammen. Mit seinem scharfen Messer zerschnitt er das Büffelfell und hüllte damit die geschändeten Köpfe der Indianer ein.
Die weißen Skalpjäger begrub er.
Sky kam mit den Ponys heran. Sie legten die Indianer bäuchlings auf die Tiere und schnürten sie fest.
Dann ritten sie durch das Tal.
Sie ließen die Ponys mit den Toten im Schatten der Bäume und traten an die Feuerstelle heran. Sun kniete neben dem Weißen, der zu sich gekommen war, und hielt den Colt.
Der bärtige Gefangene drehte den Kopf herum und starrte Sky hasserfüllt an.
„Dreckiger Indianer! Bring mich doch um, du mieses Stück Vieh!“
Sky war zu stolz, um über den Kerl herzufallen. Er nahm Sun die Waffe ab und zog sie hoch, legte den Arm um sie und ging mit ihr davon.
Als der Skalpjäger Dan Oakland erblickte, ruckte er hoch und zerrte an den Fesseln.
„Du bist doch ein Weißer wie ich“, keuchte er. „Mach mich los!“
Dan Oakland ging in die Hocke und schürte das Feuer. Er achtete darauf, dass sich kein Rauch entwickelte, der ihren Platz verraten könnte.
„Warum sagst du nichts. Trapper?“ fauchte der Skalpjäger. „Mann, was zögerst du? Wir haben nur das getan, was auch alle anderen tun. Die beiden, die da weggegangen sind, sind doch dreckige Rothäute.“
Langsam zog Dan sein Messer und hielt die Klinge in die Flammen. Er hüllte sich in düsteres Schweigen und spürte die wilden Blicke des Gefangenen auf seinem Gesicht.
„He, was tust du da? Du brauchst das Messer nicht heißzumachen, um die Fesseln zu durchschneiden.“
Dan drehte die Klinge des Jagdmessers und schien den Skalpjäger überhaupt nicht gehört zu haben. Er tat so, als wäre er völlig allein.
„Verdammt nochmal, warum sagst du nichts? He, hältst du etwa zu den Stinktieren?“
Jetzt blickte Dan auf.
„Der junge Mann ist mein Sohn. Das junge Mädchen ist seine Frau. Wenn du die beiden weiterhin mit deinem Geifer beschmutzen willst, jag ich dir dieses Messer ins Herz.“
Der Skalpjäger atmete pfeifend aus und erblasste. Er blieb mit aufgerichtetem Oberkörper steif sitzen und brauchte Zeit, um alles zu begreifen.
„So ist das also“, ächzte er. „Dann wirst du mich also umbringen.“
„Schon möglich. Wenn du mir nicht sagst, wer du bist und wer die anderen sind. Du wirst mir auch sagen, wohin sie reiten.“
„Ja. ich sag’s dir. Aber nicht sofort!“ höhnte der Skalpjäger. „Meine Freunde verrate ich nicht so schnell. Erst muss ich wissen, ob du dein Wort hältst und mich freilässt.“
Dan schüttelte energisch den Kopf.
„Du kannst mich nicht erpressen. Dein Leben ist noch nicht einmal einen Skalp wert. Was glaubst du, elender Kerl was wird geschehen, wenn wir dich den Hunkpapa ausliefern?“
„Bist du verrückt? Du kannst mich doch nicht den Indianern zum Fraß vorwerfen. Die Indsmen werden mich am Marterpfahl rösten.“
„Stimmt. Also antworte.“
„Nein, nicht jetzt!“
„Du willst Zeit gewinnen? So schnell finden deine Komplizen uns nicht. Außerdem laufen wir vor ihnen nicht weg.“
„Ich könnte dich erwürgen.“
Dan blieb ruhig. Er sah an dem Gefangenen vorbei und auf die toten Indianer. Er hatte es schwer, nicht die Beherrschung zu verlieren.
„Man sagt, dass ein Mann überlebt, auch wenn er skalpiert worden ist, wenn man ihm sofort mit einem glühenden Messer die Wunden schließt.“
Erschrocken starrte der Skalpjäger auf das Messer in Dans Hand.
„Das — bringst du — fertig?“
„Warum nicht? Auf den Ponys liegen tote Indianer. Sie wurden grausam niedergemacht. Wer bist du denn schon, Halunke? Glaubst du denn, dass du ewig leben wirst? Überleg dir alles genau. Der Tag geht zu Ende. Wenn der Mond über den Bergen steht, wirst du alles sagen — oder die Hunkpapa werden dir das Leben zur Hölle machen.“
Hart stieß Dan das glühende Messer in den Boden, richtete sich auf und holte eins der Indianerponys heran. Er packte den Gefangenen und warf ihn mit Bärenkraft bäuchlings vor dem toten Indianer auf das Pony. Dann zertrat er die Glut des Feuers.
Sky und Sun kamen zurück.
Sie brachen auf und zogen durch die Wildnis des Siouxlandes. Die Sonne wanderte nach Westen. In den Wäldern riefen die Käuze. Lange Schatten fielen von den Bergen und Hügeln in die weiten Niederungen.
In langer Reihe trotteten die Ponys mit den toten Sioux durch die Dämmerung. Catch-the-Bear Dan Oakland ritt voraus und suchte den Weg. Sky und Sun ritten am Schluß.
* * *
Aus bläulichen Nebelschwaden ragte der Höhenzug in den rotglühenden Abendhimmel.
Reiter und Pferde verschwanden in den dichten Nebelfeldern.
Allmählich tauchten bizarre Felsklippen vor Dan auf. Der Pfad war steil. Er sah windzerzauste Bäume am Hang und hoch oben vor dem flammenden Himmel schroffe Felsengrate.
„Sky“, rief er leise zurück, „lass den Halunken auf dem Pony sitzen!“
Sein Sohn ritt heran und blickte ihn ernst an.
„Warum soll das Pony sich schinden. Dad?“
Dan suchte im Gesicht seines Sohnes nach einem Hauch von Hass, fand aber nur, Abscheu.
„Dein Einwand ist gut, Sky. Soll er laufen! Hol ihn vom Pony.“
Sky nickte und strich sich das Haar aus dem ernsten Gesicht.
Wortlos zog er sein Pferd herum und ritt zum Pony, auf dem der Bandit lag. Er löste die Fußfesseln und riß ihn vom Pony. Schwer fiel der Halunke auf den Rücken. Das Gesicht war krebsrot. Stöhnend wälzte er sich herum und starrte Sky an.
„Steh auf!“ befahl Sky kalt. „Du gehst voraus. Dort drüben beginnt der Pfad. Versuch nicht, zu fliehen.“
„Was habt ihr mit mir vor?“ krächzte der Skalpjäger.
„Wir wollen keine Zeit verlieren. Hinter diesem Höhenzug muss das Lager der Hunkpapa sein. Das ist alles.“
Hart stieß er mit der Winchester gegen die Schulter des Halunken. Stöhnend richtete der Bandit sich auf. Mit gefesselten Händen taumelte er vor Sky her und nach vorn.
„Ist das wahr, was dein Halfbreed gesagt hat, Trapper? Ihr wollt mich den Hunkpapa ausliefern?“
„Ja. Auf dem Höhenzug hast du deine letzte Chance. Danach geht es bergab — auch für dich.“
Der Bandit zitterte. Der Gedanke, gemartert zu werden, ertrug er nicht.
„Das könnt ihr nicht zulassen. Die Indsmen bringen mich langsam um. Drei Tage und drei Nächte lang werde ich sterben. So lässt man nicht einmal einen Hund krepieren.“
Dan Oaklands Gesicht war ausdruckslos.
„Hunde sind manchmal auch besser als Menschen. Vorwärts!“
Sky saß ab und trieb den Halunken vor sich her. Beide erreichten den Pfad. Schwankend stieg der Bandit höher. Seine Flüche erstickten im Dunst des Tals.
Die junge schöne Sun ritt zu Dan und suchte seine Nähe. Sie legte die Hand auf seinen Arm und blickte Sky und dem Banditen nach.
„Mach dir keine Sorgen, mein Kind“, sprach Dan beruhigend. „Der Pfad sieht nur von hier unten aus so gefährlich und tückisch aus. Steig vom Pferd! Wir folgen ihnen zu Fuß.“
Noch war die Sonne nicht ganz untergegangen. Am Berghang herrschte Halbdunkel. Sky zog sein Pferd hinter sich her und hielt die Winchester in der Armbeuge. Vor ihm stieg der Bandit hoch. Jetzt folgten Sun und Dan mit den Pferden und Ponys und den toten Indianern. Immer wieder blickte der Halunke zurück.
Felsen säumten den Pfad. Steine lösten sich und rollten in die Tiefe.
* * *
Im Tal hielten mehrere Reiter und beobachteten die Menschen und die Tiere, die aus dem Talnebel gekommen waren und die Kammhöhe erreichen wollten.
Sie konnten ihren Komplizen an den gefesselten Händen erkennen.
„Dorado“, raunte einer, „du schießt. Du triffst am sichersten.“
Der Reiter namens Dorado zog das Gewehr aus dem Scabbard, lud durch, und setzte den Kolben in die Schulter. Mitleidlos suchte er über den nebelfeuchten Lauf ein Ziel.
* * *
Sky sah. wie der Halunke stehenblieb und die gefesselten Hände ausstreckte.
„Nimm mir die Fesseln ab, Bastard! Ich kann mich nirgendwo festhalten.“
„Weiter!“ befahl Sky.
Er ließ sich von diesem blutrünstigen Skalpjäger nicht reizen. Sky hatte viel von seinem Vater geerbt — Ruhe und Unerschütterlichkeit, Härte und Stolz. Niemand konnte Sky beleidigen.
Der Bandit blickte Sky mit vor Anstrengung geröteten Augen bösartig an und gab auf. Keuchend stieg er weiter, rutschte aus, fiel auf die Knie, brachte sich wieder hoch und erreichte die Kammhöhe, trat in das rote Licht des sterbenden Tages hinein und blieb stehen Vor ihm lagen die Täler. Hügel und Berge des Indianerlandes. Wälder rauschten im Abendwind. Die ersten Sterne waren erst noch glitzernde Punkte am Firmament.
Sky ließ den Banditen nicht aus den Augen.
Langsam folgte er nach.
Noch hatte er nicht die Kammhöhe erreicht, als unten um dunstigen Tal Schüsse fielen.
Zuckend richtete der Skalpjäger sich auf. Er öffnete den Mund zu einem lautlosen Schrei und kippte gegen einen Felsen, prallte ab und stürzte zurück. Schlenkernd rollte er abwärts und auf Sky zu. Hart riß Sky am Zügel und brachte sich und sein Pferd zur Seite.
Der Körper des Banditen flog an ihm vorbei, durchbrach das Gestrüpp am Hang, wurde von den Felsen herumgerissen. Geröll löste sich und polterte abwärts. Am Hang wieherten die Pferde und tobten die Ponys. Abseits des Pfades stürzte der Bandit in die Tiefe.
Wieder krachten Schüsse.
Blei schlug gegen den Hang.
In diesem Moment sackte die Sonne jenseits des Siouxlandes weg.
Der Hang lag dunkel unter dem Himmel. Die heimtückischen Schützen konnten die Menschen und Tiere an der Bergflanke nicht erkennen.
„Sky!“ brüllte Dan.
„Alles in Ordnung, Dad!“
Dan lenkte die Ponys, sein und Suns Pferd hinter die Felsen am Hang und zog Sun an sich heran.
Oberhalb ihrer Deckung brachte Sky sich und sein Pferd in Sicherheit.
Die Schüsse klangen dumpf. Im dunstigen Tal flammte es immer wieder orangefarben auf. Die Oaklands mussten in der Deckung bleiben. Kugel klatschten gegen die Felsen und jaulten als Querschläger weiter. Weder Dan noch sein Sohn schossen zurück. Das Mündungsfeuer würde ihren Platz verraten.
„Verdammtes Gesindel“, grollte Dan. „Die Halunken haben ihren Komplizen erschossen, damit er sie nicht verrät. Feine Menschen sind das. Hol der Teufel sie alle!“
„Wer ist der Teufel?“ fragte Sun und blickte ihn mit ihren großen dunklen Augen an.
„Den gibt es nur unter den Weißen, Sun. Ihr Indianer kennt so einen Burschen nicht. Steck den Kopf ein!“
Er drückte Sun hinunter. Wieder prasselte Blei gegen die Deckung. Eisern hielt Dan die Zügel fest. Die Tiere versuchten, sich loszureißen. Sie würden unweigerlich abstürzen und verenden.
Im Tal wurde es still.
Bald würde der Mond aufgehen. Dann würde es im Tal hell werden. Dan und Sky könnten die Verfolger erkennen und auf sie gezielte Schüsse abgeben.
Das mussten auch die Halunken erkannt haben. Plötzlich war Hufschlag zu hören.
Die Banditen jagten im Schutz der Nebelwand davon.
„Lauf voraus, Sun!“
Dan zerrte die Tiere hinter sich her. Oben auf der jetzt dunklen Kammhöhe erschien Sky mit seinem Pferd. Sun hastete zu ihm und umfasste seinen Arm. Mühsam brachte Dan die Ponys und Pferde nach oben. Kurz darauf verschwanden sie hinter den Felsklippen.
Die Nacht brach herein.
Bleich und hell stieg der Mond hinter den Wäldern und Bergen empor und tauchte das Indianerland in kaltes Licht.
Langsam ging Dan zurück und sah über das Tal. Er konnte die Skalpjäger nirgendwo entdecken. Für den abgestürzten Mann kam jede Hilfe zu spät. Der Tod hatte ihn bereits auf der Kammhöhe ereilt.
Der Duft von harzigem Holz wehte herauf. Die Wildnis schwieg.
Nachdenklich verharrte Dan im Wind.
Auf einmal kam sein Sohn zu ihm.
„Ich hab mit Sun gesprochen, Dad. Sie ist einverstanden.“
„Womit, Sky? Worüber habt ihr gesprochen?“
Sky hob die Hand und zeigte über das Tal, wo die Skalpjäger untergetaucht waren. Sein Haar flatterte wie die Mähne eines Pferdes und glänzte im Mondlicht wie Rabengefieder.
„Wir verlieren ihre Spur, wenn ich ihnen nicht sofort folge. Ich hinterlasse euch deutliche Zeichen. Dann finden wir uns wieder, Dad.“
Dan legte ihm die Hand auf die Schulter.
„Ich weiß, was dich bewegt. In dir ist Siouxblut, und die Hunkpapa sind Sioux. Wenn du den Halunken folgst, denke nicht wie ein Indianer. Lass dich von keinem Menschen sehen. Bleib ihnen immer in sicherer Entfernung auf der Spur. Es sind zu viele für dich allein.“
„Ja, Vater.“
Sky umarmte seinen Vater und ging zurück, nahm sein Pferd am Zügel und stieg in das Tal hinunter.
Sun kam langsam zu Dan und sagte kein Wort. Sorge war in ihren Augen, doch eine Indianerin verbarg ihre Gefühle und Empfindungen. Nur der Tod der geliebten Menschen brachte die Indianer zum Weinen und Klagen.
„Irgendwo wird Sky auf mich warten. Sun.“
„Auf dich und auf mich“, verbesserte sie leise. „Ich komm mit dir. Ich will nicht bei den Hunkpapa bleiben.“
Dan lächelte weich.
„Wir werden erst einmal zu den Hunkpapa reiten, Sun Dann wird sich alles finden. Komm, mein Kind!“
Sun sah noch einmal in das Tal hinunter, wo Sky im Nebel untertauchte. Sie atmete tief ein und folgte dem Trapper. Kurze Zeit später zogen sie mit den Toten abwärts.
* * *
Es war Tag.
Wie versteinert standen die Hunkpapa vor ihren Zelten. Krähenfedern bewegten sich kaum im heißen Wind. Aus den Lagerfeuern stieg der Rauch hoch und löste sich auf. Hunde kläfften.
Langsam ritten Dan Oakland und Sun näher.
Die Ponys trugen ihre traurigen Lasten. Schlaff hingen die Arme der Toten hinunter.
Nur das Bellen der Hunde war zu hören, sonst nichts. Keine der Squaws schrie auf, keins der Kinder weinte.
Alle waren erstarrt.
„Bleib mit den Ponys hier, Sun.“
Dan ritt allein weiter.
Die Hunkpapa betrachteten den bulligen Mann in der Wolfskleidung.
Langsam ritt Dan an den Stangen und Gestellen vorbei, an denen das Büffelfleisch für den Winter trocknete.
Vor den Indianern stieg er vom Pferd und zeigte ihnen die offene Rechte. Er machte die Zeichen des Friedens und der Freundschaft und sagte: „Ich bin Catch-the-Bear.“
Sein Blick schweifte durch das kleine Lager der wenigen Zelte. Es war kein Dorf. Es war eines der Lager, die die Männer aufbauten, bevor sie hier oder anderswo auf die Jagd gingen.
Er konnte keinen einzigen jungen Mann erblicken. Alles waren Frauen, Kinder und Greise.
Mit langem schlohweißen Haar schritt ein Greis durch das Lager. Die knochige Rechte hielt einen Stock, auf den er sich stützte. Vor Dan blieb er stehen. Trübe Augen blickten Dan an.
„Die Hunkpapa haben von Catch-the-Bear gehört“, sagte er dumpf. „Der Tag ist hell. Die Sonne wärmt. Doch Nacht ist in unsere Herzen gedrungen. Uns ist kalt.“
Dan merkte, dass der Greis sich bemühte, nicht nach den Ponys und den Toten zu sehen.
„Sie fielen tapfer im Kampf gegen Bleichgesichter, alter Mann“, sprach er. Seine Worte wurden immer schleppender. „In eure Wigwams kehrt Trauer ein. Ich konnte euren tapferen Männern nicht mehr rechtzeitig helfen. Manitu hatte mir kein Zeichen gegeben.“
„Catch-the-Bear spricht mit dem Herzen.“ Der Greis machte eine weitausholende Bewegung mit der zitternden Hand. „Er bringt uns die Nacht und den Schmerz, doch er ist unser Freund.“
„Ich danke dir, alter Mann.“
Der Greis drehte sich um und schritt humpelnd zu den anderen alten Männern. Die Squaws und Kinder bewegten sich noch immer nicht. Winselnd liefen die Hunde um die Ponys, sprangen hoch und leckten die bloßen Hände und Arme der Toten.
Dan stand still wie ein Baum im Sturm. Seine Wurzeln hatten sich schon längst tief in das Erdreich des Indianerlandes gegraben. Er wollte für immer in Dakota leben und hier auch sein Grab finden.
Die Greise sprachen miteinander. Jeder sagte nur zwei, drei Worte, und dazwischen herrschte jedes Mal längeres Schweigen.
Der Greis kam mit den anderen zu Dan.
„Die Krieger der Hunkpapa sind zu Tatanka Yotanka geritten. Die Bleichgesichter gaben ihm den Namen Sitting Bull. Die Dörfer sind leer. Die Squaws und die Kinder kriechen nachts in die leeren Zelte und warten auf die Rückkehr ihrer Männer und Väter. Es ist wichtig, was Tatanka Yotanka ihnen zu sagen hat, sonst hätte er sie nicht gerufen, denn es ist Zeit zum Jagen. Unsere jungen. Männer müssen auf die Jagd gehen. Sie haben gelernt, den Tomahawk zu halten, doch sie haben noch nicht gegen die Bleichgesichter gekämpft... Mein weißer Bruder Catch-the-Bear soll uns begleiten.“
Dan ging an seiner Seite zu den Ponys. Sun war vom Pferd gestiegen und zog es zur Seite.
Die Greise nahmen die Zügel der Ponys und führten die Tiere in das kleine Lager. Hier lösten sie die Schnüre und hoben die Toten von den Ponys. Mit ihrer letzten Kraft legten sie die Toten nebeneinander auf den Boden. Als sie die Köpfe der Toten freilegen wollten, streckte Dan die Hand aus. Stumm und starr blickten sie ihn an.
In einem der Zelte stöhnte eine Squaw. Sie hatte Wehen bekommen.
„Die Bleichgesichter hatten Messer“ sagte Dan.
Die Greise verstanden den Sinn dieser Worte. Sie gingen in die Knie und legten die knochigen Hände auf die Körper der Toten.
Im Lager schrien die Squaws gequält auf und warfen sich zu Boden. Sie wimmerten und weinten. Sie trugen den Schmerz auf den Lippen. Die Schreie sollten den Krampf ihres Herzen lösen. Sie schlugen mit den Händen auf den staubigen Boden, und ihre Klagen kamen als schauriges Echo von den Bergflanken zurück.
Die Kinder weinten wie ihre Mütter. Längst hatten diese Kleinen die grausame Zeit einer beginnenden Ausrottung durch die Weißen begriffen.
In der Hitze des Sommertages rann Dan Oakland der Schweiß über die Stirn. Um seinen Mund zuckte es. Er presste die Lippen zusammen und schritt an den Toten und den Greisen entlang, blieb vor einem Toten stehen und löste die Büffelhaut vom Kopf.
Das Gesicht des jungen Hunkpapa zeigte noch den Todesschmerz.
Lauter wurden die Klagelieder der Squaws. Die meisten Squaws waren noch sehr jung — sechzehn Jahre alt. Es waren die Frauen der Toten. Ihre Männer waren mit achtzehn und neunzehn Jahren in die ewigen Jagdgründe gegangen.
Unter den Indianern wurde jung geheiratet und früh gestorben.
Ein Greis drückte sich mühsam hoch und schritt zum Zelt, in dem eine Squaw lag. Er schlug die Felle beiseite und trat ein.
Eine Frau schrie.
Steif drehte Dan sich um und blickte zu Sun hinüber. Die junge Comanchin war blass geworden, doch sie hielt tapfer durch.
Still standen die Ponys unter der Sonne, Die Hunde jaulten und winselten. Kinder krochen um die Toten und versuchten, die Büffelhaut von den Gesichtern zu lösen. Sie suchten ihre Väter.
Der Greis kam wieder aus dem Zelt. Hinter ihm erschien eine hochschwangere junge Squaw. Sie schleppt sich zu dem jungen Indianer, der als einziger nicht skalpiert worden war, und fiel auf die Knie. Unter den Schmerzen der Wehen küsste sie das Gesicht und zog mit zitternden Händen den Tomahawk aus seinem Gürtel hervor. Dann schwankte sie aus dem Lager und verschwand hinter den Felsen im Schatten der Bäume.
Langsam ging Dan zu Sun.
„Wohin geht sie?“ hauchte sie und sah dorthin, wo die junge Squaw verschwunden war.
„Sie wird ihr Kind gebären, Sun.“
„Warum bleibt sie nicht im Zelt? Jede Comanchin tut es.“
Dan schluckte schwer und blickte über das Lager hinweg. Er roch den Wind der Weite und der Wildnis und antwortete: „Im Land der Comanchen ist ewiger Staub. Der Flugsand hört niemals auf und treibt jede Comanchin in ihr Tipi. Aber hier, Sun — hier ist die Luft klar, hier atmen die Wälder. Keine Sioux gebärt ihr Kind unter den Augen der anderen. Sie will in dieser Stunde allein sein.“
„Kann ich ihr nicht helfen?“
„Nein.“
Er ging zurück und sprach mit den Greisen. Sie sollten wissen, wer die jungen Männer umgebracht hatte und warum die Weißen es getan hatten.
Vom Schmerz fast überwältigt, presste der Greis die Hand gegen die Brust.
„Ich spürte das Alter in meinen Händen. Catch-the-Bear“. rief er gequält. „Ich kann den Tomahawk nicht mehr umfassen. Was sollen wir tun? Unsere Krieger sind weit fort. Unsere jungen Jäger sind tot. Ihre Squaws weinen und klagen — und Manitu hört sie nicht. Wo ist der Himmel der Sioux, mein Bruder? Wo ist das Licht der Jahre geblieben? Das Land der Indianer, wo es genug Büffel gab, wo die Vögel den Himmel verdunkelten, so viele sind es gewesen. Dakota atmet so schwach wie mein Körper. Dakotas Haar ist weiß geworden.“
Erschüttert stützte Dan den schwankenden Greis.
„Ich werde diese Bleichgesichter jagen. Ich werde die Skalpe eurer Krieger zurückholen.“
„Du bist ein Weißer, mein Bruder.“
„Daran denke ich nicht. Mein Sohn Sky the Walker und ich werden die Bleichgesichter finden. Ihre Skalpe sollen im Land Dakota dörren.“
Am Talhang ertönte ein Aufschrei, der den Klagegesang der Squaws übertönte.
Dan ruckte herum und sah, wie Sun unter den Bäumen hervorkam. Sie lief schwankend zu ihrem Pferd und fiel dagegen, presste das Gesicht an den Pferdehals und weinte.
„Ich muss jetzt gehen“, murmelte Dan und wandte sich ab. Mit dem Pferd am Zügel ging er zu Sun.
Sie zitterte und schluchzte.
„Warum hat sie das getan? Warum nur?“
„Du wolltest ihr helfen, Sun? Sie wollte keine Hilfe. Sie hat ihr Kind zur Welt gebracht und es getötet, und dann hat sie sich selbst umgebracht.“
„Ja!“ stöhnte Sun.
„Ihr Mann war nicht mehr am Leben, Sun. Sein Leben war in ihrem Leib. Aber sie wollte nicht weiterleben. Der Schmerz war zu groß. Jetzt ist sie mit dem Kind wieder bei ihm.“
„Die Comanchen töten nur die Kinder, die nicht gesund sind“, flüsterte Sun und sah ihn mit tränennassem Gesicht an. „Wenn ein Krieger einen Sohn haben will und ein Mädchen bekommt, ist sein Zorn manchmal so groß, dass er das Mädchen tötet und die Squaw verkauft. Aber dieses Kind war gesund. Es sah so — so lieb — so ...“ Sie konnte nicht mehr weitersprechen und umklammerte Dan.
Er strich über ihr Haar und gab ihr das Gefühl von Geborgenheit. Als sie sich beruhigt hatte, hob er sie auf das Pferd und stieg in den Sattel.
Sie ritten aus dem Tal der Hunkpapa.
Noch an diesem Tag überquerten sie den Höhenzug und erreichten den Fluss, wo das Massaker geschehen war. Am Hang, wo Dan die Antilope zurückgelassen hatte, flogen Aaskrähen auf.
Vor Einbruch der Nacht entdeckten sie Skys Zeichen.
Die Spur der Mörder lag vor ihnen.
* * *
Unerbittlich folgte Sky den marodierenden Skalpjägern, blieb wie ein drohender Schatten hinter ihnen.
Sky war wie besessen. Er konnte den Anblick der toten jungen Hunkpapa nicht aus seinem Gedächtnis verbannen.
In der klaren Mondnacht glitt er von seinem Pferd, kniete auf der Spur nieder und tastete behutsam die Eindrücke der beschlagenen Hufe ab.
Schnell richtete er sich auf und lauschte in die Stille hinein.
Fünf Reiter waren vor ihm — fünf Halunken, die den Mord im Herzen trugen. Fünf Gegner, die ihn umbringen würden, wenn sie merkten, dass er ihnen folgte.
Sie alle hatten viehisch getötet. Keiner von ihnen konnte sich freisprechen von der Schuld.
Kein Geräusch unterbrach die Stille in der Bergfalte. Tiefe Schattenfelder konnten die Skalpjäger verbergen.
Er musste damit rechnen, jederzeit auf ihr Lager zu stoßen.
Sie konnten nicht ewig im Sattel sein. Die Pferde brauchten eine Rast, sonst würden sie nach ein paar Meilen zusammenbrechen.
Sky stieg in den Sattel und verließ die Spur. Dicht neben einem Baum verhielt er kurz und durchschnitt mit dem scharfen Messer die Baumrinde. Das war ein weiteres Zeichen für seinen Vater.
Das Pferd trug ihn unter die Bäume. Leise schlugen die Hufe. Geäst streifte sein Gesicht. Er duckte sich tief und spähte ständig wachsam und suchend umher.
Längst befand er sich in der Bergfalte. Der Nachtwind stieß hindurch und brachte die Bäume in Bewegung. Das Rascheln übertönte die leisen Geräusche der Nacht.
Erschreckt glaubte Sky, Lichtschein vor sich zu sehen. Im Nu war er vom Pferd und legte die Hand auf die weichen Nüstern.
Er konnte keine Stimmen hören, obwohl der Wind ihm entgegenkam. Dennoch riskierte er nichts. Er musste den Halunken auf den Fersen bleiben und feststellen, wohin sie ritten. Ein Kampf gegen sie könnte seinen Tod bedeuten, denn er war allein.