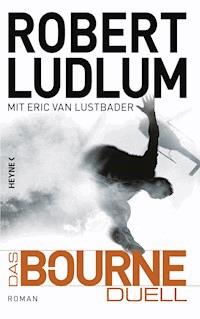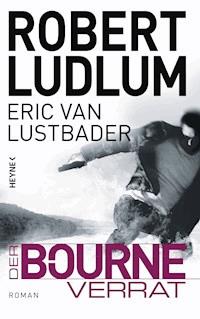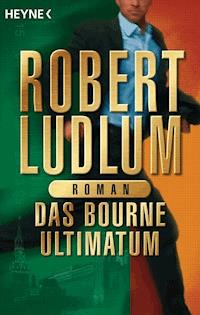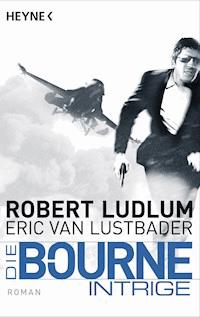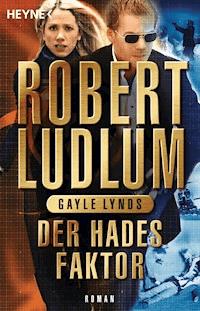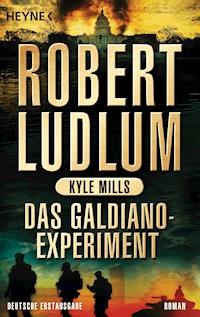9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JASON BOURNE
- Sprache: Deutsch
Bourne is back!
In den Kinoverfilmungen mit Matt Damon und Franka Potente erreichten die Bourne-Thriller ein Millionenpublikum. Jetzt wird die Trilogie fortgesetzt: David Webb glaubt, seine Identität als Jason Bourne für immer hinter sich gelassen zu haben. Doch die Vergangenheit ruht niemals.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 854
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Zum Andenken an Bob
Prolog
Chalid Murat, der Führer der tschetschenischen Rebellen, saß unbeweglich im mittleren Fahrzeug der kleinen Kolonne, die sich ihren Weg durch die zerbombten Straßen von Grosny bahnte. Die Schützenpanzer BTR-60 BP stammten aus russischen Beständen, sodass der Konvoi als solcher sich nicht von all den anderen unterschied, die auf Streifenfahrt durch die Stadt rasselten. Murats schwer bewaffnete Männer hockten in den beiden anderen Fahrzeugen – eines vor und eines hinter seinem eigenen. Sie waren zum Krankenhaus Nummer neun unterwegs, das zu den sechs oder sieben Verstecken gehörte, die Murat benützte, um drei Schritte vor den russischen Truppen zu bleiben, die nach ihm fahndeten.
Murat hatte einen schwarzen Vollbart, die tapsigen Bewegungen eines Bären und den feurigen Blick eines wahren Eiferers. Er hatte frühzeitig gelernt, dass man nur mit eiserner Faust herrschen konnte. Er war dabei gewesen, als Jochar Dudajew erfolglos die Scharia, das religiöse Gesetz des Islams, eingeführt hatte. Er hatte das Blutbad erlebt, mit dem alles angefangen hatte, als von Tschetschenien aus operierende Kriegsherren, ausländische Verbündete Osama bin Ladens, in Daghestan eingefallen waren und in Moskau und Wolgodonsk Bombenanschläge hatten ausführen lassen, denen zweihundert Menschen zum Opfer gefallen waren. Als diese von Ausländern verübten Anschläge fälschlicherweise tschetschenischen Terroristen zugeschrieben wurden, hatten die Russen mit ihren verheerenden Bombenangriffen auf Grosny begonnen und große Teile der Hauptstadt in Trümmer gelegt.
Der Himmel über der Stadt war verschleiert, durch ständige Zufuhr von Asche und Schlacke getrübt; in dem Dunst entstand ein schimmerndes Leuchten, das so stark war, dass es fast radioaktiv wirkte. Überall in der Trümmerlandschaft brannten blakende Ölfeuer.
Chalid Murat starrte durch die getönte Panzerglasscheibe, als die Kolonne am ausgebrannten Skelett eines Gebäudes vorbeirollte: massiv, imposant aufragend, das dachlose Innere von flackernden Flammen erfüllt. Er grunzte, wandte sich an seinen Stellvertreter Hassan Arsenow und sagte: »Grosny war einst die Heimatstadt von Liebespaaren, die auf den breiten, von Bäumen gesäumten Boulevards flanierten, von Müttern, die Kinderwagen über die begrünten Plätze schoben. Der große Zirkus war jeden Abend ausverkauft, voller fröhlicher, lachender Gesichter, und Architekten aus aller Welt pilgerten hierher, um die prachtvollen Gebäude zu sehen, die Grosny einst zu einer der schönsten Städte der Welt gemacht haben.«
Er schüttelte trübselig den Kopf, schlug dem anderen kameradschaftlich aufs Knie. »Allah, Hassan!«, rief er aus. »Sieh es dir genau an! Die Russen haben alles zerstört, was gut und schön war!«
Hassan Arsenow nickte. Er war ein lebhafter, energischer Mann, volle zehn Jahre jünger als Murat. Als ehemaliger Biathlet hatte er die breiten Schultern und schmalen Hüften eines geborenen Athleten. Als Murat zum Führer der Rebellen aufgestiegen war, hatte Arsenow ihn begleitet. Jetzt machte er Murat auf ein ausgebranntes Gebäude rechts vor ihnen aufmerksam. »Vor dem Krieg«, sagte er nachdrücklich ernst, »als Grosny noch ein Raffineriezentrum war, hat mein Vater dort im Öl-Institut gearbeitet. Statt Gewinnen aus der Ölförderung bekommen wir jetzt Großbrände, die unsere Luft und unser Wasser verunreinigen.«
Die beiden Aufständischen verfielen angesichts der ausgebombten Gebäude, zwischen denen sie hindurchfuhren, und der leeren Straßen, über die nur Aasfresser – menschliche und tierische – huschten, in bedrücktes Schweigen. Als sie sich wenige Minuten später einander zuwandten, stand Schmerz über die Leiden ihres Volkes in ihrem Blick. Murat wollte etwas sagen … und erstarrte dann, weil unverkennbar Geschosse gegen ihr Fahrzeug prasselten. Er brauchte einen Augenblick, um zu erkennen, dass der Schützenpanzer mit Handfeuerwaffen beschossen wurde, deren Geschosse die massive Panzerung jedoch nicht durchschlagen konnten. Arsenow, stets wachsam, griff nach dem Mikrofon ihres Funkgeräts.
»Ich lasse die Besatzung unserer Begleitfahrzeuge zurückschießen.«
Murat schüttelte den Kopf. »Nein, Hassan. Überleg doch! Wir fahren zur Tarnung in russischen Uniformen mit russischen Schützenpanzern. Wer uns beschießt, ist eher ein Verbündeter als ein Feind. Das müssen wir feststellen, bevor wir das Blut von Unschuldigen vergießen.«
Er nahm Arsenow das Mikrofon aus der Hand und ließ die Fahrzeuge halten.
»Leutnant Gotschijajew«, sagte er über Funk, »schicken Sie einen Stoßtrupp zur Erkundung los. Ich will wissen, wer uns beschießt, aber den Schützen soll nichts geschehen.«
Im Führungsfahrzeug befahl Leutnant Gotschijajew seinen Männern, in Deckung des bewaffneten Konvois auszuschwärmen. Er folgte ihnen auf die mit Trümmern übersäte Straße hinaus, zog in der schneidenden Kälte die Schultern hoch. Mit präzisen Handzeichen dirigierte er seine Männer so, dass sie die vermutliche Feuerstellung auf beiden Seiten umgingen.
Die Männer waren gut ausgebildet: Sie bewegten sich rasch und lautlos von Trümmerbrocken zu Mauerresten und zu verbogenen Metallträgern hinüber, blieben stets geduckt und boten so möglichst kleine Ziele. Allerdings fielen keine weiteren Schüsse. Den abschließenden Angriff begannen sie gemeinsam: eine Zangenbewegung, die den Gegner einschließen und durch mörderisches Kreuzfeuer vernichten sollte.
Im mittleren Fahrzeug beobachtete Hassan Arsenow weiter die Stelle, auf die Gotschijajews Männer zuhielten, und wartete auf eine wilde Schießerei, doch die Feuerstöße aus den Sturmgewehren blieben aus. Stattdessen tauchten in der Ferne Kopf und Schultern des Leutnants auf. Mit Blick zu dem mittleren BTR-60 BP bewegte er den erhobenen rechten Arm bogenförmig, um zu signalisieren, das Gebiet sei gesichert. Auf dieses Zeichen hin zwängte Chalid Murat sich an Arsenow vorbei, stieg aus dem Schützenpanzer und marschierte ohne zu zögern durch die kältestarren Ruinen auf seine Männer zu.
»Chalid Murat!«, rief Arsenow besorgt und lief hinter seinem Anführer her.
Murat hielt jedoch sichtlich unbekümmert auf einen niedrigen Mauerrest zu, hinter dem die Schüsse abgegeben worden waren. Sein Weg führte an mehreren Müllhaufen vorbei; auf einem lag ein weißer Leichnam mit wächserner Haut, der schon vor einiger Zeit seiner Kleidung beraubt worden war. Selbst aus größerer Entfernung traf einen der Verwesungsgestank wie ein Keulenschlag. Arsenow holte Murat schließlich ein und zog seine Pistole.
Als Murat den Mauerrest erreichte, standen seine Männer mit schussbereiten Waffen rechts und links davon aufgebaut. Der böige Wind pfiff und heulte durch die Ruinen. Der metallisch düstre Himmel verfinsterte sich noch mehr, und es begann zu schneien. Eine dünne Schneeschicht bedeckte rasch die Kappen von Murats Stiefeln und bildete ein Netz im drahtigen Gewirr seines Vollbarts.
»Leutnant Gotschijajew, Sie haben die Angreifer aufgespürt ?«
»Das habe ich.«
»Allah leitet mich in allen Dingen; er leitet mich auch diesmal. Lassen Sie sie mich sehen.«
»Es ist nur einer«, antwortete Gotschijajew.
»Einer?«, rief Arsenow. »Wer? Hat er gewusst, dass wir Tschetschenen sind?«
»Ihr seid Tschetschenen?«, fragte eine dünne Stimme. Hinter der Mauer tauchte das blasse Gesicht eines Jungen von kaum mehr als zehn Jahren auf. Er trug eine schmutzige Wollmütze, einen durchgewetzten Pullover über mehreren karierten Hemden, eine geflickte Hose und viel zu große rissige Gummistiefel, die er vermutlich einem Toten ausgezogen hatte. Obgleich er noch ein Kind war, hatte er die Augen eines Erwachsenen; sie beobachteten alles mit einer Mischung aus Vorsicht und Misstrauen. Er stand schützend über einer nicht detonierten russischen Rakete, die er geborgen hatte, um Brot kaufen zu können – vermutlich das Einzige, was zwischen seiner Familie und dem Hungertod stand. In der linken Hand hielt er eine Pistole; sein rechter Arm endete am Handgelenk. Murat sah gleich wieder weg, aber Arsenow starrte den Armstumpf weiter an.
»Eine Schützenmine«, sagte der Junge herzzerreißend nüchtern. »Von den Russenschweinen gelegt.«
»Allah sei gepriesen! Was für ein kleiner Soldat!«, rief Murat aus, indem er den Jungen mit seinem strahlenden, entwaffnenden Lächeln bedachte. Es war genau dieses Lächeln, das seine Leute angezogen hatte wie ein Magnet Eisenfeilspäne. »Komm, komm.« Er winkte ihn zu sich heran, hielt dann die leeren Handflächen hoch. »Wie du siehst, sind wir Tschetschenen wie du.«
»Wenn ihr Tschetschenen seid«, sagte der Junge, »wieso fahrt ihr dann mit russischen Schützenpanzern herum?«
»Wie kann man sich besser vor dem russischen Wolf verbergen, ha?« Murat kniff die Augen zusammen und lachte, als er sah, dass der Junge eine Gjursa hatte. »Du trägst die Pistole der russischen Elitetruppen. Solche Tapferkeit muss belohnt werden, stimmt’s?«
Murat kniete neben dem Jungen nieder und fragte ihn nach seinem Namen. Als er ihn erfahren hatte, fuhr er fort: »Asnor, weißt du, wer ich bin? Ich bin Chalid Murat, und auch ich möchte das russische Joch abschütteln. Gemeinsam können wir’s schaffen, nicht wahr?«
»Ich wollte nie auf tschetschenische Landsleute schießen«, sagte Asnor. Mit seinem verstümmelten Arm deutete er auf die Kolonne. »Ich hab gedacht, da käme eine satschistka.« Damit meinte er die von russischen Soldaten auf der Suche nach mutmaßlichen Rebellen durchgeführten barbarischen Säuberungen. Bei diesen satschistkas waren über zwölftausend Tschetschenen ermordet worden; zweitausend waren einfach verschwunden, unzählige andere waren verletzt, gefoltert, verstümmelt oder vergewaltigt worden. »Die Russen haben meinen Vater und meine Onkel ermordet. Wärt ihr Russen, hätte ich euch alle umgebracht.« Ein Krampf aus Wut und Verzweiflung zog über sein Gesicht.
»Das glaube ich dir«, sagte Murat feierlich. Er zog einige Geldscheine aus der Tasche. Der Junge musste seine Pistole in den Hosenbund stecken, um die Scheine mit der Linken entgegenzunehmen. Murat beugte sich zu ihm hinüber und flüsterte mit Verschwörermiene: »Pass auf, ich sage dir, wo du Munition für deine Gjursa kaufen kannst, damit du vorbereitet bist, wenn die nächste satschistka kommt.«
»Danke!« Asnor rang sich ein Lächeln ab.
Chalid Murat flüsterte ihm etwas ins Ohr, dann stand er auf und klopfte dem Jungen auf die Schulter. »Allah sei mit dir, kleiner Soldat, und mit allem, was du tust.«
Der Tschetschenenführer und sein Stellvertreter beobachteten, wie der kleine Junge mit dem unter den Arm geklemmten Blindgänger über die Ruinen kletterte und verschwand. Dann kehrten sie zu ihrem Fahrzeug zurück. Mit angewidertem Grunzen knallte Hassan die Panzerstahltür zu, um die Außenwelt – Asnors Welt – auszuschließen. »Bedrückt es dich nicht, dass du ein Kind in den Tod geschickt hast?«
Murat sah zu ihm hinüber. Der Schnee in seinem Bart war zu leicht zitternden Tropfen geschmolzen, sodass er in Arsenows Augen eher an einen Imam als an einen Kommandeur erinnerte. »Ich habe diesem Kind – das den Rest seiner Familie ernähren und kleiden und vor allem beschützen muss, als sei es ein Erwachsener – Hoffnung und ein bestimmtes Ziel gegeben. Kurz gesagt: Ich habe ihm einen Lebenszweck gegeben.«
Verbitterung machte Arsenows Gesicht blass und hart; er starrte Murat böse an. »Russische Kugeln werden ihn zerfetzen.«
»Glaubst du das wirklich, Hassan? Dass Asnor dumm oder – noch schlimmer – leichtsinnig ist?«
»Er ist nur ein Kind.«
»Ist die Saat einmal ausgebracht, keimen die Triebe auch in kargstem Boden. So war’s schon immer, Hassan. Glaube und Mut jedes Einzelnen wachsen und vervielfältigen sich, bis aus diesem einen zehn, zwanzig, hundert, tausend Kämpfer geworden sind!«
»Und in dieser ganzen Zeit wird unser Volk ermordet, vergewaltigt, verprügelt, ausgehungert, wie Vieh eingesperrt. Das reicht nicht, Chalid. Das ist nicht mal andeutungsweise genug!«
»In dir steckt noch die Ungeduld der Jugend, Hassan.« Murat packte ihn an der Schulter. »Nun, das sollte mich nicht überraschen, stimmt’s?«
Arsenow, der sich von Murat bemitleidet fühlte, biss die Zähne zusammen und wandte den Blick ab. Draußen machte der Schnee Luftwirbel sichtbar, die wie tschetschenische Derwische in ekstatischer Trance über die Straße wirbelten. Murat hielt das anscheinend für eine Bestätigung der Bedeutsamkeit dessen, was er eben getan hatte, was er zu sagen im Begriff stand. »Du musst Vertrauen haben«, sagte in besänftigendem, weihevollem Tonfall, »zu Allah und zu diesem mutigen Jungen.«
Zehn Minuten später hielt die Kolonne vor dem Krankenhaus Nummer neun. Arsenow sah auf seine Uhr. »Es ist fast soweit«, sagte er. Dass die beiden im selben Fahrzeug saßen, war ein Verstoß gegen die üblichen Sicherheitsbestimmungen, der sich nur mit der extremen Wichtigkeit des Anrufs, den sie erwarteten, rechtfertigen ließ.
Murat beugte sich nach vorn und drückte auf einen Knopf, und zwischen ihnen und dem Fahrer und den vier Leibwächtern fuhr eine schalldichte Trennwand in die Höhe. Die fünf Männer waren gut ausgebildet; sie starrten weiter nach vorn durch die Panzerglasscheibe.
»Erzähl mir, welche Bedenken du hegst, Chalid, da nun der Augenblick der Wahrheit bevorsteht.«
Murat zog seine buschigen Augenbrauen nach Arsenows Meinung übertrieben verständnislos hoch. »Bedenken?«
»Willst du nicht, was uns rechtmäßig zusteht, Chalid, was Allah uns bestimmt hat?«
»Du bist sehr impulsiv, mein Freund. Das weiß ich nur zu gut. Wir haben oft Seite an Seite gekämpft – wir haben gemeinsam getötet, und wir verdanken einander unser Leben, nicht wahr? Nun hör mir zu. Ich leide mit unserem Volk. Seine Qualen erfüllen mich mit Zorn, den ich kaum beherrschen kann. Das weißt du vermutlich besser als jeder andere. Aber die Geschichte warnt vor dem, was man am liebsten täte. Die Folgen dessen, was uns vorgeschlagen wird …«
»Was wir selbst geplant haben!«
»Ja, geplant haben«, bestätigte Murat. »Aber die Folgen müssen bedacht werden.«
»Vorsicht«, sagte Arsenow verbittert. »Immer Vorsicht!«
»Mein Freund.« Chalid Murat lächelte, als er den anderen an der Schulter packte. »Ich will nicht irregeführt werden. Ein leichtsinniger Gegner ist schnell besiegt. Du musst lernen, aus Geduld eine Tugend zu machen.«
»Geduld!«, knurrte Arsenow. »Dem Jungen von vorhin hast du keine Geduld ans Herz gelegt. Du hast ihm Geld gegeben und ihm gesagt, wo er Munition kaufen kann. Du hast ihn auf die Russen gehetzt. Jeder Tag, den wir vergeuden, ist ein Tag, an dem dieser Junge und tausend andere wie er ihr Leben riskieren. Ich sage dir, die gesamte Zukunft Tschetscheniens hängt davon ab, wie wir uns entscheiden.«
Murat rieb sich mit kreisenden Bewegungen seiner Daumen die Augen. »Es gibt andere Wege, Hassan. Es gibt immer andere Wege. Vielleicht sollten wir überlegen, ob …«
»Dafür ist keine Zeit mehr. Die Ankündigung ist erfolgt, das Datum festgelegt. Der Scheich hat Recht.«
»Der Scheich, ja.« Chalid Murat schüttelte den Kopf. »Immer der Scheich.«
In diesem Augenblick klingelte das Autotelefon. Murat sah zu seinem treuen Gefährten hinüber, dann schaltete er ruhig den Lautsprecher ein. »Ja, Scheich«, sagte er in ehrerbietigem Ton. »Hassan und ich sind beide hier. Wir erwarten deine Befehle.«
Hoch über der Straße, auf der die Schützenpanzer mit laufenden Motoren standen, kauerte auf einem Flachdach eine Gestalt, die ihre Ellbogen auf die niedrige Brüstung gestützt hatte. Hinter der Brüstung lag ein Sako TRG-41, ein finnisches Scharfschützengewehr mit Drehkammerverschluss – eine der vielen Waffen, die der Mann selbst modifiziert hatte. Ihr Schaft aus Aluminium und Polyurethan machte sie ebenso leicht wie tödlich treffsicher. Er trug einen russischen Tarnanzug, der durchaus zu dem asiatischen Schnitt seines glatten Gesichts passte.
Über der Uniform hatte er ein leichtes Gurtzeug aus Kevlar angelegt, an dem ein Karabinerhaken hing. In seiner Rechten hielt er einen mattschwarzen Kasten von der Größe einer Zigarettenschachtel. Das war ein kleiner Sender, in dessen Vorderseite zwei Knöpfe eingelassen waren. Den Mann umgab Stille wie eine Aura, die andere Menschen einschüchterte. Es war, als verstünde er sich auf Stille, als könne er sie in sich sammeln, manipulieren und schlagartig wie eine Waffe einsetzen.
In seinen schwarzen Augen stand die gesamte Welt, und die Straße, die Gebäude, die er jetzt betrachtete, waren nicht mehr als Kulissen. Er zählte die tschetschenischen Soldaten, als sie aus den Begleitfahrzeugen stiegen. Es waren achtzehn Mann; die Fahrer blieben auf ihren Plätzen, und im mittleren BTR-60 BP saßen außer den beiden Hauptpersonen noch mindestens vier Leibwächter.
Als die Rebellen das Krankenhaus durch den Haupteingang betraten, um es zu sichern, drückte er den oberen Knopf der Fernsteuerung, zündete die C4-Ladungen und ließ den Eingang einstürzen. Die Druckwelle erschütterte die Straße und ließ die schweren Fahrzeuge auf ihren überdimensionierten Stoßdämpfern schwanken. Die von der Detonation erfassten Rebellen wurden zerrissen oder von herabstürzenden Trümmern erschlagen, aber er wusste, dass zumindest einige der am weitesten in das Gebäude eingedrungenen Rebellen überlebt haben könnten – eine Möglichkeit, die er bei der Planung berücksichtigt hatte.
Während die erste Detonation noch in seinen Ohren nachhallte und bevor der Staub sich gesetzt hatte, sah der Attentäter auf die Fernsteuerung in seiner Hand hinunter und drückte den zweiten Knopf. Mit ohrenbetäubendem Knall flog die mit Schlaglöchern übersäte Makadamstraße vor und hinter dem Konvoi in die Luft.
Während die Männer unter ihm sich noch abmühten, das von ihm angerichtete Blutbad zu begreifen, nahm der Attentäter mit methodischer, nicht überhasteter Präzision die Präzisionsbüchse zur Hand. Das Gewehr war mit nicht zerlegenden Vollmantelgeschossen geladen, mit den leichtesten und schnellsten Geschossen, die es für diese Waffe gab. Das IR-Zielfernrohr zeigte ihm drei Rebellen, die die Detonationen mit nur leichten Verletzungen überlebt hatten. Sie rannten zum mittleren Fahrzeug und kreischten ihre Kameraden an, sie sollten schleunigst aussteigen, bevor es ebenfalls hochgehe. Er beobachtete, wie sie die rechte Tür aufrissen, damit Hassan Arsenow und ein Leibwächter aussteigen konnten. Damit befanden sich drinnen noch der Fahrer und drei Leibwächter mit Chalid Murat. Als Arsenow sich abwandte, zielte der Attentäter auf seinen Kopf. Durchs Zielfernrohr sah er den starr befehlenden Ausdruck auf Arsenows Gesicht. Dann bewegte er mit glatter, geübter Bewegung die Mündung seiner Waffe und zielte nun auf den Oberschenkel des Tschetschenen. Als der Scharfschütze abdrückte, griff Arsenow sich ans linke Bein und brach mit einem Aufschrei zusammen. Einer der Rebellen lief zu ihm hinüber und schleifte ihn in Deckung. Die beiden anderen Männer stellten rasch fest, woher der Schuss gekommen war, hetzten über die Straße und stürmten in das Gebäude, auf dessen Dach der Scharfschütze kauerte.
Als drei weitere Rebellen aus einem Seitenausgang des Krankenhauses gestürmt kamen, ließ der Scharfschütze das TRG-41 fallen. Er beobachtete jetzt, wie der Fahrer des Schützenpanzers mit Chalid Murat krachend den Rückwärtsgang einlegte. Hinter und unter sich konnte er hören, wie Stiefel die Treppe zu seinem Versteck hinaufpolterten. Weiterhin gelassen brachte er Spikes aus Titan und Korund an seinen Stiefeln an. Dann hob er eine Armbrust aus Verbundmaterial, schoss den Bolzen mit einem Seil in einen Lichtmast genau hinter dem mittleren Schützenpanzer und band das Seil an der Brüstung fest, damit es straff war. Aufgeregte Stimmen drangen an sein Ohr. Die Rebellen hatten das Stockwerk unter ihm erreicht.
Der BTR-60 BP war jetzt von vorn sichtbar, während sein Fahrer versuchte, mitten zwischen den von der Detonation aufgeworfenen riesigen Brocken aus Beton, Granit und Makadamplatten zu wenden. Der Scharfschütze konnte die beiden Scheiben, die gemeinsam die Windschutzscheibe ergaben, sanft glänzen sehen. Das war ein Problem, das die Russen noch nicht gelöst hatten: Das schussfeste Panzerglas war so schwer, dass die Windschutzscheibe zweigeteilt sein musste. Die verwundbare Stelle des Schützenpanzers war der Metallrahmen zwischen den beiden Scheiben.
Er hakte den Karabiner seines Gurtzeugs in das straff gespannte Seil ein. Gut dreißig Meter hinter sich hörte er die Rebellen auf das Flachdach stürmen. Als sie den Scharfschützen entdeckten, warfen sie sich herum, um im Laufen auf ihn zu schießen, wobei sie unbemerkt gegen einen dünnen Draht rannten. Im nächsten Augenblick verschwanden sie in der Detonation der letzten C4-Ladung, die der Attentäter am Vorabend angebracht hatte.
Ohne sich umzudrehen, um das Blutbad hinter sich zu begutachten, prüfte der Mann das Seil und schwang sich über die Dachbrüstung. Als er das Seil hinunterglitt, hob er so die Beine, dass die Spikes auf das Mittelstück zwischen den beiden Panzerglasscheiben zielten. Traf er es nicht ganz genau, würde es halten – und er hatte gute Chancen, sich ein Bein zu brechen.
Die Wucht des Aufpralls zuckte durch seine Beine bis ins Rückgrat nach oben, während die Titan- und Korundspikes das Mittelstück wie eine Konservenbüchse eindrückten, sodass die Scheiben nach innen fielen. Mit großen Teilen der Windschutzscheibe krachte er durch die Fensteröffnung ins Fahrzeuginnere. Ein Brocken traf den Fahrer am Hals und trennte ihm fast den Kopf vom Rumpf. Der Attentäter warf sich nach links. Der Leibwächter auf dem Beifahrersitz war mit dem Blut des Fahrers bedeckt. Er griff nach seiner Pistole, doch der Attentäter packte mit starken Händen seinen Kopf und brach ihm das Genick, bevor er einen Schuss abgeben konnte.
Die beiden anderen Leibwächter auf den Notsitzen direkt hinter dem Fahrer schossen wild auf den Attentäter, der ihren Kameraden vor sich hielt und dessen Körper als Kugelfang nutzte. Aus dieser improvisierten Deckung heraus benützte er die Pistole des Toten, um beide Leibwächter mit je einem Schuss in die Stirn zu erledigen.
Damit war nur noch Chalid Murat übrig. Das Gesicht des Tschetschenenführers war eine von Hass verzerrte Maske. Er hatte die Tür aufgestoßen und rief laut nach seinen Männern. Der Attentäter sprang ihn an und schüttelte den großen Mann wie ein Terrier eine Bisamratte; Murats Kiefer schnappten zu und hätten ihn fast ein Ohr gekostet. Ruhig, methodisch, fast genüsslich legte er Murat die Hände um den Hals, starrte ihm ins Gesicht und drückte beide Daumen in den Ringknorpel des Kehlkopfs des Tschetschenen. Murats Hals füllte sich augenblicklich mit Blut, was ihm alle Kraft raubte und ihn langsam erstickte. Er schlug wild um sich; seine Hände trafen Gesicht und Kopf des Attentäters. Aber das nützte nichts mehr. Murat ertrank im eigenen Blut. Seine Lunge füllte sich, und seine Atmung wurde unregelmäßig, röchelnd. Er spuckte Blut, dann verdrehte er die Augen nach oben.
Der Attentäter ließ den schlaffen Körper sinken, kletterte wieder auf den Vordersitz und stieß die Leiche des Fahrers aus der Tür. Bevor die letzten überlebenden Rebellen reagieren konnten, legte er den ersten Gang ein und gab Vollgas. Der BTR-60 BP schoss vorwärts wie ein Rennpferd aus der Startmaschine, überwand die Hindernisse aus Beton und Makadam und schien sich dann in Luft aufzulösen, als er in dem Krater verschwand, den eine der Sprengladungen in die Straße gerissen hatte.
Unter der Erde schaltete der Attentäter hoch und raste durch die enge Röhre eines Abwasserkanals davon, den die Russen verbreitert hatten, um ihn für Überfälle auf Stellungen der Rebellen benützen zu können. Funken flogen, als die Stahlkotflügel immer wieder die halbkreisförmig betonierten Tunnelwände streiften. Trotzdem war er jetzt in Sicherheit. Sein Einsatz hatte geendet, wie er begonnen hatte: mit der perfekten Präzision eines Uhrwerks.
Nach Mitternacht verzogen die giftigen Wolken sich allmählich und gaben endlich den Blick auf den Mond frei. Die mit Schadstoffen belastete Atmosphäre ließ ihn rötlich leuchten, und sein sanftes Licht wurde hier und da von den noch immer brennenden Feuern überstrahlt.
Zwei Männer standen mitten auf einer stählernen Bogenbrücke. Unter ihnen spiegelten sich die verkohlten Trümmer, die ein endloser Krieg zurückgelassen hatte, in träge fließendem Wasser.
»Auftrag ausgeführt«, sagte der erste Mann. »Chalid Murat ist auf eine Weise ermordet worden, die größtes Aufsehen erregen muss.«
»Ich hatte nicht weniger erwartet, Chan«, antwortete der zweite Mann. »Sie verdanken Ihren glänzenden Ruf nicht zuletzt den Aufträgen, die Sie von mir erhalten haben.« Er war eine Handbreit größer als der Attentäter, breitschultrig, langbeinig. Beeinträchtigt wurde seine Erscheinung nur durch die bis zum Hals hinunter seltsam glasige, völlig unbehaarte Haut der linken Gesichthälfte. Er besaß das Charisma eines geborenen Führers … eines Mannes, mit dem nicht zu spaßen war. Man merkte ihm an, dass er in Machtzentren zu Hause war – in öffentlichen Foren ebenso wie in den dunklen Gassen von Verbrechervierteln.
Chan genoss noch immer den Blick, mit dem Murat gestorben war. Dieser Blick war bei jedem anders. Aus Erfahrung wusste Chan, dass es keine Gemeinsamkeit gab, denn das Leben jedes Mannes war einzigartig, und obwohl alle sündigten, war die von diesen Sünden bewirkte Korrosion bei jedem anders – wie die Struktur einer Schneeflocke, die sich niemals wiederholte. Was war es bei Murat gewesen? Nicht Angst. Erstaunen, ja, Zorn, gewiss, aber auch eine tiefere Empfindung: Trauer über ein nun unvollendet bleibendes Lebenswerk. Die Analyse des letzten Blicks war immer unvollständig, das wusste Chan. Beispielsweise hätte er gern erfahren, ob auch ein Element des Verrats mitgespielt hatte. Hatte Murat gewusst, wer seine Ermordung befohlen hatte?
Er sah wieder zu Stepan Spalko auf, der ihm einen dicken Umschlag mit Geld hinhielt.
»Ihr Honorar«, sagte Spalko. »Und ein Bonus.«
»Bonus?« Als von Geld die Rede war, konzentrierte Chan sich sofort auf die Gegenwart. »Von einem Bonus haben wir nie gesprochen.«
Spalko zuckte mit den Schultern. Das rötliche Mondlicht ließ Wange und Halsseite wie eine blutige Masse leuchten. »Chalid Murat war Ihr fünfundzwanzigster Auftrag für mich. Nennen wir’s meinetwegen eine Jubiläumsprämie.«
»Sehr großzügig von Ihnen, Mr. Spalko.« Chan steckte den Umschlag ein, ohne einen Blick hineinzuwerfen. Alles andere wäre höchst ungehörig gewesen.
»Ich habe Sie gebeten, mich Stepan zu nennen. Schließlich sage ich Chan zu Ihnen.«
»Das ist etwas anderes.«
»Warum?«
Chan stand unbeweglich da, nahm die Stille in sich auf. Sie sammelte sich in ihm, ließ ihn größer und breitschultriger wirken.
»Ich brauche mich Ihnen gegenüber nicht zu rechtfertigen, Mr. Spalko.«
»Ach, kommen Sie«, sagte Spalko mit einer beschwichtigenden Geste. »Wir sind doch keine Fremden. Wir teilen die ungeheuerlichsten Geheimnisse.«
Die Stille nahm zu. Irgendwo in den Außenbezirken von Grosny erhellte eine Detonation den Nachthimmel, und Feuerstöße aus Maschinenpistolen knatterten in der Ferne wie Explosionen von Kinderknallkörpern.
Endlich sprach Chan. »Im Dschungel habe ich zwei lebenswichtige Lektionen gelernt. Die erste war, dass man nur sich selbst rückhaltlos trauen kann. Und die zweite war, dass es wichtig ist, penibel auf zivilisierte Umgangsformen zu achten, denn allein die Tatsache, dass man seinen Platz in der Welt kennt, steht zwischen einem selbst und der Anarchie des Dschungels.«
Spalko betrachtete ihn lange nachdenklich. Das Flackerlicht der Schießerei stand in Chans Augen, verlieh ihnen einen wilden Ausdruck. Spalko stellte ihn sich im Dschungel vor: das Opfer von Entbehrungen, die Beute von Gier und zügelloser, blutiger Grausamkeit. Der Dschungel Südostasiens war eine Welt für sich. Ein barbarisches, verpestetes Gebiet mit eigenen, seltsamen Gesetzen. Dass Chan dort nicht nur überlebt hatte, sondern gediehen war, stellte – zumindest für Spalko – den größten Teil des Mysteriums dar, das ihn umgab.
»Ich würde gern glauben, wir wären mehr als Geschäftsmann und Auftraggeber.«
Chan schüttelte den Kopf. »Der Tod hat einen besonderen Geruch. Ich rieche diesen Geruch an Ihnen.«
»Und ich an Ihnen.« Über Spalkos Gesicht zog ein langsames Lächeln. »Sie stimmen mir also zu, dass uns etwas Besonderes verbindet.«
»Wir sind Männer mit Geheimnissen«, sagte Chan, »nicht wahr?«
»Wir beten den Tod an – wir verstehen beide seine Macht.« Spalko nickte zustimmend. »Ich habe mitgebracht, worum Sie mich gebeten haben.« Er hielt ihm einen schwarzen Schnellhefter hin.
Chan sah kurz in Spalkos Augen. Sein scharfes Ohr hatte einen gewissen gönnerhaften Ton wahrgenommen, den er unverzeihlich fand. Wie er schon vor langer Zeit gelernt hatte, lächelte er über diese Kränkung und verbarg seine Empörung hinter der undurchdringlichen Maske seines Gesichts. Eine weitere Lektion, die er im Dschungel gelernt hatte: Impulsiv und heißblütig zu handeln führte oft zu Fehlern, die sich nicht mehr gutmachen ließen; geduldig abzuwarten, bis das heiße Blut abgekühlt war, war die Grundlage für jede erfolgreiche Rache. Er griff nach dem Schnellhefter und beschäftigte sich damit, das Dossier aufzuschlagen. Es enthielt ein einziges Blatt Luftpostpapier mit drei eng getippten Absätzen und dem Passfoto eines gut aussehenden Mannes. Unter dem Foto stand ein Name: David Webb. »Das ist alles?«
»Aus vielen Quellen zusammengetragen. Alle über ihn bekannten Informationen.« Er sprach so flüssig, dass Chan sich sicher war, dass er die Antwort eingeübt hatte.
»Aber dies ist der Mann?«
Spalko nickte.
»Ohne jeden Zweifel?«
»Todsicher.«
Nach dem sich ausbreitenden Feuerschein zu urteilen, war die Schießerei zu einem Nachtgefecht geworden. Granatwerfer waren zu hören, ein Feuerregen ging nieder. Über ihnen schien der Mond in einem dunkleren Rot zu glühen.
Chan kniff die Augen zusammen und ballte die rechte Hand langsam zu einer hasserfüllten Faust. »Ich konnte nie eine Spur von ihm finden. Ich dachte, er sei tot.«
»In gewisser Weise«, sagte Spalko, »ist er das.«
Er beobachtete, wie Chan über die Brücke davonging. Er zündete sich eine Zigarette an, inhalierte den Rauch und atmete ihn widerstrebend aus. Als Chan in den Schatten verschwunden war, zog Spalko sein Handy aus der Jackentasche und tippte eine Auslandsnummer ein. Eine Stimme meldete sich, und Spalko sagte: »Er hat das Dossier. Ist alles vorbereitet?«
»Ja, Sir.«
»Gut. Um Mitternacht Ihrer Zeit beginnen Sie mit dem Einsatz.«
Teil eins
Kapitel eins
David Webb, Linguistikprofessor an der Georgetown University, verschwand fast hinter dem Stapel korrigierter Semesterarbeiten, den er vor dem Bauch trug. Er hastete die moderigen rückwärtigen Korridore der gigantischen Healy Hall entlang. Er musste zu Theodore Barton, dem Dekan seiner Fakultät, und er war spät dran – deshalb benützte er diese Abkürzung, die er schon vor langer Zeit entdeckt hatte, durch enge, schlecht beleuchtete Flure, die nur wenige Stundenten kannten oder benützen mochten.
Ein milder Gezeitenwechsel prägte sein von universitären Verpflichtungen strukturiertes Leben. Webbs Jahr wurde von den Semestern an der Georgetown University geprägt. Der tiefe Winter, mit dem sie begannen, ging widerstrebend in einen zögerlichen Frühling über und endete in der schwülen Hitze der letzten Wochen des zweiten Semesters. Aber ein Teil seines Ichs kämpfte gegen professorale Gelassenheit an: der Teil, der sich an sein früheres Leben in einem US-Geheimdienst erinnerte und um dessentwillen er die Freundschaft mit Alexander Conklin, seinem ehemaligen Führungsoffizier, sorgsam pflegte.
Er wollte eben um eine Ecke biegen, als er laute, schroffe Stimmen und spöttisches Lachen hörte und bedrohlich wirkende Schatten über die Wand huschen sah.
»Pass auf, wir lass’n deine Zunge hint’n aus deim Kopf rauskomm’, Muttaficka!«
Webb ließ den Papierstapel fallen, den er trug, und spurtete um die Ecke. Jetzt sah er drei junge Schwarze in knöchellangen Mänteln, die einen drohenden Halbkreis um einen Asiaten bildeten, den sie gegen die Flurwand gedrängt hatten. Sie hatten eine Art, mit leicht gebeugten Knien, lockerem Rumpf und schwingenden Armen dazustehen, die ihre ganzen Körper wie stumpfe, hässliche Aspekte von Waffen erscheinen ließ, die geladen, gespannt und schussbereit waren. Jäh erschrocken sah er, dass ihr Opfer Rongsey Siv war, einer seiner liebsten Studenten.
»Muttaficka«, knurrte einer, drahtig, mit dem unruhigen, aufsässigen Gesichtsausdruck eines Süchtigen auf Entzug, »wir woll’n uns hier Kohle besorgen, damit wir Bling-Bling eintausch’n könn.«
»Bling-Bling kannste nie genug ham«, sagte ein anderer mit einem auf der Wange eintätowierten Adler. Er drehte einen massiven Goldring, einen der vielen Ringe an den Fingern seiner Rechten, hin und her. »Oder weißte nich, was Bling-Bling is, Schlitzauge?«
»Yeah, Schlitzauge«, sagte der Kerl auf Entzug glotzäugig. »Du siehst nich aus, als wennde Scheiße wüsstest.«
»Er will uns daran hindern«, sagte der Tätowierte, indem sich näher zu Rongsey heranbeugte. »Yeah, Schlitzauge, was haste vor, willste uns mit Kung-Fucking-Fu umleg’n?«
Sie lachten rau und imitierten die Tritte von Kickboxern gegen Rongsey, der sich noch ängstlicher an die Wand drängte, als sie näher heranrückten.
Der dritte Schwarze, dick mit Muskeln bepackt, stämmig, zog aus den weiten Falten seines langen Mantels einen Baseballschläger hervor. »Yeah, genau. Hände hoch, Schlitzauge! Wir brech’n dir jetzt die Knöchel.« Er klatschte den Schläger in seine Handfläche. »Willstu alle auf einmal oder einen nach dem anderen?«
»Nah«, rief der Kerl auf Entzug, »aussuch’n darf der sich nix.« Er holte ebenfalls einen Baseballschläger unter seinem Mantel hervor und trat drohend auf Rongsey zu.
Als der drahtige Junge mit dem Schläger ausholte, stürzte Webb sich auf sie. Seine Annäherung geschah so lautlos, und die drei waren so darauf konzentriert, wie sie ihr Opfer misshandeln würden, dass sie ihn nicht wahrnahmen, bis er über sie herfiel.
Bevor der Schläger des Süchtigen auf Entzug auf Rongseys Kopf herabkrachen konnte, bekam Webb ihn mit der linken Hand zu fassen. Rechts neben ihm fluchte der Tätowierte gewaltig, schwang die Fäuste, deren Knöchel von scharfkantigen Ringen strotzten, und zielte damit auf Webbs Rippen.
In diesem Augenblick übernahm die Bourne-Identität, aus einem geheimen, verborgenen Winkel in Webbs Kopf kommend, energisch das Kommando. Webb lenkte den Fausthieb des Tätowierten mit dem Bizeps ab, trat vor und rammte einen Ellbogen gegen das Brustbein des Angreifers. Der Tätowierte ging nach seiner Brust krallend zu Boden.
Der dritte Gangster, größer als die beiden anderen, ließ fluchend seinen Baseballschläger fallen und zog ein Schnappmesser. Er stürzte sich auf Webb, der den Angriff unterlief und mit einem kurzen, harten Schlag die Unterseite des Handgelenks des Angreifers traf. Das Schnappmesser fiel auf den Korridorboden, rutschte scheppernd davon. Webb hakte seinen linken Fuß hinter den Knöchel des anderen und riss ihn hoch. Der große Gangster krachte auf den Rücken, wälzte sich herum, rappelte sich auf und ergriff die Flucht.
Bourne riss dem jungen Schwarzen auf Entzug den Baseballschläger aus den Händen. »Scheißkerl!«, murmelte der Drahtige. Seine Pupillen waren geweitet, wegen irgendwelcher Drogen, die er genommen hatte, unscharf eingestellt. Er zog eine Pistole – ein billiges, altes Ding – und zielte damit auf Webb.
Bourne warf mit tödlicher Zielsicherheit den Schläger, traf den Drahtigen zwischen den Augen. Er torkelte mit einem Aufschrei zurück, und die Pistole flog aus seiner Hand.
Durch den Kampflärm alarmiert, rannten nun zwei Wachmänner des Sicherheitsdiensts der Universität um die Ecke. Sie trabten an Webb vorbei und nahmen die Verfolgung der Gangster auf, die ohne einen Blick zurück flüchteten, wobei die beiden anderen den Jungen auf Entzug zwischen sich stützten. Mit den Wachmännern dicht auf den Fersen stürmten sie durch einen Hinterausgang des Gebäudes in den sonnenhellen Nachmittag hinaus.
Trotz des Auftauchens der Wachmänner spürte Webb, dass Bournes Begierde, die Schläger zu verfolgen, heiß durch seinen Körper wogte. Wie rasch er aus seinem psychischen Schlaf erwacht war, wie mühelos er die Kontrolle über seinen Körper übernommen hatte! Weil er’s gewollt hatte? Webb atmete tief durch, gewann halbwegs die Beherrschung zurück und wandte sich Rongsey Siv zu.
»Professor Webb!« Rongsey versuchte, sich zu räuspern. »Ich weiß nicht, wie …« Er erschien plötzlich hilflos und überwältigt. Hinter seiner Brille wirkten seine großen schwarzen Augen noch größer. Seine Miene war wie immer undurchdringlich, aber in diesen Augen konnte Webb alle Angst der Welt erkennen.
»Alles wieder in Ordnung.« Webb legte Rongsey einen Arm um die Schultern. Wie immer machte seine Zuneigung zu dem kambodschanischen Flüchtling sich trotz seiner professoralen Zurückhaltung bemerkbar. Dagegen war er machtlos. Rongsey hatte viel durchgemacht – er hatte fast seine gesamte Familie im Krieg verloren. Rongsey und Webb hatten im selben südostasiatischen Dschungel gelebt, und trotz aller Bemühungen konnte Webb sich nicht völlig von der Erinnerung an diese schwülheiße Welt lösen. Einem wiederkehrenden Fieber gleich verließ sie einen nie ganz. Webb spürte einen Schauer der Erinnerung wie einen Wachtraum.
»Loak soksapbaee chea tay?« Wie geht es Ihnen?, fragte er auf Khmer.
»Mit geht’s gut, Professor«, antwortete Rongsey in seiner Muttersprache. »Aber ich weiß nicht … ich meine, wie haben Sie …?«
»Wollen wir nicht ins Freie gehen?«, schlug Webb vor. Den Termin bei Barton hatte er längst versäumt, aber das war ihm herzlich egal. Er hob das Schnappmesser und die Pistole auf. Als er die Pistole überprüfte, entlud und abdrückte, brach der Schlagbolzen ab. Die nutzlose Waffe warf er in einen Abfallkorb, aber das Schnappmesser steckte er ein.
Hinter der Korridorecke half Rongsey ihm, die verstreuten Semesterarbeiten einzusammeln. Dann gingen sie schweigend durch die Flure, die umso belebter wurden, je näher sie der Vorderseite des Gebäudes kamen. Webb erkannte die besondere Qualität dieses Schweigens, das schwerfällig träge Gewicht der nach einem Akt der Gewalt zur Normalität zurückkehrenden Zeit. Dies war etwas aus dem Krieg, ein Dschungelerlebnis; seltsam und beunruhigend, dass einem so etwas auf dem belebten Campus einer Universität mitten in einer Großstadt passieren konnte.
Sie verließen den Korridor und schlossen sich den Scharen von Studenten an, die durch den Hauptausgang der Healy Hall strömten. Im Boden vor den Türen leuchtete das in den Fußboden eingelassene heilige Wappen der Georgetown University. Die meisten Studenten gingen darum herum, denn ein alter Aberglaube besagte, wer auf das Wappen trete, werde sein Studium niemals abschließen. Rongsey gehörte zu denen, die einen weiten Bogen darum machten, aber Webb marschierte ohne die geringsten Bedenken geradewegs darüber.
Draußen standen sie in der milden Frühlingssonne, hatten Bäume und den alten viereckigen Innenhof vor sich und atmeten Luft mit einem Hauch Blütenduft. Hinter ihnen erhob sich die massive Healy Hall mit imposanter Klinkerfassade im georgianischen Stil, Dachgauben aus dem 19. Jahrhundert und einem mittig angeordneten, sechzig Meter hohen Glockenturm.
Der Kambodschaner wandte sich an Webb. »Professor, ich danke Ihnen. Wären Sie nicht gekommen …«
»Rongsey«, sagte Webb freundlich, »möchten Sie darüber reden?«
Die Augen des Studenten waren dunkel, unergründlich. »Was gibt’s da zu sagen?«
»Ich denke, das würde von Ihnen abhängen.«
Rongsey zuckte mit den Schultern. »Mir geht’s wieder gut, Professor Webb. Wirklich. Ich bin nicht zum ersten Mal beschimpft worden.«
Webb betrachtete Rongsey noch einige Sekunden lang und wurde dabei von plötzlicher Rührung erfasst, die seine Augen brennen ließ. Er wollte den Jungen in die Arme schließen, ihn an sich drücken und ihm versprechen, ihm werde nie wieder etwas Schlimmes passieren. Aber er wusste, dass Rongseys buddhistische Erziehung ihm nicht gestatten würde, die Geste zu akzeptieren. Wer konnte beurteilen, was hinter der undurchdringlichen Fassade dieses Gesichts vorging? Webb hatte viele andere wie Rongsey gesehen, die durch die Grausamkeiten von Krieg und kulturellem Hass gezwungen gewesen waren, Augenzeugen von Tod, dem Zusammenbruch einer Zivilisation und weiteren Tragödien zu sein, die die meisten Amerikaner nicht begreifen konnten. Er empfand eine starke Nähe zu Rongsey, von schrecklicher Traurigkeit getönte emotionale Bande, eine Bestätigung der Wunde in seinem Inneren, die nie ganz heilen würde.
Alle diese Gefühle standen zwischen ihnen: vielleicht im Stillen erkannt, aber niemals ausgesprochen. Mit leichtem, fast traurigem Lächeln dankte Rongsey ihm nochmals förmlich, und sie verabschiedeten sich voneinander.
Webb stand allein zwischen den vorbeihastenden Studenten und Dozenten – und wusste doch, dass er nicht wirklich allein war. Trotz aller Bemühungen hatte die aggressive Persönlichkeit Jason Bournes wieder einmal die Oberhand gewonnen. Er atmete langsam und tief, konzentrierte sich angestrengt und wandte die mentalen Techniken an, die sein Freund, der Psychiater Mo Panov ihn gelehrt hatte, um die Bourne-Identität zu verdrängen. Als Erstes konzentrierte er sich auf seine Umgebung, auf das Blau und Gold des Frühlingsnachmittags, auf den grauen Stein und die roten Klinker der Gebäude rings um den Innenhof, auf die Bewegungen der Studenten, die lächelnden Gesichter der Mädchen, das Lachen der Jungen, die ernsten Stimmen der Professoren. Er absorbierte jedes einzelne dieser Elemente vollständig und erdete sich in Raum und Zeit. Dann, erst dann richtete er seine Gedanken nach innen.
Vor vielen Jahren war er als Diplomat in Phnom Penh stationiert gewesen. Damals war er verheiratet gewesen – nicht mit seiner jetzigen Frau Marie, sondern mit einer Thailänderin namens Dao. Sie hatten zwei Kinder, Joshua und Alyssa, und wohnten in einem Haus am Fluss. Amerika führte Krieg gegen Nordvietnam, aber der Krieg war nach Kambodscha übergeschwappt. Eines Nachmittags, als er im Dienst gewesen war und seine Frau mit den Kindern im Fluss gebadet hatte, waren sie von einem Tiefflieger beschossen und getötet worden.
Webb war vor Kummer fast wahnsinnig geworden. Schließlich war er aus seinem Haus in Phnom Penh geflüchtet und als Mann ohne Vergangenheit und ohne Zukunft in Saigon angekommen. Es war Alex Conklin gewesen, der den todunglücklichen, halb verrückten David Webb dort von der Straße geholt und einen erstklassigen Geheimdienstagenten aus ihm geformt hatte. In Saigon hatte Webb töten gelernt, hatte den eigenen Selbsthass nach außen projiziert und seinen Zorn gegen andere gerichtet. Nachdem ein Mitglied von Conklins Gruppe – ein bösartiger Gangster namens Jason Bourne – als Spion enttarnt worden war, hatte Webb ihn liquidiert. Webb hatte die Identität Bournes hassen gelernt, aber in Wirklichkeit war sie oft genug seine Rettung gewesen. Jason Bourne hatte ihm häufiger das Leben gerettet, als Webb sich erinnern konnte. Eine amüsante Vorstellung, wenn sie nicht buchstäblich wahr gewesen wäre.
Jahre später, als sie beide nach Washington zurückgekehrt waren, hatte Conklin ihm einen langfristigen Auftrag erteilt. Als Geheimagent war er faktisch ein »Schläfer« gewesen und hatte den Namen Jason Bourne – eines lange toten, von allen vergessenen Mannes – angenommen. Drei Jahre lang war Webb Bourne gewesen: Er hatte sich in einen berüchtigten international agierenden Attentäter verwandelt, um einen extrem gewieften Terroristen zu fassen.
Aber in Marseille war sein Einsatz gründlich schief gegangen. Er war angeschossen und als vermeintlich Toter ins nachtdunkle Mittelmeer geworfen worden. Doch er war von der Besatzung eines Fischerboots aus dem Wasser gezogen und in dem Hafen, in dem sie ihn an Land gesetzt hatte, von einem Säufer von Arzt gesundgepflegt worden. Das einzige Problem war, dass er durch den Schock seines Beinahe-Todes das Gedächtnis verloren hatte. Langsam zurückgekehrt waren Bournes Erinnerungen. Erst viel später hatte er mit Hilfe seiner zukünftigen Frau Marie erkannt, dass er in Wirklichkeit David Webb war. Inzwischen war die Jason-Bourne-Persönlichkeit jedoch zu tief in ihm verwurzelt, zu mächtig und zu gerissen, um zu sterben.
Letztlich war er eine gespaltene Persönlichkeit geworden: David Webb, der Linguistikprofessor, mit einer neuen Frau und abermals zwei Kindern, und Jason Bourne, der von Alex Conklin zu einem erstklassigen Spion ausgebildete Geheimagent. In Krisensituationen hatte Conklin manchmal auf Bournes Talente zurückgegriffen, und Webb hatte widerstrebend seine Pflicht getan. Aber in Wirklichkeit hatte Webb seine Bourne-Persönlichkeit kaum unter Kontrolle. Was vorhin mit Rongsey und den drei Schlägertypen passiert war, war Beweis genug. Trotz Webbs endloser Therapie bei Panov hatte Bourne eine Art, sich in den Vordergrund zu drängen, gegen die Webb machtlos war.
Chan, der das Gespräch zwischen David Webb und dem kambodschanischen Studenten von jenseits des Innenhofs aus beobachtet hatte, verschwand in dem Gebäude schräg gegenüber der Healy Hall und stieg die Treppe in den zweiten Stock hinauf. Da er wie die meisten Studenten gekleidet war und viel jünger als seine siebenundzwanzig Jahre aussah, würdigte ihn niemand eines zweiten Blicks. Zu seiner Khakihose trug er eine Jeansjacke und über einer Schulter einen sehr geräumigen Rucksack. Seine Laufschuhe quietschten nicht, als er an den Türen von Seminarräumen vorbei den Flur entlangging. Vor seinem inneren Auge stand ein klares Bild des Blicks über den Innenhof. Er berechnete wieder Winkel, wobei er berücksichtigte, dass die alten Bäume sein Ziel verdecken könnten.
Er machte vor der sechsten Tür Halt, hörte drinnen einen Professor dozieren. Seine Ausführungen über Ethik nötigten Chan ein ironisches Lächeln ab. Seiner Erfahrung nach – die groß und vielseitig war – war Ethik so tot und sinnlos wie Latein. Er ging zum nächsten Raum weiter, der frei war, wie er bereits erkundet hatte, und trat ein.
Nun bewegte er sich rascher, schloss die Tür hinter sich, sperrte ab, durchquerte den Raum, öffnete eines der auf den Innenhof hinausführenden Fenster und machte sich an die Arbeit. Aus seinem Rucksack holte er ein 7,62-mm-Scharfschützengewehr SWD Dragunow mit ausklappbarer Schulterstütze. Er setzte das Zielfernrohr auf und stützte die Waffe auf die Fensterbank. Durchs Zielfernrohr fand er David Webb, der jetzt allein vor der Healy Hall stand. Unmittelbar links neben ihm ragten Bäume auf. Von Zeit zu Zeit verdeckte ihn ein vorbeigehender Student. Chan holte tief Luft und atmete langsam wieder aus. Er zielte auf Webbs Kopf.
Webb schüttelte den Kopf, als könne er so die Wirkung seiner Erinnerungen an die Vergangenheit loswerden, und konzentrierte sich nochmals auf seine unmittelbare Umgebung. Die jungen Blätter raschelten in der auffrischenden Brise, ihre Spitzen waren von Sonnenlicht vergoldet. In der Nähe lachte eine Studentin, die ihre Bücher an sich gedrückt trug, über die Pointe eines Witzes. Aus einem offenen Fenster wehte undeutlich Popmusik herab. Webb, der weiter an all die Dinge dachte, die er zu Rongsey hatte sagen wollen, war kurz davor, die Stufen zur Healy Hall hinaufzugehen, als ein leises Fffftt! an sein Ohr drang. Er reagierte instinktiv, trat in den gesprenkelten Schatten unter den Bäumen.
Du wirst beschossen!, rief Bournes nur allzu vertraute Stimme, die er wieder in seinem Kopf hörte. Los, beweg dich! Und Webbs Körper reagierte hastig, während ein weiteres Geschoss aus einer Waffe mit Schalldämpfer die Baumrinde neben seiner Wange zersplittern ließ.
Ein erstklassiger Schütze. Als Reaktion eines Organismus, der sich angegriffen sah, rasten Webb jetzt Bournes Gedanken durch den Kopf.
Vor Webbs Augen stand die gewöhnliche Welt, aber die parallel dazu existierende außergewöhnliche Welt, Jason Bournes Welt – geheim, verschlossen, privilegiert, tödlich –, flammte in seiner Vorstellung auf wie Napalm. Binnen eines einzigen Herzschlags war er aus David Webbs Alltag gerissen und von allem und allen getrennt worden, die Webb nahe standen. Auch seine zufällige Begegnung mit Rongsey schien jetzt zu einem anderen Leben zu gehören. Hinter dem Baum stehend, wo der Scharfschütze ihn nicht sehen konnte, griff er um den Stamm und ertastete mit der Spitze des Zeigefingers das Einschussloch. Er hob den Kopf. Es war Jason Bourne, der die Schussbahn zu einem der Fenster im zweiten Stock eines Gebäudes auf der anderen Seite des Innenhofs zurückverfolgte.
Überall um ihn herum liefen, schlenderten, redeten, diskutierten und debattierten Studenten der Georgetown University. Sie hatten natürlich nichts gesehen, und falls jemand zufällig etwas gehört hatte, erkannte er das Geräusch eines fliegenden Geschosses nicht und vergaß das sonderbare Zischen gleich wieder. Webb verließ seine Deckung hinter dem Baum und mischte sich rasch unter eine Gruppe von Studenten. Er bewegte sich eilig, passte sein Tempo aber möglichst ihrem an. Sie waren sein bester Schutz, weil sie die Visierlinie des Scharfschützen verdeckten.
Er hatte das Gefühl, nur halb bei Bewusstsein zu sein: ein Schlafwandler, der trotzdem alles mit gesteigerter Wahrnehmungsfähigkeit sah und fühlte. Eine Komponente dieser Wahrnehmung war Verachtung für die Zivilisten – auch für David Webb –, die die gewöhnliche Welt bevölkerten.
Nach dem zweiten Schuss hatte Chan sich verwirrt zurückgezogen. Verwirrung war ein Zustand, mit dem er nicht vertraut war. Sein Verstand arbeitete auf Hochtouren, um zu analysieren, was passiert war. Statt wie von Chan erwartet in Panik zu geraten und wie ein ängstliches Schaf in die Healy Hall zurückzulaufen, hatte Webb gelassen Deckung hinter Bäumen gesucht. Schon das war unwahrscheinlich gewesen – und passte ganz und gar nicht zu dem in Spalkos Dossier kurz beschriebenen Mann –, aber dann hatte Webb mit Hilfe des Einschusslochs im Baumstamm die Flugbahn des zweiten Geschosses rekonstruiert. Indem er Studenten als Deckung benützte, war er jetzt zu diesem Gebäude unterwegs. Statt zu flüchten, ging er zum Angriff über. Das war unglaublich …
Durch diese unerwartete Wendung leicht entnervt, zerlegte Chan rasch das Gewehr und verstaute es wieder im Rucksack. Webb hatte die Stufen vor dem Gebäude erreicht. Er würde in wenigen Minuten hier sein.
Bourne löste sich aus dem Fußgängerstrom und rannte in das Gebäude. Drinnen stürmte er die Treppe in den zweiten Stock hinauf. Oben wandte er sich nach links. Die siebte Tür rechts: ein Seminarraum. Auf dem Korridor war das Stimmengewirr von Studenten aus aller Welt zu hören – Afrikaner, Asiaten, Südamerikaner, Europäer. Alle Gesichter, selbst nur flüchtig wahrgenommene, wurden von Jason Bournes fotografischem Gedächtnis registriert.
Das halblaute Gemurmel der Studenten und ihr gelegentliches Lachen täuschten über die in seiner unmittelbaren Umgebung lauernde Gefahr hinweg. Als er sich der Tür des Seminarraums näherte, ließ er die Klinge des erbeuteten Messers herausschnappen und nahm es so in die Faust, dass sie zwischen dem zweiten und dritten Finger seiner Rechten hervorsah. Mit einer flüssigen Bewegung stieß er die Tür auf, rollte sich über eine Schulter ab und landete mit einem Satz hinter dem massiven Eichenpult, das etwa zweieinhalb Meter von der Tür entfernt stand. Seine Hand mit dem Messer war stoßbereit erhoben – er war auf alles vorbereitet.
Er richtete sich vorsichtig auf. Ein leerer Seminarraum, nur von Kreidestaub und marmorierten Sonnenflecken erfüllt, grinste ihn an. Er stand einen Augenblick da und sah sich um: mit geweiteten Nasenlöchern, als könne er die Witterung des Scharfschützen aufnehmen, sein Bild aus dem Nichts vor sich erscheinen lassen. Er trat an die Fenster. Eines, das vierte Fenster von links, stand offen. Er blieb dort stehen, starrte zu der Stelle unter dem Baum hinüber, an der er vor kurzem im Gespräch mit Rongsey gestanden hatte. Hier hatte der Scharfschütze gestanden. Bourne glaubte zu sehen, wie er das Gewehr auf der Fensterbank aufgelegt – ein Auge ein paar Zentimeter hinter dem lichtstarken Zielfernrohr – und diagonal über den Innenhof gezielt hatte. Das Spiel von Licht und Schatten, die vorbeihastenden Studenten, plötzlich ausbrechendes Lachen oder Widerworte. Sein Finger am Abzug, langsam den Druckpunkt fassend. Fffftt! Fffftt! Ein Schuss, zwei.
Bourne studierte die Fensterbank. Nach einem Blick in die Runde trat er an die Blechrinne unter der Wandtafel und kratzte Kreidestaub zusammen. Damit kehrte er ans Fenster zurück und blies den Staub vorsichtig von der Handfläche auf den polierten Schiefer der Fensterbank. Dort zeigte sich kein einziger Fingerabdruck. Der Stein war abgewischt worden. Er kniete sich hin und suchte Wand und Fußboden unter dem Fenster ab. Wieder nichts – kein verräterischer Zigarettenstummel, keine ausgefallenen Haare, keine leeren Patronenhülsen. Der pedantische Attentäter war so professionell verschwunden, wie er aufgetaucht war. Bournes Herz jagte, sein Verstand arbeitete auf Hochtouren. Wer wollte ihn ermorden lassen? Bestimmt niemand aus seinem gegenwärtigen Leben. Das schlimmste Vorkommnis war die Auseinandersetzung, die er letzte Woche mit Bob Drake, dem als lästigen Langweiler bekannten Dekan der Ethischen Fakultät, gehabt hatte. Nein, diese Bedrohung kam aus Jason Bournes Welt. Natürlich gab es aus seiner Vergangenheit viele Kandidaten, aber wie viele würden die Verbindung zwischen Jason Bourne und David Webb herstellen können? Das war die eigentliche Frage, die ihm Sorgen machte. Obwohl ein Teil seines Ichs heimfahren wollte, um diese Sache mit Marie zu besprechen, wusste er, dass der einzige Mensch, der genügend über Bournes Schattenexistenz wusste, um ihm helfen zu können, Alex Conklin war – der Mann, der Bourne wie ein Zauberer aus dem Nichts erschaffen hatte.
Er trat an das Wandtelefon, nahm den Hörer ab und tippte seinen persönlichen Zugangscode ein. Als er eine Amtsleitung bekam, wählte er Alex Conklins Privatnummer. Conklin, der bei der CIA nur noch einen Teilzeitjob hatte, würde zu Hause sein. Bourne hörte ein Besetztzeichen.
Was tun? Er konnte hier darauf warten, dass Alex zu telefonieren aufhörte – was eine halbe Stunde und länger dauern konnte, wie er aus Erfahrung wusste –, oder zu ihm hinausfahren. Das offene Fenster schien ihn zu verspotten. Es wusste mehr darüber, was hier passiert war, als er selbst.
Er verließ den Raum, ging wieder die Treppe hinunter. Ohne sich dessen bewusst zu sein, suchte er die Gesichter der Entgegenkommenden ab, verglich sie mit allen, die ihm zuvor begegnet waren.
Bourne hastete über den Campus, erreichte bald den Parkplatz für Dozenten. Er wollte schon in sein Auto steigen, als ihm Bedenken kamen. Eine rasche, aber gründliche Untersuchung der Außenseite und des Motorraums zeigte ihm, dass niemand sich an seinem Wagen zu schaffen gemacht hatte. Er setzte sich aufatmend ans Steuer, ließ den Motor an und fuhr vom Campus.
Alex Conklin lebte auf seinem Landsitz in Manassas, Virginia. Sobald Webb die Außenbezirke von Georgetown erreichte, leuchtete der Himmel in einem intensiveren Blau; zugleich setzte eine fast unheimliche Stille ein, als halte die vorbeiziehende Landschaft den Atem an.
Ähnlich wie für seine Bourne-Persönlichkeit empfand Webb zugleich Liebe und Hass für Conklin. Er war Vater, Beichtvater, Mitverschwörer und Ausbeuter. Alex Conklin verwahrte die Schlüssel zu Bournes Vergangenheit. Er musste jetzt unbedingt mit Conklin sprechen, denn Alex war der Einzige, der wissen würde, wie jemand, der Jason Bourne umlegen wollte, David Webb auf dem Campus der Georgetown University gefunden hatte.
Er hatte die Großstadt hinter sich gelassen, und als er in Virginia übers Land fuhr, schlug das Wetter um. Dichte Wolkenbänke verdeckten die Sonne, und auffrischender Wind bewegte das Grün der Hügel Virginias. Er trat das Gaspedal weiter durch, und der große Wagen schoss mit aufbrummendem Motor vorwärts.
Als er den überhöhten Kurven des Highways folgte, fiel ihm plötzlich ein, dass er Mo Panov seit über einem Monat nicht mehr gesehen hatte. Mo, ein ihm von Conklin empfohlener Psychologe der Agency, bemühte sich, Webbs Persönlichkeitsspaltung zu überwinden, die Bourne-Identität endgültig zu unterdrücken und Webb zu helfen, seine verlorenen Erinnerungen wiederzufinden. Dank Mos Techniken hatte Webb erlebt, wie Bruchstücke von verloren geglaubten Erinnerungen wieder in seinem Bewusstsein auftauchten. Aber diese Arbeit war mühsam und anstrengend, deshalb war es nicht ungewöhnlich für ihn, die Sitzungen jeweils zum Semesterende, wenn sein Leben unerträglich hektisch wurde, für einige Zeit zu unterbrechen.
Er bog vom Highway ab und folgte einer kleineren Makadamstraße nach Nordwesten. Weshalb hatte er gerade jetzt an Panov denken müssen? Bourne hatte gelernt, auf seine Sinne und seine Intuition zu vertrauen. Dass Mo aus heiterem Himmel aufgetaucht war, war eine Art Signal. Welche Bedeutung hatte Panov im Augenblick für ihn? Er verkörperte Erinnerung, ja, aber was noch? Bourne dachte zurück. Bei ihrem letzten Treffen hatten Panov und er über Stille gesprochen. Mo hatte ihm erklärt, Stille sei ein nützliches Werkzeug für Erinnerungsarbeit. Der Verstand, der tätig bleiben wollte, verabscheute Stille. Konnte man im Bewusstsein eine ausreichend wirksame Stille herstellen, war es möglich, dass verloren geglaubte Erinnerungen auftauchten, um die Leere zu füllen. Okay, sagte Bourne sich, aber wieso denkst du gerade jetzt an Stille?
Den Zusammenhang erkannte er erst, als er auf Conklins lange, elegant geschwungene Zufahrt abgebogen war. Der Attentäter hatte einen Schalldämpfer benützt, der vor allem verhindern sollte, dass der Schütze entdeckt wurde. Aber ein
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Bourne Legacybei St. Martin’s Press, New York
Copyright © 2004 by The Estate of Robert Ludlum Copyright © 2006 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH
First published in the United States as The Bourne Legacywritten by Eric van Lustbader © The Estate of Robert Ludlum, 2004. Published by arrangement with The Estate of Robert Ludlum c/o BAROR INTERNATIONAL, INC. Redaktion: Ulrich Mihr Herstellung: Helga Schörnig Geset zt aus der 11,8/14,65 Punkt Adobe Garamond Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
eISBN 978-3-641-09377-8
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe