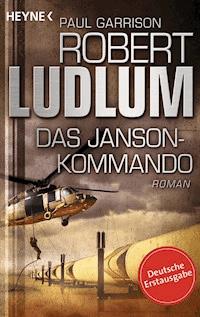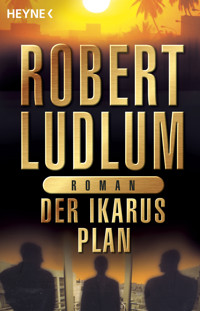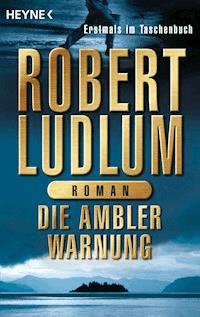
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der neue Ludlum – Bestsellergarantie!
Robert Ludlum beherrscht unangefochten das Feld des klassischen Spionage- und Agententhrillers. Auch sein neuester Roman bietet wieder eine rasante Story um Intrige und tödlichen Verrat: Ex-Agent Hal Ambler wird von seinen einstigen Auftraggebern auf einer entlegenen Insel gefangen gehalten. Als ihm die Flucht gelingt, nimmt eine mörderische Jagd ihren Lauf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 792
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Unsichtbare Einheit ist stärker als sichtbare.
HERAKLIT, 500 v. Chr.
Teil eins
Kapitel eins
Das Gebäude besaß die Unsichtbarkeit des Gewöhnlichen. Es hätte eine große Highschool oder ein regionales Rechenzentrum der Steuerbehörde sein können. Der quadratische, beige Klinkerbau – Erdgeschoss und drei Stockwerke, die einen Innenhof umgaben – war ein typisches Gebäude, wie sie in den fünfziger und sechziger Jahren errichtet worden waren. Kein zufälliger Passant hätte es eines zweiten Blickes gewürdigt.
Nur gab es hier keine zufälligen Passanten. Nicht auf dieser vorgelagerten Insel sechs Meilen vor der Küste Virginias. Offiziell gehörte die Insel zum National Wildlife Refuge System, das Biotope für Wildtiere schuf, und wer sich für sie interessierte, erhielt die Auskunft, wegen des überaus empfindlichen Ökosystems sei die Insel für Besucher gesperrt. Teile der Leeküste der Insel waren tatsächlich von Fischadlern und Gänsesägern bewohnt: von Räubern und ihren Beutetieren, die beide von dem größten Raubtier überhaupt, dem Menschen, bedroht waren. Aber in der Inselmitte lag mit gepflegten Rasenflächen und gestalteten sanften Hügeln ein sechs Hektar großes Gelände, auf dem das gesichtslose Gebäude stand.
Die Boote, die Parrish Island dreimal täglich anliefen, trugen NWRS-Markierungen, und aus der Ferne wäre nicht zu erkennen gewesen, dass die zur Insel transportierten Leute keineswegs wie Park Ranger aussahen. Hätte ein Fischerboot in Seenot versucht, die Insel anzulaufen, wäre es von Männern in Kaki mit freundlichem Lächeln und hartem, kaltem Blick abgefangen worden. Niemand kam jemals nahe genug heran, um die vier Wachttürme oder den Elektrozaun um das Gelände zu sehen und sich über sie zu wundern.
Obgleich die Psychiatrische Klinik Parrish Island äußerlich so unscheinbar war, enthielt sie eine größere Wildnis als diejenige, die sie umgab: die des menschlichen Geistes. Selbst in Regierungskreisen wussten nur wenige, dass diese Einrichtung existierte. Trotzdem erforderte simple Logik ihre Existenz: eine Psychiatrie für Patienten, die über streng geheime Informationen verfügten. Für die Behandlung von Geisteskranken war eine sichere Umgebung erforderlich, wenn das Gedächtnis dieser Patienten voller Staatsgeheimnisse war. Auf Parrish Island konnten Sicherheitsrisiken präzise unter Kontrolle gehalten werden. Das gesamte Klinikpersonal war gründlich überprüft und für den Umgang mit streng geheimen Informationen zugelassen worden. Audio-und Videoüberwachungssysteme, die Tag und Nacht in Betrieb waren, boten weiteren Schutz gegen eine Gefährdung der Sicherheit. Als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme wurde das Klinikpersonal alle drei Monate ausgewechselt, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass unerwünschte Bindungen entstehen konnten. Die Sicherheitsbestimmungen schrieben sogar vor, die Patienten seien mit Nummern, nie mit Namen zu identifizieren.
Nur selten gab es einen Patienten, der als extrem gefährlich galt, was an der Art seiner psychischen Störung oder seinem besonders brisanten Wissen liegen konnte. Ein so eingestufter Patient wurde von den übrigen Patienten isoliert und in einer geschlossenen Abteilung untergebracht. Im dritten Stock des Westflügels gab es einen solchen Patienten: Nr. 5312.
Jede Krankenschwester, die durch Rotation in die Abteilung 4W versetzt wurde und dem Patienten Nr. 5312 erstmals begegnete, wusste nur sicher, was sie mit eigenen Augen sah: dass er etwas über eins achtzig groß und schätzungsweise vierzig Jahre alt war; dass seine kurz geschnittenen Haare braun, seine Augen ungetrübt blau waren. Begegneten ihre Blicke sich, sah die Krankenschwester zuerst weg – die Intensität seines starren Blicks konnte entnervend, fast körperlich bedrängend sein. Den Rest seines Persönlichkeitsprofils enthielt seine Krankenakte. Über die Wildnis in seinem Geist konnte man nur spekulieren.
Irgendwo in Abteilung 4W gab es Detonationen und ein Blutbad und Schreie, aber sie waren lautlos, auf die unruhigen Träume des Patienten beschränkt, die jetzt lebhafter wurden, obwohl sie allmählich erwachten. Diese Augenblicke des Halbschlafs – wenn der Sehende nur registriert, was er sieht; Augen ohne ein bewusstes Ego – waren mit einer Serie von Bildern angefüllt, von denen jedes sich aufwölbte wie ein Stück Film, der vor einer überhitzten Projektionslampe zum Stehen gekommen ist. Eine Wahlversammlung an einem schwülheißen Tag in Taiwan: Tausende sind auf einem riesigen Platz versammelt, über den nur hin und wieder eine schwache kühlende Brise streicht. Ein politischer Kandidat, der mitten im Satz durch eine kleine, gut verdämmte Sprengladung getötet wird. Vor wenigen Augenblicken hatte er noch engagiert und leidenschaftlich gesprochen; jetzt lag er in einer Lache seines Blutes auf dem hölzernen Podium. Er hob den Kopf, blickte ein letztes Mal über die Menge hinaus und fixierte dabei einen einzelnen Mann: einen chang bizi – einen Weißen. Den einzigen Menschen, der nicht kreischte, weinte oder flüchtete. Den einzigen Mann, der jetzt nicht überrascht wirkte, denn die Detonation war schließlich sein Werk. Der Kandidat starb, während er den Mann anstarrte, der übers Meer gekommen war, um ihn zu töten. Dann wölbte sich das Bild auf, verschwamm, wurde zu gleißendem Weiß.
Ein weit entferntes Glockensignal, ein Dreiklang in Moll, ertönte aus einem unsichtbaren Lautsprecher, und Hal Ambler öffnete seine vom Schlaf leicht verklebten Augen.
War es wirklich Morgen? In dem fensterlosen Raum konnte er das nicht beurteilen. Aber dies war sein Morgen. Die in die Decke eingelassenen Tageslicht-Leuchtstoffröhren wurden in der folgenden halben Stunde stetig heller: eine technologische Morgendämmerung, deren Intensität durch die Weiße seiner Umgebung noch gesteigert wurde. Damit begann zumindest ein Scheintag. Amblers Zelle maß drei mal dreieinhalb Meter; der Fußboden war mit weißen Vinylfliesen ausgelegt, die Wände mit weißem PVC-Schaum beschichtet, der sich gummiartig zäh anfühlte und unter Druck wie eine Ringermatte leicht nachgab. Jetzt würde es nicht mehr lange dauern, bis die Schiebetür mit ihrem hydraulischen Seufzen zur Seite glitt. Er kannte diese Abläufe und noch Hunderte dieser Art. In einem Hochsicherheitstrakt strukturierten sie das Leben, wenn man es überhaupt »Leben« nennen konnte. Er durchmaß Zeiten grimmiger Klarheit, aber auch Intervalle, die von Fluchtfantasien geprägt waren. Und im weitesten Sinn hatte er das Gefühl, er sei entführt worden, nicht nur sein Körper, sondern auch seine Seele.
Im Verlauf seiner fast zwanzigjährigen Tätigkeit als Geheimagent war Ambler zweimal in Gefangenschaft geraten – in Algerien und Tschetschenien – und hatte längere Zeit in Einzelhaft gesessen. Er wusste, dass die Umstände für tiefsinnige Gedanken, Seelenerforschung oder philosophische Grübelei ungünstig waren. Vielmehr füllte sich der Verstand mit Bruchstücken von Werbespots, Popsongs, halb vergessenen Gedichten und einem übersteigerten Bewusstsein für kleine Unbequemlichkeiten. Die Gedanken kreiselten, trieben ziellos dahin und berührten selten interessante Themen, denn sie blieben letztlich an die eigenartige Qual der Isolation gefesselt. Seine Ausbilder beim Geheimdienst hatten versucht, ihn auf solche Extremsituationen vorzubereiten. Die Herausforderung bestehe darin, hatten sie immer wieder betont, den Versand daran zu hindern, sich selbst anzugreifen wie ein Magen, der seine Magenwand verdaut.
Aber auf Parrish Island befand er sich nicht in der Hand von Feinden; er wurde von seiner eigenen Regierung festgehalten - von dem Staat, dem er fast zwanzig Jahre lang gedient hatte.
Und er wusste nicht, warum.
Weshalb eine solche Einrichtung überhaupt existierte, war ihm keineswegs ein Rätsel. Als Agent eines als Consular Operations bezeichneten US-Nachrichtendiensts hatte er von der Klinik auf Parrish Island gehört. Ambler verstand auch, wieso es eine Einrichtung dieser Art geben musste; niemand war gegen die Verirrungen des menschlichen Geistes gefeit, auch Geheimnisträger nicht. Aber es war gefährlich, jedem beliebigen Psychiater Zugang zu solchen Patienten zu gewähren. Diese Lektion hatten die US-Geheimdienste im Kalten Krieg teuer bezahlt, als ein in Berlin geborener Psychoanalytiker in Alexandria, zu dessen Klientel mehrere Spitzenbeamte zählten, als Informant der berüchtigten Stasi, des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit, enttarnt worden war.
Das alles erklärte jedoch nicht, weshalb Hal Ambler sich hier befand, seit . . . wie lange war das nun schon her? In der Ausbildung war ihm eingebläut worden, wie wichtig es ist, in der Haft das Zeitgefühl nicht zu verlieren. Irgendwie hatte er es doch verloren, und seine Fragen nach der Haftdauer blieben unbeantwortet. War er ein halbes Jahr, ein Jahr oder noch länger hier? Es gab so vieles, was er nicht wusste. Sicher wusste er nur, dass er durchdrehen würde, wenn ihm nicht bald die Flucht gelang.
Routine: Ambler konnte sich nicht entscheiden, ob ihre Einhaltung seine Rettung oder sein Untergang war. Schweigend und effizient absolvierte er seine tägliche Gymnastik, die er mit hundert einarmigen Liegestützen abschloss, bei denen er zwischen links und rechts wechselte. Baden durfte er nur jeden zweiten Tag; heute war kein Badetag. An dem kleinen weißen Waschbecken in einer Ecke des Raums putzte er sich die Zähne. Der Stiel seiner Zahnbürste bestand aus weichem Kunststoff, denn hartes Plastikmaterial ließ sich eventuell zu einer Waffe zuschleifen. Als er eine in die Wand eingelassene Klappe berührte, glitt ein kompakter Elektrorasierer aus einem Fach über dem Becken. Er durfte ihn genau hundertzwanzig Sekunden lang benutzen, bevor er das mit einem Sensor ausgestattete Gerät in das Sicherheitsfach zurücklegen musste; sonst ertönte ein Alarmsignal. Als er fertig war, spritzte Ambler sich Wasser ins Gesicht und fuhr sich mit nassen Fingern durchs Haar, um es halbwegs zu kämmen. Es gab keinen Spiegel, nicht einmal eine reflektierende Oberfläche. In dieser Abteilung war sogar das Fensterglas entspiegelt. All das diente bestimmt obskuren therapeutischen Zwecken. Er schlüpfte in seine »Tageskleidung«, die Uniform der Insassen: ein weißes Sweatshirt aus Baumwolle und eine weiße Jogginghose mit Gummizug.
Er drehte sich langsam um, als er hörte, wie sich die Tür öffnete, und roch das Desinfektionsmittel, dessen Tannenduft immer im Korridor hing. Wie gewöhnlich kam ein stämmiger Mann mit Bürstenhaarschnitt herein, der eine Uniform aus taubengrauem Popeline trug und das Namensschild auf seiner linken Brustseite sorgfältig mit einem Stoffquadrat abgedeckt hatte: eine weitere Vorsichtsmaßnahme, die das Personal in seiner Abteilung beachten musste. Die breite Aussprache des Mannes ließ erkennen, dass er aus dem amerikanischen Mittelwesten stammte, aber seine gelangweilte, nicht im Geringsten neugierige Art war so ansteckend, dass Ambler sich herzlich wenig für ihn interessierte.
Nochmals Routine: Der Krankenpfleger trug einen breiten Nylongurt in einer Hand. »Arme hoch«, befahl er grunzend, als er auf Ambler zutrat und ihm den Gurt um die Taille legte. Ohne diesen speziellen Gürtel durfte Ambler den Raum nicht verlassen. Zwischen zwei dicken Nylonlagen steckten mehrere flache Lithiumbatterien; hatte er den Gurt angelegt, lagen zwei Metallkontakte knapp oberhalb seiner linken Niere auf der Haut.
Dieser Gürtel – offiziell als REACT-Gürtel (Remote Electronically Activated Control Technology) bekannt – wurde normalerweise bei Transporten von Schwerverbrechern benutzt; in Abteilung 4W gehörte er zur Alltagskleidung. Der Elektroschocker konnte aus bis zu hundert Metern Entfernung aktiviert werden und war so eingestellt, dass er eine Achtelsekunde lang 50 000 Volt abgab. Dieser Stromstoß hätte selbst einen Sumo-Ringer zu Boden geworfen, wo er dann zehn bis fünfzehn Minuten lang epileptisch gezuckt hätte.
Sobald das Gurtschloss eingeschnappt war, begleitete der Krankenpfleger ihn den weiß gekachelten Flur entlang zur allmorgendlichen Medikamentenausgabe. Ambler ging langsam und schwerfällig, als wate er durch tiefes Wasser. Dieser Gang war oft die Folge von Psychopharmaka in hoher Dosierung und daher allen, die in den Abteilungen arbeiteten, wohl vertraut. Amblers Bewegungen standen im Widerspruch zu dem hellwachen Blick, mit dem er seine Umgebung musterte. Das gehörte zu den vielen Dingen, die dem Krankenpfleger entgingen.
Ambler hingegen entgingen nur wenige Dinge.
Das Gebäude war jahrzehntealt, aber es war regelmäßig mit modernster Sicherheitstechnik nachgerüstet worden: Die Türen wurden nicht mit Schlüsseln, sondern mit Karten geöffnet, die Transponderchips enthielten, und wichtige Verbindungstüren erforderten einen Irisscan, sodass kein Unbefugter sie öffnen konnte. Ungefähr dreißig Meter von seiner Zelle entfernt lag der sogenannte Evaluationsraum mit einer Fensterwand aus grauem polarisiertem Glas, durch das der Proband beobachtet werden konnte, ohne den Beobachter sehen zu können. Dort saß Ambler bei seinen regelmäßigen »psychiatrischen Evaluationen«, deren Zweck dem anwesenden Arzt anscheinend ebenso wenig klar war wie ihm selbst. In den letzten Monaten hatte Ambler wahre Verzweiflung kennengelernt, die jedoch nicht mit psychischen Störungen zusammenhing; vielmehr beruhte seine Verzweiflung darauf, dass er seine Aussichten auf Entlassung realistisch einschätzte. Obwohl das Personal alle drei Monate wechselte, hatten sich alle angewöhnt – das spürte er –, ihn als Lebenslänglichen zu betrachten, der hier noch eingesperrt sein würde, wenn sie längst nicht mehr hier arbeiteten.
Vor einigen Wochen hatte sich jedoch alles verändert. Diese Veränderung war nichts Objektives, nichts Greifbares, nichts Sichtbares. Trotzdem war es eine schlichte Tatsache, dass er jemanden erreicht hatte, und das würde den Ausschlag geben. Vielmehr würde sie ihn geben. Sie hatte schon damit angefangen. Sie war eine junge psychiatrische Krankenschwester namens Laurel Holland. Und – so einfach war das – sie stand auf seiner Seite.
Einige Minuten später erreichte der Krankenpfleger mit seinem schwerfälligen Patienten einen großen halbkreisförmigen Bereich der Abteilung 4W, der hochtrabend als Lounge bezeichnet wurde. Dieser Name war denkbar unpassend. Zutreffender war die technische Bezeichnung: Überwachungs-Atrium. An einem Ende standen einige primitive Fitnessgeräte und ein Bücherregal mit einer fünfzehn Jahre alten Ausgabe der World Book Encyclopedia. Am anderen Ende befand sich die Ausgabe: eine lange Theke mit einem lamellenartigen Schiebefenster aus Drahtglas, hinter dem auf einem Wandregal weiße Plastikflaschen mit pastellfarbenen Etiketten standen. Wie Ambler aus eigener Erfahrung wusste, konnte der Inhalt dieser Flaschen einen ebenso wirkungsvoll wehrlos machen wie stählerne Handschellen. Das Zeug bewirkte Erstarrung ohne inneren Frieden, Trägheit ohne innere Ruhe.
Die Klinik legte jedoch weniger Wert auf Ruhe als auf Ruhigstellung. An diesem Morgen war in der Lounge ein halbes Dutzend Krankenpfleger versammelt. Das war nicht ungewöhnlich: Nur das Personal nutzte die Lounge wirklich. Die Abteilung war für ein Dutzend Patienten eingerichtet; gegenwärtig war dort ein einziger untergebracht. Das hatte dazu geführt, dass dieser Bereich inoffiziell zu einer Art Erholungs- und Entspannungszentrum für Pfleger wurde, die in anderen Abteilungen eher belastende Arbeit taten. Und ihre Tendenz, sich hier zu versammeln, steigerte wiederum die Sicherheit dieser Abteilung.
Als Ambler sich umdrehte und zwei Krankenpflegern zunickte, die sich auf einer niedrigen Schaumstoffcouch herumlümmelten, ließ er langsam einen Speichelfaden über sein Kinn rinnen; der Blick, den er auf sie richtete, war unscharf und verschleiert. Er hatte längst registriert, wer alles anwesend war: sechs Krankenpfleger, der behandelnde Psychiater und – Amblers einzige Rettungsleine – die psychiatrische Krankenschwester.
»Jetzt gibt’s Bonbons«, sagte einer der Pfleger, und die anderen kicherten hämisch.
Ambler stapfte langsam zur Theke, hinter der die Schwester mit den kastanienbraunen Haaren mit seinen Morgenpillen wartete. Ein unsichtbarer Funke – ein flüchtiger Blick, ein angedeutetes Kopfnicken – sprang zwischen ihnen über.
Ihren Namen hatte er zufällig erfahren; sie hatte versehentlich ein Glas Wasser verschüttet, wobei der Stoff, der ihr Azetatnamensschild hätte verdecken sollen, nass und durchsichtig geworden war. Laurel Holland – die Buchstaben waren unter der Abdeckung schemenhaft zu erkennen gewesen. Er hatte ihren Namen geflüstert; sie hatte nervös, aber irgendwie nicht ungehalten gewirkt. Damit war der Funke zwischen ihnen übergesprungen. Er studierte ihr Gesicht, ihre Haltung, ihre Stimme, ihr Auftreten. Sie war Anfang dreißig, schätzte er, mit grün gefleckten haselnussbraunen Augen und geschmeidiger Figur. Cleverer und hübscher, als ihm bewusst gewesen war.
Gespräche zwischen ihnen bestanden nur aus wenigen gemurmelten Worten, die von den Überwachungssystemen nicht registriert wurden. Vieles ließ sich jedoch allein durch Blickkontakte und vielsagendes Lächeln ausdrücken. Für das System war er Patient Nr. 5312. Aber für sie war er inzwischen weit mehr als nur eine Zahl, das wusste er.
In den vergangenen sechs Wochen hatte er ihre Sympathie gewonnen. Nicht durch Schauspielerei – die hätte sie vermutlich rasch durchschaut –, sondern indem er sich auf eine Art gestattete, auf sie zu reagieren, die sie ermutigte, ihrerseits das Gleiche zu tun. Sie hatte etwas in ihm gesehen – sie hatte ihn als geistig normal erkannt.
Dieses Wissen hatte ihm neues Selbstvertrauen verliehen und seinen Fluchtwillen gestärkt. »Ich will nicht hier sterben«, hatte er ihr eines Morgens zugemurmelt. Sie hatte keine Antwort gegeben, aber ihr betroffener Blick hatte ihm alles gesagt, was er wissen musste.
»Ihre Medikamente«, hatte sie am folgenden Morgen fröhlich gesagt und ihm drei Tabletten, die etwas anders aussahen als die üblichen dämpfenden Neuroleptika, auf die Handfläche gelegt. Tylenol, hatte sie dabei nur mit den Lippen gesagt. Die Vorschriften bestimmten, dass er die Tabletten unter ihrer Aufsicht einnehmen und danach den Mund öffnen musste, damit sie überprüfen konnte, dass er sie auch geschluckt hatte. Das tat er, und binnen einer Stunde hatte er den Beweis dafür, dass sie die Wahrheit gesagt hatte. Er fühlte sich leichtfüßiger, auch geistig beweglicher. Innerhalb weniger Tage wurde er wacher, war wieder voller Energie – mehr er selbst. Er musste ganz bewusst weiter den ruhiggestellten Patienten spielen und das ungelenke Compazine-Schlurfen vortäuschen, das die Krankenpfleger von ihm gewöhnt waren.
Die Psychiatrische Klinik Parrish Island war eine mit modernster Technologie ausgestattete Hochsicherheitseinrichtung. Aber auch die ausgeklügeltste Technik konnte den menschlichen Faktor nicht völlig kontrollieren. Jetzt, da sein Körper sie vor der Überwachungskamera verbarg, steckte sie ihre Schlüsselkarte in den Gummizug seiner weißen Jogginghose.
»Hab gehört, dass es heute Morgen vielleicht einen Code zwölf gibt«, murmelte sie dabei. Dieser Code bezeichnete einen kritischen Gesundheitszustand, der die Verlegung eines Patienten in ein Krankenhaus auf dem Festland erforderte. Woher sie das wusste, erläuterte Laurel Holland nicht, aber er konnte es sich denken: Wahrscheinlich hatte ein Patient über Brustschmerzen geklagt – oft Vorboten eines Herzanfalls. Man würde ihn aufmerksam überwachen, weil weitere Anzeichen einer drohenden Arrhythmie die Verlegung auf eine Intensivstation nötig machen würden. Ambler erinnerte sich an einen früheren Code zwölf – ein älterer Patient hatte einen Gehirnschlag erlitten – und rief sich die Sicherheitsmaßnahmen ins Gedächtnis zurück. Auch wenn sie noch so akribisch waren, hatte er doch eine Unregelmäßigkeit entdeckt: eine gewisse Regelwidrigkeit, die er vielleicht für seine Zwecke würde nutzen können.
»Aufpassen!«, flüsterte sie. »Und bereithalten.«
Zwei Stunden später – Stunden, die Ambler in schweigender, regloser Starrheit verbrachte – war ein elektronisches Glockensignal zu hören, dann sagte eine synthetische Stimme: Code zwölf, Abteilung zwei Ost. Dies war eine Computerstimme, wie man sie in Shuttlezügen auf Flughäfen und modernisierten U-Bahnen hörte: irritierend angenehm. Die Krankenpfleger sprangen sofort auf. Muss dieser alte Knabe in 2E sein. Sein zweiter Infarkt, stimmt’s? Die meisten von ihnen machten sich auf den Weg in den zweiten Stock. Das Glockensignal und die Durchsage wurden in regelmäßigen Abständen wiederholt.
Also ein älterer Mann, der einen Infarkt erlitten hatte, das war zu erwarten gewesen. Ambler spürte eine Hand auf seiner Schulter. Das war der stämmige Krankenpfleger, der morgens in sein Zimmer gekommen war.
»Vorschrift«, sagte der Mann. »In allen Notfallsituationen kehren die Patienten in ihre Zimmer zurück.«
»Was ist passiert?«, fragte Ambler verständnislos und mit schwerer Zunge.
»Nichts, was Ihnen Sorgen machen müsste. In Ihrem Zimmer sind Sie sicher und am besten aufgehoben.« Übersetzung: eingesperrt. »Kommen Sie jetzt mit.«
Lange Minuten später standen die beiden Männer vor Amblers Zelle. Der Krankenpfleger hielt seine Schlüsselkarte an den Kartenleser, eine in Taillenhöhe neben der Tür montierte graue Kunststoffbox, und die Schiebetür glitt zur Seite.
»Rein mit Ihnen«, sagte der stämmige Bursche aus dem Mittleren Westen.
»Brauch Hilfe bei ...« Ambler trat über die Schwelle, drehte sich dann nach dem Krankenpfleger um und deutete hilflos auf das Klosett mit dem heruntergeklappten Deckel.
»Ach, Scheiße«, sagte der Krankenpfleger, wobei seine Nasenlöcher sich angewidert weiteten, doch er folgte Ambler in den Raum.
Du hast nur einen Versuch. Keine Fehler!
Als der Krankenpfleger auf ihn zutrat, stand Ambler gebückt und mit leicht gebeugten Knien da, als sei er kurz davor, zusammenzuklappen. Plötzlich schoss er hoch und rammte seinen Kopf unter das Kinn des anderen. Panik und Verwirrung zeichneten sich auf dem Gesicht des Mannes ab, während er den krachenden Rammstoß zu verdauen versuchte: Der schlurfende, halb betäubte Insasse hatte sich in einen Wirbelwind aus Aktivität verwandelt – was war passiert? Im nächsten Augenblick brach der Krankenpfleger auf den Vinylfliesen zusammen, und Ambler machte sich sofort daran, seine Taschen zu durchsuchen.
Keine Fehler. Er durfte sich nicht mal einen erlauben.
Er nahm die Chipkarte und den Dienstausweis des Mannes an sich, dann zog er sein taubengraues Hemd und seine Popelinehose an. Sie passten nicht besonders, wirkten aber auch nicht absurd; er würde einem flüchtigen Betrachter kaum auffallen. Um die Hosenbeine zu kürzen, rollte er die Aufschläge rasch nach innen ein. Der Hosenbund reichte bis über den Betäubungsgurt; er hätte viel dafür gegeben, das Ding loszuwerden, aber das war in der knappen Zeit, die ihm zur Verfügung stand, einfach nicht möglich. Ambler konnte nur das graue Nylonkoppel der Uniform straff anziehen und darauf hoffen, dass es das schwarze Nylongewebe des REACT-Gürtels halbwegs verdeckte.
Ambler öffnete die Zimmertür, indem er die Chipkarte des Krankenpflegers an den inneren Kartenleser hielt, und sah hinaus. Im Augenblick war der Flur leer. Alles nicht anderswo benötigte Pflegepersonal war nach 2E beordert worden.
Würde die Schiebetür sich automatisch schließen? Er durfte sich keinen Fehler leisten. Ambler trat auf den Korridor hinaus und hielt die Karte an den äußeren Leser. Nach mehrfachem Klicken schloss sich die Tür.
Dann hastete er die wenigen Meter zu der breiten, mit einem Bügelgriff versehenen Tür am Ende des Korridors. Eine der Türen mit vier elektrisch betätigten Riegeln. Natürlich abgesperrt. Er hielt die Schlüsselkarte an den Leser und hörte ein mehrmaliges Klicken, als der Schlossmotor ansprach. Dann nichts mehr. Die Tür blieb geschlossen.
Dies war kein Ausgang, den Krankenpfleger benutzen durften.
Jetzt wusste er, weshalb Laurel Holland ihm ihre Chipkarte gegeben hatte: Hinter dieser Tür musste der Flur liegen, über den die Medikamentenausgabe zu erreichen war.
Er versuchte es mit ihrer Karte.
Diesmal öffnete sich die Tür.
Dahinter lag ein schmaler Servicekorridor, der von einer langen Reihe schwacher Leuchtstoffröhren in ein trübes Licht getaucht wurde. Er blickte nach rechts, sah dort am Ende des Korridors einen Wagen mit Bettwäsche und schlich darauf zu. Die Putzkolonne war heute offenbar noch nicht hier gewesen. Auf dem Fußboden lagen Zigarettenkippen, Bonbonpapiere und auch etwas Metallisches, gegen das er mit der Schuhspitze stieß: eine leere Red-Bull-Dose, die jemand flach getreten hatte. Einem unbestimmten Instinkt folgend, hob Ambler sie auf und steckte sie in seine Hüfttasche.
Wie viel Zeit blieb ihm noch? Genauer gesagt: Wann würde das Verschwinden des Krankenpflegers bemerkt werden? In wenigen Minuten würde der Code zwölf beendet sein und jemand losgeschickt werden, der Ambler wieder aus seinem Zimmer holte. Also musste er das Gebäude so rasch wie möglich verlassen.
Seine Fingerspitzen fuhren über etwas, das aus der Wand ragte. Er hatte den Metalldeckel der Röhre gefunden, in die Schmutzwäsche geworfen wurde, damit sie in den Keller gelangte. Er kletterte hinein, hielt sich mit beiden Händen am Rand fest und tastete die Metallröhre unter sich mit den Füßen ab. Er hatte befürchtet, der Durchmesser des Wäscheabwurfs könnte zu klein sein; tatsächlich war er jedoch zu groß, und es gab keine seitliche Steigleiter, wie er zu hoffen gewagt hatte. Stattdessen bestand der Wäscheabwurf aus einer innen völlig glatten Stahlröhre. Um nicht in die Tiefe zu stürzen, musste er sich mit beiden Händen und seinen Füßen, die in Laufschuhen steckten, gegen die Wände stemmen.
Er kletterte langsam durch die Röhre hinunter, wobei er in anstrengender Folge jeweils eine Hand oder einen Fuß tiefer ansetzte. Der Kraftaufwand war gewaltig und schon bald ungeheuer schmerzhaft. Ausruhen konnte er sich keine Sekunde, seine Muskeln mussten ständig angespannt bleiben, damit er nicht abrutschte und durch die anscheinend senkrechte Röhre in die Tiefe stürzte.
Als er so wie ein Bergsteiger, der einen Felskamin durchklettert, den Boden erreichte, schienen Stunden vergangen zu sein, obwohl er wusste, dass er vermutlich nicht länger als zwei Minuten gebraucht hatte. Seine schmerzenden Muskeln zitterten und waren vor Anstrengung verkrampft, als er sich durch Säcke voller Schmutzwäsche wühlte und sich wegen des Gestanks nach menschlichem Schweiß und Exkrementen fast übergeben musste. Ihm war zumute, als wühle er sich mit bloßen Händen aus einem Grab, als kralle, schlängele, zwänge er sich durch eine Widerstand leistende Masse. Jede Faser seiner Muskulatur schrie nach einer Erholungspause, aber er wusste, dass dazu keine Zeit blieb.
Endlich gelangte er aus dem Wäscheberg auf einen harten Betonboden und war . . . wo? In einem heißen, niedrigen Keller, in dem Waschmaschinen rumpelten und dröhnten. Er drehte den Kopf zur Seite. Am Ende einer langen Doppelreihe weiß emaillierter Industrie-Waschmaschinen waren zwei Frauen damit beschäftigt, eine Trommel zu füllen.
Ambler rappelte sich auf, überquerte den Gang zwischen den Waschmaschinen und zwang dabei seine zitternden Muskeln zur Disziplin. Falls er gesehen wurde, musste sein Schritt selbstbewusst wirken. Sobald die Wäscherinnen ihn nicht mehr sehen konnten, blieb er neben einer Reihe von Wäschekarren mit Segeltuchwänden stehen und begutachtete seine Umgebung.
Er wusste, dass Kranke mit einem schnellen Motorboot aufs Festland transportiert wurden, das bald herüberkommen würde, wenn es nicht bereits angelegt hatte. In diesem Augenblick wurde der Infarktpatient wahrscheinlich auf einer Trage festgeschnallt. Sollte Amblers Fluchtplan die geringste Chance auf Erfolg haben, musste er dringend weiter.
Er musste es schaffen, auf dieses Boot zu gelangen.
Was bedeutete, dass er irgendwie die Anlegestelle erreichen musste. Ich will nicht hier sterben – er hatte nicht nur an Laurel Hollands Mitgefühl appellieren wollen, als er das gesagt hatte. Er hatte die Wahrheit gesagt, vielleicht die wichtigste Wahrheit, die er kannte.
»He!«, rief eine Stimme. »Scheiße, Mann, was haben Sie hier zu suchen?«
Die lächerliche Autorität eines kleinen Kontrolleurs: eines Mannes, dessen Leben daraus bestand, dass er nach oben buckelte und nach unten trat.
Ambler zwang sich zu einem unbekümmerten Lächeln, als er sich einem kleinen Glatzkopf mit käsigem Teint zuwandte, dessen Augen wie eine Uberwachungskamera in ständiger Bewegung waren
»Nicht aufregen, Kumpel«, sagte Ambler. »Ich schwör’s, ich hab nicht geraucht.«
»Sie halten sich wohl für witzig?« Der Kontrolleur kam auf ihn zu. Er warf einen Blick auf den Dienstausweis an Amblers Hemdtasche. »Können Sie Spanisch? Ich kann Sie nämlich zur Putzkolonne versetzen lassen, Sie . . .« Er verstummte jäh, als er erkannte, dass das Foto auf dem Dienstausweis nicht mit dem Gesicht des vor ihm Stehenden übereinstimmte. »Ach du Scheiße«, flüsterte er.
Dann tat er etwas Seltsames: Er wich blitzschnell zehn bis zwölf Schritte zurück und hakte ein Gerät von seinem Gürtel los. Das war der Sender, mit dem der Lähmgurt aktiviert wurde.
Nein!Das musste Ambler verhindern. Wurde der Gurt aktiviert, würde eine Schmerzwoge über ihn hereinbrechen, er würde sich zuckend und von Krämpfen geschüttelt auf dem Boden winden. Dann wären alle seine Pläne vergeblich gewesen. Er würde hier sterben: als namenloser Gefangener, als Spielball von Mächten, die er nie verstehen würde. Weil sein Unterbewusstsein eine Zehntelsekunde schneller reagierte als sein Bewusstsein, griffen Amblers Hände wie aus eigenem Antrieb nach der flachgedrückten Getränkedose in seiner Hüfttasche.
Abnehmen konnte er den Lähmgurt nicht. Aber er konnte das flache Blech unter den Gürtel schieben . . . und das tat er jetzt mit aller Kraft, ohne sich darum zu kümmern, dass eine scharfe Blechkante ihm die Haut aufschürfte. Nun lagen die beiden Elektroden des REACT-Gürtels auf elektrisch leitendem Metall.
»Willkommen in einer Welt aus Schmerzen«, sagte der Kontrolleur ruhig, als er den Knopf drückte, mit dem der Lähmgurt aktiviert wurde.
Aus dem Gurt hinter Amblers Rücken drang ein knisterndes Summen. Sein Körper war nun nicht mehr die widerstandsärmste Verbindung zwischen den beiden Elektroden; die bildete jetzt die flachgedrückte Blechdose. Es roch nach versengtem Nylon, dann erstarb das Summen.
Der Gürtel war kurzgeschlossen.
Ambler verfolgte den Flüchtenden, holte ihn rasch ein und rang ihn zu Boden. Der Kopf des Mannes schlug auf den Beton, und er ließ ein leises, benommenes Stöhnen hören. Ambler erinnerte sich daran, was einer seiner Ausbilder bei Consular Operations immer gesagt hatte: Pech ist nur die Kehrseite des Glücks. Jedes Missgeschick ist eine Chance. Das war nicht gerade logisch, aber Ambler hatte die Richtigkeit dieser Behauptung oft schon intuitiv erkannt. Die Abkürzung unter dem Namen des Mannes zeigte ihm, dass er fürs Gebäudeinventar zuständig war. Das bedeutete, dass er kontrollierte, wie Dinge durch die Lieferanteneingänge herein und hinaus gelangten. An den richtigen Gebäudeausgängen wurde weit schärfer kontrolliert als auf den Korridoren: Sie erforderten die biometrische Signatur eines Berechtigten. Zum Beispiel die des Mannes, der schlaff vor Amblers Füßen lag. Er ersetzte den Dienstausweis des Krankenpflegers, den er bisher getragen hatte, durch den des Kontrolleurs. Sogar bewusstlos würde der Mann ihm jetzt zur Flucht verhelfen.
Die Stahltür des westlichen Lieferanteneingangs trug ein weiß-rotes Warnschild mit einer unmissverständlichen Aussage: BENUTZUNG DIESES AUSGANGS DURCH UNBEFUGTE STRENG VERBOTEN; TÜR IST ALARM-GESICHERT. Neben dem Bügelgriff befand sich kein Schlüsselloch, und an der Wand hing kein Kartenleser. Stattdessen war dort ein erheblich schwieriger zu überlistendes Gerät angebracht, dessen einfache Benutzeroberfläche nur aus einer senkrechten Glasplatte und einem Druckknopf bestand. Dies war ein Netzhautscanner, der buchstäblich unfehlbar war. Die vom Sehnerv ausgehenden und in die Netzhaut ausstrahlenden Kapillaren bildeten bei jedem Menschen ein einzigartiges Muster. Im Gegensatz zu Fingerabdrucklesern, die nur sechzig Identifizierungspunkte kontrollierten, überprüften Netzhautscanner viele Hundert Einzelheiten. Daher kamen Fehlidentifizierungen bei Geräten dieser Art praktisch nicht vor.
Unfehlbar hieß jedoch nicht narrensicher. Hier kommt dein Befugter, dachte Ambler, während er den bewusstlosen Kontrolleur unter den Armen packte, vor den Scanner hievte und ihm mit gespreizten Fingern die Lider öffnete. Als er mit dem Ellbogen den Knopf drückte, blitzte es hinter dem Scannerglas zweimal rot auf. Nach endlos langen Sekunden war das Surren eines Elektromotors zu hören, und die Tür öffnete sich. Ambler ließ den Mann zu Boden fallen, ging durch die Tür und stieg ein paar Betonstufen hinauf.
Oben stand er in einer Ladebucht auf der Westseite des Gebäudes und atmete erstmals seit Langem wieder ungefilterte Luft. Der Tag war wolkenverhangen: kalt, nass, trübe. Aber er war draußen. Für Sekunden ergriff ihn ein ausgelassenes, albernes Hochgefühl, das sofort stärkerer Besorgnis wich. Er war in größerer Gefahr als je zuvor. Von Laurel Holland wusste er, dass das Gelände von einem Elektrozaun umgeben war. Er konnte es nur in offizieller Begleitung verlassen – oder indem er selbst einen der offiziellen Begleiter spielte.
Aus der Ferne brauste ein starkes Motorboot heran, und irgendwo in seiner Nähe war ein anderes Motorengeräusch zu hören. Ein Elektrofahrzeug, das an einen übergroßen Golfkarren erinnerte, surrte zum Südeingang des Gebäudes. Wenig später wurde eine fahrbare Krankentrage an die geöffnete Ladeklappe herangerollt. Der Elektrokarren würde den Infarktpatienten zum Boot bringen.
Ambler holte tief Luft, ging mit großen Schritten um die Gebäudeecke, rannte zu dem Wagen und schlug mit der flachen Hand an die Fahrertür. Der Mann am Steuer betrachtete ihn leicht misstrauisch.
Du bist ruhig; du wirkst gelangweilt. Ich tue nur meine Arbeit. »Ich soll den Kerl mit dem Herzanfall bis ins Klinikum begleiten«, sagte Ambler, indem er rechts einstieg. Das bedeutete: Mir gefällt dieser Auftrag nicht besser als dir. »Die Scheißjobs kriegen immer die Neulinge.« Sein Tonfall klang leicht beleidigt, aber zugleich auch entschuldigend. Er verschränkte die Arme vor der Brust, um den Dienstausweis mit dem Foto zu verbergen, denn er sah dem Kontrolleur ganz und gar nicht ähnlich. »Da ist dieser Laden genau wie alle anderen, in denen ich je gearbeitet habe.«
»Sind Sie in Barlowes Team?«, grunzte der Fahrer.
Barlowe?»Sie sagen es.«
»Er ist ein richtiger Scheißkerl, stimmt’s?«
»Sie sagen es«, wiederholte Ambler.
An der Anlegestelle grummelten die Männer, die mit dem Schnellboot herübergekommen waren – der Steuermann, ein Sanitäter und ein bewaffneter Wachmann –, als sie hörten, dass jemand aus der Klinik den Patienten begleiten sollte. Traute man ihnen nicht zu, ihre Arbeit ordentlich zu machen? War das die Message? Außerdem, darauf wies der Sanitäter hin, war der Patient bereits tot. Er würde nur ins Leichenhaus geschafft werden müssen. Aber die Kombination aus Amblers Gleichmut und dem Schulterzucken des Fahrers beschwichtigte sie, und bei diesem Wetter wollte niemand länger als nötig im Freien sein. In ihren blauen Windjacken leicht zitternd, packten die Besatzungsmitglieder je ein Ende der Aluminiumtrage und brachten den Toten unter Deck in die Heckkabine.
Der gut zwölf Meter lange Culver Ultra Jet war kleiner als die Boote, die das Klinikpersonal beförderten. Und es war schneller: Mit seinen beiden 500-PS-Unterwasserdüsen konnte es die Strecke bis zum Klinikum in zehn Minuten zurücklegen. Einen Hubschrauber von der Langley Air Force Base oder der U.S. Naval Base anzufordern, landen zu lassen und zu beladen, hätte länger gedauert. Ambler blieb in der Nähe des Steuermannes, denn das Boot war das neue Militärmodell, und er wollte sicherstellen, dass er Antrieb und Steuerung bedienen konnte. Er beobachtete, wie der Pilot die Bug- und Heckdüsen verstellte und dann Vollgas gab. Das Boot kam nun hoch aus dem Wasser und machte gut fünfunddreißig Knoten.
Das Übersetzen würde zehn Minuten dauern. Würde seine List so lange unentdeckt bleiben? Es war nicht schwierig gewesen, dafür zu sorgen, dass das Foto auf seinem Dienstausweis durch etwas Strandschlamm fleckig wurde, und Ambler wusste, dass die meisten Leute eher auf äußere Hinweise – Tonfall, Auftreten, Verhalten – als auf Dokumente achteten. Nach einigen Minuten setzte er sich auf die Bank hinter dem Steuerruder zu dem Wachmann und dem Sanitäter.
Der Sanitäter – Ende zwanzig, rot geflecktes Gesicht, lockiges schwarzes Haar – schien Amblers Gegenwart noch immer als kränkend zu empfinden. Schließlich wandte er sich an Ambler und sagte: »Mir hat kein Mensch was gesagt, dass die Leiche begleitet werden soll. Sie wissen, dass der Kerl tot ist, stimmt’s?« Ein Südstaatenakzent, der Sprecher gelangweilt und irritiert, vermutlich sauer, weil er losgeschickt worden war, um einen Patienten abzuholen, der bereits tot war.
»Ist er das?« Ambler unterdrückte ein Gähnen oder tat zumindest so. Jesus, kann er nicht endlich damit aufhören?
»Das will ich meinen! Ich hab ihn selbst untersucht. Also dürfte er wohl kaum verduften, stimmt’s?«
Ambler erinnerte sich an die übereifrige Art des Mannes, dessen Dienstausweis er trug. Das war der Tonfall, den er anschlagen musste. »Bis der amtliche Leichenschein vorliegt, ist’s scheißegal, was Sie sagen. Auf Parrish darf ihn keiner ausstellen. Vorschrift ist nun mal Vorschrift.«
»Alles Bockmist!«
»Hör auf, ihn anzumotzen, Olson«, sagte der Wachmann. Das war nicht Solidarität, sondern ein Scherz. Aber dahinter steckte noch mehr. Ambler spürte, dass die beiden sich nicht sonderlich gut kannten und sich in Gesellschaft des anderen unwohl fühlten. Vermutlich lag hier ein klassisches ungelöstes Autoritätsproblem vor: Der Sanitäter tat gern so, als habe er zu befehlen, aber der Wachmann trug eben doch die Dienstwaffe.
Ambler nickte dem Wachmann freundlich zu. Der andere war muskulös, Mitte zwanzig und trug einen militärischen Haarschnitt. Er schien ein ehemaliger Ranger der U.S. Army zu sein; jedenfalls gehörte seine an der Hüfte getragene HK P7, eine kompakte, tödliche Pistole, seit Langem zu den Lieblingswaffen der Ranger. Er war als Einziger an Bord bewaffnet, aber Ambler merkte ihm an, dass er auch so ein harter Brocken war.
»Wie auch immer«, sagte der Sanitäter nach einer Pause. Aber er stimmte dem Wachmann innerlich nicht zu, sondern fragte sich im Stillen: Was ist dein Problem?
Als die drei wieder in ungeselliges Schweigen verfielen, gestattete Ambler sich, einen Anflug von Erleichterung zu empfinden.
Das Boot war erst wenige Meilen von Parrish Island entfernt, als der Steuermann, der Kopfhörer trug, gestikulierte, um ihre Aufmerksamkeit zu erwecken, und den Deckenlautsprecher einschaltete. »Hier Fünf-Null-Fünf auf Parrish Island.« Die Stimme des Dispatchers klang aufgeregt. »Wir haben eine Fluchtsituation! Ein Insasse ist geflüchtet. Ich wiederhole: Wir haben eine Fluchtsituation.«
Ambler spürte, wie seine Magennerven sich verkrampften. Er musste handeln, die Krise nutzen. Er sprang auf. »Jesus auf ’nem Floß!«, grunzte er.
Der Lautsprecher knackte nochmals, dann sprach der Dispatcher weiter: »Cruiser 12-647-M, der Insasse kann sich auf Ihr Boot geflüchtet haben. Bitte sofort bestätigen oder das Gegenteil melden. Ich bleibe dran.«
Der Wachmann musterte Ambler prüfend; in seinem Kopf begann ein Gedanke zu entstehen. Ich muss ihm zuvorkommen, ihm eine neue Richtung geben ...
»Scheiße«, sagte Ambler. »Jetzt wisst ihr vermutlich, wozu ich hier bin.« Eine kurze Pause. »Glaubt ihr, dass es ein Zufall ist, dass sie darauf bestehen, jedem Boot, das die Insel verlässt, zur Sicherheit einen zusätzlichen Mann mitzugeben? In den letzten vierundzwanzig Stunden haben wir immer wieder gerüchteweise von einem geplanten Fluchtversuch gehört.«
»Das hätten sie uns auch sagen können«, knurrte der Wachmann mürrisch.
»Das ist nicht die Art Gerücht, die in der Klinik geschätzt wird«, wehrte Ambler ab. »Muss gleich mal nach dem Toten sehen.« Er hastete nach achtern in die Heckkabine unter Deck. Links neben der Tür befand sich ein schmaler Werkzeugschrank, der in den Frachtraum des Innenrumpfs eingelassen war. Der Schrank enthielt nichts außer ein paar verölten Lappen auf dem Boden. Auf dem schachbrettartig gemusterten Stahlboden stand die fahrbare Krankentrage mit dem durch Gurte mit Klettverschlüssen gesicherten Toten; er wirkte aufgedunsen, wog mindestens hundertzehn Kilo, und die Leichenblässe war unverkennbar.
Was tun? Er würde schnell reagieren müssen, bevor die anderen sich dazu entschlossen, ihm zu folgen.
Zwanzig Sekunden später kam er in die Kabine gestürmt.
»Sie!«, sagte Ambler, indem er anklagend auf den Sanitäter deutete. »Sie haben gesagt, dass der Patient tot ist. Was für’n Bockmist war das? Ich hab ihm die Hand an den Hals gelegt, und raten Sie mal, was ich gespürt hab? Der Kerl hat einen Puls – genau wie Sie und ich!«
»Reden Sie keinen Unsinn«, wehrte der Sanitäter aufgebracht ab. »Dort unten liegt ’ne gottverdammte Leiche.«
Ambler atmete noch immer keuchend. »Eine Leiche, die Puls siebzig hat? Das wäre was ganz Neues!«
Der Wachmann drehte den Kopf zur Seite, und Ambler konnte sehen, was er dachte: Dieser Kerl scheint zu wissen, wovon er redet. Damit war Ambler vorübergehend im Vorteil, den er ausnutzen musste.
»Spielen Sie da mit?«, fragte Ambler, indem er den Sanitäter mit anklagendem Blick fixierte. »Haben Sie sich kaufen lassen?«
»Was zum Teufel soll das heißen?«, fragte der Sanitäter verdutzt, während die roten Flecken auf seinem Gesicht noch deutlicher hervortraten. Die Art, wie der Wachmann ihn musterte, brachte ihn noch mehr auf, und alles zusammen bewirkte, dass sein Tonfall defensiv und unsicher klang. Er wandte sich an den Wachmann. »Becker, du glaubst doch nicht etwa, was dieser Kerl behauptet? Ich weiß, wie man einen Puls fühlt, und das ist ’ne gottverdammte Leiche, die wir da auf der Trage haben.«
»Zeigen Sie’s uns«, verlangte Ambler grimmig und ging nach achtern voraus. Das Pronomen uns war wirkungsvoll, das wusste er; unausgesprochen zog es eine Linie zwischen dem Mann, den er beschuldigte, und den anderen. Ambler musste dafür sorgen, dass alle unsicher blieben; er musste Misstrauen und Zwietracht säen. Sonst würde der Verdacht sich auf ihn konzentrieren.
Er sah sich um und stellte fest, dass der Wachmann mit gezogener Pistole die Nachhut bildete. Die drei Männer gingen um die Plattformen über den Querstreben herum und näherten sich der Heckkabine. Der Sanitäter stieß die Tür auf, dann fragte er verblüfft: »Was zum Teufel ...?«
Die beiden anderen spähten in die Kabine. Die Trage war umgestürzt, die Klettverschlüsse der Gurte waren gelöst. Die Leiche war verschwunden.
»Sie verdammter Lügner!«, rief Ambler aufgebracht aus.
»Das versteh ich nicht«, sagte der Sanitäter fassungslos.
»Nun, wir verstehen’s recht gut, denke ich«, sagte Ambler in eisigem Tonfall. Damit nutzte er eine raffinierte syntaktische Fügung: Je öfter er von »wir« sprach, desto mehr wuchs seine Autorität. Sein Blick streifte die Tür des Werkzeugschranks. Er konnte nur hoffen, dass niemandem auffallen würde, wie die Tür sich wölbte.
»Willst du mir erzählen, dass ein Toter hier von selbst rausgekommen ist?«, fragte der Wachmann mit dem Bürstenhaarschnitt, indem er sich an den Südstaatler mit dem Lockenkopf wandte. Dabei hielt er seine Pistole fest umklammert.
»Wahrscheinlich ist er nur über die Bordwand gerutscht, um ein bisschen zu schwimmen«, feixte Ambler. Rühr die Trommel für dein Szenario; verhindere, dass sie auf andere Gedanken kommen. »Das hätten wir nicht gehört und bei diesem Nebel auch nicht gesehen. Von hier aus sind’s drei Meilen bis zur Küste – gut zu schaffen, wenn man flott krault. Typisches Leichenverhalten, stimmt’s?«
»Das ist verrückt!«, protestierte der Sanitäter. »Ich hab nichts damit zu schaffen! Das müsst ihr mir glauben.« Diese automatische Form des Leugnens bestätigte nur das entscheidende Element von Amblers Behauptung: Der Mann auf der Krankentrage musste der flüchtige Insasse sein.
»Ich denke, jetzt wissen wir, warum er so sauer war, als sie mich mitgeschickt haben«, sagte Ambler zu dem Wachmann. Er sprach nur eben laut genug, um sich trotz des Motorenlärms verständlich zu machen. »Hören Sie, das sollten Sie sofort melden. Ich bewache inzwischen den Verdächtigen.«
Der Wachmann war sichtlich verwirrt, und Ambler konnte seine im Widerstreit liegenden Regungen von seinem Gesicht ablesen. Er beugte sich zu ihm hinüber und sprach dem Wachmann vertraulich ins Ohr. »Ich weiß, dass Sie nichts mit dieser Sache zu tun haben«, sagte er. »Das schreibe ich ausdrücklich in meinen Bericht hinein. Folglich haben Sie nichts zu befürchten.« Die damit übermittelte Botschaft ging weit über den bloßen Gehalt der Worte hinaus. Ambler war durchaus bewusst, dass er nicht ansprach, was dem Wachmann wirklich Sorgen machte: Der Mann war noch gar nicht auf die Idee gekommen, jemand könnte ihn verdächtigen, er sei an einem Ausbruch aus einer Hochsicherheitseinrichtung beteiligt gewesen. Aber indem Ambler ihn in diesem Punkt beruhigte - und von seinem »Bericht« sprach –, etablierte er subtil seine Autorität: Der Mann in der taubengrauen Uniformbluse verkörperte jetzt die Bürokratie, die durch Vorschriften geregelten Verfahren, die Disziplin von Befehl und Gehorsam.
»Verstanden«, sagte der Wachmann und wandte sich ihm zu, um sich rückzuversichern.
»Geben Sie mir die Pistole, dann behalte ich diesen Clown im Auge«, sagte Ambler mit ruhiger Stimme. »Aber Sie müssen diese Sache sofort über Funk melden.«
»Wird gemacht«, sagte der Wachmann. Ambler sah ihm an, dass er einen Anflug von Unbehagen spürte, noch während die Ereignisse – verwirrende und außergewöhnliche Ereignisse - ihn dazu bewogen, seine gewohnte Vorsicht zu vergessen. Er zögerte einen Augenblick, bevor er dem Mann in der grauen Uniformbluse seine durchgeladene Heckler & Koch P7 übergab.
Aber nur einen Augenblick.
Kapitel zwei
Langley, Virginia
Selbst nach fast dreißig Dienstjahren genoss Clayton Caston noch immer die kleinen Details des CIA-Komplexes wie die im Freien aufgestellte Skulptur Kryptos: ein s-förmiges Kupfergitter, das von Buchstaben durchdrungen wurde – ein aus der Zusammenarbeit eines Bildhauers mit einem Kryptografen der Agency entstandenes Werk. Oder das Basrelief von Alan Dulles an der Nordwand mit der vielsagenden Inschrift: Sein Monument umgibt uns. Nicht alle Ergänzungen aus jüngerer Zeit waren jedoch ebenso erhebend. Der Haupteingang der Agency war in Wirklichkeit das Foyer des jetzt als Originales Zentralgebäude bezeichneten Baus, der »Original« geworden war, als im Jahr 1991 das Neue Zentralgebäude errichtet worden war, und die heute übliche Namensgebung verhinderte, dass ein Bau einfach Zentralgebäude genannt wurde. Man musste sich zwischen dem Original und dem Neuen entscheiden, das aus einer Ansammlung von fünfstöckigen Bürotürmen auf einem Hügel neben dem ursprünglichen OZB bestand. Um den Haupteingang des NZBs zu erreichen, musste man in den dritten Stock hinauffahren. Alles reichlich verwirrend, was seiner Erfahrung nach keinesfalls eine Empfehlung war.
Castons Büro lag natürlich im OZB, aber nicht einmal in der Nähe seiner von glänzenden Fensterreihen durchbrochenen Außenwände. Tatsächlich war es regelrecht versteckt: ein fensterloser Innenraum von der Art, in dem sonst Fotokopierer standen oder Büromaterial lagerte. Ein idealer Raum, wenn man nicht gestört werden wollte, aber nur wenige Leute betrachteten ihn unter diesem Aspekt. Selbst Veteranen der Agency neigten zu der Vermutung, Caston sei zu einem internen Exil vergattert worden. Sie betrachteten ihn und sahen einen unbedeutenden Menschen, der sicher nicht viel geleistet hatte, einen Mann in seinen Fünfzigern, der seine Zeit absaß, planlos Akten hin und her schob und die Tage zählte, bis er in Pension gehen durfte.
Wer ihn gesehen hätte, wie er morgens seinen Platz hinter dem Schreibtisch einnahm – die Augen auf die Schreibtischuhr gerichtet, Kugelschreiber und Bleistifte auf der Schreibunterlage aufgereiht wie Silberbesteck auf einem Set -, hätte solche Vorurteile nur bestätigt gesehen. 8.54 zeigte die Uhr an, nach Castons Auffassung sechs Minuten vor Beginn des eigentlichen Arbeitstages. Er zog ein Exemplar der Financial Times heraus und wandte sich dem Kreuzworträtsel zu. Ein rascher Blick auf die Uhr. Fünf Minuten. Jetzt machte er sich an die Arbeit. Eins waagrecht.
Eins senkrecht. Hauptstadt des Sudan
Ohne jemals mehr als ein bis zwei Sekunden zu zögern, füllte er mit dem Bleistift lautlos die Kästchen des Kreuzworträtsels aus.
Und jetzt war er fertig. 8.59 zeigte die Uhr an. Von der Tür her war ein Klappern zu hören: sein Assistent, der auf die Minute pünktlich kam und außer Atem war, weil er den Flur entlanggejoggt war. Pünktlichkeit war das Thema eines Gesprächs gewesen, das sie vor Kurzem geführt hatten. Adrian Choi öffnete den Mund, als wolle er eine Entschuldigung vorbringen; dann sah er auf seine Uhr und glitt schweigend auf den Stuhl vor seiner kleineren, niedrigeren Workstation. Um seine mandelförmigen Augen hing noch ein Rest Schlaf, und sein dichtes schwarzes Haar war noch feucht vom Duschen. Adrian Choi war gerade dreiundzwanzig Jahre alt, trug ein unauffälliges Zungenpiercing und schien weiterhin kein Zeitgefühl zu haben.
Um Punkt 9 Uhr steckte Caston die Financial Times in den Papierkorb und öffnete seine sichere E-Mail-Ablage. Mehrere Mails enthielten innerhalb der Agency verbreitete Mitteilungen, die ihn nicht sonderlich interessierten: ein neues Wellness-Programm, eine kleine Korrektur der Versicherung für Zahnbehandlungen, eine Intranetadresse, unter der Mitarbeiter den Stand ihres Versorgungsplans 401 (k) erfragen konnten. Eine Mail kam von einem Angestellten der Steuerbehörde in St. Louis, der sich zwar über eine Anfrage von der Innenrevision der CIA wunderte, aber gern bereit war, detaillierte Angaben über die von einem bestimmten Unternehmen der Leichtindustrie in den letzten sieben Jahren gegründeten Tochtergesellschaften zur Verfügung zu stellen. Eine weitere kam von einer kleinen Gesellschaft, deren Aktien in Toronto notiert waren, und enthielt die von Caston angeforderten Informationen über Börsentransaktionen ihrer Vorstandsmitglieder im vergangenen Halbjahr. Der Finanzchef verstand nicht, wozu Caston außer dem jeweiligen Datum auch die Uhrzeit benötigte, aber er hatte sie wunschgemäß hinzugefügt.
Caston wusste recht gut, wie trocken und langweilig seine Aktivitäten den meisten seiner Kollegen erschienen. Die Hochschulabsolventen und Mitglieder elitärer Verbindungen, die im Außendienst gewesen waren oder weiterhin hofften, dort wieder eingesetzt zu werden, behandelten ihn mit freundlicher Herablassung. »Man weiß nur, was man selbst gesehen hat«, lautete ihr Motto. Caston fuhr natürlich niemals irgendwohin, aber andererseits hielt er auch nichts von diesem Dogma. Wenn er sich in einen Stapel Arbeitsblätter vertiefte, konnte er oft jemandem alles vermitteln, was dieser wissen musste, ohne dass er seinen Schreibtisch hätte verlassen müssen.
Andererseits wussten nur sehr wenige seiner Kollegen, was Caston tatsächlich machte. War er nicht einer der Kerle, die anderer Leute Reise- und Spesenabrechnungen kontrollierten? Oder hatte seine Tätigkeit mehr mit Bestellungen von Papier und Druckerpatronen zu tun – schließlich brauchte niemand in geheimen Abrechnungen herumzuschnüffeln, nicht wahr? Jedenfalls brachte sein Job ihm kaum mehr Prestige ein als der des Hausmeisters. Es gab allerdings auch einige wenige Kollegen, die Caston respektvoll, fast ehrfürchtig begegneten. Sie gehörten meistens zum engeren Kreis der CIA-Direktoren oder zur Führungsspitze der Hauptverwaltung Spionageabwehr. Sie wussten, weshalb Aldrich Ames im Jahr 1994 wirklich geschnappt worden war. Und sie wussten, dass eine kleine, aber ständig vorhandene Differenz zwischen offiziellem Einkommen und persönlichen Ausgaben zur Enttarnung Gordon Blaines und seines Spionagenetzes geführt hatte. Sie wussten von Dutzenden von weiteren, zum Teil vergleichbaren Triumphen, von denen die Öffentlichkeit nie erfahren würde.
Es war eine Mischung aus Charakterzügen und Talenten, die Caston dort Erfolge brachte, wo ganze Abteilungen versagten. Ohne jemals sein Büro zu verlassen, grub er sich tief durchs verwirrende Labyrinth menschlicher Käuflichkeit. Gefühle interessierten ihn dabei wenig; vielmehr hatte er einen Buchhalterblick für Zahlenreihen, deren Salden nicht übereinstimmten. Eine Reise, die gebucht, aber nicht unternommen wurde; eine Taxiquittung, die zeitlich oder räumlich nicht zum Verlauf der Reise passte; eine Kreditkartenabrechnung für ein zweites, nicht gemeldetes Handy: Es gab tausend Kleinigkeiten, durch die ein Schwindler sich verraten konnte, und er brauchte nur einen Fehler zu machen. Aber wer die Mühen der Kollation scheute – wer nicht sicherstellen wollte, dass eins waagrecht mit eins senkrecht übereinstimmte –, würde sie nie entdecken.
Adrian, dessen Haar zu trocknen begann, trat mit mehreren Memos in den Händen an Castons Schreibtisch und erläuterte lebhaft, was er sortiert und was er davon weggeworfen hatte. Caston blickte zu ihm auf, bemerkte den tätowierten Unterarm des jungen Mannes und sah gelegentlich einen Zungensticker aufblitzen: beides undenkbar, als er angefangen hatte, aber vermutlich musste auch die Agency mit der Zeit gehen.
»Vergessen Sie nicht, die vierteljährlichen Vordrucke 166 zur Bearbeitung wegzuschicken«, sagte Caston.
»Super«, sagte Adrian. Er sagte oft super, was in Castons Ohren wie aus der Mitte des vorigen Jahrhunderts klang, aber anscheinend war das Wort wieder in Mode gekommen. Soweit Caston beurteilen konnte, hieß es ungefähr: Ich habe gehört, was Sie gesagt haben, und es mir zu Herzen genommen. Vielleicht bedeutete es weniger; mehr bedeutete es bestimmt nicht.
»Was ist heute Morgen eingegangen? Irgendetwas Ungewöhnliches? Irgendetwas ... Irreguläres?«
»Eine Voicemail von Caleb Norris, dem Assistant Deputy Director of Intelligence?« In Adrians Stimme klang eine kalifornische Intonation an – die fragende Stimmhebung, mit der junge Leute heutzutage oft ihre Aussagen relativierten.
»Fragen Sie mich oder erzählen Sie’s mir?«
»Sorry. Das war erzählt.« Adrian machte eine Pause. »Ich habe das Gefühl, dass die Sache dringend sein könnte.«
Caston lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Sie haben das Gefühl?«
»Ja, Sir.«
Caston betrachtete den jungen Mann, wie ein Insektenforscher eine Gallwespe studiert. »Und Sie ... teilen mir Ihre Gefühle mit. Interessant. Also, gehöre ich zu Ihrer Familie, bin ich Ihr Vater oder Bruder? Sind wir Kumpel?Bin ich Ihre Ehefrau oder Freundin?«
»Na ja, ich ...«
»Nein? Wollte mich nur vergewissern. Dann – und das ist ein Deal, den ich Ihnen vorschlage – erzählen Sie mir bitte nicht, was Sie fühlen. Mich interessiert nur, was Sie denken. Was Sie glauben, selbst wenn Sie sich Ihrer Sache nicht hundertprozentig sicher sind. Was Sie durch Beobachtungen oder Schlussfolgerungen wissen. Was Ihre nebulösen sogenannten Gefühle angeht, behalten Sie sie bitte für sich.« Er machte eine Pause. »Tut mir leid. Habe ich Ihre Gefühle verletzt?«
»Sir, ich ...«
»Das war eine Fangfrage, Adrian. Die dürfen Sie nicht beantworten.«
»Sehr erhellend, Meister«, sagte Adrian, um dessen Lippen ein Lächeln schwebte, ohne sich darauf festzusetzen. »Ich habe verstanden.«
»Aber Sie wollen mir etwas erzählen. Über aus dem normalen Rahmen fallende eingegangene Meldungen.«
»Nun, da gibt’s zum Beispiel diese gelbe interne Mitteilung aus dem Büro des stellvertretenden Direktors.«
»Sie sollten inzwischen die Farbcodes der Agency kennen. Bei der CIA gibt’s kein Gelb.«
»Sorry«, sagte Adrian. »Kanariengelb.«
»Das was bedeutet?«
»Es bedeutet ...« Er machte eine Pause, wusste einen Augenblick nicht weiter. »Es bedeutet einen inländischen Vorfall mit Auswirkungen auf die Sicherheit. Ergo nichts für die CIA1. Etwas für andere Behörden. ASD.« ASD: andere staatliche Dienststellen. Ein Euphemismus für den Papierkorb.
Caston nickte knapp und ließ sich den leuchtend gelben Umschlag geben. Er fand ihn geschmacklos wie einen garstigen, kreischenden Tropenvogel – genau gesagt wie einen Kanarienvogel. Er erbrach das Siegel persönlich, setzte seine Lesebrille auf und überflog rasch die Meldung. Potenzielle Gefährdung der Sicherheit im Zusammenhang mit der Flucht eines Insassen. Ein Patient Nr. 5312 war aus einer geheimen Hochsicherheitsklinik ausgebrochen.
Merkwürdig, dachte Caston, dass der stationär Behandelte hier nicht genannt ist. Er überflog den Bericht nochmals, um festzustellen, wo der Vorfall sich ereignet hatte.
In der Psychiatrischen Klinik Parrish Island.
Das erinnerte ihn an etwas. Es löste ein Alarmsignal aus.
Ambler bahnte sich einen Weg durch die halb im Winterschlaf liegende Strandvegetation – durch einen breiten Streifen aus Stechginster, Strandhafer und Pimentsträuchern, in dem die rauen Blätter und dornigen Zweige sich in seiner nassen Kleidung verfingen – und dann durch ein Wäldchen aus unbelaubten, in der Salzluft verkümmerten Bäumen. Er zitterte, als der kalte Wind auffrischte, und versuchte den grobkörnigen Sand zu ignorieren, der in seine schlecht sitzenden Schuhe geraten war und ihm bei jedem Schritt die Haut aufschürfte. Da die Langley Air Force Base schätzungsweise zwanzig bis dreißig Meilen nördlich von ihm und die U.S. Naval Base ebenso weit südlich von ihm lag, rechnete er jetzt jeden Augenblick damit, das tiefe wupp-wupp-wupp eines Militärhubschraubers zu hören. Der Highway 64 war von hier aus keine halbe Meile entfernt. Ambler durfte keine Zeit verlieren. Je länger er hier draußen allein unterwegs war, desto größer war die Gefahr, dass er entdeckt wurde.
Er steigerte sein Tempo, bis er Verkehrslärm zu hören begann. Auf dem breiten Bankett klopfte er sich Sand und Blätter ab, reckte einen Daumen hoch und lächelte. Er war durchnässt und schmutzig und trug eine merkwürdige Uniform. Sein Lächeln würde verdammt beruhigend wirken müssen.
Eine Minute später hielt ein Lastwagen, der das Firmenzeichen von Frito-Lay trug, neben ihm. Der Fahrer, ein mopsgesichtiger Mann mit gewaltigem Wanst und einer gefälschten Ray-Ban-Sonnenbrille, winkte ihn herein. Ambler hatte seine Mitfahrgelegenheit gefunden.
Ihm fiel der Anfang eines alten Kirchenlieds ein: Großer Gott, wir loben dich ...
Ein Lastwagen, ein Auto, ein Bus: Mit zweimal Umsteigen erreichte er einen der entferntesten Vororte der Hauptstadt. In einer Einkaufspassage fand er ein Sportgeschäft, in dem er hastig ein paar unauffällige Sachen aus den Gitterboxen mit Massenware kaufte. Er zahlte mit dem Geld, das er in der Brusttasche der Uniformbluse gefunden hatte, und zog sich im Schutz der Buchsbaumhecke hinter dem Laden um. Er hatte nicht mal Zeit, sich in einem Spiegel zu begutachten, aber er wusste, dass seine neuen Klamotten – Kakihose, Flanellhemd, Windjacke mit Reißverschluss, Baseballmütze – weitgehend der stereotypen Freizeitkleidung des amerikanischen Mannes entsprachen.
An der Bushaltestelle musste er fünf Minuten warten: Rip van Winkle kehrte heim.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Ambler Warningbei St. Martin’s Press, New York
Copyright © 2005 by Myn Pyn LLC
Copyright © 2007 der deutschen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München in der Verlagsgruppe Random House GmbH First published in the United States as The Ambler Warningwritten by Robert Ludlum © The Estate of Robert Ludlum, 2005. Published by arrangement with The Estate of Robert Ludlum c/o BAROR INTERNATIONAL, INC. Redaktion: Ulrich Mihr Gesetzt aus der 11,95/14,65 Punkt Adobe Garamond Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
eISBN 978-3-641-09382-2
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe