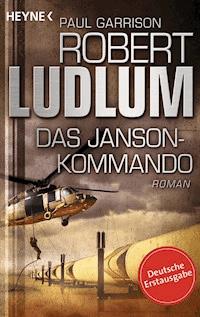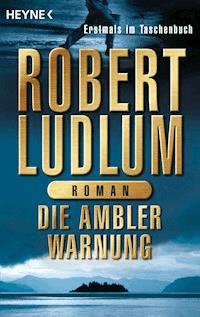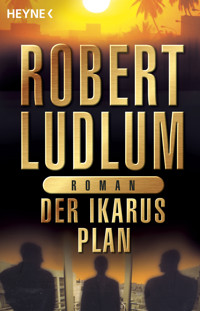9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JANSON-Serie
- Sprache: Deutsch
Ein Milliardär und internationaler Friedensaktivist wird von Topterroristen entführt. Paul Janson, ein geläuterter Auftragskiller, soll ihn befreien und eine Verschwörung aufdecken, die den Weltfrieden gefährden könnte. Robert Ludlum erscheint in zweiunddreißig Sprachen in über fünfzig Ländern. Auch sein neuester Thriller bietet atemberaubende Spannung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1146
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch:
Novak, Nobelpreisträger und Milliardär, der sich mit seiner Liberty Foundation die Förderung der Demokratie auf der ganzen Welt zum Ziel gesetzt hat, ist von Rebellen entführt worden. Ein beinahe mystischer Terrorist, genannt »der Kalif«, hält ihn in einer uneinnehmbaren Festung gefangen und droht, Novak auf brutale Weise hinzurichten. Novaks Leute wenden sich in ihrer Verzweiflung an den einzigen Mann, der auch in aussichtslosen Situationen Erfolg verspricht: Paul Janson – ehemaliger Agent und Auftragskiller für den berüchtigten US-Geheimdienst Consular Operations. Janson hat mit seinem alten Leben abgeschlossen und lebt zurückgezogen. Aber Novak hat ihm einst das Leben gerettet, und so erklärt er sich zu einer spektakulären Rettungsaktion bereit.
Der Autor:
Robert Ludlums Romane wurden in über dreißig Sprachen übersetzt und er gilt als »größter Thrillerautor aller Zeiten« (The New Yorker). Im Heyne Verlag erschien zuletzt „Der Tristan-Betrug“. Robert Ludlum verstarb im März 2001 in seiner Heimatstadt Maples, Florida. Die Romane aus seinem Nachlass erscheinen bei Heyne.
Inhaltsverzeichnis
Für ihn ist es ein Leichtes, Geschenke zu geben.Selbst wenn er ewig lebte, könnte er doch niealles vergeuden, was er besitzt,hält er doch den Nibelungenhort in seiner Macht.
Nibelungenlied, ca. 1200 n. Chr.
Prolog
8° 37 ’ Nord, 88° 22’ OstNördlicher Indischer Ozean,250 Meilen östlich von Sri LankaNordwestliches Anura
Schwül und drückend lag die warme Nachtluft fast unbeweglich auf dem Land. Am Abend hatte es ein wenig geregnet und war abgekühlt, aber jetzt hatte man das Gefühl, alles würde Hitze ausstrahlen, selbst die silberne Sichel des Halbmondes, über dessen Antlitz gelegentlich Wolkenfetzen huschten. Der Dschungel selbst schien zu atmen – den heißen, feuchten Atem eines lauernden Raubtiers.
Shyam verlagerte unruhig sein Gewicht auf dem Klappstuhl. Für diese Jahreszeit war das auf der Insel Anura eine ganz normale Nacht, das wusste er; die Monsunzeit hatte vor kurzem begonnen, und in der heißen Luft lag etwas Drohendes. Doch nur die unermüdlichen Moskitos störten die Ruhe. Es war halb zwei Uhr morgens, und Shyam schätzte, dass er jetzt seit viereinhalb Stunden Wache hielt. In der ganzen Zeit waren gerade mal sieben Autos durchgekommen. Der Checkpoint bestand aus zwei parallelen Reihen Stacheldraht – »Messerbänken« –, die im Abstand von fünfundzwanzig Metern auf der Straße angebracht waren. Shyam und Arjun waren auf vorgeschobenem Posten als Wachen eingeteilt und saßen vor der Bretterhütte, die ihnen als Schilderhaus diente. Auf der anderen Seite des Hügels sollten zwei weitere Männer als Reserve postiert sein, aber Shyam hatte seit Stunden nicht mehr von ihnen gehört, und das deutete darauf hin, dass sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach zusammen mit den anderen Männern in der provisorischen Kaserne ein paar hundert Meter weiter hinten an der Straße aufs Ohr gelegt hatten. Trotz all der düsteren Warnungen ihrer Vorgesetzten waren dies Tage und Nächte gnadenloser Langeweile gewesen. Selbst in guten Zeiten war die Nordwestprovinz Kenna nur spärlich besiedelt, und dies war alles andere als eine gute Zeit.
Jetzt trug die Brise das Geräusch eines hochdrehenden Motors heran, fern und undeutlich wie das Summen eines Insekts.
Shyam stand langsam auf. Das Geräusch kam näher.
»Arjun«, rief er in einem halblauten Singsang. »Ar-jun. Ein Auto kommt.«
Arjun ließ den Kopf kreisen – seine Nackenmuskeln hatten sich verspannt. »Um diese Zeit?« Er rieb sich die Augen. Bei der herrschenden Luftfeuchtigkeit klebte der Schweiß wie Öl an seiner Haut.
Jetzt konnte Shyam in dem spärlich mit Bäumen bewachsenen Terrain endlich die Scheinwerfer sehen. Lautes, vergnügtes Gelächter übertönte das Motorengeräusch.
»Dreckige Bauernlümmel«, brummte Arjun.
Shyam war in dieser tödlichen Langeweile für jede Abwechslung dankbar. Er hatte die letzten sieben Tage an dem Fahrzeug-Checkpoint von Kandar Dienst geschoben und empfand diesen Wachdienst als recht anstrengend. Ihr Vorgesetzter mit seinem steinernen Gesicht hatte sich natürlich alle Mühe gegeben, um ihnen klar zu machen, wie wichtig, wie bedeutend, wie in jeder Hinsicht lebenswichtig ihr Einsatz war. Der Checkpoint Kandar war nur ein kurzes Stück vom Steinpalast entfernt, in dem die Regierung eine streng geheime Sitzung abhielt. Die Sicherheitsmaßnahmen waren deshalb äußerst streng, und dies war die einzige richtige Verbindungsstraße zwischen dem Palast und der von Rebellen gehaltenen Region im Norden der Insel. Die Guerillas der Kagama Liberation Front wussten allerdings über den Checkpoint Bescheid und ließen sich dort nicht blicken. So wie die meisten anderen auch: Mehr als die Hälfte der Dorfbewohner im Norden war aus der Provinz geflohen, sei es nun vor den Rebellen oder vor den Einsätzen gegen die Rebellen. Und die Bauern, die in Kenna geblieben waren, hatten nur wenig Geld, und das bedeutete, dass die Wachen keine große Aussicht auf »Trinkgelder« hatten. Es tat sich überhaupt nichts, und die Ebbe in seiner Geldbörse hielt an. Ob das vielleicht daran lag, dass er in einem früheren Leben etwas Unrechtes getan hatte?
Jetzt war der Pick-up zu sehen; zwei junge Männer, beide ohne Hemd, saßen in der Kabine. Das Dach war heruntergeklappt. Einer der jungen Männer stand auf, schüttete sich eine Dose schäumendes Bier über die Brust und krakeelte. Der Pick-up – wahrscheinlich mit kurakkan, den Rüben eines armen Bauern beladen – polterte mit über achtzig Sachen um die Kurve, so schnell es der ächzende Motor eben erlaubte. Amerikanische Rockmusik von einem der starken Mittelwellensender der Insel plärrte aus dem Radio.
Das Krakeelen der jungen Männer hallte durch die Nacht. Es klang wie ein Rudel betrunkener Hyänen, dachte Shyam. Keinen Penny in der Tasche, diese jungen Leute, chancenlos und gleichgültig. Morgen früh würde das anders aussehen. Als so etwas das letzte Mal passiert war – das lag jetzt ein paar Jahre zurück –, hatte der Vater der jungen Leute dem Besitzer des Pick-ups mit schamerfülltem Gesicht einen Besuch abgestattet. Er hatte den Laster zurückgebracht und dazu viele, viele Säcke voll kurakkan, um den angerichteten Schaden gutzumachen. Und was die jungen Leute anging, na ja, die konnten ein paar Tage nicht sitzen, ohne das Gesicht zu verziehen, nicht einmal auf einem gepolsterten Autositz.
Jetzt trat Shyam mit seinem Karabiner auf die Straße hinaus. Der Laster raste weiter, und Shyam wich einen Schritt zurück. Hatte ja keinen Sinn, hier etwas zu riskieren. Die jungen Leute waren total betrunken. Eine Bierdose flog durch die Luft und plumpste mit einem dumpfen Knall auf die Straße. So wie das klang, war sie voll.
Der Laster fegte um die erste Messerbank herum, dann die zweite, raste weiter.
»Möge Shiva ihnen alle Gliedmaßen ausreißen«, sagte Arjun. Er kratzte sich mit seinen Stummelfingern im buschigen schwarzen Haar. »Ich denke, wir können es uns schenken, die nächste Station anzufunken. Man hört diese Jungs ja meilenweit.«
»Was sollen wir denn machen?«, fragte Shyam. Sie waren schließlich keine Verkehrspolizisten und nicht befugt, auf ein Fahrzeug, das einfach nicht anhalten wollte, das Feuer zu eröffnen.
»Bauernjungen. Nichts anderes als Bauernjungen.«
»Hey«, wandte Shyam ein. »Ich bin selbst ein Bauernjunge.« Er tippte an die Stoffplakette über der Brusttasche seines Khakihemds: ARA stand darauf, Army of the Republic of Anura. »Schließlich hat man mir das nicht auf die Haut tätowiert, oder? Wenn meine zwei Jahre um sind, gehe ich wieder auf meinen Hof.«
»Das sagst du jetzt. Ich habe einen Onkel, der auf der Universität studiert hat; er ist jetzt seit zehn Jahren Beamter. Und verdient die Hälfte von dem, was wir kriegen.«
»Und du bist jede Ruvie davon wert«, meinte Shyam mit unüberhörbarem Sarkasmus.
»Ich sage ja bloß, dass man jede Chance ergreifen soll, die das Leben einem gibt.« Arjun deutete mit dem Daumen auf die Bierdose auf der Straße. »Das hat so geklungen, als ob da noch Bier drin wäre. Was meinst du? Pukka Erfrischung, mein Freund.«
»Arjun«, protestierte Shyam. »Wir haben doch gemeinsam Dienst, das weißt du doch! Alle beide, ja?«
»Keine Sorge, mein Freund.« Arjun grinste. »Ich geb dir schon was ab.«
Als der Laster die Straßensperre einen knappen Kilometer hinter sich gelassen hatte, nahm der Fahrer den Fuß ein wenig vom Gaspedal, und der junge Mann auf dem Beifahrersitz setzte sich und wischte sich mit einem Tuch den Schweiß vom Gesicht, ehe er in ein schwarzes T-Shirt schlüpfte und sich anschnallte. Das Bier schmeckte so scheußlich, wie es roch, und war in der herrschenden Schwüle klebrig. Die beiden Guerilleros sahen einander mit ernster Miene an.
Ein älterer Mann saß hinter ihnen auf der schmalen Bank. Das schwarze, lockige Haar klebte ihm schweißnass an der Stirn, und sein Schnurrbart glänzte im Mondlicht. Der KLF-Offizier hatte flach auf der Bank gelegen, unsichtbar, als der Laster durch den Checkpoint gerast war. Jetzt schnippte er den Sprechknopf an seinem Walkie-Talkie, einem alten, aber verlässlichen Modell, und knurrte ein paar Anweisungen.
Mit metallischem Ächzen öffnete sich die Hintertür des Anhängers einen Spalt, damit die bewaffneten Männer drinnen ein wenig Luft bekamen.
Der Hügel an der Küste hatte viele Namen, die alles Mögliche bedeuteten. Die Hindus nannten ihn Sivanolipatha Malai, Shivas Fußabdruck, was auf seinen wahren Ursprung hindeutete. Für die Buddhisten war er Sri Pada, Buddhas Fußabdruck, weil sie glaubten, dass Buddha ihn mit dem linken Fuß gemacht habe, als er die Insel besucht hatte. Die Muslime kannten ihn unter dem Namen Adam Malai oder Adamshügel; die arabischen Händler im 10. Jahrhundert glaubten, dass Adam nach seiner Vertreibung aus dem Paradies hier Halt gemacht habe und auf einem Fuß stehen geblieben sei, bis Gott seine Reue zur Kenntnis genommen hatte. Die Kolonialherren – zuerst die Portugiesen und später die Holländer – betrachteten den Hügel eher unter praktischen als unter spirituellen Erwägungen: Das kleine Vorgebirge war der ideale Standort für eine Festung, für Artilleriebastionen, um sich gegen feindliche Kriegsschiffe wehren zu können. Im 17. Jahrhundert wurde zum ersten Mal eine Festung auf dem Hügel errichtet, und als die Anlage dann im Laufe der darauf folgenden Jahrhunderte mehrfach umgebaut worden war, hatte man den kleinen Gotteshäusern in der Nähe nur wenig Beachtung geschenkt. Jetzt würden sie der Armee des Propheten beim entscheidenden letzten Angriff als Zwischenstation dienen.
Normalerweise durfte ihr Anführer, der Mann, den sie den Kalifen nannten, unter keinen Umständen den Unwägbarkeiten und dem Chaos einer bewaffneten Auseinandersetzung ausgesetzt sein. Aber dies war keine gewöhnliche Nacht. Dies war eine Nacht, in der Geschichte geschrieben wurde. Wie konnte da der Kalif nicht zugegen sein? Außerdem wusste er, dass er die Moral seiner Männer mit seiner Entscheidung, sich auf dem Schlachtfeld zu ihnen zu gesellen, ins Unermessliche gesteigert hatte. Er war von tapferen, unerschrockenen Kagama umgeben, die wollten, dass er Zeuge ihres Heldentums wurde oder, sollte es dazu kommen, auch ihres Märtyrertodes. Sie sahen sein kantiges Gesicht, seine fein gemeißelten ebenholzschwarzen Züge und sein kräftiges Kinn und sahen nicht nur den Mann, den der Prophet gesandt hatte, um sie in die Freiheit zu führen, sondern auch den Mann, der ihre Taten für die Nachwelt in das Buch des Lebens schreiben würde.
Und so hielt der Kalif mit seiner Leibwache auf einer sorgfältig ausgewählten Hügelkuppe Wacht. Der Boden unter seinen dünnsohligen Stiefeln war hart und feucht, aber der Steinpalast – oder genauer gesagt sein Haupteingang – leuchtete vor ihm. Die Ostmauer war eine gewaltige Kalksteinfläche, deren verwitterte Steinquader zusammen mit dem breiten, frisch getünchten Tor von im Boden vergrabenen Strahlern in helles Licht getaucht wurden. Der Palast schimmerte verlockend, winkte ihnen zu.
»Ihr oder eure Gefolgsleute werdet möglicherweise heute Nacht sterben«, hatte der Kalif den Angehörigen seines Kommandos vor Stunden erklärt. »Falls es dazu kommt, wird man sich an euren Märtyrertod erinnern – in alle Ewigkeit! Eure Kinder und eure Eltern wird man euretwegen wie Heilige verehren. Man wird euch Schreine errichten! Pilger werden an die Orte eurer Geburt reisen! Man wird sich an euch erinnern wie an die Väter unserer Nation, wird euch verehren – von jetzt an bis in alle Ewigkeit.«
Sie waren Männer des Glaubens und des Mutes, und dem Westen gefiel es, sie als Terroristen zu verabscheuen. Terroristen! Für den Westen, die Quelle äußersten Schreckens auf der Welt, ein Begriff zynischer Bequemlichkeit. Der Kalif verachtete die Tyrannen von Anura, aber den Männern des Westens, die ihre Herrschaft erst ermöglicht hatten, galt sein unverfälschter, glühender Hass. Die Anuraner verstanden wenigstens, dass sie einen Preis dafür zahlen mussten, dass sie sich die Macht angemaßt hatten; die Rebellen hatten sie diese Lektion immer wieder gelehrt, hatten sie mit Blut geschrieben. Aber die Westler waren es gewöhnt, ungestraft zu handeln. Doch das würde sich bald ändern.
Jetzt musterte der Kalif die Hügellandschaft, die ihn umgab, und verspürte Hoffnung – Hoffnung nicht nur für sich und seine Gefolgsleute, sondern auch für die Insel. Anura. Sobald sie erst einmal ihr Schicksal wieder in die eigene Hand genommen hatte, gab es da noch etwas, wozu diese Insel und die Menschen, die auf ihr lebten, nicht fähig sein würden? Die Felsbrocken rings um ihn, die Bäume und die mit dichten Lianen überzogenen Hügel schienen ihn zum Handeln zu drängen.
Mutter Anura würde ihren Beschützern Nachsicht gewähren.
Vor Jahrhunderten hatten Besucher mit poetischen Worten die Schönheit der Tier- und Pflanzenwelt der Insel gepriesen. Wenig später sollte der Kolonialismus, angetrieben von Neid und Habgier, seine düstere Logik zur Wirkung bringen: Alles was bezaubernd war, sollte entzaubert, Schönheit, die den Beschauer in ihren Bann zog, in Ketten gelegt werden. Anura wurde zu einem Preis, um den die großen Seemächte des Westens sich stritten. Befestigungsanlagen türmten sich über den duftenden Hainen; Kanonenkugeln lagerten zwischen Muschelschalen an den Stränden. Der Westen brachte Blutvergießen auf die Insel und schlug dort Wurzeln, verbreitete sich wie ein giftiges Unkraut über die Landschaft, nährte sich von Ungerechtigkeit und Gemeinheit.
Was haben sie dir angetan, Mutter Anura?
Bei Tee und Gebäck zogen westliche Diplomaten Grenzlinien, die Unruhe in das Leben von Millionen bringen sollten, behandelten den Atlas der Welt wie ein Zeichenblatt.
Unabhängigkeit hatten sie es genannt! Das war eine der großen Lügen des 20. Jahrhunderts. Das Regime selbst kam einem Akt der Gewalt gegen das Volk von Kagama gleich, einem Gewaltakt, dem man nur mit noch mehr Gewalt begegnen konnte. Jedes Mal, wenn ein Selbstmordattentäter einen Minister der Hindu-Regierung erledigte, predigten die westlichen Medien von »sinnlosen Morden«, aber der Kalif und seine Soldaten wussten, dass nichts mehr Sinn machte als solche Taten. Der Kalif selbst hatte den Plan für die Welle von Bombenattentaten ausgearbeitet, über die die ganze Welt berichtete – Attentate, die offenkundig zivilen Zielen in der Hauptstadt Caligo galten. Die Lieferfahrzeuge, die dafür eingesetzt wurden, hatte man praktisch unsichtbar gemacht, indem man ihnen das Firmenzeichen eines allgegenwärtigen internationalen Frachtdiensts aufgemalt hatte. Was für ein einfaches Täuschungsmanöver! Voll gepackt mit Stickstoff-Kunstdünger, den die Rebellen mit Dieseltreibstoff getränkt hatten, lieferten die Fahrzeuge eine Ladung des Todes. Im zurückliegenden Jahrzehnt hatte diese Welle von Bombenanschlägen auf der ganzen Welt Abscheu und Verdammnis ausgelöst – eine seltsame Heuchelei, wo sie doch nur den Krieg ins Haus der Kriegshetzer trug.
Jetzt flüsterte der Funker dem Kalifen etwas ins Ohr. Der Stützpunkt Kaffra war zerstört worden, seine Fernmeldeinfrastruktur außer Gefecht gesetzt. Selbst wenn es den Wachen im Steinpalast gelang, eine Nachricht abzusetzen, bestand jetzt nicht mehr die leiseste Hoffnung, dass jemand ihnen zu Hilfe kam. Dreißig Sekunden später hatte der Funker eine weitere Mitteilung zu überbringen: die Bestätigung, dass ein zweiter Militärstützpunkt in ihre Hände gefallen war. Damit stand ihnen jetzt eine zweite Hauptstraße zur Verfügung. Der Kalif verspürte ein Prickeln im Nacken. Noch wenige Stunden, und sie würden die ganze Provinz Kenna dem despotischen Griff der Tyrannen entrissen haben. Der Machtwechsel könnte beginnen. Das Licht der Nationalen Befreiung würde am Morgen mit der Sonne am Horizont aufleuchten.
Aber nichts war wichtiger als die Einnahme des Steenpaleis, des Steinpalastes. Nichts! Der Vermittler hatte das mit großem Nachdruck betont, und bis jetzt hatte der Vermittler immer Recht gehabt, angefangen mit dem Wert seines eigenen Beitrags. Auf ihn war Verlass gewesen – nein, noch mehr. Er war großzügig gewesen, geradezu überschwänglich mit seinen Waffenlieferungen und, von gleicher Wichtigkeit, seinen Informationen. Er hatte den Kalifen nicht enttäuscht, und der Kalif würde ihn nicht enttäuschen. Die Gegner des Kalifen verfügten über ihre eigenen Hilfskräfte, ihre Hintermänner und ihre Wohltäter; weshalb sollte er nicht auch die seinen haben!
»Es ist noch kalt!«, rief Arjun entzückt aus, als er die Bierdose von der Straße aufhob. Die Dose war außen vereist. Arjun drückte sie sich an die Wange und stöhnte vergnügt. Seine Finger hinterließen ovale Abdrücke auf der eisigen Schicht, die verlockend im gelben Quecksilberdampflicht des Stützpunkts blitzte.
»Sie ist wirklich voll?«, fragte Shyam zweifelnd.
»Noch nicht geöffnet«, sagte Arjun. »Voll mit gesundem Getränk!« Und die Dose war schwer, ungewöhnlich schwer. »Wir werden unseren Ahnen einen Schluck opfern. Ein paar lange Schlucke für mich und die paar Tropfen, die dann noch übrig bleiben, für dich, weil ich ja weiß, dass du das Zeug nicht magst.« Arjuns dicke Finger fanden den Ring, mit dem man den Deckel abziehen konnte, und zogen kräftig daran.
Der gedämpfte Knall des Zünders, vergleichbar einem Knallkörper, der Konfetti versprüht, war Bruchteile von Sekunden vor der eigentlichen Explosion zu hören. Die Zeit reichte Arjun fast aus, um ihn erkennen zu lassen, dass er einem Trick zum Opfer gefallen war, und genügte Shyam, um den Gedanken zu registrieren, dass sein Verdacht – obwohl dieser eigentlich im Unterbewusstsein geblieben war und sich nur als vages Unbehagen geäußert hatte – gerechtfertigt gewesen war. Als das Pfund Plastiksprengstoff explodierte, fanden die Gedankengänge beider Männer ein Ende.
Die Explosion, ein alles zerschmetternder Augenblick des Lichts und des Schalls, dehnte sich sofort in ein immenses feuriges Oval der Zerstörung aus. Die Schockwellen zerschmetterten die beiden Messerbänke und das Bretterhäuschen ebenso wie die Baracke und die Männer, die dort schliefen. Die beiden Wachen, die am anderen Ende der Straßensperre hätten Dienst tun sollen, starben, ehe sie ganz wach geworden waren. Die intensive kurzzeitige Hitze überkrustete ein Stück des roten Lateritbodens mit einer an Obsidian erinnernden Glasschicht. Und dann war die Explosion – der betäubende Lärm, das blendende Licht – ebenso schnell verhallt, wie sie sich eingestellt hatte – verschwunden wie die Faust eines Mannes, wenn er seine Hand öffnet. Die Gewalt der Zerstörung war flüchtig, die Zerstörung selbst nachhaltig.
Eine Viertelstunde später, als ein Konvoi von Truppentransportern mit Segeltuchplanen durch die Überreste des Checkpoints rollte, war jegliches Täuschungsmanöver überflüssig geworden.
In der Tatsache, dass nur seine Gegner die Genialität dieser Aktion vor Anbruch der Morgendämmerung in ihrem vollen Ausmaß begreifen würden, lag Ironie, das war dem Kalifen bewusst. Die Nebel des Krieges würden auf dem Boden verhüllen, was man aus der Ferne erkennen konnte: das Muster präzise koordinierter Angriffe. Der Kalif wusste, dass militärische Analytiker in den amerikanischen Spionagediensten in ein oder zwei Tagen auf Satellitenbilder starren würden, auf denen man das Schema seiner Aktivitäten so klar wie ein Diagramm in einem Lehrbuch erkennen konnte. Der Sieg des Kalifen würde zur Legende werden; welchen Anteil der Vermittler daran hatte, würden – nicht zuletzt auf Drängen des Vermittlers selbst – nur Allah und er selbst wissen.
Man brachte dem Kalifen einen Feldstecher, und er betrachtete damit die Ehrengarde, die vor dem Haupttor aufgereiht war.
Es waren menschliche Dekorationen, ein Leporello aus Papierpuppen. Ein weiterer Beweis für die elitäre Dummheit der Regierung. Die Palastbeleuchtung machte sie zu Schießbudenfiguren und behinderte sie zu allem Überfluss auch noch dabei, in der sie umgebenden Dunkelheit etwas zu sehen.
Die Ehrengarde stellte die Elite der ARA dar – typischerweise alles Männer mit Verwandten auf wichtigen Positionen, Karrieretypen mit guten Manieren, exzellenter Hygiene und der Fähigkeit, die Bügelfalten in ihren sauber geplätteten Uniformen zu schonen. Die Crème de la Crème brûlée, sinnierte der Kalif in einer Mischung aus Ironie und Verachtung. Schauspieler waren das, keine Krieger. Durch sein Glas musterte er die sieben Offiziere, von denen jeder einen Karabiner über die Schulter gelegt hatte, wo er eindrucksvoll aussah und völlig nutzlos war. Nicht einmal Schauspieler. Spielzeugsoldaten.
Der Funker nickte dem Kalifen zu: Der Abschnittskommandant hatte seine Position eingenommen und dafür gesorgt, dass die kasernierten Soldaten nicht zum Einsatz kommen konnten. Ein Angehöriger seines Gefolges reichte dem Kalifen einen Karabiner: eine rein zeremonielle Handlung, die er selbst entworfen hatte, aber Zeremoniell war der Helfer der Macht. Und deshalb würde der Kalif den ersten Schuss abfeuern, aus demselben Karabiner, mit dem ein großer Freiheitskämpfer vor fünfzig Jahren den holländischen Generalgouverneur ermordet hatte. Der Karabiner, eine Mauser M24, war mit großer Sorgfalt überholt und perfekt eingeschossen worden. Er war lange Zeit in seidenen Tüchern verwahrt gewesen und glänzte jetzt wie das Schwert Saladins.
Der Kalif fand den Wachmann Nummer eins im Zielfernrohr des Karabiners und atmete halb aus, sodass das Fadenkreuz auf der mit einer Ordensspange geschmückten Brust des Mannes ruhte. Er betätigte den Abzug und beobachtete den Ausdruck des Mannes scharf – Verblüffung zuerst, dann Angst und schließlich Benommenheit. Auf der rechten Brusthälfte des Mannes war jetzt ein kleines rotes Oval zu sehen, wie eine Blume, die man im Knopfloch trägt.
Sofort schlossen sich die anderen Männer seiner Gruppe an und feuerten eine kurze Salve wohl gezielter Schüsse ab. Die sieben Offiziere brachen zusammen wie Marionetten, deren Drähte man durchschnitten hat, und gingen zu Boden.
Der Kalif musste unwillkürlich lachen. Ihr Tod hatte keine Würde; er war so absurd wie die Tyrannis, der sie dienten. Eine Tyrannis, die jetzt in die Defensive gezwungen wurde.
Bis die Sonne aufging, würden alle noch in Amt und Würden befindlichen Vertreter der anuranischen Regierung, die in der Provinz geblieben waren, gut beraten sein, ihre Uniformen abzulegen – sonst mussten sie damit rechnen, dass der feindliche Mob sie in Stücke riss.
Kenna würde nicht länger Teil der illegitimen Republik Anura sein. Kenna würde ihm gehören.
Es hatte ange fangen.
Der Kalif spürte eine Woge von Selbstgefälligkeit in sich aufsteigen, und die klare, alles durchdringende Wahrheit erfüllte ihn wie ein Licht. Die einzige Lösung für Gewalt war noch mehr Gewalt.
In den nächsten paar Minuten würden viele sterben, und dass sie starben, würde ein Glück für sie sein. Aber es gab eine Person im Steinpalast, die nicht getötet werden durfte – noch nicht. Er war ein ganz besonderer Mann, ein Mann, der auf die Insel gekommen war, um den Versuch zu machen, Frieden auszuhandeln. Er war ein mächtiger Mann, ein Mann, den Millionen verehrten, aber nichtsdestoweniger ein Agent des Neokolonialismus. Man musste ihn mit Vorsicht behandeln. Dieser eine – der große Mann, der »Friedensstifter«, der Mann für alle Menschen, wie es die westlichen Medien immer wieder hinausposaunten – würde nicht bei militärischen Kampfhandlungen ums Leben kommen. Ihn würde man nicht erschießen.
Für ihn würde das korrekte Protokoll eingehalten werden.
Und dann würde man ihn enthaupten, wie es sich für einen Verbrecher geziemte.
Die Revolution würde sein Blut trinken!
Teil 1
1
Die Konzernzentrale der Harnett Corporation breitete sich auf den beiden obersten Stockwerken eines schwarzen Glasturms an der Dearborn Street im Loop von Chicago aus. Harnett war ein internationales Bauunternehmen, freilich keines von der Art, das Wolkenkratzer in amerikanischen Metropolen baute. Die meisten Projekte, mit denen sich das Unternehmen befasste, waren in Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten angesiedelt, wo die Firma mit großen Gesellschaften wie Bechtel, Vivendi und Suez Lyonnaise des Eaux zusammenarbeitete. Die Gesellschaft organisierte den Bau von Staudämmen, Abwasseranlagen und Gasturbinen-Kraftwerken – alles nicht gerade glanzvolle, aber notwendige Infrastruktur. Projekte dieser Art stellten Herausforderungen im Ingenieurbau und nicht so sehr in der Ästhetik dar, setzten dafür aber die Fähigkeit voraus, in dem in stetigem Fluss befindlichen Bereich zwischen dem Behördengeschäft und der Privatwirtschaft zu operieren. Länder der Dritten Welt, die unter dem ständigen Druck der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds standen, im Staatsbesitz befindliche Unternehmen zu verkaufen, waren fortwährend auf der Suche nach Anbietern für Telefonsysteme, Wasserwerke, Kraftwerke, Eisenbahnen und Bergwerksanlagen. Der Eigentümerwechsel brachte häufig die Notwendigkeit für neue Bautätigkeit mit sich, ein Bereich, in dem hoch spezialisierte Firmen wie die Harnett Corporation inzwischen eine bedeutende Rolle spielten.
»Ich bin mit Ross Harnett verabredet«, erklärte der Mann dem Angestellten am Empfang. »Ich heiße Paul Janson.«
Der Angestellte, ein junger, sommersprossiger Mann mit rotem Haar, nickte und informierte das Büro des Vorstandsvorsitzenden. Er musterte den Besucher ohne sonderliches Interesse. Wieder einmal ein Weißer in mittleren Jahren in einem grauen Anzug und mit einer gelben Krawatte. Was gab es da schon zu sehen?
Janson hielt sich einiges darauf zugute, dass man ihn selten eines zweiten Blickes würdigte. Trotz seines athletischen Körperbaus war an ihm nichts Auffälliges. Mit seiner gefurchten Stirn und dem kurz gestutzten stahlgrauen Haar konnte er seine fünfzig Jahre nicht verleugnen. Und er verstand es, sich praktisch unsichtbar zu machen, sei es nun an der Wall Street oder an der Börse. Selbst sein teurer Maßanzug aus grauem Worsted bildete eine perfekte Tarnung und passte ebenso gut in den Dschungel der Finanzwelt wie einstmals die grüne und schwarze Tarnfarbe, die er sich früher einmal in Vietnam, im echten Dschungel, ins Gesicht geschmiert hatte. Es brauchte schon ein geschultes Auge, um zu erkennen, dass echte Muskeln und nicht etwa Wattepolster die Schulterpartie seines Anzugs ausfüllten. Und man musste einige Zeit mit ihm verbracht haben, um seine ruhige, etwas ironische Art wahrzunehmen oder um zu bemerken, wie seine schiefergrauen Augen jede Einzelheit in seiner Umgebung registrierten.
»Es dauert nur ein paar Minuten«, erklärte der Angestellte am Empfangspult gleichgültig, und Janson schlenderte durch die Eingangshalle, um die dort ausgestellte Fotogalerie zu betrachten. Man konnte dort sehen, dass die Harnett Corporation augenblicklich am Bau einer Wasseraufbereitungsanlage in Bolivien, an der Fertigstellung von Staudämmen in Venezuela, Brücken in Saskatchewan und Kraftwerken in Ägypten beteiligt war. Das dokumentierten Bilder einer erfolgreichen und wohlhabenden Baugesellschaft. Und wohlhabend war sie tatsächlich – oder war es zumindest bis vor kurzem gewesen.
Der für das Tagesgeschäft zuständige Vizepräsident Steven Burt war der Meinung, dass die Geschäfte eigentlich wesentlich besser laufen sollten. Im Zusammenhang mit dem Gewinnrückgang der letzten Zeit waren da Aspekte aufgetreten, die ihn argwöhnisch gemacht hatten, und er hatte deshalb Paul Janson dazu veranlasst, sich mit Ross Harnett, dem Vorstandsvorsitzenden und CEO der Firma, zu treffen. Janson hatte gewisse Vorbehalte, einen neuen Mandanten anzunehmen: Er war zwar erst seit fünf Jahren als Sicherheitsberater für größere Wirtschaftsunternehmen tätig, hatte sich aber von Anfang an den Ruf ungewöhnlicher Effizienz und Diskretion erworben, und das hatte die Nachfrage nach seinen Diensten weit über seine Zeit und sein Interesse hinaus ansteigen lassen. Wenn Steven Burt nicht ein alter Freund gewesen wäre, hätte Janson diesen Auftrag nicht in Erwägung gezogen. Aber Burt hatte ebenso wie er früher einmal ein anderes Leben geführt – eines, das er hinter sich gelassen hatte, als er in die zivile Welt eingetreten war –, und Janson wollte den Freund nicht enttäuschen. Zumindest wollte er sich mit ihm unterhalten.
Harnetts Direktionsassistentin, eine freundlich wirkende Frau um die dreißig, kam in die Empfangshalle und führte ihn in Harnetts Büro, einen modernen, beinahe spartanisch eingerichteten Raum mit vom Boden bis zur Decke reichenden Fenstern, die nach Süden und Osten blickten. Die Wand aus polarisierendem Glas reduzierte das Licht der hellen Nachmittagssonne auf ein kühles Leuchten. Harnett saß hinter seinem Schreibtisch und telefonierte, und die Frau blieb mit fragender Miene in der Tür stehen. Harnett bedeutete Janson mit einer fast herablassend wirkenden Handbewegung Platz zu nehmen. »Dann werden wir eben die Verträge mit Ingersoll-Rand neu verhandeln müssen«, sagte Harnett. Er trug ein hellblaues, monogrammbesticktes Hemd mit weißem Kragen, dessen Ärmel hochgekrempelt waren, sodass man seine kräftigen Arme sehen konnte. »Wenn sie die zugesagten Preise nicht halten wollen, müssen wir ihnen eben klar machen, dass wir uns dann frei fühlen, die Teile anderweitig zu beschaffen. Zum Teufel mit ihnen. Dann ist der Vertrag eben hinfällig.«
Janson nahm auf dem schwarzen Ledersessel vor dem Schreibtisch Platz. Er war etwas niedriger als Harnetts Sessel – primitive Regie, die Janson eher Unsicherheit als Autorität signalisierte. Er warf einen unverhohlenen Blick auf seine Uhr, schluckte die in ihm aufkommende Verstimmung hinunter und sah sich um. Das im siebenundzwanzigsten Stockwerk gelegene Eckbüro Harnetts bot einen weiten Blick auf den Michigan-See und die Innenstadt von Chicago. Ein hoher Stuhl, ein hohes Stockwerk: Harnett wollte keine Zweifel daran aufkommen lassen, dass er alle Höhen erklommen hatte.
Harnett war so etwas wie ein Kraftpaket, klein und kräftig gebaut, mit einer Reibeisenstimme. Janson hatte gehört, dass Harnett seinen Stolz darein setzte, regelmäßig die laufenden Bauprojekte seiner Firma zu besuchen und dabei mit den Vorarbeitern zu reden, als ob er selbst einmal einer gewesen wäre. In seinem ganzen Gehabe wirkte er jedenfalls wie jemand, der seine Karriere auf Baustellen begonnen und den Aufstieg in sein Eckbüro im siebenundzwanzigsten Stockwerk mit dem Schweiß seiner Hände geschafft hatte. Aber das entsprach nicht ganz den Tatsachen. Janson wusste, dass Harnett an der Northwestern University die Kellogg School of Management mit einem MBA absolviert hatte und dass seine Fähigkeiten eher in komplizierten Finanzkonstruktionen als im Baustellenbetrieb lagen. Die Harnett Corporation aufzubauen war ihm gelungen, weil er ihre Tochtergesellschaften zu einer Zeit aufgekauft hatte, als diese in finanziellen Schwierigkeiten steckten und daher billig zu haben gewesen waren. Da die Bauwirtschaft ständig von den Konjunkturzyklen abhängt, hatte Harnett begriffen, dass dies seine Chance war, mit gut platzierten Tauschoperationen zu Ausverkaufspreisen eine reichlich mit Bargeldreserven ausgestattete Gesellschaft ins Leben zu rufen.
Endlich legte Harnett den Hörer auf und musterte Janson ein paar Augenblicke lang stumm. »Stevie sagt, Sie hätten wirklich einen hervorragenden Ruf«, meinte er mit gelangweilter Stimme. »Könnte sein, dass ich ein paar Ihrer anderen Mandanten kenne. Für wen waren Sie denn tätig?«
Janson sah ihn lächelnd, beinahe spöttisch an. Sollte das hier etwa ein Vorstellungsgespräch werden? »Die meisten Mandanten, die ich akzeptiere«, sagte er und legte nach diesen Worten eine kurze Pause ein, »kommen auf Empfehlung anderer Mandanten zu mir.« Es deutlicher zu formulieren schien ihm unhöflich: Janson war nicht derjenige, der Referenzen oder Empfehlungen vorzulegen pflegte; es lief genau anders herum, seine prospektiven Mandanten mussten ihm empfohlen werden. »Unter gewissen Umständen erlaube ich meinen Mandanten, mit anderen über meine Arbeit zu sprechen. Für mich persönlich galt immer der Grundsatz völliger Diskretion.«
»Sie spielen den hölzernen Indianer, wie?« Harnett wirkte verstimmt.
»Ich bitte um Entschuldigung?«
»Ich auch, ich habe nämlich das bestimmte Gefühl, dass wir gegenseitig unsere Zeit vergeuden. Sie sind ein viel beschäftigter Mann, ich bin ein viel beschäftigter Mann, und wir haben beide nicht die Zeit, hier zu sitzen und uns gegenseitig den Nerv zu töten. Ich weiß, dass Stevie es sich in den Kopf gesetzt hat, dass wir ein Leck im Boot haben und dass Wasser eindringt. Das entspricht aber nicht den Tatsachen. Tatsächlich liegt das ständige Auf und Ab im Wesen unseres Geschäfts. Stevie ist einfach noch zu grün, um das zu begreifen. Ich habe diese Firma aufgebaut; ich weiß, was in jedem Außenbüro und auf jeder Baustelle in vierundzwanzig Ländern abläuft. Für mich stellt sich wirklich die Frage, ob wir überhaupt einen Sicherheitsberater brauchen. Und das Einzige, was ich über Sie gehört habe, ist, dass Sie nicht gerade billig sind. Ich halte sehr viel von Sparsamkeit im Geschäftsleben. Für mich ist das, was man Zero-based Budgeting nennt, so etwas wie die Heilige Schrift. Sie müssen versuchen, mir da zu folgen – jeder Cent, den wir ausgeben, muss irgendwie gerechtfertigt sein. Wenn die Ausgabe nichts zum Shareholder-Value beiträgt, findet sie einfach nicht statt. Das ist eines meiner Geschäftsgeheimnisse, das ich gern mit Ihnen teilen will.« Harnett lehnte sich zurück wie ein Pascha, der darauf wartet, dass ein Bediensteter ihm den Tee eingießt. »Aber Sie können ja gern versuchen, mich umzustimmen. Okay? Ich habe das Meinige gesagt. Jetzt höre ich Ihnen gern zu.«
Janson lächelte dünn. Er würde sich bei Steven Burt entschuldigen müssen – Janson bezweifelte, ob ihn jemals jemand, der ihm wohl gesonnen war, »Stevie« genannt hatte –, aber hier lief ganz offensichtlich einiges über Kreuz. Janson akzeptierte nur wenige von den Angeboten, die ihm zugingen, und diesen Auftrag hier brauchte er ganz gewiss nicht. Er würde zusehen, hier so schnell wie möglich wieder herauszukommen. »Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll, Mr. Harnett. Aus Ihrer Sicht klingt es so, als ob Sie alles unter Kontrolle hätten.«
Harnett nickte, ohne zu lächeln, als wäre ihm soeben eine Selbstverständlichkeit bestätigt worden. »Ich führe ein strenges Regiment, Mr. Janson«, sagte er mit selbstgefälliger Herablassung. »Unsere weltweiten Aktivitäten werden verdammt gut geschützt. Das war schon immer so, und wir hatten nie Probleme. Niemals eine undichte Stelle, nie jemand, der zur Konkurrenz übergewechselt wäre, ja nicht einmal Diebstahl in nennenswertem Umfang. Und ich glaube, ich bin wirklich derjenige, der das am besten beurteilen kann – können wir uns darüber einigen?«
»Ein Chef, der nicht weiß, was in seinem eigenen Unternehmen läuft, hat ja wirklich in dem Laden nichts verloren, oder?«, erwiderte Janson mit freundlicher Miene.
»Genau«, sagte Harnett. »Genau.« Sein Blick wanderte zu der Sprechanlage seiner Telefonkonsole. »Hören Sie, Sie sind bestens empfohlen – ich meine, Stevie war des Lobes voll, und ich bin überzeugt, dass Sie das, was Sie tun, wirklich gut machen. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie zu uns gekommen sind, und es tut mir wie gesagt wirklich Leid, dass wir Ihre Zeit vergeudet haben …«
Janson entging das »wir« nicht – und das, was das Wörtchen offenkundig implizierte: Tut mir wirklich Leid, dass ein Mitglied unseres Führungskreises uns beiden Ungelegenheiten bereitet hat. Ohne Zweifel würde Steven Burt in naher Zukunft mit dem Groll seines obersten Vorgesetzten rechnen müssen. Janson beschloss, sich doch ein paar Worte zum Abschied zu gestatten, und wäre es nur, um seinem Freund damit einen Gefallen zu tun.
»Keineswegs«, sagte er, stand auf und schüttelte Harnett über den Schreibtisch hinweg die Hand. »Es freut mich wirklich, dass alles in bester Ordnung ist.« Er legte den Kopf etwas zur Seite und fügte beinahe beiläufig hinzu: »Oh, hören Sie, was diese ›versiegelte Offerte‹ angeht, die Sie gerade für das Projekt in Uruguay abgegeben haben …«
»Was wissen Sie davon?« Harnetts Blick war plötzlich wachsam geworden. Hatte Janson hier einen Nerv getroffen?
»Dreiundneunzig Millionen, fünfhundertvierzigtausend, nicht wahr?«
Harnetts Gesicht rötete sich. »Augenblick mal. Ich habe diese Offerte erst gestern Morgen genehmigt. Wie zum Teufel haben Sie …«
»Wenn ich Sie wäre, würde ich mir Gedanken darüber machen, dass Ihre französische Konkurrenz, Suez Lyonnaise, die Zahlen ebenfalls kennt. Ich denke, Sie werden feststellen, dass deren Offerte genau zwei Prozent tiefer liegt.«
»Was?«, explodierte Harnett mit der Wucht eines Vulkans. »Hat Steven Burt Ihnen das gesagt?«
»Steven Burt hat mir keinerlei Informationen gegeben. Und im Übrigen ist er ja für die Baustellen verantwortlich, nicht etwa für die Buchhaltung oder die Angebotsabteilung – kennt er die Ausschreibung denn überhaupt im Detail?«
Harnetts Augen weiteten sich. »Nein«, erwiderte er nach kurzer Überlegung. »Er kann die Einzelheiten unmöglich kennen. Verdammt noch mal, darüber dürfte überhaupt niemand informiert sein. Unsere Erbsenzähler haben das Angebot per verschlüsselter E-Mail direkt an das Ministerium in Uruguay abgeschickt.«
»Und doch gibt es Leute, die darüber Bescheid wissen. Außerdem wäre dies ja in diesem Jahr nicht das erste Mal, dass man Sie knapp unterboten hat, oder? Konkret gesagt, sind Sie in den letzten neun Monaten fast ein Dutzend Mal durchgefallen. Elf von fünfzehn Ihrer Angebote wurden abgelehnt. Wie Sie ja sagten, das ist ein Geschäft, in dem es immer wieder ein Auf und Ab gibt.«
Auf Harnetts Wangen hatten sich hektische rote Flecken gebildet, aber Janson fuhr davon unbeeindruckt in kollegialem Tonfall fort: »Im Falle Vancouver galten andere Überlegungen. Die städtischen Ingenieure haben dort in dem für die Fundamente benutzten Beton Plastifizierungsstoffe gefunden. Das erleichtert zwar den Gussvorgang, schwächt aber die strukturelle Substanz. Natürlich nicht Ihre Schuld – die Bauspezifikation war in dem Punkt eindeutig. Wie konnten Sie auch wissen, dass Ihr Auftragnehmer Ihren Prüfungsingenieur vor Ort bestochen und dazu veranlasst hat, seinen Bericht zu fälschen? Da lässt sich ein untergeordneter Angestellter mit armseligen fünftausend Dollar schmieren und Sie stehen mit einem Hundert-Millionen-Dollar-Projekt plötzlich im Regen. Ziemlich komisch, was? Andererseits hatten Sie mit Ihren eigenen so genannten nützlichen Aufwendungen, die Sie unter dem Tisch bezahlt haben, wesentlich größeres Pech. Ich meine, wenn Sie sich fragen, was mit dem Projekt in La Paz schief gelaufen ist …«
»Ja?«, drängte Harnett erregt. Er stand auf und wirkte dabei unnatürlich steif, geradeso, als ob er eingefroren wäre.
»Nun, sagen wir einfach, Raffy ist wieder auf dem Kriegspfad. Ihr Manager hat Rafael Nuñez geglaubt, als der ihm gesagt hat, er habe sichergestellt, dass die Bestechungssumme den Innenminister erreicht hat. Raffy Nuñez hat in den neunziger Jahren eine Menge Firmen ausgenommen. Die meisten Ihrer Wettbewerber wissen inzwischen über ihn Bescheid. Sie haben sich krumm und schief gelacht, als sie Ihren Mann im La Paz Cabana beim Abendessen beobachten konnten, wie er mit Raffy einen Tequila nach dem anderen gekippt hat, weil sie ganz genau wussten, was passieren würde. Aber was soll’s – Sie haben es wenigstens versucht, stimmt’s? Was macht es da schon, dass Ihre Bruttoerlöse in diesem Jahr um dreißig Prozent gesunken sind. Ist ja schließlich nur Geld, oder? Das sagen Ihre Aktionäre doch immer, nicht wahr?«
Janson hatte bemerkt, dass Harnett inzwischen totenblass geworden war. »Oh ja, stimmt – die haben das gar nicht gesagt, wie?«, fuhr Janson fort. »Tatsächlich ist es so, dass eine Gruppe von Großaktionären dabei ist, sich nach einer anderen Gesellschaft umzusehen – Vivendi, Kendrick, vielleicht auch Bechtel –, und diese Firmen dazu veranlassen will, es mit einer feindlichen Übernahme zu versuchen. Sehen Sie es also ganz positiv. Wenn die damit durchkommen, wird das alles nicht mehr Ihr Problem sein.« Er tat so, als bemerke er nicht, wie Harnett gereizt Luft holte. »Aber ich bin sicher, dass ich Ihnen damit nichts sage, was Sie nicht bereits wissen.«
Harnett wirkte benommen, ja geradezu von panischer Angst erfasst; das von dem polarisierten Glas der riesigen Fenster gedämpfte Licht ließ kalte Schweißtropfen auf seiner Stirn erkennen. »Verdammte Scheiße«, murmelte er. Der Blick, mit dem er Janson jetzt musterte, erinnerte an den eines Ertrinkenden, der am Horizont ein Rettungsboot entdeckt hat. »Nennen Sie mir Ihren Preis«, sagte er.
»Wie bitte?«
»Ihren gottverdammten Preis sollen Sie mir nennen«, sagte Harnett. »Ich brauche Sie.« Er grinste, bemüht, seine Verzweiflung hinter einer Fassade von Jovialität zu tarnen. »Steven Burt hat gesagt, Sie seien der beste Mann, den es gibt, und damit hatte er ganz offensichtlich Recht. Wissen Sie, ich wollte Sie vorher bloß ein bisschen hochnehmen. Und jetzt hören Sie mir zu, Meister, Sie werden dieses Zimmer nicht verlassen, ehe wir beide, Sie und ich, zu einer Übereinkunft gelangt sind. Ist das klar?« Man konnte jetzt an seinem Hemdkragen und unter den Armen dunkle Schweißflecken erkennen. »Weil wir nämlich hier einen Deal machen werden.«
»Das glaube ich nicht«, sagte Janson unverändert freundlich. »Ich habe mich nämlich gerade entschieden, diesen Auftrag nicht anzunehmen. Das ist ein Luxus, den ich mir als selbständiger Berater leisten kann: Ich entscheide ganz alleine darüber, welche Mandanten ich annehme. Aber wirklich – ich wünsche Ihnen viel Glück. Schließlich gibt es nichts Besseres als einen kleinen Aktionärsaufstand, um das Blut in Wallung zu bringen, stimmt’s?«
Harnett stieß ein lautes, gekünstelt wirkendes Lachen aus und klatschte in die Hände. »Ihr Stil gefällt mir«, sagte er. »Eine gute Verhandlungstaktik. Okay, okay, ich hab schon verstanden. Sagen Sie mir, was Sie verlangen.«
Janson schüttelte den Kopf, lächelte, als ob Harnett etwas Komisches gesagt hätte, und ging zur Tür. Unmittelbar bevor er das Büro verließ, blieb er stehen und drehte sich um. »Aber einen Tipp will ich Ihnen geben – gratis«, sagte er. »Ihre Frau weiß Bescheid.« Den Namen von Harnetts venezolanischer Geliebten zu nennen wäre indiskret gewesen, und deshalb fügte Janson lediglich vieldeutig, aber letzten Endes unzweideutig hinzu: »Über Caracas, meine ich.« Ein vielsagender Blick folgte: Das war keine Verurteilung, er sprach schlicht und einfach als ein Profi zum anderen und bezeichnete einen Angriffspunkt.
Jetzt konnte man auf Harnetts Wangen wieder kleine rote Punkte erkennen; er machte den Eindruck, als würde ihm übel: der Gesichtsausdruck eines Mannes, dem gerade klar geworden war, dass er sich neben einem Übernahmegefecht an der Börse, das er wahrscheinlich verlieren würde, auch noch mit einer ruinösen Scheidung würde auseinander setzen müssen. »Ich bin bereit, über Aktienoptionen zu sprechen!«, rief er Janson nach.
Aber der Berater war bereits draußen auf dem Flur zu den Aufzügen unterwegs. Zuzusehen, wie der Dickschädel sich vor ihm wand, hatte ihm nichts ausgemacht; als er aber schließlich vor den Aufzugtüren stand, spürte er einen säuerlichen Geschmack im Mund und hatte das Gefühl, seine Zeit zu vergeuden. Und zwar nicht nur in diesem Augenblick.
Eine Stimme aus der Vergangenheit – gleichsam aus einem anderen Leben – hallte schwach in seinem Kopf nach. »Und das ist es, was Ihrem Leben seinen Sinn gibt?« Phan Nguyen hatte diese Frage in tausend verschiedenen Variationen gestellt. Es war seine Lieblingsfrage. Janson konnte selbst jetzt die kleinen, intelligenten Augen, das breite, verwitterte Gesicht und die schlanken Arme sehen, die wie die eines Kindes wirkten. Alles, was Amerika betraf, schien die Neugierde dieses Mannes zu reizen, der ihn verhörte, schien ihn in gleichem Maße zu faszinieren und anzuwidern. Und das ist es, was Ihrem Leben seinen Sinn gibt? Janson schüttelte den Kopf: Zum Teufel mit dir, Nguyen.
Als Janson in seine Limousine stieg, die die ganze Zeit draußen vor dem Eingangsportal an der Dearborn Street bereit gestanden hatte, beschloss er, jetzt gleich zum O’Hare Airport zu fahren; es gab einen früheren Flug nach Los Angeles, den er wohl noch schaffen würde. Wenn es nur möglich wäre, Nguyens Fragen ebenso leicht hinter sich zurückzulassen.
Zwei uniformierte Frauen standen hinter der Theke, als er die Platinum Club Lounge der Pacifica Airlines betrat. Die Uniformen und der Tresen waren in dem gleichen blaugrauen Ton gehalten. Die Jacken der beiden Frauen trugen die Epauletten, die gegenwärtig so viele größere Fluggesellschaften offensichtlich zu schätzen wussten. An einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit, überlegte Janson, hätte man derartige Schulterstücke nach reichlichen Kampfeinsätzen verliehen bekommen.
Eine der Frauen hatte gerade mit einem korpulenten Mann mit Hängebacken gesprochen, der einen offenen blauen Blazer trug und an dessen Gürtel ein Pager zu sehen war. Über der Innentasche seines Jacketts blitzte eine Plakette und verriet Janson, dass der Mann ein Inspektor der Luftfahrtbehörde war, der offenbar gerade in einer Umgebung, wo sympathische Gesellschaft zur Verfügung stand, eine kleine Pause eingelegt hatte. Die beiden Frauen und der Mann unterbrachen ihr Gespräch, als Janson auf sie zutrat.
»Ihre Bordkarte, bitte«, sagte die Frau und sah ihn an. Ihre puderig wirkende Bräune endete ein Stück unter ihrem Kinn, und ihre blonde Haarfarbe sah so aus, als stamme sie aus einer Flasche.
Janson zeigte sein Ticket und die Plastikkarte, die Pacifica ihren Vielfliegern zur Verfügung stellt.
»Willkommen im Pacifica Platinum Club, Mr. Janson«, flötete die Frau.
»Wir informieren Sie, wenn Ihre Maschine einsteigebereit ist«, ließ ihn die zweite Hostess – kastanienfarbenes, schulterlanges Haar und auf die blauen Applikationen auf ihrer Jacke abgestimmte Lidschatten – mit leiser, vertraulich klingender Stimme wissen. Sie deutete auf den Eingang zum eigentlichen Loungebereich, als wäre dieser Eingang das Tor zum Himmel. »Bis dahin wünschen wir Ihnen einen angenehmen Aufenthalt.« Ein aufmunterndes Nicken und ein strahlendes Lächeln: Petrus hätte es nicht vielversprechender machen können.
Zwischen funktionale Stahlträger und Glas eingezwängte Etablissements wie der Platinum Club von Pacifica waren Orte, an denen moderne Fluggesellschaften sich bemühten, der Crème de la Crème ihrer Kundschaft gerecht zu werden. Die kleinen Schalen, die dort herumstanden, waren nicht etwa mit gesalzenen Erdnüssen gefüllt, wie man sie les misérables in der Touristenklasse anbot, sondern mit den deutlich teureren Baumnüssen: Cashews, Mandeln, Walnüssen, Pekans. Auf einer mit einer Granitplatte belegten Getränketheke standen Kristallkrüge mit Pfirsichnektar und frisch gepresstem Orangensaft. Eleganter Mikrofaserteppichboden im Blaugrau der Fluggesellschaft bedeckte den Boden des Saals, den dunkelblaue und weiße Gitter in einzelne Sektionen unterteilten. Auf runden, zwischen wuchtigen Armsesseln verteilten Tischen lagen sauber gefaltete Exemplare des International Herald Tribune, der USA Today, des Wall Street Journal und der Financial Times. Über einen Bloomberg-Bildschirm flackerten unverständliche Zahlengruppen und Bilder, schattenhafte Marionetten des globalen Wirtschaftsgeschehens. Durch schräg gestellte Jalousien konnte man die Flughafenpiste draußen nur ahnen.
Janson blätterte ohne sonderliches Interesse in den Zeitungen. Als er im Wall Street Journal den »Marktbericht« erreichte, ertappte er sich dabei, wie sein Blick über die vertrauten Schlagzeilen huschte: Ein Gemetzel an der Wall Street, wo profitgierige Investoren den Dow in die Tiefe getrieben hatten. Ein Sportkommentar in USA Today befasste sich mit dem Zusammenbruch der Angriffsreihe der Raiders »in dem massiven Sperrriegel der Vikings«. Und die ganze Zeit tönte aus unsichtbaren Lautsprechern der Gesang einer gerade populären Diva aus dem neuesten Hollywood-Kassenschlager, einem Film über eine legendäre Schlacht des Zweiten Weltkriegs. Ein gewaltiger Aufwand an Studiogeldern und Computergrafik zu Ehren eines ebenso gewaltigen Aufwands an Blut und Schweiß.
Janson sank schwer in einen der Polstersessel und ließ seinen Blick über die Computeranschlüsse schweifen, wo leitende Angestellte von Weltfirmen ihre Laptops einstöpselten und auf der endlosen Suche nach Wichtigem E-Mails von Mandanten, Vorgesetzten, Interessenten, Mitarbeitern und Lebenspartnern abriefen. Aus ihren Aktenkoffern lugten die Rücken von Büchern, die Ratschläge von Sun Tsu und Konsorten für das Geschäftsleben anboten – die Kunst des Krieges neu verpackt für die moderne Geschäftswelt. Ein glattes, selbstzufriedenes, von nichts bedrohtes Völkchen, sinnierte Janson nach einem Blick auf die Manager und Geschäftsleute, die ihn umgaben. Wie diese Menschen doch den Frieden liebten und zugleich auch die Bilderfülle des Krieges! Für sie war die Romantik der Insignien des Militärwesens ohne Gefahr, so wie Raubtiere zum Zimmerschmuck werden, nachdem der Präparator sein Werk getan hat. Es gab Augenblicke, wo Janson fast das Gefühl hatte, auch ihn habe man ausgestopft und an eine Wand gehängt. Beinahe jedes Raubtier stand jetzt unter Naturschutz, nicht zuletzt der weißköpfige Seeadler, das Wappentier der Vereinigten Staaten, und Janson wurde plötzlich bewusst, dass er selbst einmal so etwas wie ein Raubtier gewesen war – eine aggressive Macht gegen die Mächte der Aggression. Janson hatte ehemalige Krieger gekannt, die für Adrenalin und Gefahren süchtig geworden waren und die sich selbst, als man ihre Dienste nicht länger benötigte, zu einer Art Spielzeugsoldaten gemacht hatten. Sie verbrachten ihre Zeit damit, in der Sierra Madre mit Farbbeutelgewehren aufeinander zu schießen oder, noch schlimmer, sich an unappetitliche Firmen mit unappetitlichen Bedürfnissen zu verdingen, gewöhnlich in Teilen der Welt, in denen das Bakschisch regierte. Die Verachtung, die Janson für diese Leute empfand, ging tief. Und doch fragte er sich manchmal, ob die hoch spezialisierten Dienste, die er der amerikanischen Geschäftswelt lieferte, nicht lediglich eine etwas respektablere Version derselben Sache waren.
Er war einsam, das war der Kern der ganzen Angelegenheit, und diese Einsamkeit war nie ausgeprägter als in den gelegentlichen Pausen seines meist von zu vielen Terminen gejagten Lebens – der Zeit, die er nach dem Einchecken und vor dem Start an übertrieben gestylten Orten verbrachte, die schlicht und einfach nur für das Warten bestimmt waren. Am Ende seines nächsten Fluges würde niemand seine Ankunft erwarten, mit Ausnahme eines weiteren livrierten Limousinenchauffeurs, der vermutlich seinen Namen auf einer weißen Papptafel falsch geschrieben vorwies, und danach ein weiterer Firmenmandant, ein besorgter Filialleiter eines Unternehmens der Leichtindustrie in Los Angeles – seine Einsätze führten Janson von einem Eckbüro zum nächsten. Es gab keine Frau und keine Kinder, obwohl es früher einmal eine Frau und zumindest Hoffnung auf ein Kind gegeben hatte, denn Helene war schwanger gewesen, als sie gestorben war. »Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähle ihm von deinen Plänen«, pflegte sie ihren Großvater zu zitieren, eine Maxime, die sich auf schreckliche Weise an ihr erfüllt hatte.
Janson musterte die mit bernsteinfarbener Flüssigkeit gefüllten Flaschen hinter der Bar, Flaschen, deren dicht bedruckte Etiketten ein Alibi für das Vergessen suggerierten, das sie boten. Er hielt sich in Form, trainierte verbissen, aber selbst wenn er im aktiven Einsatz war, vergönnte er sich hie und da einen Schluck oder auch zwei. Wem schadete das schon?
»Ein Gespräch für Richard Alexander«, tönte eine nasale Stimme aus der Lautsprecheranlage. »Passagier Richard Alexander. Bitte melden Sie sich an einem beliebigen Pacifica-Schalter.«
Das gehörte mit zu den Hintergrundgeräuschen eines jeden Flughafens, riss Janson aber aus seinen Träumen. Richard Alexander war ein Deckname, den er in der Vergangenheit häufig benutzt hatte. Er sah sich reflexartig um. Zufall, dachte er, und dann bemerkte er, dass im gleichen Augenblick sein Handy in den Tiefen seiner Brusttasche zu summen angefangen hatte. Er schob sich den Stöpsel des Dreiband-Nokia ins Ohr und drückte auf SND. »Ja?«
»Mr. Janson? Oder sollte ich sagen Mr. Alexander?« Eine angestrengt, ja verzweifelt klingende Frauenstimme.
»Wer spricht da?«, fragte Janson mit leiser Stimme. Stress wirkte auf ihn dämpfend, zumindest anfänglich – machte ihn ruhiger, nicht erregter.
»Bitte, Mr. Janson. Es ist äußerst dringend, dass wir uns sofort treffen.« Ihre Aussprache war von jener ganz besonderen Präzision, die den gebildeten Ausländer verrät. Und die Hintergrundgeräusche waren noch auffälliger.
»Werden Sie deutlicher.«
Eine kurze Pause. »Wenn wir uns persönlich gegenüberstehen.«
Janson drückte END, beendete das Gespräch. Er verspürte ein leichtes Prickeln im Nacken. Das Zusammentreffen der Lautsprecherdurchsage und des Anrufs, der Wunsch nach einem sofortigen persönlichen Treffen: Die Anruferin befand sich offensichtlich ganz in der Nähe. Die Hintergrundakustik des Anrufs hatte seinen Verdacht bestätigt. Jetzt huschten seine Augen von einem Insassen der Lounge zum nächsten, während er überlegte, wer wohl auf diese Weise versuchte, mit ihm Kontakt herzustellen.
War es eine Falle, ein alter Gegner, der ihm nicht verziehen hatte? Es gab viele, die seinen Tod als Vergeltung empfinden würden; und für einige wenige von ihnen würde dieser Durst nach Rache nicht völlig unberechtigt sein. Und doch kam ihm das eher unwahrscheinlich vor. Er war nicht im Einsatz; er schaffte nicht gerade einen widerstrebenden »Überläufer« der Kurdischen Befreiungsfront von den Dardanellen über Athen zu einer wartenden Fregatte und überging dabei jede offizielle Grenzkontrolle. Um Himmels willen, er befand sich schließlich auf dem O’Hare Airport. Und das war möglicherweise der Grund, weshalb man gerade diesen Ort für das Treffen ausgewählt hatte. Die Menschen neigten dazu, sich auf einem Flughafen sicher zu fühlen, wo sie von Metalldetektoren und uniformiertem Sicherheitspersonal beschützt wurden. Es wäre wirklich schlau, diese Illusion der Sicherheit auszunutzen – denn auf einem Flughafen, auf dem täglich beinahe zweihunderttausend Reisende abgefertigt wurden, war Sicherheit tatsächlich eine Illusion.
All diese Möglichkeiten gingen ihm durch den Kopf, wurden erwogen und ebenso schnell wieder abgetan. Vor der dicken Glasscheibe, die den Ausblick auf die Piste bot, war eine blonde Frau im schräg einfallenden Sonnenlicht anscheinend damit beschäftigt, auf ihrem Laptop eine Tabellenkalkulation zu studieren; ihr Handy lag neben ihr, vergewisserte sich Janson, aber es war nicht mit einem Ohrhörer verbunden. Eine weitere Frau, näher beim Eingang, war in eine lebhafte Diskussion mit einem Mann vertieft, dessen Ehering an seiner sonst sonnengebräunten Hand lediglich als schmaler, heller Hautstreifen zu erkennen war. Jansons Augen schweiften weiter, bis er sie Sekunden später sah – die, die ihn angerufen hatte.
Es war eine elegante Frau in mittleren Jahren, die täuschend ruhig und desinteressiert in einer Ecke der Lounge saß und sich ein Handy ans Ohr hielt. Sie hatte weißes Haar, das sie hochgesteckt trug, und war mit einem dunkelblauen Chanelkostüm mit diskreten Perlmuttknöpfen bekleidet. Ja, sie war es; er war jetzt ganz sicher. Nicht sicher war er dagegen, worin ihre Absichten bestanden. War sie eine Meuchelmörderin oder Mitglied eines Kidnapperteams? Das waren nur zwei von hundert Möglichkeiten, die er ausschließen musste, so unwahrscheinlich sie auch sein mochten. Standardtaktik, in vielen Jahren im Einsatz entwickelt und fester Bestandteil seiner Persönlichkeit …
Janson sprang auf. Er musste den Standort wechseln: Das war eine Grundregel. Es ist äußerst dringend, dass wir uns sofort treffen, hatte die Anruferin gesagt. Wenn es zu einem Treffen kam, würde das nach seinen Regeln geschehen. Er schickte sich an, die Lounge zu verlassen, und griff sich beim Hinausgehen einen Pappbecher von einem Wasserspender. Mit dem Becher in der Hand, ihn so haltend, als ob er voll wäre, ging er auf die Empfangstheke zu. Dann gähnte er, drückte dabei die Augen zu und stieß mit dem korpulenten Inspektor der Luftfahrtbehörde zusammen, der ein paar Schritte zurücktaumelte.
»Oh, tut mir Leid«, stieß Janson mit erschreckt wirkendem Blick hervor. »Du liebe Güte, ich habe Sie doch nicht etwa nass gemacht!?« Jansons Hände fuhren schnell über den Blazer des Mannes. »Hab ich Sie nass gemacht? Herrgott, es tut mir wirklich Leid, ehrlich.«
»Nichts passiert«, erwiderte der Mann mit einem Anflug von Ungeduld. »Aber Sie sollten wirklich aufpassen, wo Sie hinmarschieren, ja? Auf diesem Flughafen gibt es eine Menge Leute.«
»Ist schon schlimm genug, wenn man nicht weiß, in welcher Zeitzone man gerade ist, aber – Herrgott, ich weiß wirklich nicht, was mit mir los ist«, sagte Janson, das Urbild des verwirrten, vom Jetlag geplagten Passagiers. »Ich bin völlig fertig.«
Als Janson die VIP-Lounge verließ und durch den Korridor ging, der in Abflughalle B führte, summte sein Handy erneut, wie er das erwartet hatte.
»Ich glaube, Ihnen ist nicht ganz klar, wie dringlich das ist«, sagte die Frauenstimme.
»Das stimmt«, fiel Janson ihr ins Wort. »Das ist mir nicht klar. Warum sagen Sie mir nicht einfach, was das alles soll?« Er entdeckte eine kleine Nische in der Wand, vielleicht einen Meter tief, und dort die Stahltür, die er gesucht hatte, eine Tür in einen Raum, zu dem Reisende keinen Zugang hatten. UNBEFUGTEN IST DER ZUTRITT VERBOTEN stand in großen Lettern auf einem Schild.
»Das kann ich nicht«, sagte die Frauenstimme nach kurzer Pause. »Nicht am Telefon, leider. Aber ich bin im Flughafen und wir könnten uns treffen …«
»Dann rufen Sie mich in einer Minute zurück«, fiel Janson ihr ins Wort und beendete das Gespräch. Er schlug mit dem Handrücken auf die Türklinke und trat ein. Der Raum, in dem er sich jetzt befand, war mit elektrischem Inventar gefüllt: überall Anzeigetafeln, die Daten der Kühl- und Heizanlage des Flughafens wiedergaben. An einem Kleiderrechen an der Wand hingen Mützen und Windjacken für die Arbeit im Freien.
Drei Angestellte von Fluggesellschaften in dunkelblauen Drillichuniformen saßen um einen kleinen Stahltisch mit linoleumüberzogener Platte und tranken Kaffee. Er hatte offensichtlich ihr Gespräch unterbrochen.
»Was soll das?«, schrie einer von ihnen Janson an, als die Tür hinter ihm wieder zufiel. »Sie dürfen hier nicht rein.«
»Das ist nicht das Klo«, stieß ein anderer halblaut hervor.
Janson lächelte kühl. »Ihr werdet jetzt ganz schön sauer sein auf mich, Jungs, aber was meint ihr wohl?« Er zog die Plakette von der Flugsicherung heraus, die er dem korpulenten Mann in der Lounge entwendet hatte. »Wieder mal eine Anti-Drogen-Initiative. Zufallstests für eine drogenfreie Flughafenbelegschaft – so steht es im letzten Rundschreiben des Verwaltungschefs. Zeit, diese Becher hier zu füllen. Ich bedauere die Störung, aber dafür kriegt ihr ja schließlich so viel Geld, stimmt’s?«
»Das ist doch Blödsinn!«, schrie der dritte Mann verärgert. Abgesehen von einem schon grau werdenden Haarkranz am Hinterkopf war er beinahe völlig kahl. Er hatte sich einen Bleistiftstummel hinter das rechte Ohr geklemmt.
»Macht schon, Leute«, herrschte Janson sie an. »Das läuft hier diesmal nach einem völlig neuen Plan. Mein Team wartet an Gate 2 in der Abfertigungshalle A. Lasst sie nicht warten. Wenn die ungeduldig werden, bringen sie manchmal die Proben durcheinander, falls ihr versteht, was ich damit sagen will.«
»Was ist das für ein Unfug«, wiederholte der kahlköpfige Mann.
»Soll ich einen Bericht schreiben, dass ein Mitglied der Flughafengewerkschaft sich geweigert und versucht hat, sich der Rauschgiftprobe zu entziehen? Wenn Ihr Test positiv ausfällt, können Sie schon mal anfangen, die Stellenanzeigen zu lesen.« Janson verschränkte die Arme vor der Brust. »Und jetzt raus hier, und zwar dalli!«
»Ich geh ja schon«, brummelte der Kahlköpfige, der nicht mehr so selbstbewusst klang. »Bin ja schon fort.« Mit saurer Miene machten sich die drei Männer auf den Weg und ließen ihre Klemmbretter und Kaffeetassen stehen. Sie würden gute zehn Minuten brauchen, bis sie zur Abflughalle A kamen, das wusste Janson. Er sah auf die Uhr und zählte die noch verbliebenen Sekunden ab, bis sein Handy summte; die Frau hatte exakt eine Minute gewartet.
»Ganz in der Nähe des Ticketschalters gibt’s eine Imbissstube«, sagte Janson. »Wir treffen uns dort. An dem Tisch ganz hinten links. In ein paar Minuten.« Er zog seine Jacke aus, schlüpfte in eine dunkelblaue Windjacke, stülpte sich eine Mütze auf den Kopf, verließ den Raum und wartete in der Nische. Eine halbe Minute später sah er die weißhaarige Frau vorbeigehen.
»Hey, Süße!«, rief er, legte im gleichen Augenblick einen Arm um ihre Hüfte, presste ihr die Hand über den Mund und zerrte sie in die Kammer. Janson hatte sich überzeugt, dass niemand in der Nähe war, der das Manöver, das keine drei Sekunden in Anspruch nahm, hätte sehen können; wenn das doch der Fall gewesen wäre, hätte man das Ganze vermutlich für eine romantische Umarmung gehalten.
Die Frau war verblüfft und vor Angst fast steif, versuchte aber nicht einmal zu schreien und legte damit ein Maß an professioneller Fassung an den Tag, das Janson recht beruhigend fand. Sobald sich die Tür hinter ihnen geschlossen hatte, bedeutete Janson ihr brüsk, an dem Tisch mit der Linoleumplatte Platz zu nehmen. »Machen Sie sich’s bequem«, sagte er.
Die Frau, deren elegante Kleidung einen ungewöhnlichen Kontrast zu der schlichten Umgebung bildete, setzte sich auf einen der Klappstühle. Janson blieb stehen.
»Sie sehen nicht gerade so aus, wie ich Sie mir vorgestellt habe«, sagte sie, »Sie sehen nicht aus wie …« Sein unverhohlen feindseliger Blick war ihr nicht entgangen, und das veranlasste sie dazu, den Satz nicht zu Ende zu führen. »Mr. Janson, wir haben wirklich keine Zeit für so etwas.«
»Ich sehe nicht aus wie was?«, fragte er scharf. »Ich weiß nicht, wer zum Teufel Sie sind, und werde Sie zunächst auch nicht fragen, wie Sie an meine Handynummer gekommen sind oder wie Sie das erfahren haben, was Sie offenbar zu wissen glauben. Aber wenn wir hier fertig sind, möchte ich, dass ich alles weiß, was ich wissen möchte.« Selbst wenn sie eine ganz gewöhnliche Privatperson war, die auf völlig legitime Weise seine Dienste in Anspruch nehmen wollte, war eine so öffentliche Kontaktaufnahme absolut unpassend. Und einen seiner Decknamen zu benutzen, wenn auch einen, der schon lange nicht mehr aktuell war, war ein geradezu kardinaler Verstoß gegen alle Protokolle.
»Das haben Sie mir jetzt klar gemacht, Mr. Janson«, sagte sie. »Ich gebe ja zu, dass meine Kontaktaufnahme nicht sonderlich gut überlegt war. Sie werden mir verzeihen müssen …«
»Werde ich das? Das ist ziemlich anmaßend.« Er atmete ein und registrierte einen leichten Duft: Penhaligon’s Jubilee. Ihre Blicke begegneten sich, und Jansons Ärger schwand etwas, als er ihren Gesichtsausdruck sah, den besorgt verzogenen Mund und den entschlossenen Blick ihrer graugrünen Augen.
»Wie ich schon sagte, wir haben sehr wenig Zeit«, erklärte sie.
»Ich habe alle Zeit der Welt.«
»Aber Peter Novak nicht.«
Peter Novak.
Der Name durchzuckte ihn wie ein elektrischer Schlag, so wie sie das geplant hatte. Novak war ein legendärer ungarischer Financier und Philanthrop und hatte im Jahr zuvor für seine erfolgreichen Bemühungen um Konfliktbeilegung in der ganzen Welt den Friedensnobelpreis erhalten. Novak war Gründer und Direktor der Liberty Foundation, die sich der »gezielten Demokratie« verschrieben hatte – Novaks großer Leidenschaft. Diese Institution unterhielt ihre Büros in den Hauptstädten Osteuropas und in zahlreichen Entwicklungsländern. Aber Janson hatte eigene Gründe, sich Peter Novaks zu erinnern. Und er stand so tief in der Schuld des Mannes, dass er diese Dankbarkeit gelegentlich wie eine Last empfunden hatte.
»Wer sind Sie?«, fragte Janson.
Die graugrünen Augen der Frau bohrten sich in die seinen. »Ich heiße Marta Lang und bin für Peter Novak tätig. Ich könnte Ihnen eine Geschäftskarte zeigen, falls Sie das für hilfreich hielten.«
Janson schüttelte langsam den Kopf. Auf ihrer Geschäftskarte würde ein Titel stehen, der für ihn ohne Bedeutung war; wahrscheinlich würde er sie als eine hochrangige Angestellte der Liberty Foundation ausweisen. Ich bin für Peter Novak tätig