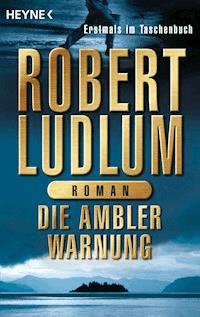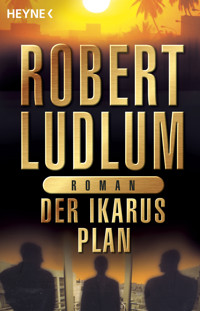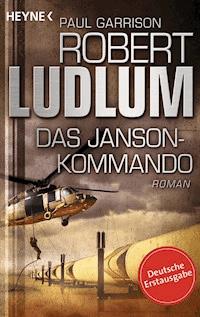
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: JANSON-Serie
- Sprache: Deutsch
Er gründete seine eigene Einheit – jetzt kommt ihr härtester Einsatz
Paul Janson ist nicht länger für die Regierung als Geheimagent und Attentäter aktiv, sondern hat sich gemeinsam mit der hochbegabten Scharfschützin Jessica Kincaid selbstständig gemacht. Allerdings übernimmt er nur Missionen, von denen er glaubt, dass sie dem Wohl der Menschheit dienen. Sein neuester Auftrag: Er soll einen von afrikanischen Piraten entführten Mediziner befreien. Doch das Unternehmen misslingt und Janson begreift, dass er mitten in den größten Schwierigkeiten steckt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 537
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Das Buch
Nach einer langen Karriere in Sachen Mord und Komplott hat sich der Auftragskiller Paul Janson unabhängig gemacht und seine eigene Spezialeinheit gegründet. Zusammen mit seiner neuen Geschäftspartnerin Jessica Kincaid will er ehemaligen Kollegen helfen, wieder ins normale Leben zu finden. Um dies zu ermöglichen, müssen sie aber auch einige andere Jobs annehmen. Jansons nächster Auftrag besteht darin, einen Arzt aus den Händen westafrikanischer Rebellen zu befreien. Janson macht sich auf die Reise nach Île de Forée in Westafrika, eine von Unruhen geplagte Insel, die von einem skrupellosen Diktator regiert wird– und gerät dort bald zwischen die Fronten.
Die actionreiche Fortsetzung zu Robert Ludlums Der Janson-Befehl.
Die Autoren
Robert Ludlum erreichte mit seinen Romanen, die in mehr als 30 Sprachen übersetzt wurden, weltweit eine Auflage von über 280 Millionen Exemplaren. Robert Ludlum verstarb im März 2001. Die Romane aus seinem Nachlass erscheinen bei Heyne. Ein ausführliches Werkverzeichnis finden Sie am Ende des Buches.
Paul Garrison wurde in New York geboren und lebt in Connecticut. Zum Schreiben inspirierten ihn die Seefahrergeschichten seines Großvaters. Er ist der Autor zahlreicher erfolgreicher Thriller.
Robert Ludlum
Paul Garrison
Das Janson-Kommando
Roman
Aus dem Amerikanischen
von Norbert Jakober
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Für Amber Edwards
Bob hat Schönheit, harte Arbeit, Liebe und Talent geschätzt.
Er hätte dich großartig gefunden.
Prolog
DIE RETTUNG
Vor drei Jahren
41°13' N, 111°57' W
Ogden, Utah
»Ogden ist eine tolle Stadt, wenn man Wandern, Mountainbiken und Skifahren mag.« Doug Case umfasste die ramponierten Armlehnen seines Secondhand-Rollstuhls und tat so, als wären es Skistöcke. »Und genau dafür bin ich hergekommen, wenn das deine Frage beantwortet. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ich hab meinen Namen aus dem Veteran-Affairs-System gelöscht.«
»Wenn alles den Bach runtergeht, zieht es einen für gewöhnlich nach Hause zurück«, sagte Paul Janson.
»In den warmen Schoß der Familie? Sicher nicht. Ich brauch niemanden.«
»Das seh ich.«
Cases Zuhause war die Mündung eines verlassenen Eisenbahntunnels, mit Blick auf einen von Abfall übersäten leeren Platz, ein abgebranntes Kentucky-Fried-Chicken-Restaurant und die schneebedeckten Wasatch Mountains. Er saß gebeugt in seinem Rollstuhl, einen zerschlissenen Rucksack auf dem Schoß, die strähnigen Haare schulterlang, Bartstoppeln im Gesicht. Sein stumpfer Blick sprang gelegentlich zu vier muskulösen Jugendlichen hinüber, die sie von ihrem vor dem Restaurant abgestellten Honda aus nicht aus den Augen ließen.
Paul Janson saß auf einem umgedrehten Einkaufswagen. Er trug leichte Einsatzstiefel, Wollhose, Pullover und eine weite schwarze Skijacke.
»Los, erschieß mich, dann haben wir’s hinter uns«, sagte Case. »Ich mag keine Spielchen mehr.«
»Ich will dich nicht umbringen.«
»Tu’s einfach! Keine Sorge, ich wehre mich nicht.« Er schob den Rucksack auf seinem Schoß zurecht.
»Du glaubst, ich arbeite noch für Consular Operations.«
»Niemand verlässt Cons Ops.«
»Wir haben eine Vereinbarung. Ich hab mich selbstständig gemacht, als Sicherheitsberater für Unternehmen. Cons Ops ruft mich hin und wieder an. Manchmal ruf ich zurück.«
»Du warst noch nie jemand, der einfach abhaut und alles hinter sich lässt.« Case klang skeptisch. »Arbeitest du allein?«
»Ich hab jemanden, der mir hilft, wenn ich mal einen Scharfschützen brauche.«
»Gut?«
»Hab noch nie einen besseren gesehen.«
»Woher?« Case war nun doch neugierig, welches Ass Janson angeheuert hatte.
»Aus der hiesigen Talentschmiede«, war alles, was Janson preisgab.
»Warum bist du nicht bei Cons Ops geblieben?«
»Mir ist irgendwann klargeworden, dass ich zu oft aus den falschen Gründen getötet habe.«
Case lachte. »Herrgott, Paul! Das State Department kann’s doch den verdeckten Einsatzkräften nicht selbst überlassen, wen sie töten. Wenn du jemanden umbringen musst, um einen Auftrag zu erledigen, dann tust du’s. Darum nennt man’s ja sanktioniertes Töten.«
»SanktionierteSerienmorde würde es besser treffen. In meinen schlaflosen Nächten hab ich sie oft gezählt. Die berechtigten Fälle und die nicht berechtigten.«
»Wie viele insgesamt?«
»Sechsundvierzig.«
»Das ist ja ein Ding! Meine Bilanz ist höher.«
»Sechsundvierzig bestätigte Fälle«, versetzte Janson gereizt.
Case lächelte. »Ich seh schon, dein Testosteron hat sein Ablaufdatum noch nicht überschritten.« Er musterte Janson von oben bis unten. Der Hundesohn war kaum gealtert. Man hätte ihn für Mitte dreißig oder Anfang vierzig halten können mit seinem kurz geschnittenen eisengrauen Haar. Dabei wirkte er immer noch genauso unscheinbar wie früher. Nur ein anderer erstklassiger Profi hätte an seinen Schultern und seinen wachsamen Augen erkannt, wen er vor sich hatte, doch dann war es vielleicht schon zu spät.
»Wir kriegen Gesellschaft«, bemerkte Janson.
Die vier jungen Kerle aus dem Honda hatten sich in Bewegung gesetzt und kamen direkt auf sie zu.
»So ahnungslos, die Jungs«, seufzte Case. Er ließ die vier bis auf zehn Meter herankommen, dann sagte er: »Gentlemen, ich geb euch eine Gratislektion in Sachen Überleben: Lasst euch nie auf den falschen Kampf ein. Setzt euch ins Auto und verschwindet.«
Drei der vier bliesen sich mächtig auf. Doch der Anführer, der Kleinste von ihnen, betrachtete Case und Janson mit Respekt in den Augen. »Wir hauen ab.«
»Der Typ sitzt in einem verdammten Rollstuhl!«
Der Anführer schlug dem Aufmüpfigen hart aufs Ohr und scheuchte seine Kumpel zurück.
»Hey, Junge!«, rief ihm Case nach. »Du hättest das Zeug für die Army. Dort lernst du, was draus zu machen.« Er sah Janson lächelnd an. »Du hast doch was übrig für junge Talente, oder?«
»Stimmt.« Janson erhob seine befehlsgewohnte Stimme: »Komm her!« Der Junge machte kehrt und näherte sich leichtfüßig, aber argwöhnisch. Janson gab ihm eine Businesskarte. »Geh zur Army. Ruf mich an, wenn du Buck Sergeant bist.«
»Was ist das?«
»Ein großer Schritt auf dem Weg nach oben.«
Janson wartete, bis der Honda mit quietschenden Reifen davonbrauste. »Das erinnert mich an etwas. Die Ideale, an die ich mal geglaubt habe und mit denen ich heute nichts mehr anfangen kann.«
»Dir täte es wahrscheinlich gut, wenn dein Gedächtnis ein bisschen nachlassen würde.«
»Das kann man sich leider nicht aussuchen.«
Case lachte. »Erinnerst du dich an den Typ, der wirklich ’nen totalen Gedächtnisverlust hatte? In seinem Frust hat er Leute verprügelt, dabei wusste er nicht mal mehr, wo er zu kämpfen gelernt hatte. Wie hieß er doch gleich?… Hab seinen Namen vergessen. Er übrigens auch. Bei dir ist es das genaue Gegenteil: Du erinnerst dich an jede Kleinigkeit. Okay, Paul, wenn du nicht hier bist, um mich umzulegen, was suchst du dann in diesem verdammten Kaff?«
»Es hat wenig Sinn, sich einzugestehen, was man getan hat, wenn man nicht versucht, es irgendwie besser zu machen.«
»Was meinst du damit? So was wie ein anonymer Alkoholiker, der sich bei allen entschuldigt, zu denen er fies war?«
»Ich kann nicht ungeschehen machen, was ich getan hab, aber ich kann’s beim nächsten Mal anders machen.«
»Warum holst du dir nicht eine Absolution vom Papst?«
Der Sarkasmus prallte an Janson ab. »Wenn du dein scharfes Auge für die Umgebung, das wir trainiert haben, nach innen richtest, ist das kein erfreulicher Anblick.«
»Saulus wird auf dem Weg nach Damaskus bekehrt und wird zu Paulus. Aber du heißt ja schon Paul. Deinen Namen brauchst du nicht mehr zu ändern, also was dann? Die Welt?«
»Ich möchte jedem Agenten helfen, der sich mit seinen verdeckten Einsätzen das Leben ruiniert hat. Leuten wie dir und mir.«
»Lass mich aus dem Spiel.«
»Kann ich nicht.«
»Was soll das heißen?«
»Du bist mein erstes Projekt.«
»Eine Million Amerikaner haben Zugang zu streng geheimen Informationen. Wenn einer von hundert undercover arbeitet, dann ergibt das zehntausend Geheimagenten, die du retten kannst. Warum gerade mich?«
»Manche sagen, du warst der Schlimmste.«
»Früher haben sie gesagt, ich bin der Beste«, erwiderte Case mit einem bitteren Lächeln.
»Tatsache ist, wir waren die Schlimmsten.«
»Mich braucht keiner zu retten.«
»Du hast kein Dach überm Kopf. Der Winter kommt. Du bist abhängig von Percocet, doch die Ärzte geben dir nichts mehr. Du kriegst es noch diesen Monat, danach musst du’s dir anderweitig beschaffen.«
»Auf Paul Jansons Nachforschungen ist wie immer Verlass.«
»Spätestens am Valentinstag bist du tot.«
»Deine analytischen Fähigkeiten sind genauso unbestritten.«
»Du brauchst Hilfe.«
»Ich will aber keine. Hau ab. Lass mich in Ruhe.«
»An meinem Van ist ’ne Rampe.«
Doug Cases blasse Wangen mit den grauen Bartstoppeln färbten sich rot vor Zorn. »An deinem Van ist ’ne Rampe? Hast du vielleicht auch ein paar Bewaffnete, die dir helfen, mich über deine verdammte Rampe in den Wagen zu bekommen?«
Ein unsicheres Lächeln trat auf Jansons Lippen. Zum ersten Mal, seit er Doug Case in der Mündung des Eisenbahntunnels aufgesucht hatte, wusste er nicht recht, was er sagen oder tun sollte. Der Mann, den sie »die Maschine« genannt hatten, wirkte plötzlich verwundbar, und Doug Case ließ nicht locker.
»Du hast deinen Coup wohl nicht gut genug vorbereitet, Kumpel. Keine Einsatztruppe im Van. Kein Notfallplan. Das sieht mir ziemlich notdürftig und spontan aus. Du hättest es so sorgfältig planen sollen wie deine Jobs für Cons Ops. Du hast doch selbst genug zu tun mit deinem Weg der Besserung. Warum willst du mich da auch noch geradebiegen?«
»Mehr als das. Wir sorgen dafür, dass du ganz von vorn anfängst. Ein neues Leben.«
»Ein neues Leben? Willst du mich zuerst vom Perc runterbringen, damit die Seelenklempner anschließend meinen Kopf reparieren können? Und wenn die Ärzte fertig sind, verschaffst du mir eine Karriere, in der meine tollen Talente zur Geltung kommen? Geh zum Teufel!«
»Du sollst einfach wieder du selbst sein.«
»Vielleicht findest du auch noch ein Mädchen für mich?«
»Wenn du’s willst, wirst du selbst eins finden.«
»Herrgott, Paul, du bist genauso kaputt wie ich. Was stellst du dir denn vor, wer deine ganzen Fantasien bezahlen soll?«
»Bei meinem letzten Job hat jemand einen Haufen Geld auf eins meiner Auslandskonten überwiesen, damit es so aussieht, als wär ich zum Verräter geworden. Dieser Jemand lebt nicht mehr. Das Geld ist also kein Problem.«
»Falls du’s jemals schaffst, irgendeinen armen Narren für deine Hirngespinste zu gewinnen, brauchst du mehr als nur Geld. Du bräuchtest Hilfe. Ein ganzes Team. Verdammt, eine ganze Firma, die sich um alles kümmert.«
Erneut wirkte Janson unsicher. »Ich weiß nicht recht. Von Firmen hab ich irgendwie genug. Von Institutionen überhaupt. Ich werd misstrauisch, sobald mehr als zwei Leute zusammenkommen.«
»Armer Paul. Willst die Welt verbessern, indem du den schlimmsten Kerl rettest, den du kennst, und das ganz allein. Wie nennst du dein Projekt? Das ›Paul Janson Institut zum Aus-der-Scheiße-Ziehen ehemaliger Feldagenten‹? Oder besser: die ›Phönix-Stiftung‹?«
Janson stand auf. »Gehen wir, mein Freund.«
»Ich geh nirgendwohin. Und dein Freund bin ich auch nicht.«
»Mag sein. Aber wir haben immerhin zusammengearbeitet, und ich könnte heute genauso hier sitzen, also sind wir Brüder.«
»Brüder? Sag mal, kneift dein Heiligenschein eigentlich sehr?« Doug Case schüttelte den Kopf, kratzte sich unter der Achsel und schlug seine schmutzigen Hände vors Gesicht. Nach einer Weile ließ er die linke Hand sinken und sprach durch die Finger der rechten. »Sie haben dich ›die Maschine‹ genannt. Weißt du noch? Manche von uns haben sie ›Tier‹ genannt, manche ›Maschine‹. Die Maschine ist normalerweise dem Tier überlegen. Aber nicht immer.«
In einer einzigen fließenden Bewegung– zehntausendmal trainiert– schnellte Cases linke Hand aus dem Rucksack hoch, den Lauf einer 9-mm-Glock zwischen Daumen und Zeigefinger haltend. Seine rechte Hand schloss sich um den Pistolengriff, der Zeigefinger legte sich um den Abzug, und die linke Hand zog blitzschnell den Schlitten zurück, um eine Kugel in die Kammer zu laden.
Janson kickte ihm die Pistole aus der Hand.
»Scheiße!«
Doug Case rieb sich das Handgelenk. Jansons Stiefel hatte ihn hart getroffen. Er hätte sich an den alten Spruch erinnern sollen, der innerhalb von Cons Ops kursierte: schnell, schneller, Janson.
Janson hob die Waffe auf. Er grinste von einem Ohr zum anderen, nunmehr überzeugt, dass der Mann kein hoffnungsloser Fall war. »Ich sehe, du bist noch nicht total im Arsch.«
»Wie kommst du darauf?«
Janson tippte auf die Glock. »Du hast auf dem Ding ein Ringvisier montiert.«
Er zog das Magazin heraus und steckte es ein, nahm die Patrone aus der Kammer, schnappte sich den Rucksack von Cases Schoß, zog zwei Ersatzmagazine aus einer Seitentasche und ein drittes aus Cases Hosenbund, ehe er ihm die leere Pistole zurückgab.
»Wann krieg ich den Rest?«
»Wenn du den Weg zurück geschafft hast.«
Erster Teil
GIGANTISCHE ERDÖLVORKOMMEN
Heute
1°19' N, 7°43' O
Golf von Guinea, 260 Meilen südlich von Nigeria, 180 Meilen westlich von Gabun
1
»Du kennst die Regel: Was in Vegas passiert, bleibt in Vegas.« Janet Hatfields Stimme klang ruhig und fest in der Stille des verdunkelten Ruderhauses. Sie war Kapitänin der Amber Dawn, eines Offshore-Serviceschiffs, das in der dunklen Nacht durch die schwere See des Golfs von Guinea rollte und stampfte. »Und was du auf der Amber Dawn gesehen hast, bleibt auch auf der Amber Dawn.«
»Das hast du mir schon erklärt, als wir in Nigeria ausgelaufen sind.«
»Ich mein’s ernst, Terry. Wenn die Firma erfährt, dass ich dich an Bord geschmuggelt hab, feuern sie meinen Arsch.«
»So einen hübschen Arsch feuert man doch nicht.« Terrence Flannigan, der als Firmenarzt und Frauenheld um die Welt reiste, hob die rechte Hand zum Schwur und schaute Janet Hatfield mit einem verschlafenen Lächeln an. »Okay, ich schwör’s noch mal. Die Geheimnisse der Amber Dawn sind bei mir sicher, kein Wort über Erdöl oder Erkundungsbohrungen. Der Blitz soll mich treffen, wenn ich irgendwas ausplaudere.«
Kapitänin Hatfield, eine athletisch gebaute fünfunddreißigjährige Blondine, wandte ihm den Rücken zu und studierte leicht beunruhigt den Radarschirm. Seit ein paar Minuten tauchte immer wieder ein undefinierbares Echo auf, um gleich wieder zu verschwinden. Der Lichtpunkt war zu schwach für ein Schiff, doch hell genug, um Janets Aufmerksamkeit zu erregen. Das Radar war durchaus zuverlässig, ein neues Furuno-Modell. Doch sie trug immerhin die Verantwortung für zwölf Menschenleben: fünf philippinische Besatzungsmitglieder, sechs amerikanische Erdölspezialisten und einen blinden Passagier. Dreizehn, wenn sie sich mitzählte, was sie eher nicht tat.
War es vielleicht nur ein Stück Müll oder ein Ölfass, das da auf dem Wasser tanzte, manchmal obenauf, manchmal zwischen den Wellen verborgen? Oder doch etwas Größeres, vielleicht ein halb versunkenes Wrack, gegen das man besser nicht mit fünfzehn Knoten krachte?
Erneut leuchtete es auf, nun etwas näher, so als würde es nicht bloß dahintreiben, sondern sich auf sie zubewegen. Sie drehte an den Einstellungen für Entfernung und Auflösung. Außer ein paar großen Öltankern etwa zwanzig Meilen westlich war weit und breit nichts zu sehen. Ganz oben hatte sie den knapp zweitausend Meter hohen Vulkan Pico Clarence auf der Île de Forée im Bild, das Ziel ihrer Reise.
Sie warf einen Blick auf die anderen Instrumente. Kompass, Autopilot und die Anzeigen für die Dieselgeneratoren, welche die zwei 3000-PS-Elektromotoren antrieben, lieferten normale Werte. Sie spähte durch die nachtschwarzen Fenster der Brücke. Schließlich griff sie sich ein Nachtsichtgerät, drückte die schwere, wasserdichte Tür mit der Schulter auf und trat auf die Brückennock hinaus in die feuchte tropische Hitze und den ohrenbetäubenden Lärm der Generatoren.
Der Dieselrauch wurde vom Südwestmonsun verweht. Die schwere See hob das Heck des Bootes empor und tauchte den Bug fast bis zum Vorderdeck ins Wasser. Die feuchte Hitze trieb ihr binnen Sekunden den Schweiß aus den Poren.
Ihr Nachtsichtgerät war ein achtzehnhundert Dollar teures Geburtstagsgeschenk, das sie sich selbst gemacht hatte, um kleine Boote und andere Hindernisse rechtzeitig erkennen zu können. Es lieferte zwar keine Vergrößerung, durchdrang die Dunkelheit jedoch wunderbar. Sie suchte die See ab, doch nichts als Schaumkronen auf der dunklen Meeresoberfläche. Wahrscheinlich doch nur ein Fass. Sie kehrte in das angenehm klimatisierte Innere zurück. Der rote Lichtschein der Instrumente spiegelte sich in Flannigans aufforderndem Lächeln.
»Das kannst du vergessen«, ermahnte sie ihn.
»Ich will dir doch nur meine Dankbarkeit zeigen.«
»In vier Stunden kannst du das bei den Damen in den Massagesalons von Porto Clarence erledigen.«
Inzwischen hatten vor allem osteuropäische und chinesische Kreuzfahrtschiffe die Hauptstadt der Insel für sich entdeckt. Die Armut des Landes, ein Diktator, der dringend auf ausländisches Geld angewiesen war, und die legendäre Schönheit der Einwohner mit ihren westafrikanischen und portugiesischen Wurzeln ließen den Sextourismus in der alten kolonialen Hafenstadt boomen.
Terry schritt im Ruderhaus auf und ab. »Ich bin schon länger als Arzt unterwegs und weiß, wann es besser ist, den Schnabel zu halten. Aber eine solche Geheimniskrämerei wie auf dieser Fahrt hab ich noch nie erlebt.«
»Lass das Gerede.«
»Ihr habt die ganze Woche Hydrophone und Airguns hinter euch hergezogen. Wann wurde dein Kahn das letzte Mal zu einer solchen Erkundungsmission eingesetzt?«
»Letzten Monat.« Janet Hatfield ärgerte sich über sich selbst, kaum dass sie es verraten hatte.
Terry lachte. »Der Fluch des Käpt’ns. Du liebst dein Schiff einfach zu sehr, um ein Geheimnis für dich zu behalten. Dann ist es also nicht das erste Mal? Hör mal, das ist doch kein Ölsuchschiff. Was geht da vor sich?«
»Vergiss, was ich grade gesagt hab. Okay, es ist ein bisschen ungewöhnlich, na und? Wenn mich die Firma mal zur Vizepräsidentin ernennt, werd ich fragen, was wir hier genau gemacht haben. Aber bis dahin konzentriere ich mich nur auf mein Schiff. Und jetzt halt den Mund. Herrgott, ich hätte dich in Nigeria lassen sollen.«
»Dann wär ich jetzt tot.«
»Da hast du recht.« Es war extrem gefährlich heutzutage im Niger-Delta. Immer wieder wurden Bohrarbeiter von irgendwelchen Milizen verschleppt, betrunkene Soldaten feuerten auf ihre eigenen Checkpoints, und Fanatiker trieben im Namen von Jesus und Mohammed ihr Unwesen. Doch der Arzt und passionierte Frauenheld Terry Flannigan wäre um ein Haar auf die altmodische Weise ums Leben gekommen: durch einen eifersüchtigen Ehemann mit einer Machete– einen reichen Stammesführer mit ausreichenden politischen Verbindungen, um ungestraft jemanden in Stücke hacken zu können, der sich an seiner Frau vergriffen hatte.
»Janet, warum ist aus uns eigentlich nichts geworden?«, fragte Terry mit einem sehnsuchtsvollen Lächeln.
»Unsere Beziehung ist an ihrem fehlenden Gewicht zerbrochen.«
Er war ein besserer Freund als Geliebter. Für eine Beziehung war er einfach zu flatterhaft und unzuverlässig. Dafür war Terry Flannigan ein umso treuerer Freund, der für einen Kumpel das letzte Hemd hergab. Und deshalb hatte Janet Hatfield auch nicht gezögert, ihn an Bord zu nehmen, bevor ihn der wütende Ehemann umbringen konnte. Seit zehn Tagen hielt sie ihn vor der Mannschaft versteckt und gewährte ihm nur Freigang, wenn sie selbst die Wache innehatte.
Die Brücke und ihre Kabine befanden sich ganz oben im Deckshaus. Darunter lagen die Mannschaftskajüten, Messe und Kombüse sowie der Aufenthaltsraum, den die Petrologen zu ihrer Computer- und Kommunikationszentrale umfunktioniert hatten. Die Wissenschaftler ließen niemanden von der Mannschaft herein; sie hatten darauf bestanden, dass sogar Kapitänin Hatfield erst um Erlaubnis fragen musste, wenn sie die Sperrzone betreten wollte. Janet hatte geantwortet, sie werde sich ohnehin von dem Raum fernhalten, außer im Brandfall, und dann würde sie sicher nicht vorher anklopfen.
»Weißt du, was die Petrologen hier machen?«
Terry blickte durch das Fenster auf das dreißig Meter lange Frachtdeck hinaus, das heute leer war, bis auf die Winsch, den Deckskran und die Ankerwinden.
»Geh weg von den Fenstern, bevor sie dich noch sehen.«
»Sie werfen irgendwas über Bord.«
»Was die tun, ist ihre Sache.«
»Einer kriecht mit einer Taschenlampe rum… Jetzt hat er etwas ins Wasser fallen lassen.«
»Was werfen sie denn über Bord?«, fragte sie, nun doch neugierig.
»Computer.«
Unter Deck zogen freudestrahlende Petrologen ihre schweißnassen Hemden aus und vollführten Freudentänze in dem nun leeren Computerraum. Zehn Tage hatten sie rund um die Uhr gearbeitet, auf einem Schiff, das den Besitz von Alkohol oder Drogen unter strengste Strafen stellte: Schon eine Flasche Bier hätte ausgereicht, um nie wieder im Ölgeschäft arbeiten zu dürfen. Nun fuhren sie einer wohlverdienten Party in den Bordellen von Porto Clarence entgegen, nachdem sie mit Hilfe von 3-D-Seismik die interessantesten Messwerte erhalten und ausgewertet hatten, die es gegenwärtig auf dem Planeten gab.
Die Datenerfassung war abgeschlossen und das seismische Modell für den Klienten entwickelt. Die Ölvorkommen überstiegen alle Erwartungen. Der Klient hatte den Erhalt des verschlüsselten Materials bestätigt und ihnen die Anweisung gegeben, alle Computer ins Meer zu werfen. Jeden Laptop, jeden PC, sogar die fünfzigtausend Dollar teure Workstation zur seismischen Modellierung, die sie zu zweit hatten über Bord hieven müssen. Auch die Monitore mussten weg, damit niemand fragte, wozu sie gedient hatten, ebenso die Hydrophone und Airguns sowie der Satellitensender.
In wenigen Stunden würden die Petrologen die Entdeckung eines gigantischen Ölvorkommens feiern: viele Milliarden Barrel Erdöl und viele Billionen Kubikmeter Erdgas, die Île de Forée zu einem westafrikanischen Saudi-Arabien machen würden.
»Hey, Janet. Wie viele Dinosaurier mussten eigentlich für so eine Erdöllagerstätte sterben?«
»Algen. Nicht Dinosaurier.«
Terry Flannigan blickte in die Dunkelheit hinaus. Bei dem großen Geheimnis konnte es sich eigentlich nur um Erdöl handeln. Das Meer war zwar hier einige Kilometer tief, doch erdgeschichtlich betrachtet stellte der Meeresgrund die Fortsetzung der afrikanischen Küste dar. Über Hunderttausende Jahre hinweg hatte der Niger-Fluss Sedimente in den Atlantischen Ozean transportiert. Gleichzeitig wurden abgestorbene Meeresorganismen auf dem Grund abgelagert und von immer neuem Material überdeckt. In diesen Sedimentschichten kamen unter hohem Druck und hoher Temperatur jene Prozesse in Gang, die zur Entstehung von Erdöl führten.
»Und was ist aus den Dinosauriern entstanden? Kohle?«
»Kohle ist aus Bäumen entstanden«, antwortete Janet Hatfield geistesabwesend, die Augen auf den Radarschirm gerichtet. Sie schaltete die starken Anlegelichter ein. Augenblicklich wurde die Meeresoberfläche im Umkreis von hundert Metern um das Offshore-Serviceschiff erhellt. »Oh, Scheiße!«
»Was ist?«
Ein gut fünf Meter langes Festrumpfschlauchboot mit einem starken Mercury-Außenbordmotor tauchte aus der Dunkelheit auf, gespickt mit Sturmgewehren und Raketenwerfern. Janet Hartfield reagierte blitzschnell, übernahm das Steuer und setzte den Autopiloten außer Kraft. Das Schlauchboot hatte Mühe in der schweren See. Vielleicht konnte sie die Kerle abhängen. Sie änderte den Kurs, rammte den Fahrthebel ganz nach vorn und riss das Funkmikrofon von der Decke.
»Mayday, Mayday. Hier ist die Amber Dawn,Amber Dawn. Ein Grad, neunzehn Minuten Nord, sieben Grad, dreiundvierzig Minuten Ost.«
»Ein Grad, neunzehn Minuten Nord. Sieben, dreiundvierzig Ost. Ein Grad, neunzehn Minuten Nord«, wiederholte sie ihre Position, »sieben Grad, dreiundvierzig Minuten Ost.« Sie konnte keine Hilfe erwarten, wenn man sie nicht fand.
»Piratenangriff auf Amber Dawn. Piratenangriff auf Amber Dawn. Ein Grad, neunzehn Minuten Nord. Sieben Grad, dreiundvierzig Minuten Ost.«
Es gab keine Garantie, dass es irgendjemand hörte. Doch der 406-MHz-EPIRB-Seenotrettungssender draußen auf der Brückennock würde ihre Position weiter durchgeben, auch wenn sie sinken sollten. Sie eilte hinaus, um ihn einzuschalten.
Das Schlauchboot war bereits so nah, dass sie acht Soldaten in Tarnanzügen erkennen konnte. »Dschungeltarnanzüge auf einem Boot?«
Sie müssen von der Île de Forée kommen, dachte sie. Jede andere Küste wäre für das kleine Boot außer Reichweite gewesen. Wenn es keine Regierungstruppen waren, dann musste es sich entweder um Piraten oder um Kämpfer der aufständischen Milizen handeln. Aber was wollten sie? Das einzig Wertvolle auf einem Offshore-Hilfsschiff war die Mannschaft. Es kam immer wieder vor, dass Geiseln genommen und Lösegeld gefordert wurde. Das hieße, sie würden ihre Leute nicht töten. Zumindest nicht sofort.
Mündungsfeuer erleuchtete das Schlauchboot wie einen Christbaum, und die Fenster der Amber Dawn zersplitterten. Janet Hatfield spürte einen jähen Schmerz im Bauch. Es riss ihr die Beine weg, und sie fiel in Terrys Arme. Fast hätte sie gelacht und gesagt: »Du gibst nicht auf, was?«, doch die Angst ließ sie verstummen.
Ein Ladenetz mit Enterhaken wurde auf die Amber Dawn geworfen, wo es sich auf dem Deck verkeilte. Sieben FFM-Rebellen kletterten mit ihren Sturmgewehren an Bord. Nur ein Mann blieb mit den Raketenwerfern im Schlauchboot. Die schlanken, athletischen Kämpfer mit harten Gesichtern von der typischen Milchkaffeefarbe der Einwohner der Île de Forée nahmen ihre Befehle von einem breitschultrigen südafrikanischen Söldner namens Hadrian van Pelt entgegen.
Van Pelt warf einen Blick auf die Mannschaftsliste der Amber Dawn.
Er schickte zwei Mann zum Maschinenraum. Die Feuerstöße von automatischen Gewehren hallten von unten herauf, und die Generatoren verstummten, bis auf einen, der die Lichter mit Strom versorgte. Die Männer blieben unten und öffneten die Seeventile. Meerwasser strömte herein.
Zwei andere traten die Tür zu dem behelfsmäßigen Computerraum auf. Van Pelt folgte ihnen mit der Liste der Crew. »Alle an die Wand!«
Die Petrologen, die eben noch ihre Hemden ausgezogen und gefeiert hatten, stellten sich zu Tode erschrocken an die Wand und tauschten ungläubige Blicke aus.
Van Pelt zählte sie ab. »Fünf!«, rief er. »Wer fehlt?«
Die Augen der Wissenschaftler sprangen zu einem Wandschrank. Van Pelt nickte einem seiner Männer zu, der die Schranktür mit einem kurzen Feuerstoß zerfetzte. Die Leiche des versteckten Mannes fiel heraus. Van Pelt nickte erneut, und seine Männer exekutierten auch die anderen.
Gewehrschüsse aus den Quartieren über ihnen kündeten vom Ende der philippinischen Schiffsmannschaft. Elf waren erledigt. Blieb nur noch die Kapitänin. Van Pelt zog seine Pistole und stieg die Treppe zur Brücke hinauf. Die Stahltür war verschlossen. Er gab einem Soldaten ein Signal, der sogleich mit einem Klebeband eine Ladung Plastiksprengstoff an der Tür anbrachte. Sie gingen auf der Treppe in Deckung und hielten sich die Ohren zu. Der Sprengsatz riss die Tür mit einem lauten Knall auf, und van Pelt stürmte hinein.
Zur Überraschung des Söldners war die Kapitänin nicht allein. Sie lag am Boden, eine hübsche Blondine mit blutdurchtränkter Hose und Bluse. Ein Mann kniete bei ihr und kümmerte sich ruhig und entschlossen um sie; er verfügte als Arzt offenbar über einige Felderfahrung.
Van Pelt hob seine Pistole. »Sind Sie Arzt?«
Terry Flannigan hielt den Tod in seinen Händen, und als er von Janets blutenden Wunden aufblickte, blickte er dem Tod ins Gesicht.
»Was für ein Arzt?«, fragte der Bewaffnete.
»Unfallchirurg, du Arschloch. Wonach sieht’s denn aus?«
»Komm mit.«
»Ich kann sie nicht allein lassen. Sie liegt im Sterben.«
Van Pelt trat näher und schoss Janet Hatfield in den Kopf. »Nicht mehr. Steig ins Boot.«
2
221 West 46th Street
Paul Janson stieg die steile Treppe zu Sofia’s Club Cache im Keller des Hotel Edison hinunter. Die lockige brünette Schönheit kassierte die fünfzehn Dollar Eintrittsgeld mit einem strahlenden Lächeln. Sie sah ihn so, wie er gesehen werden wollte: ein Geschäftsreisender, der mit dem heißen Jazz von Vince Giordano und seinen berühmten Nighthawks ein bisschen Leben in seinen einsamen Montagabend bringen wollte. Sein marineblauer Anzug war so geschnitten, dass er seine muskulöse Statur verbarg, und wirkte weder besonders elegant noch teuer. Die Falten auf seiner Stirn zeigten, dass er nicht mehr in den Dreißigern war, obwohl sein Alter schwer zu schätzen war. Die Narben konnten vom Sport in der Collegezeit stammen.
Janson nahm das Wechselgeld mit einem höflichen Lächeln entgegen und bemerkte, wie wahrscheinlich viele andere Besucher: »Tolle Stimmung hier.«
Am anderen Ende des großen niedrigen Raums lieferte die elfköpfige, in Smokings herausgeputzte Band mit Saxofonen, Klarinetten, Trompeten, Posaune, Banjo, Klavier, Schlagzeug und Kontrabass eine sprühende Darbietung von »Shake That Thing«. An die hundert Leute aßen und tranken an ihren Tischen. Etwa ein Dutzend Paare tanzte zur Musik, einige durchaus gekonnt. Die Tänzer über dreißig trugen Kleider und Anzüge, die zur Hot-Jazz-Ära passten. Die Jüngeren bevorzugten T-Shirts und Cargohosen.
Eine der jüngeren Tänzerinnen, eine attraktive Frau mit markanten, regelmäßigen Gesichtszügen, hohen Backenknochen, vollen Lippen und brauner Igelfrisur tanzte in Höchsttempo einen Onestepp aus den Zwanzigerjahren mit der Dynamik und Präzision einer Laserschneidmaschine. Janson konnte sich ein anerkennendes Lächeln nicht verkneifen. Jessica Kincaids Motto war stets: »Mach Tempo, bis es wehtut, und dann leg noch mal einen Zahn zu.«
Jessica warf Janson einen kurzen Blick zu, in dem Faszination und eine Spur Neid lagen. Paul Janson war der Meister des Unscheinbaren, und das machte sie manchmal verrückt. Sie arbeitete hart daran, sich die Fähigkeiten eines Chamäleons anzueignen. Mit entsprechender Kleidung, Frisur, Schmuck und Make-up konnte sie, je nach Bedarf, wie fünfundzwanzig oder fünfunddreißig aussehen und als Videokünstlerin aus Brooklyn ebenso auftreten wie als Barkeeperin einer kleinen Spelunke oder als Bankerin. Doch nie schaffte sie es, völlig unscheinbar zu wirken, und wenn sie es versuchte, lachte Janson bloß und erklärte ihr, »unscheinbar« und »interessant« schlössen sich für gewöhnlich aus.
Er selbst hingegen war einfach nur da. Er konnte sich mitten in der Menge verstecken. Wenn er wollte, konnte er einen Raum mit seiner Präsenz beherrschen, doch meistens trat er ein, ohne dass jemand Notiz von ihm nahm– so wie diesmal–, und genauso unbemerkt pflegte er auch zu verschwinden. Mit einem ganz eigenen Trick veränderte er seine Haltung so, dass er nur noch mittelgroß wirkte. Sie schaute erneut zu ihm hinüber. Diesmal erwiderte er ihren Blick, drehte sich um und ging zur Treppe.
»Ich muss weg«, teilte sie ihrem Tanzlehrer mit. Die Pflicht rief.
Das Town Car unterschied sich in nichts von den vielen schwarzen Miettaxis der Stadt. Doch der Junge am Lenkrad hatte früher im Irak Truppentransportpanzer gefahren, und die Innenbeleuchtung ging nicht an, als Jessica die Tür öffnete.
»Wohin fahren wir?«, fragte sie Janson, dessen Umrisse im Dunkeln kaum zu erkennen waren.
»Zuerst nach Houston, Texas. In die Zentrale der American Synergy Corporation.«
»Die größte Ölfirma des Landes. Hat besonders nach dem BP-Desaster im Golf von Mexiko gute Geschäfte gemacht. Und danach?«
»Möglicherweise nach Westafrika. Falls wir den Job übernehmen. Wenn nicht, dann nach Hause. Wahrscheinlich werden wir’s nicht tun.«
»Warum fahren wir dann überhaupt hin?«
»Der Sicherheitsdirektor von ASC ist ein alter Freund von mir.«
Jessica Kincaid nickte im Dunkeln. Janson hatte viele alte Freunde, und wenn ihn einer rief, dann kam er. Er reichte ihr ein dickes Handtuch. »Erkälte dich nicht.« Sie war schweißnass von ihrem schwindelerregenden Tanz und zitterte ein wenig.
»Willste damit sagen, ich stinke?« Jessie sprach zwar mehrere Sprachen fließend und besaß die wertvolle Gabe, Akzente nachzuahmen, doch den näselnden Dialekt aus den Hügeln von Kentucky, ihrer Heimat, hörte man stets leicht heraus, vor allem wenn sie mit Janson allein war.
»Dafür haben wir ja eine Dusche im Flugzeug.«
Der Fahrer erwischte eine grüne Welle auf der Madison Avenue, wechselte auf den Major Deegan Expressway und schließlich auf den Hutchinson River Parkway. Der Verkehr war nur noch schwach zu dieser späten Abendstunde. Vierzig Minuten, nachdem sie das Kellerlokal verlassen hatten, erreichten sie den Westchester Airport und fuhren am Passagier-Terminal vorbei zu einem Bereich, der von einem Maschendrahtzaun umgeben war. Am Tor bat eine Stimme über die Sprechanlage um ihre Identifizierung.
»Kennzeichen acht-zwo-zwo Romeo Echo«, antwortete der Fahrer und passierte das aufgleitende Tor. Ein Wächter öffnete ihnen ein zweites Tor, das zum Rollfeld führte, einer weiten dunklen Fläche mit blauen, gelben und grünen Lichtern zur Markierung der Taxiwege, Start- und Landebahnen. Das Auto hielt neben einem silbernen Embraer Legacy 650 Jet mit zwei mächtigen Rolls-Royce AE 3007 Triebwerken. Die Piloten gingen gerade die Checkliste durch. Janson und Jessie Kincaid stiegen ein, zogen die ausklappbare Treppe ein, die unabhängig vom Zustand der Landebahn jederzeit ein schnelles Aussteigen ermöglichte, und schlossen die Tür.
Embraer hatte den Langstreckenjet, der in seiner Grundausstattung bis zu vierzehn Passagiere aufnehmen konnte, an Jansons Vorstellungen angepasst, um zwei bis drei Personen bestmöglich versorgt zu ihrem Einsatzort irgendwo auf der Welt zu befördern. Die Bordküche gleich hinter dem Cockpit war erweitert worden, und die Toilette hatte man zusammen mit dem hintersten der drei Sitzbereiche zu einer Umkleidekabine samt Badezimmer umgestaltet. Die vorderen Sitze waren zugunsten eines Arbeits- und Essbereichs entfernt worden, der mittlere Sitzbereich war mit Klappbetten für Langstreckenflüge ausgestattet.
Auf ihrer Flughöhe von einundvierzigtausend Fuß meldete der Pilot: »New York Center, Embraer zwo-zwo Romeo auf Flughöhe vier-eins-null«, als Jessica, in einen Morgenmantel gehüllt, aus der Dusche kam. Janson blickte von seinem grünen Ledersitz auf, in dem er gerade ein Dossier über die American Synergy Corporation studierte. Ein Laptop stand auf einem Tisch neben ihm, mit einem Glas Wasser in Reichweite.
Ein identisches Dossier samt Laptop wartete neben Jessies rotem Ledersitz, dazu ein Glas Wasser und Elektrolyttabletten.
Janson sah sie über den Rand seiner Lesebrille hinweg an. »Wenn wir den Duft einer frisch geduschten Frau konservieren und in Flaschen abfüllen könnten, wären wir reich.«
»Manche halten uns sowieso für reich.« Sie berührte einen Fingerprint-Reader, öffnete ein Gepäckfach über ihr und nahm ihr Knight’s M110 Scharfschützengewehr heraus. Obwohl die Waffe bestens gepflegt war, nahm sie die Einzelteile auseinander und legte sie auf den Klapptisch der Bordküche, reinigte und ölte sie sorgfältig, checkte sie auf eventuelle Abnutzung und setzte alles wieder zusammen. Janson verglich ihr Ritual mit dem gewissenhaften Reinigen einer ohnehin sauberen Katze, bevor sie auf die Jagd ging.
Jessica hätte ihre Tag- und Nacht-Zielfernrohre, das Zweibein und den Laserentfernungsmesser am liebsten genauso gründlich inspiziert, doch das Dossier musste ebenfalls noch gelesen werden.
»Kann ich eins von deinen Hemden aufmachen?«
»Klar«, antwortete er, ohne aufzublicken.
Aus einer eingebauten Kommode nahm sie ein frisch gebügeltes blassblaues Anzughemd, zog das Stück Pappe heraus und legte das Hemd zurück. Sie ließ sich in ihren Ledersitz sinken, setzte einen Noise-Cancelling-Kopfhörer auf, um sich besser konzentrieren zu können, und schlug das Dossier über die American Synergy Corporation auf. Sie hielt das Stück Pappe über die oberste Zeile und wanderte langsam nach unten, während sie jede gelesene Zeile zudeckte. Tat sie das nicht, sprangen ihre Augen immer wieder zurück, aus Angst, sie könnte sich verlesen haben.
»Leichte Legasthenie«, hatte sie Paul Janson erklärt, als sie zum ersten Mal mit ihm darüber sprach. »Obwohl sie’s in Red Creek nicht so genannt haben. Da dachten sie, ich wär einfach ein bisschen langsamer. Hat mir aber nicht viel ausgemacht«, fügte sie rasch hinzu. »Dafür hab ich besser geschossen als alle Jungs und die Autos in der Werkstatt meines Daddys repariert.«
Auf den Trick mit dem Stück Pappe war sie gekommen, während sie sich durch die Vorbereitungskurse für die Aufnahme zum FBI gekämpft hatte, ihr erster Schritt auf der Leiter, die sie schließlich zu Cons Ops führen sollte.
Sie las den Bericht über ASC von vorn bis hinten durch. Wenn sie irgendein Detail auf ihrem Laptop überprüfte, klickte sie den Cursor ans untere Ende der Seite und scrollte dann nach unten, um zu verbergen, was sie bereits gelesen hatte. Sie wusste, dass sie allmählich zu müde zum Lesen wurde, als sich ein b auf den Kopf stellte und zum p wurde.
Stattdessen sah sie sich ein Blue-ray-Video an: American Synergy Corporation– New Energy for a New Tomorrow.
Paul hatte sich in seinem Sitz zurückgelehnt und war eingeschlafen. Sie drückte einen Knopf, um ihre eigene Rückenlehne nach hinten zu klappen, und hörte sich eine Rede von Kingsman Helms, dem Direktor der Erdölabteilung von ASC, an die Aktionäre an. Ein gutaussehender Mann, der sich gewandt auszudrücken verstand. Er erinnerte Jessica an einen evangelikalen Prediger.
»Es geht nicht darum, wie wir uns besser darstellen– wir müssen besser werden! Langfristiges Wachstum bedeutet langfristiges Überleben. Öl ist einer der Energielieferanten in unserem Sortiment, neben Wind- und Solarenergie, Biomasse, Kernenergie und Kohle. Unsere Mission ist es, sichere, umweltfreundliche und billige Energie zu produzieren, und das nicht nur heute, sondern auch noch in zwanzig Jahren.
In letzter Zeit ist einiges schiefgelaufen.« Helms stockte und blickte direkt in die Kamera, mit einem Ausdruck, der den Zuschauer sofort verstehen ließ, was er meinte: Fehlentwicklungen der Wall Street, übermäßige Einmischung der Regierung und Ölkatastrophen durch schlechtes Management bei anderen Firmen. »Die Amerikaner zählen mehr denn je auf uns. ASC wird sie nicht im Stich lassen, denn wir wissen, dass es nicht darum geht, heute erfolgreich zu sein, sondern Wege in eine erfolgreiche Zukunft aufzuzeigen.«
Die Rechercheabteilung von CatsPaw hatte an die DVD einen Zusatz angefügt: »Was die erneuerbare Energie betrifft, so verzichtet die Firma vollständig auf Biomasse, die laut einem geheimen Papier lediglich von den Farmstaaten gepusht werde. ASC investiert gerade genug in erneuerbare Energie, um sich einen grünen Anstrich zu geben, während man in Wahrheit massiv in den Kohlebergbau in den Appalachen investiert.« Jessie Kincaid wusste, was das bedeutete: Ganze Bergkuppen wurden weggesprengt, um an die Kohle zu gelangen. Die größte Herausforderung für ASC stellte gegenwärtig der Wettlauf um neue Bodenressourcen im Ausland dar, wo man sich mit der China National Offshore Oil Corporation einen mächtigen Konkurrenten eingehandelt hatte. »Kurz gesagt«, schloss der Bericht der Rechercheabteilung, »ASC kann sich im globalen Wettlauf um neue Fördergebiete nur schwer gegen China behaupten. Um auch noch in zwanzig Jahren erfolgreich zu sein, wird die ASC ihre Ziele mit allen Mitteln zu erreichen versuchen.«
Die Embraer landete um drei Uhr nachts auf dem William P. Hobby Airport in Houston. Jansons Piloten rollten die Maschine zum privaten Million Air Terminal und weckten ihre Chefs um sechs Uhr morgens, nachdem einer der beiden das Frühstück zubereitet hatte. »Weißt du, Mike«, sagte Janson, während er seine Krawatte knüpfte. »Meine größte Sorge ist, dass du irgendwann die Fliegerei aufgibst und ein Restaurant aufmachst.«
»Der Wagen kommt in zwei Minuten«, meldete Jessica, als sie im Seersucker-Rock und dazu passender Jacke aus der Umkleidekabine kam. Ihr Haar trug sie jetzt in einem glatten Bubikopf, der ihre hohe Stirn betonte. Ihr neues Styling unterstrich sie mit einem forschen Auftreten.
Der Million-Air-Wagen brachte sie zum Hilton Americas Houston Hotel. Sie schritten durch die Marmor-Rotunde, durchquerten die Lobby und mischten sich unter die Menge der Geschäftsleute, die vom Frühstückssaal zum angrenzenden Brown Convention Center eilten. Doch als Janson und Jessie Kincaid aus dem Verbindungskorridor hervortraten, umgingen sie den Empfangstisch und verließen das Haus, um sich ein Taxi zu nehmen.
Die Zentrale der American Synergy Corporation befand sich in einem runden dreißigstöckigen Gebäude, das etwas zurückgesetzt am Sam Houston Tollway stand wie ein riesiger bronzefarbener Silo. Entlang der Auffahrt, beim Haupteingang und in der Lobby waren zahllose Überwachungskameras angebracht. Die Sicherheitsleute überprüften die Besucher mit Metalldetektoren und waren ebenso bewaffnet wie die Mitarbeiter am Empfangstisch, die ihre Waffen jedoch nicht offen zeigten.
»Paul Janson und Jessica Kincaid, wir haben einen Termin bei Douglas Case.«
Ihre Besucherplaketten lagen schon bereit.
Sie fuhren in einem privaten Aufzug zur Chefetage im neunundzwanzigsten Stock hinauf. Durch die Fenster blickte man auf tiefstehenden Smog hinunter, den die glühende Sonne orange verfärbte. Das flüsterleise Summen eines Elektrorollstuhls wurde von einem freudigen Ausruf übertönt: »Paul!«
Janson trat dem sondergefertigten sechsrädrigen Rollstuhl entgegen und hielt dem Mann die Hand hin: »Hallo, Doug. Wie geht’s dir?«
»Großartig. Wunderbar.«
Sie schüttelten sich die Hand und musterten einander einen langen Moment. Zwei gutgekleidete weiße Typen im mittleren Alter, dachte Jessie Kincaid. Doug Case trug einen Viertausend-Dollar-Anzug und ein weißes Hemd mit schimmernder gelber Krawatte. Er war glattrasiert, und seine Frisur war die teure Version eines militärischen Bürstenschnitts. Man sah ihm an, dass er sich– so wie Paul– früher in raueren Gefilden bewegt hatte und kein glatter Businesstyp war.
»Danke, dass du so schnell gekommen bist.«
»Ist mir ein Vergnügen. Das ist meine Partnerin Jessica Kincaid.«
Doug Cases Hand besaß die biegsame Festigkeit von laminiertem Kevlar. Er musterte sie mit seinem durchdringenden Blick und rief Janson über die Schulter zu: »Was weiß sie?«
»Über uns?«, fragte Janson und blickte sich auf dem Flur um. Ihm war nicht wohl dabei, schon hier draußen zur Sache zu kommen, auch wenn im Moment niemand zu sehen war. »Dass wir Special Forces waren. Und dass es dich schwerer erwischt hat als mich.«
»Was ist mit Ihnen, Jessica? Woher kommen Sie?«
»Über sie brauchst du nichts zu wissen«, wandte Janson freundlich, aber bestimmt ein.
»Haben Sie gewusst, Jessica«, sagte Case, »dass mein ehemaliger, und Ihr jetziger ›Partner‹ von seinen Kollegen ›die Maschine‹ genannt wurde?«
»Kein Kommentar«, gab Jessie lächelnd zurück.
»Die Maschine war der Beste von allen. Haben Sie das vielleicht gehört?«
»Lass das, Doug. Das gehört nicht hierher.«
»Okay, wir stehen ja alle nicht mehr dort, wo wir einmal waren, nicht wahr? Heute beschränken sich meine Heldentaten darauf, unsere SCADA-Systeme im Auge zu behalten.«
Er sah Jessica herausfordernd an, doch sie lächelte nur und schwieg. »Supervisory Control and Data Acquisition ist zunehmend Cyberangriffen ausgesetzt, weil die Firmen von sicheren privaten Netzwerken zu Internetnetzwerken wechseln, um Kosten zu sparen.«
»Aber das ist nicht der Grund, warum du uns sprechen wolltest, Doug«, wandte Janson ein.
»Stimmt. Gehen wir in mein Büro.«
Sie folgten Doug Cases Rollstuhl über einen Flur, der von geschlossenen Türen gesäumt war.
»Wie war der Flug?«
»Pünktlich.«
In Doug Cases Empfangsbüro saß eine elegant gekleidete Frau mittleren Alters, die er ihnen als Kate vorstellte, zusammen mit zwei höflich lächelnden jungen Assistentinnen. Sein Privatbüro ging nach Süden. »An klaren Tagen sieht man den Golf von Mexiko.«
»Im Moment«, erwiderte Janson, »würdest du wahrscheinlich lieber den Golf von Guinea sehen.«
»Wie kommst du auf die Idee?«
»Wie geht es ASC im Moment?«
»Großartig. Unsere Sicherheitsstandards sind exzellent. Wir bauen keinen Mist bei der Förderung und haben die Kosten gut unter Kontrolle, deshalb erzielen wir einen größeren Gewinn pro Fass Rohöl als alle anderen. Außerdem haben wir unbeirrt weitergemacht, als alle anderen anfingen, nur noch wie verrückt nach Alternativen zu suchen.«
»Aber mit euren Ölreserven sieht es auch nicht mehr so toll aus. Die einzige Chance, sie wieder aufzufüllen, ist Westafrika. Cullen hat vor der Elfenbeinküste einen Haupttreffer gelandet, und ihr hofft wahrscheinlich auf das Gleiche, bevor die Chinesen euch die Beute wegschnappen. Euer Problem ist der Golf von Guinea.«
»Du hast deine Hausaufgaben gemacht, Paul. Wie immer. Trotzdem hat diese Sache nichts mit Ölreserven zu tun.«
»Was gibt’s denn dann für ein Problem?«
»Du hast vielleicht gehört, dass wir vorige Woche ein Offshore-Serviceschiff verloren haben.«
»Ich hab einen Bericht über ein solches Schiff gesehen, das mit der Mannschaft im Golf von Guinea gesunken ist. Ich wusste nicht, dass es American Synergy gehört hat.«
»Wir haben rausgekriegt, dass das Schiff von Rebellen des Free Forée Movement angegriffen wurde.«
»Warum?«
»Sie haben die Mannschaft ermordet.«
»Warum?«
»Wer zum Teufel weiß das schon? Das Problem ist, diese Wahnsinnigen haben einen unserer Leute geschnappt. Wir müssen ihn befreien. Dafür brauchen wir dich.«
»Das wird nicht leicht, wenn die Rebellen euren Mann in ihr Lager auf dem Pico Clarence verschleppt haben«, meinte Janson.
»Genau dort halten sie ihn fest, oben auf dem Berg.«
»Zurück zu meiner Frage: Warum? Es gibt doch keinen Sinn, dass die Rebellen einfach so eure Mannschaft ermorden. Die Rebellenbewegung gewinnt den Krieg doch sowieso. ›Präsident auf Lebenszeit‹ Iboga ist im ganzen Land verhasst.«
»Es kommt bei den Leuten nicht so gut an, wenn einer Hoden und Hirn seiner politischen Rivalen verspeist«, pflichtete Case ihm bei. »Nicht mal in Afrika.«
»Iboga wird sich nicht mehr lang an der Macht halten«, meinte Janson.
»Präsident auf Lebenszeit« Iboga hatte die Wirtschaft von Île de Forée ruiniert, das sich mit Unterstützung der nigerianischen Armee von Äquatorialguinea abgespalten hatte. Iboga, ein ehemaliger Oppositionsführer und Kämpfer im Angolakrieg, war durch einen Putsch an die Macht gekommen. Er gab sich den Namen Iboga nach der tropischen Pflanze, die als rituelle Droge verwendet wurde, verteilte die Kaffee- und Kakaoplantagen unter seinen korrupten Freunden und ließ die antiquierte Ölförder-Infrastruktur verkommen.
»Soweit ich weiß, beziehen die Rebellen ihre Waffen von angolanischen und südafrikanischen Waffenschmugglern. Ibogas Hubschrauber lassen sich jedenfalls nicht mehr beim Pico Clarence blicken. Es ist den Rebellen sogar gelungen, ihren Anführer aus dem berüchtigten Black Sand Gefängnis zu befreien. Umso weniger verstehe ich, warum sie eure Leute ermorden sollten. Ferdinand Poe ist ein Hoffnungsträger für die Demokratiebestrebungen im Land. Warum sollten Poes Kämpfer ihre gerechtfertigte Erhebung gefährden, indem sie Unschuldige abschlachten? Er kann es sich nicht leisten, Staaten vor den Kopf zu stoßen, die seine Regierung als rechtmäßig anerkennen sollen.«
»Gute Frage«, räumte Case ein. »Aber wie gesagt, wer kann das wissen? Vielleicht ein Missverständnis, wie es im Krieg schon mal vorkommt. Oder Rache? Es war ein langer, erbitterter Kampf, von beiden Seiten mit großer Brutalität geführt.«
»Haben sie Lösegeld verlangt?«, fragte Jessie Kincaid.
»Nein. Unser Mann ist Arzt. Könnte sein, dass sie einen Arzt für Ferdinand Poe gebraucht haben. Man kann sich ja denken, was sie im Gefängnis mit ihm angestellt haben.«
»Aber woher wissen Sie dann, dass einer Ihrer Leute entführt wurde?«, hakte Jessica nach. »Das Schiff wurde versenkt, die Mannschaft getötet, und Lösegeld haben die Entführer auch nicht gefordert.«
»Raten Sie mal«, erwiderte Case.
»Raten?« Sie warf Janson einen Blick zu. Was soll der Blödsinn?
Janson hatte bereits bemerkt, dass Jessie und Doug einander nicht leiden konnten, und antwortete besänftigend: »Ich nehme mal an, dass Doug außer seinen SCADA-Heldentaten auch noch ein bisschen Zeit findet, um Kontakte zu afrikanischen Waffenhändlern zu pflegen. Seine Firma hat schließlich starke geschäftliche Interessen in der Region, da schadet es nicht, wenn man frühzeitig weiß, wie sich die Dinge entwickeln. Stimmt’s, Doug?«
Douglas Case zwinkerte. »Ein Punkt für die Maschine.« Zu Jessica gewandt, fügte er hinzu: »Die Typen, die den Rebellen die Artillerie liefern, haben sich gedacht, es würde mich interessieren, was da auf dem Pico Clarence vor sich geht.«
»Warum heuern Sie die Waffenschmuggler nicht an, um den Arzt zu befreien?«
Case lachte und zwinkerte Janson erneut zu. »Die jungen Leute stellen sich das so einfach vor.«
»Was?«, versetzte Jessica.
»Sie sind Waffenschmuggler. Sie bringen etwas hinein, nicht heraus. Außerdem würden sie damit ihre besten Kunden verprellen. Falls die Rebellen wirklich gewinnen, wie Paul vermutet, dann hoffen die Schmuggler auf noch bessere Geschäfte in der Zukunft. Jeder dieser Leute will ein großer Waffenhändler werden und noch teureres Gerät an die Freunde in der neuen Regierung verkaufen.«
Ein Handy summte zwischen all den Knöpfen und Reglern auf Cases Armlehne. »Ich hab gesagt, keine Anrufe… Okay, danke.« Er trennte die Verbindung. »Ihr werdet gleich Kingsman Helms kennenlernen, Direktor der Erdölabteilung von ASC.«
»Wir haben das Video gesehen«, warf Jessie Kincaid ein.
Case machte ein angewidertes Gesicht. »Er verkörpert die ganze Arroganz eines großen Unternehmens.« Er imitierte Helms’ Rede. »›Es geht nicht darum, wie wir uns besser darstellen– wir müssen besser werden!‹ Wie wär’s mit dieser Geschichte: Wir versteifen uns so sehr auf Erdöl und Kohle, dass für amerikanisches Erdgas kaum noch Platz bleibt. Doch aus irgendeinem Grund halten die Aktionäre den Hundesohn für ein Genie.«
»Du teilst diese Ansicht anscheinend nicht so ganz«, meinte Janson lächelnd.
»Helms ist die größte Giftschlange in Buddhas Vipernnest.«
»Wer ist Buddha?«, warf Jessica Kincaid ein.
»So nennen wir den Alten.«
»Mit dem ›Alten‹ meinen Sie den Generaldirektor von American Synergy, Bruce Danforth?«
»Genau. Kingsman Helms ist einer der vier Männer und zwei Frauen, die– wenn’s sein müsste– ihre eigene Mutter erwürgen würden, um sich Buddhas Job zu angeln.«
»Gehören Sie auch dazu?«, fragte Jessica.
Case sah sie mit einem kalten Lächeln an. »In der Security-Abteilung kommt man nicht so hoch hinauf.«
»Ihre Abteilung hat Sie grade vorgewarnt, dass Helms vorbeikommt«, schoss Jessie zurück. »Sie sind also gut informiert über die Konkurrenten.«
»Wir von der Security haben eine dienende Rolle, Jessica. Das werden Sie eines Tages verstehen, wenn Sie länger im Geschäft sind. Wir beschützen– wir befehlen nicht.«
Die Tür flog auf. Der großgewachsene, blonde, achtunddreißigjährige Kingsman Helms stürmte herein, ohne anzuklopfen. »Doug, ich hab gehört, Sie haben die Marines gerufen.«
Helms’ durchdringende blaue Augen musterten Jessica Kincaid. »Hallo, Marines.« Er schritt auf Paul Janson zu und streckte ihm die Hand entgegen. »Kingsman Helms. Wer sind Sie?«
Kincaid verkniff sich ein Lächeln, als Janson dem Mann entgegentrat und ihn zwang, abrupt stehenzubleiben. »Paul Janson. CatsPaw Associates.«
»Interessant. Dann schleichen Sie also auf Katzenpfoten durch die Gegend? Als Mäusefänger oder mehr als Spion?«
»Wir bieten einen umfassenden Service an.«
Helms lächelte anerkennend. »Nett.«
»Das ist meine Partnerin Jessica Kincaid.«
»Freut mich, Jessica.« Helms lächelte, doch als er sich Janson zuwandte, war sein Gesichtsausdruck ernst. »Also, für wen arbeiten Sie, Janson?«
»CatsPaw Associates ist unabhängig.«
»Das heißt, sehr klein.«
»Unsere Klienten brauchen jemanden, der beweglich agiert.«
»Ich frage mich«, erwiderte Helms kühl, »ob eine kleine Firma über die Mittel verfügt, um den Job auszuführen.«
Zu Jansons Überraschung mischte sich Doug Case ein. »Das ist nicht Ihre Entscheidung, Kingsman. Für diese Sache bin ich zuständig.«
Helms ignorierte ihn. »Ich kann mir schwer vorstellen, wie zwei Personen– ein Mann im mittleren Alter und eine Frau, nichts für ungut– eine solche militärische Operation durchführen wollen. Unser Mann ist schließlich nur mit militärischen Mitteln zu befreien.«
Douglas Case wirbelte mit seinem Rollstuhl herum, sodass er Kingsman Helms gegenübersaß. Er drückte einen Knopf in der Armlehne, mit dem sich sein Sitz hydraulisch hochfahren ließ, während an der Basis Ausleger auf Rädern ausgefahren wurden, um den erhöhten Schwerpunkt auszubalancieren. Er saß nun Auge in Auge mit dem Direktor der Erdölabteilung, und sein Ton war sarkastisch, als er zu sprechen begann.
»Ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, mit welcher Situation wir es hier zu tun haben. Unser Doktor wird mitten in einem Kriegsgebiet festgehalten, von einer zu allem entschlossenen Rebellenmiliz, umzingelt von der Armee eines rücksichtslosen Diktators. Die ›Mittel‹, von denen Sie in Ihren Zivilistenfantasien träumen, würden einen offenen Krieg auslösen und den Doktor mit Sicherheit das Leben kosten.«
»Ich sage ja nur…«
Case fiel ihm brüsk ins Wort. »Die Île de Forée liegt zweihundertfünfzig Meilen von der Küste entfernt– das eignet sich nicht für großangelegte Aktionen. Schnell und unauffällig: Das ist der einzige Weg, wie es klappen kann. Unser Doc sitzt richtig in der Klemme, und ich kenne keinen, der besser geeignet wäre, ihn da rauszuholen, als Paul Janson. Dafür verbürge ich mich mit meinem Job.«
»Da legt sich jemand mächtig ins Zeug für Sie«, sagte Helms, zu Janson gewandt. »Sieht so aus, als hätten Sie den Job, Paul. Was kostet uns das?«
»Nichts, solange wir Ihren Mann nicht heil zurückbringen. Für Doug machen wir’s zum Familientarif: fünf Millionen Dollar.«
»Das ist eine Menge Geld.«
»Das stimmt«, sagte Janson.
»Also gut! Sie haben Folgendes zu tun: Retten Sie den Doktor um jeden Preis! ASC lässt seine Leute nicht im Stich. Wir sind eine Familie.«
»Wir haben den Job noch nicht angenommen.«
»Was? Was wollen Sie denn noch?«
»Wir müssen mehr über die Umstände wissen. Was hat Ihr Arzt da draußen gemacht?«
»Seinen Job natürlich.«
»Wie heißt der Mann?«, fragte Jessie.
Helms sah Doug Case an, der schließlich antwortete: »Flannigan. Dr. Terrence Flannigan.«
»Was hat Dr. Flannigan auf einem Offshore-Serviceschiff gemacht? Auf so kleinen Schiffen ist normalerweise kein Arzt an Bord. Oder sollte er irgendwohin gebracht werden?«
Wieder sah Helms seinen Sicherheitschef an, so als wären die Aufgaben eines Firmenarztes nicht seine Sache. »Vermutlich wollten sie ihn zu einer Ölplattform bringen, weil sich jemand verletzt hat«, antwortete Case.
»Warum wurde der Verletzte nicht einfach mit dem Hubschrauber an Land gebracht? Das wäre doch das übliche Vorgehen.«
»Gehen Sie der Sache nach, Doug«, sagte Helms zu Case. »Kriegen Sie raus, wohin Dr. Flannigan wollte.« Er wandte sich mit einem zähnefletschenden Lächeln an Janson. »Oder noch besser, Paul, befreien Sie ihn so schnell wie möglich, dann können Sie ihn gleich selbst fragen. Hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Sie auch, Jessica. Ich muss weiter. Ich hoffe, Sie übernehmen den Job«, fügte er hinzu und ging.
»Was sagst du, Paul?«, fragte Doug Case nun fast flehend. Ihm war offenbar sehr daran gelegen, dass Paul die schwere Aufgabe übernahm. Man arbeitete nun einmal lieber mit jemandem zusammen, den man gut kannte.
»Wir sehen uns erst mal an, inwieweit die Operation machbar ist«, antwortete Janson. »In zwölf Stunden sag ich dir Bescheid.«
Jessica war als Erste bei der Tür und hielt sie ihm auf.
»Paul«, rief ihm Doug Case nach, »hast du noch einen Moment? Ich würd gern noch kurz mit dir allein sprechen.«
Janson schloss die Tür und ging zu ihm zurück. »Was gibt’s?«
»Ich weiß es wirklich zu schätzen, was du für uns tust.«
»Ich werd sehen, was sich machen lässt.«
»Ich bin dir was schuldig.«
»Wenn du was schuldig bist, gib’s dem Nächsten zurück.«
»Danke. Werd ich machen. Was ich noch sagen wollte: Ob Helms nun der nächste Generaldirektor wird oder nicht, hat keine Auswirkungen auf diesen Entführungsfall. Buddha wird nicht schon morgen zurücktreten. Also mach dir keine Sorgen wegen Kingsman Helms.«
»Tu ich nicht.«
»Es stimmt, was ich ihm gesagt habe. Ich kenne keinen anderen, der das schaffen könnte, ohne die Firma in einen verdammten Bürgerkrieg reinzuziehen. Wir wollen einfach nur unseren Mann zurückhaben. Und ich brauch wohl nicht zu erwähnen, dass das meine Position hier festigen würde.«
»Wenn ich das Gefühl habe, dass ich’s schaffen kann, übernehm ich den Job.«
»Ist Jessica Kincaid der tolle Scharfschütze, von dem du erzählt hast?«
»Das geht dich nichts an.«
»Ich hoffe einfach nur, du kennst sie gut genug, um dich auf sie verlassen zu können.«
»Das tu ich«, antwortete Janson geduldig. »Was sie anpackt, macht sie ausgezeichnet.«
»Eine weibliche Maschine?«, fragte Case grinsend.
Janson überlegte einen Augenblick. Er hatte Case bereits klargemacht, dass Jessica Kincaids Hintergrund und ihre Fähigkeiten niemanden etwas angingen. Doch er sah andererseits keinen Grund zu verheimlichen, wie sehr er sie schätzte. »Sie ist eine Perfektionistin und lernt ständig neue Sachen: Tanzen, Säbelfechten, Telemark-Skifahren, Schwimmen, Boxen. Sie nimmt sogar Sprechunterricht bei einem Schauspiellehrer, sie lernt Fremdsprachen, von denen die meisten Leute noch nicht einmal gehört haben, und sie wird bald ihren Flugschein machen.«
»Sind wir vielleicht ein klitzekleines bisschen vernarrt in unseren Schützling?«
»Ich würde es Respekt und Bewunderung nennen«, antwortete Janson. »Gibt’s sonst noch was? Ich muss los.«
Er ging zur Tür und hatte die Hand schon am Türknauf, als Case sagte: »Ich hab auch mit Frauen zusammengearbeitet. Sie sind schlau. Viel schlauer als unsereins.«
»Nach meinen bisherigen Erfahrungen muss ich dir recht geben.«
»Ich hab aber noch nie mit einer Frau im Einsatz zusammengearbeitet. Jedenfalls nicht in einer Situation, wo einem die Kugeln um die Ohren fliegen. Wie ist es?«
Janson zögerte. Dougs Frage– auch wenn er nur ganz allgemein wissen wollte, wie es war, mit einer Frau zusammenzuarbeiten– machte ihn nachdenklich. Er war es gewohnt, um des bloßen Überlebens willen seine Gedanken, Gefühle und Wünsche streng voneinander zu trennen. Konnte es sein, dass er sich bisher noch gar nicht bewusst gemacht hatte, wie wichtig Jessie Kincaid ihm bereits geworden war– als Geschäftspartnerin und Freundin?
»Hast du ein Wörterbuch in deinem Computer?«
Case rollte an seinen Arbeitsplatz zurück, senkte seinen Stuhl auf Schreibtischhöhe ab, öffnete ein Fenster an seinem Computer und legte seine mächtigen Pranken auf das Keyboard.
Janson lächelte, als sich seine Gedanken plötzlich klärten. »Du willst wissen, wie es ist? Schau nach unter ›Kamerad‹.«
Doug Case tippte das aus der Mode gekommene Wort ein, scrollte zum Eintrag hinunter und las laut vor: »›Jemand, mit dem man durch bestimmte Gemeinsamkeiten, wie Arbeit oder Militärdienst, verbunden ist und dem man vertraut‹.«
»Das trifft’s.«
»Aber einen Nachteil sehe ich«, erwiderte Case. »Wenn es eng wird und dir die Kugeln um die Ohren fliegen, dann bist du wahrscheinlich abgelenkt, weil du dir Sorgen um sie machst. Besonders wenn sie so was wie dein Schützling ist. In unserem Geschäft müssen treue Gefolgsleute oft dran glauben. Ich hab einige verloren, du sicher auch.«
»Jessica ist Jägerin, nicht Beute.«
Doug Case griff zum Telefon, kaum dass Paul Janson draußen war.
Bill Pounds, ein Ex-Ranger und heute als Feldagent für ASC tätig, wartete unten in der Lobby. »Ja, Sir?«
»Sie kommen. Halten Sie mich auf dem Laufenden, wo die beiden hingehen. Passen Sie auf, dass er Sie nicht entdeckt.«
»Mich entdeckt keiner. Ich mach mich unsichtbar.«
3
Bill Pounds schritt rasch zu seinem grünen Taurus, der im Parkverbot abgestellt war. Sein Partner Rob, der im Hauptjob beim Houston Police Department arbeitete, saß am Lenkrad. Sie verfolgten, wie ein rot-weißes Fiesta-Taxi am Haupteingang vorfuhr. Der Geschäftsmann mittleren Alters und das Mädchen im Seersucker-Kostüm stiegen ein.
Pounds hatte den Fahrer des Taxis vorher angerufen und ihn angewiesen, die Verbindung nicht zu trennen. Pounds und Rob hörten die Frau sagen: »Zum Brown Convention Center.«
Rob lenkte den Taurus auf den Sam Houston Tollway und folgte dem Taxi in einigem Abstand. »Im Brown’s finden diese Woche zwei Konferenzen statt: die National Association of Black Accountants und die Texas Towmen, und sie sehen nach beidem nicht wirklich aus.«
»Überhol sie«, forderte Pounds seinen Partner auf. »Ich warte in der Lobby auf sie.«
Jessie Kincaid beugte sich zu Janson. »Was hat er gesagt?«, flüsterte sie.
»Erzähl ich dir später.«
Janson saß zurückgelehnt auf seinem Sitz und betrachtete die Gegend draußen. Houston wirkte heiß und trocken. Man sah kaum Menschen, dafür umso mehr Autos. Janson schaute durch das alles hindurch und sah sich wieder in London mit den belebten Bürgersteigen, den alten Steingebäuden und dem grünen Regent’s Park, wo Jessica Kincaid an jenem Tag auf ihn gelauert hatte mit dem Auftrag, ihn zu töten.
Sie war damals schon gut gewesen, eine der besten unter den jungen Agenten, doch noch ohne den Instinkt, den Janson sich in seinen langen Einsatzjahren angeeignet hatte. Damals hatte sie noch kritiklos geglaubt, was ihre Chefs ihr sagten, hundertprozentig überzeugt von dem, was sie tat. Als er sie in ihrer Scharfschützenstellung aufgespürt und entwaffnet hatte, sagte sie: »Sie haben keine Chance, Janson. Diesmal hat man die Allerbesten geschickt.«
Die Besten, das waren die Scharfschützen des Lambda-Teams. Und Jessica Kincaid war die Janson-Expertin im Team, nachdem sie seine Laufbahn eingehend studiert hatte. Die Lambda-Scharfschützen operierten als Einzelgänger– ein Grund, warum er heute noch lebte. Jeder musste sein Ziel selbst finden, anstatt sich dabei auf einen Beobachter zu stützen. Zu fünft waren sie auf Gebäuden und Bäumen postiert gewesen. Für den Fall, dass er ihnen entwischte, standen Leute am Boden bereit, mit Glock-Pistolen bewaffnet.
Er hatte Jessica aus ihrem Baum geholt, ohne zu wissen, dass sie eine Frau war, bis er sie am Boden niederrang. Sie hatte sich als erstaunlich stark und wendig erwiesen, eine exzellente Schützin mit scharfem Verstand und der Fähigkeit, überzeugend zu lügen. Als er sie einen Moment lang aus den Augen gelassen hatte, schlug sie ihn mit der nächstbesten Waffe k. o.
»Was ist?«, fragte sie.
»Ich hab gerade an unser Blind Date in London gedacht«, antwortete er mit einem Lächeln, das für den Fahrer bestimmt war, dessen Augen immer wieder zum Rückspiegel sprangen. Janson sah nicht über die Sitzlehne nach vorne, doch er vermutete, dass der Fahrer sein Handy mit der Vorderseite nach oben im Schoß liegen hatte.
Jessie lächelte ebenfalls. »Erinnerst du dich auch dran, wie du im Gras gelegen hast?«