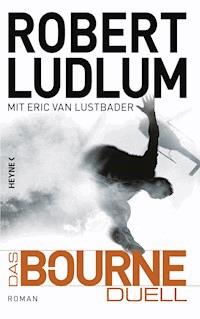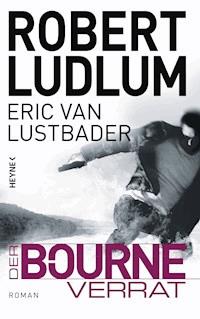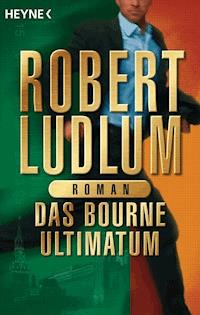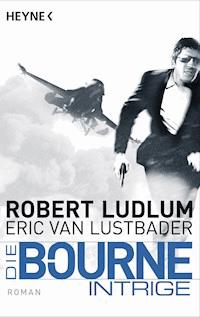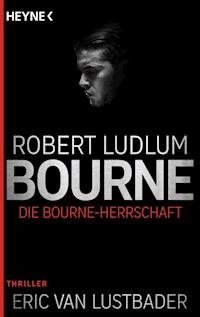7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: COVERT ONE
- Sprache: Deutsch
Die Lazarus-Gruppe ist die Speerspitze einer Umweltbewegung, die gegen die Technologisierung der Welt kämpft. Sie wird angeführt von einem mysteriösen Führer mit dem Namen »Lazarus«. Als nach einer Attacke auf ein Forschungslabor tausende Menschen ums Leben kommen, schlägt die Stunde von Colonel Smith.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 675
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Das Buch
Die Lazarus-Gruppe ist die Speerspitze einer Umweltbewegung, die gegen die Technologisierung der Welt kämpft. Aus diesem Grund steht sie ständig unter Beobachtung der wichtigsten Geheimdienste der Welt. Sie wird angeführt von einem mysteriösen Führer mit dem Namen »Lazarus«, den aber noch niemand in Wirklichkeit gesehen hat. Als nach einer Attacke auf ein Forschungslabor tausende Menschen ums Leben kommen, schlägt die Stunde von Colonel Smith und seinem Team. Er soll herausfinden, wer Lazarus tatsächlich ist und welche weiteren Pläne er hegt. Es ist höchste Zeit, Lazarus zu enttarnen, bevor der Terror neue Opfer fordert.
Die Autoren
Robert Ludlums Romane wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt und erreichten weltweit eine Auflage von über 200 Millionen Exemplaren. Im Heyne Verlag erschien zuletzt »Das Bourne Vermächtnis« und »Der Tristan-Betrug«. Robert Ludlum verstarb im März 2001. Die Romane aus seinem Nachlass erscheinen bei Heyne.
Patrick Larkin hat als Co-Autor mit Larry Bond die Bestseller RedPhoenix und The Enemy Within veröffentlicht. Er studierte an der University of Chicago und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern in Nordkalifornien.
Lieferbare Titel
Die Bourne Identität —Das Bourne Ultimatum — Das Bourne Imperium — Das Bourne Vermächtnis — Das Jesus-Papier — Die Lennox-Falle — Der Ikarus-Plan — Der Gandolfo-Anschlag — Der Janson-Befehl — Der Tristan-Betrug — Der Matarese-Bund — Der Prometheus- Ver rat —Das Scarlatti-Erbe — Das Sigma-Protokoll — Die Paris-Option — Der Cassandra-Plan — Der Hades-Faktor — Der Altman-Code
Inhaltsverzeichnis
Prolog
SAMSTAG, 25. SEPTEMBER
Nahe des Tuli Valley, Zimbabwe
Das letzte Licht der Sonne war am Horizont erloschen, und tausende von Sternen schimmerten am dunklen Himmel, der sich hoch über dem zerklüfteten, staubtrockenen Land wölbte. Diese Region von Zimbabwe war bettelarm, selbst an dem sehr niedrigen Lebensstandard dieses problemgeplagten Landes gemessen. Es gab so gut wie kein elektrisches Licht, das die Nacht erhellte, und nur wenige befestigte Straßen, die die abgelegenen Dörfer des südlichen Matabelelandes mit der größeren Welt jenseits davon verbanden.
Plötzlich tauchten die Scheinwerfer eines Autos in der Dunkelheit auf, tasteten mit ihren Lichtfingern flüchtig über dichtes Gestrüpp aus knorrigen, verkrüppelten Bäumen, über verfilzte Dornbüsche und spärliches Gras hier und dort. Ein verbeulter Toyota Pick-up schwankte durch die Kurven der ausgefahrenen Staubpiste; das Getriebe knirschte protestierend, als er langsam durch eine Reihe tiefer Rinnen holperte. Schwärme von Insekten flatterten in den auf und ab hüpfenden Lichtkegeln der Scheinwerfer und klatschten gegen die staubbedeckte Frontscheibe.
»Merde!«, fluchte Gilles Ferrand leise, während er mit dem Lenkrad kämpfte. Mit einem angestrengten Stirnrunzeln beugte sich der große, bärtige Franzose nach vorn und versuchte, durch den aufwirbelnden Staub und die fliegenden Insekten im Scheinwerferlicht die Fahrbahn zu erkennen. Seine dicke Brille rutschte auf seinem Nasenrücken nach unten. Er nahm eine Hand vom Steuer, schob die Brille wieder zurück und stieß dann erneut einen grimmigen Fluch aus, als der Pick-up um ein Haar von der kurvigen Piste abkam.
»Wir hätten in Bulawayo früher losfahren sollen«, brummte er, den Kopf halb der schlanken, grauhaarigen Frau neben ihm zugewandt. »Diese so genannte Straße hier ist schon bei Tageslicht schlimm genug. Bei Nacht ist sie ein Albtraum. Wenn bloß das Flugzeug nicht so spät gekommen wäre.«
Susan Kendall zuckte mit den Schultern. »Wenn Wünsche kleine bunte Fische wären, Gilles, wären wir alle schon an Quecksilbervergiftung gestorben. Unser Projekt braucht das neue Saatgut und die Gerätschaften, die sie uns geschickt haben, und wenn man der Mutter dient, muss man Unannehmlichkeiten in Kauf nehmen.«
Ferrand verzog das Gesicht und wünschte sich zum tausendsten Mal, seine so spröde und pedantisch wirkende amerikanische Kollegin würde ihm nicht ständig Vorlesungen halten. Sie waren beide seit langem Aktivisten der weltumspannenden Lazarus-Bewegung, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Erde vor der krankhaften Gier des ungezügelten globalen Kapitalismus zu retten. Sie hatte keinen Grund, ihn wie einen Schuljungen zu behandeln.
Die Scheinwerfer des Pick-up schälten einen vertrauten Felsen neben der Piste aus der Dunkelheit. Der Franzose seufzte erleichtert. Sie waren nicht mehr weit von ihrem Ziel — ein winziges Dorf, das vor drei Monaten in das Programm der Lazarus-Bewegung aufgenommen worden war. Er hatte den ursprünglichen Namen des Dorfes vergessen. Als Erstes hatten er und Kendall den Ort in Kusasa umbenannt, was in dem hier gesprochenen Nbelele-Dialekt soviel wie »Morgen« hieß. Es war ein passender Name, zumindest hofften sie es. Die Leute von Kusasa waren mit der Namensänderung einverstanden gewesen und hatten die ihnen angebotene Hilfe der Bewegung bei der Rückkehr zu natürlichen und ökologisch verträglichen Ackerbaumethoden angenommen. Er und Susan glaubten beide daran, dass ihre Arbeit hier den Weg zur Wiedergeburt einer ganz und gar organischen Landwirtschaft in Afrika weisen würde, einer Landwirtschaft, die im völligen Gegensatz stand zu den giftigen Pestiziden, den Kunstdüngern und den gefährlichen genetisch veränderten Getreidesorten des Westens. Die Amerikanerin war überzeugt, dass ihre leidenschaftlichen Appelle die Dorfältesten überzeugt hatten. Ferrand, von Natur aus zynischer als seine Kollegin, hegte allerdings den leisen Verdacht, dass die großzügige Unterstützung in Form von barem Geld seitens der Bewegung mehr Überzeugungskraft besessen hatte. Wie auch immer, dachte er, in diesem Fall würden die Ergebnisse die Mittel mehr als rechtfertigen.
Er bog von der Hauptpiste ab und fuhr langsam auf eine kleine Ansammlung von grellbunt gestrichenen Hütten, wellblechbedeckten Behausungen und schiefen, aus dornigen Zweigen gebauten Rinderpferchen zu. Kusasa lag, umgeben von kleinen Feldern, in einem flachen Tal, das von niedrigen, mit Felsen übersäten Hügeln und hohem Gestrüpp gesäumt wurde. Er brachte den Pick-up zum Stehen und hupte kurz.
Niemand kam, um sie zu begrüßen.
Ferrand machte den Motor aus, ließ die Scheinwerfer jedoch an. Einen Moment lang saß er reglos da und lauschte. Die Hunde des Dorfes heulten. Er fühlte, wie sich die Haare in seinem Nacken sträubten.
Susan Kendall runzelte die Stirn. »Wo stecken sie alle?«
»Ich weiß es nicht.« Ferrand rutschte hinter dem Lenkrad hervor und stieg vorsichtig aus. Inzwischen müssten sie eigentlich von Dutzenden aufgeregter Männer, Frauen und Kinder umringt sein, die alle fröhlich lachten und durcheinander schwatzten beim Anblick der prall gefüllten Säcke mit Saatgut und der nagelneuen Schaufeln, Rechen und Hacken, die sich auf der Ladefläche des Toyota türmten.
Doch nichts regte sich zwischen den dunklen Hütten von Kusasa.
»Hallo?«, rief der Franzose. Er versuchte es mit seinem begrenzten Ndebele-Wortschatz. »Litshone Njani! Guten Abend!«
Die Hunde heulten nur noch lauter und bellten den Nachthimmel an.
Ferrand fröstelte. Er beugte sich in das Führerhaus des Pick-up zurück. »Irgendwas stimmt hier nicht, Susan. Sie sollten Kontakt mit unseren Leuten aufnehmen. Jetzt. Als Vorsichtsmaßnahme.«
Die grauhaarige Amerikanerin starrte ihn einen Augenblick lang an, dann weiteten sich ihre Augen plötzlich. Sie nickte und stieg aus dem Toyota. Mit raschen Handgriffen fuhr sie den mit Satellitentelefon ausgerüsteten Laptop-Computer hoch, den sie im Einsatz stets dabeihatten. Er ermöglichte ihnen, mit ihrer Zentrale in Paris Verbindung aufzunehmen, obwohl er in erster Linie dafür benutzt wurde, Fotos und Berichte über die Fortschritte, die sie machten, auf die Website von Lazarus zu übertragen.
Ferrand sah ihr schweigend zu. Die meiste Zeit fand er Susan Kendall ziemlich enervierend, aber sie hatte Mut, wenn es darauf ankam. Mehr Mut vielleicht als er. Er seufzte und griff unter den Sitz nach der Taschenlampe, die dort befestigt war. Er überlegte einen Moment lang und hängte sich dann ihre Digitalkamera über die Schulter.
»Was haben Sie vor, Gilles?«, fragte sie, während sie bereits die Codenummer für Paris eintippte.
»Ich werd mich mal umsehen«, gab er mürrisch zurück.
»Okay. Aber Sie sollten warten, bis ich eine Verbindung habe«, erwiderte Kendall. Sie hielt eine Weile das Satellitentelefon ans Ohr. Ihr dünnlippiger Mund wurde noch schmaler. »Im Büro ist niemand mehr. Keiner nimmt ab.«
Ferrand sah auf seine Uhr. In Frankreich war es nur eine Stunde früher, aber es war Wochenende. Sie waren auf sich allein gestellt. »Versuchen Sie die Webesite«, schlug er vor.
Sie nickte.
Ferrand musste sich zwingen, sich in Bewegung zu setzen. Er gab sich einen Ruck und ging mit langsamen Schritten ins Dorf. Er schwenkte den Lichtkegel der Taschenlampe in weitem Bogen durch die Dunkelheit vor ihm. Eine Eidechse huschte vor dem Lichtstrahl in Deckung und erschreckte ihn. Er stieß einen leisen Fluch hervor und ging weiter.
Trotz der kühlen Abendluft schwitzte er, als er den offenen Platz in der Mitte von Kusasa erreichte. Hier war der Dorfbrunnen. Er war ein beliebter Treffpunkt für Jung und Alt, wenn der Tag vorüber war. Er schwenkte den Lichtkegel über den hartgebackenen Lehm — und erstarrte.
Die Leute von Kusasa würden sich nicht über das Saatgut und die Gerätschaften freuen, die sie ihnen gebracht hatten. Sie würden auch nicht den Weg für die Wiedergeburt der afrikanischen Landwirtschaft bereiten. Sie waren tot. Sie waren alle tot.
Der Franzose stand wie festgewurzelt, während seine Gedanken vor Entsetzen durcheinander wirbelten. Überall, wohin er blickte, Leichen. Tote Männer, Frauen und Kinder lagen über den Platz verstreut, reglose Häufchen im Schein seiner Taschenlampe. Die meisten der Leichen waren unversehrt, wenn auch verdreht und entstellt von furchtbaren Todesqualen. Andere wirkten grauenvoll hohl, als seien Teile ihrer Eingeweide herausgefressen worden. Einige waren nur mehr zerrissene, in Lachen von geronnenem Blut liegende Fleischfetzen, aus denen Knochen ragten.
Tausende von riesigen schwarzen Fliegen schwärmten über die verstümmelten Körper und labten sich ohne Hast an den Überresten. In der Nähe des Brunnens stupste ein kleiner Hund mit der Schnauze gegen den verkrümmten Körper eines kleinen Kindes und versuchte vergeblich, seinen Spielkameraden aufzuwecken.
Gilles Ferrand schluckte mühsam und zwang den hochsteigenden Schwall von Galle und Mageninhalt hinab. Mit zitternden Händen legte er die Taschenlampe auf den Boden, zerrte die Digitalkamera von seiner Schulter und fing an, Fotos zu machen. Jemand musste dieses furchtbare Gemetzel dokumentieren. Jemand musste die Welt über dieses Massaker an Unschuldigen informieren — an Menschen, deren einziges Verbrechen gewesen war, sich auf die Seite der Lazarus-Bewegung zu stellen.
Vier Männer lagen bewegungslos auf einem der Hügel über dem Dorf. Sie trugen Wüstenkampfanzüge und kugelsichere Westen. Nachtsichtgeräte und Nachtfeldstecher ermöglichten es ihnen, jede Bewegung dort unten zu beobachten, während mit Verstärkern ausgerüstete Mikrofone jedes Geräusch in ihre Kopfhörer übertrugen.
Einer der Beobachter studierte einen abgeschirmten Monitor. Er blickte auf. »Sie haben eine Verbindung zum Satelliten. Und wir zapfen sie an.«
Sein Kommandant, ein riesenhafter Mann mit kastanienbraunem Haar und hellgrünen Augen, grinste sparsam. »Gut.« Er beugte sich näher, um einen besseren Blick auf den Monitor zu haben. Auf ihm war eine Reihe von grauenvollen Bildern zu sehen — die Bilder, die Gilles Ferrand vor ein paar Minuten gemacht hatte und die nun eines nach dem anderen auf die Website der Lazarus-Bewegung übertragen wurden.
Der grünäugige Mann beobachtete den Vorgang aufmerksam. Dann nickte er. »Das reicht. Unterbrich ihre Verbindung.«
Der Beobachter befolgte die Order und tippte mit fliegenden Fingern Befehlsketten in eine tragbare Folientastatur. Er drückte die Enter-Taste und schickte damit eine Sequenz von kodierten Befehlen an den Kommunikationssatelliten hoch über ihnen. Eine Sekunde später erstarrten die digitalen Bilder, die aus Kusasa in den Äther gestrahlt wurden, flackerten kurz und verschwanden dann.
Der Mann mit den grünen Augen richtete den Blick auf die beiden Männer, die neben ihm auf dem Hügel lagen. Beide waren mit Heckler & Koch PSG-1 Präzisionsgewehren bewaffnet, die für verdeckte Operationen entwickelt worden waren. »Erschießt sie jetzt.«
Er richtete sein Nachtglas auf die beiden Lazarus-Aktivisten. Der bärtige Franzose und die schlanke Amerikanerin starrten ungläubig auf den Monitor ihres Satellitentelefons hinab.
»Ziel erfasst«, murmelte einer der Scharfschützen. Er drückte den Abzug. Das 7.62 mm-Projektil traf Ferrand in die Stirn. Der Franzose taumelte rückwärts gegen den Toyota und rutschte zu Boden, an der Beifahrertür hinterließ er eine verschmierte Spur aus Blut und Gehirnmasse. »Ziel getroffen.«
Der zweite Scharfschütze feuerte einen Sekundenbruchteil später. Sein Geschoss traf Susan Kendall in den Rücken. Sie sackte neben ihrem Kollegen zu Boden.
Der große, grünäugige Anführer stand auf. Ein paar andere von seinen Männern stiegen bereits, in Schutzanzügen gegen Gefahrenstoffe gehüllt, den Abhang hinab, langsam, um die hochempfindlichen Geräte, die sie trugen, nicht zu beschädigen. Er schaltete sein Kehlkopfmikrofon ein und meldete über eine verschlüsselte Satellitenverbindung: »Hier ist Prime. Field One ist abgeschlossen. Datensammlung, Evaluation und Analyse werden wie geplant durchgeführt.« Er blickte auf die beiden toten Lazarus-Aktivisten hinab. »SPARK wurde ebenfalls initiiert — wie befohlen.«
Teil eins
Kapitel eins
DIENSTAG, 12. OKTOBER
Teller Institute for Advanced Technology, Santa Fe, New Mexico
Lieutenant Colonel Dr. med. Jonathan (»Jon«) Smith bog von der Old Agua Fria Road auf die Zufahrtsstraße zum Haupttor des Instituts. Er kniff die Augen gegen das grelle Licht des frühen Morgens zu Schlitzen zusammen. Zu seiner Linken im Osten schob sich gerade die Sonne über die leuchtenden, schneebedeckten Gipfel der Sangre de Cristo Mountains und tauchte die steilen, mit gelbblättrigen Espen, riesigen Fichten, Kiefern und Eichen bestandenen Hänge in goldenes Licht. Weiter unten, am Fuß der Berge, lagen die niedrigeren Nusskiefern, Lärchen und Wacholderbäume noch immer im Schatten, ebenso wie das dichte Gestrüpp aus Ginster und Beifuß, das die dicken, sandfarbenen Adobe-Mauern des Instituts umgab.
Einige der Demonstranten, die entlang der Straße die Nacht über campiert hatten, krochen aus ihren Schlafsäcken und folgten dem vorüberfahrenden Wagen mit ihren Blicken. Ein paar hielten selbst gemachte Schilder in die Höhe, auf denen sie STOPPT DIE MÖRDERWISSENSCHAFT, NEIN ZUR NANOTECHNOLOGIE oder LAZARUS AN DIE MACHT forderten. Die meisten blieben jedoch liegen, waren noch nicht bereit, dem kalten Oktobermorgen ins Gesicht zu sehen. Santa Fe lag in einer Höhe von mehr 2300 Metern, und in der Nacht wurde es empfindlich kalt.
Smith empfand einen momentanen Anflug von Sympathie für die Demonstranten. Obwohl die Heizung in seinem Mietwagen lief, konnte er die Kälte durch seine braune Bomber-Lederjacke und die sorgfältig gebügelte Khakihose spüren.
Ein grau uniformierter Wachposten am Tor hob den Arm, und Smith hielt an. Er kurbelte das Fenster herab und reichte dem Wachmann seinen U.S. Army Dienstausweis. Das Foto auf dem Ausweis zeigte einen durchtrainierten Mann Anfang vierzig — einen Mann, dessen hohe Backenknochen und glatte, dunkle Haare ihm das Aussehen eines hochmütigen spanischen Edelmanns verliehen. Tatsächlich jedoch widerlegte das amüsierte Funkeln seiner dunkelblauen Augen den Eindruck von Arroganz.
»Guten Morgen, Colonel«, sagte der Wachposten, ein ehemaliger Staff Sergeant bei den Army Rangers namens Frank Diaz. Nachdem er den Ausweis eingehend begutachtet hatte, beugte er sich vor und spähte durch die Wagenfenster, um sich zu vergewissern, dass Smith allein war. Seine rechte Hand schwebte wachsam in der Nähe der 9mm-Beretta-Pistole, die in einem Halfter an seiner Hüfte steckte. Die Deckklappe des Halfters war offen — wodurch er die Beretta schneller ziehen konnte, falls nötig.
Smith zog unwillig die Augenbrauen hoch. Die Sicherheitsmaßnahmen am Teller Institut waren normalerweise entspannter und sicherlich nicht auf dem Standard der streng geheimen Atomforschungslaboratorien im nahe gelegenen Los Alamos. Doch der Terminplan des Präsidenten der Vereinigten Staaten, Samuel Adams Castilla, sah vor, dem Institut in drei Tagen einen Besuch abzustatten. Und jetzt war für die Zeit, in der er seine Rede halten würde, eine riesige Antitechnologiekundgebung organisiert worden. Die Demonstranten vor dem Tor heute Morgen waren nur die erste Welle von tausenden mehr, die aus allen Teilen der Welt hier zusammenströmen würden. Er deutete mit dem Daumen über die Schulter. »Kriegen Sie von den Leuten da draußen schon Zunder, Frank?«
»Nicht sonderlich viel bisher«, räumte Diaz ein. Er zuckte mit den Schultern. »Wir haben ein wachsames Auge auf sie. Diese Demonstration macht die Leute in der Regierung nervös. Das FBI sagt, es sind ein paar wirklich hartgesottene Krawallbrüder hierher unterwegs — die Sorte, die drauf steht, Molotowcocktails zu werfen und Fensterscheiben einzuschlagen.«
Smith runzelte die Stirn. Massenproteste lockten überall auf der Welt Anarchisten mit einem Faible für Gewalt und Zerstörung von Eigentum an. Genua, Seattle, Cancun und ein halbes Dutzend anderer Städte auf dem Globus hatten bereits erlebt, dass ihre Straßen in Schlachtfelder für maskierte Chaoten und die Polizei verwandelt wurden.
Während ihm dieser Gedanke durch den Kopf ging, deutete er einen militärischen Gruß an und fuhr weiter in Richtung Parkplatz. Die Aussichten, in einem Aufruhr festzusitzen, waren nicht sonderlich erfreulich. Nicht, wenn man in New Mexico auch ein bisschen Urlaub machen möchte.
Das kannst du dir abschminken, dachte Smith mit einem schiefen Grinsen. Betrachte es als einen Arbeitsurlaub. Als Militärarzt und Experte für Molekularbiologie verbrachte er den Großteil seiner Zeit im Dienst des U.S. Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID), dem Medizinischen Forschungsinstitut für Infektionskrankheiten der U.S. Armee in Fort Detrick, Maryland. Seine Tätigkeit am Teller Institut war nur temporär.
Das Office of Science and Technology des Pentagon hatte ihn nach Santa Fe geschickt, damit er sich die Arbeit ansah, die in den drei Laboratorien für Nanotechnologie des Instituts gemacht wurde, und einen Bericht darüber verfasste. Überall auf der Welt lagen Wissenschaftler im heftigen Wettstreit, praktikable und profitable Anwendungsmöglichkeiten für die Nanotechnologie zu entwickeln. Einige der Besten ihres Fachs arbeiteten hier in Teams des Teller Instituts, der Harcourt Biosciences und der Nomura PharmaTech. Grundsätzlich betrachtet, dachte Smith zufrieden, hatte ihm das Verteidigungsministerium einen Platz in der ersten Reihe zugewiesen, von dem er die Entwicklung der vielversprechendsten neuen Technologien des Jahrhunderts aus nächster Nähe beobachten konnte.
Die Arbeit hier war genau nach seinem Geschmack. Das Wort Nanotechnologie stand für ein weit gefächertes Spektrum von Inhalten. Im Wesentlichen bedeutete es die Entwicklung hochkomplizierter Maschinen, die so winzig waren, dass es das menschliche Vorstellungsvermögen überstieg. Ein Nanometer war gerade mal ein Milliardstel eines Meters, etwa zehnmal so groß wie ein Atom. Entwickle eine Konstruktion mit einer Größe von zehn Nanometern und du hast etwas, das nur ein Zehntausendstel des Durchmessers eines menschlichen Haares misst. Nanotechnologie war Ingenieurskunst auf molekularer Ebene, eine Technologie, in der Quantenphysik, Chemie, Biologie und der Einsatz von Hochleistungsrechnern zusammenspielten.
Wissenschaftsjournalisten entwarfen leuchtende Zukunftsvisionen von Robotern, die nur die Größe von ein paar Atomen besaßen und durch den menschlichen Körper streiften, um Krankheiten zu heilen und innere Verletzungen zu reparieren. Andere verlangten von ihren Lesern, sich Informations-speichereinheiten vorzustellen, die ein Millionstel der Größe eines Salzkorns haben und das gesamte Wissen der Menschheit erfassen können. Oder Staubkörner, die als hypereffektive Staubsauger durch die verschmutzte Atmosphäre trieben und dabei den Himmel blank putzten.
Smith hatte in den letzten Wochen am Teller Institut genug gesehen, um zu wissen, dass ein paar dieser scheinbar unmöglichen Vorstellungen bereits kurz vor der Realisation standen. Er zwängte seinen Wagen in eine Parklücke zwischen zwei riesige Geländewagen. Ihre Windschutzscheiben waren vereist, ein Zeichen, dass die Wissenschaftler oder Techniker, denen die Wagen gehörten, die ganze Nacht über im Labor geblieben waren. Er nickte anerkennend. Das waren die Jungs, die an den echten Wundern arbeiteten und sich von starkem schwarzem Kaffee, koffeinhaltigem Soda und von Zucker klebrigen Snacks aus dem Automaten ernährten.
Er stieg aus dem Mietwagen und zog gegen die kalte Morgenluft den Reißverschluss seiner Jacke hoch. Dann roch er den schwachen Duft von Lagerfeuern und Cannabis, der aus dem Lager der Demonstranten herüberwehte. Immer mehr Kleinbusse, Volvo-Kombis, Charterbusse und mit Gas oder Strom betriebene Autos bogen von der Interstate 25 auf die Zufahrtsstraße zum Institut. Er legte die Stirn in düstere Falten. Die angekündigten Massen sammelten sich.
Leider hatte die Nanotechnologie auch eine potenziell dunkle Seite, die den Befürchtungen und Katastrophenvorstellungen der Aktivisten und Eiferer der Lazarus-Bewegung, die sich draußen vor dem Maschendrahtzaun des Instituts sammelten, immer wieder neue Nahrung gab. Die Vorstellung von Maschinen, die so winzig waren, dass sie ohne weiteres in menschliche Zellen eindringen konnten, und die Fähigkeit besaßen, atomare Strukturen zu verändern, versetzte sie in Angst und Schrecken. Radikale Bürgerrechtler warnten vor den Gefahren, die der Menschheit von »Spionagemolekülen« drohten, die unbemerkt an sämtlichen öffentlichen und privaten Orten lauern würden. Ausgeflippte Konspirationsapostel füllten Internet-Chatrooms mit Gerüchten über heimlich entwickelte winzige Tötungsmaschinen. Andere hatten Angst davor, dass sich entkommene Nanomaschinen selbst vervielfältigen und in einer endlosen Parade von Zauberbesen, die den Zauberlehrlingen der modernen Zeiten nicht mehr gehorchten, über die Erde tanzen und schließlich die Erde und alles Leben auf ihr vernichten würden.
Jon Smith zuckte mit den Schultern. Wilden Übertreibungen konnte man am besten dadurch begegnen, indem man ihnen greifbare Resultate gegenüberstellte. Wenn die meisten Leute den unbestreitbaren Nutzen der Nanotechnologie erst einmal erkannt hatten, würden auch ihre irrationalen Ängste allmählich weniger werden. Zumindest hoffte er dies. Er machte abrupt auf dem Absatz kehrt und strebte, neugierig darauf, was für neue Wunder die Männer und Frauen in den Labors über Nacht ausgetüftelt hatten, auf den Haupteingang des Instituts zu.
Zweihundert Meter jenseits des Maschendrahtzauns saß Malachi MacNamara mit überkreuzten Beinen auf einer bunten, im Schatten einer mächtigen Lärche ausgebreiteten indianischen Decke. Seine blassblauen Augen waren offen, doch er saß vollkommen ruhig und reglos da. Die in der Nähe campierenden Anhänger der Lazarus-Bewegung waren überzeugt, dass der hagere, wettergegerbte Kanadier meditierte, um seine geistigen und körperlichen Energien für den bevorstehenden Kampf zu sammeln. Der pensionierte Biologe des Forest Service in British Columbia hatte ihre Bewunderung bereits gewonnen, als er mit eindringlichen Worten »sofortiges Handeln« gefordert hatte, um die Ziele der Bewegung zu erreichen.
»Die Erde stirbt«, erklärte er ihnen. »Sie erstickt unter den ungeheueren Mengen von giftigen Pestiziden und anderen Schadstoffen, die sie verschmutzen. Die Wissenschaft wird sie nicht retten. Die neuen Technologien werden sie nicht retten. Sie sind ihre Feinde und die wahre Ursache der Verschmutzung und Vergiftung unseres Planeten. Wir müssen etwas gegen sie tun. Jetzt. Nicht irgendwann. Jetzt! Solange es noch nicht zu spät dafür ist ...«
MacNamara verbarg ein dünnes Grinsen, als er sich an ihre glühenden, von seiner Rhetorik erhitzten Gesichter erinnerte. Er hatte mehr Talent als Redner oder Prediger, als er geglaubt hatte.
Er beobachtete die Aktivitäten in seiner Umgebung. Diesen Platz hatte er sorgfältig ausgewählt. Von hier aus überblickte er das große, grüne Zelt, das die Leute der Lazarus-Bewegung als Kommandozentrale aufgebaut hatten. Mehr als ein Dutzend der nationalen und internationalen Top-Aktivisten befanden sich im Augenblick in diesem Zelt — saßen an ihren mit den Websites der Bewegung verbundenen Computern, registrierten Neuankömmlinge, fertigten Spruchbänder und Schilder an und koordinierten Pläne für die bevorstehende Massenkundgebung. Andere Gruppierungen in der TechStock-Koalition wie der Sierra Club, Earth First! und ähnliche Vereinigungen hatten ihre eigenen, über das ständig größer werdende Lager der Demonstranten verteilten Hauptquartiere, doch MacNamara wusste, dass er zur genau richtigen Zeit am richtigen Ort war.
Die Lazarus-Bewegung war die treibende Kraft hinter dem Protest. Die anderen Antitechnologie- und Umweltorganisationen waren nur deshalb mit von der Partie, weil sie verzweifelt versuchten, etwas gegen ihre stetig sinkenden Mitgliederzahlen und den damit einhergehenden schwindenden Einfluss zu tun. Immer mehr ihrer engagiertesten Mitglieder verließen die Organisationen, um sich der Lazarus-Bewegung anzuschließen, angezogen von der Klarheit ihrer Visionen und ihrem Mut, sich mit den mächtigsten Konzernen und Regierungen anzulegen. Selbst die Ermordung einiger ihrer Aktivisten vor kurzem in Zimbabwe wirkte wie ein Sammelruf unter die Fahnen von Lazarus. Bilder von dem Massaker in Kusasa wurden als Beweis dafür gezeigt, wie sehr die »Führer der globalen Konzerne« und ihre Marionettenregierungen die Bewegung und ihre Botschaft fürchteten.
Der hagere Kanadier mit dem zerklüfteten Gesicht richtete sich noch ein wenig mehr auf.
Mehrere verwegen aussehende junge Männer näherten sich dem olivegrünen Zelt und bahnten sich zielstrebig einen Weg durch die Menge. Jeder der jungen Männer trug einen langen Seesack über die Schulter geworfen. Sie bewegten sich mit der vorsichtigen Eleganz von Raubkatzen.
Einer nach dem anderen erreichte das Zelt und schlüpfte hinein.
»Sieh an, sieh an«, murmelte Malachi MacNamara leise. Seine blassblauen Augen funkelten. »Wie überaus interessant.«
Kapitqel zwei
Das Weiße Haus, Washington, D.C.
Die elegante Uhr aus dem 18. Jahrhundert an der Wand des Oval Office schlug leise zwölf Uhr mittags. Draußen regnete es in Strömen, eiskalter Regen prasselte gegen die hohen Fenster, die auf den South Lawn hinausblickten. Was immer der Kalender sagte, die ersten Vorboten des Winters zogen über der Hauptstadt des Landes herauf.
Das Deckenlicht schimmerte auf dem Titangestell von Präsident Samuel Adams Castillas Lesebrille, während er die streng geheime Gefahreneinschätzung der Joint Intelligence, der Vereinigten Nachrichtendienste, durchblätterte, die ihm soeben ausgehändigt worden war. Seine Miene verfinsterte sich. Er sah von dem Papier auf und warf einen ärgerlichen Blick über den großen, rustikalen Tisch aus Pinienholz, der ihm als Schreibtisch diente. Seine Stimme war gefährlich leise. »Lassen Sie mich noch mal klarstellen, dass ich Sie richtig verstehe, Gentlemen. Schlagen Sie wirklich allen Ernstes vor, meine Rede am Teller Institut abzusagen? Drei Tage vor dem geplanten Termin?«
»Das ist richtig, Mr President. Um es unverblümt zu sagen, das Risiko, das ein Besuch in Santa Fe mit sich bringt, ist unakzeptabel hoch«, erwiderte David Hanson, der neu im Amt bestätigte Direktor der Central Intelligence, kühl. Wie ein Echo wiederholte Robert Zeller, der amtierende Direktor des FBI, sogleich Hansons Einschätzung mit fast genau denselben Worten.
Castilla fasste die beiden Männer kurz ins Auge, doch dann konzentrierte er seine Aufmerksamkeit auf Hanson. Der Chef der CIA war der hartgesottenere und schwierigere der beiden — trotz des Umstands, dass er mit seiner obligatorischen Fliege mehr Ähnlichkeit mit einem schmalbrüstigen und gutmütigen College-Professor aus den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts hatte, als mit dem glühenden Verfechter und kühlen Initiator verdeckter Aktionen und Sondereinsatzkommandos, der er war.
Obgleich Bob Zeller, sein Pendant vom FBI, ein ehrenwerter Mann war, hatte er in dem unergründlichen Sumpf der politischen Intrigen in Washington längst den Boden unter den Füßen verloren. Groß und breitschultrig wie er war, sah Zeller im Fernsehen zwar gut aus, aber er hätte niemals von seinem Amt als Oberster Staatsanwalt in Atlanta zum Direktor des FBI befördert werden dürfen. Nicht einmal auf temporärer Basis, während sich der Stab des Weißen Hauses nach einem geeigneteren Nachfolger umsah. Wenigstens wusste der ehemalige Verteidiger im Footballteam der Navy und langjährige Bundesstaatsanwalt um seine Schwächen. Bei Besprechungen sagte er in der Regel nicht viel und schlug sich gewöhnlich auf die Seite dessen, den er für den Stärkeren hielt.
Hanson war ein vollkommen anderer Fall. Wenn überhaupt, dann war der CIA-Veteran zu erfahren und geschickt im Spiel um Macht und politischen Einfluss. Während seiner langen Amtszeit als Chef des Operationsdirektoriums der CIA hatte er sich unter den Mitgliedern der diversen Geheimdienstkomitees im Kongress und im Senat einen festen Rückhalt verschafft. Eine Menge Kongressabgeordnete und Senatoren glaubten, dass David Hanson über Wasser gehen konnte. Dies verschaffte ihm eine Menge Bewegungsfreiheit für seine politischen Schachzüge, sogar die Freiheit, dem Präsidenten zu widersprechen, der ihn vor kurzem zum Leiter der gesamten CIA ernannt hatte.
Castilla tippte mit einem fleischigem Zeigefinger auf den Bericht zur Gefahreneinschätzung. »Ich entdecke eine Vielzahl von Spekulationen in dem Bericht. Was ich nicht entdecken kann, sind konkrete Fakten.« Er las einen Satz des Berichts laut. »>Abhörberichte nicht spezifischer aber signifikanter Natur weisen darauf hin, dass radikale Elemente unter den Demonstranten in Santa Fe möglicherweise gewalttätige Aktionen planen — entweder gegen das Teller Institut oder gegen den Präsidenten persönlich.‹«
Er nahm seine Lesebrille ab und blickte auf. »Könnten Sie das in einfachem Englisch sagen, David?«
»Wir stoßen zunehmend auf Andeutungen und Hinweise, die diesen Schluss nahe legen, sowohl im Internet wie auch bei mitgeschnittenen Telefongesprächen. Einige beunruhigende Formulierungen tauchen immer wieder auf, die sich alle auf die geplante Massendemonstration beziehen. Es ist immer wieder die Rede von dem >großen Ereignis< oder >der Aktion am Teller Institut<, erklärte der Chef der CIA. »Meine Leute haben diese Schlagworte auch schon in Übersee gehört. Die NSA ebenfalls. Und das FBI bekommt hier bei uns zu Hause dieselben Andeutungen zu hören. Hab ich Recht, Bob?«
Zeller nickte würdevoll.
»Und das versetzt unsere Analytiker in solche Aufregung?« Castilla schüttelte, offensichtlich unbeeindruckt, den Kopf. »Leute, die einander wegen einer politischen Protestaktion E-Mails schicken?« Er schnaubte verächtlich. »Großer Gott! Jede Demonstration, die dreißig- oder vierzigtausend Leute bis nach Santa Fe lockt, ist ein ziemlich großes Ereignis! New Mexico ist für mich ein Heimspiel, aber ich bezweifle, dass je halb so viele bei einer meiner Reden dort waren.«
»Wenn Mitglieder des Sierra Clubs oder der Wilderness Federation so was sagen, mache ich mir keine Sorgen«, erwiderte Hanson leise. »Aber sogar die einfachsten Worte können eine ganz andere Bedeutung haben, wenn sie von gewissen gefährlichen Gruppen und Individuen gesagt werden. Eine tödliche Bedeutung.«
»Sie reden von diesen so genannten ›radikalen Elementen<?«
»Ja, Sir.«
»Und wer sind diese gefährlichen Leute?«
»Die meisten sind auf die eine oder andere Weise mit der Lazarus-Bewegung verbündet, Mr President«, erwiderte Hanson vorsichtig.
Castilla runzelte skeptisch die Stirn. »Das ist ein altes Lied von Ihnen, David.«
Der andere Mann zuckte mit den Schultern. »Dessen bin ich mir bewusst, Sir. Aber die Wahrheit wird nicht weniger wahr, nur weil sie unangenehm ist. Als Ganzes betrachtet, ist der jüngste Bericht unserer Nachrichtendienste über die Lazarus-Bewegung äußerst alarmierend. Die Bewegung metastasiert, und was einmal ein relativ friedfertiges politisches Bündnis für Umweltschutz war, verändert sich sehr schnell in etwas, das viel unberechenbarer, gefährlicher und tödlicher ist als die frühere Organisation.«
Er sah den Präsidenten über den Tisch hinweg an. »Ich weiß, Sie haben die betreffenden Überwachungs- und Abhörberichte gesehen. Und unsere Analyse dieser Berichte.«
Castilla nickte zögernd.
Das FBI, die CIA und andere Bundesnachrichtendienste beobachteten eine lange Reihe von Gruppierungen und Personen. Angesichts des zunehmenden weltweiten Terrorismus und der Verbreitung chemischer, biologischer und nuklearer Waffentechnologien wollte niemand in Washington das Risiko eingehen, aus heiterem Himmel von einem vorher nicht bekannten Feind attackiert zu werden.
»Lassen Sie es mich unverblümt sagen, Sir«, fuhr Hanson fort. »Nach unserem Dafürhalten ist die Lazarus-Bewegung inzwischen fest entschlossen, ihre Ziele durch Gewalt und Terror zu erreichen. Ihre Wortwahl ist zunehmend feindselig, paranoid und voller Hass gegen die, die sie als Feinde betrachtet.« Der Chef der CIA schob ein weiteres Papier über den Tisch aus Pinienholz. »Das hier ist nur ein Beispiel.«
Castilla setzte seine Brille wieder auf und las schweigend. Er verzog vor Abscheu den Mund. Das Papier, auf das er hinabstarrte, war ein Glanzpapierausdruck einer Seite aus einer der Websites der Bewegung und zeigte eine Reihe grotesker kleiner Fotos von entstellten und verstümmelten Leichen. Die Schlagzeile in großen, fetten Lettern über dem Artikel verkündete: UNSCHULDIGE IN KUSASA ABGESCHLACHTET. Der Text zwischen den Bildern machte für das Massaker an den Einwohnern eines ganzen Dorfs in Zimbabwe entweder die von den internationalen Konzernen finanzierten »Todesschwadronen« verantwortlich oder »von der U.S. Regierung bewaffnete Söldner«. Er behauptete, die Morde seien Teil eines geheimen Plans, die Bemühungen der Lazarus-Bewegung, die organische Landwirtschaft in Afrika neu zu beleben, zu zerschlagen, weil sie das Monopol der Amerikaner für genetisch modifiziertes Getreide und Pestizide gefährdeten. Die Seite endete mit einem Aufruf, all jene zu vernichten, die die »Erde und alle, die sie lieben, zerstören«.
Der Präsident ließ das Papier auf den Tisch fallen. »Was für ein Haufen gequirlte Scheiße.«
»Wie wahr.« Hanson zog den Ausdruck wieder über den Tisch und schob ihn zurück in seine Aktenmappe. »Allerdings ist es hochbrisante gequirlte Scheiße — zumindest für das Publikum, auf das sie gemünzt ist.«
»Haben Sie ein Team nach Zimbabwe geschickt, das herausfindet, was in diesem — Kusasa wirklich passiert ist?«, fragte Castilla.
Der Direktor der CIA schüttelte den Kopf. »Das würde extrem schwierig, Mr President. Ohne die Genehmigung von der Regierung dort, die uns gegenüber feindselig eingestellt ist, müssten wir mit einer verdeckten Operation eindringen. Selbst dann bezweifle ich, dass wir viel finden würden. Zimbabwe ist ein hoffnungsloser Fall. Diese Dorfbewohner können von jedem ermordet worden sein — bei den Regierungstruppen angefangen bis hin zu irgendwelchen marodierenden Banditen.«
»Zum Teufel«, brummte Castilla. »Und wenn unsere Leute erwischt werden, wie sie dort ohne Genehmigung herumschnüffeln, wird jeder annehmen, wir hätten etwas mit diesem Massaker zu tun gehabt und versuchten nur, unsere Spuren zu beseitigen.«
»Das ist das Problem, Sir«, stimmte Hanson ihm leise zu. »Aber was auch immer in Kusasa wirklich geschehen ist, eines ist ziemlich klar: Die Führung der Lazarus-Bewegung benutzt diesen Vorfall dazu, ihre Anhänger zu radikalisieren und sie auf direktere und gewalttätigere Aktionen gegen uns und unsere Verbündeten vorzubereiten.«
»Verdammt, diese Entwicklung gefällt mir ganz und gar nicht«, knurrte Castilla. Er beugte sich auf seinem Stuhl nach vorn. »Vergessen Sie nicht, dass ich viele der Männer und Frauen kannte, die Lazarus gegründet haben. Sie waren angesehene Umweltaktivisten, Wissenschaftler und Schriftsteller — sogar ein paar Politiker waren darunter. Sie wollten die Erde retten, sie wieder zum Leben erwecken. Ich stimme zwar mit dem Großteil der Aussagen nicht überein, aber sie waren gute Menschen. Ehrenwerte Leute.«
»Und wo sind diese ehrenwerten Leute jetzt, Sir?«, erkundigte sich der Direktor der CIA leise. »Es gab ursprünglich neun Gründungsmitglieder der Lazarus-Bewegung. Sechs davon sind tot, entweder eines natürlichen Todes gestorben oder bei verdächtig konstruiert wirkenden Unfällen ums Leben gekommen. Die anderen drei sind ohne eine Spur verschwunden.« Er warf Castilla einen vorsichtigen Blick zu. »Einschließlich Jinjiro Nomura.«
»Ja«, erwiderte der Präsident tonlos.
Sein Blick wanderte zu einem der Fotos, die sich in einer Ecke seines Schreibtischs scharten. Es war während seiner ersten Amtszeit als Gouverneur von New Mexico aufgenommen worden und zeigte ihn und einen kleineren und älteren Japaner, Jinjiro Nomura, wie sie sich voreinander verbeugten. Nomura war damals ein prominentes Mitglied des Diet, des japanischen Parlaments, gewesen. Ihre Freundschaft, die sich auf eine gemeinsame Vorliebe für Single Malt Scotch und ein offenes Gespräch gründete, hatte Nomuras Rückzug aus der Politik und sein entschlossenes Engagement für Umweltprobleme überdauert.
Vor zwölf Monaten war Jinjiro Nomura, als er zu einer Protestkundgebung in Thailand reiste, verschwunden. Sein Sohn Hideo, der Präsident und Vorstandsvorsitzender von Nomura PharmaTech war, hatte Amerika um Hilfe bei der Suche nach seinem Vater gebeten. Und Castilla hatte sofort reagiert. Wochenlang hatte ein Sondereinsatzkommando aus Agenten der CIA die Straßen und Seitengässchen von Bangkok durchkämmt. Der Präsident hatte sogar die NSA gezwungen, ihre ultra-geheimen Spionagesatelliten für die Suche nach seinem alten Freund zur Verfügung zu stellen. Aber es hatte zu nichts geführt. Keine Lösegeldforderung. Keine Leiche. Nichts. Das letzte der ursprünglichen Gründungsmitglieder der Lazarus-Bewegung war und blieb spurlos verschwunden.
Die Fotografie stand auf Castillas Schreibtisch als eine Mahnung, dass seine Macht Grenzen hatte.
Castilla seufzte und wandte den Blick wieder den beiden vor ihm sitzenden Männern zu. »Okay, Sie haben Ihre Argumente vorgebracht. Die maßgeblichen Leute bei Lazarus, die ich kannte und denen ich vertraute, sind entweder tot oder wie vom Erdboden verschluckt.«
»Genau, Mr President.«
»Was uns wieder zu der Frage zurückbringt, wer die Lazarus-Bewegung jetzt führt«, sagte Castilla grimmig. »Lassen Sie uns zum Punkt kommen, David. Nach dem Verschwinden Jinjiros habe ich Ihr Sondereinsatzkommando gegen die Lazarus-Bewegung genehmigt — trotz meiner Bedenken. Sind Ihre Leute der Antwort auf die Frage, wer gegenwärtig die Bewegung leitet, schon ein Stück näher gekommen?«
»Nicht viel näher«, gab Hanson widerstrebend zu. »Auch nicht nach Monaten intensiver Arbeit.« Er breitete die Hände aus. »Wir sind uns ziemlich sicher, dass die letzte Entscheidungsbefugnis in den Händen von einem Mann liegt, der sich Lazarus nennt. Aber wir wissen nicht, wie er wirklich heißt oder wie er aussieht oder von wo er die Operationen dirigiert.«
»Das ist nicht gerade befriedigend«, bemerkte Castilla trocken. »Vielleicht sollten Sie aufhören, mir zu erzählen, was Sie nicht wissen, und sich an das halten, was Sie wissen.« Er blickte dem kleineren Mann direkt in die Augen. »Das würde weniger Zeit in Anspruch nehmen.«
Hanson lächelte höflich. Doch das Lächeln erreichte seine Augen nicht. »Wir haben einen großen Aufwand betrieben und alle verfügbaren Mittel eingesetzt — was Personal, Satellitentechnik und so weiter angeht. Ebenso der MI6, der französischen DGSE und verschiedene andere Nachrichtendienste des Westens, aber während des letzten Jahres hat sich die Lazarus-Bewegung gezielt neu strukturiert, um unserer Überwachung zu entgehen.«
»Fahren Sie fort«, sagte Castilla.
»Die Bewegung ist jetzt in Form von noch strafferen und noch sichereren konzentrischen Kreisen organisiert«, erklärte Hanson. »Die meisten Anhänger fallen in den äußeren Kreis. Sie operieren in aller Öffentlichkeit — nehmen an Treffen teil, organisieren Demonstrationen, geben Rundschreiben heraus und arbeiten für verschiedene von der Bewegung gesponserte Projekte überall auf der Welt. Aus ihnen rekrutieren sich auch die Mitarbeiter in den verschiedenen Büros der Bewegung überall auf der Welt. Aber jede höhere Ebene in der Hierarchie ist kleiner und geheimer. Wenige Mitglieder der oberen Ebenen kennen einander bei ihrem richtigen Namen oder treffen sich persönlich. Mitteilungen aus der Führungsebene werden fast ausschließlich über das Internet verbreitet, entweder in Form von verschlüsselten Botschaften ... oder von Kommuniques, die auf einer der verschiedenen Webseiten von Lazarus erscheinen.«
»Mit anderen Worten, die klassische Zellenstruktur«, bemerkte Castilla. »Befehle laufen problemlos die Befehlskette abwärts, aber niemand außerhalb der Gruppe kann so ohne weiteres in den inneren Kern eindringen.«
Hanson nickte. »Das ist richtig. Es ist dieselbe Struktur, die sich im Lauf der letzten Jahre eine ganze Reihe sehr gefährlicher Terroristengruppen zu eigen gemacht haben. Al-Quaida, Islamischer Dschihad. Die Roten Brigaden in Italien. Die Rote Armee in Japan. Um nur ein paar beim Namen zu nennen.«
»Und Sie hatten noch kein Glück mit Ihren Bemühungen, bis in die oberen Ebenen vorzudringen?«, fragte Castilla.
Der Leiter der CIA schüttelte den Kopf. »Nein, Sir. Ebenso wenig wie die Briten oder Franzosen oder sonst irgendjemand. Wir haben es alle versucht — ohne Erfolg. Und wir haben, eine nach der anderen, unsere besten Quellen innerhalb der Lazarus-Bewegung verloren. Einige sind aus der Bewegung ausgetreten. Andere wurden ausgeschlossen. Ein paar sind einfach verschwunden und vermutlich tot.«
Castilla runzelte die Stirn. »Es scheint zu einer Gewohnheit zu werden, dass im Umfeld dieser Gruppe Leute spurlos verschwinden.«
»Ja, Sir. Und zwar eine ganze Menge.« Der Direktor der CIA ließ diese unerquickliche und beunruhigende Wahrheit im Raum stehen, ohne weitere Details zu nennen.
Fünfzehn Minuten später verließ der Direktor der CIA das Weiße Haus und eilte die Stufen des South Portico zu einer dort wartenden schwarzen Limousine hinab. Er ließ sich auf den Rücksitz sinken, wartete, bis der Mann vom Secret Service hinter ihm die Wagentür zuwarf, und drückte auf den Knopf der Gegensprechanlage. »Bringen Sie mich nach Langley zurück«, befahl er seinem Chauffeur.
Hanson lehnte sich in die Wildlederpolster zurück, als die Limousine die Auffahrt hinab Fahrt aufnahm und dann nach links auf die Seventeenth Street bog. Er betrachtete den untersetzten Mann mit dem kantigen Kinn, der mit dem Rücken zum Fahrer auf dem Klappsitz ihm gegenüber saß. »Sie sind sehr schweigsam heute Nachmittag, Hal.«
»Sie bezahlen mich dafür, dass ich Terroristen fange oder töte«, erwiderte Hal Burke. »Nicht, um mit Ihnen höfliche Konversation zu machen.«
Ein amüsiertes Funkeln glomm kurz in den Augen des CIA-Direktors auf. Burke war ein altgedienter und erfahrener Agent im Antiterrorismus-Stab der Agency. Im Augenblick war er mit der Leitung des Sondereinsatzkommandos gegen die Lazarus-Bewegung betraut. Zwanzig Jahre im verdeckten Außeneinsatz für die Agency hatten bei ihm eine Schussnarbe an der rechten Seite seines Halses und eine notorisch zynische Betrachtungsweise der menschlichen Natur hinterlassen. Es war eine Betrachtungsweise, die auch Hanson teilte.
»Hatten Sie Glück?«, fragte Burke schließlich.
»Nein.«
»Verdammt.« Burke starrte missmutig aus dem vom Regen gestreiften Fenster der Limousine. »Kit Pierson kriegt bestimmt einen hysterischen Anfall, wenn sie das hört.«
Hanson nickte. Katherine Pierson war Burkes Pendant vom FBI. Die beiden hatten bei der Formulierung der Gefahreneinschätzung, die er und Zeller soeben dem Präsidenten unterbreitet hatten, eng zusammengearbeitet. »Castilla will, dass wir unsere Ermittlungen gegen die Bewegung weiter mit allem Nachdruck verfolgen, aber er ist nicht bereit, seine Rede am Teller Institut abzusagen. Nicht ohne klarere Beweise für eine ernsthafte Gefahr.«
Burke wandte den Blick vom Fenster ab. Sein Mund war ein dünner, grimmiger Strich. »Im Klartext heißt das, er will nicht, dass die Washington Post, die New York Times und die Fox News ihn einen Feigling nennen.«
»Würden Sie das wollen?«
»Nein«, gab Burke zu.
»Dann haben Sie vierundzwanzig Stunden, Hal«, sagte der CIA-Chef. »Ich bin darauf angewiesen, dass Sie und Kit Pierson etwas Handfestes zu Tage fördern, womit ich ins Weiße Haus gehen kann. Andernfalls fliegt Sam Castilla morgen nach Santa Fe, um den Demonstranten die Stirn zu bieten. Sie wissen ja, was dieser Präsident für ein Mensch ist.«
»Er ist ein sturer Hundesohn«, knurrte Burke.
»Ja, das ist er.«
»Dann soll es so sein«, sagte Burke mit einem Schulterzucken. »Ich hoffe nur, es kostet ihn diesmal nicht das Leben.«
Kapitel drei
Teller Institute for Advanced Technology
Jon Smith nahm immer zwei der breiten, flachen Stufen zum oberen Stockwerk des Instituts auf einmal. Die drei Haupttreppen im Haus auf- und abzulaufen, war so ziemlich die einzige nennenswerte Bewegung, für die er jetzt Zeit hatte. Die langen Tage und hin und wieder auch Nächte, die er in den verschiedenen Nanotechnologie-Laboratorien verbrachte, nahmen ihm doch sehr viel Zeit, die auf Kosten seines gewohnten Fitnesstrainings ging.
Er erreichte den Treppenabsatz, machte eine kurze Pause und stellte zufrieden fest, dass sein Atem und sein Herzschlag vollkommen normal waren. Die Sonne, die schräg durch die schmalen Fenster des Treppenhauses fiel, fühlte sich angenehm warm auf seinen Schultern an. Smith warf einen Blick auf seine Uhr. Der leitende Wissenschaftler von Harcourt Biosciences hatte ihm in fünf Minuten eine »echt coole Demonstration« ihrer jüngsten Fortschritte versprochen.
Hier oben war das betriebsame Lärmen aus dem Parterre — das Klingeln der Telefone, das Klappern der Computertastaturen und die Stimmen von Menschen, die sich unterhielten — kaum mehr zu hören; es war fast so still wie in einer Kathedrale. Das Teller Institut hatte seine Verwaltungsbüros, die Aufenthaltsräume für die Mitarbeiter und die umfangreiche wissenschaftliche Bibliothek im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht. Das Obergeschoss war ausschließlich den verschiedenen Forschungsteams zugewiesenen Laboratorien vorbehalten. Die Labors von Harcourt Biosciences lagen wie die ihrer Rivalen vom Teller Institut selbst und von der Nomura PharmaTech im Nordflügel.
Smith wandte sich nach rechts und ging einen breiten Korridor hinab, der sich über die ganze Länge des L-förmigen Gebäudes erstreckte. Die glänzenden erdbraunen Bodenkacheln harmonierten wohltuend mit den mattweißen Adobewänden. In gleichmäßigen Abständen waren nichos in der Wand, kleine gewölbte Nischen, in denen Porträts berühmter Wissenschaftler hingen — Fermi, Newton, Feynman, Drexler, Einstein und andere -, die bei einheimischen Künstlern in Auftrag gegeben worden waren. Zwischen den nichos standen hohe Keramikvasen mit leuchtend gelben Chamisas und blassroten wilden Astern. Wenn man die schiere Größe des Korridors ignoriert, dachte Smith, sieht es hier aus wie in einem gepflegten Privathaus in Santa Fe.
Er erreichte die verschlossene Tür zu den Harcourt-Labors und zog seine Ausweiskarte durch den Schlitz des Kartenlesers neben der Tür. Das Licht am oberen Rand sprang von rot auf grün, und das Schloss öffnete sich mit einem leisen Klicken. Seine Karte war eine der relativ wenigen, die für den Zugang zu sämtlichen Sperrbereichen kodiert waren. Den konkurrierenden Wissenschaftlern und Technikern der verschiedenen Teams war nicht gestattet, in den Labors der anderen herumzuschnüffeln. Wenn es jemand doch tat und dabei ertappt wurde, wurde er zwar nicht erschossen, doch er bekam unverzüglich ein Ticket ohne Rückflug ausgehändigt. Das Institut nahm seine Verpflichtung, geistiges Eigentum zu schützen, sehr ernst.
Smith trat durch die Tür und befand sich sogleich in einer vollkommen anderen Welt. Hier war kein Platz für den warmen Glanz von poliertem Holz und die rauen Adobemauern des vornehmen alten Santa Fe, hier herrschten glänzendes Metall und harte Legierungen des einundzwanzigsten Jahrhunderts vor. Die Wärme des natürlichen Sonnenlichts und die Eleganz indirekter Beleuchtung hatte dem stechenden Licht von fluoreszierenden Leuchtstoffröhren an den Decken Platz gemacht. Das Licht dieser Leuchten hatte einen sehr hohen ultravioletten Anteil, der ausreichte, Oberflächenbakterien abzutöten. Ein leiser Lufthauch zupfte an seinem Hemd und strich durch sein Haar. In den Nanotech-Labors wurde ein ständiger leichter Überdruck erzeugt, um das Risiko einer Kontamination der Raumluft durch Schmutzpartikel aus den öffentlichen Bereichen des Instituts so gering wie möglich zu halten. Hocheffiziente Partikelfilter — oder »ULPA«-Filter — sorgten für gereinigte Luft bei konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit.
Die Harcourt-Labors bestanden aus einer Reihe von hintereinander angeordneten »Reinräumen« mit zunehmendem Reinheitsgrad. Der äußere Bereich, in dem er sich befand, war eine Art Büro, das mit Rechnerarbeitsplätzen und Schreibtischen vollgepfercht war, auf denen sich Stapel von Nachschlagewerken und Verzeichnissen von Chemie- und Labormaterial und Computerausdrucken türmten. Vor den vom Boden bis zur Decke reichenden Aussichtsfenstern in der nach Osten gelegenen Wand, durch die man sonst einen spektakulären Blick auf die Sangre de Cristo Mountains hatte, waren die Jalousien herabgelassen.
Der nächste Raum in der Reihe aufeinander folgender Laboratorien war ein Kontroll- und Probenaufbereitungsbereich. Hier standen Labortische mit schwarzen Arbeitsflächen, Computerkonsolen, die klobigen Umrisse von zwei elektronischen Rastertunnelmikroskopen sowie einige andere Geräte, die zur Überwachung der Herstellung von Nanomaschinen und der Produktionsprozesse benötigt wurden.
Das Allerheiligste jedoch war der innere Kern: einzusehen nur durch hochdichte Observationsfenster in der hinteren Wand. Dies war ein Laborraum vollgepfercht mit spiegelblanken Tanks aus rostfreiem Stahl, mobilen Gleitschlitten, die mit Pumpen, Ventilen und Sensoren beladen waren, senkrecht montierten Rahmen für osmotische Filter und aufeinander gestapelten Lucite-Zylindern, welche verschiedene Reinigungsgels unterschiedlicher Stärke enthielten - alles durch sich ringelnde, durchsichtige Silikonschläuche miteinander verbunden.
Smith wusste, dass der innere Kern nur durch eine Reihe von Luftschleusen und Umkleideräumen betreten werden konnte. Jeder, der im Produktionsraum arbeitete, musste einen vollkommen sterilen Overall, sterile Handschuhe und Stiefel sowie einen vollständig geschlossenen Helm mit autonomer Luftversorgung tragen. Er grinste süffisant. Wenn die Aktivisten der Lazarus-Bewegung, die draußen vor dem Institut campierten, jemanden in diesem doch sehr gewöhnungsbedürftigen und an Außerirdische erinnernden Outfit zu Gesicht bekämen, würde das ihre schlimmsten Befürchtungen bestätigen: verrückte Wissenschaftler, die mit tödlichen Giften hantierten.
In Wirklichkeit war die Situation genau umgekehrt. In der Welt der Nanotechnologie waren die Menschen die Ursache von Gefahren und Verunreinigung. Eine herabfallende Hautschuppe, ein Haarfollikel, selbst die beim Sprechen mit dem Atem in die Luft abgegebenen Feuchtigkeitspartikel oder gar die Explosion eines Niesanfalls konnten auf der Nanoebene schwere Zerstörungen anrichten, weil dabei Öle, Säuren, alkalische Laugen und Enzyme in den Laborraum gelangten, die den Produktionsprozess kontaminieren und negativ beeinflussen konnten. Menschen waren außerdem eine unerschöpfliche Quelle von Bakterien: schnell wachsende Organismen, die die Produktionslösung verderben, Filter verstopfen und sogar die in der Entwicklung befindlichen Nanomaschinen angreifen würden.
Glücklicherweise konnten die meisten der im inneren Kern oder im Kontroll- und Probenaufbereitungsraum notwendigen Tätigkeiten von außerhalb ausgeführt werden. Robotermanipulatoren, computergesteuerte, motorisierte Geräteschlitten und andere technische Innovationen reduzierten die Notwendigkeit, dass Menschen die »Reinräume« betraten, um ein Beträchtliches. Das überaus hohe Niveau der Automatisierung seiner Laboratorien war eine der meistgefragten Innovationen des Teller Instituts, da es Wissenschaftlern und Technikern weit mehr Bewegungsfreiheit erlaubte als in anderen Einrichtungen.
Smith schlängelte sich durch das Gewirr von Schreibtischen im Vorraum und steuerte auf Dr. Philip Brinker zu, den leitenden Wissenschaftler der Harcourt Biosciences. Der blasse, große und spindeldürre Forscher saß mit dem Rücken zum Eingang und studierte auf einem Monitor das vom Rasterelektronenmikroskop übertragene Bild so konzentriert, dass er gar nicht bemerkte, wie Jon sich ihm so leise wie eine Katze näherte.
Brinkers Chefassistent, Dr. Ravi Parikh, war wachsamer. Der kleinere, dunkelhäutige Molekularbiologe sah auf. Er öffnete den Mund, um seinen Boss zu warnen, doch dann machte er ihn mit einem Grinsen wieder zu, als Smith ihm zuzwinkerte und den Finger an die Lippen legte.
Jon blieb zwei Schritte hinter den Forschern stehen und wartete.
»Verdammt, das sieht gut aus, Ravi«, sagte Brinker, den Blick noch immer auf den Monitor vor ihm gerichtet. »Mann, ich wette, unser Lieblingsspion aus dem Verteidigungsministerium wird sich vor uns verneigen, wenn er das sieht.«
Diesmal versuchte Smith gar nicht, sein Grinsen zu verbergen. Brinker nannte ihn ständig einen Spion. Das war der Standardscherz des Harcourt-Wissenschaftlers über Jons Rolle als Beobachter des Pentagon, aber Brinker hatte keine Ahnung, wie nahe er damit der Wahrheit kam.
Fakt war, dass Jon mehr als nur ein Armeeoffizier und Wissenschaftler war. Hin und wieder arbeitete er in geheimer Mission für Covert-One, eine als streng geheim eingestufte Nachrichtendiensteinheit, die allein dem Präsidenten unterstellt war. Covert-One operierte im Dunkeln, und zwar so sehr im Dunkeln, dass niemand im Kongress oder in der offiziellen Militär-und Nachrichtendienstbürokratie von seiner Existenz wusste. Gott sei Dank war Jons Arbeit hier am Institut rein wissenschaftlicher Natur.
Smith beugte sich vor und blickte über die Schulter des leitenden Wissenschaftlers von Harcourt Biosciences. »Also was genau soll mich dazu bringen, den Boden anzubeten, auf dem Sie gehen, Phil?«
Brinker fuhr erschreckt zusammen. »Jesus Christus!« Er wirbelte herum. »Wenn Sie das noch einmal mit mir machen, Colonel, falle ich tot um, das verspreche ich Ihnen! Wie würden Sie sich dann fühlen, Mann?«
»Es würde mir Leid tun, nehme ich an«, erwiderte Smith mit einem Lachen.
»Das hoffe ich!«, knurrte Brinker. Doch dann hellte sich seine Miene auf. »Aber da ich trotz Ihrer Bemühungen nicht tot bin, können Sie einen Blick drauf werfen, was Ravi und ich heute zusammengebaut haben. Weiden Sie Ihre Augen an dem
Die Originalausgabe
The Lazarus Vendetta
erschien 2004 bei St. Martin’s Griffin, New York
Vollständige Deutsche Erstausgabe 01/2007
Copyright © 2004 by Myn Pyn LLC. Copyright © 2007 dieser Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlagillustration: © Cover Artwork by Nick Castle Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München Satz: Christine Roithner Verlagsservice, Breitenaich
eISBN 978-3-641-09383-9
www.heyne.de
www.randomhouse.de
Leseprobe