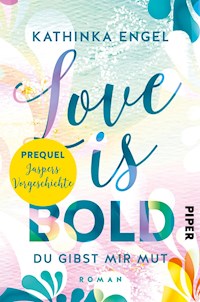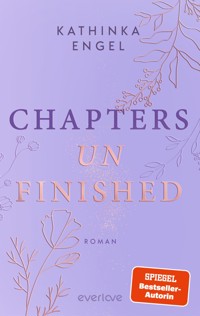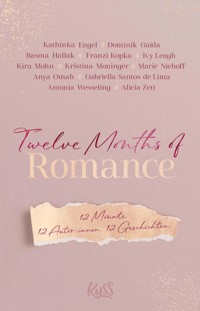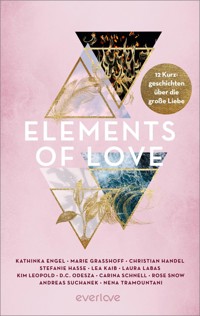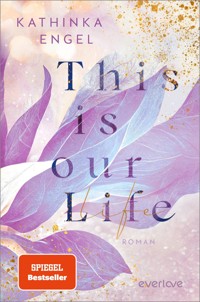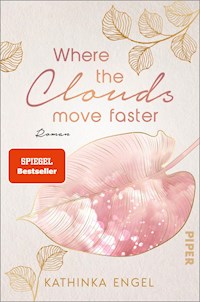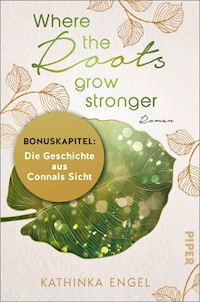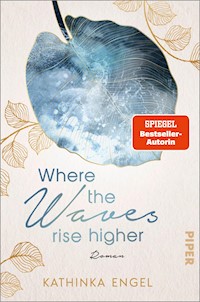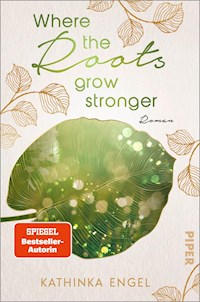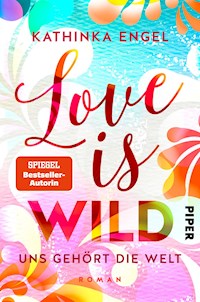9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Entertainment
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist es jemals zu spät für zweite Chancen?
London, 1974: Die 17-jährige Pippa St George, Tochter aus gutem Hause, trifft bei einem Punkkonzert Oz, den Sänger der Band. Oz steht für alles, was ihre Familie verachtet. Gegen alle Konventionen und gegen jede Logik verlieben sich die beiden ineinander, doch dann werden sie von der harten Realität eingeholt.
London, Gegenwart: Online-Redakteurin Gilly ist überglücklich, als sie eine erschwingliche Wohnung in einem viktorianischen Mietshaus findet. Doch das Haus soll verkauft und luxussaniert werden. Um das zu verhindern, tut Gilly sich mit ihrem Nachbarn, dem Dokumentarfilmer Owen, zusammen. Während ihrer Recherche stoßen die beiden auf eine Geschichte, die sie weit in die Vergangenheit führt ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungGegenwart12341974567Gegenwart89101112197413141516Gegenwart171819197420212223Gegenwart24252627282919743031Gegenwart323334197435363738Gegenwart3940411974424344Gegenwart45464748DanksagungÜber dieses Buch
London, 1974: Die siebzehnjährige Pippa St George, Tochter aus gutem Hause, wird von ihrer besten Freundin auf ein Konzert im dunklen, schmutzigen London geschleppt. Dort trifft sie auf Oz, den Sänger der Punkband, der für alles steht, was ihre Familie verachtet. Gegen alle Konventionen und gegen jede Logik verlieben sich die beiden ineinander, doch dann werden sie von der harten Realität eingeholt.
London, Gegenwart: Online-Redakteurin Gilly ist überglücklich, als sie eine erschwingliche Wohnung in einem viktorianischen Mietshaus in Camden findet. Umso größer der Schock: Das Haus soll verkauft und luxussaniert werden. Um dem Haus ein Denkmal zu setzen, tut Gilly sich mit ihren Nachbarn, und vor allem mit dem Dokumentarfilmer Owen, zusammen. Während ihrer Recherche kommen sich die beiden nicht nur näher, sie stoßen auch auf eine Geschichte, die sie mehr berührt als alle anderen …
Über die Autorin
Als leidenschaftliche Leserin studierte Kathinka Engel allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft und arbeitete im In- und Ausland für eine Literaturagentur, ein Literaturmagazin sowie als Übersetzerin und Lektorin für verschiedene Verlage. Sie lebt in Berlin, ist aber in London zu Hause. Unter @kathinka.engel teilt sie auf Instagram und Tiktok ihre Begeisterung für Bücher und das Schreiben.
KATHINKA ENGEL
Das Ende von gestern ist der Anfang von morgen
ROMAN
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch dieMichael Meller Literary Agency GmbH, München.
Copyright © 2024 by Kathinka Engel
Copyright © 2024 by Bastei Lübbe AG,
Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für das Text- undData-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Michelle Gyo, Limburg
Umschlaggestaltung: © SO YEAH DESIGN, Gabi Braununter Verwendung von Motiven von © plainpicture: Hayden Verry
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-5600-6
luebbe.de
lesejury.de
Für London.Seelenort, große Liebe und die Stadt,die mir gezeigt hat, wer ich bin, wer ich sein kannund sein darf (unapologetically).
Gegenwart
1
Wenn es eine Sache gibt, die man über mich wissen sollte, dann diese: Ich verliebe mich schnell und entliebe mich langsam. Das war schon immer so und entzieht sich sowohl meiner Kontrolle als auch meinem Verständnis. Ich hänge mein Herz in null Komma nichts an Menschen wie Dinge gleichermaßen, an Orte und Momente. Und da baumelt es dann – meistens über den Zeitpunkt hinaus, an dem es noch gut für mich ist.
Vor siebeneinhalb Minuten habe ich mich beispielsweise auf den ersten Blick und Hals über Kopf und mit Haut und Haar in eine Wohnung in der 19 Tolpuddle Street im Londoner Borough Camden verliebt. Und nicht nur in die Wohnung, sondern auch in das viktorianische Haus mit roter Ziegelfassade. In die weißen Fensterrahmen und ihre Verschnörkelungen, die kleinen Erker im Erdgeschoss und ersten Stock. In die Glyzinie über dem überdachten Eingangsbereich, in die rostrote Tür mit der messingfarbenen Nummer 19, deren Neun leicht schief hängt. In das quietschende Gartentor und den knorrigen Apfelbaum im Vorgarten. Und – und das vielleicht am allermeisten – in die geforderte Monatsmiete, die im Gegensatz zu allen anderen Löchern, die ich in den letzten Wochen besichtigt habe, nicht zwei Drittel meines Gehalts verschlingt.
»Ich melde mich bei Ihnen, Gillian«, sagt Andrew, der Makler, und schüttelt mir die Hand.
»Ich bin wirklich sehr, sehr interessiert«, erwidere ich und lächle ihn – wie ich hoffe – auf eine charmante Weise an. Dann schiebe ich ein weiteres »sehr« hinterher.
»Ist notiert.«
Als ich mich bereits ein paar Schritte entfernt habe, drehe ich mich noch einmal um. »Sehr!«, rufe ich erneut, nur für den Fall, dass er noch nicht restlos von meinem Interesse überzeugt ist.
Er reckt den Daumen in die Höhe, und in dem Moment, da ich meinen Blick wieder nach vorne richten will, rempelt mich ein Kerl an.
»Sorry«, nuschelt er, während ich überschwänglich: »Ups, sorry, keine Absicht«, sage. Er trägt eine Beanie-Mütze, aber mehr sehe ich nicht, weil er bereits mit großen Schritten an mir vorbeigeeilt ist.
Ich reibe mir meine Schulter. Das gibt einen blauen Fleck. Aber auf eine seltsame Weise habe ich auf einmal das Gefühl, dass genau dieser blaue Fleck ein gutes Omen sein könnte. Dass dieser blaue Fleck Glück bringt. Dieser blaue Fleck ist eine Botschaft an das Schicksal oder an was auch immer, dass Gillian Sallow jetzt für eine Weile genug Pech hatte und diese Wohnung verdient.
Als ich dann auch noch sehe, dass der Beanie-Typ das Gartentor der Nummer 19 aufschiebt, Andrew knapp zunickt und seinen Schlüssel zückt, bin ich mir sicher. Diesmal wird es klappen. Diesmal muss es klappen.
Auf dem Weg nach Hause verliebe ich mich in einen Song. Zackbumm. Herz drangehängt. Ich höre ihn in Dauerschleife. Auf dem Weg von der Tolpuddle Street zur Tube-Station Chalk Farm. In der Tube, während ich meinen Kopf einziehe, damit die brechend volle Feierabend-Northern-Line ihre Türen schließen kann. Er übertönt das laute Rattern des Zugs und unterstreicht zusammen mit meiner schmerzenden Schulter das Gefühl der Hoffnung, dass diese Wohnung vielleicht endlich die ist, die Luke und mich aus unserer emotionalen Zwickmühle befreit.
Ich höre den Song immer noch, als ich bei Sainsbury’s die Gänge nach einem genießbaren Fertiggericht durchkämme, das sich mit Lukes neuen Ernährungsgewohnheiten verträgt.
Sobald ich die Wohnung betrete, verbinde ich mein Handy mit Lukes Bluetooth-Box, um den Song auch im Badezimmer hören zu können. Unter der Dusche höre ich zwar nur die Hälfte, aber der Songtext hat sich in meinem Kopf verselbständigt, und inzwischen singe ich lautstark mit. Beim Abtrocknen, beim Trockenrubbeln meiner Haare.
Ich sehe mich nach meinem Bademantel um, kann ihn aber nirgends finden. Und dann fällt mir ein, dass ich ihn in einem Anfall von Aktionismus gewaschen habe und er im Wohnzimmer auf dem Wäscheständer hängt.
Also trete ich mit Handtuchturban auf dem Kopf in den Flur, just in dem Moment, als ein Schlüssel in der Wohnungstür herumgedreht und die Tür aufgeschoben wird. Luke ist hier. Luke hat früher Feierabend gemacht, ist jetzt hier und blickt mich an.
In Luke habe ich mich auch in null Komma nichts verliebt. Drittes Jahr im College, ein feuchtfröhlicher Clubabend, er stand an der Bar und sah umwerfend aus in seiner Lederjacke. Ich war auf diese euphorische Weise betrunken, die einem mit Anfang zwanzig vorgaukelt, die Welt sei eine große Wundertüte aus Möglichkeiten, die nur darauf warten, ergriffen zu werden. Man macht ein Auslandssemester in Spanien oder ein unterbezahltes Praktikum in New York. Oder man stolpert eben in eine siebenjährige Beziehung.
Und jetzt ist Luke hier, in seinem engen, verschwitzten Sportsdress, blickt mich an, und ich bin wie ein sehr nacktes Reh im Scheinwerferlicht. Erstarrt in unserem Flur. Oder besser gesagt, in seinem Flur. Denn Luke ist mein Ex. Und die Wohnung ist seine Wohnung.
»Hi«, sagt er außer Atem über die Musik hinweg. Seit wir nicht mehr zusammen sind, joggt er jeden Abend sechs Meilen von der Arbeit nach Hause. Und ich habe schnell festgestellt, dass es weniger lang dauert, sich von menschlichen Gerüchen zu entlieben als von dem Menschen selbst.
Ich will etwas erwidern, aber mein Mund klappt einfach nur auf und dann wieder zu. Obwohl Luke und ich sieben Jahre ein Bett und alles, was dazugehört, miteinander geteilt haben, kehrt die Scham zurück, wenn man Schluss macht. Vor allem, weil er sich in Form bringt – vermutlich, um sein Dating-Game erstligatauglich zu machen –, während ich mich nicht einmal mehr daran erinnern kann, wann ich zum letzten Mal meine Beine rasiert habe.
»Ich … äh … hi … ich …«, stottere ich und halte mir unbeholfen die Arme vor die Brust.
Luke wendet sich mit einem leisen Lachen ab – das Lachen, an dem früher mal mein Herz hing –, und auch mir entfährt ein Prusten, weil das alles so bescheuert ist. Nicht nur meine Nacktheit oder seine keuchenden Dehnübungen. Diese gesamte Situation, in die wir uns über Jahre manövriert haben, weil unsere Beziehung mit familiären und gesellschaftlichen Erwartungen (oder Konventionen) so überladen wurde, dass wir erst uns verloren und dann irgendwie den Absprung verpasst haben.
Mich von Luke zu entlieben dauerte lange. Es war ein schleichender Prozess. Als Erstes kamen die Zweifel. Genau benennen kann ich den Moment nicht, aber es muss nachts gewesen sein, denn diese Dinge passieren immer nachts, wenn man mit seinen Gedanken allein ist und nichts hört als das Rattern des eigenen Kopfs und das Schnarchen desjenigen Menschen, mit dem man viel zu betrunken und so jung zusammengekommen ist, dass vor jugendlicher Unsicherheit die Aussicht, irgendjemandes Freundin zu sein, erstrebenswerter schien, als allein zu bleiben.
Dann sprach ich die Zweifel eines Abends laut aus. Erst einmal nur vor meiner kreditwürdigsten Freundin Sameena, die ich seit der Grundschule kenne. Die, die ihre frühen Zwanziger tatsächlich für ein Auslandssemester und Praktika in den Metropolen der Welt genutzt hat.
Aber sobald man etwas laut ausspricht, ist es da, ist es real und verschwindet nicht mehr. Auch nicht, wenn man sieben Jahre lang ein Paar war, auch nicht, wenn man heiraten, eine Familie gründen und ein Haus in einem Vorort kaufen wollte – oder sollte (in der Erinnerung verschwimmt es). Auch nicht, wenn man auf »die große Drei« zugeht, wie mein Vater es nennt und dabei klingt, als wäre das der Anfang vom Ende.
Als ich mich schließlich überwand, mit Luke zu sprechen, reagierte er wider Erwarten weder schockiert noch verzweifelt. Im Gegenteil, er war regelrecht erleichtert und schlug sofort bereitwillig vor, getrennte Wege zu gehen, aber Freunde zu bleiben. Einen kurzen Moment war ich unschlüssig, ob ich vielleicht beleidigt sein sollte, schließlich war ich sieben Jahre lang eine ziemlich tolle feste Freundin gewesen. Doch dann fiel mir ein, dass Luke auf dem Papier auch ein ziemlich toller fester Freund gewesen war. An diesem Abend beendeten wir unsere Beziehung. Nur der Punkt mit den getrennten Wegen ist noch so eine Sache.
Vor zwei Monaten erzählten wir es immerhin unseren Familien, die mit Enttäuschung und Unverständnis (auf meiner Seite, denn jemand, der erfolgreich ein IT-Start-up für medizinische Datenbanken ins Leben gerufen hat, ist wohl der Inbegriff einer guten Partie) und den besten Wünschen und Verständnis (auf seiner Seite) reagierten.
Hinter dem Sofa in der Wohnküche, das seit der Trennung außerdem mein Bett ist, suche ich nun versteckt vor Lukes Blicken nach frischer Unterwäsche.
Luke hat sich zu Ende gedehnt und ext ein Pintglas mit Wasser, das wir vor Jahren aus unserem Local mitgenommen haben, als zwar schon Sperrstunde, aber das Glas noch halbvoll war. Damals, als alle Gläser noch halbvoll wirkten. Seine Haare kleben auf der verschwitzten Stirn. »Wie war denn die Wohnung?«, fragt er und schaltet energisch die Bluetooth-Box aus. In angezogenerem Zustand wäre ich ihm längst zuvorgekommen, schon um des fragilen Haussegens willen. Aber auch, weil der Song nicht Lukes Geschmack entspricht.
Der Moment, in dem Luke anfing zu joggen, war der Moment, in dem ich mich in die frustrierende Wohnungssuche stürzte. Dass der Londoner Mietmarkt ein Arschloch ist, war mir natürlich klar. Aber dass mein eigentlich okayes Redakteurinnengehalt so wenig wert ist, fühlt sich an guten Tagen ernüchternd an. An schlechten … Sagen wir, ich habe mehr als einmal in eines unserer Sofakissen geschrien – unter anderem auch deswegen, weil meine Schwester Heather mir nach jeder Absage die Vorteile des Londoner Speckgürtels aufzählt. Niedrigere Mietpreise (»Man könnte sogar etwas kaufen! Vielleicht gemeinsam mit Luke? Wollt ihr es nicht doch noch mal miteinander versuchen?«), Naherholung (»Rob und ich haben jetzt mit Nordic Walking angefangen.«), Nähe zur Familie (»Willst du nicht präsenter in Jacks und Rosies Leben sein?«), und überhaupt würde man gar nichts vermissen, wenn man erst einmal die Großstadt verlassen hat – im Gegenteil.
»Die Wohnung war toll«, sage ich. »Bezahlbar. Mitten in Camden in Laufweite zu Chalk Farm. Beinahe zu schön, um wahr zu sein.«
Luke seufzt erneut. »Wäre wirklich gut, wenn es endlich mal klappen würde.« Die Erschöpfung ist ihm anzuhören. Nicht die körperliche, sondern die emotionale. Er klingt, wie ich mich fühle. Dass die Fronten zwischen uns zwar geklärt sind, wir uns aber nach wie vor in diesem Schwebezustand befinden, in dem keiner von uns einen Schritt in irgendeine Richtung machen kann, zehrt an den Nerven.
»Glaub mir, Luke, ich schlafe nicht freiwillig auf unserem Sofa.«
»Auf meinem Sofa«, nuschelt er.
Und damit hat er natürlich recht. Genau genommen gehört alles in dieser Wohnung ihm – inklusive der Sofakissen, in die ich von Zeit zu Zeit brülle.
»Vielleicht musst du dich ein bisschen mehr reinhängen bei den Besichtigungen«, rät er jetzt auf diese Luke-Art, die früher hilfsbereit klang. Seit Neuestem kommt sie mir ab und zu ein bisschen herablassend vor, aber wahrscheinlich bin ich einfach überempfindlich. Schließlich erfordert das Zusammenleben mit dem Ex auf engstem Raum über Monate hinweg einiges an Kompromissbereitschaft – fast so viel wie sieben Jahre Beziehung. Außerdem bin ich Luke wirklich dankbar, dass er mich kein einziges Mal gedrängt hat, das Angebot meiner Eltern anzunehmen und in ihr Speckgürtel-Gästezimmer nach Surrey zu ziehen.
»Ich gebe wirklich mein Bestes«, sage ich und ziehe mir mithilfe absurdester Verrenkungen endlich ein T-Shirt über den Kopf.
»Und das glaube ich dir auch. Es ist nur … langsam frage ich mich, ob Heather vielleicht recht hat.«
»Heather? Wann hast du denn mit Heather geredet?« Ich wage es nun, mich aufzurichten, um in meine Jogginghose zu schlüpfen. Früher durfte sie gemeinsam mit Lukes Jogginghosen auf dem Sofa gammeln. Inzwischen geben Lukes Streberjogginghosen meinen das Gefühl, faul und ungesund und grundsätzlich unter ihren Möglichkeiten zu sein.
»Sie hat mich neulich angerufen, um zu fragen, wie es mir geht.« Er zuckt mit den Schultern.
»Warum das denn?« Meine Schwester hat mich seit der Trennung kein einziges Mal angerufen, um zu fragen, wie es mir geht. Wenn Heather anruft, will sie mir ein schlechtes Gewissen machen, weil ich als Tante nicht involviert genug in das Leben ihrer Kinder bin. Oder um mich zu bitten, ihr irgendein teures Duschgel aus der Stadt mitzubringen, weil man im Naherholungsgebiet Speckgürtel eben doch so manches vermisst.
»Und, na ja, ich glaube, vielleicht stimmt es. Vielleicht willst du einfach nicht erwachsen werden.«
»Wie bitte?« Warum beredet meine Schwester mit meinem Ex meine Bereitschaft zu irgendwas?
»Dass du dich nicht committen wolltest, dass du nicht in eine eigene Wohnung ziehen willst …«
Ich beiße mir auf die Zunge und denke an den Haussegen. Wir haben uns schließlich im Guten getrennt. Und zwar einvernehmlich, wenn auch in der Hoffnung, bald einen klaren Schlussstrich ziehen zu können. Dass die Situation, wie sie im Moment ist, uns beide an den Rand des Wahnsinns treibt, gibt ihm allerdings noch lange nicht das Recht, sich mit meiner Schwester zu verbünden, wenn er sich augenscheinlich genauso wenig committen wollte wie ich.
»Ich will sehr wohl in eine eigene Wohnung ziehen«, sage ich mit Nachdruck. »So sehr, dass ich mit dem Makler geflirtet habe, was das Zeug hält, damit ich bessere Karten habe als der Beratungstyp, der vor mir da war.«
Lukes Blick verfinstert sich. »Oh wow, Gilly. Das ist echt unter der Gürtellinie.«
»Hä?« Das sollte doch einfach nur ein Witz sein. Aber wahrscheinlich gehört auch das zu einer Trennung dazu. Man teilt sich nicht mehr das Bett, normalerweise auch nicht mehr die Wohnung, warum sollte man sich dann noch den Humor teilen?
»Mir jetzt auch noch deine Flirts reinzudrücken. Ich würde dir nie unter die Nase reiben, dass ich jemanden kennengelernt habe.«
»Ach, deswegen willst du mich los sein?« Diesmal wackle ich anzüglich mit den Augenbrauen, um zu unterstreichen, dass ich das natürlich nicht ernst meine. Denn wo sollte Luke jemanden kennenlernen? Beim Joggen entlang der Borough High Street, während er mit Pulks aus roten Doppeldeckerbussen um die Wette schnauft?
Er blickt zu Boden und schweigt.
Sagte ich eben, dass keiner von uns beiden einen Schritt in irgendeine Richtung machen kann? Nun, das gilt offenbar nur für mich. Und in diesem Moment fühle ich mich klein und erbärmlich, passend zu meinen Jogginghosen, und genau so, wie Heather mich sieht.
»Echt jetzt?« Die Erkenntnis sinkt langsam ein und mit ihr eine unangenehme Hitze, die sich in meinem gesamten Körper ausbreitet. Es ist natürlich sein gutes Recht, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass es derart schnell gehen würde. Und auf einmal sehe ich ein Bild vor meinem inneren Auge: Luke in seinem Sportsdress an einer roten Ampel. Eine Joggerin gesellt sich zu ihm. Blicke werden auf der Stelle laufend ausgetauscht, ein schüchternes Lächeln … Wäre diese Situation nicht maximal demütigend, würde ich vielleicht lachen.
»Es ist nichts Ernstes«, sagt er kleinlaut, aber das macht es auch nicht besser.
»Wenn das so ist, muss ich noch mal kurz ins Bad. Meine Beine rasieren.« Und noch während ich mich frage, in welcher Welt das bitte auch nur im Ansatz bedrohlich klingen soll, fängt irgendwo mein Handy an zu vibrieren.
»Dein Handy«, sagt Luke überflüssigerweise.
»Ach.« Ich will nicht genervt klingen, aber die letzten Minuten haben mal wieder deutlich gezeigt, dass es allerhöchste Zeit für eine eigene Wohnung wird. Hektisch schiebe ich meinen Kleiderberg auf dem Sofa beiseite, hebe die Kissen hoch, verteile vor lauter Hektik wichtige Steuerunterlagen über den gesamten Couchtisch, die ich in mühevoller Arbeit zusammengesucht habe.
»Dass du immer deine Sachen verlegen musst.« Luke stöhnt, aber die Tatsache, dass er mir beim Suchen hilft, schafft beinahe so etwas wie einen Moment der intimen Eintracht. »Was ist das überhaupt für ein Chaos?« Doch gleich darauf zieht er das Handy aus der Tasche meiner Jeans und reicht es mir.
»Ja?«, frage ich ins Telefon.
»Gillian?«, meldet sich eine Männerstimme. »Hier ist Andrew.«
Der Makler? Mein Herzschlag beschleunigt sich, und mit der Hand reibe ich mir über den blauen Fleck an meiner Schulter. Den blauen Glücksfleck, den der Typ mit der Beanie mir verpasst hat. Mein neuer Nachbar?
»Oh, hi, Andrew.« Ich versuche, meine Stimme einigermaßen im Griff zu haben. »Der Makler«, flüstere ich an Luke gewandt, und der überkreuzt an beiden Händen Zeige- und Mittelfinger.
»Ich rufe wegen 19 Tolpuddle Street an. Wenn ich mich richtig erinnere, hatten Sie sehr, sehr großes Interesse?«
»Ja! Sehr!«
»Wir hatten die Wohnung eigentlich bereits jemand anderem zugesichert«, sagt er.
»Oh«, mache ich, und Luke lässt enttäuscht die Schultern sinken.
»Aber … wie soll ich sagen«, fährt Andrew fort. »Es gab da eine kleine Komplikation.«
»Eine Komplikation?« Leise an Luke gewandt: »Es gab eine Komplikation.«
»Was denn für eine Komplikation?«, fragt Luke ebenfalls flüsternd.
»Keine große Sache. Nur …«
Aber es spielt keine Rolle. Wenn ich dadurch aus Lukes Apartment ausziehen kann, liebe ich jede Komplikation. »Egal, was es ist, ich nehme die Wohnung.« Schimmelflecken an der Wand? Mäusekolonien hinter dem Herd? Wilde Technopartys im Vorgarten? Es wird meine liebste Lieblingskomplikation.
Andrew lacht ein pseudo-verbindliches Makler-Lachen. »Alles klar, Gillian. Das freut mich zu hören. Wollen Sie vorbeikommen, um den Mietvertrag zu unterschreiben?«
»Sehr gern«, sage ich, und auf einmal wird mir vor Erleichterung ganz warm. Und innerlich werde ich ganz ruhig. Das hier ist ein Neuanfang. Mein Neuanfang. Ehe wir auflegen, überkommt mich dann doch noch die Neugierde. »Andrew?«, frage ich. »Was war denn nun die kleine Komplikation?«
»Es … ähm … geht um die Nachbarin. Mr Ecclestone, der Vermieter, vertraut auf ihre Meinung. Und obwohl das Gehalt und die Referenzen unseres Kandidaten einwandfrei waren, hat sie ihn vehement abgelehnt.«
Die Nachbarin hat den Beratungstypen im Anzug abgelehnt? Fast muss ich laut loslachen. Ich mache mir eine geistige Notiz, mich bei ihr zu bedanken. »Wenn das alles ist«, sage ich.
Luke tritt immer noch nervös von einem Bein aufs andere, versucht, in meinem Gesicht zu lesen. Und dann heben sich meine Mundwinkel zu einem vorsichtigen Lächeln, und seine tun es ebenso. Das Lächeln wird zu einem Grinsen, und als ich auflege, schlage ich mir die Hände vor den Mund und quietsche.
»Und?«, fragt Luke.
»Ich hab die Wohnung.«
»Echt jetzt?«
»Ich hab die Wohnung!«, wiederhole ich.
»Herzlichen Glückwunsch!« Luke klatscht gleichermaßen begeistert und erleichtert in die Hände.
»Ich hab die Wohnung!« Ich kann es gar nicht glauben. »Ich hab die Wohnung! Ich hab die Wohnung!«, kreische ich immer wieder und hüpfe dabei auf und ab, bis Mr Chakrabarti aus der Wohnung unter uns mit dem Besen gegen die Decke klopft.
»Du hast die Wohnung!«, ruft nun auch Luke, und in einem seltsam euphorischen Moment, der der Betrunkenheit Anfang zwanzig gar nicht mal so unähnlich ist, umarmen wir uns.
2
Dreieinhalb Wochen später sitzen wir ein letztes Mal nebeneinander im Auto, wie wir es jahrelang gemacht haben. Luke ist gefahren, ich habe navigiert. Aus den Boxen des kleinen Vauxhall, den ich so lange unser Auto genannt habe, schallt ein Song von unserer gemeinsamen Playlist. Luke hat sie »Gilly und Luke – Geschmacksüberschneidungen« genannt, weil unsere Musikgeschmäcker vermutlich das Einzige waren, was von Anfang an nicht so richtig kompatibel war.
Nach einem Streit, dem meine mangelnde Wertschätzung irgendeines Gitarrensolos von Eddie van Halen vorausging, schickte Luke mir den Link zu unserer gemeinsamen Playlist als Friedensangebot. Und auch wenn der Name nicht unbedingt Romantik und ewige Liebe schrie, fand ich die Geste dennoch niedlich. Ab diesem Moment befüllten wir »Gilly und Luke – Geschmacksüberschneidungen« mit den Songs, auf die wir uns beide einigen konnten. Classic Rock auf seiner Seite, fröhlicher Gitarrenpop auf meiner.
Dass die Playlist auch jetzt läuft, ist der Gewohnheit geschuldet und fühlt sich an, als würde man Reste aus dem Kühlschrank aufwärmen, die ihre beste Zeit bereits hinter sich haben. Eine Mischung aus schlechtem Gewissen, weil man etwas Gutes hat verkommen lassen, und dem Wunsch, das komplette Tupper-Gefäß direkt in den Müll zu werfen und nie wieder daran zurückzudenken. Da alle meine Tupper-Gefäße allerdings Leihgaben meiner Mutter sind, ist die Sache mit dem Nie-wieder-dran-Zurückdenken nicht so leicht. Und wenn man bedenkt, dass sie bei jedem Telefonat einen Grund für mich findet, es noch einmal mit Luke zu versuchen, ist die Analogie doppelt gelungen.
»Hier ist es also«, sagt Luke und beugt sich vor, um einen Blick auf mein neues Wohnhaus zu werfen. Seine Lederjacke – ein neueres Modell, das wenig mit dem zerschlissenen Teil aus unserer Anfangszeit zu tun hat – knarzt leise.
»19 Tolpuddle Street.« Ich nicke und fühle mich ein bisschen unwohl. Hier mit Luke auf engstem Raum in seinem Auto zu sitzen, sein Aftershave zu riechen, »Gilly und Luke – Geschmacksüberschneidungen« und dem Geräusch seiner Lederjacke zu lauschen … es ist gleichzeitig zu normal und zu intim. »Danke fürs Fahren.«
»Nichts zu danken.« Luke stellt den Motor ab, und die Musik verstummt. »Gilly …«
»Luke?«
»Ich wünsche dir alles Gute. Wirklich.« Er sieht mich an und lächelt.
»Aber du bist froh, dass du jetzt die Wohnung für dich hast«, sage ich grinsend.
»Haha, ja, schon ein bisschen.«
»Keine Sorge. Ich freue mich auch auf ein richtiges Bett.«
»Ich freue mich darauf, abends sofort ins Bad zu können. Ohne laute Musik.«
»Ich freue mich darauf, Indisch zu bestellen.« Luke kann den Geruch von Currys nicht leiden. »Mit lauter Musik.« Solange es die Nachbarin nicht stört.
»Aber wir waren schon auch glücklich, oder?«, fragt er und sieht mich mit einem Blick an, bei dem ich früher dahingeschmolzen wäre.
»Na klar. Super glücklich.« Und das waren wir, nur veränderte sich für uns beide das, was wir zum Glücklichsein brauchten. »Aber jetzt wirst du noch glücklicher mit deinem eigenen Badezimmer und der Fülle an Privatsphäre und der Privatsphäre im Badezimmer.«
»Und du mit deinem indischen Essen im Bett.«
»Während meine eigene Playlist läuft.« Und ich muss sagen, das klingt tatsächlich sehr verlockend, denn ich bin zwar nicht unbedingt begabt im Umgang mit großen Veränderungen – weil ich, um ehrlich zu sein, auch nicht sonderlich erfahren darin bin –, aber bei dieser hier habe ich ein richtig gutes Gefühl.
Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich nicht genau weiß, was von mir erwartet wird oder was als Nächstes passiert – weil es ganz allein meine Sache ist. Es ist aufregend, es ist ein Aufbruch, es ist ein unbeschriebenes Blatt Papier im Gegensatz zu einem Studienbeginn oder dem Antritt einer Junior-Stelle bei einem Online-Magazin. Bisher war jeder Schritt in meinem Leben immer die logische Fortsetzung des vorher Dagewesenen. Und das vorher Dagewesene war immer schon ein Kompromiss gewesen, weil es nie um mich gegangen war. Immer glaubte ich, den kleinsten gemeinsamen Nenner, die Geschmacksüberschneidung finden zu müssen, sodass mein Leben zu einer Aneinanderreihung aus Geschmacksüberschneidungen wurde. Die Trennung von Luke und mein Auszug sind so etwas wie ein Ausbruch aus diesem Trott. Ein Unterbrechen der Logik. Zeit für eine eigene Playlist.
Zusammen mit Sameena und Becca, die vor allem aufgrund ihres unnachahmlich trockenen Humors von meiner Kollegin beim Online-Magazin In London zu meiner und schnell auch zu Sameenas Freundin wurde, laden wir meine wenigen Habseligkeiten plus ein paar ausrangierte Küchenutensilien, die Luke mir netterweise überlassen hat, aus dem Auto. Dann fährt er. Was bleibt, ist ein beinahe absurder Anblick von vier Kisten, einem Rollkoffer und Lukes alter Sporttasche. Seltsam gewichtig und doch beinahe lächerlich, wenn man bedenkt, dass das all mein Hab und Gut ist. Ein dezenter Hinweis darauf, dass ich diese Sache mit dem Erwachsensein vielleicht tatsächlich nicht ganz so gut im Griff habe wie andere kurz vor »der großen Drei«, die von Kreditwürdigkeit oder den Superfood-Qualitäten von Chia-Samen reden. Wie Sameena beispielsweise. Oder einfach nur der Beweis dafür, dass ich die Geschmacksüberschneidung hinter mir lasse.
»Wie fühlst du dich?«, fragt Sameena und nimmt meine Hand. Das ist typisch für sie, und es ist einer der Gründe, warum ich in der ersten Klasse mein Herz an sie gehängt habe. Sie strahlt in jeder Situation eine enorme Ruhe aus. Ist da. Ist stark. Ist mutig. Ob sich nun ältere Schüler ohne Benehmen über ihre Augenbrauen lustig machten oder ich das Gefühl hatte, mich von meinem So-gut-wie-Verlobten trennen zu müssen. Oder eben in diesem Moment. Ein bisschen wie die große Schwester, die Heather nie für mich war, weil wir einfach zu verschieden sind.
»Als wäre etwas zu Ende. Und das ist es ja auch. Aber gleichzeitig fängt etwas an. Das ist …« Doch ich weiß noch nicht, was es ist. Gut, gesund, überfordernd, von allem etwas. Dann schließe ich kurz die Augen und atme tief die nasskalte Londoner Januarluft ein – es riecht nach Leben und Zuhause, nach Erde und Autoreifen. Ich bin bereit.
Einen Moment lang betrachten wir das Haus mit der roten Ziegelfassade, das ab heute Abend mein Zuhause ist.
»Hier wohnst du jetzt«, sagt Becca.
»Hier wohne ich jetzt«, erwidere ich, und auch wenn man mir die Euphorie vielleicht nicht anhört, bin ich innerlich Feuer und Flamme für alles, was ab jetzt auf mich wartet. Für meine eigene Wohnung. Fürs Singledasein. Fürs Mich-selbst-Kennenlernen.
»Das da ist meine Wohnung.« Mit dem Kinn, weil meine Hände zwei Kisten halten, zeige ich auf das Fenster oben rechts. Mein einigermaßen bezahlbares Fenster in einer absurd guten Lage ganz für mich allein. Es ist das Einzige, das in völliger Dunkelheit liegt, doch nicht mehr lange, Fenster, ich komme und erhelle dich!
Das Gartentor ist nur angelehnt und quietscht leise, als ich es aufschiebe.
»Geht nicht zu«, sagt Sameena, deren vehemente Versuche, das Tor zu schließen, offenbar wirkungslos bleiben.
»Krasse Farbe.« Becca betrachtet mit gerunzelter Stirn die Eingangstür. »Wie nennt man die? Rostlaube? Tartanbahn? Ochsenblut?«
Aber mir könnte Beccas Meinung zur Farbe meiner neuen Haustür nicht egaler sein, und ich drängle mich zwischen die beiden, um aufzuschließen.
Kurz darauf stapelt sich mein gesamtes Hab und Gut neben der Tür von Apartment 4. Mein Blick flackert kurz zur Tür gegenüber. Dahinter wohnt also die Dame mit der sehr genauen Vorstellung von passenden Nachbarn. Es könnte mich nervös machen, doch erstens war auch Mr Chakrabarti schrullig genug, und zweitens scheine ich schließlich ihren Ansprüchen genügt zu haben. Gleich morgen bringe ich ihr einen Blumenstrauß als Dankeschön vorbei.
»Der große Moment ist gekommen«, verkünde ich und untermale die Größe des Moments mit einem bedeutungsschwangeren Blick.
Ich habe die Wohnung nur einmal gesehen. Und um ehrlich zu sein, war ich mehr damit beschäftigt, Andrew zu bezirzen, als mir die Räumlichkeiten genau einzuprägen. Entsprechend nervös bin ich nun, als ich den Schlüssel im Schloss umdrehe.
»Tadaaaaa! Herzlich willkommen chez Gilly.« Mit einer etwas übertriebenen Geste bedeute ich den beiden einzutreten.
Wir schieben und wuchten Kisten und Koffer in den kleinen Eingangsbereich, dann schalte ich die Lichter im Schlafzimmer und in der Wohnküche ein.
»Okay«, sagt Becca, nachdem sie wie ein aufgescheuchtes Huhn von Raum zu Raum gesprungen ist und alles in Augenschein genommen hat. »Es ist …«
»… alt.« Sameena dreht die Wasserhähne im Badezimmer auf und zu. »Aber fließendes Wasser hast du.«
»Und das ist etwas Gutes«, sage ich mit erhobenem Zeigefinger.
»Und wenn du deine Schlafzimmerwand gerne beige streichen möchtest« – Beccas Kopf taucht in der Badezimmertür auf – »ist der Anfang schon gemacht.« Sie nimmt mich an der Hand, zieht mich in den Nebenraum und zeigt auf die obere linke Ecke über dem Dachfenster.
»Und hey, dein Vormieter hat dir Abendessen dagelassen.« Sameena holt eine Dose aus einem der Hängeschränke meiner Küchenzeile. »Baked Beans. Haltbar bis …« Sie sucht das Etikett ab. »… März zweitausendundzwölf.« Mit einem angewiderten Blick stellt sie die Dose zurück und schüttelt die Hände aus, als hätte sie in die Dose gefasst.
Becca fängt an zu lachen. »Also erstens, Sameena, ist das ein Mindesthaltbarkeitsdatum, kein Verfallsdatum. Und zweitens, hast du die Dose gerade wirklich wieder zurückgestellt?«
Sameena gluckst nun ebenfalls, und ich nehme mir einen Moment, um mein neues Zuhause auf mich wirken zu lassen. Natürlich, es ist kein schicker Neubau wie der, den ich mit Luke bewohnt habe. Keine Doppelfenster – aber wer hat schon diesen Luxus? –, der feuchte Fleck im Schlafzimmer sollte demnächst mal übermalt werden, und auf die Nachbarin bin ich ziemlich gespannt, aber im Großen und Ganzen …
»Also, ich liebe es.« Und das tue ich wirklich. Natürlich ist es nicht perfekt. Aber wer braucht schon perfekt, wenn er sein Herz an eine eigene Wohnung hängen kann? Ich jedenfalls mag die mintfarbenen Hängeschränke in der Küche, die Nachttischlampe mit den altrosa Fransen, die fast schon antiken Wasserhähne, auf denen in verschnörkelter Schrift »hot« und »cold« steht.
»Darf ich fragen, was dein Maßstab ist?«, will Becca mit einem frechen Grinsen wissen.
»Du darfst«, sage ich, lege den Kopf schief und tue so, als würde ich nachdenken. »Ich konnte sofort einziehen. Es ist in Zone 2.« Ich zähle einen offensichtlichen Pluspunkt nach dem anderen an meiner Hand ab. »Es ist nicht das Gästezimmer meiner Eltern. Mein Ex wohnt nicht hier. Und so nett es mit Luke war, aber man kann nach einer Trennung nicht noch ewig zusammenwohnen. Das ist auf Dauer nicht gesund für die emotionale Balance.«
»Wie gesund der gelbe Fleck ist, würde ich allerdings mal abchecken lassen«, sagt Sameena. Doch ihre Skepsis wird sie schon noch ablegen. Spätestens, wenn sie merkt, wie glücklich ich hier sein werde.
»Und das Wichtigste«, fahre ich fort, ohne auf den Einwurf einzugehen, »es ist meins.«
Die Kisten und Taschen sind schnell ausgepackt und eingeräumt. Einerseits, weil ich nicht sonderlich viel besitze, andererseits, weil Sameena vor einigen Monaten Marie Kondo gelesen und seither eine Leidenschaft fürs Zusammenrollen und Senkrechtstellen entwickelt hat. Ein paar Wochen lang gab es kaum ein anderes Thema, bis Becca Sameenas Belehrungen eines Abends mit den Worten unterbrach, ob ihr Glas Wein ihr eigentlich noch joy sparken würde. Denn sie, Becca, und ich, Gilly, hätten kein Interesse daran, unsere Leben auszusortieren (was, wie sich schon bald herausstellte, zumindest in meinem Fall falsch war), sie, Becca, würde aber Sameenas Wein liebend gern upcyceln, wenn sie nicht endlich die Klappe halte. Auf meine Frage, wie man Wein upcyceln würde, nahm sie Sameenas Glas und leerte den kompletten Inhalt kurzerhand in ihr eigenes. Seither heißt unsere gemeinsame WhatsApp-Gruppe »Upcycling«, und Sameena missioniert nicht mehr.
»Wenn du was brauchst, sag Bescheid!«, beschwört Sameena mich, als Becca und sie wenig später im Aufbruch begriffen sind. »Ich bin nur eine Fahrt mit drei U-Bahn-Linien und einem Bus entfernt.«
»Wenn du einen emotionalen Zusammenbruch planst, sag also frühzeitig Bescheid«, rät Becca.
»Im Moment habe ich es jedenfalls nicht vor«, erwidere ich lachend.
Auf einmal hört man von der gegenüberliegenden Wohnungstür ein Geräusch. Ein lautes, beinahe aggressives Klacken, als hätte jemand ein Hochsicherheitsschloss verriegelt. Ich zucke zusammen.
»Was war das denn?«, fragt Becca und sieht mich halb amüsiert, halb alarmiert an.
»Die Nachbarin ist wohl etwas …« Ich suche nach einem Wort, um Becca und vor allem Sameena in ihrer Skepsis nicht noch zu bestärken. »… eigen. Aber ich werde morgen einfach klingeln und mich vorstellen«, flüstere ich mit etwas mehr Coolness, als ich tatsächlich fühle. »Mein Dad hat gerade Heathers und Robs Haus mit einem neuen Sicherheitssystem ausgestattet. Vielleicht kann ich der Nummer 5 ein paar Tipps geben.«
Als Sameenas und Beccas Stimmen verklungen sind, blicke ich noch einmal zur Nachbarswohnung. Die Tür ist im gleichen Taubenblau gestrichen wie meine. Eine angelaufene Fünf hängt über dem Türspion, und auf einmal stelle ich mir vor, wie meine Nachbarin hindurchsieht, mich beobachtet, um herauszufinden, ob sie mich vielleicht auch besser hätte ablehnen sollen. Ob das Hochsicherheitsschloss angemessen ist. Kurz spiele ich mit dem Gedanken, die Hand zu heben. Aber ich will ihr nicht das Gefühl geben, dass ich mich beobachtet fühle – falls sie mich denn tatsächlich beobachtet. Ertappt zu werden wäre ein schlechter Start für ein offensichtlich ohnehin fragiles Nachbarschaftsverhältnis. Aber ich werde ihr schon zeigen, dass ich genau die Art von Mensch bin, die man gegenüber wissen möchte. Ich werde mit Zucker und Eiern aushelfen, Werkzeug verleihen, Blumen gießen, wenn die Nummer 5 im Urlaub ist. Gleich morgen besorge ich Zucker und Eier und den ein oder anderen Schraubenzieher – nur für den Fall. Vielleicht auch eine Pflanze, um zu beweisen, dass ich dieser Art von Verantwortung gewachsen bin. Denn ja, meine Kreditwürdigkeit ist nicht mit Sameenas zu vergleichen; mein Minimalismus ist eher meiner Unentschlossenheit, gepaart mit einer Portion Leichtsinn, geschuldet als einer Marie-Kondo-esken materiellen Katharsis. Aber zur Hölle, eine Grünpflanze für gute Nachbarschaft kriege ich hin.
3
Sollte man meinen. Aber das Basilikum auf dem Fensterbrett in der Küche lässt schon nach zwei Tagen die Blätter hängen. Ganz im Gegensatz zu dem prächtigen Blumenstrauß für meine Nachbarin. Der steht neben dem Basilikum in Ermangelung einer Vase in einer leeren Baked-Beans-Dose mit Mindesthaltbarkeitsdatum aus diesem Jahrzehnt und wartet darauf, dass die Nummer 5 auf mein Klopfen reagiert. Ein bisschen bekümmert zupfe ich an den hängenden grünen Blättern herum, als mein Handy klingelt.
»Hi, Mum«, sage ich und befühle mit dem Zeigefinger die Erde des Basilikums. Sie ist feucht.
»Gilly, du hast uns immer noch nicht deine neue Adresse gegeben.« Mums Ton mir gegenüber ist seit der Trennung von Luke eine Mischung aus kurz angebunden und latent vorwurfsvoll. Sie braucht Zeit, um sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass mein Weg nicht so geradlinig ist wie Heathers.
»19 Tolpuddle Street, Apartment 4, NW 5 …«
»Was ist das für eine Gegend?«, will sie wissen.
»Camden. Die Lage ist richtig gut und …«
»Camden?«, unterbricht sie mich. »Ist das nicht voller Punks?«
»Das sind doch nicht die Siebziger, Mum. Camden ist absolut sicher. Wenn überhaupt, ist es zu touristisch.«
»Ich mache mir ein bisschen Sorgen, Gillian. Meinst du nicht, Luke und dir hätte einfach ein bisschen Abstand gutgetan? Oder ein gemeinsames Projekt? Ein Haus vielleicht. Etwas Sicheres, weißt du? Rob sagt auch immer, Immobilien sind die beste Geldanlage. Etwas Handfestes.«
»Ich lege mein Gehalt ganz gern in Nahrung für mich an«, gebe ich zurück. »Etwas Bissfestes.« Es soll ein Witz sein, aber anders als Luke und ich haben Mum und ich noch nie denselben Humor geteilt. Ich unterdrücke ein Seufzen und zupfe aus Versehen eines der herabhängenden Basilikumblätter ab.
»Kosten zu halbieren bedeutet, Kosten zu sparen«, fährt sie fort, und beinahe bewundere ich sie für ihre Ausdauer.
Selbst jetzt, wo ich ausgezogen bin, ist sie überzeugt, mit den richtigen Argumenten würde ich erkennen, dass ich einen Fehler gemacht habe, der dazu führen wird, dass ich mein Leben lang allein und damit unweigerlich unglücklich bleibe – und sie folglich ebenso. Denn meine Mum hört das Ticken meiner biologischen Uhr lauter als irgendjemand sonst auf der Welt. Ich bin mir sicher, manchmal wacht sie von dem Geräusch nachts auf.
»Ich habe neulich erst in einer Zeitschrift gelesen, dass sich immer mehr junge Leute finanziell übernehmen. Die haben dann verschiedene Kreditkarten, um ihre Schulden zu decken …«
»Eine Wohnung zu mieten macht einen doch nicht gleich shoppingsüchtig, Mum.« Während ich versuche, sie zu beruhigen, hebe ich mit dem Finger eines der größeren Blätter von meinem Basilikum an, dann lasse ich es wieder traurig herabfallen.
»Das weiß ich, Schatz. Ich meine ja nur, du bist jetzt eben allein. Ich schicke dir den Artikel. Das ist das Schöne an den Printmedien. Dass man die Artikel einfach so verschicken kann.«
Kurz bin ich versucht, ihr zu erklären, dass man Online-Artikel, wie ich sie für In London schreibe, noch viel einfacher verschicken kann. Doch dann würde sie mich bitten, ihr meine neuesten Artikel zukommen zu lassen. Was eine Diskussion darüber zur Folge hätte, ob meine Generation mit ihren Sieben Geheimtipps für das erste Date und Die witzigsten Anmachsprüche der Londoner vielleicht emotional einfach hinterherhinkt und ob das der Grund für Lukes und meine Trennung ist. Stattdessen wechsle ich ganz unelegant das Thema.
»Sag mal, Mum, so ein Basilikum. Was braucht der?«
»Wie bitte?«
»Mein Basilikum lässt die Blätter hängen.«
»Es ist immer entweder zu viel oder zu wenig Licht oder zu viel oder zu wenig Wasser«, sagt sie.
»Na, wenn das mal nicht hilfreich ist«, erwidere ich. Aber dann fällt mir auf, dass genau das vermutlich auch fürs Leben gilt. Man muss wohl einfach selbst herausfinden, wie viel Licht und wie viel Wasser man braucht.
Und auf einmal scheint es immens wichtig, dass ich die Sache mit dem Basilikum hinkriege.
Aus diesem Grund bin ich am Montag für das Team-Meeting ein bisschen zu spät dran. Die Auswahl zweier weiterer Basilikumtöpfe hat bei Tesco deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen als die Entscheidung für das matschige Sandwich in meinem Meal Deal. Ganz Sameena-mäßig habe ich nämlich beschlossen, einen Plan zu erstellen, um den perfekten Standort mit der perfekten Wassermenge auszuloten. Mehr Testobjekte bedeuten schnellere Antworten. Und man will ja nicht irgendwelche Testobjekte. Man möchte die, die am frischesten aussehen – was sie wiederum dann doch mit den Sandwiches gemeinsam haben.
»Habe ich noch Zeit für einen Kaffee?«, frage ich Becca und stelle die Basilikumtöpfe auf meinen Schreibtisch.
Doch in diesem Moment kommt Elliott, unser Chef, aus seinem Einzelbüro, klatscht in die Hände und versucht sich an etwas Motivierendem, das klingt wie ein fragwürdiger Jagdruf.
»Gillian, kannst du das Basilikum woanders hinstellen?«, fragt Lindsay, die Marketingmanagerin, als sie an meinem Schreibtisch vorbeikommt. »Ich kann den Geruch nicht ab.«
»Riecht man das so?«, frage ich etwas verwirrt, doch sie flötet nur ein »Dankeeee« und verschwindet durch die Tür.
Kurz darauf sitzen wir alle um den Konferenztisch herum – in meinem Fall kaffeelos.
»Okay, Leute.« Elliott reibt sich ein bisschen übereifrig die Hände. Jedes Meeting eröffnet er auf diese Weise. Er ist nett, aber herausragend unflexibel für jemanden, der seit Jahren ein Online-Magazin leitet. Dann raschelt er mit seinen ausgedruckten Unterlagen. Elliott ist nämlich – wie ein Entenküken auf die Entenmutter – auf Papierstapel geprägt, was ebenfalls erstaunlich ist für jemanden, der ein Online-Magazin leitet. »Zahlen. Ja. Hm.« Er blickt in die Runde. »Sie sind wieder etwas runtergegangen. Die Click-Through-Rate ist im Keller.«
»Also macht nicht mal das Click-Baiting einen Unterschied?«, fragt Kim. »Wofür habe ich dann die letzten Monate diese albernen Artikelgeschrieben?«
Als ich vor ein paar Jahren bei In London anfing, war es noch ein ziemlich cooles Magazin. Hip, unterhaltsam, informativ. Wir wurden von Palatino Press, einer großen Verlagsgruppe, gekauft, alles lief hervorragend. Aber die Konkurrenz wurde mit jedem Jahr größer, uns brachen die Leserinnen und Leser weg, weswegen vor einem Jahr Lindsay zu uns stieß, die das Marketing ordentlich ankurbeln sollte. Elliott fand alles toll, was sie sagte, obwohl er eigentlich nur die Hälfte verstand, sodass sie sehr zu unser aller Überraschung mit ihrer ganz eigenen SEO-Strategie Einfluss auf die redaktionellen Inhalte nahm. Ab dem Moment mussten wir vor allem Nonsense-Aufzählungs-Artikel mit catchy Überschriften schreiben, für die sich offenbar wirklich niemand interessiert, obwohl Punkt 9 unseren Leserinnen und Lesern die Schuhe ausziehen würde.
»Vielleicht könnten wir es doch wieder mit guten Inhalten versuchen, statt in jedem Absatz zweimal irgendwelche Royals unterzubringen, nur, weil das gute Keywords sind«, schlage ich vor. Neben mir unterdrückt Becca ein Prusten. Sie ist die Königin des Royal-Spagats, wie wir es nennen, indem sie so etwas wie einen Sport daraus gemacht hat. »Wenn wir die Wahl zwischen keiner Zielgruppe und schlechten Artikeln und keiner Zielgruppe und guten Artikeln haben, ist doch Letzteres auf jeden Fall erstrebenswerter.« Ich sehe Lindsay direkt an, weil sie mein Basilikum beleidigt hat.
»Es sind aber gute Keywords, weil sie ein gutes Suchvolumen haben«, schnappt sie. »Und das wüsstest du, wenn du dir ansehen würdest, wie die Leute auf unsere Webseite kommen.«
»Aber dann gehen sie wieder, oder? Und kommen auch nicht mehr zurück.«
»Wenn’s nach dir ginge, würden wir nur noch Artikel über irgendwelche lesbischen Underground-Künstlerinnen mit zweihundertfünfzig Followern bringen, die keine Sau interessieren. Wir brauchen Inhalte, nach denen die Leute goooo-geln.« Sie zieht das letzte Wort in die Länge, damit auch der größte Trottel (ich) versteht, was sie meint.
»Ist das nicht dein Job?«, frage ich und will noch anbringen, dass Jinani Wazir, die feministische Poetry-Slammerin mit pakistanischen Wurzeln, die ich heute Abend gegen Lindsays ausdrücklichen Wunsch interviewen werde, auf Instagram zweihundertfünzigtausend Follower hat, da springt mir Becca zur Seite.
»Ich glaube, Gilly hat recht«, sagt sie, und Lindsay formt mit den Lippen ein tonloses »War ja klar«. »Natürlich müssen die Leute uns finden, aber dann brauchen sie eben auch spannende Inhalte.«
»Die zehn heißesten Londoner Bachelors und wo man sie findet?«, fragt Antoine. »Tut mir leid, aber da bin ich raus.«
»Das sind die Sachen, auf die die Leute klicken.« Lindsay hat die Arme vor der Brust verschränkt und schmollt.
»Sorry, Lindsay, aber nicht mal ich weiß, wie ich Harry und William da reinpressen soll, seit beide verheiratet sind.«
»Mädels«, sagt Elliott in einem hilflosen, halb sexistischen Versuch zu schlichten und kramt wieder in seinem Papierwust herum. Gerade will ich ihn darauf hinweisen, weil wir hier eine sehr offene Feedback-Kultur leben wollen, da spricht er weiter. »Es ist ohnehin egal, denn In London, so, wie wir es kennen, wird es nicht mehr lange geben.«
Auf einmal sind alle wie erstarrt. Was?
»W-was meinst du?«, fragt Antoine.
»Ich hatte heute Vormittag einen Call mit Benjamin Eklund.« Benjamin ist der CFO von Palatino Press. »Er sagt, sie glauben an uns, aber sie können die Beträge, die sie jeden Monat in uns reinpumpen, nicht mehr rechtfertigen.« Er zuckt mit den Schultern. In diesem Moment sieht man ihm an, dass er eben nicht der hippe Chef eines jungen Online-Magazins am Puls der Zeit ist, sondern ein erschöpfter Mittvierziger, dessen drittes, nicht ganz geplantes Kind zahnt.
»Also war’s das?«, fragt Kim.
»Wie lange haben wir noch?«, will Becca wissen.
»Landen wir jetzt alle auf der Straße?« Und wie soll ich dann meine Wohnung bezahlen, wo ich doch gerade erst mein Herz daran gehängt habe?
»Schlimmer«, sagt Elliott. »Eklund wird die nächsten Monate hier vor Ort ein neues Konzept ausrollen. Irgendetwas Ganzheitliches. Magazin meets Social Media.« Er verzieht das Gesicht, und ich bin mir nicht sicher, ob ihm Benjamin Eklunds Anwesenheit oder ganzheitliches Social Media unangenehmer ist. »Und er will Einzelgespräche mit jedem von euch führen.«
Auch wenn das zwar deutlich weniger schlimm ist als eine drohende Kündigung, verbringen wir alle den Nachmittag mehr oder weniger paralysiert. Alle, bis auf Lindsay. Denn als ich Feierabend mache, fällt mein Blick auf ihren Bildschirm. Zehn Tricks, wie du endlich deinen Traumjob bekommst, steht über dem Artikel, den sie gerade liest. Und die Webseite ist sicher nicht In London.
4
Eigentlich liebe ich die Londoner Tube. Ich mag das Gedränge mit all den Leuten, die zur Arbeit oder von der Arbeit nach Hause müssen. Diese unverhoffte Solidarität, weil man einen gemeinsamen Feind hat: Enge und die Notwendigkeit, von A nach B zu kommen, obwohl man lieber im Bett geblieben wäre. Das ohrenbetäubende Rattern, den Geruch von Coffee-to-go, zu viel Männerparfüm und U-Bahn-Gummi. Doch nachdem dieser Tag ohnehin schon bescheiden genug war und mein Basilikum aussieht, als wären die Lichtverhältnisse unter der Erde eine persönliche Beleidigung, bin ich froh, als wir endlich in Camden einfahren.
Selbst an Wochentagen herrscht auf der Camden High Street ein reges Treiben. Leute, die nichts suchen, finden hier alles. Vom Band-T-Shirt, das sich nach zweimaligem Waschen in ein einfaches, aus der Form geratenes schwarzes Fruit-of-the-Loom-T-Shirt verwandelt, über jede Menge Nippes, der so tut, als wäre er handgefertigt, bis hin zu qualitativ hochwertigen Nietengürteln. Die Touristen drängen sich in den verschlungenen Gassen des Camden Market, von überallher dröhnt Musik und vereint sich zu einer interessanten Mischung aus Punk-Rock mit jamaikanischen Rhythmen, lauten Hip-Hop-Beats und der Melodie von Oh when the Saints, die ein betrunkener Obdachloser in ein orange-weißes Verkehrshütchen grölt. Es riecht nach einem Mix aus Streetfood, billigem Leder und Alkohol, und sosehr ich die Lebendigkeit liebe, bin ich dennoch froh, als ich in eine Seitenstraße einbiege und dem Trubel entkommen kann. Hier befindet sich das Sputnik, der kleine Club, in dem Jinani Wazir heute auftreten und mir danach ein paar Fragen beantworten wird. Nach Elliotts Ankündigung war ich schon kurz davor, das Interview abzusagen, doch er wollte davon nichts wissen. Offenbar vertragen sich in seinen Augen Poetry-Slammerinnen und ganzheitliches Magazin meets Social Media.
Es dauert einen Moment, bis sich meine Augen an das schwache Funzellicht gewöhnt haben, das den kleinen schmucklosen Raum kaum erhellt. Schwarzer Boden, einfache Bar, eine Bühne, auf der ein einsames Mikrofon steht. Leise Indie-Musik spielt im Hintergrund. Sameena sitzt bereits an einem der runden Tische, ein Glas Wein vor sich.
Ich bedeute ihr, dass ich mir ebenfalls etwas zu trinken hole, und stelle kurz darauf ein eigenes Glas Wein sowie meine traurigen Basilikumtöpfe auf den Tisch.
»Die Testobjekte zwei und drei«, erkläre ich. »Man muss sich also keine Sorgen machen, dass ich vereinsame. Vergiss das Konzept der verrückten Katzenfrau. Der verrückten Basilikumfrau gehört die Zukunft.«
»Was wohl deine Nachbarn denken«, sagt Sameena und prostet mir zu. »Apropos, hast du sie schon kennengelernt? Die komische?«
»Ich habe ein paar Mal geklopft. Aber sie hat nicht aufgemacht.« Weswegen ich den inzwischen welken Blumenstrauß langsam mal entsorgen könnte. »Gestern hätte ich schwören können, dass hinter der Tür ein Geräusch zu hören war, aber sie hat nicht reagiert.«
Schon bald ist der Laden proppenvoll. Die Gespräche um uns herum werden lauter. Alle Tische sind besetzt, und an der Bar drängen sich die Gäste. Jinani hatte mir extra empfohlen, früh da zu sein, weil die Poetry Slams im Sputnik richtig beliebt sind.
Als ein junger Typ mit Baseball-Cap auf die Bühne springt, verstummen die Gespräche.
»Schön, dass ihr da seid«, sagt er. »Ich mache heute den Anfang.« Und dann beginnt er, ein Rap-artiges Gedicht über das Aufwachsen in einem Social-Housing-Estate vorzutragen, bei dem die Worte so schnell und so hart klingen wie ein Maschinengewehr. »Wenn wir von dort sind, sind wir arm, sind wir wertlos, sind wir ohne Zukunft, aber was ist dann das, was vor uns liegt?«, endet er und schiebt noch hinterher: »Ich bin Amir, folgt mir auf Instagram unter Amir_poetry.«
Er verbeugt sich, lüftet die Baseball-Cap und verschwindet gleich darauf im Gedränge.
Als Nächstes singt ein junges Mädchen, das kaum älter sein kann als sechzehn, zwei selbstgeschriebene Folksongs und begleitet sich dazu auf der Gitarre. Die Stimmung ist gut. Auf eine befreiende Weise unbürokratisch. Niemand kündigt die Leute an, niemand gibt eine Reihenfolge vor. Die Künstlerinnen und Künstler klatschen sich ab, machen sich gegenseitig Komplimente. Es ist familiär, aber gleichzeitig wild, und einen kurzen Moment lang denke ich daran, dass ich mit Luke nie an einem solchen Ort war. Pubquizzes in unserem Local und Freitagsdrinks, um das Wochenende einzuläuten, waren das höchste der Gefühle. Ich weiß nicht einmal, ob es an ihm lag oder einfach an der Tatsache, dass wir zusammen langweilig geworden waren.
»Hi«, sagt in diesem Moment eine heisere Frauenstimme. Alle Blicke wenden sich wieder der Bühne zu, und dort steht eine überraschend kleine, mädchenhafte Frau und stellt das Mikrofon auf ihre Höhe ein. »Ich bin Jinani Wazir, und das habe ich zu sagen.« Sie schließt kurz die Augen, atmet ein. Dann sieht sie mit wachen Augen ins Publikum. »Du kannst nicht beides sein, sagen sie. Nicht zu uns und zu denen gehören.« Sie spricht über die Schwierigkeit, zwischen zwei Kulturen zu stehen, davon, wie sie zu beiden gehören will und am Ende zu keiner gehört. Sie spricht vom Anpassen und Rebellieren und fragt, wie man lernen soll, wer man ist, wenn: »Alles. Immer. Falsch. Ist. Sei nicht zu englisch, du bist nicht englisch genug. Sei nicht so weiblich, aber weiblicher als das.« Sie macht eine abwertende Geste. »Dein Ehrgeiz ist abschreckend, aber steh auf eigenen Beinen. Sei Mutter, nicht mütterlich, sei Powerfrau ohne Power, sei du selbst, nur bitte nicht so.«
Als sie geendet hat, ist es für einen Augenblick komplett still, dann bricht der Applaus los, und Jinani, die während ihres Gedichts ganz konzentriert war, um jedes Wort perfekt zu platzieren, entspannt sich sichtlich und lächelt.
Das Sputnik leert sich nach Jinanis Auftritt relativ schnell, und als ich sehe, wie sie sich an der Bar ein Glas Wasser holt, gehe ich auf sie zu und stelle mich vor. Wir setzen uns an einen kleinen Tisch bei der Bühne, wo sie mir erlaubt, das Gespräch aufzuzeichnen.
»Welche Rolle spielt die Stadt in deiner Kunst?«, frage ich.
»Die Stadt ist meine Kunst«, sagt Jinani. »Alles, was ich bin, bin ich durch die Stadt. Sie hat mir die Sprache geschenkt, in der ich mich ausdrücke, und das Selbstbewusstsein, sie zu benutzen.« Sie erzählt von den Möglichkeiten, die London ihr bietet, aber auch von den Hindernissen.
»Wenn du von Hindernissen sprichst«, hake ich ein. »Was meinst du da? Welche Steine legt dir London in den Weg? Was brauchst du von deiner Stadt?«
»Bezahlbaren Raum«, sagt sie und lacht. »Das klingt so banal. Aber Kunst kann nur existieren, wenn es dafür Räume gibt. Und das gilt nicht nur für die Kunst. Es gilt fürs Leben. Das beginnt beim Wohnraum, aber dort endet es nicht. Eine Stadt muss den Leuten Platz geben. Nimm das Sputnik beispielsweise. Es gibt ständig Gerüchte darüber, dass es hier raus muss. Dass das Gebäude saniert werden soll, damit dann die zwanzigste Burgerkette in Camden einen Laden aufmachen kann. Oder die fünfzigste seelenlose Cocktailbar mit indirektem Beleuchtungskonzept und Lounge-Sound. Die Gentrifizierung erstickt die Kreativität. Woher soll die Inspiration kommen, wenn alles gleich aussieht? Wo sollen wir wohnen, wenn die Wohnungen alle als reine Investitionsobjekte leer stehen?«
Ich nicke, obwohl ich sofort Lindsays Stimme im Ohr habe, die mir sagt, dass Gentrifizierung kein gutes Keyword ist. Aber das ist mir egal. Denn Gentrifizierung ist ein Problem. Was es bedeutet, keinen bezahlbaren Wohnraum zu finden, habe ich selbst lange genug am eigenen Leib gespürt. Und deswegen müssen wir Stimmen wie Jinani Wazir bei In London – oder was auch immer daraus wird – Raum geben.
Als ich in die Tolpuddle Street einbiege, sehe ich, wie jemand das Gartentor der Nummer 19 aufschiebt. Im Licht der Straßenlaterne kann ich es nicht genau erkennen, aber weder ist es Vincent, ein Jurastudent aus der WG im Erdgeschoss, der schon ein paar Mal auf eine jungenhafte, aber nicht uncharmante Weise an den Briefkästen mit mir geflirtet hat, noch Mr oder Mrs Fisher, die im ersten Stock wohnen. Also entweder trägt O. Barnes aus der Nummer 3 (dessen Post ab und zu fälschlicherweise in meinem Briefkasten landet – gemeinsam mit Zeitschriftenartikeln über späte Schwangerschaften und Depressionen bei alleinstehenden jungen Erwachsenen, die meine Mutter mir schickt) wehende Kleider oder … es ist meine Nachbarin.
Ich beschleunige meine Schritte. Das ist meine Chance, mich endlich vorzustellen und mich bei ihr zu bedanken. Als ich die Haustür aufschließe, höre ich tatsächlich noch Schritte auf der Treppe. Immer zwei Stufen auf einmal nehmend, eile ich ihr nach, fast bin ich oben angekommen, da fällt ihre Tür ins Schloss.
Etwas außer Atem wage ich dennoch kurz entschlossen einen Versuch. Obwohl man von drinnen Geräusche hört, passiert auf mein Klopfen hin eine gefühlte Ewigkeit nichts. Ich klopfe erneut. Und endlich, endlich wird die Tür einen Spalt aufgezogen.
»Hi«, sage ich mit meinem strahlendsten Lächeln, das die Unsicherheit – ach, was sage ich, die blanke Panik – überspielen soll. »Guten Abend, ich bin Gilly. Gillian. Sallow. Wir kennen uns noch nicht …«
»Ist mir nicht entgangen.« Ihre Stimme klingt überraschend tief und wie erwartet unfreundlich.
»Ich bin vor einem Monat eingezogen. Freut mich sehr, Sie endlich kennenzulernen, Miss …«
Sie schweigt.
»Miss …«, wiederhole ich.
Immer noch sagt sie nichts.
»Miss …?«
»… Dewbre«, sagt sie schließlich knapp. Aber immerhin weiß ich jetzt ihren Namen. Das ist doch schon mal ein Fortschritt.
Sie öffnet die Tür etwas weiter, und ich erkenne eine ältere Dame. Eine ältere Dame mit knallrot gefärbten Haaren und getönter Brille. Sie trägt ein weites buntgemustertes Kleid und darunter grell-pinke Leggins.
Sie muss meinen leicht überraschten Gesichtsausdruck bemerken, denn sie fragt: »Ist was?«
»Nein, nein, ich …«, beeile ich mich zu sagen, aber ich weiß nicht einmal, wie der Satz weitergehen soll. Miss Dewbre ist definitiv nicht das, was ich hinter der Tür der Nummer 5 erwartet hatte.
Sie macht ein Geräusch, das ein Schnauben sein könnte, aber durch die halb geöffnete Tür ist es schwer einzuordnen. »Dann geh mir nicht auf die Nerven und hör um Himmels willen auf, dauernd an meine Tür zu klopfen.«
»Ich … wollte mich nur vorstellen«, sage ich zögerlich. Denn noch bin ich nicht bereit aufzugeben. Gute Nachbarschaft. Eier, Zucker. Basilikum! Auf einmal ist mir sehr bewusst, dass ich die beiden Basilikumtöpfe in der Hand halte. »Und mich dafür bedanken, dass Sie den eigentlichen Kandidaten für meine Wohnung abgelehnt haben, aber mich nicht. Das war wirklich sehr nett von Ihnen und … hier.« In Ermangelung eines Blumenstraußes halte ich ihr in einer Art Übersprunghandlung eine der traurig aussehenden Pflanzen hin.
»Wenn du nicht aufhörst, ständig zu klopfen, könnte es sein, dass ich meine Entscheidung vielleicht noch bereue.«
»Oh, okay …«
»Und deine sterbenden Pflanzen kannst du behalten.«
Sie schiebt die Tür langsam zu, und ich schaffe es gerade noch zu sagen: »Wenn Sie mal etwas brauchen, fragen Sie gern.« Auch wenn ich wohl schon mal nicht mit einem grünen Daumen punkten konnte.
Im nächsten Moment erklingt das laute Klacken ihres Sicherheitsschlosses. Und das ist definitiv weder für das nachbarschaftliche Verhältnis noch fürs Google-Ranking ein gutes Keyword.
1974
5
Philippa Genevieve St George, genannt Pippa, war sich der Geschichte ihrer Familie und der damit einhergehenden Verantwortung für das Land deutlich bewusst. Sie war stolz auf ihren Vater Algernon St George und auf seine politischen Ideen für die Wirtschaft des Landes, die er als Mitglied des House of Lords im Parlament verfocht.
Auch auf ihre Mutter Cordelia, die sie und ihren Bruder liebevoll und mit dem richtigen Maß an Strenge erzogen hatte, hielt Pippa große Stücke. Sie hatte sie nicht an ein Kindermädchen abgeschoben, wie beispielsweise die Mutter ihrer besten Freundin Henrietta, die allerdings auch mit Migräne zu kämpfen hatte, und da Pippa sich mit Migräne nicht auskannte, wollte sie nicht urteilen.
Besonders stolz war Pippa auf ihren Bruder Digby, der nun schon im zweiten Jahr in Oxford Politik- und Wirtschaftswissenschaften studierte. Sie konnte es nicht erwarten, am Ende des Schuljahres endlich selbst ihren Abschluss zu machen und ihm an die Universität zu folgen. Freilich würde sie nicht an das prestigeträchtige Magdalen College gehen können, da dort keine Studentinnen zugelassen waren. Ebenso wenig würde sie Teil des House of Lords werden, aber Politik interessierte sie ohnehin nicht besonders. Lieber wollte sie eine Familie gründen und Charity-Events besuchen wie ihre Mutter. Denn deren Leben erschien ihr deutlich entspannter als das ihres Vaters, der sich ständig über die Gewerkschaften aufregte, über die faule Arbeiterschicht, die immer nur die Hand aufhielt, ohne ihrem Land etwas zurückzugeben. Lamentieren, ja, das konnten sie. Aber etwas an ihrer Situation zu ändern – dazu hatten sie nicht den Mumm. Sie behaupteten, benachteiligt zu sein, ohne je Anstalten zu machen, ihr Glück selbst in die Hand zu nehmen. Das brachte ihren Vater und Digby regelmäßig auf die Palme. Manchmal fiel es Pippa schwer zu glauben, dass ihre Welt nur eine halbe Autostunde – oder eine Dreiviertelstunde mit dem Zug – von den grauen, schmutzigen Problembezirken Londons entfernt war, wo genau solche Menschen herumlungerten.
Obwohl es Pippa an nichts mangelte, hatte sie sich in den letzten Wochen gelangweilt. Digby war nach Neujahr nach Oxford zurückgekehrt und hatte sie im grauen Januar dieses noch jungen Jahres – 1974, es kam ihr immer noch unwirklich vor – wieder allein gelassen. Ihr Vater war noch beschäftigter als sonst, denn im Februar standen Neuwahlen an, und für die Konservativen sah es nicht gut aus. Zu allem Überfluss hatte ihre beste Freundin Henrietta vor Weihnachten wegen schlechter schulischer Leistungen Hausarrest bekommen, der nur über die Feiertage ausgesetzt worden war. Und so hatte es abgesehen von der Schule und dem Sechsuhrdinner mit ihrer Mutter keinerlei Ablenkung gegeben.